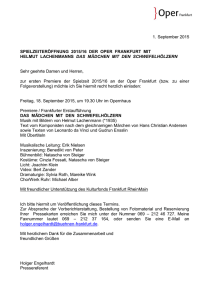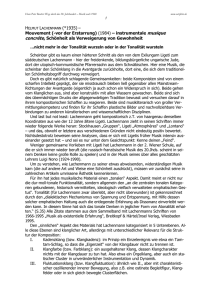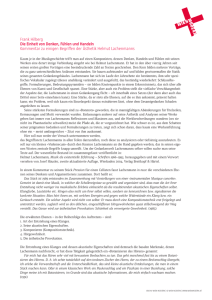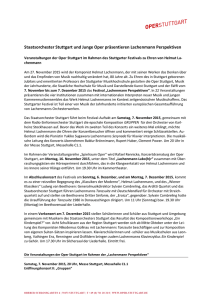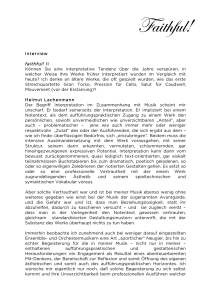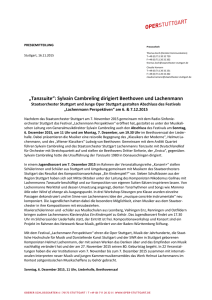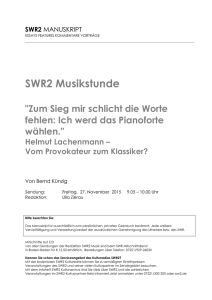Befreite Wahrnehmung - Ensemble unitedberlin
Werbung
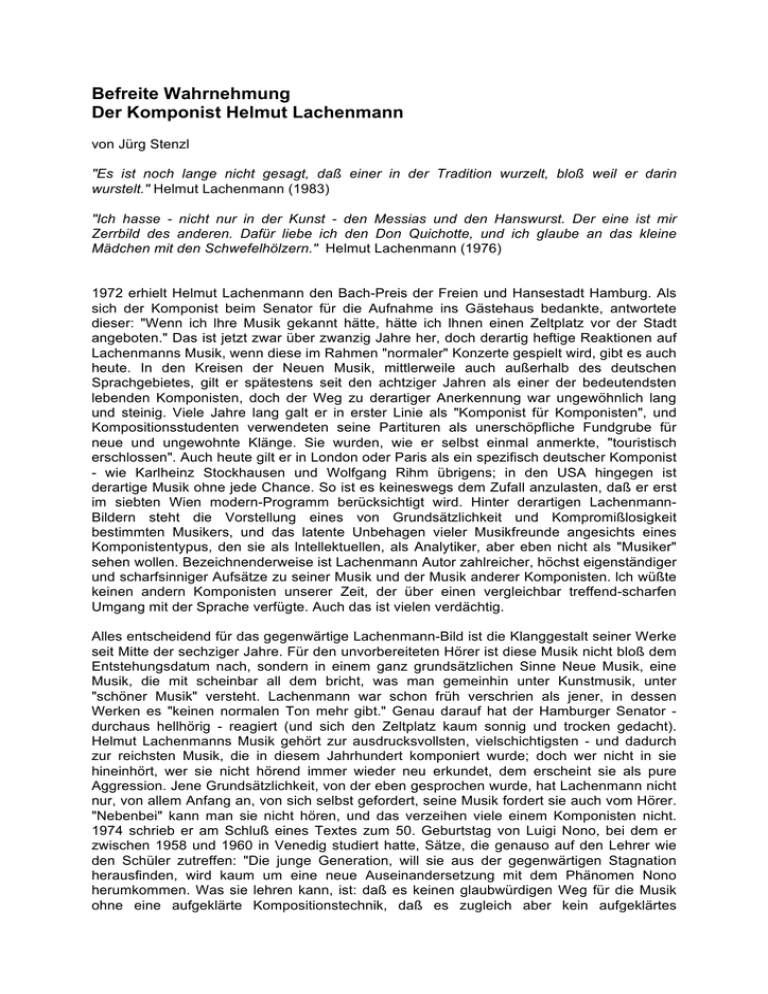
Befreite Wahrnehmung Der Komponist Helmut Lachenmann von Jürg Stenzl "Es ist noch lange nicht gesagt, daß einer in der Tradition wurzelt, bloß weil er darin wurstelt." Helmut Lachenmann (1983) "Ich hasse - nicht nur in der Kunst - den Messias und den Hanswurst. Der eine ist mir Zerrbild des anderen. Dafür liebe ich den Don Quichotte, und ich glaube an das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern." Helmut Lachenmann (1976) 1972 erhielt Helmut Lachenmann den Bach-Preis der Freien und Hansestadt Hamburg. Als sich der Komponist beim Senator für die Aufnahme ins Gästehaus bedankte, antwortete dieser: "Wenn ich lhre Musik gekannt hätte, hätte ich lhnen einen Zeltplatz vor der Stadt angeboten." Das ist jetzt zwar über zwanzig Jahre her, doch derartig heftige Reaktionen auf Lachenmanns Musik, wenn diese im Rahmen "normaler" Konzerte gespielt wird, gibt es auch heute. In den Kreisen der Neuen Musik, mittlerweile auch außerhalb des deutschen Sprachgebietes, gilt er spätestens seit den achtziger Jahren als einer der bedeutendsten lebenden Komponisten, doch der Weg zu derartiger Anerkennung war ungewöhnlich lang und steinig. Viele Jahre lang galt er in erster Linie als "Komponist für Komponisten", und Kompositionsstudenten verwendeten seine Partituren als unerschöpfliche Fundgrube für neue und ungewohnte Klänge. Sie wurden, wie er selbst einmal anmerkte, "touristisch erschlossen". Auch heute gilt er in London oder Paris als ein spezifisch deutscher Komponist - wie Karlheinz Stockhausen und Wolfgang Rihm übrigens; in den USA hingegen ist derartige Musik ohne jede Chance. So ist es keineswegs dem Zufall anzulasten, daß er erst im siebten Wien modern-Programm berücksichtigt wird. Hinter derartigen LachenmannBildern steht die Vorstellung eines von Grundsätzlichkeit und Kompromißlosigkeit bestimmten Musikers, und das latente Unbehagen vieler Musikfreunde angesichts eines Komponistentypus, den sie als lntellektuellen, als Analytiker, aber eben nicht als "Musiker" sehen wollen. Bezeichnenderweise ist Lachenmann Autor zahlreicher, höchst eigenständiger und scharfsinniger Aufsätze zu seiner Musik und der Musik anderer Komponisten. lch wüßte keinen andern Komponisten unserer Zeit, der über einen vergleichbar treffend-scharfen Umgang mit der Sprache verfügte. Auch das ist vielen verdächtig. Alles entscheidend für das gegenwärtige Lachenmann-Bild ist die Klanggestalt seiner Werke seit Mitte der sechziger Jahre. Für den unvorbereiteten Hörer ist diese Musik nicht bloß dem Entstehungsdatum nach, sondern in einem ganz grundsätzlichen Sinne Neue Musik, eine Musik, die mit scheinbar all dem bricht, was man gemeinhin unter Kunstmusik, unter "schöner Musik" versteht. Lachenmann war schon früh verschrien als jener, in dessen Werken es "keinen normalen Ton mehr gibt." Genau darauf hat der Hamburger Senator durchaus hellhörig - reagiert (und sich den Zeltplatz kaum sonnig und trocken gedacht). Helmut Lachenmanns Musik gehört zur ausdrucksvollsten, vielschichtigsten - und dadurch zur reichsten Musik, die in diesem Jahrhundert komponiert wurde; doch wer nicht in sie hineinhört, wer sie nicht hörend immer wieder neu erkundet, dem erscheint sie als pure Aggression. Jene Grundsätzlichkeit, von der eben gesprochen wurde, hat Lachenmann nicht nur, von allem Anfang an, von sich selbst gefordert, seine Musik fordert sie auch vom Hörer. "Nebenbei" kann man sie nicht hören, und das verzeihen viele einem Komponisten nicht. 1974 schrieb er am Schluß eines Textes zum 50. Geburtstag von Luigi Nono, bei dem er zwischen 1958 und 1960 in Venedig studiert hatte, Sätze, die genauso auf den Lehrer wie den Schüler zutreffen: "Die junge Generation, will sie aus der gegenwärtigen Stagnation herausfinden, wird kaum um eine neue Auseinandersetzung mit dem Phänomen Nono herumkommen. Was sie lehren kann, ist: daß es keinen glaubwürdigen Weg für die Musik ohne eine aufgeklärte Kompositionstechnik, daß es zugleich aber kein aufgeklärtes Komponieren geben kann, ohne die Verankerung in einer verantwortungsvollen Gesinnung, die übers bloße Musikmachen hinausreicht, und daß es nicht geht ohne den Willen und die Bereitschaft, für solche Gesinnung mit seiner ganzen Existenz einzustehen." Wer derartige musikalische und ethische Forderungen erhebt, kann auf keine schnellen und leichten Wege zum Ruhm rechnen. Am 27. November 1935 wurde Helmut Lachenmann in einer Stuttgarter Pfarrersfamilie geboren, früh genug, um die ersten Schuljahre bewußt als Jahre des Krieges und des totalen Zusammenbruchs zu erfahren. Zu Hause viele Geschwister, viele Anregungen, viel Musik, bald KIavierstunden, Chorgesang und bereits Komponieren. Als er nach dem Abitur in Stuttgart sein Musikstudium in der Stuttgarter Musikhochschule bei Jürgen Uhde (Kiavier) und Johann Nepomuk David (Theorie und Kontrapunkt) begann, waren die deutschen Wunderkinder mit Wiederaufbau und blühendem Wirtschaftswunder vollauf beschäftigt; für Blicke zurück in die jüngere Vergangenheit blieb da kaum Zeit. Es ist kein Zufall, daß Lachenmann Jahre später zu jenem Komponisten wurde, der am intensivsten nach im stillen mitgeschleiften, nur halbbewußten und verdrängten Traditionen fragte. Bereits während des Studiums, das er 1958 abschloß, besuchte er (seit 1957) die Darmstädter Ferienkurse, lernte Scherchen, Stockhausen, Pousseur, Maderna, Adorno und vor allem Luigi Nono kennen. ln Stuttgart war er bei David mit den traditionellen Mitteln gründlich vertraut geworden - und hat das nie bereut. Man müsse erkennen lernen, wie Komponisten sich in ihrer Zeit gegenüber einem vorhandenen Stil verhalten, wie sie ihn durchdacht und sich selbst dann darin emanzipiert und verwirklicht hätten, äußerte er 1970 in einem Gespräch, und fuhr bezeichnenderweise fort: Der Komponist "muß ihre [d. h. dieser alten Komponisten] Art, Freiheit zu praktizieren, und deren Niveau erkennen und beurteilen lernen, um daraus Maßstäbe und Verantwortung bei sich selbst abzuleiten." In Darmstadt aber "war ich vor allem fasziniert von der Konsequenz, mit welcher dort im engeren Kreis musikalisches Denken revolutioniert und neue adäquate Kompositionstechniken erarbeitet und diskutiert wurden", fasziniert von der Bereitschaft, die sich notwendigerweise beim Publikum ergebenden Konflikte mit festem Willen auszutragen "ohne von der Provokation bürgerlicher Tabus durch irgendwelche Tricks abzulenken". Aus der Zeit des Unterrichts bei David stammen die ersten aufgeführten und ein auch publiziertes Werk, die erweitert tonalen Fünf Variationen über ein Thema von Franz Schubert für Klavier von 1956. Das nächste veröffentlichte (aber erst 1979 aufgeführte) Werk, Souvenir für 41 lnstrumente, entstand dann bereits 1959 während der Lehrzeit bei Nono in Venedig und läßt sich als Auseinandersetzung mit Nonos Diario polacco von 1958 / 59 hören. - Wieso aber wählte er ausgerechnet Nono als Lehrer, einen Komponisten, der nicht nur wenig, sondern, wie sich bald herausstellte, auch höchst unkonventionell unterrichtete? Lachenmann hat nach Nonos Tod beschrieben, was es für ihn bedeutet hatte, "von Nono berührt" gewesen zu sein. Auch hier zeichnet er, wie im älteren Geburtstagstext, ein Programm, das dann während Jahrzehnten für ihn selbst Gültigkeit hatte - und auch heute noch hat: "Leben und Arbeiten in der Nähe von Nono, so spürte ich, bedeutete mehr als den Sprung über den Zaun auf neue Spielwiesen. Es bedeutete Selbstbefragung und Neuorientierung in reinerer Luft. lm Dialog mit Nono seinen Weg suchen, das hieß in vielfachem Sinne: ausgesetzt sein - ausgesetzt in einen ungewohnten, schwindelerregenden Freiraum, von wo aus alles, was als Kodex traditioneller Tugenden noch anknüpfbaren Anspruch und so auch künftig relative Geborgenheit des Komponierens und ästhetischen Denkens hätte bedeuten können, weit hinten am Horizont verschwand; ausgesetzt zudem der riesigen Leere und zugleich beklemmend empfundenen Enge der Ratlosigkeit eines scheinbar entwurzelten, in Wahrheit auf seine tieferen Wurzeln verwiesenen Ichs; ausgesetzt zugleich aIl den Fragen nach der Möglichkeit und der Verantwortung des Komponierens in einer ZiviIisation, vor deren lähmenden Widersprüchen den Kopf arglos in den Sand einer fragwürdigen Oase, genannt Neue Musik, zu stecken, schlicht das Risiko eigener Entmündigung in Kauf nimmt; ausgesetzt aber auch und täglich konfrontiert mit der Klarheit eines entschlossen, seinen Visionen folgenden und für sie lebenden Geistes, wie Nono ihn verkörperte. Studium bei Nono, das mußte heißen: im Blick auf neu entdeckte Wirklichkeiten ein für allemal und zeitIebens sich ständiger innerer Verunsicherung ausgesetzt wissen, so wie er es selbst bis zum letzten Augenblick war, und es schloß die Bereitschaft ein, sich nach seinem Vorbild zeitlebens Konflikten und Krisen, äußeren und inneren, auszusetzen." Die Komponisten, denen Lachenmann in Darmstadt von 1957 an begegnete, waren nur elf (Nono), zehn (Boulez), sieben (Stockhausen) und sechs (Pousseur) Jahre älter als er selbst. Doch der entscheidende Traditionsbruch war bereits sechs Jahre früher - vor allem durch Pierre Boulez - vollzogen worden. Jetzt stellte sich nicht minder radikal die Frage nach den Konsequenzen aus dem, was Boulez und seine Darmstädter Freunde als monde sériel, als "serielle Welt" entworfen und realisiert hatten. 1957 lagen die epochemachenden Werke vor: Structures I (1952) und der Marteau sans maître (1952 / 54) von Boulez, Kontra-Punkte (1953), die Klavierstücke I - VIII (1952 - 55) und die Gruppen für drei Orchester (1955 / 57) von Stockhausen und Luigi Nonos Il canto sospeso (1955 / 56). Lachenmann war SchüIer Nonos - aber er ging nicht Nonos Weg, genauer: Er stellte sich Nonos Anspruch, teilte dessen grundsätzliche Zielsetzungen, aber er entwickelte bald Lösungen, die sich von jenen Nonos wesentlich unterschieden. Zunächst einmal wurde Lachenmann zum Instrumentalkomponisten. Consolation I und II (1967 und 1968) für solistischen Chor, temA (1968) für Flöte, (instrumental behandelte) Stimme und Cello und " ... zwei Gefühle ... " (1992) für zwei Sprecher und Ensemble sind die einzigen Werke, die Stimmen verwenden; doch in keinem dieser Werke verwendet er die Stimme in herkömmlicher Weise, und auch nicht in der Art seines Lehrers Nono. - In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre wurde die "Eigenart der Klänge" für Lachenmann genauso bedeutungsvoll wie deren Strukturierung in der seriellen Musik. Die Aufgabe bestand darin, den "abstrakten Strukturalismus der fünfziger und empirisches Klangdenken der sechziger Jahre" zu integrieren. Mit temA, Air für großes Orchester mit Schlagzeugsolo (1968 / 69) und Pression (1969) für Cello entstand eine Gruppe von Werken, denen ein unverwechselbarer Klang eignet und die aus einer Situation hinausführen, welche Lachenmann als beklemmend beschrieben hat. Sie sind von einer eigenständigen ästhetischen Reflexion getragen, die auf Nonos Fragen und Werke neue Antworten gibt. Die serielle Musik hatte die Töne nach Tonhöhe, Dauer, Dynamik, Artikulation und Klangfarbe reihentechnisch strukturiert und solcherart den musikalischen Satz radikal neu begriffen. Für Lachenmann war erst durch den Darmstädter Serialismus - und nicht schon durch die "freie Atonalität" und die Zwölftontechnik der Wiener Schule - die Tonalität überwunden. In Werken wie jenen Schönbergs sah er vielmehr ein tonal geprägtes Musikdenken am Werk, das sich eines nichttonalen Materials bediente. Genauso wichtig wie die serielle Strukturierung des Tonsatzes als atonalen Klangraum wurde für ihn der KIang selbst, die "Unterscheidung zwischen Klang als Zustand einerseits und Klang als Prozeß andrerseits" (wie er es 1970 in seinem grundlegenden Aufsatz "Klangtypen der neuen Musik" erstmals darstellte). Er unterschied verschiedene Formen des "Kadenzklangs" (den "Impulsklang", ein Ausschwingvorgang, und die "Einschwingklänge" und die "Ausschwingklänge"). Diesen Klangprozessen stellt er die Zuständlichkeit der "Farbklänge" gegenüber. Diese werden durch ausgeweitete innere periodische Veränderungen zu "Fluktuationsklängen". Wenn sich nun das figürliche lnnenleben der "Fluktuationskläinge" nicht periodisch wiederholt, sondern dauernd ändert, entsteht ein "Texturklang". Man ersieht aus dieser Beschreibung und Ordnung von Klangtypen, daß der junge Komponist sozusagen als Klangrealist die Werke der jüngsten Avantgarde untersuchte. Den entscheidenden Schritt vollzog er aber mit der Beschreibung des "Strukturklangs": "Auch im 'Strukturklang'" - so stellte er fest - "erfahren wir eine Menge unterschiedlicher Details [wie im "Texturklang"], EinzelkIänge, die keineswegs identisch sind mit dem Gesamtcharakter des Klangs, vielmehr im Hinblick auf ihn zusammenwirken. Dieser Gesamtcharakter seinerseits ist aber nun nicht wieder eine primitive Pauschalqualität, sondern etwas virtuell neues, durch dessen Originalität jene Details erst als dessen Funktionen sich rechtfertigen." So könne man die gesamte Structure Ia für zwei Klaviere von Pierre Boulez als einen "Strukturklang" verstehen und hören. Später hat Lachenmann auch Weberns Orchesterstücke op. 10, Nr. 4 und Werke jüngerer und älterer Komponisten als "Strukturklänge" zu erfassen vermocht. Mit dem Begriff "Strukturklang" aber beschrieb Lachenmann nicht bloß einen besonders entwickelten Klangtypus, wie er sich in Werken seit den fünfziger Jahren finden läßt, er beschrieb gleichzeitig auch eine dieser Musik adäquate Hörweise. Er wandte sich in einer Zeit dem konkreten Hören zu, als kaum jemand ernsthaft fragte, wie denn die neue Musik eines Boulez, Stockhausen oder Cage zu hören sei, wenn herkömmliche Hörweisen offensichtlich versagen. (Das wurde dieser "Unmusik" der Darmstädter ja auch heftigst vorgeworfen.) Das Hören einer Musik, die mit herkömmlicher Thematik, Form und Harmonik radikal gebrochen hat, die überhaupt die Sprachähnlichkeit von Musik weitgehend getilgt hatte, konnte Lachenmann nun als ein sich in der Zeit vollziehendes hörendes Abtasten des "Strukturklangs" beschreiben. "Letztlich" - so Lachenmann im erwähnten Aufsatz - "ist der 'Strukturklang' der einzige Klangtyp, in welchem sich wahrhaft neue Klangvorstellungen verwirklichen lassen; bei ihm verschmelzen Klangund Formvorstellung in eines. Form wird so erfahren als ein einziger 'überdimensionaler' Klang, dessen Zusammensetzung wir beim Hören von Teilklang zu Teilklang abtasten, um uns auf diese Weise Rechenschaft zu geben von einer unsere bloß simultane Erfahrung übersteigenden Klangvorstellung." Die Musik, seine Musik, wurde als "Klangform" und "Formklang" erdacht und komponiert. "Wahrhaft neue Klangvorstellungen verwirklichen": Genau das tat Lachenmann in seinen Kompositionen in einer auf viele Hörer schockierend wirkenden Weise. Komponieren bedeutete für ihn nun, neue Zusammenhänge zwischen Klängen und Formideen zu entwickeln. Das veränderte sowohl die ldee der Form (die man deshalb, neutraler, als Struktur bezeichnete) wie jene des Klanges von Grund auf. Dabei verwendete er fast ausschließlich "ungewohnte" Klänge, Klänge mit hohem Geräuschanteil, Klänge, die von ihrer Erzeugung - dem Streichen oder dem Blasen beispielsweise - nicht zu trennen sind, weil sie als Resultat einer Arbeit erkennbar sind: Pression für Cello wie Dal Niente für Klarinette, Gran Torso für Streichquartett und Air für Orchester weisen bereits in den Titeln auf die "Klangthematik" der Werke hin. Der Cellist Hans-Peter Jahn hat in Pression nicht weniger als 35 verschiedene Spielweisen sowohl auf den Saiten wie dem Corpus des lnstruments zusammengestellt und festgehalten, daß Lachenmann "das Instrument in seiner ursprünglichsten, ungekünsteltsten Art: als Resonanzkörper seines elemenaren Klangpotentials" verwende. Dazu bedurfte es auch der Entwicklung einer adäquaten Notation, die jedes Detail der genau vorgeschriebenen und ausgehörten Spielweisen festhält. Ein derartig neues, ungewohntes und deshalb unverbrauchtes Material hatte - wie bereits gesagt - für einen Komponisten, der von der Interdepenzen von Klang und Struktur, der Idee des Strukturklangs ausging, weitreichende Folgen für die Form. "Was der Komponist zu ermöglichen hat, sind neue Formen des Hörens: Situationen 'befreiter Wahrnehmung' durch die Neubeleuchtung und Umformung des Vertrauten", so umschrieb er 1990 seine Aufgabe. Seine Musik seit den späten sechziger Jahren hat er mit musique concrète instrumentale beschrieben. Als musique concrète bezeichnete man die frühe, von Pierre Schaeffer entwickelte Form der französischen Tonbandmusik, die von "konkreten" Klängen und (Alltags-)Geräuschen ausging, diese veränderte und in weitgehend konventionellen Formen collagierte. Lachenmann hingegen ging von der Konkretheit des lnstrumentes und des Instrumentalspieles, von den "mechanischen und energetischen Bedinungen bei der Klangerzeugung" aus. Diese "energetischen Bedingungen", der Akt der Klanghervorbringung waren für ihn Teil des Materials selbst und keine zu verbergende Spieltechnik. ln gewohnten, vertrauten Klängen, im "seelenvoll schönen Ton" aber sah er, in Weiterführung von Adornos Begriff des "musikalischen Materials", das Wirken eines Musikverständnisses und einer Kulturindustrie, welche durch reaktionäres und kommerzielles Denken und Handeln bestimmt sind. Den Schein der Oberfläche zu kultivieren heißt auch, die in der Geschichte liegende Sprengkraft zensurieren, heißt in letzter Konsequenz Angst vor einem Expressiven, das nicht durch Konvention und Gewohnheit "gesichert" - und dadurch harmlos gemacht - worden ist. "Schönheit sei" - so formulierte er 1985 - "Verweigerung von Gewohnheit" - doch ein bloßes Erfinden neuer und ungewohnter Klänge und deren katalogartiges Herunterbuchstabieren in Werken wird der mit dem "Strukturklang" aufgestellten Forderung nach Einheit von Klang und Form nicht gerecht, sondern befriedigt nur die Lust auf Klang-Anekdotisches. Die überragende Bedeutung von Lachenmanns Komponieren für das letzte Drittel dieses Jahrhunderts liegt darin begründet, daß er - dem "seriellen Denken" und dessen aufs Grundsätzliche zielenden Ansatz durchaus treu und sie weiterführend - musikalische Formen entwickelte, die von den Eigenarten dieses Materials ausgingen. Entscheidend war dabei seine Befragung dieser Klänge im Hinblick auf ihre Expressivität. Daß er gleichzeitig die klanglichen Möglichkeiten fast aller lnstrumente wie nur wenige andere Komponisten erweitert hat, zählt zu den Voraussetzungen und nicht bereits zu den Resultaten. Resultate sind erst jene Werke, in denen der Komponist sich mit diesen neuen Klangmöglichkeiten auseinandersetzt und der "befreiten Wahrnehmung" des Hörers zugänglich macht. Das Hören derartiger Werke definierte er "als Konzentation des Geistes, Erfahrung des Eindringens in die Welt, welche zugleich Selbsterfahrung ist". Angesichts eines Musikbetriebs, in welchem die Werke selbst durch sich konkurrenzierende Interpretationen auf Tonträgern immer mehr verdrängt werden, fordert Lachenmann unablässig das Primat des Hörens, des entdeckenden Hörens zurück. Dann aber - so Hans-Peter Jahn zum ersten Streichquartett Gran Torso - konzentriere "die organisierte Vielfalt der Klangereignisse die Aufmerksamkeit auf die Momente der Stille und des Stillstandes, so, als steigere sich in ihnen noch einmal die Komplexität des Klingenden." Das läßt sich durchaus verallgemeinern, und jeder Hörer, der sich auf Lachenmanns meist sehr leise Musik eingelassen hat, machte diese Feststellung: Nicht bloß die Hörperspektive auf ein bestimmtes Werk verändert sich im Hören, erst recht im mehrmaligen Hören, das Hören selbst entwickelt und entfaltet sich; dem Hörer wächst ein Sensorium für das Ineinanderwirken von Klang und Zeit, und damit für die Klangform zu, das auch das Hören anderer - sowohl älterer wie jüngerer - Musik verändert. Eine derartige Hörerfahrung löst ein, was Lachenmann einmal gesprächsweise den Sinn von Kunst genannt hat, nämlich "den Menschen an sich zu erinnern, an Kräfte in ihm, die ungenutzt sind, während er verschlissen wird", oder (in Form einer kreativ sinnerfüllten Provokation): Kunst hat einen "geistigen Widerstand dort zu mobilisieren, wo wir im Genuß kultureller Dienstleistungen unsere wahren und falschen Sehnsüchte provisorisch befriedigen, d. h. betrügen". Lachenmanns Rettung des Hörens ist eine Rettung des Geistigen in der Kunst: "Aufgaben an seine Wahrnehmungsfähigkeit stellen, Aufgaben, die befreiend wirken in dem Maße, wie sie beunruhigend wirken und umgekehrt." Die Geschlossenheit von Lachenmanns Œuvre ließ zunächst die Frage nach Entwicklungen und Veränderungen innerhalb dieses Schaffens im Verlaufe eines Vierteljahrhunderts kaum aufkommen. In den als musique concrète instrumentale konzipierten Werken waren Elemente herkömmlicher Musik ausgeschlossen; Lachenmanns Werke erschienen vielmehr in den durch sie sozusagen leer gelassenen Räumen - und ausschließlich dort - angesiedelt. So herausfordernd andersartig diese Werke, welche Vertrautes so konsequent ausschlossen, auch erscheinen mochten, Lachenmanns Klangwelt erschien in sich - bei aller neuen Expressivität der unverbrauchten Klänge - homogen, als eigene Klangwelt, dadurch aber auch von jedem Gestern rigoros getrennt. Insofern glichen die Werke der späten sechziger und der frühen siebziger Jahre, mit denen Lachenmann Aufsehen erregte und sich langsam durchsetzte, im Grundsätzlichen der musique pure von Pierre Boulez, selbst wenn sie ein fundamental andersartiges Klangmaterial verwendeten. (Boulez vermeidet bis heute die sogenannt "denaturierten" Klänge.) Wie dessen musique pure waren sie auch dann durch und durch instrumentale Musik, wenn sie - wie wir sahen, selten genug - eine Singstimme (und damit Texte) verwendeten. - Von der französischen musique concrète, auf die doch Lachenmanns vielzitierter Ausdruck musique concrète instrumentale anspielte, unterschied sich seine Musik - von der Klangform einmal abgesehen - radikal durch die Vermeidung aller Verweise auf Außer- (genauer: Über-)musikalisches. Darin unterschied sich Lachenmann ja auch grundsätzlich von Luigi Nono: Nono stand in einer spezifisch italienischen Tradition einer Nachkriegsavantgarde (Neorealismo), innerhalb derer Kunstwerke sich gezielt auf die Gegenwart (und deren unmittelbare Vorgeschichte) bezogen - das genaue Gegenteil einer musique pure. Doch mit dem auf Mozart bezogenen Klarinettenkonzert Accanto (1975 / 76), mit der Tanzsuite mit Deutschlandlied (1979 / 80), dem Kinderspiel (1980) für Klavier und in seinem "Erfolgsstück" Mouvement (- vor der Erstarrung) (1982 / 84) tauchte überraschenderweise eine Art von musique concrète in der seinen auf: Allusionen etwa, sogar Zitate "alter Musik" offensichtliche oder, wesentlich häufiger, verborgene. Ihnen entsprach dann in den Werken seit dem Klavierkonzert Ausklang (1984) auch ein anderes, aber durchaus vergleichbares Durchbrechen von "Berührungsängsten": lm Allegro Sostenuto (1986 / 88) etwa, dem zweiten "Erfolgsstück" nach Mouvement, gibt es sogar einen A-Dur-Akkord, dazu vermehrt "normale Klänge", im Klavierkonzert sogar "Spielfiguren", gar Kadenzen, und in beiden eine Art hintergründig verschmitzte souveräne Heiterkeit (die dann wiederum im II. Streichquartett Reigen seliger Geister von 1989 völlig zu fehlen scheint). Das "musikalische Erbe", von der Gregorianik bis Webern, ist in unserer durch die Speichermedien Tonband und Platte dominierten Musikkultur omnipräsent. "Alte Musik" darf nicht mehr, wie noch bis zur Zeit der Wiener Klassik, sterben, um als Musikgeschichte abgelegt zu werden und solchermaßen Gegenwärtigem fortlaufend Platz zu machen. lm Gegenteil: Aus vielerlei Gründen wird immer mehr Altes aus den Archiven geholt und ungeachtet seines ästhetischen Wertes oder seiner (vielleicht auch nur vermeintlichen) Aktualität - in die Distributionsnetze des ästhetischen Apparats eingespeist. Dem kann ein Komponist (oder ein Musikhistoriker!), dem es um die Essenz älterer Musik geht, nicht einfach entfliehen. Das eindrücklichste Beispiel einer kreativen Reaktion auf diese Form von Musik-"Kultur" ist Lachenmanns Klarinettenkonzert Accanto. Der Klarinettist Eduard Brunner regte bei Lachenmann ein Klarinettenkonzert an. Klarinettenkonzert ist gleich KV 622 (Oktober 1791, 184 Jahre vor Accanto) - Weber, Spohr hin oder her -, "Inbegriff von Schönheit, Humanität, Reinheit [so der Komponist] und zugleich Beispiel eines gesellschaftlichen Fetischs heute, Objekt gesellschaftlichen Entzückens, eine 'Kunst', scheinbar 'mit der Menschheit auf Du und Du' (Thomas Mann), in Wirklichkeit zur Ware geworden für eine Gesellschaft mit der Kunst auf Oh und Ah. (...) Mein Stück ist 'accanto': daneben." (1976 im Programmheft zur Uraufführung von Accanto). Doch wie kann man "accanto" von KV 622 sein? In Gran Torso wurde die große Tradition des Streichquartetts (von Haydn bis Bartók, Schönberg und Webern) gleichsam von hinten betrachtet, die Leerstellen der Tradition zum Zentralen eines "Streichquartetts heute" gemacht. Beim Klarinettenkonzert packte der Komponist den "schönen, humanen, reinen" Stier bei den Hörnern, KV 622 wurde zum "konkreten, quasi paradigmatischen" Bezugspunkt: "Gleichzeitig mit dem Stück läuft 'insgeheim' ein Band mit dem Mozartschen Klarinettenkonzert ab; (...) es wird von Fall zu Fall in bestimmten Rhythmen hineingeblendet. Dabei ist klar, daß gerade dort, wo sie im Zusammenhang ihres eigenen strukturellen Ablaufs diese andere Klangwelt [von Mozart] 'anzapft', meine Musik sich erst recht von den ästhetischen Kategorien der so in Erinnerung gebrachten Sprache entfernt." Von einem "zerstörerischen Umgang mit dem, was man liebt, um sich dessen Wahrheit zu bewahren", sprach Lachenmann angesichts seines auf ein Modell bezogenen Komponierens. Doch nicht das Geliebte, nicht Mozarts Konzert wurde hier zerstört, nicht einmal dekomponiert, sondern die tabuisierte Konvention, der gegenwärtige Konsumartikel "KV 622" auf seine Essenz hin durchschaut. Dergestalt wurde Accanto kein Klarinettenkonzert gegen Mozart, sondern ein emphatisches Plädoyer für jene - allerdings ferne - "Schönheit, Humanität und Reinheit" einer vergangenen Zeit. Einen vergleichbaren Umgang mit dem Fernen finden wir in der Tanzsuite mit Deutschlandlied. Der Titel provoziert zunächst einmal: Kann für den politisch so hellhörigen Lachenmann das "Deutschland, Deutschland über alles" irgend etwas anderes bezeichnen als all jenes finster National(soziaI)istische, das so viele verdrängen? Bezeichnenderweise bilden in diesem Werk zwei andere vertraute Liedchen zum "Deutschlandlied" einen bedeutungsschweren Kontrapunkt: Das - auch aus Schönbergs 2. Streichquartett (als Katastrophensignal) bekannte - "O, du lieber Augustin, alles ist hin" und, ganz am Schluß, hintergründig gegen das "Deutschlandlied" gesetzt, "Schlaf, Kindlein schlaf ..." Ein derartiges Durchleuchten der aufgegriffenen Objekte und die Herstellung von semantischen Bezügen zwischen ihnen stellt aber nur einen Aspekt eines umfassenderen Prinzips dar: "Ob das nun der 'Liebe Augustin' ist oder die 'Marseillaise', ob es rhythmische Patterns sind [wie die Tanzmetren Walzer, Marsch, Siciliano, Polka u. a. in der Tanzsuite] oder die Bewegungsgeste als solche, also ob es das Musikantische als Triebhaftes oder als künstlerisch mechanistisches ist: in all diesen Formen wird indirekt Musik als Bewegung zitiert." Der Komponist schuf in diesen jüngeren Werken neue Bezüge und Zusammenhänge zwischen Vorgefundenem und Erfundenem, innerhalb derer "auch das Verfremdete völlig andere Abstrahlungen für das Bewußtsein, nicht nur für das Ohr hat. Es erprobt sich, präzisiert sich, schärft sich in irgendeiner Form auch daran, daß es zugleich die Erinnerung an die alten abgelegten Aspekte enthält". Musik heute sei der Walkman, mit dem man hört und sich zugleich die Ohren zuhalte, meinte Helmut Lachenmann in seinem Vortrag "Hören ist wehrlos - ohne Hören". Dagegen stellte er seine Forderung, daß "der Gegenstand von Musik das Hören" sei, "die sich selbst wahrnehmende Wahrnehmung." In der Praxis aber bedeute solches Hören "Konzentration des Geistes, also Arbeit, Arbeit aber als Erfahrung des Eindringens in die Welt"; als fortschreitende Selbsterfahrung aber sei derartige Erfahrung eine Glückserfahrung. Das Glück eines sich als frei erfahrenden, eines sich hörend erweiternden Hörens. Als was er seine eigene Musik versteht, mit welcher Hoffnung sie erdacht und zum Klingen gebracht wird, hat Helmut Lachenmann - auch hier mit der ihm eigenen Klarheit - festgehalten: "Musik also, die sich auf das Abenteuer einläßt, den Begriff Schönheit unter veränderten, sprachlosen Bedingungen nochmals zu fassen in der altbekannten Hoffnung, daß was von Herzen komme, trotz aller Sprachlosigkeit auch wieder zu Herzen gehe." Dem ist nichts beizufügen.