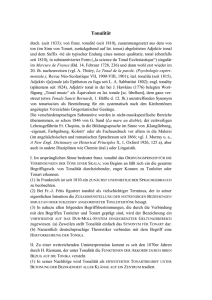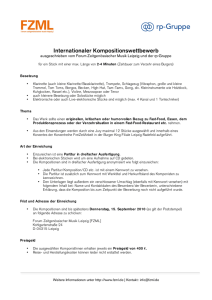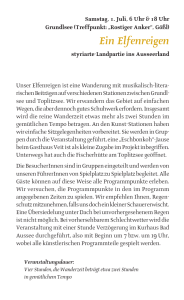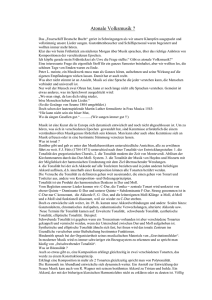Schönberg, Arnold
Werbung
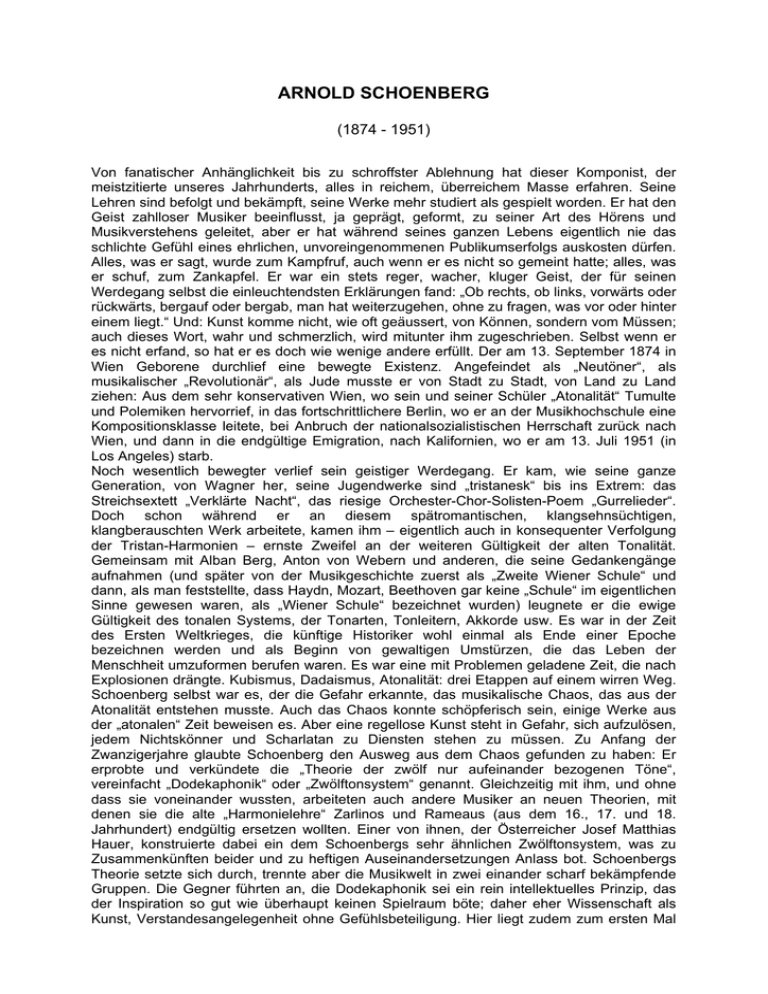
ARNOLD SCHOENBERG (1874 - 1951) Von fanatischer Anhänglichkeit bis zu schroffster Ablehnung hat dieser Komponist, der meistzitierte unseres Jahrhunderts, alles in reichem, überreichem Masse erfahren. Seine Lehren sind befolgt und bekämpft, seine Werke mehr studiert als gespielt worden. Er hat den Geist zahlloser Musiker beeinflusst, ja geprägt, geformt, zu seiner Art des Hörens und Musikverstehens geleitet, aber er hat während seines ganzen Lebens eigentlich nie das schlichte Gefühl eines ehrlichen, unvoreingenommenen Publikumserfolgs auskosten dürfen. Alles, was er sagt, wurde zum Kampfruf, auch wenn er es nicht so gemeint hatte; alles, was er schuf, zum Zankapfel. Er war ein stets reger, wacher, kluger Geist, der für seinen Werdegang selbst die einleuchtendsten Erklärungen fand: „Ob rechts, ob links, vorwärts oder rückwärts, bergauf oder bergab, man hat weiterzugehen, ohne zu fragen, was vor oder hinter einem liegt.“ Und: Kunst komme nicht, wie oft geäussert, von Können, sondern vom Müssen; auch dieses Wort, wahr und schmerzlich, wird mitunter ihm zugeschrieben. Selbst wenn er es nicht erfand, so hat er es doch wie wenige andere erfüllt. Der am 13. September 1874 in Wien Geborene durchlief eine bewegte Existenz. Angefeindet als „Neutöner“, als musikalischer „Revolutionär“, als Jude musste er von Stadt zu Stadt, von Land zu Land ziehen: Aus dem sehr konservativen Wien, wo sein und seiner Schüler „Atonalität“ Tumulte und Polemiken hervorrief, in das fortschrittlichere Berlin, wo er an der Musikhochschule eine Kompositionsklasse leitete, bei Anbruch der nationalsozialistischen Herrschaft zurück nach Wien, und dann in die endgültige Emigration, nach Kalifornien, wo er am 13. Juli 1951 (in Los Angeles) starb. Noch wesentlich bewegter verlief sein geistiger Werdegang. Er kam, wie seine ganze Generation, von Wagner her, seine Jugendwerke sind „tristanesk“ bis ins Extrem: das Streichsextett „Verklärte Nacht“, das riesige Orchester-Chor-Solisten-Poem „Gurrelieder“. Doch schon während er an diesem spätromantischen, klangsehnsüchtigen, klangberauschten Werk arbeitete, kamen ihm – eigentlich auch in konsequenter Verfolgung der Tristan-Harmonien – ernste Zweifel an der weiteren Gültigkeit der alten Tonalität. Gemeinsam mit Alban Berg, Anton von Webern und anderen, die seine Gedankengänge aufnahmen (und später von der Musikgeschichte zuerst als „Zweite Wiener Schule“ und dann, als man feststellte, dass Haydn, Mozart, Beethoven gar keine „Schule“ im eigentlichen Sinne gewesen waren, als „Wiener Schule“ bezeichnet wurden) leugnete er die ewige Gültigkeit des tonalen Systems, der Tonarten, Tonleitern, Akkorde usw. Es war in der Zeit des Ersten Weltkrieges, die künftige Historiker wohl einmal als Ende einer Epoche bezeichnen werden und als Beginn von gewaltigen Umstürzen, die das Leben der Menschheit umzuformen berufen waren. Es war eine mit Problemen geladene Zeit, die nach Explosionen drängte. Kubismus, Dadaismus, Atonalität: drei Etappen auf einem wirren Weg. Schoenberg selbst war es, der die Gefahr erkannte, das musikalische Chaos, das aus der Atonalität entstehen musste. Auch das Chaos konnte schöpferisch sein, einige Werke aus der „atonalen“ Zeit beweisen es. Aber eine regellose Kunst steht in Gefahr, sich aufzulösen, jedem Nichtskönner und Scharlatan zu Diensten stehen zu müssen. Zu Anfang der Zwanzigerjahre glaubte Schoenberg den Ausweg aus dem Chaos gefunden zu haben: Er erprobte und verkündete die „Theorie der zwölf nur aufeinander bezogenen Töne“, vereinfacht „Dodekaphonik“ oder „Zwölftonsystem“ genannt. Gleichzeitig mit ihm, und ohne dass sie voneinander wussten, arbeiteten auch andere Musiker an neuen Theorien, mit denen sie die alte „Harmonielehre“ Zarlinos und Rameaus (aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert) endgültig ersetzen wollten. Einer von ihnen, der Österreicher Josef Matthias Hauer, konstruierte dabei ein dem Schoenbergs sehr ähnlichen Zwölftonsystem, was zu Zusammenkünften beider und zu heftigen Auseinandersetzungen Anlass bot. Schoenbergs Theorie setzte sich durch, trennte aber die Musikwelt in zwei einander scharf bekämpfende Gruppen. Die Gegner führten an, die Dodekaphonik sei ein rein intellektuelles Prinzip, das der Inspiration so gut wie überhaupt keinen Spielraum böte; daher eher Wissenschaft als Kunst, Verstandesangelegenheit ohne Gefühlsbeteiligung. Hier liegt zudem zum ersten Mal in der Geschichte der Fall eines theoretisch erklügelten Systems vor, dem die Praxis der Komposition folgen sollte. Bei den erwähnten „alten“ Musiktheoretikern war es gerade umgekehrt gewesen. Sie fassten in ein System, was in der Praxis schon lange gültig war. Auch andere Einwände tauchten auf: handelt es sich bei der „Tonalität“, dem Tonalitätsempfinden, nicht um ein Naturgesetz, das vom Menschen gar nicht willkürlich beibehalten oder aufgelöst werden kann, vielleicht in diesem Sinne der Schwerkraft vergleichbar? Schoenberg wurde zum Führer einer „Partei“, zahlreiche Komponisten seiner und der folgenden Generationen bekannten sich zu ihm, viele andere bekämpften es (Melichar: „Musik in der Zwangsjacke“), die Spaltung zwischen Musikschöpfern und dem „Publikum“, die sich seit den Zwanzigerjahren unseres Jahrhunderts aufgetan und zu einer fast unüberbrückbaren Kluft geworden war, ebnete sich nicht nur nicht ein, sie vertiefte sich noch gefährlich. Zwar scheint sich seit den Siebzigerjahren eine „Rückkehr zur Tonalität“ abzuzeichnen, aber immer noch spielt die Dodekaphonik und der aus ihr entwickelte „Serialismus“ eine nicht zu unterschätzende Rolle. Mag diese auch von späteren Zeiten als vorwiegend negativ erkannt werden, sie ist ein Zeitsymptom, eine Etappe im Ringen um neue Inhalte und neue Formen, in dem der Kunst die Rolle eines feinfühligen Spiegels zukommt. Schoenberg (er schrieb sich in der ersten Hälfte seines Lebens „Schönberg“, adoptierte aber die von uns hier gebrauchte Schreibweise endgültig während seines Lebens in Amerika) beschäftigte sich mehrmals auch mit dem Musiktheater. Mit zwei frühen Werken, also in seiner Phase von Expressionismus und Atonalität; und mit einem grossen Werk, dem die Zwölftontheorie zugrunde liegt. „Erwartung“ ist ein Monodrama, also eine Handlung mit einer einzigen Person: einer Frau, die auf ihren Geliebten wartet, ihn in wachsender Spannung im Walde sucht und schliesslich seine Leiche findet. Alles wahre Geschehen ist ins Innere der Frau verlegt: ihr Harren, ihre Eifersucht, ihre ängstlichen, lüsternen, rachsüchtigen Gedanken, ihr Verzweiflung. Das wirkliche Geschehen nimmt nur wenige Sekunden in Anspruch, vielleicht noch weniger, wenn wir es als Traum auffassen wollen. Nach Art der filmischen Zeitlupe werden die Phasen dieses kurzen Prozesses zergliedert, retardiert und dadurch eindringlich gemacht. Den Text schrieb Marie Pappenheim, Schoenbergs Partitur umfasst 426 Takte und rollt in einer Spieldauer von weniger als einer halben Stunde ab. Das 1909 komponierte Stück musste fast 20 Jahre lang auf seine Uraufführung warten; diese erfolgte 1928 in Wiesbaden. Noch konzentrierter ging Schoenberg 1924 bei dem Drama „Die glückliche Hand“ zu Werke. Diese Partitur umfasst nur 255 Takte, von einer opernmässigen Handlung kann nicht gesprochen werden; eine seltsame Folge von Bildern, Gedanken, Gefühlen, die unklar, verschwommen, traumhaft ausgedrückt werden. Analog dem (allerdings etwas späteren) Begriff des „Anti-Theaters“ haben wir es bei diesem vom Komponisten selbst entworfenen Stück am ehesten mit einer „Anti-Oper“ zu tun. Einer singenden Person, dem „Mann“ stehen zwei stumme Gestalten gegenüber: „die Frau“ und „ein Herr“. Es entwickelt sich ein innerliches Ringen um die Frau, das Schoenberg mit einem eigenartigen „Chor“ unterstreicht, der nicht singt, sondern auf festgelegten Tonhöhen rezitiert. Licht- und Farbwirkungen werden durch genaue Vorschriften in der Partitur einbezogen; man wird an surrealistische Bilder gemahnt, die zwar jede Einzelheit mit fast fotografischer Genauigkeit darstellen, aber in die anscheinend unsinnigsten Zusammenhänge verweist, gerade wie im Traum. Ein seltsames, durchaus spannend wiederzugebendes Geschehen, dessen Musik durch expressionistische Objektivität und das Fehlen jeder malenden oder beschreibenden Absicht seltsam „verfremdet“ wirkt. Zwei weitere Arbeiten Schoenbergs seien hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. „Begleitmusik zu einer Lichtspielszene“ untermalt, betont unromantisch, „Drohende Gefahr“, „Angst“, „Katastrophe“, drei Grundthemen unseres Jahrhunderts. 1930 wurde in Frankfurt/Main ein Lustspiel, bezeichnet als satirischer Einakter, mit dem Titel „Von heute auf morgen“ uraufgeführt. Es handelt sich um eine banale Komödie ohne jede Bedeutung, zumal auch die begleitende Zwölftonmusik hier wie eine Parodie ihrer selbst wirkt. Auszug aus „OPER DER WELT“ von Prof. Dr. Kurt Pahlen. ACS-Reisen AG