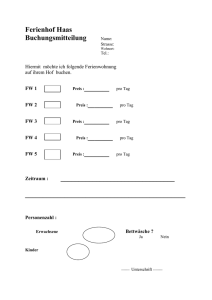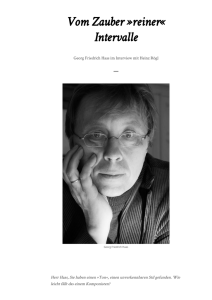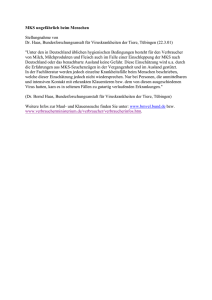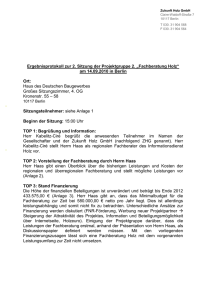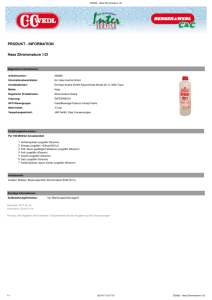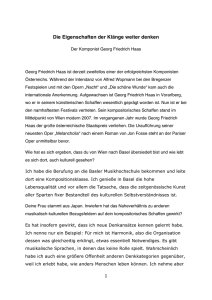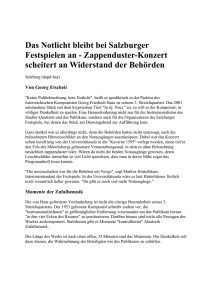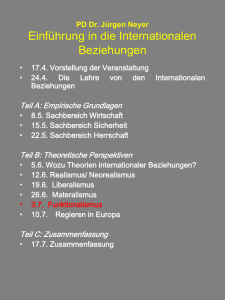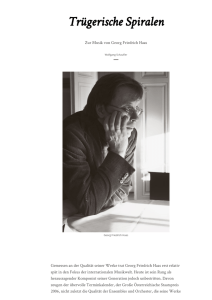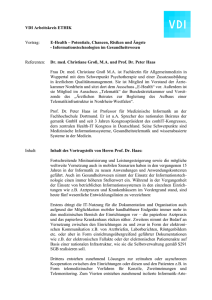Im Klang denken
Werbung

Lisa Farthofer «Im Klang denken» Eine Annäherung an die Klangwelt von Georg Friedrich Haas «Die Liebe zum Erklingenden, die Liebe zu den Klängen, die sich wie Lebewesen in Raum und Zeit entfalten, ist für mich eine der Grundvoraussetzungen meiner Arbeit»1, notiert Georg Friedrich Haas im Jahr 2004 in seinen Anmerkungen zum Komponieren. Diese Maxime spiegelt nicht nur ein grundsätzliches Bedürfnis eines Komponisten, sondern im Fall von Haas eine konkrete kompositorische Zugangsweise wider. Ebenso deutlich wird dies, wenn er in seinem Ensemblewerk «… Einklang freier Wesen …» (1994–96) das Wirksamwerden von «Scelsis Hineinhören in die Klänge»2 konstatiert. In diesem Hineinhören nämlich eröffnet sich eine Welt voller Obertöne, Schwebungen, Mikrointervalle – eine Klangwelt jenseits von zwölf temperierten Halbtonschritten, in der sich ein musikalischer Mikrokosmos zu einem klanglichen Makrokosmos weiten kann. Mikrointervalle werden darin nicht bloß als Verzerrungen der zwölftönig gleichmäßigen Temperierung, sondern als eigenständige Intervallkategorien und Melodien wahrgenommen. Das uneingeschränkte Intervall-Raum-Denken, das Bewusstsein über die schier unendlichen Möglichkeiten der Intonation und Klangfarben, aus denen Haas schöpft, bilden einen zentralen – und vielleicht auch den faszinierendsten – Grundpfeiler seines Schaffens. Haas, dem dieser Tage die höchste künstlerische Auszeichnung der Republik Österreich verliehen wird, lebt und lehrt seit 2005 in Basel. 1953 in Graz geboren, verbrachte er seine Kindheit im abgeschiedenen vorarlbergischen Dorf Latschau und später im etwas größeren Tschagguns. Dass er zu Beginn der 1970er Jahre an den Grazer Universitäten Physik, Mathematik, Germanistik sowie Komposition, Klavier und Musik­pädagogik inskribierte, zeugt von seinen vielseitigen ­Interessen als Student. Ursprünglich habe er sich, so Haas, nicht entscheiden können, ob er Schriftsteller oder Komponist werden sollte, bis er feststellte, dass Sprache nur über eine begrenzte Ausdrucksspanne verfüge und dass er in der Musik Zustände und Gefühle formulieren konnte, die ihm mit ­Worten nicht fassbar schienen.3 1979 beendete er seine ­musikalischen Studien bei Gösta Neuwirth und Ivan Eröd (Komposition) sowie bei Doris Wolf (Klavier). (Das Studium der Naturwissenschaften und der Germanistik hatte er inzwischen aufgegeben.) Bereits 1978 hatte Haas begonnen an der Kunstuniversität Graz die Fächer Kontrapunkt, Zeitgenössische Kompositionstechniken, Werkanalyse und Einführung in mikrotonale Musik zu unterrichten. Parallel dazu belegte er zu Beginn der 1980er Jahre ein ­postgraduelles Studium bei Friedrich Cerha in Wien, nahm mehrfach an den Darmstädter ­Ferienkursen teil, gestaltete das Programm des musikprotokoll 1988 mit einem Schwerpunkt auf mikrotonaler Musik des 20. Jahrhunderts, absolvierte ein Praktikum am IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) in Paris (1991) und war Stipendiat der Salzburger Festspiele (1992/93). Aus diesen frühen Jahren stammt beispielsweise die Kurzoper Adolf Wölfli (1980/81). Im Zentrum der Handlung steht der Psychiatrieinsasse Adolf Wölfli (1864–93), der durch die Texte und Bilder, die er in der Anstalt schuf, als Künstler an­erkannt wurde. Für das Libretto stellte Haas eine Collage aus Originaltexten von Wölfli zusammen, in denen sich der geschmeidige Duktus der Poesie mit skurrilen Wortschöpfungen und dem Ausdruck der pädophilen Neigungen Wölflis zu einem teils verstörenden, teils märchenhaften surrealistischen Ganzen fügen. Das unverstandene Individuum, der aus der Gemeinschaft Ausgeschlossene, der aus politischen und weltanschaulichen Gründen Verfolgte, der unbezwingbaren Mächten Ausgelieferte, Utopieverlust und geistige Umnachtung sind auch die ­zentralen Themen des zweiten und dritten Opernwerks von Haas: Nacht (1995/96), in dessen Zentrum die Dichterfigur Friedrich Hölderlin steht, sowie Die schöne Wunde (2002/03) mit Texten unter anderen von Franz Kafka, Edgar Allan Poe und Rosa Luxemburg. In beiden Libretti führt Haas autobiographische Aufzeichnungen mit Prosatexten der Autoren zusammen. Beide Opern wurden bei den Bregenzer Festspielen uraufgeführt und waren maßgeblich für das wachsende ­Interesse an Haas im Kulturbetrieb mitverantwortlich. Begegnung mit der Musik des Ivan Wyschnegradsky Zwischen 1982 und 1985 schrieb Haas drei Werke für einen Pianisten an zwei im Abstand eines Vierteltones gestimmten Klavieren, betitelt als Hommagen an Steve Reich, Josef ­Matthias Hauer und György Ligeti. Sie bezeugen Haas’ intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte der Mikrotonalität im 20. Jahrhundert, in der das «Vierteltonklavier» ein ­zentrales Instrument darstellte. Uraufgeführt wurden die ­Hommagen im Rahmen von Hauskonzerten bei Haas in Graz. Zumeist standen bei diesen Hauskonzerten (mikrotonale) ­Werke auf dem Programm, die es sonst nur selten in den ­Konzertsaal schaffen, darunter Kompositionen von Ivan Wyschnegradsky, Alois Hába, James Tenney, Harry Partch und Julián Carrillo. ARCHIV WIEN MODERN | © WIEN MODERN | WWW.WIENMODERN.AT Ivan Wyschnegradsky (1893–1979) war es auch, der Haas musikalisch nachhaltig beeinflusste. Der aus Russland stammende Komponist, der 1920 aus seiner Heimat St. Petersburg nach Paris emigrierte, war ein Einzelgänger und Querdenker, der zu Lebzeiten nur wenig Anerkennung für sein kompositorisches wie musiktheoretisches Schaffen fand. Seine innovativen harmonischen und rhythmischen Konzeptionen leben jedoch – kaum beachtet – in der Musik der nachfolgenden Komponistengenerationen weiter.4 Wyschnegradsky selbst war ein großer Verehrer Skrjabins. Dies mag sich in Wyschnegradskys harmonischer Fokussierung auf Quart- und Quintbeziehungen ebenso niedergeschlagen haben wie in seiner Musikanschauung: Die enge Verknüpfung von Musik und Metaphysik, die sich bei Skrjabin ins Sektenhafte kehrte, tritt in etwas gemilderter Form auch bei Wyschnegradsky zutage. Musik als spirituelle Erfahrung bestimmte sein kompositorisches Schaffen und ihm schwebte – ähnlich zu Skrjabin – ein Totalkunstwerk vor, das bei den Menschen die Kräfte eines kosmischen Bewusstseins löse.5 Im Zentrum steht bei Wyschnegradsky die Idee des «Klangkontinuums», eines unendlichen Klangraumes, in dem Töne in beliebiger Dichte angesiedelt werden und in dem die Tonvorräte aus den nicht mehr wahrnehmbaren Klangregionen in die hörbare Zone übertragen werden. Darin liegt auch sein mikrotonales System begründet, dem Wyschnegradsky den Namen «Ultrachromatismus» gab. Anstelle der gleichmäßig temperierten Halbtöne werden hier kleinere, vom temperierten Halbton abgeleitete Intervalle zur Skalenbildung herangezogen: Drittel-, Viertel-, Sechstel- bis hin zu kaum mehr unterscheidbaren Zwölfteltönen. Das zentrale Element, das Haas von Wyschnegradsky ­übernommen hat, ist die harmonische Konzeption «nichtoktavierender Tonräume»: Die Funktionen, die bisher der Oktave zukamen (Skalenbegrenzung, Transposition), überträgt Wyschnegradsky auf ein anderes Intervall, das bis zu sechs Zwölfteltöne über oder unter der ursprünglichen Oktave erklingen kann.6 So sind es hier unterschiedlich temperierte Sept- und Nonintervalle, die den Skalenzyklus definieren. Bei Haas finden wir solche nicht-oktavierenden Tonräume in ­seinen Werken der letzten fünfzehn Jahre vielfach angewandt (vergleiche zum Beispiel Descendiendo für großes Orchester, 1993, Violinkonzert, 1998, Konzert für Violoncello und ­Klavier, 2003/04, Sieben Klangräume, 2005). Sie stechen als Quart-Tritonus-Quint-Schichtungen ins Auge, die Haas selbst als «Wyschnegradsky-Akkorde»7 bezeichnet. Ein weiteres, charakteristisches Frühwerk von Haas, das kurz nach Adolf Wölfli entstanden und von seriellen Konstruktionsprinzipien dominiert ist, sind die Phantasien für Klarinette und Viola (1982). Klarinette und Bratsche durchwandern in den Phantasien alle Lagen ihres Intonationsraums, von melodischer bis geräuschartiger Artikulation – mit Spieltechniken, die auch in die Klangwelt der Obertöne führen. Die Instrumente nähern sich klanglich einander an, entfernen sich wieder von­einander, verharren in gegensätzlichen Extremitäten der ­Artikulation und potenzieren dadurch die Intensität ihrer Klangfarben. Es sind aber auch zarte, lyrische Melodielinien, denen der junge Haas nachspürt und die wir ebenso in späteren Werken (zum Beispiel im Violinkonzert und in de terrae fine für Violine solo, 2001) finden. Durch gezielte Pausensetzungen wird zudem der Ausschwingphase der Klänge Entfaltungsmöglichkeit gegeben und so die Aufmerksamkeit des Hörers auf die im leisen Klangbereich angesiedelten Vorgänge gelenkt. Der Protagonist der Phantasien ist gleichsam die Klangfarbe – die tiefe, mannigfaltige Tonwelt, die ein Instrument offenbart. Und es ist derselbe Protagonist wie in den ­späteren Werken von Haas. Beispielhaft für Haas’ frühere serielle Kompositionsmethode steht «… Schatten … durch unausdenkliche Wälder»8 für zwei Schlagzeuge und zwei Klaviere (1992). Wie komponiert man Beschleunigung?9 Diese Frage stellte sich Haas – ähnlich zum später entstandenen Violinkonzert – bei diesem Werk. Es ist in drei Sätze gegliedert, wobei der zweite halb so lang ist wie der erste (das heißt die Zeitstruktur verläuft doppelt so schnell) und der dritte wiederum halb so lang wie der zweite. Der 1. Satz ist mit Schichtung, Schwingung, Abbruch betitelt. Wie Haas in der Einleitung zur Partitur vermerkt, wird dieser Abschnitt «durch Sinusfunktionen bestimmt, die auf unterschiedliche Art in die Notenschrift übertragen werden: als transversale Schwingungen (die Tonhöhen folgen dem Verlauf von Sinuskurven), als longitudinale Schwingungen (Verlangsamungen beziehungsweise Beschleunigungen werden durch Sinuskurven gesteuert) sowie durch Kombinationstechniken dieser beiden Verfahren. Die derart definierten Gestalten ­werden übereinandergelagert, gedämpft, ineinandergeschichtet, abgebrochen, auf einen Punkt hin konzentriert.»10 Hinwendung zur Intuition Setzt man Haas’ Kompositionen aus seiner Studienzeit in ­Vergleich zu seinem Schaffen ab etwa 1996 (vergleiche Kammeroper Nacht), scheint zu diesem späteren Zeitpunkt nur mehr wenig an die einst so seriell durchdrungene Kompositionstechnik der Jugendwerke zu erinnern. Dass Haas eine starke Entwicklung in Richtung eines eigenstän- digen Personalstils durchlebte, verbunden mit immer konkreter und detaillierter realisierten Klangvorstellungen, ist unüberhörbar. Die bis 1981 entstandenen «Jugendwerke» gibt der Komponist – mit Ausnahme der Derivate für Klavier (1974) sowie der Kurzoper Adolf Wölfli – mittlerweile nicht mehr zur Aufführung frei. Doch in vielen frühen Stücken drücken sich bereits einige wegweisende kompositorische Interessen aus – Interessen, die Haas’ Schaffen nach wie vor fundamental prägen. Es sind dies Aspekte in Hinblick auf seine Arbeit mit Klang an sich und seine Behandlung des Instrumentariums. Gleichsam systematisch tastet Haas in den frühen Werken den klanglichen ­«Spielraum» der Instrumente ab. Sie intonieren in sämtlichen Lagen, in zahlreichen Artikulationsweisen und werden an unterschiedlichen Stationen zu «Dialogen» zusammengeführt. Mitte der 1990er Jahre wird eine Veränderung in Haas’ Komponieren spürbar, die in Verbindung mit seiner zunehmenden Abkehr von seriellen Kompositionsmethoden (zum Beispiel Berechnung des Netzes aus Tonhöhe und Dauer, strenge Goldener-Schnitt-Proportionen, gleichmäßige Verlangsamungen und Prozesse in der Tonhöhenveränderungen) steht. Einen zentralen Ausdruck für diese kompositionstechnische und mitunter auch ästhetische Neuorientierung stellen die zehn Solostücke «… aus freier Lust verbunden …» dar, die zusammen das Ensemblewerk «… Einklang freier Wesen …»11 (1994–96) ­bilden. Haas berichtet, dass er bei der Komposition der Stücke bereits begonnen hatte, mathematisch zu konstruieren – so wie er es bisher vorwiegend getan hatte –, als er bemerkte, dass er mit einer strengen Konstruktion der Solostimmen, die ja zusammen eine Werkeinheit ergeben sollten, überfordert ­gewesen wäre. «Und deshalb habe ich dann vollkommen frei gearbeitet und nur die harmonischen Felder definiert. Wie lange diese jedoch zu dauern haben und wie sie sich verändern, das habe ich jedes Mal frei entschieden – und zu meiner Überraschung festgestellt, dass das gut funktioniert. […] Vielleicht kann man das sogar mit gesteigertem Selbstvertrauen definieren. Man muss/möchte sich beim Komponieren anfangs immer für alles rechtfertigen. Irgendwann einmal bemerkt man jedoch, dass das absurd ist und dass sich die Musik nicht durch den Goldenen Schnitt und die Exponentialgleichung definiert, sondern durch die Phantasie, die trotz Goldenen Schnitts und Exponentialgleichung immer noch die Musik ausmacht. Man kann metaphorisch sagen, dass das Stützkorsett irgendwann zur Bleiweste wird.»12 Bereits in den Entstehungsprozessen von quasi una tânpûrâ (1990/91) sowie von Nacht-Schatten (1992) ereilte Haas ein ganz ähnliches Gefühl, wenn auch diese Werke noch im ­Zeichen serieller Konzeption standen. In NachtSchatten ­komponierte Haas mit Kombinationstönen (Töne, die aus der Überlagerung zweier Frequenzen als drittes Teilprodukt hervorgehen). Deren exakte Frequenzen, die er im Vorfeld berechnet hatte, erschienen ihm im kompositorischen Prozess als «unbrauchbar», weshalb er «in einem völlig willkürlichen, durch keinerlei akustische Gesetze gerechtfertigten Akt» zu jedem dieser berechneten Töne «eine konstante Frequenzzahl dazugezählt (oder abgezogen)» und «solcherart die Kombi­nationstöne ­verzerrt» habe.13 Die Entstehung von Nacht-­Schatten war auch stark von Haas’ Aufenthalt am IRCAM geprägt: Die erste ­Version des Stückes war noch vor dem ­dortigen Aufenthalt entstanden. Währenddessen arbeitete Haas das Stück jedoch komplett um. «Nach dem IRCAM-Aufenthalt war die Komposition ganz verändert», erzählt Haas. «Dort hat sich für mich eine neue Welt aufgetan. Ich habe von da an zwar weiterhin keine ­Elektronik verwendet – das Einzige, was ich übernommen habe, war der Homecomputer.»14 Allerdings haben die neuen Erfahrungen – konkret die «Denkprozesse»15 elektronischer Musikerzeugung – seine ­Kompositionsweise stark beeinflusst, wie sie sich in den ­Projektionen spektraler Klangeigenschaften auf musikalische Prozesse in seinen Werken manifestieren (dies wird im ­Folgenden noch näher erläutert). Im Violinkonzert (1998) ging Haas wiederum einen Schritt weiter als in Nacht-Schatten und «… Einklang freier Wesen …». Der Komponist berichtet über den Entstehungsprozess: «Ich erinnere mich an das Violinkonzert, da gab es ein Dauern-Konzept, gebaut nach einer recht komplizierten Exponentialgleichung. Ich entschloss mich jedoch, es so zu verändern, wie ich es brauchte. […] Hinterher wurde mir bewusst, dass das Einzige, das gleich geblieben war, die Eingabe darstellte, die ich zuvor in den Rechner getippt hatte, und dass ich hingegen sämtliche Ergebnisse der Rechnung umgeändert hatte.»16 Die Hinwendung zur Intuition und deren verstärkte Einflussnahme auf den Kompositionsprozess vollzog sich bei Haas Schritt für Schritt und nicht in Form eines punktuellen Wendegeschehens. Die Genese der Werke der frühen 1990er Jahre sind Ausdruck neuer Tendenzen im Schaffen des damals etwa 40-jährigen Komponisten. Dabei ist festzustellen, dass Haas’ Neigung, serielle Parameter bei der Komposition nach eigenem Ermessen zu befolgen beziehungsweise zu umgehen, parallel zur Ausprägung seines klanglichen Personalstils steht. Exemplarisch für die Richtung, in welche diese neue Entwicklung ging, stehen die Sieben Klangräume zu den unvollendeten Fragmenten des Requiems von W. A. Mozart für Chor und Orchester (2005): In diesem Werk scheint die Umsetzung von dramatisch konnotierten Klangstrukturen dem seriellen Kompositionsanspruch materialer Bedeutungsneutralität schlicht zu widerstreben. Es scheint zudem kein Zufall zu sein, dass Haas gleichzeitig mit dem beschriebenen Ablegen der «Bleiweste» Mitte der 1990er Jahre auch beruflich einen entscheidenden Schritt setzte: 1997 ließ er sich von seiner Lehrtätigkeit an der Kunstuniversität Graz beurlauben und konzentrierte sich in den folgenden Jahren voll und ganz auf das Komponieren. Er verbrachte ein Jahr in Berlin als DAAD-Stipendiat (1999/2000) und zog daraufhin sechs Monate nach Irland, ehe ihn die Abgeschiedenheit des Küstendorfes Moyrisk doch wieder in die größeren Städte Wien und Graz zurückkehren ließ. In jener Zeit entstanden zentrale Werke wie das Violinkonzert, das 1. und 2. Streichquartett (1997 und 1998), Torso nach Franz Schuberts unvollendeter Klaviersonate C-Dur D 840 für großes Orchester (1999/2000), Blumenstück nach der «Rede des toten Christus vom Weltengebäude herab, daß kein Gott sei» aus dem Siebenkäs von Jean Paul für 32-stimmigen Chor, Basstuba und Streichquintett (2000), in vain für 24 Instrumente (2000), Natures mortes für großes Orchester (2003), das Konzert für Violoncello und Orchester und Sieben Klangräume zu den unvollendeten Fragmenten des Requiems von W. A. Mozart für Chor und Orchester. Abgesehen von der Obertonharmonik, die in jenen Jahren zunehmende Bedeutung in Haas’ Schaffen gewann, ist es deren Überlagerung mit der temperierten Stimmung oder der Wyschnegradsky-Harmonik, die für seine Werke charakteristisch sind. In den Sieben Klangräumen beispielsweise erwächst aus der zu Beginn temperiert intonierten Obertonreihe im 3. Klangraum schließlich ein reines Obertonfeld. Sodann entspinnt Haas aus dem Quint-(Halb)schluss des mozartschen Lacrimosa-Fragments (Requiem K 626) im 3., 4. und 6. Klangraum ein Quart-Tritonus-Quint-Feld, das letztlich zu einer direkten Überlagerung von Obertonakkorden (diesmal «richtig» intoniert) und «Wyschnegradsky-Akkorden» überkippt. Im Ersten Streichquartett wendet Haas hingegen die Technik der Skordatura an, um die Intonation mehrerer Obertonreihen zu begünstigen. Aus der Überlagerung der erzeugten Obertonreihen entsteht ein mikrotonales Geflecht, in denen – unter anderem – scheinbar tonale Akkorde (Dominantseptakkorde gebildet aus dem 1., 3., 5. und 7. Teilton) durch die ­vielfältigen Intonationsmöglichkeiten der einzelnen Intervall­kategorien mikrotonal «neutralisiert» werden. Neben diesen harmonischen Aspekten sind es aber auch Projektionen spektraler Klangeigenschaften, der physikalischen und akustischen Prozesse eines Schallvorganges auf musikalische Prozesse, die Haas’ Werke fundamental prägen. Mit der Erfindung der Schallspektrographie in den 1970er Jahren begannen sich viele Komponisten (allen voran Gérard Grisey und Tristan Murail der Groupe L’Itinéraire) für die Prozesse eines Schallvorganges, die mittels der Spektralanalyse in eine optische (graphische) Darstellung übertragen werden, zu interessieren und musikalisch aufzubereiten. Durch die Spektralanalyse sichtbar gemacht wird die Physiognomie eines Klanges – seine einzelnen Bestandteile wie Frequenzen, Schwingungsformen, Intensitätskurven, Merkbarkeitsschwellen, Rauheitsgrade, Verdeckungen, Verzerrungen sowie die Beschaffenheit seiner Teiltöne. Die Technik der «Superzeitlupe»17, so wie Haas sie nennt, bildet dabei die Voraussetzung dafür, dass die spektralen ­Charakteristika eines Tones in wahrnehmbarer Form auf die Komposition übertragen werden können. Vereinfacht gesagt entspricht sie der zeitlichen Dehnung, mit der spektrale Klangereignisse in einer Komposition dargestellt werden: ein ein- oder mehrstimmiger Satz wird extrem verlangsamt vom Ensemble gespielt, wobei Tonhöhenschwankungen in stilisierter Weise auskomponiert werden. Haas benutzt dieses Verfahren auch als Zitattechnik, so zum Beispiel in «… sodaß ich’s hernach mit einem Blick gleichsam wie ein schönes Bild … ­ im Geist übersehe» (1990/91), dem ein Ausschnitt aus dem zweiten Satz von Mozarts Sonate für Violine und Klavier in B-Dur K 454 zugrunde liegt. Mozarts Partitur wird darin – nach Methoden des gesteuerten Zufalls – collagiert, Motive werden extrahiert, rhythmisch und klanglich verfremdet. Das Resultat ist die komplette harmonische und klangfarbliche Diffusion, in der das Original immer wieder fragmentarisch hervorschimmert. Für Haas besonders relevante Projektionen spektraler Klangeigenschaften sind zudem «auskomponierte» Schwebungen (rhythmisierte Tonrepetitionen verbunden mit dynamischen Schwankungen, in horizontaler Abfolge oder durch ­vertikale Überlagerung wie in Descendiendo und in vain), Klangspaltungen (auf Scelsi zurückgehende, mikrotonale ­Frequenzverdichtung rund um eine Tonhöhe wie in Monodie, 1998/99, «Wer, wenn ich schriee, hörte mich …», 1999, und im Zweiten Streichquartett), der orchestral arrangierte ­psychoakustische Effekt einer scheinbar endlos sinkenden oder steigenden Tonreihe (als musikalisch-motivische Annäherung an den Shepard-Skalen-Effekt wie in in vain und Natures ­mortes) und der Einsatz von Kombinationstönen (insbesondere von Differenztönen wie in NachRuf … ent-gleitend …, 1992, und in vain). Der ästhetische Reiz von Reibung und Diffusion Dass die kleinsten Abstufungen der mikrotonalen Intervalle, Schwebungen, nicht als Übel der Musizierpraxis und der Temperierungen anzusehen sind, sondern als «ein menschliches Grundbedürfnis», davon ist Haas überzeugt. «Dass es nicht die Übereinstimmung mit den Proportionen der Teiltonreihe ist, die in den unterschiedlichen Musik- traditionen gesucht wird, sondern die Abweichung davon: nicht die Verschmelzung, ­sondern die Reibung»18, sieht Haas anhand zahlreicher Musikkulturen belegt: zum Beispiel anhand der Gamelan-Musik mit ihren vergrößerten oder verkleinerten Oktaven, ferner anhand der indischen Ragas durch deren schwebungsreichen Intervalle zur Bordunquinte, aber auch anhand der zwölftönig gleichmäßigen Temperierung der abendländischen Musik mit ihren abstrakten und deshalb Schwebungen hervorrufenden Intervallen. Die zwölftönige Temperierung, so Haas, fasziniere gerade wegen ihrer «wunderbar ‹falschen›, schwebungsreichen Dur- und Dominantseptakkorde»19. Haas spricht im Eingangszitat dieses Textes von Klängen als Lebewesen. Diese Metaphorik ist durchaus wissenschaftlich zu untermauern, da Klänge ein überaus komplexes Innenleben (zum Beispiel Frequenz- und Dynamikschwankungen der Obertöne) aufweisen. Und: Haas gibt den Klängen eine Geschichte. In seinen Orchester- und Ensemblewerken strebt er nach einer sehr klaren dramaturgischen Aussagekraft der innermusikalischen Prozesse (vergleiche zum Beispiel das Violinkonzert, in vain, Natures mortes und Sieben Klangräume). Interessant ist, dass Haas bei seinem häufigen Einsatz der Obertonreihe keineswegs ideologisch argumentiert, wo doch in der musikwissenschaftlichen Debatte die Obertonreihe oft emphatisch als «natürlich» im Gegensatz zur «künstlichen» zwölftönig gleichmäßigen Temperierung bezeichnet wird. Im Sinne Haas’ erscheint es fraglich, ob es überhaupt irgendein Tonsystem gibt, das Anspruch auf «Natürlichkeit» oder All­gemeingültigkeit stellen könnte. Im Falle der Obertonreihe schließt Haas dies ebenso wie bei der zwölftönigen Temperierung aus. Beide Tonsysteme erscheinen gleichermaßen artifiziell: die zwölftönige Temperierung aufgrund ihrer konstruierten Gleichmäßigkeit der Intervalle, die als praktikable Kompromisslösung dient, und die Obertonreihe, weil sie im Grunde gar nicht konkret fassbar, das heißt nicht naturgetreu darstellbar ist, da sie einer konstanten Gestaltveränderung unterworfen ist. Wichtig ist für Haas auch nicht die eventuelle Feststellbarkeit von Natürlichkeit der Intervalle – genau genommen schließt er eine solche in der Musik grundsätzlich aus –, ­sondern deren klanglicher Reiz, egal welcher systemischen Konvenienz. Bezeichnend ist deshalb Haas’ Kommentar zur Künstlichkeit von komponierten Obertonakkorden und das darin ebenso enthaltene ästhetische Plädoyer: «Ein aus den Teiltönen der Obertonreihe gebildeter Akkord ist also nicht eine detaillierte Übertragung einer Analyse eines realen Instrumentalklanges, sondern eine Abstraktion, beinahe eine Fiktion, die aber […] eine eigene, selbständige Qualität entwickelt.»20 Mit Haas’ Faszination für Obertonakkorde ist auch jene für Mikrotöne im Allgemeinen verbunden. Er habe schon immer einen «inneren Drang»21 nach Mikrotonalität verspürt und versucht bei seiner Argumentation auch deren Alltäglichkeit, deren allgegenwärtiges Vorkommen in der Musizierpraxis aufzuzeigen – all das, worüber nichts in den Noten steht: «Ich denke, die Faszination ist, dass die Mikrotonalität einfach da ist. […] Mikrotonalität gibt es einfach: Wenn ich spreche, verwende ich eine mikrotonale Sprachmelodie, wenn ich auf der Straße gehe, höre ich Hupen von Autos oder was auch immer, die in mikrotonalen Klängen übereinander gelagert sind, dann kommen noch Vogelstimmen hinzu und dann hab ich eine dritte Ebene mit mikrotonalen Intervallen. Aber das gibt es auch immer, wenn Musiker traditionelle Musik spielen. Die Intonation, das weiß jeder Streicher, Bläser oder Sänger, arbeitet mit mikrotonalen Modifikationen. Man intoniert auch ganz bewusst gegen die reinen Naturklänge, Sänger singen etwas zu hoch, damit sie sich gegen das Orchester leichter durchsetzen. Das hat eine ungeheure Wirkung, wenn es gut gemacht wird. Aber auch so etwas Banales wie das Vibrato. Wenn das zum Beispiel Streicher machen, dann entsteht ein mikrotonaler Cluster. Die Tonhöhe ist nicht durch einen Punkt, sondern durch einen Frequenzbereich definiert. Die Abweichung macht das Aufregende aus, bestimmt Reize und auch Klangfarben. Was mich verblüfft, ist, dass niemand im 19. Jahrhundert oder auch davor damit explizit gearbeitet hat.»22 In Haas’ Musik, die so sinnlich, schwelgend, klangprächtig wie romantisch-dekadent, zerbrechlich, provokant und ohrenbetäubend sein kann, spiegelt sich so etwas wie eine Totalaufnahme des Lebens, das die Euphorie und das Glücksgefühl gleichermaßen kennt wie Angst und kafkaesk anmutende Gemütszustände. Es ist bezeichnend, wenn Haas den Musikern Aufgaben stellt, «die so schwierig sind, dass sie nur unter höchster Anspannung und mit der [für den Hörer] fühlbaren Angst zu scheitern realisiert werden können»23. Das bringt darüber hinaus mit sich, dass Haas in radikaler Weise jenes musikalische Material resubjektiviert, das die Avantgarde nach dem Zweiten Weltkrieg einst mühevoll versuchte zu objektivieren. Haas’ Musik ist überaus persönlich,24 soll emotionalisieren – soll gleichermaßen im Klang schwelgen können wie betroffen machen. – Wie definiert Haas in diesem Zusammenhang einen musikalischen Schönheitsbegriff? «Ich habe einmal auf eine ähnliche Frage geantwortet: Ich würde sehr gerne eine Musik schreiben, die so hässlich ist wie die von Franz Schubert; aber ich fürchte, ich schaffe es nicht. Was ist eigentlich Schönheit? Es ist eine Frage des Kontrastes; so wie Lachenmann schöne Musik schreibt oder so wie Otto Dix schöne Bilder malt. Einen Schönheitsbegriff in dieser Weise suche ich.»25 In der intensiven Begegnung mit Haas’ Musik offenbart sich eine grundlegende ästhetische Tendenz, die Schönheit in der Totalität der Dinge sieht – in ihrer Klangintensität sowie in ihrer Ambivalenz, die zugleich vielfältige Ausdrucksweise bedeutet, und in unserer Fähigkeit, die Dinge in dieser Ganzheit wahrzunehmen. Dies spiegelt zumindest den weltanschaulichen Versuch einer ­Annäherung an Haas’ Musikästhetik, die dieser in seinen Fünf Thesen zur Mikrotonalität (2001) in folgende zentrale Worte fasst: «Komponieren heißt für mich: ‹im Klang denken›.»26 Dieser Text basiert auf Lisa Farthofers Studie «Im Klang denken» – jenseits der zwölf Halbtöne. Studien zum kompositorischen Schaffen von Georg Friedrich Haas. Diese erscheint im November 2007 im Pfau Verlag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 G. F. Haas, «Anmerkungen zum Komponieren», in: Musik und Metaphysik, hrsg. von ­Eckhard Tramsen, Hofheim: Wolke 2004, S. 116. «Mikrotonale Zusammenklänge – R. Kager im Gespräch mit G. F. Haas», in: ­Programmheft Next Generation im Rahmen der Salzburger Festspiele 1999, S. 13. Diese Aussage, die aus dem Gedächtnis zitiert wurde, entstammt einem Gespräch mit dem Komponisten um das Jahr 2006. Christoph Staude erläutert in einer Werkanalyse: «Pierre Boulez erwähnt in seiner ­ästhetischen Schrift Musikdenken heute, in der er seine Theorie der ‹geraden und kurvigen Räume› darlegt, Wyschnegradsky überhaupt nicht, obgleich seine Vorstellung doch extrem von dessen Theorie der oktavierenden und nicht-oktavierenden Tonräume sich abzuleiten scheint. Immerhin hatte Boulez als gerade Zwanzigjähriger an einem Wyschnegradsky-Konzert im Salle Chopin in Paris am 10. November 1945 mitge­wirkt und war wohl mit ihm näher bekannt geworden. Bereits 1918 unternimmt ­Wyschnegradsky in seinem L’évangile rouge op. 8 eine ultrachromatische Teilung des Rhythmus vor – ein Bild, das 34 Jahre später mit frappierender Ähnlichkeit in den ­frühen Klavierstücken von Karlheinz Stockhausen wieder auftauchen sollte.» (Christoph Staude in: Ivan Wyschnegradsky: «Étude sur le Carré magique sonore» op. 40 (1956) für Klavier. Eine analytische Betrachtung, Saarbrücken: Pfau 1995 (= fragmen 9/Beiträge, Meinungen und Analysen zur neuen Musik), S. 3. Vergleiche: Christoph Staude, Ivan Wyschnegradsky, S. 6. Ivan Wyschnegradsky, «L’ultrachromatisme et les espaces non octaviants», in: La Revue Musicale 290–291 (1972), S. 90 ff. G. F. Haas in einem Gespräch am 29.3.2005 in Graz sowie am 4.12.2005 in einem ­universitärem Kolloquium mit Wolfgang Gratzer in Salzburg anlässlich der Uraufführung der Sieben Klangräume. Der Titel ist ein Zitat aus Fernando Pessoas Fragment Das Buch der Unruhe des ­Hilfsbuchhalters Bernardo Soares. Vergleiche: G. F. Haas in einem universitären Kolloquium am 14.3.2007 am ­Konservatorium Privatuniversität Wien. G. F. Haas, Vorwort zur Partitur von «… Schatten … durch unausdenkliche Wälder» für zwei Schlagzeuge und zwei Klaviere (1992), Wien: UE 31453. Die Titelzitate stammen aus Hölderlins Roman Hyperion. G. F. Haas in einem Gespräch am 29.3.2005 in Graz. G. F. Haas, «Die Abbildung akustischer Phänomene als Material der kompositorischen Gestaltung», in: Ton 4/1996-1/1997, S. 26. G. F. Haas in einem Gespräch am 29.3.2005 in Graz. Ebenda. Ebenda. G. F. Haas, «Die Abbildung akustischer Phänomene», S. 26. G. F. Haas, «Fünf Thesen zur Mikrotonalität», in: Positionen 48 (2001), S. 43. Ebenda, S. 43. G. F. Haas, «Die Abbildung akustischer Phänomene», S. 25. G. F. Haas, «Die Utopie von Kompromisslosigkeit, Vergeblichkeit und Schönheit», in: Programmheft Klangspuren Schwaz 2005, S. 23. Ebenda, S. 24. G. F. Haas, «Anmerkungen zum Komponieren», S. 117. Vergleiche G. F. Haas, «Anmerkungen zum Komponieren», S. 114: «Ich versuche in meiner Musik mich als ganzen Menschen einzuhören und habe mich in quasi ­exhibitionistischer Weise bloßgestellt.» G. F. Haas, «Die Utopie von Kompromisslosigkeit», S. 27. 26 G. F. Haas, «Fünf Thesen zur Mikrotonalität», S. 44. Lisa Farthofer: «Im Klang denken». Eine Annäherung an die Klangwelt von Georg Friedrich Haas, in: Katalog Wien Modern 2007, hrsg. von Berno Odo Polzer und Thomas Schäfer, Saarbrücken: Pfau 2007, S. 19-23.