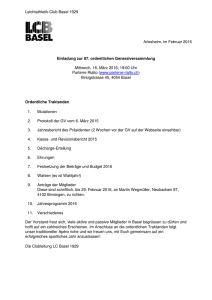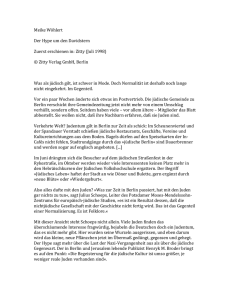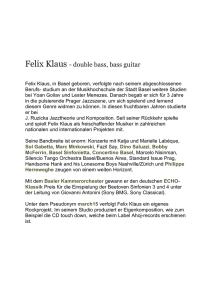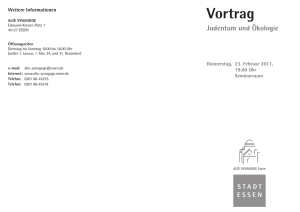Zukunft der jüdischen Gemeinde ist nicht rosig
Werbung

region. BaZ | Montag, 18. Oktober 2010 | Seite 24 Zukunft der jüdischen Gemeinde ist nicht rosig Nationales Forschungsprogramm stellt zunehmende Differenz zwischen Rabbinat und Gemeinde fest Kinder jüdisch sein sollen. Und traditionell jüdisch zu leben heisst unter anderem, einen koscheren Haushalt zu führen und den Ruhetag Sabbat einzuhalten. «Das Anforderungsprofil ist hoch», sagt Gerson. Konflikt Ehe. Immer weniger Gelebte Tradition. Orthodoxe Juden beim Einweihen einer neuen Thora für die Basler Synagoge im Jahr 2002. Foto Tino Briner CLAUDIA KOCHER Der Fortbestand kleinerer und mittlerer jüdischer Gemeinden sei gefährdet, sagt Historiker Daniel Gerson. Das organisierte jüdische Leben werde sich in Zukunft auf Genf und Zürich konzentrieren. Als die Methodistin Chelsea Clinton vor Kurzem ihren jüdischen Freund Marc Mezvinsky ehelichte, waren bei der Zeremonie ein Pfarrer sowie ein ReformRabbiner zugegen. In der Schweiz sei eine solche Kombination undenkbar, sagt Historiker Daniel Gerson vom Institut für Jüdische Studien der Universität Basel. Gerson hat zusammen mit Sabina Bossert, Madeleine Dreyfus, Leonardo Leupin, Valérie Rhein sowie Isabel Schlerkmann im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft» das Judentum in der Schweiz untersucht. Schweizweit gibt es ungefähr 18 000 Juden, rund 13 000 sind dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund verpflichtet. Rund 2000 Juden leben im Grossraum Basel. Antisemitis- mus sei heute nicht mehr das vorherrschende Thema, meint Gerson. «Er ist zwar nicht vollständig verschwunden.» Aber die Juden könnten heutzutage in allen gesellschaftlichen Bereichen Anteil nehmen und seien anerkannte Interessensvertreter gegenüber Behörden und Mehrheitsgesellschaften, schreibt Gerson in seinem Schlussbericht. Nach 1945 hätten Juden wie auch Nichtjuden vom stets grös­ ser werdenden persönlichen Freiraum profitiert. So ermöglichte ein Studium an der Universität immer mehr Jüdinnen und Juden vielschichtige Erfahrungen auch mit der nicht jüdischen Gesellschaft. «Das gab und gibt ihnen neue Perspektiven.» Die neuen Perspektiven führten unter anderem zu einer hohen Mischehenquote, die heute bei 50 Prozent liegt. In der jüdischen Tradition aber werden Kinder von Juden und nicht-jüdischen Frauen nicht automatisch jüdisch. Wenn jüdische Männer nicht-jüdische Frauen heiraten, muss die Frau zum Judentum übertreten, wenn die Juden seien bereit, sich den Bedingungen eines Rabbiners zu unterwerfen. «Viele Juden leben deshalb am Rande oder ausserhalb einer Gemeinde.» Die Leute in der Gemeinde seien zwar frei, nicht so wie die streng orthodoxen Juden, wo ein Rabbiner ganz über die Lebensform bestimme. «Aber bei der Eheschliessung kommt es dann zum Konflikt.» Die Israelitische Gemeinde in Basel weist laut Gerson einen starken Mitgliederverlust auf. Die Gemeinde hat heute noch rund 1300 Mitglieder. Natürlich gebe es dafür auch andere Gründe wie die Abwanderung nach Israel oder in die grössere Gemeinde nach Zürich (geschätzte 6000 Mitglieder). Das finanzielle Engagement, das für die Gemeinde geleistet werden müsse, sei beachtlich. Die Identifikation mit den Gemeindeinstitutionen wie dem Gemeindehaus oder dem Friedhof sei schwächer geworden. Gerson beobachtet eine zunehmende Differenz zwischen dem Rabbinat und der Gemeinde. Auch in Basel entstanden Reformbewegungen wie die Gemeinde Migwan oder die Ofek, wo fortschrittlichere Ansichten gepflegt und vor allem für die Frauen, die traditionell eher stiefmütterlich behandelt würden, interessant seien. Denn auch jüdische Frauen seien vermehrt an Gleichberechtigung interessiert. Diese reform-jüdischen Gemein- den würden sich stark um die Integration der nicht jüdischen Angehörigen bemühen. Dies sei vor allem bei Frauen der Fall, die bis 90 Prozent der erwachsenen Übertrittskandidaten ausmachten, so Gerson. Da in nicht-orthodoxen Gemeinden auch die Kinder von nicht-jüdischen Müttern relativ einfach ins Judentum aufgenommen werden, seien sie für viele Mischehefamilien eine attraktive Alternative. offene USA. Der Historiker stellt fest, dass in den USA auch auf Ehepaare aus Mischehen zugegangen werde. In der Isrealitischen Gemeinde Basel zeige sich der Gemeindevorstand zwar auch offen gegenüber solchen Ideen. Mittlerweile dürften auch Kinder aus Mischehen die jüdische Primarschule besuchen. «Wohl weil es ihnen sonst an genügend Kindern fehlen würde.» Doch liberale Ideen liessen sich hier nicht mit dem Rabbinat vereinbaren. «Der Rabbiner würde damit seine orthodoxe Glaubwürdigkeit verlieren.» Ein gleichberechtigtes Nebeneinander von orthodox und liberal sei in Basel nicht denkbar. Die Zukunft für die Juden in Basel sieht Gerson als nicht sehr rosig. Positiv sei immerhin: «Das jüdische und das nicht-jüdische sind nicht mehr so klar getrennt.» Der Fortbestand kleinerer und mittlerer jüdischer Gemeinden aber, sagt Gerson, sei gefährdet. Das organisierte jüdische Leben werde sich im Wesentlichen auf Genf und Zürich konzentrieren, so sein Fazit. Der Historiker glaubt nicht, dass ihn nun jüdische Gemeinden zu einem Vortrag einladen werden. «Über solche Probleme wird in der Öffentlichkeit nicht gerne geredet.» «Der jüdische Heiratsmarkt in Basel ist beschränkt» Rabbiner Yaron Nisenholz über die Gründe des Mitgliederschwunds in der Israelitschen Gemeinde Basel INTERVIEW: CLAUDIA KOCHER Seit zwei Jahren ist der 36-jährige Yaron Nisenholz Rabbiner der Israelitischen Gemeinde Basel. Die Studie von Daniel Gerson kannte er bis zum Interview mit der BaZ nur vom Hörensagen. BaZ: Herr Nisenholz, in seiner Studie kommt Daniel Gerson vom Institut für Jüdische Studien der Uni Basel zum Schluss, dass sich das organisierte jüdische Leben in Zukunft auf Genf und Zürich konzentrieren, Basel also keine Bedeutung mehr haben wird. Yaron Nisenholz: Die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) ist sehr aktiv, zum Beispiel mit dem Studentenverband und der Jugendarbeit. Auch haben wir viele religiöse und soziale Angebote im Programm, und es gibt in Basel zwei koschere Restaurants. Ich glaube nicht, dass die Gemeinde hier bald verschwinden wird. Wie viele Mitglieder haben Sie heute und wie viele hatten Sie vor zehn Jahren? Letztes Jahr hatten wir 1140 Steuerzahler. Dazu kommen noch rund 200 Kinder und Jugendliche. Im Jahr 2000 waren es 1271 zahlende Mitglieder. 1980 verzeichnete das Statistische Amt im Kanton Basel-Stadt 1780 Personen, die als Religion jüdisch angaben, letztes Jahr waren es in dieser Statistik noch 1195. Das ist doch ein rechter Schwund. Natürlich machen wir uns Sorgen über die Zukunft. Wir wissen noch nicht, wohin sie uns führen wird. Dank den Chemiekonzernen wie Roche oder Novartis hoffen wir, dass wieder mehr jüdische Leute nach Basel kommen. Relativ neu haben wir eingeführt, dass Zuzügler bei der IGB zwei Jahre gratis Mitglied sein können. Sie sind dann zwar nicht Vollmitglied und können nicht abstimmen. Doch nach den zwei Jahren können sie sich für eine Mitgliedschaft entscheiden ­oder nicht. tet, beobachte ich auch. Ich bin aber nicht einverstanden mit seinem Vorschlag, dass es in Basel keine Einheitsgemeinde mehr geben soll, sondern einen Dachverband. In den letzten zweihundert Jahren war in Basel die orthodox geführte Einheitsgemeinde ein erfolgreiches Modell. Vor allem, weil die meisten Gemeindemitglieder, wie die meisten Juden in Europa, sich eher mit der Orthodoxie identifizieren, auch wenn sie nicht die Regeln der Religion nach der Interpretation des orthodoxen Judentums praktizieren. Die Reformbewegung in Europa ist sehr klein. Sogar in den USA hat sie grosse Probleme. Vor allem Mischehen sollen die Fortführung der jüdischen Tradition gefährden. Wie geht die IGB damit um? Als eine orthodox geführte Einheitsgemeinde sind alle Juden in Basel herzlich willkommen und ebenso alle, die in Mischehen leben. Auch in der Synagoge? Ja. Bei uns in der Synagoge ist jeder Mensch willkommen, aber als eine jüdische Gemeinde ist es klar, dass wer bei uns Mitglied werden will, jüdisch sein muss. Wer bei uns konvertieren will, muss unter anderem orthodox leben – im Gegensatz zu Reformgemeinden. Das heisst, er muss sich zum Beispiel an das Koschergesetz oder den Sabbat halten. Mischehen sind aber nicht der einzige Grund, weshalb wir kaum neue Mitglieder gewinnen. Viele Jugendliche gehen nach der Schule weg, sei es wegen eines Jobs oder weil sie eine grössere Gemeinde suchen. Die Jungen wollen neue Gesichter sehen. Auch ist der jüdische Heiratsmarkt in Basel beschränkt. Schule in Not Melden sich viele Leute bei Ihnen, die zum Judentum konvertieren wollen? Nicht sehr viele. Wir haben ab und zu Übertritte von Leuten, die nicht-jüdisch sind und sich fürs Judentum interessieren. Leute, die in einer Mischehe leben, wollen weniger übertreten, da sie keine strengeren Regeln befolgen wollen. Sie versuchen also nicht, Personen aus Mischehen zu gewinnen? Natürlich versuchen wir, neue Mitglieder zu finden. So gibt es alle drei bis vier Monate einen Freunde-Anlass. Das ist ein rein sozialer Anlass für Juden zwischen 30 und 55 Jahren. Die Idee ist, näher zur Gemeinde zu rücken und für Leute gedacht, die sonst Für den Status quo. Rabbiner Yaron Nisenholz will das Modell der orthodox- geführten Einheitsgemeinde beibehalten. Foto Henry Muchenberger keinen grossen Kontakt zur Gemeinde haben. Wie viele Mitglieder der Gemeinde sind denn aktiv religiös? In Rahmen unserer orthodox geführten Einheitsgemeinde sind etwa 20 Prozent der Mitglieder praktizierende Juden. Der Rest, also etwa 80 Prozent, praktiziert das Judentum weniger. Da hat jeder seine Art und seinen Stil. Sie sagen, dass Sie nicht an ein Verschwinden der jüdischen Gemeinde glauben. Halten Sie Gersons Studie für übertrieben? Die Arbeit von Herrn Gerson finde ich gut. Den Ist-Zustand, den er beobach- Problem wegen Harmos. Die Israelitische Gemeinde (IGB) führt in Basel eine eigene Primarschule. Zurzeit werden dort 17 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Nun hat der ohnehin defizitäre Betrieb ein neues Problem, schreibt das jüdische Wochenmagazin «Tachles». Die Situation werde durch die im Kanton Basel-Stadt beschlossene Harmos-Reform verschärft, da die Primarschule neu sechs statt vier Jahre dauern wird. Der Unterhalt der Schule betrug bisher jährlich 490 000 Franken. Für Rabbiner Yaron Nisenholz ist klar, dass die jüdische Gemeinde eine Grundschule braucht. Aber: «Es ist eine grosse finanzielle Belastung.» Noch sei nicht klar, wie man die finanziellen Probleme lösen könne, aber an einer Lösung werde gearbeitet. cko