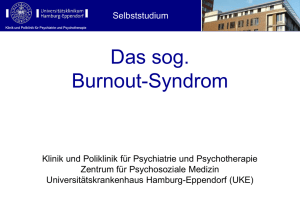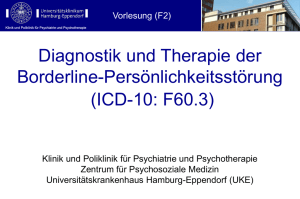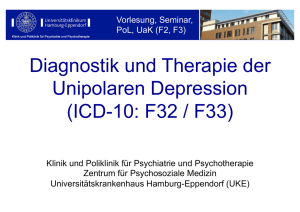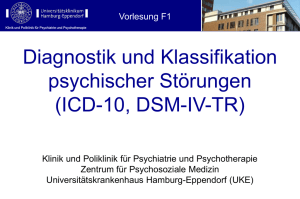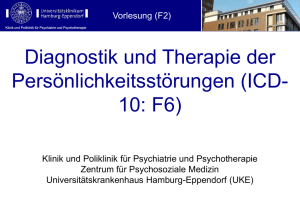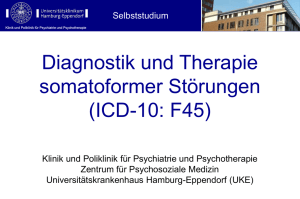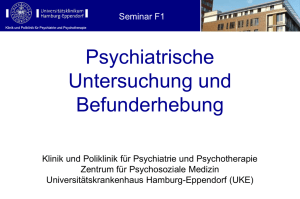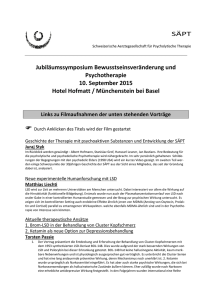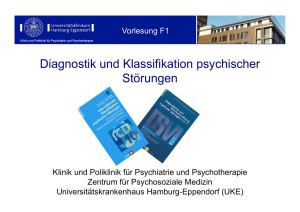Affektive Störungen - Universitätsklinikum Hamburg
Werbung

Vorlesung, Seminar, PoL, UaK (F2, F3) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Diagnostik und Therapie der Unipolaren Depression (ICD-10: F32 / F33) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Zentrum für Psychosoziale Medizin Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf (UKE) Vorlesung, Seminar, PoL, UaK (F2, F3) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Erstellung des Inhalts: Prof. Dr. Martin Lambert Lehrbeauftragter Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Zentrum Psychosoziale Medizin Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) Martinistr. 52, 20246 Hamburg Gebäude W37 Tel.: +49-40-7410-24041 Fax: +49-40-7410-52229 E-Mail: [email protected] Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Teil 1: Unipolare Depression Überblick Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Übersicht zum Krankheitsbild Grundlagen • • • • Epidemiologie Diagnostik: u.a. Symptomatik, Komorbidität, Entstehung Diagnostische Kriterien nach Leitlinien nach ICD-10 Differentialdiagnostik nach ICD-10 Therapie • Prävention / Früherkennung • Pharmakotherapie • Psychosoziale Therapie Verlauf und Prognose Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Übersicht zum Krankheitsbild Einteilung depressiver Störungen nach ICD-10 und DSM V Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie ICD-10 Affektive Störungen Manische Episoden (F30) Bipolare affektive Störungen (F31) Depressive Episode, rezidivierende depressive Episoden (F32, 33) Anhaltende affektive Störungen (F34) Zyklothymia (F34.0) DSM V Gemischte Episode (F38.0) Affektive Störungen Depressive Störungen Major Depression Dysthymia (F34.1) Sonstige affektive Störungen (F38) Dysthme Störung Bipolare Störungen Depressive Störung NNB Bipolar I Störung Bipolar II Störung Zyklothyme Störung Substanz-induzierte affektive Störungen Bipolare Störung NNB 1-Jahres-Prävalenz depressiver Störungen in Europa (2005 / 2011) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 40 30 38,3 1-Jahres-Prävalenz psychischer Erkrankungen 2005 1-Jahres-Prävalenz psychischer Erkrankungen 2011 27,4 Stabile 1-Jahres-Prävalenz von 6.9% 20 10 6,9 6,9 1,2 4,9 3,4 0,5 0,3 0,5 6,3 1 0,81,2 0,9 0,9 1,8 1,8 1,3 2 2,3 2,3 1,7 2,4 0,7 0,7 0,70,7 0,4 0,3 0,4 0,3 0,7 0,6 0,4 Al ko h G es am t De ol a b men O hä z pi ng oi da ig C ke an bh it na än Ps bi g ig sa yc ke bh ho it ä tis ng ch ig e ke St it M ör aj un or ge D Bi n e pr po e la ss re io St n ör un Pa ge ni n ks tö ru Ag ng G or en So a ph er al ob zia isi ie le er Ph te ob Sp Ang ie st ez s ifis tö ru ch ng e Ph Zw ob an ie n gs st So ör m un at g of or PT m e BS St ör un ge n An or ex ie Bu Bo lim rd ie er lin e Ve PS rh al te AD ns M HS en st ör ta un le g R et KJ ar di er un g 0 2,4 6,4 6,4 Wittchen et al. European Neuropsychopharmacology (2011) 21, 655–679 1 Betroffene mit depressiven Störungen in Europa (2005 / 2011) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 118,1 120 Betroffene in Millionen 2005 Betroffene in Millionen 2011 100 82,7 80 2005: 18.4 Millionen Betroffene 2011: 30.3 Millionen Betroffene 60 40 30,3 3,3 g rd ta Re le ta en ie r g un ör st ns lt e M ha Ve r un H AD de 4,2 2,1 KJ S PS 0,7 2,3 r li ne lim ie 1,2 Bu or 0,8 Bo r St ex ge n ie 1,2 An ör un PT B e or m of at So m 18,9 7,7 S g un ör st gs an Zw e ch if is Wittchen et al. European Neuropsychopharmacology (2011) 21, 655–679 20,4 2,7 2,9 ie n ob g Ph tö ts gs ez An Sp en er al ru n ob Ph is ie r te So zia le ap or 10,1 8,9 6,7 5,9 ie e bi ho ru tö Ag iks ng Pa n ru 4 ng en n sio St ö re la aj M re s ng ep St ö e D gi gk ch t is 8,8 7,9 G Ps yc ho na bi sa bh än än bh da an C ei t t ei it ig ng oi pi O gi gk ke z en m hä De Al k oh ol ab G es am t 0 2,4 3 5,3 Bi po 21 en 2 1,4 3,7 5 ru 14,6 6,3 7,2 or 20 22,7 18,5 18,4 Erkrankungen mit den meisten Lebensjahren mit Behinderung in Europa 2011 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Depression 4320400 2236514 Demenz 2039741 Alkohol Krankheit 1576838 Schlaganfall Drogen Krankheit 756548 Bipolare Störung 727841 Migräne 642677 Schizophrenie 637693 Insomnie 389753 Panikstörung 383783 Parkinson Krankheit 334446 Zwangsstörung 2011 rangierte die depressive Störung unter allen psychischen und neurologischen Erkrankungen auf Platz 1! 329684 Epilepsie 260424 PTBS 245475 Lebensjahre mit Behinderung bei psychischen und neurologischen Erkrankungen 172826 Multiple Sklerose 5393 Mentale Retardierung 0 1000000 2000000 Wittchen et al. European Neuropsychopharmacology (2011) 21, 655–679 3000000 4000000 5000000 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Grundlagen: Epidemiologie Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Übersicht zum Krankheitsbild der unipolaren Depression Krankheitsaspekt Wissen Lebenszeitprävalenz 16-26 % Punktprävalenz 5.6 % Geschlechterverhältnis w > m, ca. 2 : 1 Erkrankungsalter In jedem Lebensalter, 50 % vor 30. Lebensjahr nach 60. LJ Ersterkrankung selten Wichtige Komorbiditäten Angst- und Panikstörung 30–50 % Suchterkrankungen 30–60 % gehäuft: Essstörungen, somatoforme Störungen, Persönlichkeitsstörungen, Zwangserkrankungen Erblicher Faktor Verwandte von Patienten: Risiko 5-fach Leitlinien APA 2010, NICE 2004, S3-Leitlinie der DGPPN 2009 Quellenangaben: Voderholzer, U., Hohagen, F. Therapie psychischer Erkrankungen. Elsevier, 2013 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Grundlagen: Diagnostik: u.a. Symptomatik, Komorbidität, Risikofaktoren Depressive Episode (nach ICD-10) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Klassifizierung: 1) leicht (F32.0), mindestens 2 Haupt- und 2 Zusatzsymptome 2) mittel (F32.1), mindestens 2 Haupt- und 3-4 Zusatzsymptome 3) schwer; ohne/mit psychotischen Symptome (F32.2./F32.3) alle drei Haupt, und mind. 4 Zusatzsymptome, davon einige schwer Mindestdauer der Episode: etwa 2 Wochen Hauptsymptome Zusatzsymptome depressive Stimmung Interessenverlust, Freudlosigkeit Antriebsmangel, erhöhte Ermüdbarkeit verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen Gefühl von Schuld/Wertlosigkeit negative und pessimistische Zukunftsperspektiven Suizidgedanken und - handlungen Schlafstörungen verminderter Appetit Diagnostische Einteilung (nach ICD-10) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie ICD-10 Diagnostische Entität F32 Depressive Episode F32.0 Leichte depressive Episode F32.1 Mittelgradige depressive Episode F32.2 Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome F32.3 Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen F33 Rezidivierende depressive Störung (RDS) F33.0 RDS, gegenwärtig leichte Episode F33.1 RDS, gegenwärtig leichte Episode, gegenwärtig mittelgradige Episode RDS, gegenwärtig leichte Episode, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome RDS, gegenwärtig leichte Episode, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen F33.3 Symptomen F33.2 F34 Anhaltende affektive Störungen F34.0 Zyklothymia F34.1 Dysthymia Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Entstehungsmodell affektiver Störungen Genetische Belastung Ungünstige frühkindliche Erfahrungen Irritierbare, selbstunsichere Persönlichkeit Geringe Stressresistenz Geringe Bewältigungs-/ Problemlösefähigkeit Fehlendes soziales Netzwerk Akute und / oder chronisch psychosoziale Belastung „ gemeinsame Endstrecke“ Symptome einer affektiven Störung Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Therapie Therapieziele Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Depressive Episode Rezidivneigung Kurzfristig (Stunden bis Tage) Akute Linderung von Angst, Unruhe und Insomnie Verhinderung suizidaler Handlungen – Mittelfristig (Tage bis Wochen) Besserung von Stimmung, Antrieb und Denkvermögen Beseitigung psychosozialer Belastungsfaktoren – Längerfristig (Wochen bis Monate) Verhinderung eines raschen Rückfalls in der vulnerablen Zeit nach Remission (Erhaltungstherapie) Verhinderung von Chronifizierung und – Therapieresistenz Wiedererlangung von sozialer Kompetenz mit Reintegration in Familie, Beruf und Gesellschaft Langfristig (Jahre) – Verhinderung von Rezidiven und Chronifizierung Behandlungsphasen zunehmender Schweregrad der Erkrankung Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Euthymie Remission Rückfall Wiedererkrankung Rückfall Symptom Response Syndrom Behandlungsphasen Akut Erhaltung Prophylaxe (6–12 Wochen) (4–9 Monate) (1 Jahr) Zeit Nach Kupfer,1991 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Therapie: Pharmakotherapie Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Antidepressivaklassen mit dazugehörigen Beispielen Antidepressivaklassen Substanz (Handelsname, Beispiele) Klassische Antidepressiva Trizyklika Amitryptilin (Saroten®, Amineurin®), Nortryptilin (Nortrilen®), Doxepin (Aponal®), Imipramin (Tofranil®) Tretrazyklika Maprotilin (Ludiomil®) MAO-Hemmer (irreversiblel) Tranylcypromin (Jatrosom N®) MAO-Hemmer (reversiblel) Moboclemid (Aurorix®) Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI) Selektive Noradrenalin-WiederaufnahmeHemmer (SNRI) Duale selektive Serotonin- und NoradrenalinWiederaufnahme-Hemmer (SSNRI) Präsynaptische Alpha-2-Antagonisten mit 5HT2/5HT3-Antagonismus (NaSSA) Selektive Noradrenalin-DopaminWiederaufnahme-Hemmer (SNDRI) Fluoxetin (Fluctin®), Fluvoxamin (Fevarin®), Paroxetin (Seroxat®), Citalopram (Cipramil®), Sertralin (Zoloft®) Reboxetin (Edronax®) Venlafaxin (Trevilor®), Duloxetin (Cymbalta®) Mirtazapin (Remergil®) Bupropion (Elontril®) Trizyklische Antidepressiva Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Substanz Handelsname (Bsp.) NA 5-HT AcH Sedierung Amitryptilin Saroten® + ++ +++ ++ Trimipramin Stangyl® + (+) ++ ++ Doxepin Aponal® ++ + ++ ++ Nortriptylin Nortrilen® ++ (+) + - Clomipramin Anafranil® + +++ ++ - Imipramin Tofranil® ++ ++ ++ - Nebenwirkungen (UAW) und Behandlungsrichtlinien UAW: Mundtrockenheit, Obstipation, Akkomodationsstörungen, Müdigkeit, Schwindel, Orthostatische Dysregulation, Krampfanfälle, Blutbildschädigungen, Arrythmien, Gewichtszunahme, sexuelle Funktionsstörungen CAVE: Delir, Harnverhalt, Glaukomanfall Kontraindikationen beachten, Kontrolluntersuchungen! MAO-Hemmer Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Substanz Handelsname (Bsp.) NA 5-HT AcH Sedierung Tranylcypromin Parnate® +++ +++ ++ - Nebenwirkungen (UAW) und Behandlungsrichtlinien UAW: Unruhe, Hypotonie, Tremor, Schwindel, Palpitationen Tyraminarme Diät erforderlich CAVE: Hypertensive Krisen, Suizidalität (Antriebssteigerung), zentrales Serotoninsyndrom Lange Wirkdauer, Umstellungszeit Keine Kombination mit SSRI Substanz Handelsname (Bsp.) NA 5-HT AcH Sedierung Moclobemind Aurorix® ++ ++ + - Nebenwirkungen (UAW) und Behandlungsrichtlinien UAW: Übelkeit, Schlafstörungen Keine Diät erforderlich, keine hypertensiven Krisen, kurze Umstellungszeit Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI) Substanz Handelsname (Bsp.) NA 5-HT AcH Sedierung Fluoxetin Fluctin® - ++ - - Fluvoxamin Fevarin® - ++ - - Paroxetin Seroxat® - ++ - - Sertralin Zoloft® - +++ (+) - Citalopram Cipramil® - +++ - - Escitalopram Cipralex® - +++ - - Nebenwirkungen (UAW) und Behandlungsrichtlinien UAW: Unruhe, Agitiertheit, Schlafstörungen, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, sexuelle Funktionsstörungen CAVE: Suizidalität Auf Arzneimittelinteraktionen achten (CYP450) Neuere Antidepressiva Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie NA 5-HT AcH Substanz Handelsname (Bsp.) Venalfaxin Trevilor® ++ ++ Duloxetin Cymbalta® ++ ++ Nebenwirkungen (UAW) und Behandlungsrichtlinien UAW: Appetitlosigkeit, Übelkeit, Unruhe NA 5-HT AcH Substanz Handelsname (Bsp.) Mirtazapin Remergil® ++ ++ ++ Nebenwirkungen (UAW) und Behandlungsrichtlinien UAW: Müdigkeit, Benommenheit, Gewichtszunahme CAVE: Leukopenien NA 5-HT AcH Substanz Handelsname (Bsp.) Reboxetin Edronax® +++ (+) Nebenwirkungen (UAW) und Behandlungsrichtlinien UAW: Mundtrockenheit, Schwitzen, Hypotonie, Übelkeit, Kopfschmerzen CAVE: Harnverhalt NA 5-HT AcH Substanz Handelsname (Bsp.) Buproprion Elontril® +++ +++ Nebenwirkungen (UAW) und Behandlungsrichtlinien UAW: Leberfunktionsstörungen, Übelkeit, Kopfschmerzen, Krampfanfallsrisiko Sedierung - Sedierung ++ Sedierung - Sedierung - Anwendungsprinzipien Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Prinzipien Wirkmechanismen Durchführung Wirklatenz Kombination Nebenwirkungen Inhalt akut substanzabhängig: NA, 5-HT, DA, ...? chronisch: second messenger, ß-down-Regulation wichtig: ausreichende Dosis und ausreichende Dauer langsame Dosisänderungen auf Nebenwirkungsprofil achten Interaktionen beachten, Kontrolluntersuchungen! Fahrtüchtigkeit u.a. abhängig von Substanz Antidepressiva machen nicht abhängig fraglich, 7-28 Tage, auch Sofortwirkungen frühes Ansprechen prädiziert Response mit Psychotherapie, Stimmungsstabilisierer mit BZD oder Antipsychotikum möglich substanzabhängig, v.a. TZA (anticholinerge) substanzabhängiges Risiko für Manien (switch) Dosierungen (I) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Wirkstoff Initialdosis (mg/Tag) Standardtagesdosis (mg/Tag) Maximaldosis (mg/Tag) Amitriptylin 50 150 300 Amitriptylinoxid 60 180 300 Clomipramin 25 150 300 Doxepin 50 150 300 Imipramin 50 150 300 Nortriptylin 50 150 300 Trimipramin 50 150 300 Maprotilin 50 150 225 Mianserin 30 60 120 75 300 600 Trizyklische Antidepressiva Tetrazyklische Antidepressiva Chemisch andersartige Antidepressiva Trazodon Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) Citalopram 20 20 40 Escitalopram 10 10 20 Fluoxetin 20 20 80 Fluvoxamin 100 200 300 Paroxetin 20 20 40 Sertralin 50 100 200 Dosierungen (II) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Wirkstoff Initialdosis (mg/Tag) Standardtagesdosis (mg/Tag) Maximaldosis (mg/Tag) Selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SSNRI) Venlafaxin 75 150 375 Duloxetin 60 60 120 30 75 6 12 150 300 300 Moclobemid 150 300 600 Tranylcypromin 10 20 40 25 25 50 100 250 400 Noradrenerg spezifisch serotonerge Antidepressiva (NaSSA) Mirtazapin 15 Selektive Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI) Reboxetin 4 Selektive Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer (SNDRI) Bupropion Monoaminoxidasehemmer (MAO-Hemmer) Melatoninagonisten Agomelatin Atypische Antidepressiva Sulpirid Nebenwirkungsüberblick (I) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Generischer Name Übelkeit/ AntiSchlaflosigkeit/ Sexuelle Orthostatische Gewichts- Spezifische unerwünschte gastroSedation cholinergb Erregung Dysfunktion Hypotension zunahme Nebenwirkungen intestinal Agomelatin – + + + – – – Amitriptylin +++ – +++ – + +++ Bupropion + + – + – Citalopram – ++ – ++ Clomipramin +++ + + Doxepin +++ – Duloxetin – Escitalopram Letalität bei Überdosierung CYP1A2-Substrat gering +++ EKG-Veränderungenc; Senkung Krampfschwelle hoch – – kann die Krampfschwelle herabsetzen gering ++ – – QTC-Verlängerung > 40 mg/d gering + +++ ++ ++ EKG-Veränderungenc; Senkung Krampfschwelle mittel +++ – + +++ +++ ++ – ++ + – – – ++ – ++ ++ – – QTC-Verlängerung > 20 mg/d gering Fluoxetin – ++ – ++ ++ – – inhibitorische Wirkungen auf CYP2D6d gering Fluvoxamin – ++ + ++ ++ – – inhibitorische Wirkungen auf CYP1A2, CYP2C19d gering ++ – + ++ + ++ ++ EKG-Veränderungenc; Senkung Krampfschwelle hoch Imipramin hoch gering Kategorien der Stärke der Nebenwirkungen: +++ (hoch/stark), ++ (moderat), + (gering/schwach), – (sehr gering/keine) a die Nebenwirkungsprofile der Antidepressiva sind nicht vollständig und nur für einen groben Vergleich geeignet. Details zu den verwendeten Medikamenten, wichtige Warnhinweise und Wechselwirkungen sollten in einem Lehrbuch oder in Reviews (z. B. Kent 2000; Benkert und Hippius 2011), in der Originalliteratur, im Beipackzettel oder in der Roten Liste nachgelesen werden b diese beziehen sich auf Symptome, die gewöhnlich durch muskarinerge Rezeptorblockade ausgelöst werden, einschließlich Mundtrockenheit, Schwitzen, verschwommenes Sehen, Konstipation und Urinretention c Reizleitungsverzögerungen d Es werden nur die inhibitorischen Wirkungen auf hepatische CYP-450-Enzyme gezeigt, die klinisch relevant sind; für Details s. Brosen (1998) und Kent (2000) e Erhöhtes Risiko mit Nahrungsmitteln, die einen erhöhten Tyramingehalt haben, und mit Sympathikomimetika f in Kombination mit serotonergen Medikamenten Nebenwirkungsüberblick (II) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Generischer Name Übelkeit/ AntiSchlaflosigkeit/ Sexuelle Orthostatische Gewichts- Spezifische unerwünschte gastroSedation cholinergb Erregung Dysfunktion Hypotension zunahme Nebenwirkungen intestinal Letalität bei Überdosierung Maprotilin ++ – ++ – + ++ ++ erhöhtes Anfallsrisiko/Krampfrisiko hoch Mianserin + – ++ – – + + Blutdyskrasie (selten) gering Mirtazapin – – ++ – – + +++ Restless Legs gering Moclobemid + + – + – – – Nortriptylin + + + + + + EKG-Veränderungenc; Senkung Krampfschwelle hoch Paroxetin + ++ – ++ ++ – + inhibitorische Wirkungen auf CYP2D6d gering Reboxetin – + – ++ + ++ – gering Sertralin – ++ – ++ ++ – – gering Tranylcypromin + + + ++ + ++ + Hypertensive Krisee; Gefahr eines Serotonin-Syndromsf hoch Trazodon – + ++ – ++ + + Priapismus (selten) gering ++ – +++ – + ++ ++ EKG-Veränderungenc; Senkung Krampfschwelle hoch – ++ – ++ ++ – – Hypertension gering Trimipramin Venlafaxin gering Kategorien der Stärke der Nebenwirkungen: +++ (hoch/stark), ++ (moderat), + (gering/schwach), – (sehr gering/keine) a die Nebenwirkungsprofile der Antidepressiva sind nicht vollständig und nur für einen groben Vergleich geeignet. Details zu den verwendeten Medikamenten, wichtige Warnhinweise und Wechselwirkungen sollten in einem Lehrbuch oder in Reviews (z. B. Kent 2000; Benkert und Hippius 2011), in der Originalliteratur, im Beipackzettel oder in der Roten Liste nachgelesen werden b diese beziehen sich auf Symptome, die gewöhnlich durch muskarinerge Rezeptorblockade ausgelöst werden, einschließlich Mundtrockenheit, Schwitzen, verschwommenes Sehen, Konstipation und Urinretention c Reizleitungsverzögerungen d Es werden nur die inhibitorischen Wirkungen auf hepatische CYP-450-Enzyme gezeigt, die klinisch relevant sind; für Details s. Brosen (1998) und Kent (2000) e Erhöhtes Risiko mit Nahrungsmitteln, die einen erhöhten Tyramingehalt haben, und mit Sympathikomimetika f in Kombination mit serotonergen Medikamenten Ansprechraten von Antidepressiva Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Therapie: Psychosoziale Therapien Psychologische Therapien Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) nach Beck und Lewinsohn Interpersonelle Psychotherapie (IPT) nach Klerman und Weissman Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) nach McCullough Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie (MBCT) nach Segal Psychodynamische Kurz- und Langzeitansätze Gesprächspsychotherapie (GT) Psychoedukation Internetgestützte Psychotherapie Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) nach Beck und Lewinsohn Ziele: Veränderung von negativen kognitiven Schemata Identifikation automatischer Gedanken und grundlegender Einstellungen Kritische Auseinandersetzung damit “Sokratischer Dialog” Verhaltensexperimente Therapiemanuale (Beispiele): Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Interpersonelle Psychotherapie (IPT) nach Klerman und Weissman Ziele: Anfangsphase (1.-3. Sitzung) Psychoedukation und Symptommanagement Zuweisung der Krankenrolle Beziehungsanalyse und Identifikation eines Problembereiches Therapievertrag Mittlere Phase (4.-13. Sitzung) Problembereich „Rollenwechsel“ Problembereich „Konflikt“ Problembereich „Trauer“ Problembereich „Einsamkeit/Isolation“ Beendigungsphase(14.-18. Sitzung) Thematisieren des Therapieendes unter Berücksichtigung von Emotionen; Zusammenfassung des in der Therapie Erlernten und Ausblick auf die Zukunft Therapiemanuale (Beispiele): Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) nach McCullough Ziele: Therapeutische Techniken des CBASP sind die spezifische Situationsanalysen und daraus abgeleitete Verhaltenstrainings und interpersonelle Strategien zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung. Situationsanalyse lernen Patienten eine kausale Beziehung zwischen eigenen Verhaltens- und Denkmustern und den jeweiligen Konsequenzen herzustellen. Im Rahmen der interpersonellen Strategien wird eine auf die Bedürfnisse chronisch Depressiver adaptierte Rolle des Therapeuten realisiert. Patienten lernen zwischen vertrauten dysfunktionalen Beziehungsmustern und dem Verhalten des Therapeuten oder anderer Personen zu unterscheiden und negative Interaktionsmuster dadurch zu verändern Therapiemanuale (Beispiele): Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie (MBCT) nach Segal Ziele: MBCT wird in der Regel als Gruppentherapie mit maximal 12 Teilnehmern durchgeführt und umfasst (ebenso wie MBSR) acht Sitzungen, die in wöchentlichem Abstand durchgeführt werden. Es werden verschiedene achtsamkeitsbezogene Übungen (angelehnt an MBSR) eingeführt (z. B. Body-Scan, Atemmeditation, Achtsamkeitsmeditation, Gehmeditation, Yoga-Übungen). Parallel dazu werden klassisch kognitivverhaltenstherapeutische Interventionen durchgeführt (z. B. Psychoedukation zur Depression, Beobachtung von und Umgang mit automatischen Gedanken, Aufbau angenehmer Aktivitäten) Therapiemanuale (Beispiele): Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Psychodynamische Kurz- und Langzeitansätze Ziele: Berücksichtigung von Annahmen über unbewusste Prozesse, Abwehr, Widerstand und Übertragung/Gegenübertragung Drei Zielaspekte: Aktivität, dysfunktionale Kognitionen, ungünstige Affekt- und Beziehungsdispositionen Akute Depression: Aufbau einer Sicherheit gebenden Beziehung Aufklärung und Stützung Behandlung der Kernsymptome (Rückzug, Antrieb, Suizidalität) Nach Stabilisierung: Bearbeitung ungünstiger Beziehungsmuster (Idealisierung anderer, Selbstentwertung, daraus folgend Abhängigkeit) Bearbeitung ungünstiger Kognitionen Konkrete Problemlösung Langfristige Kompetenz- und Selbstwirksamkeitssteigerung Therapiemanuale (Beispiele): Psychoedukation bei Depression Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Ziele: Verbesserte Aufklärung und Wissen über die Erkrankung Emotionale Entlastung Unterstützung der Behandlung durch Förderung der Kooperation Verbesserter Umgang mit Stress Förderung der „Hilfe zur Selbsthilfe“ Verbessertes Wissen für Betroffene und Angehörige Therapiemanuale (Beispiele): Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Internetgestützte Psychotherapie bei Depression Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Teil 2: Unipolare chronische und therapieresistente Depressionen Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Epidemiologie der chronischen Depression Krankheitsaspekt Wissen Lebenszeitprävalenz 13–26 % für Depressionen insgesamt Ca. 30 % aller Depressionen verlaufen chronisch Punktprävalenz Ca. 30 % aller Depressionen verlaufen chronisch Geschlechterverhältnis 2 : 1 Frauen : Männer Erkrankungsalter Erstmanifestation meist vor dem 21. LJ, erste Symptome oft schon in der Kindheit Wichtige Komorbiditäten Angst- und Panikerkrankungen: 46 % Substanzmissbrauch und -abhängigkeit: ca. 30 % Persönlichkeitsstörung: mehr als 50 % Erblicher Faktor Für dysthyme Störungen konnte gezeigt werden, dass diese Erkrankungen häufiger bei Angehörigen 1. Grades von MajorDepression-Erkrankten auftreten als in der allgemeinen Bevölkerung Leitlinien APA 2007 NICE 2005 S-III Leitlinie der DGPPN: in Vorbereitung, evidenzbasierte Leitlinie im Auftrag der Fachgruppe Klinische Psychologie Quellenangaben: Voderholzer, U., Hohagen, F. Therapie psychischer Erkrankungen. Elsevier, 2013 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Epidemiologie der therapieresistenten Depression Krankheitsaspekt Wissen Lebenszeitprävalenz Keine verlässlichen epidemiologischen Zahlen1 Punktprävalenz Ca. 20 % aller Depressionen sprechen auf mindestens zwei Behandlungsversuche mit Antidepressiva nicht an (klinisch gängige Definition von Therapieresistenz); weitere 30 % dieser therapieresistenten Patienten sprechen auf einen dritten Behandlungsversuch an1 Geschlechterverhältnis 2,5–3 : 1 Frauen : Männer1 Erkrankungsalter Am häufigsten bei depressiven Patienten im mittleren Lebensalter1 Wichtige Komorbiditäten Angsterkrankungen, Substanzmissbrauch und -abhängigkeit, Persönlichkeitsstörungen1 Erblicher Faktor Keine verlässlichen epidemiologischen Zahlen1 Leitlinien APA 20072; evidenzbasierte Leitlinie der World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP)3 Quellenangaben: Voderholzer, U., Hohagen, F. Therapie psychischer Erkrankungen. Elsevier, 2013 Chronische Depressionen (I) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Affektive Störungen Manische Episoden (F30) Bipolare affektive Störungen (F31) Depressive Episode, rezidivierende depressive Episoden (F32,33) Sonstige affektive Störungen (F38) Anhaltende affektive Störungen (F34) Zyklothymia (F34.0) Dysthymia (F34.1) gemischte Episode (F38.0) Chronische Depressionen (II) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 1) Chronische major depressive Episoden (MDE mit einer Dauer von mehr als 2 Jahren) 2) Dysthyme Störung (leichter ausgeprägte Symptomatik für länger als 2 Jahre) 3) Zyklothymia 4) Double Depression (MDE auf eine dysthyme Störung aufgesetzt) und 5) MDE mit unvollständiger Remission. Dysthymia (nach ICD-10) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Klassifikation F34.1 Chronische depressive Verstimmung, nicht ausgeprägt genug, um die Kriterien einer rezidivierenden depressiven Störung zu erfüllen Meist monatelange Phasen depressiver Verstimmung, aber auch Tage bis Wochen mit normaler Stimmung Beginn meist früh im Erwachsenenleben, Dauer mindestens mehrere Jahre, manchmal lebenslang Zyklothymia (nach ICD-10) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Klassifizierung F 34.0 Anhaltende Stimmungsinstabilität mit nur gelegentlich normaler Stimmung Zahlreiche Perioden leichter Depression und leicht gehobener Stimmung, ohne die Kriterien für depressive oder manische Episoden zu erfüllen Beginn in der Regel im frühen Erwachsenenleben, chronischer Verlauf Psychotherapie und Pharmakotherapie Pharmakotherapie und Psychotherapie Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der chronischen Depression Bei chronischer Major Depression erwies sich nach der derzeitigen Datenlage eine Kombinationsbehandlung einer Psychotherapie und Medikation gegenüber einer alleinigen Behandlungsstrategie als signifikant überlegen Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP): Dabei handelt es sich um das einzige spezifisch für chronische Depression entwickelte Verfahren. Bei diesem Ansatz werden behaviorale, kognitive und interpersonelle Strategien integriert. Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Behandlungsstrategien bei Antidepressiva-Non-Respondern Es stehen verschiedene Behandlungsstrategien bei Teil- oder NonResponse auf einen adäquat durchgeführten ersten Versuch mit einem Antidepressivum zur Verfügung. Die Möglichkeiten sind: 1) Dosiserhöhung 2) Wechsel zu einem neuen Antidepressivum aus einer anderen pharmakologischen Klasse 3) Wechsel zu einem anderen Antidepressivum aus derselben Klasse 4) Kombination zweier Antidepressiva aus unterschiedlichen Klassen 5) Augmentation des Antidepressivums mit anderen Wirkstoffen (z. B. Lithium, Schilddrüsenhormon, Pindolol, Östrogen, Buspiron) um die antidepressive Wirkung zu verstärken und 6) Kombination des Antidepressivums mit einer psychotherapeutischen Intervention. Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Strategie Pharmakologische Augmentation Lithium Quetiapin Aripiprazol Olanzapin Risperidon Carbamazepin Valproat Lamotrigin Pindolol Buspiron Stimulanzien Bromocriptin Pergolid Reserpin Hormonelle Augmentation Triiodthyronin (T3) L-Thyroxin (L-T4) Östrogen (nur Frauen) Dehydroepiandrosteron (DHEA) Sonstige Ketoconazol, Metyrapon L-Tryptophan Nicht-pharmakologisch Elektrokrampftherapie (EKT) Repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS) Vagusnervstimulation (VNS) Pharmakologische Strategien bei chronischer / therapieresistenter Depression Mechanismus/Klassifizierung Evidenzlevel Stimmungsstabilisierer Atypisches Antipsychotikum Atypisches Antipsychotikum Atypisches Antipsychotikum Atypisches Antipsychotikum Antikonvulsivum/Stimmungsstabilisierer Antikonvulsivum/Stimmungsstabilisierer Antikonvulsivum/Stimmungsstabilisierer 5-HT1A-Autorezeptor-Antagonist, Beta-Rezeptor-Blocker 5-HT1A- und D2-Rezeptor-Agonist Dopamin- und Noradrenalin-Ausschüttungs- und Wiederaufnahmehemmung Dopamin(D2)-Agonist Dopamin(D1/D2)-Agonist Wiederaufnahmehemmung der biogenen Amine A A A B B C C D C C C C C C Schilddrüsenhormon Schilddrüsenhormon Ovariales Steroidhormon Adrenales androgenes Hormon B C C C Periphere Cortisolsuppression Essenzielle Aminosäure, 5-HT-Vorläufer C C Elektrische Stimulation um einen generalisierten Krampfanfall auszulösen Nicht-invasive Stimulation des zerebralen Kortex Autonome Signale zu limbischen und kortikalen Arealen A B C Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Alternative Behandlungen bei chronischen Depressionen Alternative Behandlung bei Non-Respondern (40%-55%) 1) Algorithmusgestüzte Behandlung 2) Weitere medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten Additive Gabe von Antipsychotika bei psychotischer Depression Additive Gabe von Tranquilizern/Anxiolytika 3) Hirnstimulationsverfahren Elektrokrampftherapie (EKT) Repetitive Transkranielle Magnetstimulation (rTMS) Vagusnervstimulation (VNS) Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Bei Fragen bitte unter: http://www.uke.de/kliniken/psychiatrie/index_2512.php