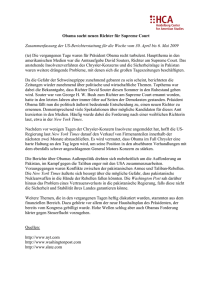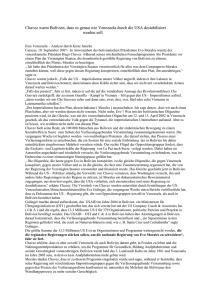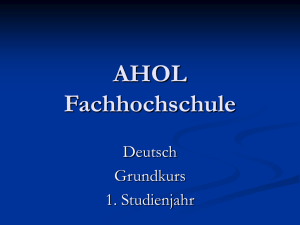Inhalt - Weißensee Verlag
Werbung

Katharina Friederike Gallant Evo Morales und Barack Obama zwischen Kulturdialog und Kulturkonflikt Brücken der Interkulturalität in Abya Yala und America Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar. Als Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie im Fachbereich Historische Ethnologie der Johann-WolfgangGoethe-Universität zu Frankfurt am Main vorgelegt 2013 unter dem Titel „Brücken der Interkulturalität in Abya Yala und America: Evo Morales und Barack Obama zwischen Kulturdialog und Kulturkonflikt“ von Katharina Friederike Gallant aus Landau an der Isar. 1. Gutachterin: Frau Prof. Dr. Iris Gareis 2. Gutachter: Herr Prof. Dr. Thomas Hauschild Tag der mündlichen Prüfung: 4. Dezember 2013 © 2014 Weißensee Verlag, Berlin www.weissensee-verlag.de [email protected] Alle Rechte vorbehalten Umschlag: Weißensee Verlag Umschlagbild: © Creative Commons Attribution 4.0 International Morales: Roberto Stuckert Filho/PR, abzurufen unter https://www.flickr.com/photos/ dilma-rousseff/6539408977/ mit der Lizenz Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Obama: Pete Souza, abzurufen unter http://change.gov/newsroom/entry/new_official _portrait_released/ mit der Lizenz Creative Commons Attribution 2.0. Karte: Nicolas Raymond, abzurufen unter http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_ grunge_map__sepia_p1729.html mit der Lizenz Creative Commons Attribution 3.0 Unported. Die Bilder wurden zur Verwendung bearbeitet. Satz: Sascha Krenzin für den Weißensee Verlag Gesetzt aus der Aptifer Slab LT Pro Gedruckt auf holz- und säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Printed in Germany ISSN 1610-6768 ISBN 978-3-89998-224-4 Berliner Beiträge zur Ethnologie Band 34 Inhalt Danksagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.1 Theoretische Verortung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.2 Konzeption von Kultur und Interkulturalität .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.3 Begriffsverständnis von Ethnizität und Kulturalität . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2Methodik.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.1Forschungszeitraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Literaturüberblick und Forschungsstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Zu Evos Bolivien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Zu Obamas USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Zur Umsetzung der Interkulturalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3Forschungsumstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Allgemeine Hinweise .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 37 38 44 49 51 53 3 Restauration der Chakana in Abya Yala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.1 Historische und biographische Kontextualität von Evos Kulturbezug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.1.1 Historische Apriori der Ära Morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.1.2 Evos Biographie im diskursiven Kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3.2 Die Ära Morales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.2.1 Der Kulturbezug in den Ansprachen des Präsidenten . . . . . . . . . 104 3.2.2 Feindbilder im ethnisch-kulturellen Diskurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 3.2.3 Evos implizit-symbolische Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 3.3 Evos andine Chakana .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 3.3.1 Das Konzept der interkulturellen Chakana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 3.3.2 Patriotismus und Universalismus in Evos ethnisch-­ kulturellem Diskurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 3.3.3Feuerprobe TIPNIS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 3.4 Fazit: Der Cambio der Ära Morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 4 American Dream Revisited.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 4.1 Historische und biographische Kontextualität von Obamas Kulturbezug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 4.1.1 Historische Apriori der Ära Obama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 10 4.1.2 Obamas Biographie im diskursiven Kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 4.2 Die Ära Obama .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Der Kulturbezug in den Ansprachen des Präsidenten . . . . . . . . . 4.2.2 Feindbilder im ethnisch-kulturellen Diskurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Obamas implizit-symbolische Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 279 326 334 4.3Obamas American Dream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 4.3.1 Das Konzept des interkulturellen American Dream . . . . . . . . . . . . . 361 4.3.2 Patriotismus und Universalismus in Obamas ethnisch-­ kulturellem Diskurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 4.4 Fazit: Der Change der Ära Obama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 5 Ausblick zur Umsetzung der Interkulturalität. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 5.1 Zur Begegnung von Bolivien und den USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Historische und persönliche Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2 Evos und Obamas tatsächliche Begegnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.3 Evo und Obama im interkulturellen Dialog? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Zur gegenwärtigen Bedeutung der Kulturalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 „Nebenwirkungen“ der Globalisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.2 Auswirkungen der Globalisierung auf die kulturelle Identität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.3 Clash of Civilizations als Resultat von Ethnizität und ­Kulturalität? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Auf dem Weg zur interkulturellen Gerechtigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1 Hermeneutische Überlegungen zur Ausgangslage . . . . . . . . . . . . . 5.3.2 Das Problem der Kontextualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.3 Die interkulturelle Lösung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 408 415 423 429 430 436 444 453 454 459 465 6Schlussbetrachtung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 7Epilog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 8 Literaturverzeichnis und Quellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 9Anhang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Glossar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Abkürzungsverzeichnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 11 Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas.1 (Constitución de Bolivia, 2009, Preámbulo) We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. (Declaration of Independence, 1776) 1Einleitung Am 20. Oktober 2008, dem 460. Jahrestag der Gründung von La Paz, der funktionellen Hauptstadt Boliviens, befand sich die Stadt im Ausnahmezustand: Es war zu beobachten, wie zehntausende Indígenas ‚Indigene‘ in ihren traditionellen Ponchos und Polleras ,Röcken‘, mit ihren Q’epis ‚Stoffbündeln‘ und Chicotes ‚Peit­schen‘, die Hauptverkehrsadern entlangzogen. Aus allen vier verschiedenen Him­mels­rich­tungen kommend waren viele von ihnen seit Tagen unterwegs, hatten ihre Familien, Häuser, Felder, Tiere und Arbeitsstellen verlassen, um an diesem histo­rischen Datum ihren Einzug zu halten auf dem Plaza Murillo, dem Zentrum der politischen Macht. Dort befinden sich sowohl der Regierungspalast als auch das Kongressgebäude und hier wollten die Demonstranten durchsetzen, dass per Volksabstimmung über die Annahme der neuen Staatsverfassung entschieden wird. Der Marsch der indigenen Bevölkerung war beeindruckend: Die Demonstranten zogen friedlich schreitend in Reih und Glied die Straße hinauf. Nur einmal, als der Zug etwa zwanzig Minuten lang zum Stillstand kam, schien sich die Stimmung zu verändern und ein paar Unmutsrufe über „Yankees“ waren zu hören. Dann wurde es wieder still. Einige Indígenas setzten sich an den Straßenrand. Die Erschöpfung durch das mehrtägige Laufen war ihnen anzusehen. Doch sobald sich der Marsch erneut in Bewegung setzte, erhoben sie sich ohne Zögern. Als sich ihr Abstand zur voran­ge­hen­den Abtei1 „Wir, die wir diese heilige Mutter Erde bevölkern, tragen verschiedene Gesichtszüge und begreifen von nun an die Vielfalt aller Dinge und unsere eigene Diversität als Lebewesen und Kulturen als rechtmäßig“ (e. Ü.). 13 lung vergrößerte, begann eine Gruppe Frauen zu joggen, um an der steilen Straße nicht den Anschluss zu verlieren. Weder das fortgeschrittene Alter einiger von ihnen noch ihre dicken Röcke oder die Stoffbündel, in denen sie (fast wörtlich) „Kind und Kegel“ auf dem Rücken trugen, konnten sie stoppen. Als die Demonstranten schließlich die südöstliche Hauptverkehrsader von La Paz passiert hatten und sie nur noch wenige Kilometer von ihrem Ziel trennten, setzten sich Autos, Busse und Taxis im Stadtteil Sopocachi langsam wieder in Bewegung. Das Straßenbild normalisierte sich – und doch war klar: dieser zurückkehrende Alltag war Ausdruck einer neuen Normalität. In friedlicher Basisdemokratie waren die jahrhun­derte­lang marginalisierten Bevölkerungsgruppen – die Indígenas, die Bauern, die Minenarbeiter und die Cocabauern – zum geographischen Zentrum der Macht vorgedrungen, um hier auf ihr politisches Mitbestimmungsrecht aufmerksam zu machen. Tatsächlich konnten sie ihr Ziel erreichen: Am 25. Januar 2009 wurde die neue Verfassung im Volksentscheid mit einer Mehrheit von 61,4 % der Stimmen angenommen. Laut Juan Evo Morales Ayma (Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, MAS-IPSP ), der seit 2006 das Amt des ersten indigenen Präsidenten Boliviens innehat, ruht auf dieser neuen Carta Magna die Hoffnung, dass sie die Ära der Diskriminierung und des Rassismus im Andenstaat beenden werde (20. 10. 2008; 22. 01. 2009 b). Im November 2005, einen Monat bevor Morales ins Präsidentenamt gewählt wird, erscheint auf der nördlichen Halbkugel des amerikanischen Doppelkontinents ein Artikel des damaligen demokratischen US-Senators Barack Hussein Obama II. mit dem Titel „The Political Movement in Black America“. Hierin lässt der heutige Präsident der Vereinigten Staaten das Leben der Afroamerikanerin Marguerite Lewis Revue passieren. Als Obamas Artikel veröffentlich wird, ist diese 105 Jahre alt, und in ihrer Lebensgeschichte spiegeln sich die historischen Meilensteine einer Ära wider, die vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis ins beginnende 20. Jahrhundert hinein­reicht. Lynchmorde an Afroamerikanern seien alltäglich gewesen zu der Zeit, in der Lewis auf­wuchs, und das Wahlrecht sei ihr allein aufgrund ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts versagt gewesen, schildert der Präsident. Auch nach den beiden Welt­kriegen hätten Rassismus und Diskriminierung fortbestanden – im markanten Widerspruch zu den Versprechungen von Freiheit und Gleichheit, auf denen die geradezu magische Anziehungskraft der USA für Immigranten bis heute basiere. Erst in den 1960er Jahren habe sich die gesellschaftliche Wirklichkeit zu ändern begonnen und eine Erweiterung des 14 Handlungsspielraums der afroamerikanischen Bevölkerung zugelassen. Jetzt habe auch Marguerite Lewis von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und dadurch, so ihre feste Überzeugung, Einfluss auf den Kurs der Vereinigten Staaten nehmen können (Obama, 2005, S. 120). Obamas Artikel berichtet nicht von einem revolutionären Demonstrations­ zug, der – vergleichbar dem bolivianischen Kontext – die F ­ undamente der Nation verändern oder gar neuschreiben könnte. Nichtsdestoweniger erklärt er das Leben von Marguerite Lewis zum Zeichen der Hoffnung, das richtungsweisend für die Zukunft sei: „[I]f she could persevere over the span of three centuries, always reaching toward a more just future; if she could do all of this, then we can walk toward the next 60 years of ­African-Americans in politics with an unbridled hope in what we can achieve“ (2005, S. 120 f.). Nur drei Jahre später wird Barack Obama zum ersten afro­amerikanischen Präsidenten der USA gewählt und findet sich damit in einer Rolle wieder, in der er selbst die (afro-) amerikanische Politik maßgeblich beeinflussen kann. Bereits im Wahlkampf fiel Obama aufgrund seines Talentes auf, Menschen verschiedener Hintergründe zusammenbringen zu können. „Barack, 46, has changed American politics … It’s the variety of the crowd that is the real phenomenon … Every race, religion and creed. Every political party and no party at all“ (Patrick, 2008), ist in dem US-Nachrichtenmagazin Time zu lesen, als dieses Obama zur dritteinflussreichsten Person des Jahres 2008 kürt2 – direkt hinter dem Dalai Lama und Wladimir Putin. – Tatsächlich sind auf der Liste der Einflussreichen des Jahres 2008 die verschiedensten Persönlichkeiten des öffentlichen Interesses versammelt. Unter den „Top 20“ ist auch Evo Morales zu finden, der in der Rangfolge den 18. Platz erreichte. Ihn zeichne aus, dass er sogar in Zeiten steigender Preise darum bemüht sei, Bolivien als Sozialstaat aufzubauen. Weiter heißt es: „Morales, 48, has resisted the temptations of his high position in favor of a low-key manner that includes an appreciation of simple food – a meat-and-potatoes man … – and a taste for wearing his favorite old sweaters����������������������������� “ (Stiglitz, 2008). Abschließend hält ihm der Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Joseph 2 Obama war auch 2005 (Platz 4), 2007 (Platz 38), 2009 (Platz 20), 2010 (Platz 4), 2011 (Platz 86) und 2012 (Platz 61) in der Time-Liste der 100 einflussreichsten Personen vertreten (Bacon, 2005; Brown, 2009; J. Klein 2007; 2012; D. M. Kennedy, 2011; Remnick, 2010). 15 E. Steglitz noch zugute: „[H]is �������������������������������������������� presence in the presidential palace will inspire indigenous people throughout Latin America“ (Stiglitz, 2008). Wenn auch die Time-Nominationen hinsichtlich des illustren Charakters der resultierenden Runde und des uneinheitlichen Argumentationsstils der Laudationes von zweifelhafter Validität sind, so ist es doch beachtenswert, dass zu den aufgeführten Einflussreichen sowohl Morales – oder „Evo“ wie er in Bolivien meist genannt wird3 – gezählt wird als auch der Hoffnungsträger der US-Demokraten Barack Obama. Hier kommen die Wirklichkeiten der beiden Politiker zueinander und erlauben einen ersten Blick auf das Phänomen des ethnisch-kulturellen Wandels, der sich an der politischen Spitze von Bolivien und den USA vollzieht. Zugleich ist bereits die Weise, in der die beiden Politiker präsentiert werden, bezeichnend für die unterschiedliche Bekanntheit und Reputation, die Morales und Obama als Repräsentanten zweier sehr unterschiedlicher Länder seitens der Weltgemeinschaft zuteilwird. Der eine wird von einem Parteikollegen hoch gelobt, da er die US-Politik nachhaltig verändert habe – wohl gemerkt zu einem Zeitpunkt, als Obama noch nicht einmal zum Präsidentschaftskandidaten gekürt worden ist. Der andere hat bereits seit über zwei Jahren das Präsidentenamt inne und wird – von einem Nobelpreisträger – vorgestellt als einfacher Mann mit ebenso einfachen kulinarischen Vorlieben und einem einfachen Kleidungsstil. Obama ist „ein großer Mann“, noch bevor er sich durch ein weltbewegendes Verdienst hervortun kann; Morales dagegen entstammt einer Wirklichkeit, aufgrund derer er sogar als Präsident noch als „kleiner Mann“ aus einfachen Verhältnissen präsentiert wird. Gemein ist den beiden Staatsmännern jedoch, dass ungeachtet aller Unterschiede zwischen Morales in Bolivien und Obama in den USA ihr Verhältnis zur ethnisch-kulturellen Landschaft ihres Landes Erwähnung findet. Besagte Time-Kurzporträts unterstreichen die Notwendigkeit eines bewussteren und respektvolleren Umgangs mit „dem kulturell Fremden“ (Kohl, 2012, S. 26) – und damit mit dem klassischen Gegenstand der Ethnologie –, um zu einer kontextsensitiveren und doch über ethnisch-kulturelle Grenzen hinweg vergleichbaren Vorstellung des Anderen und seiner Wirklichkeit zu gelangen. Wenn sich auch die Wirklichkeiten Boliviens und der USA , etwa im Hinblick auf ihr ökonomisches und politisches Gewicht im 3 Diese Eigentümlichkeit wird im Folgenden aufgegriffen, um die kontextuelle Gebundenheit der Ära Morales möglichst unverzerrt wiederzugeben (s. Kap. 2.3). 16 internationalen Miteinander, sichtlich unterscheiden, so sind gleichzeitig doch auch Gemeinsamkeiten auszumachen: Beide Länder zeichnen sich nicht zuletzt aufgrund ihrer Kolonialisierung durch die Europäer durch eine hohe ethnisch-kulturelle Diversität ihrer Gesellschaften aus – und sehen sich nach wie vor mit einem ausgeprägten Rassismus konfrontiert (v. Vacano, 2012, S. 162). Gleichzeitig werden Bolivien und die USA derzeit jedoch von Präsidenten regiert, deren ethnisch-kultureller Hintergrund sie von der Gruppe ihrer Amtsvorgänger unterscheidet. Beide Aspekte – die Verschiedenheit und die Ähnlichkeit der Hintergründe von Morales und Obama – sind aufschlussreich hinsichtlich der Bedeutung der ethnisch-kul­tu­rellen Identität und des interkulturellen Miteinanders zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts und verlangen eine eingehende Beschäftigung mit dem Bolivien der Ära Morales und den Vereinigten Staaten der Ära Obama. Hierzu ist es notwendig, den Wirklichkeiten der einzelnen Länder und den Diskursen ihrer Präsidenten, insbesondere hinsichtlich deren ethnisch-kultureller Verortung und der Konstruktion der nationalen Identität, Gehör zu schenken. In der Epoche der weltweiten Vernetzung von Zeit und Raum ist es aber auch erforderlich, die traditionell gewachsene Kluft zwischen reichem Norden und armem Süden – zwischen reichem und mächtigem Industrieland mit dem dritthöchsten Human Development Index (HDI) und einem der ärmsten lateinamerikanischen Länder, das den 108. Platz des HDI-Rankings belegt (PNUD, 2013, S. 143), – zu überbrücken und Bolivien und die USA zum Gegenstand einer gemeinsamen Untersuchung zu machen. Dies bedeutet, die bolivianische und die US-amerikanische ­Wirklichkeit zueinander in Beziehung zu setzen und die Möglichkeiten und Hindernisse eines interkulturellen Dialogs von Präsident Morales und Präsident Obama zu analysieren. Forschungsleitend ist dabei die Frage, wie sich der ethnisch-kulturelle Hintergrund von Morales und Obama in ihrem jeweiligen Diskurs niederschlägt und auf die diskursive Konstruktion eines interkulturellen Miteinanders auswirkt. Verbunden ist diese Fragestellung mit dem übergeordneten Erkenntnisinteresse, zu einem tieferen Verständnis der ethnisch-kulturellen Identität und ihrer Bedeutung für die Begegnung mit dem kulturell Anderen zu gelangen. Dementsprechend ist über die unmittelbare Problemstellung hinausgehend auch auf erste Anhaltspunkte für ein umfassenderes diskursives Regelwerk zu achten, in dem sich Grundprinzipien des gegenwärtigen ethnisch-kulturellen Wandels und seines Bezuges zur konstruktiven und ebenbürtigen Kulturbegegnung – im Sinne des philosophischen Konzeptes der Interkulturalität – offen­baren sollten. 17 2Methodik Im Zentrum dieser Arbeit stehen das Bolivien der Ära Morales sowie die Vereinigten Staaten der Ära Obama in Anbetracht des Phänomens, dass beide Präsidenten gewissermaßen als erste „ihrer Art“ in die Geschichte ihres jeweiligen Landes eingehen. Inwiefern sich ihr ethnisch-kultureller Hintergrund in ihrem jeweiligen Diskurs niederschlägt und auf die diskursive Konstruktion eines interkulturellen Miteinanders auswirkt, wird anhand von zwei Fallstudien untersucht. Dabei werden die Ausführungen zu Bolivien respektive zu den USA nicht als vollkommen getrennte Untersuchungen behandelt, sondern in der Fallstudie zur Ära Obama werden an einigen Stellen Bezüge zur vorher analysierten Ära Morales hergestellt. Dieses Vorgehen scheint indiziert, da ein wirklicher Vergleich des bolivianischen und des US-amerikanischen Kontextes jenseits einer Analyse des bolivianisch-US-amerikanischen Verhältnisses nicht vorgesehen ist: Zu unterschiedlich sind die Wirklichkeiten der beiden Länder sowohl hinsichtlich der Rolle, die sie in der internationalen Gemeinschaft einnehmen, als auch im Hinblick auf die demographischen Kenndaten ihrer jeweiligen Bevölkerung. Hierdurch würde ein Vergleich den Analyseschwerpunkt verschieben auf die Gegenüberstellung der Wirklichkeiten von Bolivien und den USA, anstatt ausgehend von den Diskursen ihrer Präsidenten einen allgemeineren Ausblick zur Bedeutung der ethnisch-kulturellen Identität und zur Umsetzung der Interkulturalität zu geben. Insofern sind die Ausführungen zum Bolivien der Ära Morales und zu den USA der Ära Obama zwar grundsätzlich als weitgehend parallele Fallstudien angelegt (Kap. 3 und Kap. 4); zugleich sind sie jedoch vor dem Hintergrund dieses übergeordneten Erkenntnisinteresses zu verstehen (Kap. 5). Von besonderem Interesse sind bei beiden Fallstudien die Ansprachen der Präsidenten, die als wertvolle Quellen und Kernstücke des Diskurses Auskunft geben über die Konstruktion der nationalen ethnisch-kulturellen Identität und ihrer Möglichkeiten für die Implementierung eines interkulturellen Dialogs auf nationaler und internationaler Ebene. Zur Analyse dieser Ansprachen stützt sich vorliegende Untersuchung auf ein intensives Literaturstudium, wobei der Schwerpunkt auf landeseigener kritischer Literatur aus Bolivien und den USA liegt, um im Sinne einer methodischen Interkulturalität den Ländern selbst eine Stimme zu geben. Darüber hinaus beruht die folgende Analyse auf Daten, die während eines insgesamt 21-monatigen Auslandsaufenthalts in Bolivien und den USA erho- 33 ben wurden. Hierzu zählen Erkenntnisse aus eigener (teilnehmender) Beobachtung, aus informellen Gesprächen, aus 18 im Durchschnitt ca. 75-minütigen Leitfadeninterviews mit Experten des ethnisch-kulturellen und politischen Diskurses in Bolivien respektive den USA (s. Anhang A) sowie aus der Teilnahme an zwei Fokusgruppen und mehreren Konferenzen. Somit greift die vorliegende Untersuchung auf die gängigen Methoden des qualitativen Paradigmas zurück und verfolgt ein exploratives Vorgehen. Dass aufgrund dieser Methodik Einschränkungen bezüglich der Generalisierbarkeit der Ergebnisse hingenommen werden müssen, versteht sich von selbst. Im Hinblick auf das zentrale Thema der Interkulturalität erscheint jedoch ein qualitatives Vorgehen indiziert, um das Phänomen des jeweiligen Diskurses in seinen Eigenarten möglichst umfassend abbilden und reflektieren zu können. 2.1Forschungszeitraum Die Auseinandersetzung mit dem Thema des interkulturellen Dialogs in Bolivien und den USA erstreckte sich von der Konzipierung der Untersuchung im Juli 2009 bis zu ihrer Fertigstellung im Juni 2013. Die wissenschaftliche Arbeit begann also gut drei Jahre nach der Inauguration von Evo Morales bzw. wenige Monate nach dem Beginn von Barack Obamas Präsidentschaft. Im bolivianischen Kontext ergab sich eine Schwerpunktsetzung auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis zum 1. Oktober 2010: Auf diese Zeit entfallen ein sechsmonatiger Bolivienaufenthalt, der eine erste Sichtung des Feldes ermöglichte und anschließend zur Formulierung der Forschungsfrage dieser Arbeit führte, sowie ein zwölf­monatiger Aufenthalt im Andenland, der auf die Beantwortung eben dieser Frage abzielte. Beide Auslandsaufenthalte konzentrierten sich in räumlicher Hinsicht auf die funktionale Hauptstadt La Paz, LPZ; es wurden aber auch andere Landesteile besucht, insbe­sondere die Provinz Ingavi, LPZ. Grundlegend für diese Entscheidung war die Annahme, dass sich in unmittelbarer Nähe zum Regierungssitz die Wirkung von Evo Morales am stärksten manifestieren würde. Schließlich ließen sich hier sowohl öffentliche Auftritte des Präsidenten beobachten als auch die politische Atmosphäre erfassen, wenn etwa der Präsidentenpalast zum „Anlaufpunkt“ eines (überregionalen) Demonstrationszuges wurde. Die unmittelbare Nähe zum Palast ermöglichte auch, dass die in der Nachbarschaft ansässige bolivianische Nachrichtenagentur Agencia Boliviana de Información (ABI) der Verfasserin sämtliche An- 34 sprachen von Morales zur Verfügung stellte, die er zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 1. Oktober 2010 hielt. Insgesamt lagen 1.252 Ansprachen des bolivianischen Präsidenten zur Auswertung vor, darunter auch einige ausgewählte Reden aus den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit.11 Während die zeitliche Eingrenzung nicht zuletzt aus pragmatischen Gründen resultierte, ist festzuhalten, dass in den genannten Zeitraum tatsächlich eine Reihe von Ereignissen fiel, die überaus wichtig für den ethnischkulturellen (Dis-) Kurs von Morales und sein Bolivien werden sollten. Zu nennen sind u. a.: der Einzug Zehntausender Bolivianer mehrheitlich indigener Herkunft in La Paz, LPZ, am 20. Oktober 2008, um eine Volksabstim­ mung über die neue Staatsverfassung durchzusetzen (s. Kap. 1); die Ratifi­ zierung der neuen Verfassung am 25. Januar 2009 per ­Volksentscheid; die vorgezogenen Präsidentschaftswahlen, bei denen Morales am 6. Dezem­ber 2009 ein triumphales Ergebnis von 62,5 % erzielte (La Razón, 07.12.2009a); die hochsymbolische rituelle Amtseinführung des Präsidenten am 21. Januar 2010 (einen Tag vor dem offiziellen Beginn seiner zweiten Amtszeit) auf dem Gelände der präinkaischen Ruinenstätte von Tiahuanacu, LPZ; die institutionelle Inauguration am darauffolgenden Tag; sowie die Bürgermeister- und Gouverneurswahlen am 4. April 2010, bei denen der Präsident weit hinter seinem gewünschten Ergebnis zurückblieb (La Razón, 2010). Des Weiteren fand im April 2010 auf Initiative von Evo Morales die alternative Klimakonferenz der indigenen Völker in Tiquipaya, CBBA, statt. Im September desselben Jahres hielt der indigene Präsident zwei Ansprachen, in denen sehr deutlich hervortrat, wie sein Bolivien aussehen solle und von wem es sich abgrenze: Am 11. September 2010 (dem Jahrestag der Terroranschläge von 2001) sprach Morales anlässlich der Amtseinführung der Koordinatorin der ethnischen Völker in Santa Cruz, SCZ ; neun Tage später, am 20. September 2011 wandte er sich in New York, NY, an die Generalversammlung der Vereinten Nationen und bezog auch hier noch einmal Stel­lung hinsichtlich der Position des mehrheitlich indigenen Bolivien im interna­tio­nalen Staatengefüge. 11 Angesichts der Menge der Ansprachen versteht es sich von selbst, dass bei der folgenden Analyse des Diskurses von Evo Morales nur auf eine Auswahl seiner Reden unmittelbar eingegangen werden kann. Diese sind exemplarisch für sein Gedankengut und könnten durch eine Vielzahl von Verweisen auf seine weiteren Ansprachen ergänzt werden, die sich oftmals sogar im Wortlaut gleichen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird im Folgenden jedoch darauf verzichtet, alle entsprechenden Ansprachen als Quellenverweise im Text zu nennen. Gleiches gilt auch für die Ansprachen von Barack Obama. 35 Im US-amerikanischen Kontext erfolgte eine zeitliche Schwerpunktsetzung auf den Zeitraum von Obamas Amtsantritt am 20. Januar 2009 bis zum zehnten Jahrestag der Terroranschläge auf das World Trade Center am 11. September 2011, verweist doch dieser Gedenktag auf jene hochtraumatische kollektive Erfahrung, die den Diskurs der USA seit Beginn des 21. Jahrhunderts am stärksten beeinflusst haben dürfte. Der räumliche Schwerpunkt des dreimonatigen Feldforschungsaufenthaltes wurde bei dieser Fallstudie ebenfalls auf die Hauptstadt gelegt, wobei neben Washington, DC, vor allem auch New York, NY, besucht wurde. Während erstere Stadt zweifellos das Zentrum der politischen Macht darstellt und die Regierung Obama hier unmittelbar präsent ist, machten nicht zuletzt besagte Terroranschläge deutlich, dass auch New York als Zentrum der finanziellen Macht und Emblem der US-amerikanischen Kultur (z. B. Freiheitsstatue, s. Kap. 4.2.1) eine besondere Bedeutung zukommt. Über die Homepage des Weißen Hauses wurden 1.207 Ansprachen Obamas eingesehen, die als Quellen unmittelbar von seinem Diskurs in genanntem Forschungszeitraum zeugen. Als bedeutsame Ereignisse des historischen Kontexts entfallen auf genannte Zeitspanne u. a.: die Inauguration des ersten afroamerikanischen Präsidenten, die berühmte Ansprache des Präsidenten in Kairo, Ägypten, am 4. Juni 2009 sowie die Verleihung des Friedensnobelpreises am 10. Dezember 2009, der bereits frühzeitig die große Tragweite von Obamas Rolle als erstem afroamerikanischen Präsidenten und neuem Hoffnungsträger der Vereinigten Staaten deutlich machte. Des Weiteren umfasst genannter Zeitraum beispielsweise Obamas Kampf um die Gesundheitsreform, die Diskussion um den geplanten Truppenabzug aus Irak (und Afghanistan), die für die Demokraten desolaten MidtermWahlen im November 2010, die Ermordung des Terroristenführers Osama bin Laden am 2. Mai 2011 sowie schließlich der Jahrestag der ebenso zerstörerischen wie hochsymbolischen Terroranschläge am 11. September 2011. Aus besagter zeitlicher Schwerpunktsetzung folgt unweigerlich, dass auf jene Ereignisse nur ansatzweise eingegangen werden kann, die sich nach den im bolivianischen und US-amerikanischen Kontext angegebenen Zeiträumen abspielten.12 Mit einer vergleichbaren Einschränkung sieht sich 12 Im Falle Obamas betrifft dies auch seine Wiederwahl; im bolivianischen Kontext wurde die gegenwärtige Veränderung von Evos Diskurs nur kurz thematisiert, indem der Konflikt um ein indigenes Territorium und Naturschutzgebiet zur Sprache kommt, der sich ab August 2011 manifestierte (s. Kap. 3.3.3). 36 wohl jedes Forschungsvorhaben konfrontiert, in dessen Zentrum ein zeitgeschichtlicher Analysegegenstand mit konkretem Gegenwartsbezug steht. Insofern ist die zeitliche Beschränkung zwar kritisch hinsichtlich der Aktualität der im Folgenden darzustellenden Analyseergebnisse; dessen ungeachtet ist sie bei besagter Themenstellung nicht zu vermeiden. 2.2 Literaturüberblick und Forschungsstand Bei den Ausführungen zur Konzeption dieser Arbeit und zu ihren zentralen Begrifflichkeiten wurde bereits auf Foucaults Erläuterungen zur Diskursanalyse und die Werke von Fornet-Betancourt und Estermann zum Konzept der Interkulturalität verwiesen (s. Kap. 1.1 und Kap. 1.2). Sie stellen das theoretische Gedankengerüst dieser Abhandlung dar und werden dabei etwa um den Geertzschen Kulturbegriff oder auch Webers Reflektion zum Wesen der legitimen Herrschaft ergänzt. Indem das philosophische Konstrukt der Interkulturalität in Verbindung gebracht wird mit der Ära Morales und der Ära Obama, resultiert unmittelbar ein Gegenwartsbezug: Evo Morales und Barack Obama sind während der Konzeption und des Verfassens der vorliegenden Analyse aktiv im höchsten Amt ihrer jeweiligen Nation. Da sie Personen des öffentlichen Interesses sind, erscheinen täglich neue Publikationen, die den ein oder anderen Bezug zur hier diskutierten Themenstellung aufweisen. Am stärksten zeigt sich dieses Phänomen in der Tagespresse, aber auch von wissenschaftlicher Seite werden Morales und Obama bzw. die durch sie vertretenen Länder fortlaufend untersucht. Dabei deckt die Bandbreite der Veröffentlichungen ein großes Spektrum ab: Politische, juristische, ökonomische, soziologische, psychologische und philosophische Schwerpunktsetzungen sind ebenso zu finden wie (kultur-) anthropologische bzw. ethnologische Fokussierungen. Die folgenden Angaben zum Forschungsstand können daher nur auf einen Ausschnitt jener weltweit verfügbaren Publikationen eingehen, da naturgemäß jegliche Angaben zum Status quo schnell überholt zu werden drohen. Des Weiteren weist bereits die große Bandbreite der Publikationen darauf hin, dass die Analyse der ethnisch-kulturellen Diskurse von Morales und Obama letztlich ein interdisziplinäres Unterfangen sein muss – wenn auch selbstverständlich mit ethnologischer Schwerpunktsetzung. Dies geht natürlich auch aus der Themenstellung und der theoretischen Verortung der vorliegenden Untersuchung hervor. Foucault selbst betont, ihn interes- 37 3 Restauration der Chakana in Abya Yala Als Juan Evo Morales Ayma 2002 zum ersten Mal bei den Präsidentschaftswahlen in Bolivien antrat, wurde seine Partei MAS-IPSP mit 20,9 % der Stimmen zur stärksten Oppositionspartei gewählt.21 Nur drei Jahre später, im Dezember 2005, gelang es Morales als drittem Präsidenten in der Geschichte des bolivianischen Staates, bereits im ersten Wahldurchgang mit absoluter Mehrheit (53,7 %) gewählt zu werden. Diese Beobachtung sowie sein Wahlergebnis von 62,5 % bei den vorgezogenen Präsidentschaftswahlen im Dezember 2009 wären Grund genug, um ihm einen besonderen Platz in der Geschichte des Andenstaates einzuräumen (La Razón, 07.12.2009b).22 Doch das Einzigartige an Morales, das ihn von seinen Amtsvorgängern unterscheidet, erschöpft sich nicht in der Feststellung seiner überragenden Wahlsiege, sondern ergibt sich vor allem aus dem ethnischkulturellen Hintergrund des Staatsmannes: Morales geht als erster indigener Präsident in die Geschichte Boliviens ein. Dieses historische Einzigartigkeitsmerkmal ist umso bedeutsamer, als die indigene Bevölkerung in Bolivien keineswegs eine Minderheit darstellt und dennoch bis zu Evos Amtsantritt im Januar 2006 niemals auf höchster Regierungsebene vertreten gewesen war. Als erster indigener Präsident steht Morales an der Spitze einer Gesellschaft, die sich durch eine große ethnisch-kulturelle Diversität auszeichnet. Im Zensus von 2001, d. h. noch unter der Präsidentschaft von Jorge Quiroga Ramírez (Acción Democrática Nacionalista, ADN, 2001/02), identifizierten sich 62 % der bolivianischen Bevölkerung als einer indigenen Ethnie angehörig, indem sie sich für eine der Kategorien Quechua, Aymara, Guraní, Chiquitano, Mojeño oder die Zugehörigkeit zu einem (nicht näher 21 Im Jahr 1999, als die MAS-IPSP unter Morales zum ersten Mal bei den Bezirkswahlen antrat, erreichte sie nur 3,2 % der Stimmen (CIDOB Barcelona, 2011). 22 Allerdings ist auch anzumerken, dass die MAS-IPSP bei den Bürgermeister- und Gouverneurswahlen am 4. April 2010 deutlich hinter ihren Ansprüchen und dem sensationellen Ergebnis der Präsidentschaftswahlen des Vorjahres zurückblieb: Die Partei des Präsidenten konnte zwar sechs der neun Gouverneursposten für sich gewinnen; in sieben der zehn wichtigsten Städte entschied jedoch die Opposition die Bürgermeisterwahlen für sich, darunter auch im Regierungssitz La Paz, LPZ (La Razón, 2010). Gleichwohl sei darauf hingewiesen, dass bei diesem Wahlergebnis nicht nur sinkende Sympathien für den Präsidenten eine Rolle gespielt haben könnten, sondern dass auch die Interessenlage in kommunalen Fragen von denen in nationalen Belangen verschieden sein kann. 56 bezeichneten) anderen autochthonen Volk entschieden ( INE , 2011).23 Wird dieser prozentuale Anteil weiter nach den einzelnen indigenen Völkern differenziert, entfallen 30,7 % auf die Quechua und 25,2 % auf die Aymara als die beiden größten indigenen Gruppen. Damit besitzen auch diese zahlenmäßig großen Ethnien für sich genommen den Status ethnischer Minderheiten im Vergleich zu den 38 % der Bevölkerung, die sich nicht mit einem indigenen Volk identifizieren ( INE , 2011) (s. Anhang B). Allerdings war die Antwortmöglichkeit „Mestize“ in besagtem Zensus nicht vorgegeben, weshalb genau genommen nur eine Wahl zwischen „weiß“ und „verschiedenen Varianten von nicht-weiß“ getroffen werden konnte. Dieser Umstand schränkt sicherlich die Validität der erhobenen Daten ein, da es fraglich ist, ob die Art der Operationalisierung das Konstrukt der ethnischen Zugehörigkeit angemessen abzubilden vermochte. Spedding (2010, S. 1) bezeichnete das Ergebnis des Zensus daher als Artefakt und meinte, dass ausgehend von biologisch-rassischen Kriterien – die von der e­ th­nischen Auto­ identifikation abweichen können –, alle Bolivianer Mestizen sein müssten. Tatsache ist jedoch ungeachtet dieser methodischen Kritik, dass sich angesichts der vorgegebenen Wahlmöglichkeiten die Mehrheit der bolivianischen Bevölkerung eher mit einer indigenen Ethnie identi­fizierte, als sich der nicht-indigenen Gruppe zuzuordnen. Werden die Zensusdaten folglich auf die Dichotomisierung indigen versus nicht-indigen reduziert, erscheint es auf einmal berechtigt, in der nicht-indigenen Bevölkerung die ethnische Minderheit zu sehen. Hierdurch wiederum wird Morales zum Präsidenten der bisher unter­reprä­sen­tierten ethnischen Mehrheit der indigenen Völker. Indes ist anzumerken, dass der Zensus von 2001 keineswegs einen Endpunkt der Geschichte markiert, sondern vielmehr einer schemenhaften Momentaufnahme gleicht, die sogar im Augenblick der Aufnahme noch verwackelt erscheint. So ist letztlich nicht nur das Klassifikationssystem relativ willkürlich gewählt, sondern die Kategorien selbst (Quechua, Aymara, Guaraní, Chiquitano, Mojeño, anderes autochthones Volk) sind zudem Konstrukte, die mit unterschiedlichen und veränderbaren Inhal- 23 Dieser Zensus war der erste, der sich der Selbstidentifikation der Bevölkerung als Kriterium für die ethnische Zugehörigkeit bediente. Im Zensus von 1900 war stattdessen die rassische Zugehörigkeit des Haushaltsvorstandes erhoben worden, während 1950 die ethnische Zugehörigkeit basierend auf der selbstberichteten Muttersprache bestimmt wurde (Gray Molina, 2007, S. 12). 57 ten gefüllt werden können. Während früher etwa die indigenen Ethnien stets mit einer bestimmten eher ländlichen, nicht-technologisierten Lebensweise assoziiert wurden, ist dieses stereotype Bild heute fehlerhafter denn je. Schließlich gingen in den vergangenen 30 bis 40 Jahren die Phänomene der Urbanisierung, des Ausbaus des industriellen und des Dienstleistungssektors gegenüber dem Primärsektor sowie der zunehmenden Demokratisierung der Gesellschaft nicht zuletzt einher mit einer Veränderung der ethnisch-kulturellen (Auto-) Identifikation ( PNUD, 2007, S. 120). Insofern ist heute etwa folgernder (exemplarischer) Aussage uneingeschränkt zuzu­stimmen: „Una mujer andina urbana que usa un celular no es menos andina que la campesina que escarba papas“24 (Estermann, Maidana Rodriguez, Quezada, Colque Jimenez, & Tancara Chambe, 2006, S. 22). Auch Morales selbst als erster indigener Präsident Boliviens ist zweifels­ohne als Zeugnis dieser Entkoppelung von ethnischer Zugehörigkeit und konventionell-begrenztem Handlungsspielraum – bzw. ganz allge­mein als Zeugnis des gesellschaftlichen Wandels – anzusehen. Somit sind zwei Determinanten des diskursiven Feldes auszumachen, deren Zusam­­menkommen den Ausgangspunkt für die Präsidentschaft von Morales bildet und insofern für die folgenden Ausführungen maßgeblich ist: zum einen Evos historische Einzigartigkeit als erster indigener Präsident Boliviens sowie zum anderen die heterogene und sich wandelnde Gesellschaft als hoch bedeutsames Kontext­merkmal seiner Präsidentschaft. Wichtig ist zudem die Annahme, dass die Diversität und Dynamik der bolivianischen Bevölkerung nicht allein strukturelle Heraus­forderungen bedeuten, denen die Regierung erfolgreich begegnen muss, sondern dass diese beiden Komponenten zugleich auch das Potential zur Überbrückung möglicher gesellschaftlicher Spaltungen sowie zur Lösung sozialer Spannungen in sich tragen. In diesem Sinne ist es der Staat, der auf die Charakteristika seiner Bevölkerung eingehen und sich als ihr Spiegel­bild neu erfinden muss. Dem Staat und mehr noch der Regierung als demokratischer Volksvertretung obliegt es, der Vielfältigkeit der Bevölkerung gerecht zu werden und auf die gesellschaftlichen Dynamiken angemessen zu reagieren. Hierzu muss die Regierung einen Diskurs konstruieren, der möglichst die Wirklichkeiten aller Bürger gleichermaßen berücksichtigt und insofern den Bedürfnissen der gesamten Bevölkerung Rechnung trägt ( PNUD, 2007, S. 33). 24 „Eine in der Stadt lebende andine Frau, die ein Handy benutzt, ist nicht weniger andin, als die Bäuerin, die Kartoffeln ausgräbt“ (e. Ü.). 58 Dass tatsächlich ein Handlungsbedarf in dieser Richtung besteht, zeigt ein Blick auf die Regierungszeiten der Vorgänger Evos im Präsidentenamt des Andenstaates: „Sobre ochenta y tres gobiernos, treinta y seis no duraron más de un año, treinta y siete fueron de facto y hasta el momento ningún historiador ha sabido precisar la cantidad exacta de golpes de Estado e intentonas militares“25 (Sivak, 2008, S. 11).26 Die fast schon institutionalisierte Instabilität verweist auf das Ausmaß der strukturellen Pro­bleme des Landes, die eine stabile und demokratische Präsidentschaft zweifellos zur Herausforderung werden lassen. Entsprechend ist etwa in einem Bericht des Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD ) ‚Entwick­lungs­ programm der Vereinten Nationen‘ aus dem Jahr 2004 (S. 128 f.), d. h. noch vor der Wahl von Morales zum Präsidenten, die Aussage zu finden, dass die Integration der verschie­denen sozialen Sektoren und kulturellen Gruppen als gleichwertige Mitglieder des Staates geradezu unabdingbar für die weitere Entwicklung des Landes sei. Dies zeigte sich auch konkret in den ersten beiden Regierungsjahren von Morales, als die vergleichsweise „weißen“ und wohlhabenden Departamentos27 des sogenannten Media Luna ‚Halbmond‘ (BEN, PDO, TJA und SCZ ) drohten, sich von dem stärker indigen geprägten und sozioökonomisch schwächerem Rest des Landes abzuspalten.28 Hierdurch waren der Zusammenhalt der bolivianischen Gesellschaft und somit der Fortbestand des Staates unmittelbar gefährdet. Bei seinem Amtsantritt begegnete der erste indigene Präsident Boliviens diesen soziopolitischen Herausforderungen, indem er weitreichende Veränderungen ver­sprach. Er kündigte einen profunden Cambio ‚Wandel‘ an, der mittels einer „kulturellen und demokratischen Revolution“ (Villegas Quiroga, 2006; e. Ü.) zu einer deutlichen Veränderung, wenn nicht gar zu einer Art „Neugründung“ des Andenstaates führen sollte (Ministerio de Pla- 25 „Von 83 Regierungen dauerten 36 nicht länger als ein Jahr, 37 waren de facto-Regierungen, und bis heute ist es keinem Historiker gelungen, die exakte Anzahl der Staatsstreiche und militärischen Putschversuche zu bestimmen“ (e. Ü.). 26 Dent (1999, S. 39) spricht von mindestens 190 Staatsstreichen seit der Unabhängigkeit Boliviens im Jahr 1825. 27 Bolivien setzt sich aus neun Departament genannten Verwaltungseinheiten zusammen. 28 Die Wahlen vom 6. Dezember 2009 indizierten einen nicht zu vernachlässigenden Gesinnungswandel der Media Luna dahingehend, dass einige von Evos früheren Gegnern darin für ihn gestimmt haben müssen. So erreichte Morales in allen Departamentos bis auf Santa Cruz und Beni mehr als 50 % der Stimmen. Bei den Wahlen im Jahre 2005 hatten sich noch alle fünf Departamentos der Media Luna (Chuquisaca wird manchmal ebenfalls zur Media Luna gezählt) gegen ihn ausgesprochen. 59 nificación y Desarrollo, 2006). Angesichts dieser Ankündigung einer tiefgehenden Umwälzung und Erneuerung des Staates stellt sich natürlich die Frage, welches Ziel durch diese Veränderungen angestrebt wird, bzw. wie die Positivität des präsidentiellen Diskurses der Ära Morales tatsächlich aussieht (Foucault, 1981, S. 182). Es gilt, den Begriff des Cambio mit Inhalten zu füllen und zu prüfen, wodurch sich die (Re-) Konstruktion des bolivianischen Staates durch Morales auszeichnet. Im Hinblick auf die zwei Determinanten von Evos Präsidentschaft – seinen indigenen Hintergrund und die Diversität der Bevölkerung – interessieren hierbei insbesondere der Kulturbezug seines Diskurses und die diskursive Konstruktion eines interkulturellen Miteinanders. Um den Cambio der Ära Morales begreiflich zu machen, ist somit zunächst eine Reflektion des historischen Diskurses erforderlich, der den soziopolitischen Kontext darstellt, aus dem die Präsidentschaft von Morales hervorging (Kap. 3.1.1). Selbiges gilt für die soziokulturelle Einordnung von Evos biographischem Hintergrund als dem individuellen Umfeld, das den heutigen Präsidenten prägte und das aufgrund dessen auch für seinen Diskurs von Bedeutung ist (Kap. 3.1.2). Ausgehend von diesem Kontextwissen wird das Besondere an Evos Diskurs erkennbar durch die Identifizierung jener Inhalte, auf deren Basis Morales die nationale Identität zu konstituieren sucht. Hierzu gehört die Analyse der ethnisch-kulturellen Diskurstraditionen, in die sich der Präsident aktiv stellt (Kap. 3.2.1), ebenso wie die Untersuchung jener Traditionen, Konzepte und Fremdgruppen, von denen er sich abgrenzt (Kap. 3.2.2). Schließlich stellt auch die implizit-symbolische Funktion des ersten indigenen Präsidenten eine bedeutsame Komponente seines Diskurses bzw. der Wirkung seiner Person dar (Kap. 3.2.3). Basierend auf diesen strukturellen und inhaltlichen Untersuchungen ist es dann möglich, Evos ethnisch-kulturellen Diskurs hinsichtlich seines Potentials für ein interkulturelles Miteinander zu analysieren (Kap. 3.3.1). An dieser Stelle interessiert auch das Verhältnis seines Diskurses zu einem plurikulturellen bzw. plurinationalen Patriotismus einerseits und einem universalistischen Gültigkeitsanspruch andererseits (Kap. 3.3.2). Des Weiteren erscheint angesichts der tagespolitischen Ereignisse eine kurze Reflektion des Konflikts um den Schutz des Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure ( TIPNIS ) ‚Indigenes Territorium und Nationalpark Isiboro-Sécure‘ angebracht, um anhand dieser die Anwendungsebene des präsidentiellen Diskurses zu thematisieren und die (mangelnde) Umsetzung der Interkulturalität kritisch zu reflektieren (Kap. 3.3.3). Als Ab- 60 schluss des Fallbeispiels Boliviens erfolgt eine Bewertung der Bedeutung des Präsidenten und seines Diskurses für den versprochenen Cambio. Zugleich ist an dieser Stelle auch einzuschätzen, ob Evos Cambio tatsächlich das angekündigte Ausmaß erreicht und es daher berechtigt erscheint, von einem Diskursbruch zu sprechen (Kap. 3.4). 3.1 Historische und biographische Kontextualität von Evos Kulturbezug Es versteht sich von selbst, dass Morales und sein Diskurs keineswegs isoliert betrachtet werden dürfen, da sie eine Vielzahl von Bezügen zu einem weit zu fassenden Kontext aufweisen. Schließlich hat Foucault selbst dazu aufgerufen, die „Spiele von Beziehungen zu beschreiben“ (1981, S. 45), in denen einzelne Aussageereignisse auftreten. Auf die ethnisch-kulturellen Traditionen, in denen der erste indigene Präsident steht, wird noch ausführlich einzugehen sein. Doch existiert auch das ethnisch-kulturelle Moment nicht unabhängig vom seinem Kontext, sondern es steht in einer wechselseitigen Abhängigkeits- und Beeinflussungssituation mit dem historischen Diskurs als Manifestation des Bisherigen, das zu Evos Präsidentschaft führte und (zumindest indirekt) in diese hineinreicht. Somit kann der historische Diskurs gewissermaßen als die äußere, formgebende und auch formannehmende Facette von Kulturalität und Ethnizität verstanden werden: geschichtliche Ereignisse werden verarbeitet und in das (kollektive) Selbstbild einer Gruppe aufgenommen. Die (kollektive) Identität wiederum prägt das Handeln der Gruppe, wodurch sich ihr Selbstverständnis u. a. in politischen Entscheidungen niederschlägt, die ihrerseits wieder auf das Selbstbild der Gruppe zurückwirken. Auf diese Weise entsteht aus einzelnen Begebenheiten ein historisch-politisches Diskursgefüge, das zur Tradition heranwächst, der sich das Individuum – sei es vornehmlich aktiv-gestaltend oder rezeptiv-annehmend, sei es als Befürworter oder Gegner des Diskurses – kaum zu entziehen vermag. In diesem Sinne steht auch Morales in Beziehung zu einer bestimmten Diskurstradition. Zweifellos geht er als erster indigener Präsident in die Geschichte Boliviens ein und spricht nachdrücklich vom Cambio (z. B. 06.08.2006), den er herbeizuführen sucht; durch diese Rhetorik unterstreicht er eindrücklich „das Neue“ seiner Präsidentschaft, den (angestrebten) Bruch mit der Vergangenheit und deren Diskurs. Zumindest aus seiner Sicht beginnt mit ihm eine neue Ära, die sich durch ihren eigenen, neuen 61 4 American Dream Revisited Am 27. Juli 2004 übernahm Barack Obama bei der Democratic National Convention das Mikrophon, um seine Keynote Address anlässlich der Ernennung von John Kerry zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten zu halten, und wurde selbst über Nacht zum neuen Gesicht und Hoffnungsträger der demokratischen Partei (Mieder, 2009, S. 109). Im darauffolgenden Jahr zog er für Illinois in den US-Senat ein und wurde damit der fünfte afroamerikanische Senator in der Geschichte der Vereinigten Staaten.221 Das Fundament für die sogenannte „Obamania“ (Haltern, 2009, S. 89), für jene Begeisterung und Hoffnung, die Obama auszulösen vermochte, war gelegt. Sie sollte schließlich ermöglichen, dass er am 4. November 2008 mit 52,9 % der Wählerstimmen respektive mit 365 Wahlmännerstimmen zum Präsidenten der USA gewählt wurde ( U. S . N AR A , 2008a; 2008b) und noch im Jahr seines Amtsantritts den Friedensnobelpreis in Oslo entgegennehmen konnte. Vier Jahre später, am 6. November 2012, wurde Obama trotz aller Schwierigkeiten, mit denen er in seiner ersten Amtszeit zu kämpfen hatte, mit 50,9 % der Stimmen bzw. mit 332 Wahlmännerstimmen im Amt bestätigt ( U. S . N AR A , 2012a; 2012b). Bereits diese Eckdaten seiner steilen politischen Karriere machen deutlich, dass es sich bei Obama um einen Ausnahmepräsidenten handelt. So urteilte Morris rückblickend auf Obamas politische Anfänge: „No one could have predicted Obama’s success except that his singularity of potential was illustrated in the 2004 campaign“ (2010, S. 3). Eben dieses außergewöhnliche Potential, das in seinem Engagement für Kerrys Wahlkampf sichtbar wurde, offenbarte sich auch in seinem eigenen Wahlkampf, als Obama sein Publikum zu bewegen und für sich einzunehmen wusste. Nicht zuletzt dank dieser Fähigkeit kennzeichnet ihn heute das Einzigartigkeitsmerkmal, der erste afroamerikanische Präsident in der Geschichte der USA zu sein. 221 Haltern spricht davon, der heutige Präsident sei „als dritter Schwarzer überhaupt in den Senat eingezogen“ (2009, S. 89). Ein Blick auf die Auflistungen der afroamerikanischen Abgeordneten zeigt jedoch, dass vor Obama bereits vier andere Politiker mit afroamerikanischem Hintergrund als Senatoren tätig waren: für die Republikaner Hiram Rhodes Revels (MS, 1869–1871), Blanche Kelso Bruce (MS, 1875–1881) und Edward William Brooker (MA, 1967–1979) sowie für die Demokraten Carol Moseley-Braun (IL, 1993–1999) (History, Art & Archives, U. S. House of Representatives, 2013). 234 Als solcher steht er an der Spitze einer Nation, deren Gesellschaft sich ähnlich wie die bolivianische durch eine deutliche ethnisch-kulturelle Heterogenität auszeichnet, wenn auch die Komposition der ethnisch-kulturellen Landschaft sich maßgeblich von der des südamerikanischen Landes unterscheidet. So identifizierten sich dem Zensus von 2010 zufolge 72,4 % der USAmerikaner als „weiß“, 12,6 % wählten die Kate­gorie Black or African Ameri������ can, 0,9 % American Indian and Alaska Native, 4,8 % Asian, 0,2 % Native Hawaiian and Other Pacific Islander und 6,2 % Some Other Race, wobei sich weitere 2,9 % der Bevölkerung als zu zwei Rassen oder mehr gehörig identifizierten (Humes, Jones, & Ramirez, 2011, S. 4). Des Weiteren erfasste der Zensus von 2010 die Ethnizität der Bevölkerung, indem sie gemäß der Revision to the Standards for the Classification of Federal Data on Race and Ethnicity abgefragt wurde durch Autoidentifikation entweder als Hispanic/Latino oder als nicht zu dieser Kategorie gehörig (Katzen, 1997).222 16,3 % der Bevölkerung gaben an, einen hispanischen Hintergrund zu haben. Diese Zahlen lassen sich aufgrund der getrennten Erfassung von rassischer und ethnischer Autoidentifikation weiter differenzieren in eine Reihe von Unterkategorien, die sich aus den Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Rassen und der ethnischen Selbstidentifikation ergeben (Humes, Jones, & Ramirez, 2011, S. 4, 6–16). Gleichermaßen wie im bolivianischen Kontext fällt auch hier der Konstruktcharakter der Zensuskategorien – und damit letztlich die Beliebigkeit ihrer Inhalte – auf. So stellt etwa Naylor (1998, S. 35) heraus, dass es weder eine (einzige) asiatische Kultur gebe noch eine einheitliche kulturelle Gruppe, die ihren Ursprung auf den Pazifikinseln genommen habe. Ent- 222 Zur inhaltlichen Erklärung dieser Kategorien sind folgende Angaben zu finden: „American Indian or Alaska Native. A person having origins in any of the original peoples of North and South America (including Central America), and who maintains tribal affiliation or community attachment.“ „Asian. A person having origins in any of the original peoples of the Far East, Southeast Asia, or the Indian subcontinent including, for example, Cambodia, China, India, Japan, Korea, Malaysia, Pakistan, the Philippine Islands, Thailand, and Vietnam.“ „Black or African American. A person having origins in any of the black racial groups of Africa. Terms such as ‚Haitian’ or ‚Negro’ can be used in addition to ‚Black or African American.‘“ „Hispanic or Latino. A person of Cuban, Mexican, Puerto Rican, Cuban, South or Central American, or other Spanish culture or origin, regardless of race. The term, ‚Spanish origin,‘ can be used in addition to ‚Hispanic or Latino.’“ „Native Hawaiian or Other Pacific Islander. A person having origins in any of the original peoples of Hawaii, Guam, Samoa, or other Pacific Islands.“ „White. A person having origins in any of the original peoples of Europe, the Middle East, or North Africa“ (Katzen, 1997). 235 sprechend ist natürlich auch bei den anderen angegebenen Kategorien davon auszugehen, dass diese keine homogenen Völker bezeichnen, sondern dass eine Einheitlichkeit bestenfalls durch die Abgrenzung vom kulturell Anderen suggeriert wird (Devine, 1996, S. 74). Von Regierungsseite wird dieser grundsätzlichen Kritik an der abstrakt-theoretischen Konzeption der Kategorien kaum Rechnung getragen; immerhin betont sie aber den Konstruktcharakter der Kategorien dahingehend, dass diese nicht erblich determiniert seien: „�������������������������������������������������������� The racial and ethnic categories set forth in the standards should not be interpreted as being primarily biological or genetic in reference. Race and ethnicity may be thought of in terms of social and cultural characteristics as well as ancestry“ (Katzen, 1997). Bei Rasse und Ethnizität handelt es sich folglich um die Autoidentifikation einer Person gemäß einer mehr oder weniger gesellschaftlich verbreiteten Vorstellung darüber, welche Charakteristika ein Individuum aufweisen sollte, wenn es sich einer bestimmten Kategorie zugehörig fühlt. Dabei bleibt offen, weshalb rassische und ethnische Zugehörigkeit in der Klassifikation überhaupt voneinander unterschieden werden, wenn es sich bei beiden um soziale Konstrukte handelt, die nicht mit einer biologisch oder genetisch nachweisbaren Abstammung übereinstimmen müssen. Jedoch hat es den Anschein, als läge dem Klassifikationsschema die Einteilung der US-amerika­ni­schen Bevölkerung gemäß zweier kultureller Zugehörigkeiten zugrunde, wobei Repräsentanten einer sogenannten hispanischen Kultur von allen anderen Bürgern abgegrenzt werden. Insofern als erst im zweiten Schritt die rassische Autoidentifikation erfasst wird (die Frage nach der Ethnizität wird vor der Frage nach der Rasse einer Person gestellt), bleibt das distinkte Hauptmerkmal die kulturelle Komponente. Diese impliziert eine potentiell diskriminierende Unterscheidung eben dieser hispanischen Kultur von einer – wenn auch nicht explizit als solche bezeichneten – US-amerika­ni­schen Kultur. Womöglich liegt der Ursprung dieser Differenzierung in der sprachlichen Präferenz; jedoch verkennt sie die anzunehmende Existenz verschiedener ethnisch-rassischer – bzw. in der Terminologie der vorliegenden Analyse ethnisch-kul­tureller – (Sub-) Gruppen und suggeriert mehr oder weniger subtil, dass Bürger hispanischer Ethnizität keine „echten“ US-Amerikaner sein könnten. Dies deutet bereits daraufhin, dass auch in den USA die Lösung ethnisch-kultureller Differenzen und hierauf basierender Diskriminierung oder gesellschaftlicher Marginalisierung noch aussteht. 236 Indes ist festzustellen, dass bei den Präsidentschaftswahlen von 2008 die ethnisch-rassische Autoidentifikation der Wähler eine Rolle spielte, da sie von den Kennzahlen der vorherigen Präsidentschaftswahl (sowie auch von einer bloßen Zufallsverteilung) deutlich abwich. Es fällt auf, dass 95 % der afroamerikanischen und 67 % der hispanischen Wähler für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten stimmten, wobei diese Zahlen einem Anstieg von 7 % respektive von 13 % gegenüber den Wahlen von 2004 entsprechen (Warburton, 2010, S. 113).223 Marable ergänzt, dass 78 % der jüdischen Wähler, 62 % der unter Dreißigjährigen sowie 58 % der weiblichen Wähler ihre Stimme Obama gaben. Dies führt Marable zu dem Urteil, die Präsidentschaft von Obama beruhe auf einer „�������������������������� broad, multiethnic, multiclass coalition“ (2009b, S. 8). Demnach sind auch im US-amerikanischen Kontext zwei Determinanten zu erkennen, die kennzeichnend für die ethnisch-kulturelle Dimension von Obamas Präsidentschaft sind: Dies ist zum einen das Einzigartigkeitsmerkmal, das ihn als ersten afroamerikanischen Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten charakterisiert; zum anderen steht auch Obama einer ethnisch-kulturell heterogenen Gesellschaft gegenüber, für die seine Ethnizität offensichtlich von Bedeutung ist und deren Diversität er gerecht werden muss. Im Gegensatz zu seinem bolivianischen Amtskollegen Morales gehört Präsident Obama jedoch einer Minderheit an. Dieser Minoritätsstatus der Afroamerikaner äußert sich, so Gibbs, hinsichtlich der ethnischen, der kulturellen und der rassischen Identität der Gruppe. Gibbs führt weiter aus: Although generations of African-Americans have lived in the United States, they cannot claim status as ethnic nationals because they never had ownership of the land. African-Americans, while occupying some mayoral, state legislative, congressional, and city council seats, are small in numbers, and many of the cities in which African223 2012 ging die Zustimmungsrate, die Obama seitens afroamerikanischer Wähler erzielte, leicht zurück auf 93 %; die Zustimmungsrate der hispanischen Wähler verzeichnete dagegen einen leichten Anstieg und erzielte 71 % (Allen, 2012). Damit erreichte er zwar eine hohe Zustimmung auch seitens der hispanischen Wähler; jedoch blieb Obama (wie auch schon 2008) weit hinter Kennedys Rekordmarke von 85 % der hispanischen Stimmen zurück und bewegte sich eher in der Nähe der Durchschnittswerte, die demokratische Präsidentschaftskandidaten (mit Ausnahme vielleicht von John Kerry) in den vergangenen Jahrzehnten auf Seiten der hispanischen Wähler zu erzielen vermochten (Wallace, 2012, S. 1362, 1364). 237 American mayors govern are plagued with low tax bases, high crime, and poor infrastructure conditions. All of these differential accesses to political and monetary power, coupled with the easy identification because of their skin tones, clearly establishes the African-American as the classic minority. (1997, S. 93) Doch auch wenn Obamas Situation als Angehöriger der afroamerikanischen Minorität nur begrenzt mit der des Aymara Morales vergleichbar ist, stellte auch er seinen Wahlkampf ins Zeichen der Leitmotive des Wandels und des Neuanfangs bzw. des Change und des New Beginning (Mieder, 2009, S. 87). Während Obama nach eigenen Angaben als Community Organizer unmittelbar an der Basis anzusetzen versuchte, um einen Wandel von Politik und Gesellschaft zu bewirken (2008a, S. 133), obliegt es ihm seit seiner Inauguration, diesen Change von der Spitze der Vereinigten Staaten aus anzustoßen. Als Präsident und Diskursgestalter vermag er entscheidend auf die nationale (ethnisch-kulturelle) Identität der USA einzuwirken und über den Diskurs auch die Beziehungen innerhalb der ethnisch-kulturellen Landschaft der Vereinigten Staaten maßgeblich zu beeinflussen. Insofern stellt sich auch im Falle Obamas die Frage, wodurch sich sein Versprechen des Wandels auszeichnet und inwiefern bei ihm eine Transformation des Diskurses – insbesondere hinsichtlich seines eigenen ethnisch-kulturellen Hintergrundes sowie im Sinne des interkulturellen Gedankenguts – überhaupt festzustellen ist. Schließlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Obama als Angehöriger einer ethnischen Minderheit der Diskursgeschichte der weißen Mehrheit gegenübertritt und aufgrund dessen möglicherweise nur über einen eingeschränkten Handlungsspielraum verfügt. Um die Bedeutung des ersten afroamerikanischen Präsidenten für einen möglichen Change zu verstehen, erscheint es angebracht, zunächst einen Blick auf die historischen Apriori zu werfen, die seine Wahl denkbar werden ließen und die jene soziopolitischen Ereignisse oder Traditionen darstellen, auf denen die Ära Obama aufbaut (Kap. 4.1.1). Neben diesen gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen interessiert auch die soziokulturelle Einordnung von Obamas biographischem Hintergrund als dem individuellen Kontext, in dem seine heutige Präsidentschaft steht (Kap. 4.1.2). Unter Berücksichtigung dieser Kontextmerkmale wird es möglich, die Einzigartigkeit des präsidentiellen Diskurses zu identifizieren und ihn ethnisch-kulturell zu verorten, d. h. sowohl zu klären, inwiefern Obamas Diskurs in einer bestimmten Tradition steht oder ein klassisches Narrativ berücksichtigt (Kap. 4.2.1), als auch jene Konzepte oder Feindbilder zu identi- 238 fizieren, von denen er sich möglicherweise abgrenzt (Kap. 4.2.2). Eine dritte Komponente seines Diskurses ergibt sich schließlich aus der implizit-symbolischen Bedeutung, die Obama als erster afroamerikanischer Präsident innehat (Kap. 4.2.3). Aufbauend auf dieser thematischen Auseinandersetzung ist das interkulturelle Potential Obamas zu diskutieren unter dem Schlagwort seines interkulturellen American Dream (Kap. 4.3.1). Hierzu gehört auch, den präsidentiellen Diskurs in Beziehung zu setzen zu den Konzepten des Patriotismus und des Universalismus als möglichen Gefährdungen des interkulturellen Gedankenguts (Kap. 4.3.2). Abschließend erfolgt eine kritische Reflektion der Bedeutung Obamas und seines Diskurses für den angekündigten Change bzw. für die Veränderung der ethnisch-kulturellen Landschaft der USA. Hierbei ist auch zu bewerten, ob der zu verzeichnende Wandel dazu berechtigt, von einem Diskursbruch zu sprechen, oder ob die Ära Obama eher durch eine begrenzte Transformation des Diskurses gekennzeichnet ist, die das Ausmaß einer der Tradition verwandten Positivität nicht überschreitet (Kap. 4.4). 4.1 Historische und biographische Kontextualität von Obamas Kulturbezug Ebenso wie bei der Diskussion des Fallbeispiels der Ära Morales in Bolivien herausgestellt wurde, dass die Präsidentschaft des ersten indigenen Staatsoberhaupts keinesfalls isoliert betrachtet werden kann, ist auch im Falle von Obama sein in Beziehung stehen mit „Aussagen oder Gruppen von Aussagen oder Ereignissen einer ganz anderen (technischen, ökonomischen, sozialen, politischen) Ordnung“ (Foucault, 1981, S. 45) bedeutsam. Auch er, in seiner Einzigartigkeit als erster afroamerikanischer Präsident der Vereinigten Staaten, befindet sich im Netzwerk einer Vielzahl von Bezügen und kann nicht umhin, sowohl Gestalter als auch Produkt der Geschichte und des Diskurses zu sein. Die Gesellschaft und ihre politische Führung treten in Wechselwirkung miteinander und konstruieren eine nationale Identität, in der sich die Machtverhältnisse und die gesellschaftliche Stellung der einzelnen ethnisch-kulturellen Gruppen widerspiegeln und als solche auf die kollektive Identität zurückwirken. Dieses grundsätzliche Wechselspiel existiert unabhängig von dem jeweiligen Präsidenten und seinem etwaigen Versprechen eines Wandels. Vielmehr wird ein Change überhaupt nur denkbar in Abgrenzung von dem Bisherigen. 239 Somit ist auch in dieser Fallstudie die Entwicklung des kulturellen Gefüges innerhalb der vergangenen rund 60 Jahre von Interesse, da dies die zeitgeschichtliche Periode ist, die als Kontextbedingungen die Biographie Obamas prägte und an die sich seine Ära unmittelbar anschließt. Neben diesem Blick auf die Geschichte, die History, ist in einem weiteren Schritt auf „his story“, d. h. auf die Biographie von Obama, einzugehen und eine soziokulturelle Einordnung seines Hintergrundes vorzunehmen. Diese ist für die Untersuchung des ethnisch-kulturellen Diskurses des Präsidenten von Bedeutung, da sie einen kritischen Blick auf seine Authentizität bzw. Typizität als Afroamerikaner erlaubt und möglicherweise bereits Hinweise auf seine implizit-symbolische Bedeutung für die Bevölkerung gibt. Schließlich erleichtern die biographischen Eckpunkte der präsidentiellen Vita – ebenso wie die historischen Apriori – das Verständnis des präsidentiellen Diskurses und seiner ethnisch-kulturellen Verortung. Letztlich zeichnet sich wie beim historischen Diskurs auch in Obamas Biographie jenes Regelwerk ab, das unter seinen Amtsvorgängern kennzeichnend für den US-amerikanischen Diskurs war und dem er die Botschaft des Change gegenüberzustellen versucht. 4.1.1 Historische Apriori der Ära Obama Wodurch wurde die Präsidentschaft von Obama als erstem Präsidenten mit einem afroamerikanischen Hintergrund möglich? Welches sind die Apriori, ohne die seine Wahl undenkbar gewesen wäre? Selbstverständlich stellt auch im US-amerikanischen Kontext der Kontakt der verschiedenen Ethnien und Kulturen die absolute Conditio sine qua non für jegliche Entwicklung eines wie auch immer gearteten multikulturellen Miteinanders dar. Die leidvolle Ursache für das Zusammentreffen der europäischstämmigen US-Amerikaner und der heutigen Afroamerikaner ist zweifellos in der Verschiffung afrikanischer Sklaven in die sogenannte Neue Welt zu finden224, wobei allein bis zum Unabhängigkeitskrieg 300.000 Sklaven 224 An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Situation der Native Americans keineswegs von weniger Leid geprägt war als die der afroamerikanischen Sklaven. Aufgrund der Themenstellung dieser Untersuchung, die eine intensive Beschäftigung mit dem Verhältnis der afroamerikanischen Bevölkerung zur weißen Mehrheit der US-Bürger verlangt, sei bezüglich der Native Americans jedoch lediglich auf weiterführende Literatur verwiesen (z. B. Cambridge, 1997; Heideking, 2003; Hodges, 2003; D. King, 2005; Meagher, 2003; Naylor, 1998). 240 5 Ausblick zur Umsetzung der Interkulturalität Im Vorherigen erfolgte eine Analyse des ethnisch-kulturellen Diskurses der Ära Morales respektive der Ära Obama. Es wurde nach einem Blick auf die Diskurs­ge­schichte des jeweiligen Landes gefragt, inwiefern die Präsidentschaften der beiden Staatsmänner Ausdruck eines Wandels des diskursiven Regelsystems sind und ob sie selbst eine Diskontinuität des traditionellen Diskurses anstreben. Besonderes Augen­merk wurde bei der Analyse auch auf die Beziehung der beiden Präsidenten zum (philosophischen) Konstrukt der Interkulturalität gelegt. Hierzu wurde thematisiert, welche Rolle die sozialen Probleme der Marginalisierung und Diskriminierung unter Morales und Obama spielen und in welchem Ausmaß die Staatsmänner bisher auf einen ebenbürtigen Dialog der verschiedenen ethnischkulturellen Gruppen hinwirken konnten. Dabei erforderte die Komplexität des Analysegegenstandes, die beiden Fallstudien weitgehend getrennt voneinander zu betrachten und so Evos Bolivien und Obamas Vereinigte Staaten zunächst vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen ethnisch-kulturellen Wirklichkeit zu erläutern. Soll das Thema der Interkulturalität im Zentrum einer Untersuchung stehen, versteht es sich jedoch von selbst, dass eine einzelne ethnisch-kulturelle Wirklichkeit nicht isoliert bleiben kann. Schließlich handelt es sich beim Gegenstand der Inter­kul­tu­ra­lität gerade um ein In-Beziehung-Treten der verschiedenen Kulturtra­di­tionen in Form eines Dialogs auf Augenhöhe. Ihr methodologisches Analogon findet eine solche Bezugsherstellung eben in der Thematisierung der Begegnung der verschiedenen ethnischkulturellen Wirklichkeiten auf Basis von sowohl kontextsensitiven als auch weitgehend äquivalenten Fallstudien. Demzufolge verlangen auch vorstehende Analysen von Evos „Restauration der Chakana in Abya Yala“ einerseits und Obamas „American Dream Revisited“ andererseits eine Erweiterung ihres Bezugsrahmens und somit ein „In-Beziehung-Setzen“ des bolivianischen und des US-amerikanischen Kontextes. Dabei sind nicht allein die spezifischen nationalen Kontexte – d. h. die Diskurse von Bolivien und den USA – von Bedeutung, sondern auch die ethnisch-kulturelle Dimension der gegenwärtigen globalen Entwicklungen, die ihrerseits den übergeordneten Kontext bzw. das „Setting“ der bolivianisch-US-amerikanischen Begegnung darstellen. 405 Entsprechend gilt es in einem ersten Schritt, die Herausforderungen eines interkul­turellen Dialogs am Beispiel der Begegnung von Bolivien und den USA aufzuzeigen. Ausgehend vom ethnisch-kulturellen Diskurs der beiden Präsidenten ist an dieser Stelle die geschichtlich bedingte Asymmetrie des konfliktbehafteten Verhältnisses zu thematisieren, in das nicht zuletzt auch Evos und Obamas Biographien hineinspielen (s. Kap. 5.1.1). Das historische bolivianisch-US-amerikanische Verhältnis bildet den diskursiven Kontext der tatsächlichen Begegnung von Evo und Obama; es kann eine respektvolle Begegnung auf Augenhöhe im Sinne einer wahren interkulturellen Begeg­nung erleichtern oder aber sie maßgeblich erschweren, wenn nicht sogar verhindern (s. Kap. 5.1.2). Da bereits die Analysen der beiden Fallstudien auf einen eher konfliktbeladenen Status quo des bolivianischUS-amerikanischen Verhältnisses hinwiesen, lässt sich (aufbauend auf der Auseinandersetzung mit der faktischen Gestaltung der Begegnung) hypothetisch danach fragen, welche Umstände gegeben sein müssten, um einen interkulturellen Dialog von Morales und Obama möglich werden zu lassen (s. Kap. 5.1.3). In einem zweiten Schritt gilt es den weltweiten Kontext zu berücksichtigen, vor dessen Hintergrund sich die Diskurse in Bolivien und den USA sowie die Begegnung der beiden Länder entwickeln. Gemeint ist die Globalisierung, die sich in vielfältiger Weise auf die Wirklichkeiten von Individuen, Gesellschaften und Nationen sowie auf die der internationalen Beziehungen auswirkt (s. Kap. 5.2.1). Besonders interessieren angesichts vorstehender Analyse natürlich mögliche globalisierungsbedingte Verän­der­un­gen in der ethnisch-kulturellen Identität (s. Kap. 5.2.2) sowie in der Begegnung verschiedener Ethnien und Kulturen (s. Kap. 5.2.3). Hier stellt sich die Frage, ob der globale Kontext eine Re-Definition des diskursiven Regelwerkes von Kulturalität und Interkulturalität notwendig werden lässt. In einem dritten Schritt ist schließlich zu erörtern, wie wirkliche Interkulturalität auf soziopolitischer Ebene überhaupt zustande kommen kann und ob sich – ausgehend von den Diskursen der Interkulturalität in Bolivien und den USA – im Foucaultschen Sinn Hinweise auf ein transnationales Regelwerk der Aussagen aufzeigen lassen. Während im Bisherigen die Interkulturalität zwar als wünschenswerter Zustand der Kulturbegegnung dargestellt wurde, blieb in vorstehender Analyse vorerst offen, wie dieses Ideal der Völkerverständigung konkret implementiert werden könnte. In diesem Zusammenhang ist zunächst noch einmal ein Blick auf die Ausgangslage zu werfen, so wie sie von Philosophie und Sozialwissenschaf- 406 ten hinsichtlich ihrer Möglichkeiten der Interkulturalitätsherstellung reflektiert wird (s. Kap. 5.3.1). Ausgehend von diesen ist auf die Kontextualität als vielleicht größtes Hindernis für das Zustandekommen eines interkulturellen Dialogs und der damit verbundenen Etablierung einer ethnischkulturellen Gerechtigkeit einzugehen (s. Kap. 5.3.2). Abschließend lohnt ein Blick auf sozialpsychologische Erkenntnisse zu den unterschiedlichen Rollen und Bedürfnissen von „Tätern“ und „Opfern“ im Prozess der Versöhnung sowie auf allgemeinere Maß­nahmen zur Förderung eines interkulturellen Dialogs (s. Kap. 5.3.3). 5.1 Zur Begegnung von Bolivien und den USA Mit Morales und Obama betraten zwei Männer die politische Arena, die allein aufgrund des Einzigartigkeitsmerkmals ihres ethnisch-kulturellen Hintergrundes die Geschichte ihrer Länder verändert haben. Beide waren vergleichsweise jung, als sie ihr Amt antraten; beide kamen in Zeiten des Umbruchs an die Macht, in der „das alte System“ in einer Krise steckte – in Bolivien drohten zu Beginn des neuen Jahrtausends bürgerkriegsähnliche Zustände, und die USA sehen sich nach wie vor mit der schwersten Wirtschaftskrise seit der Great Depression konfrontiert. Dies sind die Kontexte, in denen die Aussicht auf einen Cambio bzw. Change mehr Anklang fand als die Vorstellung einer Kontinuität des Diskurses. Ein „neues Gesicht“ sollte Bolivien respektive die USA hin zu besseren Zeiten führen und dabei auch – so die Hoffnung vieler Wähler – die Jahrhunderte währende Ära der ethnisch-kulturellen oder rassischen Diskriminierung beenden. Ein neues Zeitalter der Interkulturalität schien in Bolivien und den USA zum Greifen nah und ließ darauf hoffen, dass es Morales und Obama letztlich sogar gelingen würde, miteinander in Dialog zu treten und die bisherigen Schwierigkeiten der bolivianisch-US-amerikanischen Beziehungen zu überwinden. Ungeachtet der Parallelen, die sich zwischen dem ersten indigenen und dem ersten afroamerikanischen Präsidenten aufzeigen lassen, treffen mit Bolivien und den USA einer der ärmsten Staaten Südamerikas und eines der reichsten Industrieländer – nach Maßstäben des Human Development Ranking (HDR) – aufeinander ( PNUD, 2013). Dieser Sachverhalt weist für sich genommen auf das ökonomische und politische Machtgefälle zwischen den Vereinigten Staaten und Bolivien hin, das sich grund­sätzlich in dem unterschiedlichen weltpolitischen Gewicht der beiden Länder abzeichnet. Darüber hinaus war dieses Machtgefälle in der Vergangenheit 407 die vielleicht prägendste Konstante des bolivianisch-US-amerikanischen Verhältnisses, die aufgrund dessen auch bei der Diskussion der Begegnung von Präsident Morales und Präsident Obama nicht außer Acht gelassen werden darf. Erst vor dem Hinter­grund dieser historischen Dimension, insbesondere aber vor dem Hintergrund der Entwicklungen seit Mitte des 20. Jahrhunderts als direktem Bezugspunkt für Evo und Obama, wird der Status quo der bolivianisch-US-amerikanischen Beziehungen bzw. des Verhältnisses der beiden Präsidenten hinsichtlich seiner Möglichkeiten und Grenzen in vollem Umfang verständlich. 5.1.1 Historische und persönliche Dimension In den zeitgeschichtlichen Entwicklungen ab den 1950er Jahren werden die Auswirkungen der bolivianisch-US-amerikanischen Machtasymmetrie unmittelbar eminent: Bereits die Nationale Revolution in Bolivien als vielleicht wichtigster Meilenstein für das mittelfristige Empowerment der indigenen Bevölkerung – immerhin wurden den Indígenas hier erstmals staatsbürgerliche Rechte zugesprochen – wurde von Washington kritisch beäugt. Mehr noch berichtet Crabtree (2005, S. XXXIV), die US-Regierungen der 1950er Jahre hätten nichts unversucht gelassen, um die mit der bolivianischen Revolution assoziierte Arbeiterbewegung unter Kontrolle zu halten. Ähnlich hält auch Zunes fest: „Indeed, it was clear from an early stage of the revolution that the economic weakness of Bolivia, combined with the economic power of the United States, allowed the U. S. to establish clear parameters for the revolution“ (2008). Im Gegensatz zu Crabtree und Zunes meint zwar die Politologin Waltraud Queiser Morales, die Reaktion der USA auf die Nationale Revolution sei von einer konstruktiven Grundhaltung geprägt gewesen und leitet hieraus ab: „[This U. S. policy] became the basis for more than a decade of close, cooperative relations“ (2006, S. 33). Gleichzeitig gibt aber auch sie zu, dass Evos Wahl im Jahr 2006 ein Mandat für Boliviens Souveränität in innenpolitischen Angelegenheiten gewesen sei (2006, S. 33). Die Nationale Revolution mag also innenpolitisch bedeutsame Veränderungen angestoßen haben, einen Befreiungsschlag gegenüber einer hegemonialen Vormachtstellung jeglicher unterdrückender Akteure – innenpolitisch wie außen­po­li­tisch – bedeutete sie jedoch nicht.305 305 Diese Ausführungen deuten bereits darauf hin, dass die USA der Nationalen Revolution nicht im Sinne der wenige Jahre zuvor formulierten Truman-Doktrin begegneten. Diese hätte eigentlich erwarten lassen, dass die Vereinigten Staaten bemüht sein würden, 408 Stattdessen erlangte die strukturelle Veränderung der bolivianischen Gesellschaft, die von der Nationalen Revolution angestoßen worden war, im Angesicht des Kalten Krieges einen geradezu bedrohlichen Charakter für die USA, den letztgenannte durch die gezielte Subvention des privaten Sektors in Bolivien einzudämmen versuchten.306 Als symptomatische Reaktion auf die Red Scare zeigten sich die Vereinigten Staaten z. B. auch darum bemüht, 1964 die Regierungsbeteiligung des Gewerkschafts­f unk­tionärs Lechín Oquendo zu verhindern. In Anbetracht der Bedrohung, die die USA durch den Kalten Krieg empfanden, verwundert es kaum, dass ihre oppositionelle Haltung gegenüber jeglicher Mobilisierung der gesellschaftlichen Basis sie schließlich sogar dazu veranlasste, der Ära der Militärdiktaturen in Bolivien von Barrientos Ortuño bis Banzer Suárez insgesamt unterstützend gegenüberzustehen (Crabtree, 2005, S. XXIV; Zunes, 2008). Tatsächlich setzte sich die US-amerikanische Einmischung in die bolivianische Politik im Verlauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fast ununterbrochen fort: Zwar meint Bedregal Gutiérrez (2003, S. 216), Präsident Kennedy habe grundsätzlich Verständnis für die bolivianische Revolution gezeigt und erst mit Johnson habe jene US-amerikanische Ideologie ihren Anfang genommen, die sich gegen jegliche kommu­nistische Strömung zu verteidigen versuchte. Im Unterschied zu Bedregal Gutiérrez geht jedoch beispielsweise Dent davon aus, dass Kennedy ebenfalls von einer antikommunistischen Motivation angetrieben worden sei, obwohl er sich zugleich dem damaligen bolivianischen Präsidenten Paz Estenssoro eng „die freien Völker zu unterstützen, die sich der Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder durch Druck von außen widersetzen“ (Truman zit. n. Heideking, 2003, S.359). Im Gegensatz zu Trumans Formulierung bauten die USA jedoch in der Folge ihre hegemoniale Vormacht­stellung gegenüber Bolivien weiter aus und übten selbst „Druck von außen“ auf das Andenland aus (s. u.). 306 Abweichend hiervon führt Dent (1999, S. 43) die US-amerikanischen Bedenken gegenüber der Nationalen Revolution weniger auf die durch sie ausgelösten gesellschaftlichen Veränderungen zurück als auf ideo­logisch-moralische Vorbehalte gegenüber der Führungsriege der MNR: Diese habe sich zusammengesetzt aus früheren Nationalsozialisten sowie aus Marxisten mit einer äußerst kritischen Einstellung gegenüber den USA. Dent nennt allerdings an dieser Stelle weder konkrete Namen noch macht er Quellenangaben zur Unter­ stützung seiner Argumentation. Dies lässt vermuten, dass es sich möglicherweise um einen Vorwand der USA handelte, der von den eigentlichen ökonomischen Gründen bzw. der Sorge um die eigene Vormachtstellung in Lateinamerika ablenken sollte. Ähnlich kommt auch Queiser Morales (2006, S. 27) zu dem Schluss, die Reaktionen der USA auf revolutionäre Umbrüche im Ausland seien oftmals abhängig gewesen von ihren jeweiligen machtstrategischen, ideologischen und ökonomischen Interessen. 409 verbunden gefühlt habe. Des Weiteren weist Dent (1999, S. 43 ff.) darauf hin, dass es Johnson gewesen sei, während dessen Präsidentschaft Ché Guevara 1967 in Bolivien gefangen und ermordet worden sei. Auch wenn der Erschießungsbefehl vom damaligen bolivia­nischen Präsidenten Barrientos Ortuño ausging, so seien die USA durch die Ent­sen­dung von CIA-Agenten und einer weiteren Spezialeinheit doch am Aufspüren des Guerilla­f ührers maßgeblich beteiligt gewesen (vgl. Kryzanek, 1995, S. 398, 406). In diesem Akt zeigte sich somit erneut die anti-kommunistische Gesinnung als hand­ lungs­bestimmende Motivation der USA, die jegliche Einmischung in bolivianische Belange zu rechtfertigen schien. Im Laufe der darauffolgenden Jahre verlagerte sich der Schwerpunkt der US-amerikanischen Bemühungen vom Kampf gegen den Kommunismus hin zur Eindäm­mung des internationalen Drogenhandels, bis schließlich in den 1980ern, nach dem sogenannten Kokain Coup von General Luis García Meza (1980/81) (Dent, 1999, S. 45), an die Stelle des Kalten Krieges weitgehend der „Krieg gegen die Drogen“ (Crabtree, 2005, S. XXV; e. Ü.) getreten war.307 Mit ihm wandte sich Washington – bzw. die US-amerikanische Botschaft in La Paz, LPZ, – gegen den bolivianischen Coca-Anbau, manipulierte aber auch maßgeblich die nationale Entscheidungsfindung und unterminierte somit systematisch die Autorität der bolivianischen Regierung und Behörden (Crabtree & Whitehead, 2001, S. 230). Da ein Teil der bolivianischen Coca-Produktion dem Kokainkonsum in den USA diente, war es verständlich und gerechtfertigt dem internationalen Drogenhandel den Kampf anzusagen. Allerdings überschritten die Vereinigten Staaten in ihrem „Coca-Kreuzzug“ deutlich die Grenzen eines respektvollen Miteinanders. In diesem Zusammen­hang betitelt Crabtree (2005, S. XXV) die nachdrückliche Machtdemon­stra­tion der Vereinigten Staaten als „offen interventionistische Position“ (Crabtree, 2005, S. XXV; e. Ü.) und verweist darauf, dass die USA auch nicht davor zurückschreckten, dem bolivianischen Präsidenten Jaime Paz Zamora (MIR, 1989–1993) aufgrund einer angeblichen Verbindung zum Drogengeschäft die Einreise in ihr Land zu verweigern (vgl. Dent, 1999, S. 48). 307 Die Ära von García Meza gilt als eine der blutigsten in der bolivianischen Geschichte; zudem war unter seiner Regierung eine exponentielle Zunahme des Drogenhandels zu verzeichnen. Die Drogenproduktion war dann auch das handlungsleitende Motiv für die USA, während das brutale Vorgehen von García Meza und seiner Regierung eine untergeordnete Rolle gespielt zu haben scheint (Mesa Gisbert, 2008b, S. 567 ff.). 410 Bolivien wurde nicht allein durch die USA, die versuchten, maßgeblichen Einfluss auf den Kurs des Andenstaates zu nehmen, unter Druck gesetzt. Auch die finanzielle Abhängigkeit von den internationalen Geldgebern ließ jegliche bolivianische Regie­r ung zur vom Ausland gesteuerten Marionette werden. Dies führt Crabtree zu der Beo­bachtung: Parecería que los gobiernos bolivianos se sienten más en deuda con la presión de los extranjeros que con el pueblo que los había elegido. La manera abierta en que los embajadores estadounidenses intervenían en el escenario interno para lograr resultados políticos favorables a Washington muchas veces pusieron a los gobiernos y a sus funcionarios en ridículo frente al público.308 (2005, S. XXVf) Vizepräsident García Linera et al. gehen noch einen Schritt weiter und definieren die Hörigkeit der bolivianischen Regierungen bzw. den Machtmissbrauch seitens der Vereinigten Staaten als „diskursive Konstruktion einer Art Kolonialismus“ (2005, S. 444; e. Ü.). Neben dieser theoretisch reflektierten ideologischen Komponente der USamerika­ni­schen Hegemonialpolitik enthält das asymmetrische Verhältnis der beiden amerikanischen Länder natürlich auch eine unmittelbare Erlebnisseite. Diese spiegelt sich nicht zuletzt in den Erinnerungen der Cocaleros wider: Während der „kolonialistischen“ Ära des Coca-Krieges wurden sie nur zu oft Opfer von Verhaf­t ungen, Misshandlungen und anderen Arten der missbräuchlichen Machtausübung, die im Zusammenhang mit der US-amerikanischen Coca-Politik standen (García Linera et al., 2005, S. 444 f.). Tatsächlich nahmen die Auswirkungen der US-Antidrogenpolitik auf die bolivianische Gesellschaft ein bedenkliches Ausmaß an: For many Bolivians, U. S. intervention in Bolivia has left a distinctly bitter taste. Bolivia’s draconian drug control law, Ley 1008, implemented in 1988 under heavy U. S. pressure, made illegal any coca cultivation beyond a 12,000-hectare limit specified as sufficient for meeting legal demand. The law also criminalized many campesino coca growers by not discriminating between cocaine and the unpro- 308 „Es schien, als fühlten sich die bolivianischen Regierungen eher dem Druck des Auslands verpflichtet als dem Volk, das sie gewählt hatte. Die offene Art, in der die US-amerikanischen Botschafter in das interne Geschehen eingriffen, um politische Resultate im Sinne Washingtons zu erzielen, gaben die Regierungen und ihre Funktionäre oftmals öffentlich der Lächerlichkeit preis“ (e. Ü.). 411 cessed coca leaf. In 2004, 40 percent of people in Bolivia’s jails were imprisoned under Ley 1008, and 77 percent of them remained uncharged with any crime, this even after a 1999 reform. (Gordon, 2006) Insofern überrascht es kaum, wenn auch Evo als früherer Cocalero eine kritische Haltung gegenüber dem US-amerikanischen „Engagement“ in Bolivien einnimmt – ebenso wie er selbst aufgrund dieser biographischen Verbindung und der sozialis­tischen Gesinnung seiner Partei wohl ein „rotes Tuch“ für den klassischen US-amerika­nischen Diskurs darstellt. Ganz im Sinne dieser traditionellen Feindbild­kon­struktion ermahnte auch der damalige US-Botschafter Manuel Rocha die bolivianische Bevölkerung anlässlich der Präsidentschaftswahlen von 2002, sie solle keinesfalls für Evo Morales stimmen, und bezeichnete das heutige Staatsoberhaupt bei dieser Gele­gen­heit als „Drogenterroristen“ (Crabtree, 2005, S. 23; e. Ü.). Das Verhältnis der USA zu Evo war somit bereits vor seiner tatsächlichen Wahl zum ersten indigenen Präsi­den­ten deutlich getrübt. Hierzu dürfte auch beigetragen haben, dass sich Ex-Präsident Sánchez de Lozada, als sich die Proteste gegen ihn weder beruhigen noch niederschlagen ließen, im Oktober 2003 in die Vereinigten Staaten absetzte. Wenige Tage nach seinem Rücktritt und fluchtartigen Verlassen des Landes, habe der Ex-Präsident dann – so berichtet Sivak (2008, S. 160) – von Washington, DC, aus davor gewarnt, Bolivien könne zu einer Art drogenexportierendem Afghanistan werden. Angesichts der Beobachtungen, dass Sánchez de Lozada selbst größtenteils in den USA aufgewachsen war, dass er Spanisch nur mit einem US-amerikanischen Akzent spricht (Mesa Gisbert, 2008b, S. 594 f.) und dass er nun auch noch den gesamten bolivianischen Staat mit dem damals vielleicht wichtigsten symbolischen Staatsfeind der USA verglich, hätte der Bruch zwischen Evo und dem Ex-Präsidenten, aber auch zwischen dem Bolivien der Ära Morales und den Vereinigten Staaten, kaum größer sein können. Entsprechend stand Evos Machtübernahme ganz im Zeichen davon, sich und sein Land von jenem „Imperium“ zu distanzieren, das ihn als Terroristenführer, Drogen­händler und sogar Attentäter bezeichnet hatte (Sivak, 2008, S. 284). Diese Entfrem­dung kann durchaus als beiderseitiger Prozess bezeichnet werden, insofern als bei­spiels­weise dem Vizepräsidenten García Linera 2006 die Einreise in die USA verweigert wurde: Zwar hatte dieser zunächst ein Visum erhalten, doch wurde er aufgrund seiner vergangenen Mitgliedschaft beim EGTK seitens der USA nach wie vor als poten- 412 tieller Terrorist geführt, weshalb ihm kurzfristig doch untersagt wurde, US-amerikanischen Boden zu betreten. Auch andere bolivianische Politiker der Regie­r ung Morales hatten in Evos erstem Amtsjahr Schwierigkeiten, in die USA einzu­reisen. Dies wiederum trug dazu bei, dass der bolivianische Präsident sich bald – unter­stützt durch seinen indigenen Kanzler Choquehuanca – für eine rachsüchtige Interpretation des andinen Reziprozität-Konzepts aussprach und verfügte, dass US-Bürger nun ebenfalls ein Visum benötigten, um die bolivianische Staatsgrenze zu passieren (Sivak, 2008, S. 268 f., 273). Die anfängliche Sabotagepolitik der USA gegen Morales wurde von diesem also mit gleichen Mitteln beantwortet. Dabei steht außer Frage, dass diese Auslegung der Reziprozität eher an ein alttestamentarisches „Aug‘ um Aug‘, Zahn um Zahn“ erinnert als an das traditionelle andine Verständnis der Reziprozität. Außerdem kam es zur weiteren – diesmal persönlichen – Desavouierung: Als Morales die Nationalisierung der natürlichen Ressourcen des Landes ankündigte, hätten die Vereinigten Staaten, so der Sprachwissenschaftler und Philosoph Noam Chomsky, dem indigenen Präsidenten seine demokratische Machtbasis in Abrede gestellt. Sarkastisch stellt Chomsky fest: „We have a particular concept of democratic, which means ‚do what we say‘. Then a country is democratic, or is becoming democratic. But if a country does what the population wants, it’s not democratic“ (2007, S. 47). Wohlgemerkt formulierte Chomsky seine US-amerikanische Demokra­tie­definition und Einstellung gegenüber dem (ethnisch-kulturell) Anderen vor der Ära Obama und verwies damit auf einen Missstand, wie ihn schon Queiser Morales vorher­gesehen hatte, als sie 2006 anmahnte: „Washington’s response to Morales must be measured and constructive, and not overreact to the anti-American and anti-imperialist rhetoric that he uses to rally his constituency“ (S. 30). Folglich sind bezüglich der historischen und der persönlichen Dimension der bolivianisch-US-amerikanischen Begegnung zwei grundsätzliche Einstellungs- und Verhaltensweisen zu identifizieren, die das Verhältnis der Länder bis heute trüben: Erstens ist hier das Unrecht der USA zu nennen, in der Vergangenheit die Souveränität des Andenstaates missachtet und sich auf missbräuchliche Weise in nationale Belange eingemischt zu haben – eine Beobachtung aufgrund derer Salgado im Interview pessi­mis­ tisch verlauten ließ: „Ich glaube, dass dieses Verhältnis schon verloren ist“ (2010, S. 6; e. Ü.). Zweitens deutete sich bereits vor Evos Amtsantritt an, dass dieser dazu neigen würde, die Vereinigten Staaten moralisch zu verurtei- 413 len – nicht zuletzt um hier­durch die neue nationale Identität des Andenlandes zu verankern (Urioste F. de C., 2010, S. 3, 7) sowie um seine eigenen (rhetorischen) Grenzüberschreitungen zu recht­fer­tigen und den USA die alleinige Schuld für das problembeladene bolivianisch-US-amerikanische Verhältnis zuzuschieben. Schließlich gibt es noch eine dritte Komponente, die als prägendes Moment auf die gegenwärtige bolivianisch-US-amerikanische Beziehung einwirkt: die Präsidentschaft Barack Obamas. Im Unterschied zu Evo, dessen Verhältnis zu den USA durch eine historische und persönliche Dimension geprägt ist, trat Obama sein Amt an, ohne dass er eine wie auch immer geartete Verbindung zu Lateinamerika oder gar zu Bolivien in den Vordergrund gestellt hätte. In diesem Sinne findet in seinem „politisches Manifest“ (Mieder, 2009, S. X; e. Ü.) genanntem Werk The Audacity of Hope Latein­amerika nur kurz Erwähnung, als Obama die US-Außenpolitik der prä-9/11-Ära Revue passieren lässt. Hier erzählt er, dass Theodore Roosevelt (Republican, 1901–1909) aus der Monroe Doktrin abgeleitet habe, im Zweifelsfall in Lateinamerika zu intervenieren, falls eine dortige Regierung nicht den USamerikanischen Wünschen ent­spre­chen sollte (2008b, S. 333).309 Im Weiteren meint Obama (2008b, S. 343), es sei das Anliegen der Clinton-Regierung gewesen, die Demokratie unter anderem auch in Lateinamerika zu stärken. Eine explizite Wertung des tatsächlichen US-amerika­ni­schen „Engagements“ in Lateinamerika erfolgt jedoch nicht. Vielmehr hat es den Anschein, als sei diese Region für Präsident Obama ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Dies würde im Positiven erwarten lassen, dass der afroamerikanische Präsident Lateinamerika bzw. Bolivien relativ unvoreingenommen gegenübertritt; gleichzeitig fehlen aber auch Anhaltspunkte, die auf ein besonderes Interesse an dem Kontinent im Allgemeinen oder gar dem Andenstaat im Besonderen hinweisen würden und sich insofern handlungsleitend auf seine Amtszeit auswirken könnten. 309 Ähnlich formuliert auch Heideking zur Monroe-Doktrin: „Hauptziel blieb … stets, Lateinamerika und die Karibik … als exklusive Interessensphäre der USA gegen Konkurrenz und Einmischung anderer Großmächte abzuschirmen“ (2003, S. 291 f.). Heideking bezieht sich an dieser Stelle zwar auf die Regierungszeit von F. D. Roosevelt; wie vorstehende Ausführungen deutlich machen, ist das Primat der US-amerikanischen Interessen aber auch heute noch aktuell auf dem amerikanischen Doppelkontinent, wobei die Durchsetzung der US-amerikanischen Perspektive sogar deutlich stärker betont wird als die Verteidigung der einzelnen Staaten gegen­über nicht-amerikanischen Nationen. 414 5.1.2 Evos und Obamas tatsächliche Begegnung Zunächst, im Vorfeld von Obamas Inauguration, galt dieser sogar für Evo Morales als Hoffnungsträger: Während der bolivianische Präsident Bush Jr. – angesichts der Kriege in Afghanistan und Irak310 sowie angesichts der desolaten US-amerikanischen Wirtschaftslage – als „schlechtesten Präsidenten der ganzen Welt“ (01.03.2009; e. Ü.) bezeichnete, hegte Morales zumindest anfangs noch die Hoffnung, dass mit Obama eine neue Ära beginnen würde. Sie sollte sich unter anderem auszeichnen durch die Aufhebung jeglicher Sanktionen gegenüber Bolivien, durch eine Akzeptanz des ethnisch-kulturell motivierten Coca-Anbaus und eine grundsätzliche Verbesserung des bolivianisch-US-amerikanischen Verhältnisses (Morales, 16.12.2008; 11.03.2009). Evo begründete die Möglichkeit einer Annäherung mit den Erfahrungen, die Obama aufgrund seines afroamerikanischen Hintergrunds geprägt hatten; zu ihnen zählte Morales – ähnlich seinem eigenen Erleben als Indígena – die erlittene Diskriminierung ebenso wie das allmähliche Empowerment der Marginalisierten, das schließlich einen der ihren zum Präsidenten werden ließ. Diese Parallelen könnten, so erklärte Morales (22.01.2009b) zwei Tage nach Obamas Inauguration, nicht nur die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder verbessern, sondern möglicherweise sogar eine Ära der Kooperation einläuten. In den ersten Monaten von Obamas Amtszeit schien es, als wären diese Hoffnungen berechtigt und könnten tatsächlich zu einem Neubeginn der bolivia­ nisch-US-amerikanischen Beziehungen führen. Morales (13.03.2009) setzte darauf, dass Obama – im Einklang mit dem Konzept der Interkulturalität – eine Begegnung auf Basis eines wechselseitigen Respekts s­ uchen würde. Evo fand dies zunächst bestätigt, als sich der US-amerikanische Präsident beim Amerika-Gipfel in Trinidad und Tobago im April 2009 für einen internationalen Dialog auf Augenhöhe aussprach und (entgegen der Gepflogenheiten seines Amtsvorgängers) auch nach seiner eigenen Ansprache dem Treffen weiter beiwohnte, um die Beiträge der anderen Staats­oberhäupter 310 Den Krieg in Irak bezeichnet Morales (11.09.2010) an anderer Stelle – ausgerechnet am neunten Jahrestag der Anschläge von 9/11 – als zweites Vietnam mit der Begründung, die US-Truppen hätten sich auch hier auf­g rund der fortwährenden gewalttätigen Aufstände zum Abzug gezwungen gesehen. Ein siegreiches Moment stellt Evo dem US-Militär dadurch in Abrede; stattdessen weist er durch den Vergleich mit dem Vietnam-Krieg und das Datum seiner Äußerung auf zwei überaus wunde Punkt im US-amerikanischen Narrativ hin. 415 anzuhören (Morales, 22.04.2009b; 04.05.2009). Darüber hinaus habe Obama zum Ausdruck gebracht, dass „er jegliche gewalttätige Handlung gegen die bolivianische Regierung verurteil[e]“ (Morales, 21.04.2009; e. Ü.). Analog zu dieser Aussage begrüßte Morales (30.06.2009) auch, dass die US-Regierung dem Militär­putsch gegen den honduranischen Präsidenten José Manuel Zelaya im Juni 2009 ablehnend gegenüber stand. Diese Haltung war für Morales ein Indiz für einen historischen Wandel, hatte er noch gut zwei Monate zuvor kritisch angemerkt, dass bisher, d. h. bis zum Beginn der Ära Obama, gegolten habe: Yo escuché en algún momento comentario que dice, en toda Latinoamérica habían golpes de estado, en toda América excepto en estados [sic] Unidos, y por qué no había golpe de estado, golpe militar en Estados Unidos, porque no había un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos.311 (22.04.2009a) Doch schon bald wurde Evos Auffassung von Obama als Hoffnungsträger getrübt, als die US-Regierung Zollbegünstigungen für Bolivien aufzuheben drohte, die das Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act ( ATPDEA ) den südameri­ka­ni­schen Andenländern zugebilligt hatte, um durch die wirtschaftliche Begünstigung des legalen Handels indirekt das illegale Drogengeschäft unattraktiver werden zu lassen (Mesa Gisbert, 2008b, S. 616). Als Grund für die Aufhebung der Begünstigungen wurde, so Morales (01.07.2009), unter anderem aufgeführt, dass sich Bolivien bei der Eindämmung der Drogenherstellung nicht kooperativ genug gezeigt hätte. Morales gibt zwar zu, dass die Coca-Kultivierung in einigen Gegenden zugenommen habe. Zugleich leitet er aus der US-amerikanischen Stellungnahme jedoch ab, die Verei­nigten Staaten wollten erneut in die nationale Politik Boliviens eingreifen und nicht zuletzt sogar die Rechtmäßigkeit der bolivianischen Verfassung (etwa beim Thema der Enteignung von ungenutztem Land) anzweifeln. Diese Haltung sei ein Angriff der US-Regierung auf das bolivianische Volk; die Vereinigten Staaten träten nach wie vor in der Rolle eines Imperiums auf, das sich in fremde Belange einmische. Dies führte Morales zu der desillusionierten Einsicht, sich in Obama bzw. seiner Bedeutung für das bolivianisch-US-amerikanische Verhält- 311 „Ich habe irgendwann eine Bemerkung gehört, die lautete, dass es in ganz Lateinamerika Staatsstreiche gegeben habe, in ganz Amerika außer in den Vereinigten Staaten. Und warum gab es keinen Staatsstreich, keinen Militärputsch in den Vereinigten Staaten? Weil es in den Vereinigten Staaten keinen Botschafter der Vereinigten Staaten gibt“ (e. Ü.). 416 nis getäuscht zu haben: „Yo quiero decirle con mucho respeto al presidente Obama, si en Estados Unidos ha cambiado la fisonomía de los gobernantes pero no ha cambiado las políticas del imperio“312 (01.07.2009). Bei anderen Gelegenheiten relativiert Morales (01.03.2009; 02.07.2009) diese harsche Beurteilung, indem er zum einen anerkennt, dass der USPräsident ein nur schwer zu bewältigendes Erbe von seinem Amtsvorgänger übernehmen musste, und er zum anderen zwischen Obama als erstem afroamerikanischen Präsidenten der USA und den traditionellen Strukturen und Interessen der US-Regierung differenziert. In der Tat verteidigt Evo seinen US-amerikanischen Amtskollegen sogar, wenn es um die rassistischen Verunglimpfungen von dessen Person durch die Birthers geht (14.07.2009), und erklärt an anderer Stelle: „Estoy viendo que es una cosa es Obama y otra cosa es el imperialismo“313 (23.07.2009). Diese Strukturen aber zeichnen Evo zufolge das US-amerikanische „Imperium“ nach wie vor aus; gegen sie gibt er an, kämpfen zu wollen (26.09.2009). Erneut konstruiert sein Diskurs diesen Kampf nicht allein als Anliegen Boliviens, sondern als lateinamerikanisches, wenn nicht gar weltweites, Interesse: Morales (09.11.2009) erklärt etwa, Obama solle – um sich seines Friedensnobelpreises würdig zu erweisen – die US-Truppen aus der ganzen Welt zurückziehen, dadurch u. a. die Demokratie in Honduras wiederherstellen314 sowie alle ökonomischen Sanktionen gegen Kuba aufheben. Die Präsenz des US-amerikanischen Militärs unterminiere jegliche demokratische Verbindung zwischen dem Volk eines Staates und seiner Regierung (30.11.2009); die USA würden nur versuchen, ihre Interessen an natür­lichen Ressourcen unter dem Deckmantel einer angeblichen Terrorgefahr oder auch eines Kampfes gegen den Drogenhandel zu rechtfertigen (05.08.2010). Anstatt die Kriege in Irak und Afghanistan zu finanzieren, solle Obama lieber in das Leben der Menschheit investieren, indem er sich tatkräftig für die Ziele des Kyoto-Protokolls und den Schutz der Erde einsetze (18.12.2009). Eine solche Politik verfolge Obama aber bisher nur un312 „Ich möchte mit tiefem Respekt Präsident Obama sagen, ja, in den Vereinigten Staaten hat sich die Physiognomie der Regierenden geändert, aber das hat nicht die Politik des Imperiums verändert“ (e. Ü.). 313 „Ich sehe, dass Obama eine Sache ist und eine andere Sache ist der Imperialismus“ (e. Ü.). 314 Morales (24.07.2009) bezog sich hier auf die Präsenz der US-Streitkräfte in Honduras in Form des United States Southern Command. Bei dem US-Regionalkommando für Lateinamerika handelt es sich Evo zufolge um eine imperialistische Machtdemonstration, durch deren Präsenz die nationalen Interessen der lateinameri­ka­nischen Staaten gefährdet werden. 417 zureichend. In diesem Sinne erzählt Morales, beim Klima-Gipfel in Kopenhagen im Dezember 2009 den Wahlspruch gesehen zu haben: „[C]ambien el sistema, no al planeta tierra, cambien a Obama, no la Tierra“315 (05.01.2010). Diesen Slogan scheint auch Morales zu befürworten. Er erkennt zwar die historische Einzigartigkeit des ersten afroamerikanischen Präsidenten an, doch genügt ihm dieses Charakteristikum nicht, um seinem Amtskollegen längerfristig einen politischen Freibrief auszustellen. Im Gegenteil beharrt er darauf, das bolivianisch-US-ameri­kanische Verhältnis müsse frei von jeglichem Machtgefälle werden, um eine Zusammenarbeit der beiden Staaten zu gewährleisten (22.09.2009). Dabei weiß Morales (22.01.2009b), dass Bolivien womöglich für die USA nur eine untergeordnete Rolle spielt, dass das Andenland aber umgekehrt internationale Partnerschaften braucht, um die angestrebten politischen Reformen umzusetzen. An dieser Stelle wird deutlich, dass Evo sich sehr wohl der faktischen Machtdifferenz bewusst ist, die sich bereits aus dem diametral entgegengesetzten ökonomischen Gewicht von Bolivien und den USA ergibt. Die Notwendigkeit ausländischer Unterstützung bedeute jedoch nicht – dies betont Morales (23.03.2010a) –, dass die uneingeschränkte Souveränität Boli­v iens zur Debatte stünde. Zu wem sein Land diplomatische Beziehungen unterhalte – auch wenn es sich hierbei z. B. um Iran handle316 –, sei allein die Entscheidung des Plurinationalen Bolivien (Morales, 20.09.2010b). Eine Verbesserung des bolivianisch-US-amerikanischen Verhältnisses erscheint Morales daher zwar wünschenswert, nicht aber existentiell; im Übrigen meint er, dass Bolivien – auch wirtschaftlich – von den USA unabhängig sei (24.02.2010). Im selben Atemzug verweist Morales darauf, dass er auch nicht davor zurückscheuen würde, die United States Agency for International Development (USAID) des Landes zu verweisen, falls er durch deren Arbeit die Souveränität Boliviens gefährdet sehen sollte (05.06.2010). Diese Drohung ist durchaus bemerkenswert, gilt doch Bolivien seit über 50 Jahren als größter pro Kopf-Empfänger der US-Behörde für internationale Entwicklung (Healy, 2010b, S. 4 f.). 315 „[Ä]ndert das System, nicht den Planeten Erde, ändert Obama, nicht die Erde“ (e. Ü.). 316 Seit 2008 unterhält Bolivien wirtschaftliche Beziehungen mit Iran. Mahmud Ahmadinedschad besuchte das Andenland mehrfach, vergab Kredite von mehr als einer Milliarde US-Dollar und unterzeichnete ein Abkom­men für den Lithiumabbau im Salar de Uyuni, einem riesigen Salzsee im Departamento Potosí (La Razón, 13.12.2009). 418 Nichtsdestotrotz hatte sich Morales seit Anbeginn seiner Präsidentschaft stets als erklärter Skeptiker gegenüber möglichen Machenschaften der USEntwicklungs­behörde gezeigt, wobei seine Befürchtungen ausgerechnet durch eine Personalent­schei­dung Obamas neuen Aufwind erhielten, als der US-Präsident im Juni 2010 Mark Feierstein zum USAID -Beauftragten für Lateinamerika ernannte. Dieser hatte sich während des bolivianischen Präsidentschaftswahlkampfes von 2002 als politischer Berater von Evos Konkurrent Sánchez de Lozada hervorgetan und zuletzt im Präsi­dent­ schafts­wahlkampf von 2009 für einen politischen Gegner von Morales Partei ergriffen, als er Manfred Reyes Villa (Nueva Fuerza Republicana, NFR) unterstützte. Insofern ist es kaum verwunderlich, wenn Morales (05.06.2010) die Personal­ent­schei­dung seines Amtskollegen stark kritisiert und sie als Bestätigung seiner – vermutlich berechtigten (Hertzler, 2010)317 – Vorbehalte gegenüber möglichen imperialistischen Interessen der USA auffasst. Auch hier scheint für ihn zu gelten: „Yo tenía mucha esperanza que con el presidente Obama iba a cambiar las políticas [sic], pero no cambió, si algo ha cambiado es el color del presidente de Estados Unidos“318 (07. 05. 2010a). Dabei gehen Evo zufolge mit Obamas afroamerikanischem Hintergrund das Vermögen und die moralische Verpflichtung einher, sich in andere diskriminierte Gruppen einzufühlen und für deren Rechte einzusetzen. Dies, so der Bolivianer, habe Obama seinen Wählern versprochen; aufgrund seiner Botschaft des friedlichen und kulturübergreifenden gesellschaftlichen Miteinanders sei Obama an die Macht gekom­men. Hieraus erwachse unmittelbar die Verantwortung, sich als Präsident seines Wahl­ver­sprechens sowie seiner eigenen Wurzeln – insbesondere der Situation seines Vaters als Ausländer in den USA – zu erinnern. Besonders prägnant formuliert Evo diesen Appell an seinen Amtskollegen im August 2010 in einem Brief, mit dem er Obama dazu auffordert, das Einwanderungsgesetz von Ari- 317 Es scheint, als sei USA ID in der Vergangenheit tatsächlich dazu instrumentalisiert worden, die politischen Machtverhältnisse in Bolivien zu verändern. So hält etwa Zunes fest: „A cable from the U. S. Embassy in Bolivia last year revealed a USAID -sponsored ‚political party reform project‘ to ‚help build moderate, prodemocracy political parties that can serve as a counterweight to the radical MAS or its successors‘ … Despite numerous requests filed under the Freedom of Information Act, the Bush administration refuses to release a list of all the recipient organizations of USAID funds“ (2008). 318 „Ich hatte viel Hoffnung, dass sich mit Präsident Obama die [US-] Politik ändern würde, aber sie hat sich nicht geändert. Wenn sich etwas geändert hat, ist es die Hautfarbe des Präsidenten der Vereinigten Staaten“ (e. Ü.). 419 zona, Senate Bill 1070, zu verhin­dern. Dieses Gesetz sei rassistisch und versuche, ein System der Apartheid zu eta­blie­ren, das die Latinos marginalisiere und diskriminiere. Dabei, so erinnert Evo, seien die Vereinigten Staaten und ihr heutiger Wohlstand ohne die vielen Immigranten undenk­bar. Abschließend mahnt Morales: „Señor presidente, está en sus manos evitar que en su país retornen los oscuros días de persecución por el color de la piel y el origen racial“319 (05.08.2010).320 Morales sieht sich dazu legitimiert, Obama als Vertreter der Vereinigten Staaten zu ermahnen, mit der Begründung: Por lo menos Latinoamérica nunca ha buscado esta clase de normas discriminatorias sobre los emigrantes, sean norteamericanos, sean europeos, sean africanos, y sobre todo como originario de esta noble tierra, tengo cierta autoridad para pedir al presidente Obama a que no cometa un error histórico de permitir estas normas de discriminación, de expulsión, de marginación, y sobre todo de castigo racial, de castigo inhumano a los latinoamericanos que trabajaron para el desarrollo en Estado Unidos.321 (05.08.2010) Von einem Machtgefälle im Diskurs zu Lasten Boliviens kann hier sicherlich nicht die Rede sein. Evos Rolle ist nicht die eines untergeordneten internationalen Kontakts der USA, sondern die des – indigenen – Regierungsoberhaupts eines souveränen Boli­v ien, das nicht davor zurückscheut, die 319 „Herr Präsident, es liegt in Ihren Händen zu verhindern, dass die dunklen Tage der Verfolgung aufgrund der Hautfarbe oder der rassischen Herkunft in Ihr Land zurückkehren“ (e. Ü.). 320 Tatsächlich dürfte es kaum in Obamas Händen liegen, ein solches Gesetz zu verhindern, da er auf die Legis­lative der einzelnen Bundesstaaten kaum Einfluss hat. Entsprechend zeigte sich auch im Falle des Einwanderungsgesetzes von Arizona, dass dieses nicht vom US-Präsidenten außer Kraft gesetzt wurde, sondern vom U. S. Supreme Court als nichtverfassungsgemäß eingestuft wurde: Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschied am 25. Juni 2012, dass die Ermittlung des Aufenthaltsstatus nur gerechtfertigt sei, wenn die Person angeklagt sei, gegen ein lokales oder ein bundesstaatliches Gesetz verstoßen zu haben (Manuel & Garcia, 2012). 321 „Wenigstens hat Lateinamerika nie eine vergleichbare Art diskriminierender Gesetze gegenüber Auswan­derern – seien sie US-Amerikaner, seien sie Europäer, seien sie Afrikaner – verfolgt. Und insbesondere als Autoch­t honer dieser edlen Erde habe ich eine gewisse Autorität, um Präsident Obama zu bitten, nicht einen historischen Fehler zu begehen, indem er diese Gesetze der Diskriminierung, der Abschiebung, der Marginalisierung und vor allem der rassischen Bestrafung, der unmenschlichen Bestrafung der Latinos erlaubt, die für die Entwicklung der Vereinigten Staaten gearbeitet haben“ (e. Ü.). 420 nördliche Supermacht auf mögliche Unzu­läng­lichkeiten hinzuweisen. Der „Coca-Terrorist“ Evo Morales appelliert – mal mehr mal weniger diplomatisch im Ton – an die Person des Friedensnobelpreisträgers und US-Präsidenten Barack Obama. Morales mahnt innenpolitische Missstände in den USA an, er fordert Obama dazu auf, sich der internationalen Mehrheit zu beugen, Kuba und Palästina nicht länger zu blockieren und dadurch die Implementierung der Menschen­rechte zu sichern (23.09.2010). Evo inszeniert sich seinem Amtskollegen gegenüber als Anwalt der Marginalisierten – seien dies Völker oder Staaten – und leitet eben aus seiner Rolle als Angehöriger einer traditionell diskriminierten Ethnie und eines histo­ risch ausgebeuteten Staates das Recht ab, Obama mit seinen moralischen Überzeu­gun­gen zu konfrontieren. Morales schreckte auch nicht davor zurück, Obama zu kritisieren, als dieser auf dem Amerika-Gipfel vergangene Fehler und Unzulänglichkeiten der US-Regierungen in der Begegnung mit den lateinamerikanischen Staaten eingestand, um dann aber hinzuzufügen: „I didn’t come here to debate the past – I came here to deal with the future. I believe … that we must learn from history, but we can’t be trapped by it“ (Obama, 17.04.2009). Eben dieses Fokussieren auf die Zukunft missfällt Morales, der lieber der Vergangenheit mehr Gewicht geben möchte. Ihm zufolge obliegt es Obama, die Fehler seiner Amtsvorgänger, insbesondere aber die von Bush Jr., zu beheben und im Einzelfall auch Entschädigungen für geschehenes Unrecht in die Wege zu leiten (Morales, 21.04.2009; 27.06.2009). Wie diese Entschädigungen im Detail aussehen sollen, bleibt offen. Es wird jedoch deutlich, dass von Evos Seite das bolivianisch-US-amerikanische Verhältnis weit von einer Normalisierung der diplomatischen (und wirtschaftlichen) Beziehungen entfernt ist, wenn gegenwertig die Schuld- bzw. Entschädigungs- und Wiedergutmachungs­t hematik im Vordergrund stehen. Positiv im Sinne des Konzepts der Interkulturalität ist immerhin, dass Morales sich Obama gegenüber weniger ausfallend äußert als in seinen üblichen Hasstiraden auf die Vereinigten Staaten (s. Kap. 3.2.2). Im Gegenteil weiß Morales (24.09.2010) auch einzelne positive Aspekte der bolivianisch-US-amerikanischen Begegnung hervorzuheben, wenn er etwa begrüßt, dass Obama vor dem US-Kongress die Bemühungen Boliviens im Kampf gegen den Drogenhandel anerkennend erwähnt. Doch selbst wenn mitunter von Evos (und von Obamas) Seite die Notwendigkeit einer respektvollen Begegnung auf Augenhöhe betont wird, 421 scheint es eine Möglich­keit für einen tatsächlichen interkulturellen Dialog der beiden Staatsmänner bisher kaum gegeben zu haben. So verweisen beide Präsidenten auf besagten Amerika-Gipfel in Trinidad und Tobago im April 2009 als ihr bislang einziges Zusammentreffen (außerhalb von Zusammenkünften im Rahmen der Vereinten Nationen). Allerdings hebt Morales (24.02.2010) auf dieses Treffen bezogen hervor, dass er auch hier nicht mit Obama unter vier Augen gesprochen habe, sondern dass sie lediglich gemeinsam an einer Sitzung teilgenommen hätten. Obama dagegen erzählt, „I had very cordial conversations with President Morales and President Correa“ (19.04.2009) – diese positive, jedoch sicherlich auch diplomatisch motivierte Wortwahl lässt keine eindeutigen Schlüsse auf die Vertraulichkeit des Settings zu – und berichtet weiter, bei den Gesprächen die Möglichkeit einer konstruktiven Zusammenarbeit unter Achtung der Souveränität des jeweiligen Partners betont zu haben. Weiter verspricht der Afro­ameri­kaner, den demokratisch gewählten Regierungen der südamerikanischen Staaten mit Respekt begegnen zu wollen unabhängig von möglichen Meinungs­ver­schie­denheiten in bestimmten politischen Angelegenheiten (19.04.2009).322 Diese Botschaft könnte zwar auf die Etablierung eines interkulturellen Dialogs hindeuten, doch ist dies tatsächlich die einzige Ansprache des US-Präsidenten im Untersuchungs­zeitraum, in der der Name des bolivianischen Präsidenten überhaupt fällt oder ein expliziter 322 Immerhin wurde gut anderthalb Jahre nach diesem Treffen von Morales und Obama ein Abkommen zwischen Bolivien und den Vereinigten Staaten unterzeichnet, demzufolge die bilateralen Beziehungen zukünftig von wechselseitigem Respekt geprägt sein und die Kooperation der beiden Länder gestärkt werden soll. Des Weiteren erklärten der bolivianische Vizeaußenminister Juan Carlos Alurralde und die Under Secretary for Global Affairs Maria Otero durch ihre Unterschrift die Absicht Boliviens und der USA, die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen Landes anerkennen, sich für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen, den Drogenhandel bekämpfen, die Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung ausweiten und die Handels­beziehungen stärken zu wollen (Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia & Gobierno de los Estados Unidos de América, 2011; U. S. Department of State, 2011). – Allerdings ist anzumerken, dass Morales und Obama nicht unmittelbar an der Formulierung des Abkommens beteiligt waren – Evo musste der Ratifizierung des Schriftstücks durch die Asamblea Legislativa Plurinacional immerhin zustimmen (Ley № 227, 2012) – und somit der darin bekundete Wille zur Kooperation nicht einer direkten Absichtserklärung der Präsidenten entspricht. Dennoch ist das Abkommen bedeutsam, insofern als hierdurch erstmals seit der Ausweisung des US-Botschafters Goldberg im Jahre 2008 eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen bis hin zur erneuten Entsendung eines Botschafters nach Bolivien in greifbare Nähe rückt. Hierzu muss Bolivien den von US-Seite designierten Kandidaten für den Posten des Botschafters jedoch noch genehmigen (Paredes, 2013). 422 Bezug auf das Andenland zu finden ist. Von Obamas Seite kann folglich trotz seiner grundsätzlich versöhnlichen Botschaft kaum von einem interkulturellen Dialog mit Evo die Rede sein, da hierzu bisher schlechthin die praktische Gelegenheit fehlte. Mehr noch deutet die gegenwärtige Lage der Vereinigten Staaten mit Wirtschafts­k rise, hart umkämpften Wahlen und internationalen militärischen Einsätzen kaum darauf hin, dass Obama in naher Zukunft seinem bolivianischen Kollegen mehr Bedeu­tung beimessen wird – obwohl grundsätzlich denkbar wäre, dass Bolivien etwa aufgrund des weltweit größten Lithiumvorkommens im Salar de Uyuni für die USA von wirtschaftlichem Interesse wäre (Cohen, 2010, S. 9 f.). Jedoch scheint der gesamt­politische Kontext der Ära Obama eine Prioritätensetzung der präsidentiellen Aktivi­ täten zu verlangen, in der der Andenstaat nicht vorkommt. Ähnlich stellt auch der frühere Außenminister Mexikos Jorge Castañeda fest: „There is little question that in the field of foreign policy, Latin America is far from being a priority for the Obama administration“ (2009). So verwundert es kaum, dass Obama in der dritten Fernsehdebatte des Präsidentschaftswahlkampfes 2012 verlauten ließ: „[O]ur alliances have never been stronger – in Asia, in Europe, in Africa, with Israel“ (23.10.2012). Lateinamerika (oder gar Bolivien) war dagegen nicht Teil dieser Auflistung enger Verbündeter, sondern wurde mit keinem Wort erwähnt. 5.1.3 Evo und Obama im interkulturellen Dialog? Fast hat es den Anschein, als zeichne sich das bolivianisch-US-amerikanische Verhält­nis der Ära Morales-Obama bestenfalls durch seine Inexistenz aus, wenn der afroamerikanische Präsident dem Andenstaat kaum Beachtung schenkt. Schlimmstenfalls aber hat sich das Verhältnis durch Obamas Amtsantritt nicht geändert: Schließlich kritisiert Morales die USA – selbst wenn er die Person Obamas an einigen Stellen in Schutz nimmt – nach wie vor scharf und greift sie aufgrund des vergangenen Unrechts an; zugleich ist nur schwer zu bestimmen, inwiefern die Vereinigten Staaten nach wie vor daran interessiert sind, sich in nationale bolivianische Belange einzumischen. Es scheint, als sei im Hinblick auf die Kontextualität der beiden Staaten die politische und ökonomische Machtasymmetrie umso schwieriger zu überwinden, als die USA in der Vergangenheit die politische Labilität des Entwicklungslandes mit aufrechterhalten, wenn nicht gar unmittelbar gefördert haben. Hier wirken sich die Erinnerung an vergangene 423 Ungerechtigkeiten und die Frage nach der Verantwortung für die fortbestehenden sozioökonomischen Schwierigkeiten Boliviens erschwerend auf das Zustandekommen eines unvoreinge­nom­menen und ebenbürtigen interkulturellen Dialogs aus. Zugleich lässt die Diskussion von Evos und Obamas tatsächlicher Begegnung aber auch erkennen, dass es bisher schlechthin kein Zusammentreffen der beiden Staats­männer gab, dessen Umstände das Eintreten in einen solchen interkulturellen Dialog überhaupt gestattet hätten. Erst diese Beobachtung erlaubt, die Hypothese in den Raum zu stellen, dass der Etablierung eines interkulturellen Austauschs bisher weniger die historisch bedingte Trübung des bolivianisch-US-amerikanischen Verhältnisses im Wege stand als das Ausbleiben einer geeigneten Begegnung von Evo und Morales. Ihr Treffen sollte idealerweise außerhalb des internationalen politischen Protokolls erfolgen, um einem gegenseitigen vertieften Kennenlernen und Austausch Raum zu geben. Teil dessen wäre sicherlich, wie auch Healy (2010b, S. 11 f.) anmerkte, den Einfluss des jeweiligen Regierungsstabs auf die Begegnung zu minimieren und poten­tiell konfliktbeladene Themen, in denen sich das Machtgefälle und die Meinungs­verschiedenheiten der beiden Länder direkt widerspiegeln – wie etwa der Streit um den Coca-Anbau –, zunächst beiseite zu lassen, um ein Aufeinanderzugehen fern der historisch trennenden Momente zu ermöglichen. Stattdessen hat Healy vorgeschlagen, dass sich die beiden Präsidenten beispielsweise über das Problem der weltweiten Armut austauschen könnten; im Dialog über dieses Thema würden sie womöglich zu der Einsicht gelangen, dass sie beide für die gleichen Ziele kämpfen. Anstelle der entzweienden Unterschiede träte dann das Entdecken von Gemeinsamkeiten, die den Ausgangspunkt für eine konstruktive Begegnung auf Augenhöhe darstellen könnten. Denkbare Gemeinsamkeiten wären etwa die Parallelen in Evos und Obamas Biographien, insofern als beide aufgrund ihres ethnisch-kulturellen Hintergrunds darum kämpfen mussten, eine Machtposition zu erlangen, die ihnen erlauben würde, sich gegen die Diskriminierung einzusetzen (Healy, 2010b, S. 11 f.). Schwierig könnte in diesem Zusammenhang jedoch sein, dass bereits früh in Obamas Karriere sein hoher Bildungsgrad und seine (vor allem für bolivianische Verhält­nisse) beachtlichen finanziellen Möglichkeiten auf einen gänzlich anderen Hand­lungs­spielraum des US-Amerikaners hinwie- 424 sen als dieser Morales als indigenem Bauern aus einfachsten Verhältnissen offenstand. Hier zeichnet sich auf individueller Ebene ein sozioökonomisches Ungleichgewicht ab und spiegelt jene Asymmetrie wider, die sich auf der Makroebene in der bolivianisch-US-amerikanischen Begegnung manifestiert. Da das asymmetrische Verhältnis wiederum auf die historischen Unge­rechtig­keiten verweist, könnte folglich eine Akzentuierung von Obamas vergleichs­weise privilegiertem Status erneut der Etablierung eines interkulturellen Dialogs im Wege stehen. Eine denkbare Überbrückung dieser Schwierigkeit wäre, dass Obama den Dialog mit seinem südamerikanischen Kollegen sucht, indem er ein profundes Interesse an der bolivianischen Wirklichkeit – wie Evo sie wahrnimmt – zum Ausdruck bringt. Würde der US-Amerikaner auf diese Weise in der Rolle des Initiators auftreten, könnte es ihm gelingen, die historische Spaltung und das bestehende Machtgefälle zu überwinden, indem er seine Bereitschaft zu einer neuen Begegnung auf Augenhöhe signalisiert bzw. Evo sogar einen „Interessensvorschuss“ anbietet. Zwar mutet es fast ironisch an, dass ausgerechnet Obama als Vertreter des mächtigeren Landes den Dialog mit Morales initiieren müsste; schließlich wirkt diese Feststellung auf den ersten Blick eher wie eine Bestätigung der spaltenden Asym­metrie, wenn der Mächtige dem „Unterlegenen“ Gehör schenkt, als dass eine solche Interaktion auf einen ebenbürtigen Kontakt hinweisen würde. Doch deutet die Tatsache, dass sich bisher kein Dialog der Präsidenten entwickeln konnte, darauf hin, dass es nicht ausreicht, wenn Morales seine grundsätzliche Bereitschaft zu einem Neuanfang der bolivianisch-US-amerikanischen Beziehungen zum Ausdruck bringt. Diese Worte verhallen ungehört, solange Obama dem südamerikanischen Kontinent nur einen untergeordneten Platz in seinem politischen Tagesgeschäft einräumt. Frustriert durch diesen Mangel an Wertschätzung resultiert schnell eine erneute Verhärtung der diskursiven Fronten, die sich nicht zuletzt in Evos Abwendung von den USA und der Suche nach Verbündeten äußert, die sich ebenfalls von den Vereinigten Staaten missachtet sehen und wie Kuba, Venezuela und Iran lange zu deren traditionellen Feinden zählten. Obwohl, wie Healy (2010b, S. 11) hervorhob, theoretisch denkbar wäre, dass Evo und Obama – aufgrund ihrer historischen Sonderstellung und ihres Interesse an einer Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen – eine gewisse Faszination füreinander empfänden und hierauf aufbauend eine Annäherung von Bolivien und den USA entstehen könnte, bleibt dieses Potential bisher ungenutzt und Cambio und Change 425 verpuffen im Raum der Möglichkeiten, wenn es um die tatsächliche Begegnung der beiden Länder geht. Ein wenig hoffen lässt immerhin die symbolische Dimension von Evos und Obamas Präsidentschaften. Allein die Tatsache, dass sich zu Beginn dieses Jahrtausends in der mächtigsten Industrienation und einem der ärmsten Staaten Südamerikas ein profunder gesellschaftlicher Wandel in den Gesichtern der Präsidenten offenbart, bedeutet eine entscheidende Veränderung. Zwar könnte es passieren, dass Evos und Obamas politische Programme in Zukunft nicht weiter fortgeführt oder sogar rückgängig gemacht würden. Dennoch gilt für die symbolische Tragweite ihrer Präsidentschaften: „[T]he fact that Evo and Obama are in positions of power, at the highest position of power, in both countries is something that they cannot erase anymore“ (Calla, 2010, S. 6). Indem eine gewisse Parallelität der Entwicklungen in den beiden Ländern auszumachen ist, wäre ausgelöst durch diese neue Ähnlichkeit theroetisch auch eine Annäherung der beiden Länder – fern des traditionellen Machtgefälles und weitgehend unabhängig von den Personen Evos und Obamas – denkbar: Ebenso wie in Bolivien die Präsidentschaft von Morales einen Wandel in der (ethnisch-kulturellen) Selbstdefinition der Bevölkerung ausgelöst hat (Calla, 2010, S. 6), bewirkt auch Obama als neues Gesicht der USA eine Modifikation der Wahrnehmung des Landes, die nicht auf die eigenen Bürger beschränkt bleibt, sondern auch die bolivianische Perzeption miteinbezieht. Zwar mögen die USA für Bolivien nach wie vor als Feindbild dienen, doch ist gleichzeitig eine gewisse Solidarität zwischen den diskriminierten Ethnien und Kulturen vorstellbar. Auf dieser Ebene, so Healy (2010b, S. 11), könnte selbst Morales seinen Amtskollegen und dessen Errungenschaften wertschätzen – wodurch der indigene Präsident unweigerlich einräumen würde, dass sich (auch) in den USA positive gesellschaftliche Entwicklungen in Richtung einer zunehmenden Akzeptanz der Bürgerrechte und der Chancengleichheit abzeichnen. Die Präsidentschaft Obamas könnte somit zu einer tendenziellen Verbesserung der Wahrnehmung der Vereinigten Staaten durch die Bolivianer führen. Umgekehrt dagegen verhält es sich komplizierter: Es hat kaum den Anschein, als könne Evo als erstes indigenes Staatsoberhaupt Boliviens auf Sympathien seitens des Gros der US-Amerikaner hoffen; zu voreingenommen ist die Berichterstattung über Morales und das Andenland in den US- 426 Medien.323 Hier wird seine historische Einzigartigkeit bzw. seine „indigene Andersartigkeit“ eher zum kaum berechenbaren Exotikum, das mit der US-amerikanischen Kultur und Wirklichkeit in Konflikt steht. Morales als Präsident, der offen mit dem bisherigen Diskurs seines Landes bricht, wird zur Bedrohung des historischen Vormachtstatus der USA auf bolivianischem Terrain. Indem seine Wahl unmittelbar mit dem Ablösen der alten, US-orientierten Elite einhergeht, bedeutet seine Machtübernahme im nationalen bolivianischen Kontext zwar eine Verminderung der Diskriminierung; auf das bolivianisch-US-amerikanische Verhältnis bezogen kün- 323 Von Dezember 2005 bis März 2006 analysierte PNUD (2007, S. 487 ff.) die Darstellung Boliviens in der internationalen Presse insbesondere hinsichtlich der Einschätzung der damaligen politischen Entwicklungen; einbezogen in die Analyse wurden u. a. die US-Tageszeitungen The Washington Post und The New York Times. Der angegebene Zeitraum der Untersuchung schließt den Monat von Evos Wahl zum Präsidenten sowie die ersten Wochen seiner Amtszeit mit ein, wobei im Durschnitt alle fünf Tage ein Artikel in einer der beiden Zeitungen veröffentlicht wurde. Bemerkenswert erschien den Publikationsorganen zunächst die große Unterstützung, die Morales seitens des bolivianischen Volkes erfuhr und die sich nicht zuletzt in der hohen Wahlbeteiligung niederschlug. Zugleich wurde jedoch vor Evos radikalem politischen Kurs gewarnt, der als Reaktion auf das Scheitern vorangegangener Regierungen und der klassischen politischen Elite darstellt wurde. Evo selbst wurde als Sozialist beschrieben, und seine Präsidentschaft aufgrund seiner engen Verbindungen zum Coca-Anbau mit Sorgen erwartet ( PNUD , 2007, S. 489). PNUD berief sich beispielsweise auf einen Artikel in der New York Times vom 21. Dezember 2005, dem zufolge Morales angekündigt habe: „[H]e would become America’s nightmare“ (Brinkley, 2005). Zudem habe Evo gegenüber dem Nachrichtensender Al Jazeera den damaligen Präsidenten George W. Bush als „Terroristen“ bezeichnet (Brinkley, 2005; PNUD , 2007, S. 489 f.). Am meisten Aufmerksamkeit wurde Evo seitens der beiden Tageszeitungen jedoch zuteil aufgrund seiner engen Beziehungen zu Fidel Castro und Hugo Chávez, die bedingt durch ihre antiimperialistische und antineoliberale Gesinnung wohl ebenfalls zu den „Albträumen“ der USA zählen dürften. Tatsächlich verwiesen mehr als die Hälfte der Artikel auf Evos Verbindung zu dem Kubaner und dem Venezolaner, die ihrerseits mitunter zur Achse des Bösen in Beziehung gesetzt wurden [an anderer Stelle wurde der Stellenwert Boliviens für Venezuela mit der Bedeutung Kubas für die Sowjetunion verglichen (Queiser Morales, 2006, S. 30), wodurch auch Bolivien unweigerlich zu jener Gruppe der „Bösen“ zu zählen wäre]. Im Gegensatz zu diesen Vorbehalten, die die Mehrheit der Artikel dominierten, thematisierten nur 27 % der Zeitungsausschnitte Evos indigenen Hintergrund und seine Herkunft aus einfachen bäuerlichen Verhältnissen. PNUD zufolge diffamierten zudem 16 % der Artikel Morales aufgrund seiner populistischen Züge, aufgrund seiner Tendenz, politische Meinungsverschiedenheiten auf der Straße auszutragen, sowie aufgrund seiner Befürwortung des Coca-Anbaus. Nicht zuletzt wurde Evo in den Artikeln als bedrohlich eingeschätzt wegen der zu erwartenden Unvereinbarkeit seiner Politik mit den US-amerikanischen Interessen im Kampf gegen den Drogenhandel, aber auch wegen der bevorstehenden Nationalisierungen und Evos genereller Ankündigung, sich dem Diktat Washingtons nicht länger beugen zu wollen. Eine Verbesserung der bolivianisch-US-amerikanischen Beziehungen oder eine positive 427 digt aber die Ära der neuen Gleichberechtigung auch eine relative Entmachtung der USA an. Während letztere zwar nötig ist, um eine Begegnung auf Augenhöhe zu ermöglichen, verweisen die vergangenen monetären Investitionen der USA z. B. in die bolivianische Coca-Politik jedoch darauf, dass der US-Regierungs­apparat – unabhängig von Obamas persönlicher Position – diese politische Linie nicht ohne weiteres aufgeben wird (Healy, 2010b, S. 3 f.). An dieser Stelle zeichnet sich folglich erneut ab, dass die Tragweite von Evos und Obamas symbolischer Bedeutung für eine neue Ära der Interkulturalität begrenzt ist, nicht zuletzt da in der Realität vielfältige wirtschaftliche und politische Interessen maßgeblich Einfluss nehmen auf den Kontext jeglicher internationaler Begegnung. Während also einerseits Evos und Obamas persönliche Hintergründe bedeutsam für die Möglichkeit einer bolivianisch-US-amerikanischen Annäherung sind – insofern als ihr ethnisch-historisches Einzigartigkeitsmerkmal ein verbindendes Element und einen Hinweis auf ihre interkulturelle Sensibilität darstellen könnte –, gilt andererseits, dass sie die jeweilige Kontextualität ihrer Präsidentschaft ein Stück weit außer Acht lassen müssen, um überhaupt in einen konstruktiven Dialog treten zu können. Hier ist eine verbindende Metaebene vonnöten, die die anfängliche Horizontbegrenzung des Individu- Einstellung der US-Bevölkerung zu Evos Präsidentschaft schien somit keinesfalls bevorzustehen ( PNUD , 2007, S. 490). – Im Gegensatz zur US-Berichterstattung über Morales wird in den bolivianischen Zeitungsnachrichten zur Wiederwahl Obamas am 6. November 2012 dessen ethnisch-kultureller Hintergrund viel stärker hervorgehoben: Hier findet oft schon im ersten Satz eines Artikels die Tatsache Erwähnung, dass Obama als erster afroamerikanischer Präsident in die US-Geschichte eingeht; des Weiteren wird seine Wiederwahl auf die Stimmen der diskriminierten Minoritäten, insbesondere die der hispanischen Bevölkerung, zurückgeführt (AFP, 2012; La Razón Digital / A FP, 2012). Obama wird folglich den bolivianischen Lesern unmittelbar in Anlehnung an zentrale, positiv konnotierte Werte der Ära Morales vorgestellt. Eine Bedrohlichkeit oder offene Feindseligkeit kommt dagegen nicht zum Ausdruck. Wenn überhaupt, wird eine gewisse Irrelevanz des US-Wahlergebnisses suggeriert, indem in einem Artikel etwa folgende Aussage von Morales zitiert wird: „‚[W]er in den Vereinigten Staaten gewinnt, betrifft das bolivianische Volk nicht mehr‘“ (zit. n. La Razón, 07.11.2012; e. Ü.). In demselben Artikel wird jedoch auch auf Evos Forderung verwiesen, Obama solle den Ex-Präsidenten Sánchez de Lozada an Bolivien ausliefern und sich auf diese Weise erkenntlich zeigen für die Unterstützung, die ihm die hispanische Bevölkerung zuteilwerden ließ (La Razón, 07.11.2012). Angesichts dieses offensichtlichen Interesses an Obamas Aktionen kann also von einer tatsächlichen Bedeutungslosigkeit des US-Präsidenten für Bolivien keine Rede sein; stattdessen wird hier an eine ethnisch-kulturelle „Brüderschaft“ appelliert. 428 ums aufhebt und den Weg für eine interkulturelle Begegnung fern von Machtgefällen und einengender Schuldthematik bereitet (s. Kap. 5.3.3). 5.2 Zur gegenwärtigen Bedeutung der Kulturalität Der Glaube an die kulturübergreifende Gültigkeit der eigenen ethnischkulturellen Werte, Normen und Weltanschauung ist zweifellos ein bedeutsames Kennzeichnen einer ethnozentrischen Sichtweise. Doch nicht nur diese führt zu einem Universalitätsdenken; die Ubiquität des eigenen ethnisch-kulturellen Diskurses könnte sich bald fast „von alleine“ ergeben durch das viel beschworene Zusammenwachsen der Welt, die durch ihre hochgradige, auch virtuelle, Vernetzung den einzelnen Diskurs nicht länger auf eine bestimmte Lokalität festlegt. Dies führt wiederum zu der Erwartung, dass der vermehrte Kontakt mit andersartigen Kulturen auch ein verändertes Bewusstsein der eigenen Kulturalität entstehen lässt. Wenn etwa das kulturell Eigene – ebenso wie das kulturell Fremde – überall zu finden ist, könnte dies nicht zuletzt Einfluss nehmen auf die Negativdefinition des Eigenen. Der Philosoph Martin Heidegger wies darauf hin, „[eine] Grenze [sei] nicht das, wobei etwas aufhört, sondern … jenes, von woher etwas sein Wesen beginnt“ (2009, S. 149). Doch wenn das kulturell Eigene im globalisierten Kontext nicht länger räumlich begrenzt ist, wird – zumindest geographisch gesehen – auch anfechtbar, wo das Wesen des Anderen beginnt. Falls die (ethnisch-kulturellen) Grenzen verwischen, müsste – ausgelöst durch eine „natürliche Universalisierung“ – eine Diskontinuität des Diskurses resultieren, da sich dieser traditionell als Produkt von Eigen- und Fremdkonstruktionen konstituiert. In Abgrenzung hiervon gibt es aber in Teilen der Wissenschaft auch die Vision eines bevorstehenden Kampfes der Kulturen. Eine gewalttätige Auseinandersetzung auf Basis ethnisch-kultureller Verschiedenheit würde ihrerseits ein Fortbestehen fest definierter Gruppen und ethnisch-kultureller Grenzen bedingen und damit eine Kontinuität, wenn nicht gar eine Intensivierung des exklusiven Charakters von Ethnizität und Kulturalität nahelegen. Somit sind heute zwei konträre Gegenwartsanalysen und darauf aufbauende Zukunfts­szenarien auszumachen. Um diesen Beobachtungen als Kontext der im Vorherigen angeführten Fallbeispiele von Bolivien und den USA Rechnung zu tragen, ist es unerlässlich, einen Blick auf die „Nebenwirkungen“ der Globalisierung und ihre Auswirkungen auf die Kultura- 429 lität bzw. ethnisch-kulturelle Identität zu werfen. Schließlich gilt es kritisch zu fragen, ob eine (gewalttätige) Konfrontation der Kulturen tatsächlich unumgänglich ist. 5.2.1 „Nebenwirkungen“ der Globalisierung Das vielleicht wichtigste Schlagwort, das zur Kennzeichnung der gegenwärtigen Weltsituation fällt – sei es um die damit verbundenen Schwierigkeiten zu verteufeln, oder aber um die neue Geburt der Menschheit als vermeintliche kontinentübergreifende Einheit zu feiern –, ist das der Globalisierung. Osterhammel und Petersson stellen den Terminus als „Begriff der Gegenwartsdiagnose“ (2007, S. 7) vor und verweisen auf die unglaubliche Popularität, die ihm seit den 1990er Jahren zuteilwird. Weiter führen sie aus, dass die Globalisierung zumeist im Zusammenhang mit den veränderten Kommunikationsstrukturen, d. h. mit der „elektronischen Revolution“ der Kommunikationsmedien, und der erweiterten Wirkungsentfaltung der (post-) modernen westlichen Kultur nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Erwähnung finde, wobei insgesamt von einer „Ausweitung, Verdichtung und Beschleunigung weltweiter Beziehungen“ (2007, S. 10) die Rede sei. Obwohl der Begriff „Globalisierung“ heute in aller Munde ist, handelt es sich hierbei nicht um ein gänzlich neuartiges Phänomen, das für sich genommen einer weltweiten Diskontinuität der bisherigen Diskurse gleichkäme. Im Gegenteil wird betont, dass zwar der Terminus eher neu sein möge, das Phänomen selbst jedoch bereits durch die frühneuzeitlichen – geographischen, wirtschaftlichen und soziopolitischen – Expansionsbewegungen Europas ausgelöst worden sei (Osterhammel & Petersson, 2007, S. 109).324 Ähnlich erläutert auch Fornet-Betancourt (2006, S. 84), das Novum der Begrifflichkeit sei eigentlich auf die gegenwärtig wahrgenommene Intensität des viel beschriebenen Zusammenwachsens von Raum und Zeit beschränkt; tatsächlich, so bringt er missbilligend zum Ausdruck, handle 324 Nederveen Pieterse (1993, S. 4) weist darauf hin, dass die vermeintlich neuartige Intensivierung sozialer Beziehungen als noch älterer Prozess gedacht werden kann, der bereits mit den ersten Migrationsbewegungen seinen Anfang nahm. Unabhängig davon, ob der Globalisierungsbegriff mit diesem frühen historischen Beginn assoziiert oder aber an jüngeren Prozessen wie der Entwicklung des Weltmarktes festgemacht wird, ist das Bestehen sozialer Beziehungen sicherlich eine Bedingung sine qua non für das gegenwärtige Globalisierungsphänomen. 430 es sich bei der Globalisierung aber um die „historische Kontinuität der Phänomene des Kolonialismus und des Imperialismus“ (2006, S. 83; e. Ü.). Wie aus dieser Konzeption bereits hervorgeht, bewegt sich das Phänomen der Globalisierung nicht im wertfreien Raum. Vielmehr wird der Globalisierungsprozess mitunter heftig kritisiert als Versuch eines Überstülpens der westlichen bzw. okzidentalen Kultur (Estermann, 2006a, S. 9). Zudem wird der Globalisierung angelastet, vor allem durch die Verbreitung des neoliberalen Wirtschaftssystems vorangetrieben zu werden und dessen Interessen zu gehorchen (Fornet-Betancourt, 2003, S. 150). Estermann beanstandet: La concepción totalizadora de la globalización económica y cultural es la punta del iceberg de la modernidad y postmodernidad occidentales que una vez más demuestra su aspiración supercultural y ‚totalitaria‘ … Este afán universalista y totalitario se puede realizar sólo a condición de negar al ‚otro‘ y a la ‚otra‘ en su alteridad.325 (2006a, S. 9 f.) Damit ist die Globalisierung nicht einfach ein Zusammenwachsen der Welt zum viel besungenen „globalen Dorf“, das große raumzeitliche Distanzen zu überbrücken vermag oder gar ein neues Zeitalter des Friedens in einer demokratischen Welt verspricht (Berger, 2002, S. 2), sondern die Globalisierung wird eben als imperialistisches Aufdrängen einer bestimmten Kultur zulasten aller anderen Traditionen kritisiert (Estermann, 2006a, S. 40). Lindholm und Zúquete erläutern die Ansicht der Globalisierungskritiker: „According to the standard ideology, the globe is under command of the ‚Unholy Trinity‘ of the World Bank, the IMF, and the WTO“ (2010). In diesem Sinne wird die Globalisierung beschuldigt, eine ethnisch-kulturelle Verarmung der Welt herbeizuführen, indem sie interpersonale und internationale Beziehungen auf deren Marktwert reduziert (Fornet-Betancourt, 2003, S. 150). Ein solches Empfinden ist nicht allein Ausdruck eines (wissenschaftlichen) Diskurses, der eine Verwandtschaft zur Dependenztheorie und Befreiungs- 325 „Die totalitäre Konzeption der wirtschaftlichen und kulturellen Globalisierung ist die Spitze des Eisbergs der okzidentalen Moderne und Postmoderne, die einmal mehr ihr superkulturelles und ‚totalitäres‘ Streben zeigt … Dieses universalistische und totalitäre Verlangen kann nur realisiert werden unter der Bedingung, dass es den ‚Anderen’ und die ‚Andere’ in ihrer Andersartigkeit negiert“ (e. Ü.). 431 theologie aufweist und den sogenannten Entwicklungsländern (Lateinamerikas) nahe steht. Viel mehr wird die zugrundeliegende Problematik von verschiedenen Seiten thematisiert. Der Soziologe Peter L. Berger beschreibt etwa die geradezu groteske Gestalt, die die globalisierte Welt in den Augen ihrer Kritiker anzunehmen droht: „[Globalization] implies the threat of an American economic and political hegemony, with its cultural consequence being a homogenized world resembling a sort of metastasized Disneyland (charmingly called a ‚cultural Chernobyl‘ by a French government official)“ (2002, S. 2). Bergers anschauliche Schilderung wirkt fast schon komisch, doch bekräftigt er im Folgenden, dass die Globalisierung tatsächlich zur Verbreitung einer US-amerika­nisch geprägten Kultur führe und zudem die Kluft zwischen Gewinnern und Verlieren – im nationalen wie im internationalen Kontext – größer werden lasse (2002, S. 2). Auch die Vereinten Nationen erkannten die mit der Globalisierung einhergehenden Gefahren und sprachen sich 2001 in Durban, Südafrika, dafür aus, dass die Globalisierung allen Menschen gleichermaßen zugutekommen solle. Infolgedessen erklärte die UN die gleichberechtigte Teilhabe an der weltweiten Entwicklung zu ihrem unbedingten Ziel. Dieses soll erreicht werden durch die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und der weltweiten Kommunikation bei gleichzeitiger Wertschätzung der kulturellen Diversität: „Only through broad and sustained efforts to create a shared future based upon our common humanity, and all is diverstiy, can globalization be made fully inclusive and equitable“ (United Nations, 2001, S. 6), lautet die offizielle Stellungnahme. Im Idealfall sollte folglich die Globalisierung bereits die „Ressourcen“ – d. h. die Kommunikationsstrukturen und Vernetzung – zur Eindämmung ihrer eigenen Problematik mit sich bringen. Mehr noch verlangen hier ausgerechnet die globalisierungsbedingten Gefahren der Diskriminierung und Ausbeutung der dominierten Kulturen eine verstärkte Nutzung eben jener technologischen und kommunikativen Mechanismen326, die selbst das Fundament des Globalisierungsphänomens darstellen. Bedingung für das 326 Als Schritt in dieser Richtung kann der Aufbau von Radiostationen in Bolivien angesehen werden, die die Interessen der indigenen Landbevölkerung auf Aymara oder Quechua artikulieren (Lindholm & Zúquete, 2010, S. 157). Allerdings müssten diese Radiosendungen eigentlich überregional, wenn nicht gar international, ausgestrahlt werden, um an der Globalisierung teilzuhaben. Paradoxerweise könnten diese Sender jedoch nur dann ein großes Publikum erreichen, wenn ihr Programm in einer weit verbreiteten Sprache formuliert würde, beispielsweise auf Spanisch oder Englisch. Damit aber würde der Grundge- 432 6Schlussbetrachtung Ausgangspunkt der vorstehenden Analyse war das Phänomen, dass sich gegenwärtig an der Spitze zweier sehr unterschiedlichen Länder ein ethnischkultureller Wandel offenbart: Im Januar 2006 übernahm mit Juan Evo Morales Ayma erstmals ein indigener Präsident die Staatsgeschäfte Boliviens; im Januar 2009 wurde mit Barack Hussein Obama II. erstmals ein Afroamerikaner als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika inauguriert. Basierend auf dieser Beobachtung wurde als Forschungsfrage formuliert zu untersuchen, wie sich der ethnisch-kulturelle Hintergrund von Morales und Obama in ihrem jeweiligen Diskurs niederschlägt und auf die diskursive Konstruktion eines interkulturellen Miteinanders auswirkt. Diese Problemstellung war verbunden mit der Suche nach ersten Hinweisen auf ein umfassenderes Regelwerk des gegenwärtigen ethnisch-kulturellen Wandels sowie dessen Bezug zum philosophischen Konzept der Interkulturalität. In Anlehnung an Foucaults (1981; 2007) Diskursanalyse erfolgte die Auseinandersetzung mit genannter Forschungsfrage in vier Schritten: Zunächst zeigte die Beschäftigung mit den historischen Apriori der Ära Morales und der Ära Obama und der Biographie der beiden Staatsmänner, dass sich in beiden Ländern etwa seit Mitte des 20. Jahrhunderts eine Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen abzeichnete, insofern als die indigene bzw. afroamerikanische Bevölkerung zunehmend Zugang zu den offiziellen Regierungsstrukturen gewann, wodurch schließlich auch die Präsidentschaften von Morales und Obama als rational-legitime Herrschaft im Sinne Webers (1922, S. 124) denkbar wurden. Damit sind sowohl Morales als auch Obama Kinder jener Diskursdiskontinuität, die die Beobachtung der gegenwärtigen (erneuten) Veränderungen der ethnisch-kulturellen Landschaft überhaupt erst ermöglichte. Heute obliegt es ihnen als „Produkt“ der historischen Diskurse, die Weichen für nachfolgende Generationen zu stellen (s. Kap. 3.1 und 4.1). In einem zweiten Schritt wurden die Diskurse von Morales und Obama im Hinblick auf ihre ethnisch-kulturelle Verortung durch Positivkonstruktion der nationalen Identität, durch Abgrenzung von Fremdgruppen oder abstrakteren Feindbildern sowie durch die Analyse ihrer implizit-symbolischen Funktion untersucht. Es stellte sich heraus, dass Morales die ethnisch-kulturelle Identität Boliviens als andin-indigen-gepräg­tes Land neu zu entwerfen gewillt und entsprechend bemüht ist, einen Staat zu konsti- 476 tuieren, der zwar namentlich plurinational ist, dessen Diskurs jedoch faktisch eine große Nähe zur andinen Philosophie, d. h. zu seinem eigenen Hintergrund, aufweist. Entsprechend wirkt Evos Diskurs auch hin auf eine Veränderung des traditionellen Machtverhältnisses der einzelnen ethnisch-kulturellen Gruppen in Bolivien, wobei wiederum sein eigener ethnisch-kultureller Hintergrund als „Begünstigter“ hervortritt (s. Kap. 3.2). Obama dagegen stützt sich deutlich stärker auf die Traditionen des Mainstreams und konstruiert seinen Diskurs vornehmlich als Tribut an die klassischen Konzepte und mythisch aufgeladenen Führungspersönlichkeiten der Civil Religion (Bellah, 2008). Sein Diskurs setzt nur wenig neue Vorzeichen und zielt mitnichten auf eine (Diskurs-) Revolution ab. Vielmehr tritt Obamas Identität als Afroamerikaner oftmals hinter seiner nationalen Identität als US-Amerikaner zurück, wodurch auf den ersten Blick der Change in seinem Diskurs – abgesehen von der neuen inhaltlichen Komponente, die sein Diskurs durch die gekonnte Einbindung der Terroranschläge vom 11. September 2001 in das nationale Narrativ erfährt – auf das Versprechen der Erfüllung der alten Ideale beschränkt zu bleiben scheint. Bei genauerer Untersuchung wird jedoch auch in Obamas Diskurs eine neue ethnisch-kulturelle Komponente sichtbar. Sie stützt sich maßgeblich auf die mythisch aufgeladene Figur des afroamerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King Jr. und spiegelt so Obamas Bezug zur afroamerikanischen Diskurstradition wider (s. Kap. 4.2). Im Falle beider Präsidenten ist somit zu beobachten, dass ihr persönlicher Hintergrund eine Veränderung des klassischen Diskurses hinsichtlich dessen Verortung in der jeweiligen ethnisch-kulturellen Landschaft bewirkt, wenn sich auch das Ausmaß dieser Modifikation erheblich unterscheidet: Während Evo offensichtlich um einen Diskursbruch bemüht ist, präsentiert Obama eher eine subtile Diskurskontinuität. Ungeachtet dieser Verschiedenheit fällt auf, dass sowohl Morales als auch Obama auf bestimmte mythische Narrative zurückgreifen, um ausgehend von diesen zum einen sich selbst zu inszenieren und zum anderen das Wertesystem und die nationale Identität ihrer Ära im Diskurs zu (re-) konstruieren. Mehr noch versprechen beide Präsidenten einen Wandel, eine Neugründung des bolivianischen Staates respektive eine „Wiedergeburt der Freiheit“ und der Idee America.349 349 Interessanterweise greift sowohl der Diskurs von Morales als auch der von Obama die Symbolik eines mythischen Neubeginns auf, die nach Lindholm und Zúquete oftmals in Anti-Globalisierungsdiskursen zu finden ist: „[T]he literature in all these movements is 477 In einem dritten Schritt wurde das interkulturelle Potential der präsidentiellen Diskurse analysiert und im Hinblick auf die Standpunkte eines kontextsensitiven Patriotismus in Vielfalt auf der einen Seite und eines fundamentalistischen Universalismus auf der anderen Seite verortet. Grundsätzlich zeigte sich Evos Diskurs der andinen Chakana mit dem philosophischen Konzept der Interkulturalität vereinbar und darum bemüht, ein patriotisches Verbundenheitsgefühl in Diversität zu erzeugen, während ein Indigenismus oder Indianismus nicht zu beobachten waren. Doch stand der indi­gene Präsident zugleich aufgrund seiner ausgeprägten Feindbildrhetorik sowie auch aufgrund seines faktischen Vorgehens gegen eine Gruppe indigener Tieflandvölker im TIPNIS -Konflikt der Verwirklichung der Interkulturalität deutlich im Weg (s. Kap. 3.3). Insofern als Obamas Rückbesinnung auf althergebrachte Ideale, insbesondere seine Auslegung des American Dream, in großen Teilen einer kontextsensitiven Interpretation des interkulturellen Gedankenguts entsprach, stimmte sein Diskurs mit der Idee eines friedlich-konstruktiven Miteinanders in Pluralität weitgehend überein. Tatsächlich ließen die konkreten Äußerungen in Obamas Diskurs zunächst eine neue Ära der Kulturverständigung erwarten und standen somit auch im Einklang mit der Einschätzung seiner Person durch das Friedensnobelpreiskomitee als Vermittler zwischen verschiedenen Völkern. Nichtsdestoweniger sind die USA nach wie vor in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt, und Obamas versöhnliche Töne konnten innenpolitisch nur wenig für ein gleichberechtigtes Miteinander der verschiedenen ethnisch-kulturellen Gruppen erreichen; tatsächlich besteht die Diskriminierung auf Basis der ethnischkulturellen Identität einer Person fort. Dies führt etwa Harris zu der desillusionierten Aussage: „The vision of independent black politics … would have predicted that the rise in black political empowerment, symbolized by the election of Obama as president, would produce more substantive full of narratives of rebirth, transformation, mutation, the resumption of harmony, the creation of new human beings, and the purification of nature and humanity“ (2010, S. 165). Während der Diskurs von Morales sicherlich eine kritische Einstellung gegenüber der Globalisierung (der westlichen Kultur) einnimmt, kann Obamas Diskurs nicht globalisierungskritisch sein, da er sich hierzu gegen die zivilreligiösen Werte und damit gegen die Essenz der Nation richten müsste. Vielmehr hat es den Anschein, dass die von Lindholm und Zúquete aufgezählten Diskurscharakteristika nicht nur in der Abgrenzung zur Globalisierung auftreten, sondern im Allgemeinen typisch sind für einen Diskurs des Wandels oder einen (versuchten) Diskursbruch. 478 7Epilog Die vorliegende Dissertation wurde am 2. Juli 2013 fertiggestellt. Eigenartigerweise markiert genau dieses Datum einen neuen Tiefpunkt in der Geschichte der bolivianisch-US-amerikanischen Beziehungen, der eine kurze nachgestellte Reflexion verlangt: Am 2. Juli 2013 bewirkten die USA, dass Evo Morales von den Mitgliedstaaten der North ������������������������� American����������������� Treaty Organization (NATO) die Überflugrechte verweigert wurden, als er von Russland in sein Heimatland zurückkehren wollte. Hintergrund dieser drastischen Maßnahme war der Verdacht der Vereinigten Staaten, der Whistleblower Edward Snowden könne sich an Bord der bolivianischen Präsidentenmaschine befinden. Während Snowdens Enthüllungen zweifellos Anlass für eine Vielzahl kritischer Auseinandersetzungen mit dem Zeitalter des Überwachungsstaats bieten, sind vor dem Hintergrund dieser Dissertationsschrift vor allem drei Aspekte hervorzuheben: An erster Stelle ist natürlich festzuhalten, dass die USA unter der Führung von Barack Obama das Leben des bolivianischen Präsidenten aufs Spiel setzten, als dessen Maschine am 2. Juli 2013 nicht ungestört nach Lateinamerika zurückfliegen konnte und ihr der Treibstoff auszugehen drohte. Ein stärkerer Affront seitens der Vereinigten Staaten wäre wohl kaum vorstellbar! Gleichzeitig bedeutet die Tatsache, dass die USA die Ergreifung des Whistleblowers über das Leben des bolivianischen Präsidenten stellten, dass dem Bolivien der Ära Morales auch heute – d. h. ungeachtet Obamas versöhnlichem Diskurs – in der tatsächlichen Begegnung weder Anerkennung noch Vertrauen seitens der Vereinigten Staaten zuteil werden. Im Gegenteil wird angenommen, dass Evo durchaus mit dem Whistleblower kollaborieren könnte, wodurch der bolivianische Präsident aus Sicht der USA selbst zum Verräter oder gar Terroristen wird, dessen Leben aufs Spiel gesetzt werden darf. Dies wiederum führt in einem zweiten Schritt dazu, dass sich Morales – in Übereinstimmung mit seinem US-kritischen Diskurs – tatsächlich zum Verbündeten von Snowden erklärt, dem Asyl zu gewähren er durchaus bereit wäre. An dritter Stelle schließlich verweisen die Geschehnisse des 2. Juli 2013 auf die grundsätzliche Relevanz, zwei hinsichtlich ihrer Stellung im internationalen Gefüge so unterschiedliche Staaten wie Bolivien und die USA miteinander in Verbindung zu bringen und ihr Verhältnis zwischen Kultur- 488 dialog und Kulturkonflikt zu untersuchen. Entsprechend wird das bolivianisch-US-amerikanische Verhältnis auch über die unmittelbaren Präsidentschaften von Morales und Obama hinaus von Interesse sein und sogar durch die Enthüllungen des Skandals um die National Security Agency (NSA) an Brisanz gewinnen. 489