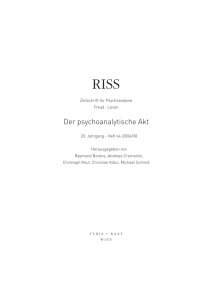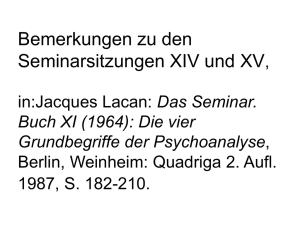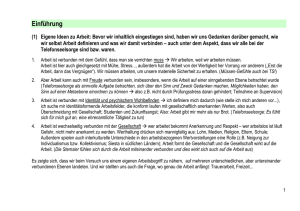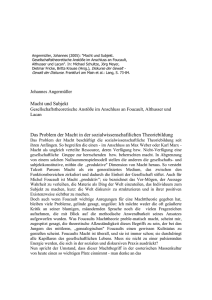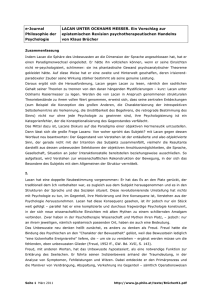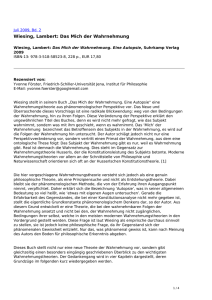63 Jacques Lacan: Struktur. Andersheit. Subjektkonstitution. Hrsg
Werbung
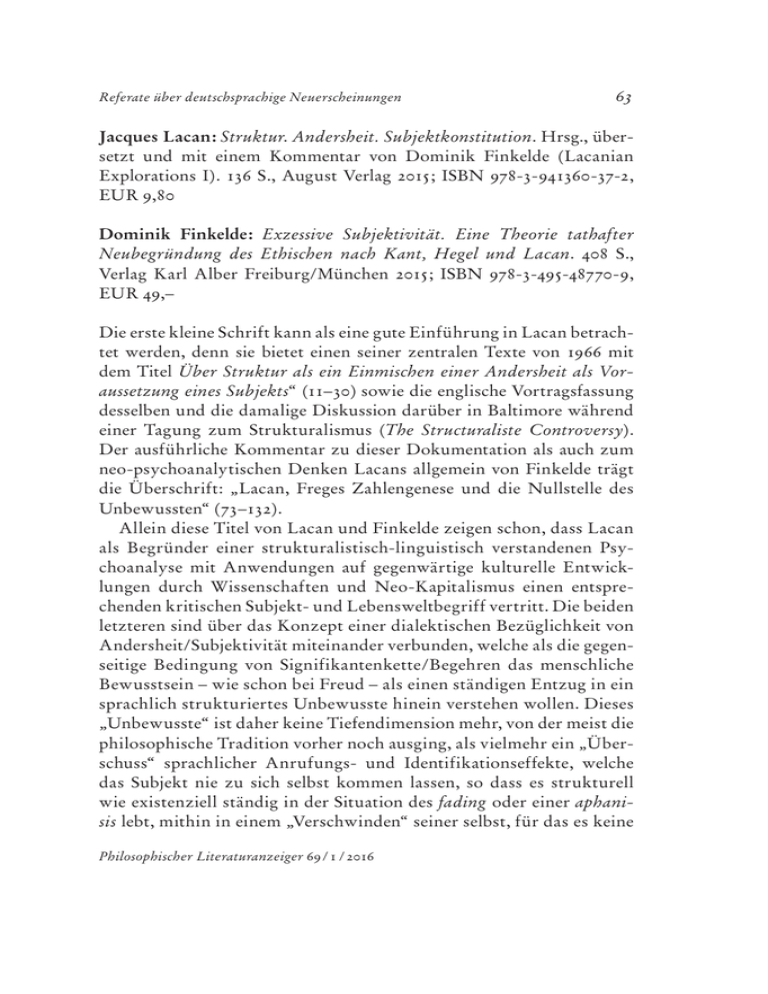
Referate über deutschsprachige Neuerscheinungen 63 Jacques Lacan: Struktur. Andersheit. Subjektkonstitution. Hrsg., übersetzt und mit einem Kommentar von Dominik Finkelde (Lacanian Explorations I). 136 S., August Verlag 2015; ISBN 978-3-941360-37-2, EUR 9,80 Dominik Finkelde: Exzessive Subjektivität. Eine Theorie tathafter Neubegründung des Ethischen nach Kant, Hegel und Lacan. 408 S., Verlag Karl Alber Freiburg/München 2015; ISBN 978-3-495-48770-9, EUR 49,– Die erste kleine Schrift kann als eine gute Einführung in Lacan betrachtet werden, denn sie bietet einen seiner zentralen Texte von 1966 mit dem Titel Über Struktur als ein Einmischen einer Andersheit als Voraussetzung eines Subjekts“ (11–30) sowie die englische Vortragsfassung desselben und die damalige Diskussion darüber in Baltimore während einer Tagung zum Strukturalismus (The Structuraliste Controversy). Der ausführliche Kommentar zu dieser Dokumentation als auch zum neo-psychoanalytischen Denken Lacans allgemein von Finkelde trägt die Überschrift: „Lacan, Freges Zahlengenese und die Nullstelle des Unbewussten“ (73–132). Allein diese Titel von Lacan und Finkelde zeigen schon, dass Lacan als Begründer einer strukturalistisch-linguistisch verstandenen Psychoanalyse mit Anwendungen auf gegenwärtige kulturelle Entwicklungen durch Wissenschaften und Neo-Kapitalismus einen entsprechenden kritischen Subjekt- und Lebensweltbegriff vertritt. Die beiden letzteren sind über das Konzept einer dialektischen Bezüglichkeit von Andersheit/Subjektivität miteinander verbunden, welche als die gegenseitige Bedingung von Signifikantenkette/Begehren das menschliche Bewusstsein – wie schon bei Freud – als einen ständigen Entzug in ein sprachlich strukturiertes Unbewusste hinein verstehen wollen. Dieses „Unbewusste“ ist daher keine Tiefendimension mehr, von der meist die philosophische Tradition vorher noch ausging, als vielmehr ein „Überschuss“ sprachlicher Anrufungs- und Identifikationseffekte, welche das Subjekt nie zu sich selbst kommen lassen, so dass es strukturell wie existenziell ständig in der Situation des fading oder einer aphanisis lebt, mithin in einem „Verschwinden“ seiner selbst, für das es keine Philosophischer Literaturanzeiger 69 / 1 / 2016 64 Referate über deutschsprachige Neuerscheinungen Aufhebung gibt. Daraus ergeben sich Konsequenzen für die zentrale psychoanalytische Frage des Zusammenhangs von jouissance und Anerkennung durch den Anderen (groß A nach Lacan), wo meist eher die „Barriere der Lust“ vorherrscht (29 f.) als eine wirkliche Befreiung vom „Phantasma“ derselben durch die Trennung (séparation) von den Vorgaben der symbolischen Ordnung. Deren „Anerkennungsprozeduren“ werden von Finkelde auch eingehend als „basal-hysterischer Zustand“ für „einen Überschuss generierende Bedeutungsprozesse“ beschrieben (85 f.). Die Ausführungen zu Lacan und Frege sind dabei besonders wertvoll, insofern sie verständlich machen, dass das Verhältnis von natürlicher Zahlenreihe und Nullmenge im strukturalistisch-semantischen Sinne Lacans genau das beschreiben kann, was die Ex-zentrizität des Subjekts als ex-istence ausmacht, nämlich von jenen Effekten her zu existieren, die ihm als unbewusste Sprachbedingung vorausliegen (vgl. bes. 101 ff.). Diese Ich-Genese als Exzentrizität im Kommentar Finkeldes wird noch ausführlicher in seiner Monographie „Exzessive Subjektivität“ entwickelt, wo besonders auch Bezüge Lacans zu Kant und Hegel (Teil II–III) dargelegt werden. Ist Hegel der Hauptbezugspunkt für die ethisch-psychoanalytische Frage des Herr-Knecht-Verhältnisses als Anerkennungskampf sowie für die darin enthaltene Problematik von Wissen/Wahrheit (als unmögliches absolutes oder vereinheitlichtes Wissen), so ist mit Kant (und Sade) ein ethischer Gesetzesbegriff vorgegeben, dessen Universalisierungsthese letztlich der Kritik des „Vaters“ bei Lacan unterliegt, das heißt der Möglichkeit, die Psychoanalyse aus einem noch nicht aufgeklärten Bezug zur Religion (le nom-du-Père) herauszulösen. Wir bieten hier hauptsächlich die Besprechung des V. Teils über Lacan in Finkeldes Buch, der mit „Lacan: Die Begründung autonomineller Rechtssubjektivität und ihre Konsequenzen“ überschrieben ist (247–382). Der hierbei eingehend verfolgte Zusammenhang von Begehren und Anrufungsprozessen an den Anderen (A) als ethische Frage verknüpft nicht nur die frühkindliche Entwicklung mit den gesellschaftlichen Institutionen, wie wir sie alle kennen lernen. Vielmehr ist die eigentliche ethisch-therapeutische oder autonome Frage nach Lacan eine solche der ständigen Überdeterminiertheit des Subjekts, welche aus diesem jene genannte ex-sistence als Ex-zentrizität macht, deren sePhilosophischer Literaturanzeiger 69 / 1 / 2016 Referate über deutschsprachige Neuerscheinungen 65 mantischer Überschuss auch in den Träumen beispielsweise nicht zur Ruhe kommt. Diese Heimsuchung des unerfüllbaren Begehrens durch die politisch-symbolische Ordnung, in welche das Subjekt als ein solch exzentrischer Mangel und dessen Identitätsspaltung als Folge seit dem „Spiegelstadium“ eingeschrieben sein soll, birgt folglich im Lacanschen Sinne eine Dialektik von Effekten eben dieser Einschreibung, die an ebenso normative wie rätselhafte Anrufungen (demandes) gebunden bleiben und in der Kur zum Thema der Übertragungsdynamik werden können. Nach der These von Finkelde (248 ff.) erweist sich die Aporetik der Moralität Kants wie der „gespaltenen Sittlichkeit“ nach Hegel als ein je retrospektiv selbst-entdeckendes Subjekt, welches sich wie bei Lacan sowohl sich selbst entziehe wie auch unmittelbar in diesem Akt vorauseile. Daraus sei eben auf ein „exzessives Subjekt“ einerseits sowie auf gesellschaftsrelevante Implikationen andererseits verwiesen, die dann gerade für die Analyse/Therapie als die Prämissen einer eignen Form der Ethik zu verstehen wären. Mit anderen Worten heißt dies, dass das Selbstverständnis des Subjekts und der ihn umgebenden Wirklichkeit durch kollektiv verbürgte Virtualitäten, Idealisierungen und verdrängte Paradoxien geprägt ist, wobei das Spezifische Lacans gegenüber solch eher allgemein als soziologisch zu bezeichnenden Betrachtungsweise durch das symbolisch-imaginäre Netzwerk als einer phantasmatisch wirkenden Autorität „zweiter Natur“ zu verstehen bleibt. Zur Behebung eines solch fundamentalen Mangels scheinen Politik wie Gemeinwesen im ständigen Wettstreit zu liegen, um Stabilitäten zu garantieren, welche allerdings durch ihren ideologisch-interpellativen Charakter das Missverhältnis von Phantasma/Realem gerade nicht überbrücken können. Daraus ergibt sich die ethische Fragerichtung der Autonomie seit Finkeldes Einleitung (11–47) hier, dass die als performativer Freiheitsakt aufzufassende Entzerrung des phantasmatischen Rahmens der Subjektkonstitution im Durchgang durch das Reale nicht nur eine immer ex-zentrische Subjektivität bekundet, sondern zugleich als transgressive Selbstsetzung auch innovativ ausrichtende Wirkungen für die symbolische Ordnung mit sich führt, insofern das Subjekt dann die Bedingungen seiner Anrufung in freier „Rechtsautonomie“ eher autopoietisch denn kompensatorisch gegenüber der Umwelt zu gestalten vermag. Philosophischer Literaturanzeiger 69 / 1 / 2016 66 Referate über deutschsprachige Neuerscheinungen Der gesellschaftliche Kontext intendiert mithin immer Kohärenz und Stabilität für einen an sich traumatischen Kern des Begehrens, da es über Mythen, Narrative und Rituale in ein Netz von Autorität eingefangen werden soll. Letztere verkennt allerdings den verbleibenden psychischen Antagonismus als „Wunde“ dieses primordial traumatischen Begehrens, weshalb das Subjekt als ethische Autonomie sich stets nur vorauseilen und verpassen kann, um dadurch in eine weniger verzerrte oder fixierte Umweltanerkennung einzutreten. Es ist diese notwendige ethische oder „tathafte“ Kraft, welche es dem Subjekt erlaubt, die Lücke im Sein, welche es nach Lacan bildet, dennoch zu leben – und so seine prinzipielle Instabilität nicht nur als Verlust zu begreifen. Denn es ist analytisch/therapeutisch offensichtlich, dass jede Frage nach Anerkennung im Rahmen irgendeiner symbolischen Ordnung von der Dialektik zwischen Anrufung/Legitimierung bedingt bleibt, welche daher nicht definitiv aufgelöst werden kann, sondern eine solche Ethik impliziert eher jene „Dimension, die sich in der so genannten tragischen Erfahrung des Lebens ausdrückt“, wie Lacan selbst sagt. Unstillbares Begehren und Jüngstes Gericht sind folglich, wie Kant es wollte, nicht als Einheit lösbar, aber ebenso wenig hilft eine Aristotelische Ethik letztlich, „nach Maßgabe des Möglichen“ zu leben, da sie ihrerseits dadurch die „Topologie des menschlichen Begehrens nicht berührte“, so Lacan, sofern dieses an den unbewusst verschlungenen Borromäischen Knoten von Realem, Imaginären und Symbolischen gebunden bleibt (zit. 256). Worauf wir oben schon hinwiesen, sind die Bezüge zur Ethik Kants nicht ohne Lacans Berücksichtigung von Sade zu verstehen, was einen Zusammenhang von Lust/Schmerz insofern für die hier angesprochene Ethik nach Finkelde umgreift, als das Phantasma einer Unerreichbarkeit der Lust durch multiple sexuelle Befriedigung oder perverse Tendenzen gekennzeichnet ist, welche den eigenen Schmerz mit dem Schmerz des Anderen verbindet. Dies bedeutet keine Sanktionierung der perversen Praktiken bei Sade, sondern umfasst prinzipiell die Bezüglichkeit von Glückseligkeit/Schmerz im Begehren der jouissance selbst, was mithin also keineswegs pathologisch ist. Die Abwehrmomente gegenüber eigenen destruktiven Begehrenselementen bedeuten daher nicht nur Realitätsanpassungen im Sinne einer Freudschen Ethik in der PsychoanalyPhilosophischer Literaturanzeiger 69 / 1 / 2016 Referate über deutschsprachige Neuerscheinungen 67 se, sondern die Wunde des Subjekts als Phantasma-Markierung seiner Selbstkonstitution als solcher beinhaltet eine Nichtschließbarkeit dieser Wunde. Das zuvor genannte Traumatische im Begehren, welches in der Dialektik von Lust/Schmerz je wiederkehrt, ist daher für Lacan sowohl der Mangel im Moment einer notwendigen Loslösung vom „MutterDing“ (Objekt a) wie das nicht präzis auffindbare paternale Verbot innerhalb der Ichgenese – mithin ein abwesender Ort für die kastrierend wirkenden Gesetze, Worte und Begehrensverdrängungen. In dieser Hinsicht ist das Begehren in der Tat immer auch unbewusstes Fremdbegehren des Anderen (A), so dass sich analytisch-therapeutische Ethik gerade in der Nicht-Koinzidenz des Subjekts mit sich selber solche Erinnerungsspuren in seinen „Lustkoordinaten“ zu vergegenwärtigen hat. Der Andere (A) bedeutet mithin die strukturrnotwendige Koordinate für die Halluzinationen von falscher Realität, welche unseren nicht voll ausgereiften körperlichen Organismus von Beginn an bestimmen, so dass die Wahrnehmung von Realität immer prekär ist und vom Realen im Sinne Lacans stets durchbrochen werden muss. Die „Realität“ als Bürgschaft zwischen Subjekt und intersubjektiver Metastruktur besitzt daher nur inferentielle Begründungen des virtuellen Status von Wirklichkeit, denn wir erstellen Wirkliches mit nicht enden wollenden Begehrensstrukturen, deren Legitimität eben nicht vom Fremd-Begehren abgekoppelt sein kann. So schreibt Lacan: „Alle Bedürfnisse sind kontaminiert durch die Tatsache, eingeschlossen zu sein in einer anderen Befriedigung […], der nicht nachzukommen [dem Subjekt] nicht möglich ist.“ (Encore, 1975, 57) Ethisch-therapeutisch heißt dies auf dem Hintergrund des Narzissmus des Spiegelstadiums, dass wir stets in einem Ressentimentfeld des enigmatisch begehrenden und absoluten Anderen (A) unsere Selbstvergewisserung suchen und so im „Herrendiskurs“ solcher Anerkennungsbegehren existieren. Verbunden mit „dem Ding“ (la Chose) als Phantasma unaussprechlichen Genusses impliziert dies zudem, dass wir durch ein vom Anderen her erzwungene Wahl des je einzelnen Begehrensobjekts eine Pseudo-Fülle des Genießens anstreben. Die „Nächstenliebe“ und die „Heiligkeit“ in der Kur, von denen Lacan als ethisch-therapeutischer Praktiker auf dem Boden des von ihm veritativ präzisierten „psychoanalytischen Diskurses“ spricht, ist also einerseits das Durchschauen eines solch phantasmatischen „Dings“ Philosophischer Literaturanzeiger 69 / 1 / 2016 68 Referate über deutschsprachige Neuerscheinungen überhaupt sowie andererseits die Notwendigkeit eines permanent sich aufschiebenden libidinösen Begehrens, welches sich dann in der ethischen Selbstwerdung nicht mehr von den Verheißungen der Sprache vereinnahmen lässt. Das Symptom signalisiert diesbezüglich daher ehemalige Überforderung, welche das Subjekt nicht mehr aus seinem phantasmatischen Bann lässt, sowie andererseits auch die Gegenwart des Realen, um gegen die ideologisch-lebensweltlichen Appelle nicht in Unterwerfung zu verfallen, welche dieselben bewirken wollen. In dieser Hinsicht hat das Symptom folglich eine ethisch paradoxe Situation inne, denn es ist einerseits psychisches und existentielles Leiden und andererseits der Aufruf zur Befreiung von solcher Unterwerfung. Bei Lacan gibt es demzufolge (etwa im Unterschied zu Althusser, wie Finkelde 269 ff. klar herausarbeitet) sowohl die Einbettung des Subjekts in die über den Anderen (A) stets ideologisch geprägte Anrufung wie ein „Fehlgehen“ solcher Anrufung, wo sich die Verschränkung von Symptom/Realem sowie von Begehren/Freisetzung zusammen aufweisen lässt. Dadurch bleibt das semantische Autoritätsfeld zwar als Unbewusstes verinnerlichter Andersheit meiner Anerkennungswünsche vorherrschend, aber da Lacans Konzeption des Menschen als Mangelwesen, Lücke oder „verschwindendes Subjekt“ in der Signifikantenkette zugleich eine Leere oder ein Nichts impliziert, das durch kein Phantasma definitiv ausgefüllt werden kann, ist gerade hierbei auch das Moment der ethischen Freisetzung vom Anderen (A) als angeblicher Wissensfülle gegeben. Der Große Andere steht mithin nicht nur ausschließlich für die Sprache auf der linguistischen Ebene, sondern auch für die Vektorrichtung des Begehrens, welches sich als partikulärer Willensanspruch rückwirkend durch die kulturbedingte Praxis als legitimiert erfährt – oder eben nicht. So ist durchaus das Geben und Nehmen von Gründen des Handelns als scheinbar selbstverantwortlich in der jeweilig symbolischen Ordnung eintrainiert, aber diese strukturale Epistemologie Lacans kennt gleichfalls eine ethischtherapeutische Selbsttranszendierung der Selbstsetzung als Durchbrechen von Anrufungskoordinaten, die nicht bloß eine neuerliche Phantasmawahl im Bereich des Objekts a darstellen, sondern prinzipiell eben auch das Potenzial oder die schon genannte „ethische Kraft“ der Regelsetzung gegen Regelbefolgung. Philosophischer Literaturanzeiger 69 / 1 / 2016 Referate über deutschsprachige Neuerscheinungen 69 Artikuliert man daher hier abschließend mit D. Finkelde den Zusammenhang von der subversiven Performanzkraft der Normen- und Wertsetzungen als Freiheitsakt im Sinne Lacans im Zusammenhang mit der Leere oder Lücke des Subjekts als einem Mangel-an-Sein (manque d’être) schlechthin, dann impliziert jede Unterwerfung als symbolische Subjektivierung zugleich auch deren ethische Freisetzung als schon erwähnte „Durchquerung des Phantasams“. Denn niemals geht eben das Subjekt aufgrund seines Begehrens ganz in seine gesellschaftliche Anrufung ein, und die Sehnsucht nach einer Fundierung durch die entsprechenden performativen Sprachakte der lebensweltlichen Praxis ist zwar verständlich, aber das Moment jeder Versymbolisierung enthält immer auch ein „An-sich“ des Subjekts als Abstraktion von jeder Beziehung zum Anderen (A). Mit anderen Worten offenbart gerade die Welt der symbolischen Formen selbst einen Widerspruch zwischen der Leere des Selbstseins des Subjekts und jenen signitiven Merkmalen, die es für Andere repräsentieren. Meine symbolische Entfremdung im symbolischen Mandat wäre daher jene genannte Freiheit als Leere, welche sich dem Zugriff des Mandats entzieht. Für den Sprachtheoretiker Lacan als analytisch-therapeutischen Praktiker gibt es folglich einen Unterschied zwischen der indexikalischen Verwendung eines Begriffs und seiner gleichzeitigen symbolisch-linguistischen Verwendung, so dass die Tautologie A = A in der Identitätssetzung immer schon aufgesprengt ist, insofern die Effekte der symbolischen Ordnung in der Rückwirkung auf das Subjekt stets auch dessen Selbstbezug zu dieser Ordnung als eine Distanz möglicher Vorbehalte manifestieren. Für die analytisch-therapeutische Praxis als Ethik einer Phantasmabefreiung sind psychosomatische wie neurotische Symptome daher Merkmale eines partikulären Ausnahmezustands, der im Unterschied zu einer totalitär wirkenden Ideologie die potentielle Lossagung vom vorgegebenen phantasmatischen Subjektivierungsrahmen als „Durchquerung“ indiziert. Gerade weil das Subjekt „für sich“ ein „An-sich“ als Nichts in den Augen der symbolischen Ordnung darstellt, kann diese Leere letztlich nicht weiter substantiviert werden und erlaubt die genannte ethische oder freie Entfaltung einer Potenzialität der SelbstSubjektivierung, so dass insbesondere der Repräsentationsmangel eine Wirkkraft freilegt, den das Subjekt als „Nichts der Selbstbeziehung“ Philosophischer Literaturanzeiger 69 / 1 / 2016 70 Referate über deutschsprachige Neuerscheinungen nutzen kann, um die immanent ethische Anfrage über die ideologischlebensweltlichen Anrufungsprozesse hinaus weiterzuverfolgen. Insofern vollendet sich hier die Analyse eines sprachlich-leiblichen Risses in der analytisch-therapeutischen Ethik eines Selbstbezuges ohne weiter phallisch wirkenden „Namen-des-Vaters“, der sich ja genau am Umschlagplatz der äußeren Ordnungen zu innerlich vernommenen Effekten der Realitätsanpassung situiert (vgl. 284 ff.). Diese Unmöglichkeit des Ideologischen, den Menschen in seiner Inkommensurabilität zu umfassen, vermag die kritischen wie befreienden Elemente der Lacanschen Herausarbeitung der verschiedenen Diskursformen sichtbar zu machen und die von Finkelde dargestellten philosophiehistorischen Bezüge gut zu unterstreichen, auch wenn Lacan selber sein Denken nicht als „Philosophie“ missverständen haben wollte, sondern eine erneuerte psychoanalytische Praxis und Theorie anvisierte. Wie die meisten strukturalistischen oder destruktivistisch postmodernen Denker Frankreichs geht auch Lacan von einer epistemischen Vorentscheidung der Differenz oder der Distanz (Riss etc.) aus, die nicht weiter phänomenologisch reflektiert wird. Dabei überwiegt methodisch zudem die Abhängigkeit von der Schau seit Lacans Ausarbeitung des Spiegelstadiums zur Erklärung der Psychose, ohne zu erkennen, dass selbst in letzterer diesem Stadium eine originär leibliche Bewegung vorausliegt, die als selbstaffektive Vorgegebenheit auch in Bezug auf den Primat der Signifikantenkette fruchtbar zu machen bleibt. Wir verweisen daher der Kürze halber für diese Auseinandersetzung auf unsere jüngste Veröffentlichung1, um übereinstimmend mit Finkelde zu unterstreichen, dass Lacan für den analytisch-therapeutischen wie philosophischen Bereich weiterhin eine wichtige Figur bleibt. Sie sollte ebenfalls für die kulturell-gesellschaftliche Diskussion auch im deutschsprachigen Raum verstärkt zur Kenntnis genommen werden, auch wenn der Begriff einer „exzessiven Subjektivität“ im Sinne Finkeldes wohl letztlich nur dann die Gegebenheit des „Überschusses“ (excès) in Anspruch nehmen dürfte, wenn deutlich wird, dass letzterer nicht 1 Vgl. Rolf Kühn: Begehren und Sinn. Grundlagen für eine phänomenologisch-tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und Supervision – zugleich ein Beitrag zu Jacques Lacan, Verlag Karl Alber, Freiburg/München 2015. Philosophischer Literaturanzeiger 69 / 1 / 2016 Referate über deutschsprachige Neuerscheinungen 71 rein sprachlich-symbolisch bedingt sein kann, sondern eine transzendentale Lebendigkeit als Affektabilität voraussetzt, die gegen-reduktiv trotz allem auch den phantasmatischen Einschreibungen über die Figur von Vater, Phallus oder Gesetz entgehen dürfte. Rolf Kühn, Freiburg i. Br. Ronald Dworkin: Gerechtigkeit für Igel. 813 S., Suhrkamp Verlag, Berlin 2012; ISBN 978-3-518-58575-7, EUR 48,– (geb.); 978-3-518-29707-0, EUR 25,– (kt.) Ronald Dworkin, der im Jahr 2013 verstarb, gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Politischen Philosophie und der Rechtsphilosophie im 20. und im beginnenden 21. Jahrhundert. Neben seiner Aufsatzsammlung Was ist Gleichheit? und der Spätschrift Religion ohne Gott, in der sich Dworkin unter anderem für die Annahme objektiver Werte ausspricht, ohne eine theologische Begründung einzubeziehen, ist mit Gerechtigkeit für Igel nun auch sein Opus Magnum in deutscher Übersetzung erschienen, das zeigt, wie intensiv sich Dworkin auch mit der jüngsten Entwicklung in der Moralphilosophie und der Metaethik kritisch auseinandergesetzt hat. In dieser umfangreichen Monographie versucht Dworkin die These von der Einheit der Werte zu verteidigen (vgl. 13). Werte spielen laut Dworkin eine Hauptrolle bei der ethischen Frage nach einer gelungenen Lebensführung und der moralischen Frage danach, wie man sich anderen gegenüber zu verhalten habe. Werte bilden „eine große Sache“ (13, Hervorhebung W. K.), und um die weiß laut Dworkin – und dies erklärt den Titel des Werkes – der Igel, während Füchse viele Dinge wissen.1 Dworkin geht es um ein Plädoyer zugunsten einer bestimmten Lebensweise (vgl. 13), aber auch um eine entsprechende umfassende und 1 Die Unterscheidung geht wohl auf den antiken griechischen Lyriker Archilochos zurück, von dem der Satz „Der Fuchs weiß viele verschiedene Sachen, der Igel aber nur eine große“ stammen soll. Philosophischer Literaturanzeiger 69 / 1 / 2016