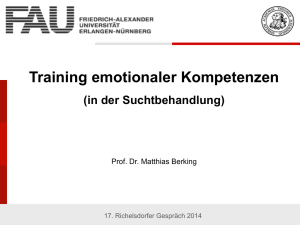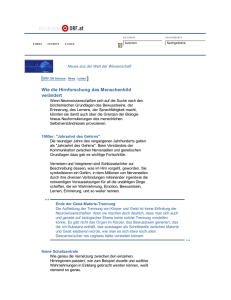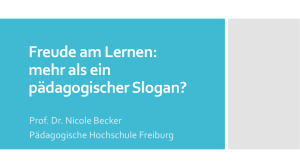„Neuropsychotherapie“ – theoretische und
Werbung

Neuropsychotherapie Schwerpunkt Schwerpunkt „Neuropsychotherapie“ – theoretische und praktische Implikationen eines „gewagten Konstruktes“ Matthias Berking & Hans Jörg Znoj Zusammenfassung: Die Erkenntnisse der (affektiven) Neurowissenschaften sind einerseits von großer Bedeutung für die Modellbildung und Interventionsentwicklung in der klinischen Psychologie. Andererseits besteht jedoch die Gefahr, dass neuronale Modelle und Befunde bei dem Versuch, sie für die konkrete therapeutische Praxis nutzbar zu machen, so stark vereinfacht werden, dass sie der Realität bzw. den tatsächlichen empirischen Befunden nicht mehr entsprechen. Vor diesem Hintergrund soll anhand von Beispielen aufgezeigt werden, wie (a) relativ gesicherte Befunde der Neurowissenschaften schon heute wirkungsvoll in Modelle zur Entwicklung psychischer Störungen integriert werden können, und wie (b) diese Befunde für die Entwicklung effektiver therapeutischer Interventionsmethoden genutzt werden können. Schlüsselwörter: Neuropsychotherapie, Störungsgenese, Emotionale Kompetenz, Training Emotionaler Kompetenzen “Neuropsychotherapy” – theoretical and practical implications of an “adventurous concept” Summary: Many findings from the (affective) neuroscience have important implications for the development of theories and interventions in the field of clinical psychology. But care has to be taken that the attempt to make use of these theories and findings in clinical practice does not result in oversimplified models and statements that do not fit with empirical finding. With this in mind we will present two examples of (a) how findings from the (affective) neurosciences can be integrated into comprehensive theories that explain the development of mental disorders and (b) how these finding can be used for the development of effective clinical interventions methods. Keywords: Neuropsychotherapy, etiology, psychopathology, emotion regulation skills, emotion regulation skill training 1. Einleitung Klaus Grawe hat die großen Würfe immer geliebt. Nachdem er in herausragender Weise die Erkenntnisse der Psychotherapieforschung und der Allgemeinen Psychologie nutzte, um die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen besser verstehen und dadurch deren Behandlung verbessern zu können, wandte er sich in seinen letzten Lebensjahren dem Gebiet der (affektiven) Neurowissenschaften zu. Diese Ausrichtung war von der Überzeugung geleitet, dass in diesem Gebiet zurzeit in rascher Folge bedeutsame Erkenntnisse gewonnen werden, die für die Psychotherapieforschung von großer Relevanz sind. Vor dem Hintergrund von Erkenntnissen, die zeigen, dass psychotherapeu- tische Interventionsverfahren die neuronale Verarbeitung im Gehirn kurz- und langfristig verändern können, sah er es an der Zeit, dass Psychotherapeuten das „bio“ im „bio-psycho-sozialen“ Krankheitsmodell nicht mehr nur als unveränderbare oder nur von Psychiatern veränderbare Größe betrachten sollten. Psychotherapeuten seien vielmehr aufgefordert, sich über die Funktionsweisen des Gehirns zu informieren und sich Gedanken dazu zu machen, mit welchen psychotherapeutischen Methoden sich die neuronalen Grundlagen des Erlebens und Verhaltens so verändern lassen, dass psychischen Krankheiten und Problemen die Grundlage entzogen wird. Doch dieser Ansatz birgt durchaus Risiken. So sind die biologischen Mechanismen zum einen so komplex, Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis, 38. Jg. (4), 777-778, 2006 S_Berking.indd 777 777 03.05.2007 16:18:13 Schwerpunkt dass sie notwendigerweise mit vereinfachenden Modellen beschrieben werden müssen, um sie für das psychotherapeutische Setting handlungsrelevant zu machen. Dabei besteht die Gefahr, dass vereinfachende Modelle und Annahmen der Realität den tatsächlichen empirischen Befunden nicht mehr gerecht werden. Eventuell sind psychologische Modelle viel besser geeignet, das komplexe Funktionieren eines biologischen Systems in toto zu erfassen. Neuropsychotherapeutische Theoriebildung muss deswegen entscheiden, an welcher Stelle welche Erklärungsebene den größten heuristischen Gewinn mit sich bringt. Um zu veranschaulichen, wie die Befunde der Neurowissenschaften in multimodale Modelle der Entstehung psychischer Störungen integriert werden können, soll zunächst das Berner Modell der Entwicklung psychischer Störungen aus einer biographischen Perspektive vorgestellt werden. Das Modell basiert zu großen Teilen auf den Überlegungen von Klaus Grawe (2004), geht aber an bestimmten Punkten auch über diese hinaus. Es stützt sich primär auf Befunde aus der klinischen Psychologie, der Entwicklungspsychologie, der Sozialpsychologie und der Allgemeinen Psychologie. Es integriert jedoch dort vergleichsweise abgesicherte Befunde aus den Neurowissenschaften, wo dies unseres Erachtens mit einem bedeutsamen Erkenntnisgewinn verbunden ist. Am Beispiel des Trainings Emotionaler Kompetenzen soll anschließend illustriert werden, wie die Erkenntnisse der Neurowissenschaften schon heute in der konkreten psychotherapeutischen Praxis genutzt werden können.1 2. Ein „neuro“-psycho-soziales Modell der Entwicklung psychischer Störungen Im Folgenden soll die prototypische Entwicklung einer psychischen Störung im Laufe des Lebens einer fiktiven Person skizziert werden. Mit dieser biographischen Perspektive wird dem Umstand Rechnung getragen, dass psychische Störungen nicht „vom Himmel fallen“, sondern sich über die Zeit und unter bestimmten Umständen entwickeln. Die Zeitachse verläuft in diesem Modell von links nach rechts, das heißt, am linken Rand der Graphik liegt die Geburt der fiktiven Person und am rechten Rand der Moment, an dem es zur Ausbildung einer manifesten psychischen Störung kommt. Das Modell Teile dieses Artikels stammen aus Berking (in Druck). Das Training Emotionaler Kompetenzen – Manual für Gruppenleiter. Berlin: Springer. 1 778 S_Berking.indd 778 M atthias Berking & H ans Jörg Znoj expliziert Risikofaktoren für die Entwicklung psychischer Störungen. Je mehr von diesen Faktoren vorliegen, desto wahrscheinlicher ist die Entwicklung einer psychischen Störung (multifaktoriellprobabilistisches Modell). Die einzelnen Komponenten und Zusammenhänge des Modells werden in den sich anschließenden Abschnitten näher erläutert. 2.1 Startbedingungen: Genetische Einflüsse und frühe Inkonsistenzerfahrungen Die Wurzeln für die Entwicklung psychischer Störungen reichen in der Regel weit in die Vergangenheit zurück. Schon im Moment der Geburt stehen wichtige Faktoren fest, die die Vulnerabilität eines Menschen für die Entwicklung psychischer Störungen wesentlich beeinflussen. Dabei handelt es sich einerseits um das genetische Programm, mit dem das Neugeborene ausgestattet ist (vgl. Abbildung 1, Punkt 1). Dieses kodiert zum einen die Vulnerabilitäten für spezielle Störungen und zum anderen das Temperament, welches ab dem Zeitpunkt der Geburt in bedeutendem Maß die Interaktionen beeinflussen wird, die das Kind mit seiner Umwelt hat (Tellegen et al., 1988). Der zweite früh wirkende Einflussfaktor ist der Verlauf von Schwangerschaft und Geburt. Es gibt mittlerweile eine Reihe von neurowissenschaftlichen Befunden, die darauf hindeuten, dass sich z. B. unkontrollierbarer Stress für die Mutter während der Schwangerschaft und Komplikationen bei der Geburt negativ auf die Systeme im Gehirn des Kindes auswirken, die für die Emotionsregulation verantwortlich sind (s. z. B. Viltart et al., 2006 oder Wurmser et al., 2006). Der dritte wichtige Einflussfaktor, der zum Zeitpunkt der Geburt bereits feststeht, sind die Eltern des Kindes. Deren Verfügbarkeit und Verhalten (bzw. das von eventuell stellvertretend eintretenden Bezugspersonen) hat einen zentralen Einfluss auf die Entwicklung einer guten Emotionsregulation. Wenn sich die primären Bezugspersonen nicht gut um die Bedürfnisse des Kindes kümmern (können), wird dieses oft „Inkongruenz-Erfahrungen“ machen (vgl. Abbildung 1, Punkt 2). Das heißt, es wird Wahrnehmungen machen, die nicht mit seinen Zielen und Bedürfnissen im Einklang stehen (vgl. Grawe, 1998, 2004). Die Diskrepanz von Zielen/Bedürfnissen auf der einen und den aktuellen Wahrnehmungen auf der anderen Seite wird beim Kind zu einer Stressreaktion führen. Dabei wird die Amygdala – das Angst- und Stresszentrum im zentralen Nervensystem – eine erhöhte mentale und körperliche Aktivierung einleiten (vgl. Abbildung 1, Punkt 3). Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 03.05.2007 16:18:13 Neuropsychotherapie Schwerpunkt Abbildung 1: Das Berner Modell der Entstehung psychischer Störungen aus einer biographischen Perspektive Risikofaktor 1 Genetische 1 Vulnerabilität + Risikofaktor 2 Leicht 3 auslösbare, intensive und lang andauernde StressReaktionen 2 Frühe InkongruenzErfahrungen Starke und nicht kontrollierbare 4 neg. Emotionen 7 Keine Unterstützung bei Emotionsregulation Keine guten ERModelle 12 Angst vor Gefühlen 13 Vermeidungs- schemata Geringe 11 emotionale Selbstwirksamkeit 8 Abwertung, wenn negative Emotionen gezeigt werden 9 Entwicklungs 5 schäden bei PFC & Hippocampus Negative Emotionen triggern negatives Selbstbild 10 + Risikofaktor 3 Externe 17 Ereignisse Vermeidung von 14 Situationen, die negative Emotionen triggern Verdrängung I 15 N Kurzfristige 16 Spannungsreduktion durch prä-pathologische mentale Aktivitäten (die Kontrolle suggerieren): 18 hohes 19 Arousal + 20 keine sekundäre Kontrollerfahrung K O N Neurotoxische 21 Effekte von Stress-Hormonen G R Sich-Sorgen Ruminieren „Musturbieren“ Substanzgebrauch Checking Etc. U Hemmung von hemmenden PFC-Arealen 22 E N Z Expression von23 genetischen Risikofaktoren 24 Emotions-Regulations-Defizite 6 Psychische Störungen Zeit Anmerkung:Die Erläuterungen zu den nummerierten Kästchen finden sich im Text. Diese Aktivierung soll Handlungen erleichtern, die zu Zielerreichung und Bedürfnisbefriedigung führen. Mit der erhöhten mentalen Aktivierung geht (zunächst) auch eine Erhöhung der Lernbereitschaft einher, die dafür sorgt, dass erfolgreiche Handlungen auch in Zukunft in ähnlichen Situationen leichter abgerufen werden können. Wenn die Bezugspersonen auf die Inkongruenz-Signale des Kindes angemessen reagieren, wird die Stressreaktion durch diesen „Eingriff von außen“ beendet. Kinder sind zu Beginn ihres Lebens in hohem Maße auf eine solche „externe Regulation ihrer Emotionen“ angewiesen und können erst nach und nach lernen, ihre Emotionen selbst aktiv zu regulieren. Befunde aus der Entwicklungspsychologie und aus den Neurowissenschaften stützen die Hypothese, dass die „externe Emotionsregulation“ in einer guten Bindung wichtig ist für die Ausbildung der neuronalen Strukturen, die es dem Kind ermöglichen, seine Stressreaktionen und negativen Gefühle zunehmend eigenständig zu regulieren (z. B. Hofer, 1984, 1987; Ogawa et al., 1994; zusammenfassend Grawe, 2004). Wenn das Kind trotz intensiven Bemühens keine externe Unterstützung bei der Regulation der Stressreaktion erfährt, macht es die Erfahrung, dass es seine Umwelt in wichtigen Belangen nicht kontrollieren kann. Dieses Erleben von Kontrollverlust (vgl. Abbildung 1, Punkt 4) geht auf der physiologischen Ebene mit gänzlich anderen Prozessen einher als das Erleben von kontrollierbarem Stress (vgl. Hüther, 1998). Bei einer unkontrollierbaren Bedrohung der Grundbedürf38. Jg. (4), 777-778, 2006 S_Berking.indd 779 779 03.05.2007 16:18:13 Schwerpunkt nisse kommt es zur verstärkten Ausschüttung von Stresshormonen, die die Funktionsfähigkeit von Bereichen beeinträchtigen, die Stressreaktionen und negative Emotionen herunterregulieren können. Dabei handelt es sich zum einen um die orbitofrontalen, die ventromedialen und die dorsolateralen Bereiche des präfrontalen Kortex (PFC) und zum anderem um den Hippocampus (vgl. Abbildung 1, Punkt 5). Diese Bereiche werden durch einen anhaltend erhöhten Spiegel dieser Stresshormone auch in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Somit resultiert aus häufigen, intensiven und unkontrollierbaren Verletzungen der Grundbedürfnisse eine defizitäre Ausbildung der „Hardware“, die für die effektive Regulation von Stressreaktionen und negativen Gefühlen (vgl. Abbildung 1, Punkt 6) notwendig ist (z. B. Graham, Heim, Goodman, Miller & Nemeroff, 1999; oder Nemeroff, 2004). 2.2 Defizitäre Lernmöglichkeiten in der späteren Kindheit Doch der Einfluss der primären Bezugsperson geht noch weiter. Mit dem Heranwachsen des Kindes steigen prinzipiell auch seine Möglichkeiten, selbst aktiv auf seine Stressreaktionen und negativen Gefühle Einf luss zu nehmen. Bei dem Erwerb diesbezüglicher Strategien und Fertigkeiten ist das Kind allerdings auf Unterstützung angewiesen. Wenn sich eine Mutter liebevoll und gekonnt um ein Kind kümmert, wenn es diesem nicht gut geht, wird sie dazu eine Reihe von Strategien einsetzen. Sie wird sich zuerst dem Kind freundlich zuwenden. Sie wird das Kind fragen, was los ist und ihm dabei Angebote machen, wie man den aktuellen Gefühlszustand bezeichnen könnte („Bist du wütend?“). Dann wird sie fragen, warum sich das Kind so fühlt („Was ist denn passiert?“) und dabei signalisieren, dass sie das Erleben des Kindes verstehen kann („Ach, aber das ist ja auch wirklich blöd!“). Dann wird sie mit dem Kind zusammen nach Veränderungsmöglichkeiten suchen („Was können wir denn da tun?“) und letztlich wird sie ihm Unterstützung anbieten und ihm Mut machen, dass es diese Ideen auch umsetzen kann („Komm, ich helfe dir dabei, zusammen schaffen wir das“). Durch diese Art von „emotionalem Coaching“ in einer guten Bindung (vgl. Abbildung 1, Punkt 7) kann das Kind dann lernen, Emotionen wahrzunehmen, zu benennen, zu verstehen, zu akzeptieren und sich selbst in emotional schwierigen Situationen zu unterstützen. Dadurch wird es dem Kind möglich, angstfrei und offen mit problematischen Gefühlen zu experimentieren, so dass es im Laufe der Zeit immer mehr 780 S_Berking.indd 780 M atthias Berking & H ans Jörg Znoj Strategien sammeln kann, mit denen man Stresszustände und negative Gefühle positiv beeinflussen kann. Bleibt diese Unterstützung aus, fehlen diese Kompetenzen. In diesem Fall kann das Kind immer noch versuchen, über die Beobachtung nahestehender Personen diese Strategien zu erwerben. Aber die Möglichkeiten des Modelllernens (vgl. Abbildung 1, Punkt 8) bestehen nur in dem Umfang, in dem die Bezugspersonen auch selbst über effektive Emotionsregulationskompetenzen verfügen. In einer Familie, in der die Eltern selbst keine guten Emotionsregulationskompetenzen besitzen, in der die Mutter bei jeder Enttäuschung depressiv wird und der Vater bei jedem Ärger zur Flasche greift, wird es für das Kind schwer sein, diese Strategien von seinen Eltern zu lernen. Wenn das Kind dann weiter mit dem ihm angeborenen Reaktionsrepertoire auf negative Gefühle reagiert (z. B. mit Weinen, Schreien, Wutausbrüchen) kann es zu einer nicht unbeachtlichen Stressquelle für die Bezugspersonen werden. Vor allem dann, wenn diese selbst ihre Emotionen nicht gut regulieren können, besteht die Gefahr, dass sie in diesen Situationen dem Kind gegenüber mit Abwertung und Aggression (vgl. Abbildung 1, Punkt 9) begegnen („Du Schreihals“, „Du Heulsuse“, „Du kleiner Teufel“). Durch die häufige Kombination von negativen Emotionen einerseits und dem Erleben von verbaler und/oder nonverbaler Abwertung bzw. körperlichen und/oder verbalen Angriffen andererseits wird beim Kind ein mit negativen Emotionen assoziiertes negatives Selbstbild aufgebaut. Wenn das Kind dann zukünftig negative Emotionen erlebt, werden diese jedes Mal das negative Selbstbild „triggern“ (vgl. Abbildung 1, Punkt 10). Dadurch kommt es zu einer zusätzlichen Bedrohung des Bedürfnisses nach Selbstwerterhöhung, wodurch die Inkongruenz weiter erhöht wird. Damit einher geht die Aktivierung zusätzlicher, belastender Gefühle, wie z. B. Angst vor den Reaktionen anderer, Schuld oder Scham. Diese „sekundären“ Gefühle erschweren dann zusätzlich den konstruktiven Umgang mit den „primären“ problematischen Stressreaktionen oder Gefühlen und untergraben emotionsbezogene Selbstwirksamkeitserwartungen (vgl. Abbildung 1, Punkt 11). Damit haben wir auf Seiten der Bezugspersonen drei Faktoren, die den Erwerb einer guten Emotionsregulation behindern können: (1.) Das Fehlen des Coachings in emotional belastenden Situationen, (2.) das Fehlen von Modellen und (3.) die Abwertung in emotional belastenden Situationen. Je zahlreicher, anhaltender und ausgeprägter diese Faktoren sind, Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 03.05.2007 16:18:13 Neuropsychotherapie umso schwieriger wird es für das Kind sein, eine gute Emotionsregulation aufzubauen. Da diese Faktoren sich untereinander bedingen bzw. gemeinsame Ursachen haben, kann man davon ausgehen, dass sie gehäuft gemeinsam auftauchen. Wenn diese Beeinträchtigungen des Erwerbs einer effektiven Emotionsregulation zusammen mit häufigen Inkongruenzerfahrungen und/oder bei einem Kind mit einem „schwierigen Temperament“ auftreten, kommt es dazu, dass diese Kinder häufig anhaltende, ausgeprägte und unkontrollierbare Stressreaktionen und negative Emotionen erleben. Und dies kann gravierende Konsequenzen haben: Unkontrollierbare innerpsychische Stresszustände bedrohen in hohem Maße die Funktionsfähigkeit des psychischen Systems (s. o.). Deswegen werden in diesen Situationen Ängste (vgl. Abbildung 1, Punkt 12) ausgelöst und Vermeidungsschemata (vgl. Abbildung 1, Punkt 13) aktiviert. Diese initiieren Verhaltensweisen, die diesen Zustand möglichst schnell beenden sollen. Da dieses Vermeidungsverhalten eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Emotionsregulationsdefizite und der Entwicklung psychischer Störungen spielt, sollen die drei wichtigsten Arten von Emotionsvermeidung kurz vorgestellt werden. 2.2.1 Situationsvermeidung (vgl. Abbildung 1, Punkt 14) Eine Möglichkeit, unkontrollierbare, unangenehme Emotionen zu vermeiden, besteht darin, Situationen aus dem Weg zu gehen, die diese Emotionen auslösen. Durch ein solches Vermeidungsverhalten wird allerdings auch das Erreichen wichtiger Annäherungsziele behindert, da viele Ziele nur erreichbar sind, indem man sich Situationen stellt, die zunächst auch negative Gefühle auslösen. 2.2.2 Verdrängung (vgl. Abbildung 1, Punkt 15) Eine zweite Möglichkeit besteht darin, negative Gefühle nicht bewusst wahrzunehmen, sondern zu verdrängen. Mit dieser Möglichkeit geht der Nachteil einher, dass die Ressource, belastende Erlebnisse kognitiv und emotional verarbeiten zu können, nicht genutzt werden kann. Dies kann dann dazu führen, dass die Zustände körperlicher Erregung, die durch die Belastung ausgelöst wurden, länger als nötig anhalten und dann zu körperlichen Beschwerden führen. Außerdem wird der Erfahrungsraum um den Bereich negativer Emotionen beschnitten, was je nach Weltbild schon als ein Verlust an sich gesehen werden kann. Das Fehlen emotionaler Reaktionen kann sich letztlich auch beeinträchtigend auf soziale Beziehungen auswirken, da diese ihre Le- Schwerpunkt bendigkeit zu großen Teilen aus dem Austausch emotionaler Signale beziehen. 2.2.3 Aktivierung mentaler Prozesse, die ablenken und/oder Kontrolle suggerieren und/oder die Stimmung kurzfristig „reparieren“ (vgl. Abbildung 1, Punkt 16) Diese dritte Möglichkeit der Emotionsvermeidung ist für das Verständnis psychischer Störungen wohl am relevantesten. Sie besteht darin, Prozesse zu aktivieren, die von der schmerzhaften Emotion ablenken und/oder Kontrollierbarkeit suggerieren und/oder die Stimmung kurzfristig „reparieren“. Die Ablenkung kann zum Beispiel darüber erfolgen, dass man mit der Aufmerksamkeit auf Körperempfindungen fokussiert, die eine potenzielle Gefahr für die Gesundheit signalisieren. Da die „Sicherung der körperlichen Unversehrtheit“ in der Zielhierarchie von Lebewesen in der Regel einen zentralen Platz einnimmt, beinhalten solche Somatisierungsprozesse ein hohes Ablenkungspotenzial. Um Kontrolle zu erleben, kann man sich z. B. Sorgen machen. Dabei suggeriert das ständige Analysieren, dass man Ursachen finden und daraus Handlungspläne entwickeln kann. Damit wird die Situation wieder eher als kontrollierbar erlebt. Um kurzfristig die Stimmung zu verbessern, kann man z. B. psychoaktive Substanzen konsumieren. Damit stimuliert man Zentren im Gehirn, die für positive Stimmungen zuständig sind, und reduziert so den vorherigen aversiv-unkontrollierbaren Zustand. Neben den exemplarisch aufgeführten Prozessen des Somatisierens, des Sich-Sorgens und des Drogenkonsums können eine Vielzahl weiterer Prozesse eine wichtige Funktion bei der kurzfristigen Emotionsregulation spielen, wie z. B. Selbstabwertung, Selbstbeschuldigung, Abwertung anderer, Anklammern an andere, Rumination, überzogene Zielsetzungen, Essen und Essanfälle, Fasten, Checking-Behavior, Substanzmissbrauch, Zwänge etc. All diese Prozesse können in den Dienst einer kurzfristigen Reduktion aversiv-unkontrollierbarer Zustände gestellt werden. Wenn sie diese Funktion erfüllen, werden sie selektiv verstärkt. Wenn die Verstärkung stark genug ist oder sich über die Zeit aufsummiert, ohne dass alternative Mechanismen die emotionsregulierende Funktion übernehmen können, dann können diese Prozesse letztlich zum Ausgangpunkt der Entwicklung einer psychischen Störung werden oder zur Aufrechterhaltung einer bestehenden Störung beitragen (s. u.). Die drei eben aufgeführten Arten von Vermeidungsverhalten gegenüber unangenehmen Gefühlen 38. Jg. (4), 777-778, 2006 S_Berking.indd 781 781 03.05.2007 16:18:13 Schwerpunkt haben alle denselben Nachteil: Sie erschweren den Erwerb von Regulationsstrategien, die auch langfristig effektiv sind und weniger „Nebenwirkungen“ haben. Damit entsteht letztlich ein Teufelskreis: Mangelnde Emotionsregulationsfertigkeiten führen dazu, dass belastende Gefühle als unkontrollierbar erlebt werden. Das Gefühl von Kontrollverlust löst Angst aus und aktiviert bzw. generiert Vermeidungsschemata. Diese reduzieren dann die Möglichkeiten, die eigenen Emotionsregulationskompetenzen aufzubauen und zu trainieren. Damit bleiben Erfolgserlebnisse aus, die eine emotionsbezogene Selbstwirksamkeitserwartung stärken könnten. Außerdem verfestigen die Misserfolge das negative Selbstbild, welches dann in emotionalen Belastungssituationen aktiviert wird, die Selbsteffizienzerwartung weiter reduziert und zusätzliche negative Gefühle auslöst. Diese Teufelskreise können im Verlauf der weiteren Entwicklung dann dazu beitragen, dass die Emotionsregulationskompetenzen auch dann noch bestehen bleiben, wenn das Kind bzw. der Jugendliche oder junge Erwachsene sich im Zuge seiner weiteren Entwicklung mehr und mehr von seinen primären Bezugspersonen löst. 2.3 Akute Inkongruenzerfahrungen als Auslöser Die soeben geschilderten vermeidungsorientierten Umgangsweisen mit Emotionen und die dadurch verfestigten Emotionsregulationsdefizite müssen nicht zwingend zur Ausbildung psychischer Störungen führen. Viele Menschen leben lange sehr gut und sehr erfolgreich, ohne dass sie sich mit ihren Gefühlen jemals direkt beschäftigen. Problematisch kann diese Art, mit Emotionen umzugehen, allerdings werden, wenn die Person mit Ereignissen (vgl. Abbildung 1, Punkt 17) konfrontiert wird, die mit massiven Bedrohungen und/oder Verletzungen ihrer Ziele und Bedürfnisse einhergehen (vgl. Abbildung 1, Punkt 18). In dieser Situation sind die eingespielten Coping-Mechanismen, die die Gefühle bislang weit im Vorfeld des bewussten Erlebens herunterreguliert haben, dann oft überfordert. In einer solchen Situation steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Gefühle und/oder ihre somatischen Manifestationen trotz vorliegender Vermeidungstendenzen ins Bewusstsein dringen, da dies der Ort ist, an dem Probleme gelöst werden, für die keine erfolgreichen Handlungsroutinen zur Verfügung stehen. Wenn jetzt keine explizit kodierten Konzepte abgerufen werden können, wie man diese Erfahrungen einordnen und wie man mit ihnen konstruktiv umgehen kann, kommt es (je nach Veranlagung und frühen Inkongruenzerfahrungen) zu einem 782 S_Berking.indd 782 M atthias Berking & H ans Jörg Znoj hohem psychophysiologischen Arousal (vgl. Abbildung 1, Punkt 19), zum Erleben von Kontrollverlust (vgl. Abbildung 1, Punkt 20) und zur Ausschüttung von Stresshormonen (vgl. Abbildung 1, Punkt 21). Je länger der erhöhte Spiegel von Stresshormonen wie Cortisol und Noradrenalin anhält, desto mehr wird die Hemmung von negativen Emotionen oder problematischen Verhaltensweisen gestört, die vom PFC und vom Hippocampus ausgehen (vgl. Abbildung 1, Punkt 22). Damit können jetzt „pre-pathologische Reaktionsmuster“ ungehemmt auftreten. Wenn diese kurzfristig den bedrohlichen Zustand unkontrollierbaren Stresses reduzieren – etwa dadurch, dass sie die Aufmerksamkeit verschieben, Kontrolle suggerieren oder positive Emotionen auslösen –, werden sie selektiv verstärkt. Zukünftig werden sie dann in ähnlichen Situationen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit automatisch aktiviert (und gegebenenfalls wieder selektiv verstärkt). Über diese Verfestigung des Reaktionsmusters und die anschließende Einbindung anderer Reaktionsweisen, die dieses Muster weiter aufrechterhalten (z. B. Vermeidung bei Angst), können beim Scheitern adäquater Selbsttherapiebemühungen (z. B. Aktivierung konstruktiver Emotionsregulationsstrategien) aus den „prä-pathologischen Mechanismen“ manifeste psychische Störungen (vgl. Abbildung 1, Punkt 24) entstehen. Außerdem ist davon auszugehen, dass diese anhaltende massive Stressreaktion die Expression von Genen fördert, die spezifische Störungsmuster kodieren (vgl. Abbildung 1, Punkt 23). Das eben geschilderte Modell stellt eine Integration wichtiger Befunde aus den verschiedenen Unterdisziplinen der Psychologie und den Neurowissenschaften dar. Ein solches Modell kann praktisch arbeitenden Therapeuten als Bezugssystem dienen, innerhalb dessen sie das aktuelle Verhalten ihrer Patienten besser verstehen können. Unter Umständen kann das Modell auch (in Teilen) als Hilfestellung herangezogen werden, um mit Patienten zusammen zu erarbeiten, wie ihre aktuellen Beschwerden entstanden sind. Die Integration der neuronalen Ebene kann dabei zumindest bei einer Subgruppe von Patienten eine wichtige Hilfestellung sein, um diese einerseits von Selbstvorwürfen zu entlasten, andererseits aber auch für Veränderungsbemühungen zu motivieren (vgl. Berking & Grawe, 2005a). Zum anderen kann die Einnahme der neurowissenschaftlichen Perspektive helfen, das Bewusstsein dafür zu stärken, dass sich die Therapie nicht nur auf die Reduktion psychopathologischer Symptome reduzieren darf. Die Befunde zur patho- Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 03.05.2007 16:18:13 Neuropsychotherapie logischen Wirkung unkontrollierbaren Stresses legen nahe, dass in der Therapieplanung sorgfältig geprüft werden muss, wie sich die Wahrscheinlichkeit verringern lässt, dass der Patient zukünftig in diese Zustände gerät. Dazu gilt es zum einen, die Ziele und Bedürfnisse des Patienten besser mit seinen Wahrnehmungen in Einklang zu bringen bzw. ihn in die Lage zu versetzen, etwaige Diskrepanzen zukünftig selbst zu reduzieren. Da diese Diskrepanzen jedoch nie völlig reduziert werden können, gilt es auch zu prüfen, ob gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Umgangs mit intrapsychischen Stresszuständen indiziert sind. Wenn es gelingt, in der Therapie die Kompetenzen im konstruktiven Umgang mit negativen Emotionen zu stärken, wird damit verhindert, dass intrapsychische Stresszustände als überwältigend und nichtkontrollierbar erlebt werden. Auf diesem Weg wird die Notwendigkeit reduziert, auf pathologische mentale Prozesse zurückzugreifen, um diese Zustände zu reduzieren. Somit kann die Verbesserung emotionaler Kompetenzen die störungsbezogenen Interventionen stärken und langfristig ein wichtiger Schutz vor Rückfällen sein. Auf der Grundlage dieser Überlegungen haben wir ein spezielles Training emotionaler Kompetenzen entwickelt, das im folgenden Abschnitt vorgestellt werden soll. 3. „Neuropsychotherapie“ in der Praxis: Das Training Emotionaler Kompetenzen (TEK) Das Training Emotionaler Kompetenzen wurde mit dem Ziel entwickelt, die emotionsbezogenen Bewältigungskompetenzen von Menschen zu stärken, die entweder unter psychischen Störungen leiden oder ein erhöhtes Risiko aufweisen, psychische Störungen zu entwickeln. Da diese Kompetenzen für Patienten mit diversen psychischen Störungen wichtig sind (vgl. Berking, in Druck), haben wir das TEK als störungsübergreifendes Interventionsmodul entwickelt. Im Training sollen die emotionalen Kompetenzen gestärkt werden, die sich empirisch als besonders wichtig für die psychische Gesundheit erwiesen haben (vgl. Berking & Grawe, 2005b). Bei der Behandlung psychischer Störungen sollte das TEK eine Komponente eines Behandlungsangebotes darstellen, das auch störungsspezifischere Interventionsmodule enthält. Im nichtklinischen und präventiven Bereich kann das TEK auch als eigenständige Intervention eingesetzt werden. Schwerpunkt Im TEK sollen die Patienten/Teilnehmer lernen, mit diversen negativen Emotionen konstruktiv umgehen zu können. Das heißt konkret, dass sie negative Emotionen entweder (a) positiv verändern und/ oder (b) akzeptieren und aushalten können und (c) dass sie sich dieser Fähigkeiten bewusst sind. Zur Förderung der emotionsbezogenen Selbsteffizienz werden den Patienten im TEK sieben „Basiskompetenzen“ vermittelt (s. Abbildung 2). Diese Kompetenzen werden als Werkzeuge angesehen, die man wie „in einem Koffer bei sich hat“ und bei Bedarf einsetzen kann. Sie sind Handlungspläne, deren Verfügbarkeit der Einschätzung vorbeugt, negativen Gefühlen hilflos ausgesetzt zu sein. Die Basiskompetenzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei allen negativen Gefühlen hilfreich sind. Zusätzlich zu den Basiskompetenzen werden im TEK noch die „spezifischen Kompetenzen“ vermittelt, die sich auf den Umgang mit einzelnen, für die Gesundheit besonders relevanten affektiven Reaktionen beziehen. Dazu zählen: Stress, Angst, Ärger, Traurigkeit, Depressivität, Schuld und Scham. Je nach Bedarf kann diese Liste noch um Gefühle erweitert werden, die für die jeweilige Patientengruppe besonders relevant ist (z. B. Ekel oder Eifersucht). Um individuelle Schwierigkeiten bei der Regulation dieser Gefühle identifizieren zu können, haben wir mit dem EMO-Check (Berking & Znoj, zur Veröffentlichung eingereicht) einen speziellen Fragebogen entwickelt. Über ein ebenfalls kürzlich entwickeltes online-gestütztes Erfassungs- und Auswertungssystem können die Veränderungen der emotionalen Kompetenzen während des Training ohne viel Aufwand monitoriert und an Patienten und Therapeut/Trainer rückgemeldet werden (s. www.emoforsch.info). Inspiriert von neurowissenschaftlichen Befunden, die belegen, dass für die Veränderung synaptischer Verschaltungen eine intensive und anhaltende Stimulation dieser Verschaltungen notwendig ist, wird dem Trainingsaspekt im TEK besondere Beachtung geschenkt. So wird zum Beispiel jede der Basiskompetenzen erst durch Psychoedukation und vertiefende Übungen vermittelt und dann immer weiter verkürzt, so dass sie letztlich in kurzer Zeit anwendbar sind. Die Patienten werden dann mit verschiedenen Techniken dabei unterstützt, diese Übungen einmal am Tag in einer Langform (15 Minuten) und dreimal am Tag in einer Kurzform (15 Sekunden) zu üben. Diese Kurzformen werden dann zur so genannten „TEK-Sequenz“ zusammengesetzt, die sich in emotional belastenden Situationen als intrapsychisches Coping einsetzen lässt. Eine der Hilfestellungen für das möglichst regel38. Jg. (4), 777-778, 2006 S_Berking.indd 783 783 03.05.2007 16:18:14 Schwerpunkt M atthias Berking & H ans Jörg Znoj Abbildung 2: Die sieben im TEK vermittelten „Basiskompetenzen“ 1. MuskelEntspannung 7. Regulieren 6. Analysieren Wenn Gefühle verletzen 5. Selbstunterstützung S_Berking.indd 784 3. Bewertungsfreie Wahrnehmung 4. Akzeptieren & Tolerieren mäßige, eigenverantwortliche Training der TEKKompetenzen besteht z. B. darin, dass die Patienten (bei Interesse) über ein spezielles Computerprogramm über den Tag verteilt SMS-Botschaften zugeschickt bekommen, die jeweils zu den gerade im TEK behandelten Übungen einladen. Ein weiterer Punkt, an dem das TEK von den neurowissenschaftlichen Befunden profitiert, ist die Vermittlung eines motivierenden Störungs- und Veränderungsmodells. So wird im psychoedukativen Teil des TEK z. B. zunächst erklärt, welche „neuronalen Teufelskreise“ zu einer Chronifizierung negativer Gefühle führen. Aus jedem der sieben explizierten Teufelskreise wird dann eine der TEKBasiskompetenzen als eine Möglichkeit abgeleitet, wie dieser Teufelskreis durchbrochen werden kann. Ein Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass die dabei verwendeten Grafiken der beteiligten Hirnstrukturen viel anschaulicher, konkreter und damit „realer“ sind als die abstrakteren „Kästchenmodelle der Psychologie“. Auch bei der Thematisierung der Relevanz regelmäßigen Übens wird auf Bilder zurückgegriffen, die die neuronalen Mechanismen 784 2. AtemEntspannung des Lernens darlegen (Stichwort „use it or lose it“). Bislang haben wir mit diesem Vorgehen sehr gute Erfahrungen gemacht. Speziell für eher somatisch orientierte Patienten hilft diese Vorgehensweise oft, die Offenheit für psychotherapeutische Verfahren zu erhöhen (Psychotherapie als „Hirntraining“). 4. Fazit und Ausblick Der Einbezug von Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften hat bislang sicher nicht zu revolutionären Veränderungen bei der Erklärung und Behandlung psychischer Störungen geführt. Aber wie wir oben anhand von Beispielen zeigen konnten, kann der Einbezug dieser Perspektive der therapeutischen Praxis bereits jetzt wertvolle Impulse geben. Das TEK, das die Erkenntnisse der Neurowissenschaften systematisch zu nutzen sucht, wird mittlerweile in einer Reihe von Institutionen bei einer Vielzahl von psychischen Störungen eingesetzt und auf seine Effektivität geprüft. Erste empirische Befunde sprechen dafür, dass das Training als zusätzliches Interventionsmodul die Effektivität be- Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 03.05.2007 16:18:17 Neuropsychotherapie währter Behandlungsverfahren noch weiter steigern kann (Berking, Reichardt, Pejic & Dippel, 2007). Speziell für stationäre, interdisziplinäre Behandlungseinrichtungen bringt die neuropsychotherapeutische Perspektive des TEK den Vorteil mit sich, dass sie für die Arbeit der verschiedenen Berufsgruppen ein einheitliches Behandlungsrational zur Verfügung stellt. Ermutigt von diesen vielversprechenden Erfahrungen und Befunden planen wir zurzeit weitere Forschungsprojekte, in denen wir untersuchen, inwieweit das TEK bei der langfristigen Stabilisierung des Behandlungserfolgs helfen kann. Dabei entwickeln wir unter anderem in Kooperation mit der Universität Lüneburg internetbasierte TEK-Angebote zur Nachbetreuung der Patienten nach der eigentlichen Therapiephase. Ein weiterer Entwicklungsstrang besteht darin, störungsspezifische Variationen des psychoedukativen Teils des TEK zu entwickeln. In diesen soll „neuropsychotherapeutisch“ dargelegt werden, warum die emotionalen Kompetenzen für die einzelnen Störungen von Relevanz sind. Literatur Berking, M. (in Druck). Training Emotionaler Kompetenzen. Heidelberg: Springer. Berking, M. & Grawe, K. (2005a). Angststörungen aus „neuropsychotherapeutischer“ Perspektive. Psychotherapie im Dialog, 6(4), 414–419. Berking, M. & Grawe, K. (2005b, September). Be smart – suffer less: About the importance of emotional intelligence for well-being and mental health. Vortrag auf dem 35. Kongress der European Association of Cognitive Behavioral Therapy, Thessaloniki, Griechenland. Berking, M., Reichardt, A., Pejic, T. & Dippel, A. (2007). The effectiveness of an intense emotion regulation skills training as an additional component in the treatment of unipolar depression. Vortrag auf dem 160. Kongress der American Psychiatric Association, San Diego, USA. Berking, M. & Znoj, H.-J. (zur Veröffentlichung eingereicht). Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur standardisierten Selbsteinschätzung emotionaler Kompetenzen (SEK-27). Graham, Y. P., Heim C., Goodman, S. H., Miller, A. H. & Nemeroff, C. B. (1999). The effects of neonatal stress on brain development: Implications for psychopathology. Development and Psychopathology, 11, 545–565. Grawe, K. (1998). Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe. Schwerpunkt Grawe, K. (2004). Neuropsychotherapie. Göttingen: Hogrefe. Hofer, M. A. (1984). Relationships as regulators: A psychobiological perspective on bereavement. Psychosomatic Medicine, 46, 183–197. Hofer, M. A. (1987). Early social relationships: A psychophysiologist’s view. Child Development, 58, 633–647. Hüther, G. (1998). Stress and the adaptive self-organization of neuronal connectivity during early childhood. International Journal of Developmental Neuroscience, 16, 297–306. Nemeroff, C. B. (2004). Neurobiological consequences of childhood trauma. Journal of Clinical Psychiatry, 65, 18–28. Ogawa, T., Mikuni, M., Kuroda, Y., Muneoka, K., Miori, K. J. & Takahashi, K. (1994). Periodic maternal deprivation alters stress response in adult offspring, potentiates the negative feedback regulation of restraint stressinduced adrenocortical response and reduces the frequencies of open field-induced behaviors. Pharmacology Biochemistry Behavior, 49, 961–967. Tellegen, A., Lykken, D. T., Bouchard, T. J., Wilcox, K. J., Segal, N. L. & Rich, S. (1988). Personality similarity in twins reared apart and together. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1031–1039. Viltart, O., Mairesse, J., Darnaudery, M., Louvart, H., Vanbesien-Mailliot, C., Catalani, A. & Maccari, S. (2006). Prenatal stress alters Fos protein expression in hippocampus and locus coeruleus stress-related brain structures. Psychoneuroendocrinology [Epub ahead of print]. Walcott, C. M. & Landau, S. (2004). The relation between disinhibition and emotion regulation in boys with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33(4), 772–782. Wurmser, H., Rieger, M., Domogalla, C., Kahnt, A., Buchwald, J., Kowatsch, M., Kuehnert, N., BuskeKirschbaum, A., Papousek, M., Pirke, K. M. & von Voss, H. (2006). Association between life stress during pregnancy and infant crying in the first six months postpartum: A prospective longitudinal study. Early Human Development [Epub ahead of print]. Zu den Autoren Dr. Matthias Berking ist Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut und Supervisor. Nach dem Studium der Psychologie arbeitete er zunächst 38. Jg. (4), 777-778, 2006 S_Berking.indd 785 785 03.05.2007 16:18:17 Schwerpunkt für einige Jahre an der Paracelsus Roswitha Klinik in Bad Gandersheim. Anschließend promovierte er an der Universität Göttingen. Danach war er mehrere Jahre als Assistent von Prof. Dr. Klaus Grawe an der Universität Bern tätig. Zurzeit arbeitet er, im Rahmen eines Stipendiums des Schweizer Nationalfonds, zusammen mit Marsha M. Linehan an der University of Washington (USA) vor allem im Bereich „Interventionen zur Verbesserung der Emotionsregulation bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung“. Weitere Forschungsschwerpunkte sind: „Emotionsregulation als therapeutischer Ansatzpunkt bei diversen psychischen Störungen“, „Ressourcenaktivierung“ und „Förderung der Therapiemotivation“. Prof. Dr. Hans Jörg Znoj, Studium der Psychologie, Promotion 1992 zum Dr. phil., die Habilitation folgte 2001. Seit 1988 Übernahme und Durchführung von Psychotherapien an der Praxisstelle des Instituts für Psychologie, Mitglied des Leitungsteams. 2002 bis 2006 Assistenzprofessor an der Universität Bern, 2006 Berufung zum a.o. Professor für Klinische Psychologie. Von 2005 bis voraussichtlich Mitte 2007: ad interim Leitung der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität Bern. Forschungsinteressen: Psychotherapieprozesse; Effektivität von Psychotherapeutischen Interventionen; Emotionsregulation und Bewältigungsprozesse im Zusammenhang mit kritischen Lebensereignissen; Trauer und Trauerverabeitung; Positive Psychologie (Wachstum – „personal growth“); gesundheitspsychologische Fragen; Evaluation und Entwicklung psychologischer Interventionen bei somatischen Störungen. 786 S_Berking.indd 786 M atthias Berking & H ans Jörg Znoj Korrespondenzadressen Dr. Matthias Berking University of Washington Behavioral Research and Therapy Clinics Department of Psychology Box 351525 Seattle, WA 98195, USA E-Mail: [email protected] Prof. Dr. Hans Jörg Znoj Klinische Psychologie und Psychotherapie Institut für Psychologie Universität Bern Gesellschaftsstr. 49 CH-3012 Bern E-Mail: [email protected] Danksagung Wir danken dem Team der Psychotherapeutischen Praxisstelle der Universität Bern, Chefärztin Frau Alexandra Dippel, Dipl.-Psych. Marek Szczepanski und Dipl.-Psych. Tanja Pejic von der Vogelsbergklinik, Prof. Dr. Waldemar Greil, Dr. Christine Huwig-Poppe und Dipl.-Psych. Verena Jäggi vom Sanatorium Kilchberg, Dipl.-Psych. Salome Lienert von der Neurologie Reinfelden, Dr. Frank Meyer und Monika Stratmann von der Chrisoph-DornierKlinik Münster) sowie David Ebert von der Fachhochschule Lüneburg für die Hilfe bei der Evaluation des TEK bzw. die wertvollen Tipps für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Trainings. Weiterer Dank geht an den Schweizer Nationalfonds (SNF), der Grundlagenforschung, auf der das Training aufbaut, im Rahmen des Projektes Nr. PA001113040/1 von M. Berking unterstützte. Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 03.05.2007 16:18:17