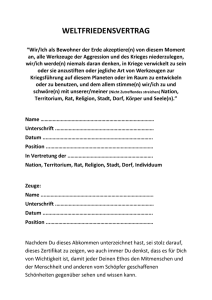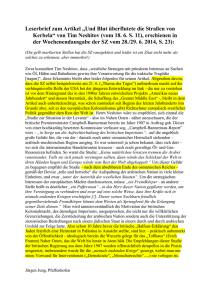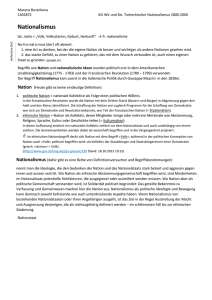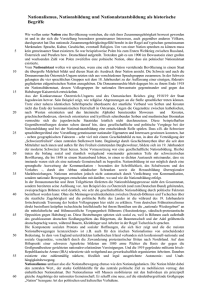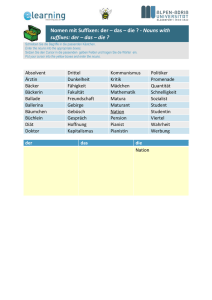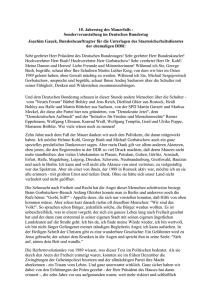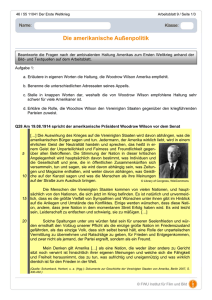Vexierbild US-Amerika
Werbung

Vexierbild US-Amerika (14.4.2005) Wir alle kennen das irritierende Vexierbild der alten Hexe, die plötzlich als schöne junge Frau erscheint, je nachdem, wie wir das Bild betrachten. Wir können mit einer gewissen Übung von einem Bild zum andern wechseln, beide gleichzeitig zu sehen, will uns jedoch nicht gelingen. Genau dies wollen wir im Folgenden am Beispiel US-Amerika versuchen. Auch die USA sind nämlich ein solches Vexierbild mit zwei (oder mehr) Gesichtern - besonders im jetzigen geschichtlichen Moment. Für viele, die Amerika noch vor der Bush-Ära erlebt haben, ist es (oder war es) ein Land des Versprechens, der Freiheit und der Demokratie, und gerade sie sind von den gegenwärtigen - irrational anmutenden - Entwicklungen aufs tiefste frustriert. Für die meisten ist Amerika heute zu einer wahren Horrorvision geworden, und jede Lust, dieses Land zu besuchen, ist uns vergangen - dies gilt selbst für AkademikerInnen, Wirtschaftsbosse und Politiker, die berufshalber regelmäßig in die USA reisen. Was ist geschehen? Nach allgemeiner Auffassung hat der Terrorangriff vom 11.9.01 eine völlig neue Lage geschaffen und ist für das gegenwärtige paranoisch-aggressive Verhalten der USA hauptverantwortlich. Jedenfalls ist das jetzige (böse) Gesicht Amerikas für die meisten von uns mit dem tradierten Bild der stolzen, an Pallas gemahnenden, Freiheitssstatue nicht mehr vereinbar. Wie Emma Lazarus‘ prophetische Inschrift zudem verdeutlicht, ist diese imposante Figur ein Symbol der USA als Zufluchtsort für alle Verfolgten und Ausgestoßenen dieser Erde. Dies soll nun plötzlich anders sein. Kein Wunder, wenn das neue, abstoßende Gesicht einem einzigen Mann und dessen Mannschaft zugeschrieben wird: George Bush Jr., der in wenig vornehmer Weise im Internet als Affe karikiert ist. Nun stellte der „ugly American“ schon immer ein Gegenbild zum heroischen Pionier dar, den D.H. Lawrence in der Person des Lederstrumpf gar als Killerseele apostrophiert. Auch die big stick-Politik der USA ist durchaus nichts Neues, es gab sie schon immer, wenngleich der spanisch-amerikanische Krieg den Weg zur jetzigen globalen Machtpolitik geebnet hat. Auch die Verschwörungshysterie hat eine lange Vorgeschichte, man erinnere sich nur an den (gegen Frankreich gerichteten) Alien and Sedition Act von 1798. Was dagegen neu scheint, ist die groteske Diskrepanz zwischen dem Bild der USA als heroischer - quasi-religiöser Verteidiger der Menschenrechte und Ort der demokratischen Freiheiten, wie es den US-Amerikanern selbst vorschwebt und der Fremdperspektive einer übermächtigen und (im antiken Sinn) maßlos-übermütigen Weltmacht, die ausschließlich ihren eigenen Vorteil sucht, sich selbst keine Grenzen setzt und ohne Ruecksicht auf internationales Recht, das die USA wesentlich mitgeschaffen haben und durch dessen Mißachtung sie nun ihre besten Traditionen zu zerstören drohen. Je genauer wir hinsehen, desto unbegreiflicher wird das Vexierbild Amerika. Daß dieser Kontinent - zunächst für Europäer - seit den kolonialen Anfängen als 1 Projektionsfläche fungierte, hat jenes Wunschbild geschaffen, an dem wir heute noch hangen und dessen Verschwinden wir schon deshalb bedauern, weil es Teil unserer eigenen Vorstellung geworden ist. Wenn Utopien realisiert werden, sehen sie meist sehr viel anders aus als im vorgestellten Modell. Allgemein dürfte man sagen, es gibt soviele Amerika(bilder) als es Betrachter dieses Landes gibt, wobei jedes Bild stark durch persönliche Erfahrungen gefärbt ist. Zur Zeit scheint das Vexierbild auf ein simples Vor- und Nachher sowie auf eine Positiv- und Negativkopie reduziert. Das ist zweifellos eine Verzerrung. In Wirklichkeit sind beide Seiten des Vexierbildes ebenso wie die scheinbar unvereinbaren Perspektiven von Eigen- und Fremdeinschätzung seit den kolonialen Anfängen auf komplexe Weise in der Geschichte angelegt. Bei genauerem Hinsehen zeigt es sich nämlich, daß die amerikanische Identität immer schon eine ambivalente war (die Forschungsliteratur spricht in diesem Zusammenhang gewöhnlich von Paradoxien und Dilemmen), wobei je nach den historischen Bedingungen das eine oder andere Moment stärker hervortrat .Zwei dieser komplementären, aber auch konfliktgeladenen, Gegenpole seien hier herausgehoben: Das Spannungsverhältnis zwischen dem demokratischen Grundprinzip und dem Anspruch auf imperiale Vorherrschaft einerseits, sowie das Gegensatzpaar von aufklärerischem Impuls und einem religiös-biblisch fundierten Messianismus anderseits. Geschichtsmächtig wurden diese scheinbar konfligierenden Elemente vor allem dadurch, daß sie sich in paradoxer Form gegenseitig hochschaukelten. Das (gelegentlich doch etwas schlechte) Gewissen der Nation kann sich immer wieder damit beruhigen, daß selbst in Fällen eklatanter Ungerechtigkeit der eine Pol den andern legitimiert. Einmal ist es die messianische Sendung der „Stadt auf dem Berg“, ein andermal die Verpflichtung, als stärkste Macht in dieser Welt endlich für Ordnung zu sorgen, ein Gedanke, der auf das biblische Bild der Weltherrschaft im Hinblick auf den kosmischen Endkampf zwischen den Mächten der Finsternis und des Lichts voraus weist (eine Erwartung, die dem jüdisch-christlichen und dem islamischen Denken gemeinsam ist), als empire-Konzept aber auch den religiösen Begriff des Empyreum evoziert, des obersten geistigen Lichtreiches - ein hoffnungsvolles Bild. Die Amerikaner waren seit den kolonialen Anfängen bemüht, im Reflex auf ein quälendes Minderwertigkeitsgefühl, welches sich aus der im Verhältnis zu Großbritannien (speziell London) nur allzu fühlbaren - und nicht selten als „Exil“ verstandenen - kulturell und intellektuell peripheren Lage heraus natürlicherweise ergab, als Gegenzug im großen theatrum mundi jene Vorbild- und Führungsrolle zu übernehmen, welche das Herkunftsland zunächst religiös und dann wirtschaftlich und machtstrategisch übertreffen sollte. Entscheidend war dabei weniger, wie man seine Rolle aus einer selbstkritischen Eigenperspektive gesehen spielt, sondern vielmehr, welche Figur das Land in den Augen Europas und der übrigen Welt macht. Deshalb der kürzliche Vorwurf Clintons an Bush: Guantanamo ist eine Schande, denn es beschädigt das Bild der USA in der Welt - die Verletzung der Menschenrechte war Clinton dabei eher zweitrangig (eine Begründung übrigens, die 2 Bushs eigener Argumentationsstrategie entlehnt ist). Die Versuchung, im Welttheater neben der wirklichen Macht auch eine rhetorisch-grandiose Pose zu kreieren, ist seit jeher in den USA überdeutlich: Nicht das Auge Gottes, sondern der Blick der Welt scheint für das Selbstimage der Vereinigten Staaten entscheidend. Das hörte sich in John Winthrops berühmten Worten noch anders an: the eies of all people are uppon us; so that we shall deal falsely with our God . . . we shall be made a . . . by-word through the world (letzteres ganz im Ton der frühen Jeremiaden). Bush spielt die Rolle, die er sich als Nimrodscher Terrorismusbekämpfer selbst gegeben hat, nicht ohne Erfolg, aber die Rolle, die ihm der in Amerikas Grundwerten eingeschriebene geschichtliche Auftrag erteilt, diese Rolle hat er bislang nicht erfüllt. Wenn eine Nation nicht selbst befolgt, was sie andern als Ideale verkündet, und wenn ihre Interventionen mehr Schaden stiften als der Schaden, den die Interventionen beseitigen sollten (wie bereits Twains The Connecticut Yankee in King Arthur‘s Court und Saul Bellows Henderson the Rain King unvergesslich ins Bild gebracht haben), und wenn dazu noch der konkrete Erfolg nach herkömmlicher puritanischer Doktrin ein Zeichen göttlichen Wohlwollens darstellt, dann steht es eher fragwürdig um Bushs weltgeschichtliche Statur. Eine Gesamtbeurteilung seiner Leistung ist aber noch verfrüht. Was nun die spezifisch amerikanische Form der Selbstlegitimation angeht, welche die Amerikaner selbst als historisches Vermächtnis seit frühesten Zeiten befeuert hat und die ihnen - nach eigenem Verständnis - als religiös-mythische und moralische Verpflichtung sogar literaliter aufgetragen ist, so muß dies den nicht-Amerikanern, zumal den als post-mythologisch sich verstehenden Europäern, als schiere Hybris vorkommen. Bleibt die schwierige Frage, wieweit dies heute eine unbewußte bzw. eine sich nicht zugestandene Selbsttäuschung darstellt, an welche die Amerikaner in für Außenstehende kaum verständlicher Weise ohne Einschränkung glauben oder doch glauben wollen und mit der sie (zumindest in ihren eigenen Augen) auch unrechtmäßiges Handeln - jesuitisch - jederzeit zu rechtfertigen vermögen. Ob sich die USA zur Klärung ihrer Verdrängungsmechanismen nicht doch einmal auf Freuds Couch legen sollten? Es ist dies eine Form von religiös-politischer Selbstbeglaubigung, die unter dem Tocquevilleschen Etikett American Exceptionalism schon die ersten puritanischen Kolonisten und dann die gesamte Gründerzeit bestimmt hat und als solche auch in die politische Theorie Eingang fand. In American Exceptionalism: A Double-Edged Sword (1986) hat Seymour Martin Lipset zu diesem Thema eine brilliante Studie geliefert. Interessant ist die Feststellung, daß bei Lipset der naheliegende Begriff der Instrumentalisierung (des Religiös-Mythischen) gar nicht vorkommt. Richard Hofstadter hat den Sachverhalt folgendermaßen auf den Punkt gebracht: Amerika als Nation hat gar keine Ideologie, es ist vielmehr sein Schicksal, selbst eine Ideologie zu sein. Zunächst dürfte man annehmen, daß der demokratische Gedanke in seiner christlich3 egalitären Wertvorstellung, wie dies neben Whitman auch von Melville und vielen anderen Autoren wie Crane und Williams zelebriert wurde, mit dem politischen Willen nach gewaltsamer Landnahme und nach imperialer Vorherrschaft eher kollidieren müßte, doch wird schon in den ersten Fahrten puritanischer Übersiedler nach dem neuen Kontinent deutlich, wie sehr sich diese als saints von den strangers abzusetzen gedenken. Diese binäre Vorstellung verstärkt sich noch in der genozidartigen Ausmerzung der indianischen Bevölkerung sowie in der Sklaverei im Süden, und sie hat sich auf Grund der anfänglich rassisch-religiösen Dominanz des anglo-amerikanischen Bevölkerungsteils in der Begegnung mit anderen Minoritäten bis weit ins 19. Jahrhundert und darüber hinaus erhalten. Die Vereinigten Staaten waren keineswegs die Begründer und Förderer multikulturellen Zusammenlebens, wie das heute von ihnen selbst als a nation of nations gerne gesehen wird, im Gegenteil. Dazu spricht die leidvolle Geschichte verschiedener Minoritäten eine zu deutliche Sprache. Was den Willen zur geographischen Expansion angeht, so erwies sich der Glaube an die eigene rassische und kulturelle Überlegenheit - als Reaktion auf das dem Herkunftsland gegenüber stark verspürte Unterlegenheitsgefühl - und die damit verbundene überhöhte Selbsteinätzung (auch hinsichtlich der südlichen Nachbarn) zusammen mit dem messianischen Gedanken eines göttlichen Auftrags zur Erweiterung der Herrschaft immer wieder als unwiderstehlicher Motor. Während sich die frühen Puritaner noch als nachahmenswertes Modell religiöser Haltung verstanden, projizierte sich dies rasch auf die politisch-territoriale Inbesitznahme fremden Staatsgebiets. Selbst der durch und durch sich demokratisch verstehende Whitman schob das Gebiet der Staaten bald bis an den Atlantik und weit in den Norden vor, und er träumte bereits von einer Grenze im Süden, die weite Teile Mexikos, Zentralamerika, Cuba und die Caribbean umfaßte. So wie mythisch-visionär gesehen die Wissenschaften als translatio studii zusammen mit der staatlichen Macht und der translatio libertatis historisch von Osten nach Westen wanderten, verstanden sich auch die frühen Kolonisten - hier zeigt sich einmal mehr der defensiv-kompensatorische Reflex - gerne als Erben der hebräischgraeco-römischen Kultur und als die von der Vorsehung erwählten Nachfolger vergangener Weltreiche, das Britische mit eingeschlossen. Die Monroedoktrin von 1823 bewies das gestiegene Selbstvertrauen der jungen Nation, ein Selbstvertrauen, das seither - und zurecht - mit den beiden Weltkriegen noch eine unerhörte Steigerung erfuhr und die USA nach dem Kollaps der Sowjetunion zur unbestrittenen militärischen und wirtschaftlichen Weltmacht Nummer Eins werden ließ. Die entscheidende Zielrichtung hin zum globalen Empire wurde allerdings schon im (vorerwähnten) Jahr 1898 festgelegt, das als Scharnierjahr gelten darf, wie uns Thomas Schoonover in Uncle Sam‘s War of 1898 and the Origins of Globalization magistral vorführt. In diesen Zusammenhang gehört auch die konservativ getönte Präsidentschaft Theodore Roosevelts, der mit der Hochstilisierung männlicher Tugenden die schon länger praktizierte big-stick policy in Amerikas Außenpolitik salonfähig machte. 4 Die Privatisierung der Gewalt, wie kürzlich Spillmann in der NZZ beklagt hat, ist somit nichts Neues, sondern findet seine Wurzeln in der Idee eines manifest destiny, eines providentiellen Auftrags zum amerikanischen Empire, dessen Grenzen sich mit der Erstarkung der jungen Nation laufend verschoben, wobei von Anfang an das internationale Recht von den Vereinigten Staaten unbeachtet blieb. Kein Wunder, daß die Idee des Völkerbundes (von Präsident Woodrow Wilson persönlich portiert) in Amerika selbst skeptisch aufgenommen wurde und die Nation dem Völkerbund nie beitrat; in ähnlicher Weise werden zur Zeit auch die Beschlüsse der UNO und des internationalen Gerichtshofs von den USA ganz einfach ignoriert. Man erinnert sich an die kürzliche Warnung Phyllis Schlaflys (einer führenden Figur der religiösen Rechten), die 1998 Clintons diesbezügliche Absichten scharf kritisierte: international treaties are a direct threat to us. Hier zeigt sich das Doppelgesicht der Vereinigten Staaten besonders eklatant. Dem Prinzip der Demokratie und der Freiheit soll weltweit zum Durchbruch verholfen und damit eine gerechte Weltordnung eingerichtet werden, dies jedoch nur unter dem imperialen Diktat Amerikas, dem sich die andern Staaten zu unterwerfen haben - ein klassisches Beispiel von Orwellschem double-speak. Anatol Lieven führt diese Haltung wesentlich auf die anti-modernistische und populistisch-rassistische Ideologie der Jacksonian Democracy zurück, die einen ausländerfeindlichen und brachial nationalistischen Kurs steuerte. In einem aufschlußreichen Vortrag an der Universität Göttingen hat kürzlich der frühere Sicherheitsberater Clintons, Charles Kupchan, in aller Offenheit erklärt, was das Ziel der Vereinigten Staaten sei: Power, möglichst unbegrenzte Macht. Dahinter erscheint leicht erkennbar der alte koloniale Traum eines amerikanischen (poströmischen) Imperiums, wobei noch offen bleibt, ob dies heute ausschließlich zu egoistischen nationalen Zwecken angestrebt wird oder aber zur Errichtung einer genuinen Pax Americana, einer friedlichen Weltordnung, führen soll. Bisher ist letzteres eher ein rhetorisch geschickt inszeniertes Alibi geblieben. An dieser Stelle ist es nützlich, die Meinung der Kunstschaffenden in USA selbst zu befragen. Die vehementen Kritiken an Nixon und Bush durch Gore Vidal u.a. sind bekannt. Weniger bekannt sind die Reaktionen früherer Schriftsteller auf die Idee einer imperial republic, wie sie neuerdings von Jeffrey W. Westover vorgestellt wurden. Am Beispiel von Robinson Jeffers‘ Shine, Perishing Republic und von Robert Frosts Our Doom to Bloom zeigt sich die gespaltene Identität der Nation in aller Schärfe. Der Angriff Jeffers wird von Frost ironisch pariert. Die innere Spannung zwischen Republik und Empire, so erweist es sich, muß immer aufs neue ausgetragen werden, wobei in Frosts Text unklar bleibt, ob dies zu einer abrupten Katastrophe oder einer Verwandlung der Nation zu neuem Wachstum und zu neuer Blüte führen wird. Es wäre interessant, die entsprechenden Reaktionen auch in der Popkultur genauer zu untersuchen. Der demokratische Gedanke und die Ambition auf ein Imperium in Nachfolge des römischen und britischen Weltreichs verharren jedenfalls in einem bis heute nicht gelösten Spannungsverhältnis, das immer wieder 5 zu neuen kulturellen und politischen Lösungsversuchen herausfordert. Der Zusammenhang zwischen Minderwertigkeitsgefühl, einem kompensatorischen rassisch-kulturellen Überheblichkeitsdenken, einem ganz und gar unpuritanischen Mangel an Selbsterforschung, oberflächlischer moralischer Selbstgerechtigkeit und militärischem Hegemoniestreben ist historisch wie psychologisch gesehen komplex. Etwas von dieser Komplexität ist in Quentin Andersons Konzept des imperial self eingefangen. Emerson, Whitman, James (hinzuzufügen wären u.a. Thomas Wolfe und Saul Bellow), sie alle wollen auf je eigene Weise die Totalität der Welt erfahren, um sie für sich imaginativ oder realiter nach Hause zu tragen; das Gettymuseum mag dafür als visuelle Ikone dienen. Bezieht man noch Kritiker wie Leslie A. Fiedler oder Richard Slotkin (Regeneration through Violence) mit ein, wird deutlich, wie schwer es dem US-Amerikaner fällt, das Andere - kulturell und gendermäßig - ohne Violenz zu akzeptieren und zu integrieren. Fremdes wird meist gewaltsam vereinnahmt, das eigene politische System - als unbesehen bestes - andern aufoktruiert, ohne die kulturellen Verschiedenheiten zu berücksichtigen. Während an den Universitäten Multikulturalität zur sozialen Revolution emporstilisiert wurde, blieb Interkulturalität ein Stiefkind nicht nur der Akademia, sondern auch der Politik. Der imperiale Anspruch auf eine Vorreiterrolle macht es den Vereinigten Staaten trotz Emerson, Thoreau und vielen anderen - praktisch unmöglich, den notwendigen Perspektivenwechsel zu vollziehen und andere Nationen und Kulturen in ihrer Eigenart zu erkennen und zu verstehen, geschweige denn zu schätzen und sich von ihnen bereichern zu lassen. An dieser US-zentrischen Haltung haben auch die hochstehenden Thinktanks und die (oft als un-American verurteilten) Künstler und Akademiker nichts zu ändern vermocht. Deshalb erscheint den Amerikanern jede fremde Kultur zunächst einmal als (potentieller) Feind. Auf diese Weise ist jedoch keine zukunftssichernde Politik zu erreichen. Die zweite ungelöste Spannung ist die zwischen antik inspiriertem und europäisch vermitteltem Aufklärungsdenken sowie dem protestantisch-kalvinistischen Beharren auf dem biblischen Wort als Kerygma, als bindende Verkündigung. Nirgendwo auf der Welt ist diese Spannung zwischen Athen und Jerusalem so deutlich wie in den USA. Der religiöse Aspekt, erstmals von Tocqueville als konstitutives Element der amerikanischen Demokratie herausgestellt, scheint im Augenblick zu dominieren, jedenfalls wird er von Bush Jr. in mitunter fast obsessiver Weise für die persönlichen und nationalen politischen Interessen instrumentalisiert. Ob und wann der Aufklärungsgedanke wieder zu seiner historisch rechtmäßigen Rolle zurückfinden wird, läßt sich heute noch nicht sagen, doch ist der Streit zwischen den beiden ein ebenso fortdauernder wie jener zwischen Demokratie und imperialem Ehrgeiz. Zu berücksichtigen ist hier die Tatsache, daß aufklärerisches Denken auf dem neuen Kontinent zum erstenmal in der politischen Praxis konkret realisiert wurde, wie dies 6 Ralf Dahrendorf in seiner Schrift Die angewandte Aufklärung dargestellt hat. Was Dahrendorf nicht untersucht, ist die Frage, in welcher Form die USA als Nation eine Phase der Aufklärung erlebt haben. Die Frage scheint überflüssig, ja absurd angesichts der Tatsache, daß die Ideologie der Revolution durchtränkt war vom politischen und literarischen Gedankenreichtum der römischen Republik als Modell. Aufklärerische Elemente waren bekanntlich grundlegend für die Declaration of Independence und sie wurden auch im politischen Kampf um die Unabhängigkeit vielfach heran gezogen, obgleich mit stark instrumentellem Charakter, wie Frank Kelleter in Amerikanische Aufklärung für die Periode der Revolution belegt. Festzustellen bleibt, daß im sogenannten Zeitalter des Federalism die politische Diskussion ein aufgeklärtes Niveau besaß, das in der Welt wohl einzigartig ist; auch alle höheren Bildungsinstitutionen, allen voran die Universität Princeton (unter ihrem schottischen Präsidenten Witherspoon), waren von aufgeklärtem Gedankengut motiviert. Eine Aufklärung im europäischen Sinn hat in den USA jedoch nur begrenzt stattgefunden, dafür war - speziell im orthodox-illiberalen Süden - das literalistischreligiöse Element (und der hieraus entspringende allgemeine Atheismusverdacht) zu stark, wenngleich Reformbewegungen aufklärerisches Gedankengut wiederholt zu integrieren versuchten. Dem steht auch die Tatsache vieler aufgeklärter Gründerfiguren wie Madison, Jefferson, Hamilton, Rush, Washington und Franklin nicht entgegen, zumal diese ihrerseits von einer durchaus religiösen Grundstimmung und zahlreichen betont religiösen Familien der Gründergeneration konterkariert waren und aufklärerische Ideen bald in den providentiellen historischen Auftrag des Manifest Destiny-Gedankens eingingen. Insgesamt wurde die Revolution, wie Bernard Baylin in Faces of the Revolution gezeigt hat, stark durch religiöse Impulse genährt. Aus diesem Grund wäre ein Dialog zwischen dem aufklärerischen und religiösen Gedankengut als den zwei Grunddominanten der historischen Entwicklung erst noch zu führen. Hierzu hat John C. Shields in The American Aeneas: Classical Origins of the American Self - als Gegenstück zu Sacvan Bercovitchs The Puritan Origins of the American Self gedacht - eine viel versprechende Möglichkeit eröffnet. Wenn die USA - wie der Historiker Pierre Wenger in seiner Schrift "Ist Amerika im Begriff, sein größtes Werk selber zu zerstören?" (Ms. Juli 2002) erläutert hat gegenwärtig ihre eigenen demokratisch fundierten nationalen und internationalen politischen Errungenschaften wie die Haager Landkriegsordnung von 1907, Rechte der Kriegsgefangenen (besonders schockierend deshalb die Behandlung der Gefangenen in Guantanamo), Schutz der Zivilbevölkerung; Völkerbund von 1919; Die Vereinigten Nationen von 1945 und zuletzt auch noch das Den Haager Kriegsverbrechertribunal, wenn also die USA all dies dem schieren nationalen Machtstreben und dem Ziel eines hegemonialen amerikanischen Imperiums opfern, werden sie damit ihren historisch verbürgten demokratischen Grundprinzipien untreu und laufen in ihrer Selbstüberschätzung Gefahr, das geschichtliche Schicksal Assyriens zu teilen. Keine Nation der Welt ist nämlich stark genug, die übrigen 7 Mächte dauerhaft zu kontrollieren, ohne sich in einem endlosen Überwachungs- und Vielfrontenkrieg zu erschöpfen, wie der paranoisch gehetzte Protagonist in Kafkas Erzählung Der Bau exemplarisch zeigt. Arnold Toynbee kommt zm Schluß: Great empires do not die by murder, but suicide - sie fallen nicht äußeren Feinden zum Opfer, sondern zerstören (zuerst) sich selbst. Die wohl größte Gefahr zur Zeit liegt in der Neuauflage des historisch alten Dilemmas der USA zwischen den Polen Sicherheit und Freiheit bzw. Demokratie und Freiheit. Mit der exklusiven Betonung der Sicherheit gehen nicht nur die demokratischen Grundfreiheiten verloren, sondern auch die Dimension des Ethischen. Dieser Problematik soll ein eigener Aufsatz gewidmet werden. Eine Großmacht wie die Vereinigten Staaten aus europäischer Sicht kritisieren zu wollen, also aus der Außenperspektive, bleibt natürlich immer fragwürdig. Das Handeln und Denken der USA jedoch an ihrem eigenen Anspruch und ihren eigenen historischen Idealen zu messen, mit dem sie in der Geschichte angetreten sind, und diese dann als zu leicht zu befinden, das ist eine sachlich begründete - immanente Kritik, der sich die Vereinigten Staaten zuletzt selbst stellen müssen, wenn sie ihre Glaubwürdigkeit als torchbearer of democracy and liberty für eine bessere Zukunft und als Verteidiger der Menschenrechte für eine gerechtere Gesellschaft nicht aufs Spiel setzen wollen. Wollte man noch die Abschiedsrede des ersten Präsidenten George Washington - des Vaters der Nation - mit der gegenwärtigen Politik der USA in Bezug setzen, fällt das Urteil über das heutige Verhalten der USA in fast allen von Washington und später auch von Jefferson angesprochenen Belangen freundschaftlicher Verkehr mit allen, Handel statt kriegerische Expansion, Unabhängigkeit und keine einseitigen Bindungen an andere Nationen - höchst beunruhigend aus. War es vormals ein Anspruch der Neuen Welt, der zynischen europäischen Politik eine superior morality entgegen zu setzen, so läßt sich jetzt nicht ohne Ironie, aber doch mit einer gewissen Enttäuschung, ja Trauer beobachten, wie die USA den anfangs von ihnen heftig bekämpften „korrupten Imperialismus“ der Europäer kopieren und weiterführen - Stoff für eine griechische Tragödie. Natürlich muß der Handelnde in einem bestimmten Sinn gewissenlos sein (Goethe), denn ein zu hohes Maß an Selbstreflexion verhindert gerade die Fähigkeit zur Tat (Hamlets Tragik). Aus der Sicht der USA ist dies genau die Schwäche Europas, wie Condoleezza Rice kürzlich nach den Wahlen zur europäischen Verfassung kritisiert hat, während Jeremy Rifkin gerade umgekehrt argumentiert und den „sozialen europäischen Traum“ im Gegensatz zum „kapitalistischen amerikanischen Traum“ den USA als menschlich und soziopolitisch überlegenes Vorbild vor Augen hält. Hier zeigt sich das letzte und wohl irritierendste Vexierbild: Beide - Europa und USA - vermissen bzw. schätzen an einander stets das, was jeder bei sich selbst als den höchsten Wert erachtet und am andern vermißt, nämlich politisches Handeln einerseits (USA) und Reflexion anderseits (Europa). Im Moment scheint es jedenfalls, als ob die USA ihre Ideologie des Friedens 8 (Spillmann) ad acta gelegt hätten. Statt dessen verfolgen sie eine Politik der „kleinen Kriege“, weil große als zu riskant empfunden werden, wie aus einem internen Dokument hervorgeht, an dessen Niederschrift politische Koryphäen wie Huntington und Kissinger mitgewirkt haben. Damit rückt T.S. Eliots Endzeitvision bedenklich näher: This is the way the world ends / This is the way the world ends / Not with a bang but a whimper. Zitierte/Benutzte Literatur Ralf Dahrendorf, Die angewandte Aufklärung (1968). Jackson T. Lears, No Place of Grace: Antimodernism and the Transformation of American Culture (1981). Kurt Spillmann, Amerikas Ideologie des Friedens (1984). Seymour Martin Lipset, American Exceptionalism. A Double-Edged Sword (1986). David S. Shields, Oracles of Empire (1990). Jeffrey H. Richards, Theater Enough. American Culture and the Metaphor of the World Stage (1991). John C. Shields, The American Aeneas. Classical Origins of the American Self (2001). Frank Kelleter, Amerikanische Aufklärung (2002). Roland Hagenbüchle, “US-Amerika – eine religiöse oder säkulare Nation?” Schweizer Monatshefte 3 (März 2003). Thomas D. Schoonover, Uncle Sam‘s War of 1898 and the Origins of Globalization (2003). Jacques Derrida, Schurken (2003), Originaltitel: Voyous. Deux essais sur la raison. Jacques Derrida, Schurken (Suhrkamp, 2003). Original title: Voyous. Deux essais sur la raison (Paris: Galilée, 2003). Jeffrey W. Westover, The Colonial Moment (2004). Anatol Lieven, America Right or Wrong. An Anatomy of American Nationalism (2004). 9