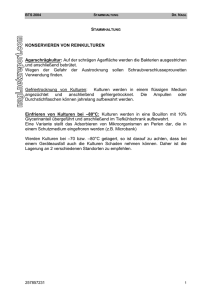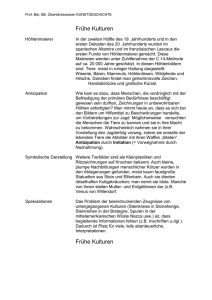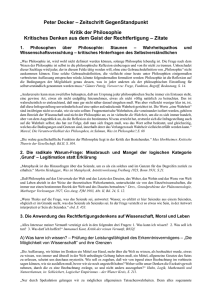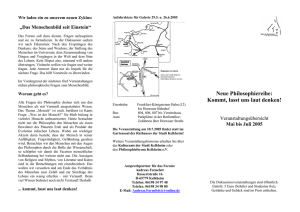Kampf der Kulturbegriffe Kritik der Globalisierung
Werbung

WIDER SPRUCH Kampf der Kulturbegriffe Kritik der Globalisierung MÜNCHNER ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE Heft 40 Manuel Knoll Die Grenzen des Westens: Eine Kritik an Huntingtons Kozeption von kultureller Identität Alexander von Pechmann Zur neuen Dimension der Globalisierungskritik Wolfgang Melchior Die alte Weltordnung: die Neugestaltung der Welt nach Kulturen Mohamed Turki Arabische Vernunft versus westliche Vernunft? Charme I. Sucharewicz Die israelische Entwicklung – multikulturelle Gesellschaft und übergeordnete Kultur 6.- EUR Kim Lan Thai Thi „Warum ging Bodhidharma gen Osten?“ Ein Koan zur Lehrbiographie Widerspruch Kampf der Kulturbegriffe Kritik der Globalisierung Dem Kritiker passt die Kultur nicht, der er sein Unbehagen verdankt. Theodor W. Adorno Zum Thema Kampf der Kulturbegriffe Kritik der Globalisierung Artikel Manuel Knoll Die Grenzen des Westens. Eine Kritik an Samuel P. Huntingtons Konzeption von kultureller Identität 11 Alexander von Pechmann Zur neuen Dimension der Globalisierungskritik 26 Wolfgang Melchior Die alte Weltordnung: die Neugestaltung der Welt nach Kulturen 41 Mohamed Turki Arabische Vernunft versus westliche Vernunft? Zur Rationalitätsdebatte in der arabisch-islamischen Welt 61 Charme I. Sucharewicz Die israelische Entwicklung – multikulturelle Gesellschaft und übergeordnete Kultur 77 Elmar Altvater / Birgit Mahnkopf: Globalisierung der Unsicherheit Percy Turtur 85 Dan Diner: Feindbild Amerika Georg Koch 86 Terry Eagleton: Was ist Kultur? Konrad Lotter 89 Heinz Kimmerle: interkulturelle Philosophie Alexander von Pechmann 91 Robert Kurz (Hg): Marx lesen Bernd M. Malunat 93 Bücher zum Thema 7 Werner Seppmann: Das Ende der Gesellschaftskritik? Reinhard Jellen 96 Charles Taylor: Die Formen des Religiösen Wolfgang Melchior Slavoj Zizek: Die Tücke des Subjekts Wolfgang Habermeyer 98 101 Münchner Philosophie Neuerscheinungen Anhang Kim Lan Thai Thi „Warum ging Bodhidharma gen Osten?“ Ein Koan zur Lehrbiographie 105 Hannelore Bublitz: Judith Butler Jadwiga Adamiak 113 Manfred Frank: Selbstgefühl Thomas Wimmer 114 Otfried Höffe (Hg): Aristoteles. Politik Manuel Knoll 116 Otfried Höffe: Gerechtigkeit Reinhard Jellen 118 Gerd Irrlitz: Kant-Handbuch. Leben und Werk Micha Homolka 121 Ulrike Kleemeier: Grundfragen einer philosophischen Theorie des Krieges Wolfgang Teune 122 Manuel Knoll: Theodor W. Adorno – Ethik als erste Philosophie Roger Behrens 125 Martha C. Nussbaum: Konstruktion der Liebe, des Begehrens und der Fürsorge Fritjof Bönold / Norbert Walz 127 Richard Rorty: Wahrheit und Fortschritt Christian Schwaabe 130 Michael Ruoff: Schnee von Morgen – das Neue in der Technik Hans-Martin Schönherr-Mann 132 Peter Trawny: Die Zeit der Dreieinigkeit Alexander von Pechmann 134 Christoph Türcke: Erregte Gesellschaft Jonas Dörge 137 Rainer E. Zimmermann: Subjekt und Existenz Roger Behrens 140 AutorInnen Impressum 142 143 Zum Thema Kampf der Kulturbegriffe Kritik der Globalisierung Der Traum von der Einen Welt ist wieder verflogen. So manchem erschien es nach dem Kalten Krieg als reale Möglichkeit, dass durch die Öffnung der Märkte, die mediale Vernetzung der Kontinente und durch den Wandel zur „Weltinnenpolitik“ die Welt zum „globalen Dorf“ werde, in dem die Völker und Kulturen sich begegnen und in ihrer Vielfalt zur Einheit zusammenwachsen. Dieser Traum ist in weite Ferne gerückt. Spätestens seit dem 11. September rüstet die USA nicht nur militärisch im Namen des „war against terrorism“ auf, wächst in der islamischen Welt nicht zuletzt dadurch der Hass gegen „den Westen“, und spielt der Ferne Osten mit seinen atomaren Muskeln. Europa sieht sich mittendrin und zwischen Friedensliebe und Kriegsbereitschaft hin- und hergerissen.. Wie aber ist diese neue Lage zu beschreiben? Stehen erneut „Arme gegen Reiche“, die Globalisierungsverlierer gegen die -gewinner; resultiert sie aus den Anpassungsproblemen traditionaler Gesellschaften an die moderne globale Welt; oder ist sie doch der viel zitierte „Kampf der Kulturen“? Welcher theoretische Rahmen und welche Begrifflichkeit sind geeignet, um die unerhoffte neue „Welt-Unordnung“ zu beschreiben? Hatte die letzte Nummer Beiträge versammelt, die aus außereuropäischen Perspektiven den kritischen Blick auf die Globalisierungsprozesse geworfen haben, so befasst sich diese Nummer nicht mit der Globalisierung selbst, sondern streitet um die Begriffe, die sie begreifen wollen. Ins Zentrum ist dabei der Begriff der „Kultur“ gerückt, nicht nur, weil von S. Huntington der „Kampf der Kulturen“ ausgerufen worden ist, sondern weil es prima vista in der Tat so erscheint, als stünden in den gegenwärtigen Konflikten sich Kulturen einander gegenüber. Was aber meint dieser Begriff? In seinem Beitrag Die Grenzen des Westens hinterfragt Manuel Knoll die antagonistische Konzeption von kultureller Identität, die Samuel P. Huntington in seinem Buch Der Kampf der Kulturen vertritt. Nach einer Einführung in 8 Zum Thema Huntingtons Konzeption thematisiert er zuerst die inneren Grenzen der westlichen Kultur und bemüht sich dann darum, eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie sich die konfliktreichen Grenzen zwischen westlichem und islamischem Kulturkreis überwinden lassen. Alexander von Pechmann unterscheidet in seinem Artikel über Die neue Dimension der Globalisierungskritik zunächst die immanente von der externen Kritik, die sich in den nicht-westlichen Kulturen formiert hat. Er unternimmt dann den Versuch, einen Begriff der Kultur zu formulieren, der die Konfliktlage zwischen den Kulturen verstehbar machen kann. In seinem Artikel Die Alte Weltordnung: die Neugestaltung der Welt nach Kulturen setzt sich Wolfgang Melchior ideologiekritisch mit denjenigen Theorien auseinander, die vom ‚Kampf der Kulturen’ reden. Seine Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass es sich bei ihnen weniger um empirische als um präskriptive Theorien handelt, die die eigentlich ökonomischen Konflikte zu verschleiern versuchen. Kampf der Kulturbegriffe 9 Mohamed Turki gibt in seinem Artikel Arabische Vernunft versus westliche Vernunft? anhand von zwei Protagonisten der Diskussion, M.A. Al Gabiri und M. Arkoun, einen Einblick in die derzeitige Debatte in der arabischislamischen Welt um ein gegenwartsadäquates Rationalitätsmodell. In ihrem Beitrag über Die israelische Entwicklung geht Charme I. Sucharewicz schließlich der Frage nach, ob und inwiefern in Israel heute unter den Bedingungen einer multiethnischen, aber auch multinationalen Gesellschaft von einer einheitlichen „israelischen Kultur“ gesprochen werden kann. In unserer Reihe „Münchner Philosophie“ stellt die vietnamesische Philosophin Kim Lan Thai Thi ihre intellektuelle Entwicklung dar. Ihr Beitrag Warum ging Bodhidharma gen Osten? beschreibt zuerst den Weg, der sie von der geistig-kulturellen Tradition ihrer Heimat weg zur europäischabendländischen Philosophie geführt hat, um in der kritischen Auseinandersetzung mit ihr dann den Wert und die Bedeutung der buddhistischen Denk- und Lebensweise (wieder)zuentdecken. Anzeige 10 Zum Thema Neben einem umfangreichen Rezensionsteil, der Bücher zum Thema vorstellt und bespricht, beschließen Rezensionen aktueller Neuerscheinungen das Heft. Last not least haben wir eine Berichtigung anzuzeigen. Frau Shalini Randeria hat uns um den Abdruck der folgenden Erklärung gebeten: „Der Beitrag von Shalini Randeria: ‚Die Transnationalisierung des Rechts und der Rechtspluralismus im Süden’ in Heft Nr. 39 wurde in der vorliegenden Fassung ohne Genehmigung der Autorin abgedruckt und enthält sachliche Fehler aufgrund der nicht autorisierten Übersetzung. Die ungekürzte englische Originalfassung des Textes erscheint unter dem Titel: ‚Domesticating neo-liberal discipline: Transnationalisation of law, fractured states, and legal pluralism in the South’, in: Wolf Lepenies (Hg), Shared Histories and Negotiated Universals, Campus-Verlag, Frankfurt/Main 2003.“ Wir bedauern dieses Vorkommnis. Die Redaktion Manuel Knoll Die Grenzen des Westens. Eine Kritik an Samuel P. Huntingtons Konzeption von kultureller Identität Zweifellos hat der 11. September 2001 Samuel P. Huntingtons Theorie vom Kampf der Kulturen zu neuer Aktualität verholfen. Der Theorie des US-Politikwissenschaftlers nach könnten die Terroranschläge als Folge des Konflikts zwischen der islamischen und der westlichen Kultur verstanden werden. Huntington verneint jedoch in einem Interview die Frage, ob mit den Terroranschlägen der vorausgesagte Kampf der Kulturen tatsächlich beginnt: „Nein, die islamische Welt ist gespalten. Ob der echte Zusammenprall verhindert wird – das hängt davon ab, ob islamische Staaten mit den USA bei der Bekämpfung dieses Terrors zusammenarbeiten werden“.1 Interpretiert man die Terroranschläge und die anschließenden Kriege in Afghanistan und im Irak als Folge des Konflikts zwischen der islamischen und der westlichen Kultur, würde dies bedeuten, daß sich die von Huntington unterstellten „blutigen Grenzen des Islam“ territorial zunehmend weiter entgrenzen (415 ff.).2 So verliefe die Front zwischen den beiden Kulturen mittlerweile nicht nur durch den arabischen Raum, sondern auch mitten durch die USA und in Zukunft vielleicht durch den ganzen Westen und die halbe Welt. Dazu könnte insbesondere eine von westlichen Staaten unterstützte US-Invasion Syriens oder des Irans führen, die das Auseinanderbrechen der Anti-Terror-Koalition von westlichen und islamischen Staaten bewirken und eine Vielzahl weiterer Terroranschläge nach sich ziehen könnte. Auch wenn das Szenario eines großen Krieges zwischen dem westlichen und dem islamischen Kulturkreis übertrieben anmutet, ist es vor dem Hintergrund einer möglichen weiteren Entgrenzung des Konflikts dieser Kulturkreise geboten, die von Huntington vertretene antagonistische Konzep1 2 Interview: „Nein, kein Kampf der Kulturen“, in: Die Zeit, 66/2001. Die im Text in Klammern angegebenen Seitenangaben beziehen sich auf folgende Ausgabe: Samuel P. Huntington: Der Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, München/Wien 1997. 12 Manuel Knoll tion von kultureller Identität zu hinterfragen. Diese soll anhand der kulturellen Identität des Westens, den Huntington als weitgehend einheitlichen bzw. monolithischen Block begreift, kritisch überprüft werden. Im Zentrum stehen dabei die Fragen nach der Abgrenzung der kulturellen Identität der USA von der Europas und danach, wie sich die konfliktreichen Grenzen des Westens zum islamischen Kulturkreis überwinden lassen. 1. Huntingtons Konzeption von kultureller Identität Als zentrales Thema und Hauptaussage seines Buches benennt Huntington: „Kultur und die Identität von Kulturen, auf höchster Ebene also die Identität von Kulturkreisen, prägen heute, in der Welt nach dem kalten Krieg, die Muster von Kohärenz, Desintegration und Konflikt“ (19). Die zeitgenössischen Kulturen sind für ihn der chinesische, der japanische, der hinduistische, der islamische, der westliche, der lateinamerikanische und der afrikanische Kulturkreis. Huntingtons Theorie richtet sich vor allem gegen die – als falsch bezeichnete – „verbreitete Annahme des Westens, daß kulturelle Verschiedenheit eine historische Kuriosität ist, welcher durch das Heranwachsen einer gemeinsamen, westlich orientierten, anglophonen Weltkultur, die unsere Grundwerte prägt, bald der Boden entzogen sein wird“ (511). Mit der hier ausgesprochenen Zurückweisung des westlichen Universalismus geht Huntingtons entschiedene Ablehnung der multikulturalistischen Strömungen in den USA einher, die „Amerika der Welt gleichmachen“ wollen (525). In einer unaufhebbar multipolaren und multikulturellen Welt bleiben die Nationalstaaten die „Hauptakteure des Weltgeschehens“, die sich allerdings nach dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr nach Blöcken, sondern nach Kulturkreisen gruppieren (21). Huntington geht davon aus, daß jeder Mensch eine Vielzahl von Identitäten besitzt. Er erwähnt die „identitätsstiftende Dimension der Verwandtschaft, des Berufs, der Kultur, der Institutionen, des Territoriums, der Bildung, der Parteizugehörigkeit, der Ideologie usw.“ (198). Die verschiedenen Identifikationen eines Menschen können ohne Beziehung sein, konkurrieren oder einander verstärken. Die kulturelle Identität des Menschen definiert „sich sowohl durch gemeinsame objektive Elemente wie Sprache, Geschichte, Religion, Sitten, Institutionen als auch durch die subjektive Identifikation der Menschen mit ihr“ (54). Unter diesen Elementen hebt Huntington an erster Stelle die Religion und an zweiter die Sprache als die Die Grenzen des Westens 13 Hauptunterscheidungsmerkmale von Kulturen hervor (81, 413). Zudem unterscheidet er verschiedene Ebenen der Identität, die sich nach Allgemeinheitsgraden abstufen: „Ein Einwohner Roms kann sich mit unterschiedlichem Nachdruck als Römer, Italiener, Katholik, Christ, Europäer, Westler definieren. Die Kultur, zu der er gehört, ist die allgemeinste Ebene der Identifikation, mit der er sich nachdrücklich identifiziert“ (54). Identität läßt sich für Huntington auf allen Ebenen immer nur in Bezug auf ein „Anderes“ definieren. Zwischen Kulturkreisen gibt es eine unaufhebbare Abgrenzung von einem „Wir“ und einem „Sie“ da draußen. Huntingtons zutreffende Einsicht ist bereits in dem alten Satz „omnis determinatio est negatio“ ausgedrückt. Die unumgänglichen Abgrenzungen bei der Bestimmung von kultureller Identität gehen für Huntington zwangsläufig mit Gegnerschaft und allgegenwärtigen Konflikten einher: „Hassen ist menschlich. Die Menschen brauchen Feinde zu ihrer Selbstdefinition und Motivation: Konkurrenten in der Wirtschaft, Gegner in der Politik. Von Natur aus mißtrauen sie und fühlen sich bedroht von jenen, die anders sind und die Fähigkeit haben, ihnen zu schaden.“3 Für Huntington lautet eine alte Wahrheit: „Ohne wahre Feinde keine wahren Freunde! Wenn wir nicht hassen, was wir nicht sind, können wir nicht lieben, was wir sind“ (18). Derartige Aussagen lassen an Carl Schmitt denken, für den das Kriterium des Politischen „die Unterscheidung von Freund und Feind“ ist.4 Huntington beruft sich allerdings nicht explizit auf ihn. An anderer Stelle äußert er: „Wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wer wir nicht sind und gegen wen wir sind“ (21). Huntingtons Behauptung, daß die für kulturelle Identität notwendige Abgrenzung eines „Wir“ von einem „Sie“ auch zwangsläufig mit einem „Wir“ gegen „Sie“ verknüpft ist, ist für sein Buch und für seine Konzeption eines Kampfes der Kulturen zentral. Sie ist aber höchst problematisch, da sie das interkulturelle Verhältnis ausschließlich als Gegnerschaft begreift. Analog dazu sieht Huntington auch das Verhältnis zwischen den Religionen, die kulturelle Identitäten entscheidend bestimmen, von einer Dialektik von Aufwertung und Abwertung geprägt: „Alle Religionen, was immer ihre universalistischen Ziele sein mögen, postulieren eine grundlegende Unterscheidung zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen 3 4 Ebenda, S. 202, 200, 54. Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, in: Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, Bd. 58 (1927), S. 1-33. 14 Manuel Knoll einer überlegenen In-Gruppe und einer anderen, minderwertigen OutGruppe“ (147). Daß die von Huntington als unauflöslich behauptete Verknüpfung von kulturellen Identitäten mit Antagonismen in Gegenwart und Geschichte häufig anzutreffen ist, soll hier nicht bestritten werden. So verdankt sich die Selbstschätzung der Griechen seit den Perserkriegen zunehmend auch ihrer verachtenden Abgrenzung von den Barbaren. Der Vergleich mit der Despotie und Roheit der „Anderen“ ermöglichte es den Griechen, ihre eigene Freiheit und Bildung zu erkennen und zu schätzen. Im Hinblick auf das geschichtlich wechselhafte Verhältnis des Westens zu anderen Kulturen betont Huntington: „Vor dem 19. Jahrhundert empfanden sich, jeweils in ihrer Zeit, Byzantiner, Araber, Chinesen, Osmanen, Moguln und Russen hinsichtlich ihrer Stärke und ihrer Errungenschaften als dem Westen überlegen. In diesen Zeiten sahen sie auch auf die kulturelle Minderwertigkeit, institutionelle Rückständigkeit, Korruption und Dekadenz des Westens verächtlich herab. In dem Maße, wie der relative Erfolg des Westens schwindet, kehren solche Haltungen wieder“ (142). Belegen diese geschichtlichen Befunde, daß Selbstachtung und Selbstbejahung von Kulturen notwendig die Verachtung und Verneinung von anderen Kulturkreisen voraussetzen, die damit zwangsläufig zu Gegnern werden? Sind also – gemäß Sartres berühmtem Diktum – nicht nur die anderen Individuen, sondern auch die anderen Kulturen die Hölle? Setzen die Terroranschläge vom 11. September nicht auch die Verachtung und Verneinung der westlichen Kultur voraus, die im islamischen Kulturkreis häufig als dekadent, materialistisch, gottlos, unmoralisch, arrogant und korrupt wahrgenommen wird (342 f.)? Huntingtons antagonistische Konzeption von kultureller Identität läßt sich durch Rousseaus kulturkritische und psychologische Theorien philosophisch abstützen. Treffen diese zu, dann gibt es wenig Hoffnungen, der teuflischen Dialektik von Selbstschätzung und Verachtung zu entkommen. Denn der vergesellschaftete Mensch ist für Rousseau unentrinnbar Opfer seiner Eigenliebe (amour-propre). Rousseaus Gedanken zur Eigenliebe beziehen sich ausschließlich auf die intersubjektive Ebene. Sie lassen sich aber ohne Schwierigkeiten auf die interkulturelle Ebene übertragen. So äußert Rousseau: „Die Eigenliebe ist nur ein relatives, künstliches und in der Gesellschaft entstandenes Gefühl, das jedes Individuum dazu veranlaßt, sich selbst höher zu schätzen als jeden anderen, das den Menschen all die Übel Die Grenzen des Westens 15 eingibt, die sie sich wechselseitig antun, und das die wahrhafte Quelle der Ehre ist.“5 Der Ursprung dieses Gefühls ist für Rousseau der Vergleich mit „Anderen“, der zwischen Kulturen in einer globalisierten Welt noch häufiger und bedeutender wird als in früheren Epochen. Sobald „man die Gewohnheit annimmt, sich mit andern zu messen und sich außerhalb seiner selbst zu versetzen, um sich den ersten und den besten Platz zuzuweisen“, wird es für Rousseau unmöglich, „nicht eine Abneigung gegen alles das zu fassen, was uns übertrifft, alles was uns erniedrigt, alles, was uns einengt, gegen alles das, was dadurch, daß es etwas ist, uns daran hindert, alles zu sein“.6 Auch Max Webers Auffassung vom Polytheismus und Kampf der Werte kann zur Unterstützung von Huntingtons antagonistischer Konzeption von kultureller Identität herangezogen werden. Dabei ist zu bemerken, daß sich Huntington weder auf Rousseau noch auf Max Weber ausdrücklich beruft. Zudem thematisiert Weber den Kampf der Werte zumeist auf prinzipiellphilosophischer und nur selten auf interkultureller Ebene, auf die er sich aber durchaus übertragen läßt. Für Weber handelt es sich „zwischen den Werten letztlich überall und immer wieder nicht nur um Alternativen, sondern um unüberbrückbar tödlichen Kampf, so wie zwischen ,Gott’ und ,Teufel’“.7 Webers Überzeugung ist, daß „die verschiedenen Wertordnungen der Welt in unlöslichem Kampf untereinander stehen“.8 Zudem betont er, daß die „Weltanschauungen“ und „höchsten Ideale, die uns am mächtigsten bewegen, für alle Zeit nur im Kampf mit anderen Idealen sich auswirken, die anderen ebenso heilig sind, wie uns die unseren“.9 2. Die Abgrenzung der kulturellen Identität der USA von der Europas Huntingtons antagonistische Konzeption von kultureller Identität kann anhand der kulturellen Identität des Westens kritisch überprüft werden. Der 5 6 7 Jean-Jacques Rousseau: Diskurs über die Ungleichheit, Paderborn u.a. 1997, S. 369. Ebenda, S. 370 f. Max Weber: Der Sinn der „Wertfreiheit“ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften, in: Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 1982, S. 507. 8 Max Weber: Wissenschaft als Beruf, in: Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, a.a.O., S. 603. 9 Max Weber: Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, a.a.O., S. 154. 16 Manuel Knoll Westen ist nämlich kein weitgehend einheitlicher bzw. monolithischer Block, wie Huntington unterstellt.10 Die kulturelle Identität der USA unterscheidet sich sehr wohl von der Europas und diese Differenzen gehen offensichtlich keineswegs zwangsläufig mit Gegnerschaft oder gar Feindschaft einher. Früher als das christliche Abendland bezeichnet, umfaßt der westliche Kulturkreis, der „nach allgemeiner Auffassung um 700 oder 800 n. Chr. entstanden“ ist, heute neben Nordamerika und Europa auch von Europäern besiedelte Länder wie Australien und Neuseeland. Definierten die USA ihre Gesellschaft bis Anfang des 20. Jahrhunderts als Gegensatz zu einem als rückständig angesehenen Europa, so führte der zunehmende Kontakt mit nichtwestlichen Kulturen sukzessive zu dem „Gefühl einer größeren Identität mit Europa“ (59 f.). Auch in Zukunft dient es nach Huntington den Interessen der USA, wenn sie „eine atlantikorientierte Politik der engen Zusammenarbeit mit ihren europäischen Partnern verfolgen, um die Interessen und Werte der einzigartigen, ihnen gemeinsamen Kultur zu schützen und zu fördern“ (514). Trotzdem erwartet er, daß der Westen im Verhältnis zu den anderen Kulturen „allmählich, unaufhaltsam und fundamental“ an Macht verlieren wird (119). Um welche Werte handelt es sich bei der westlichen Kultur, und wodurch unterscheidet sich diese von anderen Kulturen? Spezifisch westliche Werte und Institutionen sind für Huntington vor allem Christentum, Pluralismus, Individualismus und Rechtsstaatlichkeit. Huntington zitiert zustimmend Arthur Schlesinger, Jr., für den Europa die „Quelle, die einzige Quelle ... für Ideen wie individuelle Freiheit, politische Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und kulturelle Freiheit“ ist (513). Zudem führt Huntington noch das klassische griechische und römische Erbe, die Fülle der europäischen Sprachen, die Trennung von geistlicher und weltlicher Macht, Repräsentativorgane, Selbstbestimmung, Liberalismus, freie Märkte, eine kontrollierte Regierung, Unabhängigkeit, Gleichheit vor dem Gesetz und Achtung von Verfassung und Privateigentum als Merkmale der westlichen Kultur an (99 ff., 139, 292, 505). Huntington sieht zwischen der Identität der USA, die 10 Bereits 1994 lehnt R. Picht Huntingtons Auffassung ab, daß Kulturkreise weitgehend einheitliche Blöcke sind und fragt: „Wie eindeutig gehören Europa und die Vereinigten Staaten zum gleichen ,Westen’?“ (R. Picht: Der Konflikt der Kulturen und die große Mutation, in: Zeitschrift für Kulturaustausch, 4/1994, Jg. 44, S. 438-444, 440). Die Grenzen des Westens 17 sich seit dem 20. Jahrhundert als „Führer einer umfassenden Einheit, eben des Westens“ (60) definiert, und der Europas keine gravierenden Unterschiede. Er erwähnt allerdings zutreffend, daß in den USA im Gegensatz zu Europa die Mehrzahl der Menschen an Gott glauben, und daß sich die Amerikaner für ein religiöses Volk halten und zahlreich die Kirchen besuchen. Während Huntington in den USA seit Mitte der 80er Jahre sogar ein Wiedererstarken der Religion konstatiert, befürchtet er, daß die westliche Kultur in Europa „durch die Schwächung ihres zentralen Elements, des Christentums, unterminiert werden“ könnte. Denn immer „weniger Europäer bekennen sich zu religiösen Überzeugungen, beachten religiöse Gebote und beteiligen sich an religiösen Aktivitäten“ (501). Bedenkt man, daß sich die kulturelle Identität eines Menschen für Huntington an erster Stelle durch die Religion definiert, dann zeigt sich bereits hier eine schwerwiegende Spaltung zwischen der kulturellen Identität der USA und der Europas. Die europäische Kultur ist heute zudem, sieht man von ihrem englisch- und spanischsprachigen Teil ab, in einer Vielzahl anderer Sprachen verwurzelt als die der USA. Auch deshalb fällt es schwer, Huntingtons Unterstellung eines einheitlichen westlichen Kulturkreises zu akzeptieren. Schließlich stellt die Sprache für ihn nach der Religion das zweite Hauptunterscheidungsmerkmal von Kulturen dar.11 Erkennt man jedoch an, daß die oben angeführten Werte und Institutionen für die kulturelle und politische Identität des Westens auch zentral sind, dann ist es äußerst schwierig, die europäische Identität in abwertender Abgrenzung von den USA zu definieren, wie dies etwa die zumeist antiamerikanisch gesinnte europäische Linke gerne unternimmt. Allerdings muß mit der europäischen Linken gegen Huntington eingewendet werden, daß sich die kulturelle Identität der USA sehr wohl von der Europas abgrenzen läßt. Gegen Huntingtons Konzeption von kultureller Identität und gegen die europäische Linke muß eingewendet werden, daß diese Abgrenzung nicht zwangsläufig mit Gegnerschaft oder gar Feindschaft einhergeht oder einhergehen muß. 11 Dagegen könnte Huntington vorbringen, daß sich der Westen für ihn „von den meisten Kulturkreisen durch die Fülle seiner Sprachen“ unterscheidet (99 f.). Eine Pluralität, hier von Sprachen, stellt aber – zumindest nach Huntingtons genereller Konzeption von Identität – kein integrierendes oder identitätsstiftendes, sondern ein trennendes Moment innerhalb einer Kultur oder zwischen Kulturkreises dar. 18 Manuel Knoll Worin unterscheidet sich die kulturelle Identität der USA von der Europas neben den religiösen und sprachlichen Differenzen noch? Vielleicht ist eine der gängigsten Gegenüberstellungen die von einer einheitlichen und vereinheitlichenden amerikanischen Konsum- und Populärkultur – Coca Cola und Hollywood – mit der Vielfalt der nationalen und regionalen Kulturproduktionen Europas sowie der europäischen Hochkultur. Diese Gegenüberstellung ist teilweise zutreffend. So steht die Mannigfaltigkeit von spanischen, französischen und deutschen Filmen sicherlich im Gegensatz zu der Homogenität einer Masse von standardisierten Hollywoodproduktionen, die Zweifel erwecken, ob Adornos Theorie der Kulturindustrie wirklich überholt ist. In Anbetracht von Filmemachern wie den Coen Brothers, Jim Jarmusch, Spike Lee und Quentin Tarantino läßt sich aber nicht bestreiten, daß in den USA auch eine Vielfalt nicht standardisierter Filme erzeugt wird. Auch das Vorurteil, daß es in den USA keine Hochkultur gibt, kann ohne Schwierigkeiten durch die Bedeutung der zeitgenössischen amerikanischen Kunst entkräftet werden. Man denke an Künstler wie Jasper Johns, Bruce Nauman, Richard Serra und Frank Stella. Die Kulturproduktion der USA läßt sich also gewiß nicht auf Popmusik, Jeans und Hollywoodfilme reduzieren. Derartige Erzeugnisse als das Spezifische der amerikanischen Kultur zu betrachten, trivialisiert sie zu Unrecht. Die Eigentümlichkeit der kulturellen Identität der USA besteht vor allem in den von Huntington angeführten Werten und Institutionen. Diese konstituieren zwar auch ein beträchtliches Moment der kulturellen Identität Europas. Gerade hier bestehen allerdings schwerwiegende Differenzen, etwa im Verständnis der Menschenrechte. So schließen für viele Europäer mittlerweile die unantastbare Menschenwürde und das Recht auf Leben die Todesstrafe aus, die in den USA bekanntlich noch häufig vollstreckt wird. Dies führt aber nicht zu nennenswerten Verstimmungen des gegenseitigen Verhältnisses. Dagegen war das Festhalten der islamischen Türkei an der Todesstrafe, die seit 1984 nicht mehr vollstreckt12 und im Sommer 2002 abgeschafft wurde, bisher ein wichtiger Grund, ihr die Aufnahme in die EU zu verweigern. Ein weiterer wichtiger Gegensatz innerhalb des Westens besteht zwischen der Betonung von Selbstverantwortung und aktiver Selbstorganisation der Individuen auf gesellschaftlicher Ebene in den USA und umfänglicher staat12 Süddeutsche Zeitung, 20. Dezember 2001, S. 1. Die Grenzen des Westens 19 licher Regelungstätigkeit und Aktivität in zahlreichen Bereichen auf dem europäischen Kontinent. Dem entspricht der Gegensatz einer weitgehend freien Marktwirtschaft in den USA und ihrer sozialen Abmilderung in Kontinentaleuropa. Die Verteidigung des europäischen Wertes der Sozialstaatlichkeit, der heute auch durch die Globalisierung, die von den USA etwa durch Freihandelspolitik vorangetrieben wird, bedroht ist, ist für viele Europäer ein zentrales Motiv zur weiteren politischen Integration des Kontinents. Der US-Historiker Michael H. Hunt arbeitet in einer bemerkenswerten Studie drei zentrale und dauerhafte Elemente der nationalen Ideologie der USA heraus, die ihre Außenpolitik gestalten: die Feindseligkeit gegenüber Revolutionen, besonders von der Linken, die von der amerikanischen Norm abweichen, die Klassifikation von anderen Völkern nach einer rassischen Hierarchie und eine Vision nationaler Größe, die mit der Vorstellung von der Mission einhergeht, die Freiheit im Ausland eifrig fördern zu müssen.13 Diese Überzeugungen und Annahmen sind oder waren – insbesondere in den letzten zwei Jahrhunderten – teilweise auch für die kulturelle Identität Europas charakteristisch. Der von Huntington abgelehnte westliche Universalismus, der von anderen Völkern als Imperialismus wahrgenommen wird, hat ebenso genuin europäische Wurzel und ist sowohl in Europa als auch in den USA vorhanden. Trotzdem ist der hohe Stellenwert der Ideologie in den USA, insbesondere ihr ungebrochen starkes Sendungsbewußtsein, ein spezifisches Merkmal, das sie von Europa unterscheidet. So betont Wolfgang Koydl: „Richtig ist freilich, dass Europa, das vom Nationalismus über Faschismus und Kommunismus schon alle Varianten ausprobiert hat, der Ideologien müde geworden. Amerika hingegen ist in vielerlei Hinsicht eine radikal-ideologische Nation geblieben, die in ihrer Form der Demokratie nicht weniger als das Heil der Menschheit sieht. Gerade die Verknüpfung mit einem religiös verbrämten Sendungsbewußtsein verwirrt, irritiert und bestürzt viele Europäer.“14 Zum Abschluß dieser kurzen verallgemeinernden Reflexion über die Differenzen zwischen der kulturellen Identität der USA und der Europas muß 13 14 Michael H. Hunt: Ideology and U.S. Foreign Policy, New Haven 1987. Wolfgang Koydl: Amerikas Visionen, in: Süddeutsche Zeitung Nr. 101, 3./4. Mai 2003, S. 4. 20 Manuel Knoll betont werden, daß die Identität einer Kultur veränderlich und immer im Werden ist.15 Insbesondere in Europa könnte in näherer Zukunft eine Dekonstruktion der nationalen und die Konstruktion einer europäischen Identität erfolgen. Für die klassischen europäischen Nationalstaaten und ihre Identitätskonstruktion war zumeist eine Tendenz zur Vereinheitlichung und Nivellierung der Pluralität charakteristisch. So versuchte der faschistische Nationalstaat in Italien durch die Italienisierungswelle in Südtirol das Andere zu unterwerfen, gewaltsam zu assimilieren und zu integrieren. Diese Tendenz hat sich seit Ende der 70er Jahre verkehrt. In der Dezentralisierung von 1982/83 erhielten die Regionen in Frankreich den Status von Gebietskörperschaften. Seit den 90er Jahren ist die beschränkte Autonomie von Schottland, Wales und Korsika anzuführen. In den sich abzeichnenden mehr oder weniger „Vereinigten Staaten von Europa“ dürfte diese neue Tendenz zur Anerkennung der Vielfalt und des Anderen fortgeschrieben werden. Denn das europäische Ziel kann nicht eine vereinheitlichte europäische Sprache, Kultur etc. sein, sondern immer nur die Anerkennung und Betonung der Pluralität. Die europäische Identität läßt sich gerade als die Einheit in der Vielfalt, gerade als die geographische Nähe des mannigfaltigen Anderen und Fremden begreifen. Das macht auch weltweit die Eigentümlichkeit der europäischen Identität aus.16 So betont auch Herfried Münkler, daß „wo die Pluralität endet und die Uniformität beginnt, da endet auch Europa“.17 Ein derartiges Verständnis der europäischen Identität findet auch seinen Niederschlag in der Charta der Grundrechte der EU. So spricht die Präambel von der „Achtung der Vielfalt der Kulturen und Tradi15 Identität läßt sich zwar als das konstante und beharrende Seiende in einer werdenden und damit sich verändernden Wirklichkeit begreifen. Demgemäß kann kulturelle Identität als ein Komplex von konstanten und beharrenden Momenten verstanden werden, der von den vergänglichen Individuen eines Kulturkreises weitgehend geteilt wird. Dieser allgemeine Komplex im Besonderen verändert sich aber selbst wiederum im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung. So bildet sich etwa nach Jacob Burckhardt mit Ausgang des 13. Jahrhunderts in Italien das später den Westen prägende Moment des Individualismus neu aus (Jacob Burckhardt: Die Kultur der Renaissance in Italien, Stuttgart 1988, S. 99). 16 Mariano Delgado; Matthias Lutz-Bachmann (Hrsg.): Herausforderung Europa. Weg zu einer Europäischen Identität, München 1995; Denis de Rougemont: Europa. Vom Mythos zur Wirklichkeit, München 1962, S. 385 ff. 17 Herfried Münkler: Europa als politische Idee. Ideengeschichtliche Facetten des Europabegriffs und deren aktuelle Bedeutung, in: Leviathan, Bd. 4, 1991, S. 521-541, 539. Die Grenzen des Westens 21 tionen der Völker Europas“ und Artikel 22 lautet: „Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen.“18 Hier gilt es nochmals kritisch gegen Huntingtons antagonistische Konzeption von kultureller Identität festzuhalten, daß die erwähnten Differenzen zwischen der kulturellen Identität der USA und der Europas de facto nicht mit Gegnerschaft oder gar Feindschaft einhergehen. Analog dazu gehen die kulturellen Unterschiede zwischen den europäischen Nationalstaaten seit dem 2. Weltkrieg mit friedlichen Grenzen einher. Zudem bilden sich zunehmend partnerschaftliche Kooperation, Strukturen wechselseitiger Anerkennung und sogar Freundschaft heraus. Die Existenz von friedlichen Abgrenzungen und Grenzen innerhalb des westlichen Kulturkreises zeigt somit deutlich, daß die für kulturelle Identität notwendige Abgrenzung eines „Wir“ von einem „Sie“ nicht auch zwangsläufig mit einem „Wir“ gegen „Sie“ verknüpft ist. Trotzdem bergen etwa die mögliche weitere Entgrenzung des Krieges gegen „den Terrorismus“ durch die USA, ihre zunehmend imperialen Bestrebungen und die divergierenden umweltpolitischen Vorstellungen ein ernstzunehmendes Konfliktpotential zwischen den USA und Europa. Die politische Spaltung des Westens durch den jüngst von den USA gegen den Irak geführten Krieg hat darüber hinaus die konkrete Möglichkeit zu Bewußtsein gebracht, daß „der Westen“ in Zukunft tatsächlich auseinanderdriften könnte. Denn die politische Spaltung des Westens hatte nicht nur pragmatische Gründe, etwa daß Gerhard Schröder durch seine dezidierte Ablehnung eines Krieges gegen den Irak von innenpolitischen Problemen ablenken und seine Chancen bei der Bundestagswahl 2002 verbessern wollte. Sie hat auch offenbart, daß es innerhalb des Westens klare Interessengegensätze gibt und daß sich die Werte und damit auch die kulturelle Identität der „neuen USA“ und des „alten Europas“ zunehmend unterscheiden. So wird Europa in der Außenpolitik zunehmend friedfertiger und moralischer, setzt auf Verhandlungen, Diplomatie und auf internationale Organisationen wie die UNO sowie auf eine stärkere globale Verrechtlichung, etwa auf den von den USA abgelehnten Internationalen Strafgerichtshof. Dagegen tendieren die USA zunehmend zu unilateralem Handeln und setzen auf militärische Macht, die sie wie im jüngsten Irak18 Charta der Grundrechte der EU. Sonderbeilage zu NJW, EuZW, NVwZ und JuS, Juristische Schulung (JuS), Heft 1, 41. Jg., 2001. 22 Manuel Knoll krieg auch auf Basis einer höchst fragwürdigen völkerrechtlichen Legitimation einsetzen.19 Die neuzeitliche Entwicklung des Völkerrechts hat dazu geführt, daß ein Staat trotz eines als gefährlich, schlecht und böse eingeschätzten Regimes vor einem Angriffskrieg geschützt war. Diese zivilisatorische Errungenschaft scheinen die USA bis auf weiteres verabschieden zu wollen. 3. Eine Möglichkeit zur Überwindung der konfliktreichen Grenzen zwischen westlichem und islamischem Kulturkreis Mit diesen Betrachtungen über die Grenzen innerhalb des westlichen Kulturkreises sind natürlich noch nicht die Fragen beantwortet, ob sich ein Kulturkreis nicht unabwendbar immer wieder Feinde macht oder ganz ohne Feinde auskommen kann. So wurde der Ostblock als Feind des Westens im Kalten Krieg erst von einer Reihe islamischer Staaten und dann von dem Milosevic-Regime in Serbien abgelöst. Letzteres wurde Ende der 90er Jahre wiederum von Osama Bin Ladens Terrororganisation Al-Qaida und den afghanischen Taliban abgelöst. Geht man mit Niccolò Machiavelli von der anthropologischen Prämisse aus, daß die invariante conditio humana darin besteht, daß die Menschen von ihren Leidenschaften und Begierden, insbesondere von einem unersättlichen Ehrgeiz angetrieben werden, dann scheinen Feindschaft, Konflikt und Krieg zwischen Staaten und Kulturen für alle Zeiten unvermeidlich. Denn wird der Ehrgeiz innerhalb der Staaten und Kulturen durch gute gesetzliche Ordnung gezähmt, dann richtet er „seine Wuth nach außen“.20 Machiavellis Auffassung läßt sich eine aktualisierte Variante des Arguments entgegenhalten, das Rousseau gegen Hobbes vorbringt.21 Beide Denker unterstellen nämlich, daß der durch die zeitgenössischen gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse geprägte Mensch unwandelbar der Mensch schlechthin ist. Ein kurzer Vergleich von der Kriegsbereitschaft und dem 19 In diesem Zusammenhang ist die vieldiskutierte These von Robert Kagan ernst zu nehmen, daß die angeführten divergierenden Entwicklungen zum einen auf die relative militärische Schwäche Europas und zum anderen auf die Macht und Stärke der USA zurückgeführt werden können (Robert Kagan: Power and Weakness, Policy Review, Nr. 113, 2002). 20 Niccolò Machiavelli: Der Ehrgeiz. An Luigi Guicciardini, in: ders.: Sämtliche Werke, Karlsruhe 1832/41, Bd. VII, S. 237. 21 Jean-Jacques Rousseau: Diskurs über die Ungleichheit, a.a.O., S. 70 f., 139. Die Grenzen des Westens 23 nationalen Ehrgeiz der deutschen Jugend in der ersten und der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigt dagegen, wie wandlungsfähig der Mensch ist. Huntington vertritt mit guten Argumenten die These, „daß im Anschluß an die iranische Revolution 1979 ein interkultureller Quasi-Krieg zwischen dem Islam und dem Westen ausbrach... Zwei fundamentalistische Staaten (Iran, Sudan), drei nichtfundamentalistische Staaten (Irak, Libyen, Syrien) sowie ein breites Spektrum islamistischer Organisationen haben, finanziell unterstützt von muslimischen Ländern wie Saudi-Arabien, gegen die USA und gelegentlich gegen Großbritannien, Frankreich und andere westliche Staaten und Gruppen sowie gegen Israel und die Juden generell gekämpft“ (347 ff.). Zudem kann Huntington zeigen, daß bereits der sowjetischafghanische Krieg von vielen Muslimen als Konflikt zwischen Kulturen und der zweite Golfkrieg als Krieg „gegen sie“ angesehen wurde (403, 400-410). Dasselbe trifft auch für den gerade zu Ende gegangenen dritten Golfkrieg zu. Die erneute Eskalation des palästinensisch-israelischen Konflikts seit den Monaten vor dem 11. September 2001 und die von vielen Muslimen als ungerecht erachtete US-Parteinahme zugunsten Israels fügt sich nahtlos in die von Huntington beschworene Neugestaltung globaler Politik entlang „kultureller Kampflinien“ (193). Das tiefere Problem für den Westen im Konflikt mit dem islamischen Kulturkreis ist für Huntington nicht der islamische Fundamentalismus, sondern „der Islam, eine andere Kultur, deren Menschen von der Überlegenheit ihrer Kultur überzeugt und von der Unterlegenheit ihrer Macht besessen sind“ (349 f.). Das tiefere Problem für den Islam ist für Huntington der von ihm als gefährlich abgelehnte westliche Universalismus (524). Diese Ingredienzien heizen für Huntington den Konflikt zwischen den beiden Kulturkreisen an. Dem läßt sich noch hinzufügen, daß der Westen nach einer im islamischen Kulturkreis verbreiteten Sichtweise diesem seit dem Untergang des Osmanischen Reiches statt Anerkennung vornehmlich Mißachtung widerfahren ließ. Die Kette der Mißachtungen beginnt etwa mit dem quasi kolonialen Status des unter französische und britische Herrschaft geratenen arabischen Teils des Osmanischen Reiches und reicht bis zur Stationierung von US-Truppen in SaudiArabien, dem Land der islamischen Heiligtümer, die nicht nur von Osama Bin Laden als Entwürdigung und Beleidigung des Islam angesehen wird. 24 Manuel Knoll Dem Westen empfiehlt Huntington eine klare Abgrenzung vom islamischen Kulturkreis. Insbesondere befürwortet er, die schwierige und umstrittene Frage nach der Festlegung der Ostgrenze Europas nach religiösen Gesichtpunkten zu beantworten: „Wo hört Europa auf? Es hört dort auf, wo das westliche Christentum aufhört und Orthodoxie und Islam beginnen“ (252). Seine „Identifikation Europas mit der westlichen Christenheit“ liefert Huntington auch „ein klares Kriterium für die Zulassung neuer Mitglieder zu westlichen Organisationen“ wie der EU und der NATO (255). Im Zusammenhang mit der Osterweiterung und der „kulturellen Umgestaltung“ dieser Organisationen wirft er die Frage nach deren Verkleinerung um die muslimische Türkei und das orthodoxe Griechenland auf, die allerdings nicht absehbar ist (258). In Anbetracht der geplanten Erweiterung der Europäischen Union stellt sich für Europa vor allem die Frage nach dem weiteren Umgang mit der islamischen Türkei, der von der EU im Dezember 1999 der Kandidatenstatus zugesprochen und im Dezember 2002 angeboten wurde, nach einer erfolgreichen Prüfung ab Dezember 2004 „ohne Verzug“ mit Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Diese Frage muß natürlich auch im Zusammenhang mit den ca. 15 Millionen Muslimen gesehen werden, die derzeit in Westeuropa leben. Identifiziert man mit Huntington Europa vor allem mit der westlichen Christenheit, dann werden die in Europa lebenden Muslime per definitionem ausgegrenzt. Begreift man dagegen den Kern der europäischen Identität gemäß der oben angeführten europäischen Selbsthermeneutik als die Einheit in der Vielfalt und als die geographische Nähe des mannigfaltigen Anderen und Fremden, dann kann dies die Integration der islamischen Bevölkerung und der Türkei in die Gemeinschaft fördern. Dazu wäre es allerdings erforderlich, dieser europäischen Selbsthermeneutik zur Verbreitung im Bewußtsein der europäischen Bevölkerungen zu verhelfen. Zudem müßte sich die Türkei noch weiter an europäische Werte und Institutionen angleichen und insbesondere „Parteien- und Berufsverbote, die Unterdrückung anderer Sprachen, Bekleidungs- und Denkvorschriften“22 überwinden, die die Pluralität mißachten. Letzteres dürfte allerdings kein unüberwindliches Hindernis darstellen. Denn durch die bereits im Zuge des 22 Süddeutsche Zeitung, 11./12. Dezember 1999, S. 4. Die Grenzen des Westens 25 Kemalismus erfolgte Modernisierung und Verwestlichung hat die Türkei eine erstaunliche Reformfähigkeit bewiesen. Die erfolgreiche Integration der islamischen Türkei in „Vereinigte Staaten von Europa“ könnte langfristig zum nachahmenswerten Paradigma für das Verhältnis des gesamten Westens zum islamischen Kulturkreis werden. Denn die Abgrenzung von islamischen und christlichen EU-Mitgliedern würde statt mit Gegnerschaft mit Zusammenarbeit in den gemeinsamen europäischen Institutionen und der Anerkennung der Anderen und Fremden einhergehen. Dazu bedarf es der Rückbesinnung auf eine Tugend, die genauso europäisch wie islamisch ist und die bezeichnenderweise von Huntington nicht erwähnt wird: Toleranz.23 Denn echte Toleranz ist nicht bloß die – allerdings nicht unbegrenzte – Duldung anderer religiöser, politischer und kultureller Überzeugungen und Lebensweisen. Toleranz ist auch die wechselseitige Anerkennung der anderen Individuen und Kulturen als Gleiche und als Andere. Die Anderen werden als Gleiche anerkannt, da alle als frei bzw. autonom respektiert werden, sich ihre Überzeugungen und Lebensweisen selbst zu wählen oder aus der Tradition zu übernehmen. Da diese Wahl von den verschiedensten Faktoren wie Herkunft, Bildung, Denkweise etc. beeinflußt wird und natürlich unterschiedliche Ergebnisse zeitigt, werden die tolerierten Individuen und Kulturen auch als Andere bzw. Fremde anerkannt. Ist die Tugend der Toleranz erst in Folge der blutigen Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts zum europäischen Grundwert geworden, so herrschte sie über weite Strecken des Mittelalters im muslimischen Spanien gegenüber Christen und Juden vor und förderte maßgeblich dessen wirtschaftliche Prosperität und kulturelle Blüte. 23 Rainer Forst (Hg): Toleranz. Philosophische Grundlagen und gesellschaftliche Praxis einer umstrittenen Tugend, Frankfurt am Main 2000; Adel-Theodor Khoury: Toleranz im Islam, München u.a. 1980. Alexander von Pechmann Zur neuen Dimension der Globalisierungskritik Wenn wir nicht die Bereitschaft der Menschen verstehen, für eine Überzeugung zu sterben, dann verstehen wir die Menschen nicht. Walden Bello Zur Wende des Jahrtausends hat sich gegen die Globalisierung ein selbst globaler Widerstand formiert. Auf der einen Seite der Front ist das strategische Ziel klar: die optimale Verwertung des eingesetzten Kapitals. Und dies Lager besteht aus einem höchst schlagkräftigen Heer von visionären Bankern, effizienten Unternehmern und beflissenen Politikern, von klassenund konkurrenzkampferprobten Managern und Merchandisern sowie so agilen wie kreativen Kulturvermittlern und Medienagenten. Im gegnerischen Lager jedoch scheint die blanke Furcht und Wut und Ohnmacht zu regieren: hier kämpfen brasilianische Landlose um ihre Parzelle, stemmen sich mexikanische Rebellen dem Ausverkauf ihrer Heimat entgegen, opfern arabische Intellektuelle ihr und anderer Leben für ihren bedrohten Glauben, treibt die Sorge um die Familie US-amerikanische Teamsters auf die Straße, streiten indische Bäuerinnen um ihr jährliches Saatgut und kämpfen australische Tierschützer fürs Überleben der Kängurus und der Schildkröten ... Diese bunte Menge aus aller Welt eint offenbar allein der Kampf gegen die Übermacht der Globalisierer und ihre Hoffnung auf ein anderes, besseres Leben. Als Geburtsstunden der Globalität dieser Anti-Globalisierungsinitiativen lassen sich drei „Ereignisse“ festmachen, die – über die Vielfalt der Einzelinteressen hinaus – auch drei verschiedene Typen der Kritik benennen: 1. die weltweit geführte Auseinandersetzung um das Multilaterale Investitionsabkommen (MAI) im Jahre 1998, die zum Scheitern des Abkommens und in der Folge zur Gründung von „attac“ führte; 2. die „Schlachten“ um Seattle und Genua Ende 1999 und Mitte 2001, die zu Kristallisationspunkten einer global vernetzten Protestbewegung wurden und die Schaffung der „People’s Global Action“ (PGA) initiierten; und Zur neuen Dimension der Globalisierungskritik 27 3. schließlich der Crash des Welthandelszentrums in New York und der Angriff auf das Pentagon in Washington am 11. September 2001 durch das „Al-Quaida“-Netzwerk, die dem Kampf gegen die Globalisierung eine ganz neue Dimension verliehen haben. I. „Die Wiedergewinnung des Politischen“ Der erste Typ der Globalisierungskritik hat seinen Ausgang vom moralischen Protest am Charakter der derzeitigen Globalisierung und an der Dominanz des Neo-Liberalismus genommen, der von Viviane Forrester in „Der Terror der Ökonomie“ (1997) so eindrucksvoll und von Pierre Bourdieu im „Elend der Welt“ (1997) so empirisch gehaltvoll formuliert worden war. Die weltweite Deregulierung und Vernetzung der Finanz-, Waren- und Arbeitsmärkte, die Politik der Privatisierung staatlicher Betriebe und kommunaler Einrichtungen sowie der ‚Konsolidierung’ der Staatshaushalte – und damit die Unterordnung des Staates und der Gesellschaft unter die Effizienzkriterien der kapitalistischen Wirtschaftsweise wurden in ihren sozialen Folgen als unvereinbar mit den Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit beurteilt. Statt eines wachsenden Wohlstandes habe die Entfesselung eines gnadenlosen „Raubtierkapitalismus“ (Helmut Schmidt), die gezielte Privilegierung des Großen Kapitals durch eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik und der Abbau des Sozialstaates durch eine rigide Sparpolitik weltweit eine sprunghafte Vermehrung der Armut und den Zusammenbruch ganzer Wirtschaftsräume bewirkt und bedrohe so die sozial-ökonomischen Grundlagen demokratischer Strukturen. – Diese Art der Kritik an der herrschenden Globalisierung zielt darauf, durch Formen des zivilen Protests und des organisierten Widerstandes sowohl die Interventionsfähigkeit demokratisch legitimierter Regierungen gegenüber den globalen Märkten zu stärken als auch das transnationale Wirtschaftssystem der politischen Kontrolle, einer „global governance“, zu unterwerfen.1 Versuchen wir diese Kritik an der Globalisierung gewissermaßen zu lokalisieren, so nimmt es nicht Wunder, dass diese Protestbewegung ihren Ausgangs- und Schwerpunkt in Kontinentaleuropa, vor allem in Frankreich, hatte und sich in den sog. „NGO’s“ organisiert hat. Spiegelt sich in ihr doch siehe dazu das Attac-Manifest 2002: Mit ATTAC die Zukunft zurückerobern. In: www.attac-netzwerk. de/archiv/manifest2002.pdf. 1 28 Alexander von Pechmann die Kontroverse um das Wesen und die Ausgestaltung der modernen Gesellschaft wider: dort, auf Seiten der Globalisierer, das liberale Gesellschaftsund Staatsmodell, das in der Tradition von Locke, Smith und Ricardo insbesondere die angloamerikanische Kultur geprägt hat; hier, auf Seiten der Kritiker, das republikanische Gesellschafts- und Staatsmodell, das in der Tradition Rousseaus und auch Kants das Marktgeschehen der bürgerlichen Gesellschaft in vorgängige politisch-rechtliche und demokratische Strukturen eingebettet sehen will. Während das liberale Modell das „Gemeinwohl“ oder „allgemein Beste“ nicht als das Produkt eines gemeinsamen, politisch organisierten Willens, sondern als das zwangsläufige, quasi naturwüchsige Ergebnis der autonom handelnden Wirtschaftssubjekte versteht, konzipiert jenes republikanische Modell das Gemeinwohl gerade nicht als Resultat eines solchen „freien Spiels der Kräfte“, sondern als Folge eines bewussten und gewollten Prozesses der politischen Orientierung, Regulierung und Steuerung. Auch wenn diese Kontroverse um die Globalisierung sich heute zweifellos auf neue Räume und Felder erstreckt, so können doch die philosophischen Grundlagen dieses Streits nicht als neu verstanden werden. Sie sind kein Produkt der Globalisierung, sondern sind so alt wie die moderne bürgerliche Gesellschaft selbst, zumindest seit die französische Revolution die Liberté mit der Egalité zusammengespannt und den Kampf zwischen den liberalen Girondisten und den republikanischen Jakobinern ausgetragen hat. Dementsprechend reproduziert dieser Streit auch nur wieder die bekannten Bilder von der unstillbaren Profitsucht des Yankeetums auf der einen Seite und der sterilen Reglementierungssucht der Kontinentaleuropäer auf der anderen Seite. Und auch die Einwürfe und Gegeneinwürfe über die Machbarkeit und die Wünschbarkeit politischer (De-)Regulierungen sowie über die moralischen und intellektuellen Qualifikationen der je anderen Seite wiederholen nur, was die klassische politische Philosophie an Argumentationsmustern bereitgestellt hat. Es kann daher auch nicht überraschen, dass dieser Typ der Kritik keineswegs gegen die Globalisierung selbst gerichtet ist, sondern nur gegen die einseitig ‚angloamerikanische’ Art der Globalisierung. Und es ist unschwer vorauszusehen, dass jene vermeintliche Unvereinbarkeit der beiden Modelle sich im Zuge der Ausgestaltung der globalen Beziehungen als durchaus vereinbar erweisen wird. Zur neuen Dimension der Globalisierungskritik 29 II. „Eine andere Welt ist möglich“ Ganz anders hingegen scheint es sich mit dem zweiten Typus der Globalisierungskritik zu verhalten. Denn dieser richtet sich nicht nur gegen das Laisser-faire des gegenwärtigen Globalisierungsprozesses, sondern gegen die Globalisierung als Herrschaftsstruktur. Er kritisiert sie gleichsam ‚von unten’: „Ihr seid G8 – wir sind sechs Milliarden!“ Ihm geht es nicht um politische Reformen sozial ungerechter Prozesse, sondern um die revolutionäre Überwindung unmenschlicher Strukturen. Im Zentrum dieser Kritik steht daher nicht die Entmachtung der Politik durch dominante ökonomische Interessen, sondern zunächst und vor allem die Darstellung und die Analyse der Globalisierungsprozesse als Entstehung eines Systems der universalen Herrschaft. Dies System sei heute nicht mehr, wie vormals, national und territorial organisiert, sondern formiere sich in hybriden Transformationsprozessen zum „Empire“, zu einem transnationalen zentrumslosen Imperium. Dieses globale Herrschaftssystem aber schaffe durch die Produktion seiner eigenen Krisen, Widersprüche und Widerstände zugleich die Bedingungen für eine künftige sich selbst vernetzende, solidarische und herrschaftsfreie Weltgemeinschaft.2 Wenn wir auch hier fragen, wo dieser Typus des revolutionären Protests zuhause ist, so finden wir ihn sicher nicht in den Vorzimmern der staatlichen Institutionen oder den Konferenzräumen der internationalen Organisationen, sondern in den regionalen Protestbewegungen und auf den Massendemonstrationen, in denen sich die Widersprüche des Systems manifestieren. Er ist vor allem in den autonomen Gruppen und Netzwerken Italiens wie den Centri sociali oder der „Tute Bianche“- bzw. „Disobbedienti“-Bewegung und in den Aktionsgruppen Lateinamerikas verankert und gründet sich auf deren traditionelles Misstrauen gegenüber den Herrschenden sowie ihr ebenso traditionelles Vertrauen in die Aktionskraft der Massen. Auch diese Protestbewegung ist nicht gegen die Globalisierung selbst gerichtet. Im Gegenteil: indem sie im entstehenden Imperium das Imperium zugleich global bekämpft, eignet sie sich die globalen Techniken an und sieht sich in diesem weltweiten Kampf gleichsam als die Vorhut einer künftigen solidarischen Weltgemeinschaft, in der die sozialen Hierarchien und 2 Siehe dazu insbesondere: M. Hardt, A. Negri: Empire. Die neue Weltordnung, Frankfurt/Main 2002. 30 Alexander von Pechmann die kulturellen Unterschiede verschwunden sein werden. Diese Bewegung steht so in der emanzipatorischen Tradition der modernen Gesellschaft, die die Überwindung aller völkischen, nationalen und staatlichen Schranken, die Schaffung globaler Verhältnisse der materiellen wie geistigen Produktion als einen Prozess der Befreiung, der „kulturellen Vereinigung der Menschheit“ (Gramsci), gefeiert hat, die so zum Träger und zum Subjekt ihrer eigenen Geschichte wird. Sie versteht daher – in der Tradition von Marx und Engels – die Globalisierung als einen umfassenden, dialektischen und in sich widersprüchlichen Geschichtsprozess, der zugleich die Bedingungen für eine herrschaftsfreie, solidarische und sozial gerechte Weltgemeinschaft hervorbringt. Dieser Typus der Kritik ist jedoch gleichfalls kein Kind der Globalisierung. Er vertritt vielmehr in der europäischen Moderne das radikale und revolutionäre Element – Hardt und Negri sehen in ihm mit guten Gründen sogar ihren Ursprung3 –, das die Moderne als den Ausbruch des Menschen aus unmenschlichen Verhältnissen begreift, der im Kampf gegen die bestehenden Verhältnisse zum Gattungswesen wird. Diese Kritik repräsentiert so neben dem Prinzip der Freiheit des Bourgeois und dem Prinzip der Gleichheit des Citoyen das Prinzip der Solidarität, der Brüder- und Schwesterlichkeit aller Menschen. Sie bildet das radikale und sozialrevolutionäre Element der Moderne, das seine geschichtliche Wurzel vor allem im italienischen Renaissance-Humanismus findet. III. Der „Kampf der Kulturen“ Wirkt so diese Dreifaltigkeit – wenn auch nicht Dreieinigkeit – der Ideen der Freiheit in der bürgerlichen Gesellschaft, der Gerechtigkeit im säkularen Staat und der Solidarität im emanzipatorischen Kampf zusammen, um das europäische Projekt der Moderne gegen alle Widerstände im globalen Maßstab wirklich zu machen, und sieht sich diese Kultur gerade in und wegen ihrer Selbstkritik zur globalen Herrschaft – Habermas spricht von ihr als „weltweit zivilisierender Gestaltungsmacht“4 – berufen, so kommt die wirkebd., 83 ff. J. Habermas: Glaube, Wissen – Öffnung. Zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels. In: Süddeutsche Zeitung, 15.10.01. – Vgl. auch G. Schröder: Regierungserklärung des Bundeskanzlers am 18.10.01. zit. nach: www.documentarchiv.de/brd/2001/ rede_schroeder_1018.html. 3 4 Zur neuen Dimension der Globalisierungskritik 31 liche Kritik an der Globalisierung offenbar von außen, von den Betroffenen. Dieser dritte Typus der Gegnerschaft, der gegen dieses Projekt als solches gerichtet ist, scheint so das wirklich Neue der Globalisierung zu sein, weil er das Produkt der Globalisierung selbst ist und ganz neue Fronten, Akteure und Formen des Kampfes hervorbringt. Sowohl die Radikalität dieser Gegnerschaft als auch das Brachiale des Kampfes zeigen, in welch vertrauten Bahnen und Mustern der bisher skizzierte Protest verlief, der in seinen Grundlagen nur den alten Streit der europäischen Moderne mit sich neu auflegt. In diesem neuen, durch die Globalisierung selbst bewirkten Konflikt geraten daher nicht, wie in den vertrauten – mehr oder weniger gewaltlosen – Formen des Protestes, wohlunterscheidbare Elemente des einen Diskurses in Gegensatz, sondern prallen, wie das Ungeheuerliche der Terroranschläge gezeigt hat, schlicht verschiedene Diskurse aufeinander. Hier sind die Kontrahenten nicht die sozialen Klassen einer gemeinsamen Gesellschaftsformation, sondern Repräsentanten einander fremder Kulturen. Dieser Zusammenstoß erst schafft eine in der Tat neue und unvertraute Situation, die mit dem vertrauten Instrumentarium der politischen Philosophie offenbar nicht angemessen zu beschreiben ist. Im folgenden möchte ich dieser neuen Art der Globalisierungskritik anhand von drei Problemfeldern nachgehen: 1. einem Kulturbegriff, der diese globale Konfliktlage beschreibbar macht; 2. den Wahrnehmungs- und Beurteilungsmustern des Eigenen und des Anderen; 3. möglichen Szenarien der künftigen Weltgesellschaft. 1. zum Begriff der „Kultur“ Beschreiben wir diesen dritten Typ der Globalisierungskritik nicht psychologisch als ein irgendwie erklärbares Phänomen des Hasses auf die „Moderne“ und ihre Zumutungen oder in sozial-ökonomischen Kategorien als eine ebenso erklärbare Reaktion der Verlierer auf die Globalisierungsprozesse, sondern betrachten wir ihn in seinem Kern als einen Konflikt von Kulturen, dann kommt es offenbar darauf an, den Begriff von Kultur angemessen zu bestimmen. Jedenfalls kann er in diesem Fall nicht in dem klassischen, auf Aristoteles zurückgehenden Sinne gebraucht werden, wonach die Kultur der Inbegriff der Tätigkeiten sei, durch die die Menschen sich von den Tieren unterscheidet; denn dieser Begriff lässt sich nur in der Einzahl, nicht 32 Alexander von Pechmann aber in der Mehrzahl verwenden. Unter „Kulturen“ können aber auch nicht – wie etwa in der romantischen Tradition – gewisse individuelle, in sich abgeschlossene Entitäten verstanden werden5; denn solche Monaden können nicht streiten. Schließlich kann der Kulturbegriff aber auch nicht – in einem postmodernen Sinne – die Vielfalt der je regionalen geistigen und ästhetischen Produktionen umfassen6; denn mit ihm lassen sich zwar die mehr oder weniger friedliche Diffusionen und Hybridisierungen der Kulturen in einer sich „kreolisierenden Welt“ beschreiben, nicht aber die neue Art der Feindschaft, die aus ihnen offenbar hervorgeht. Soll also dieser neue Typ der Globalisierungskritik mit dem Begriff der Kultur bezeichnet werden, dann erscheint es sinnvoll, ihn nicht auf Objekte, auf geistige Produkte wie die Sprache, die Religion oder die Kunst zu beziehen, sondern unter „Kultur“ vielmehr das Subjektive und unverfügbar Innere zu verstehen, das ihren Produkten je schon zugrunde liegt und diese prägt und bestimmt. In diesem Sinne bezeichnet der Kulturbegriff nicht das, was Menschen machen, sondern wie sie das, was sie machen, machen. Was die jeweilige Kultur ist, besteht so gesehen nicht in ihren materiellen und immateriellen Produkten, sondern in der Art oder Form, in der sie diese hervorbringt. Sie ist in der Terminologie Foucaults das „Dispositiv“, das menschliches Handeln zu einem je eigentümlichen „Diskurs“ formiert, oder in der Redeweise Wittgensteins die „Lebensform“, in der und durch die erst die menschlichen Tätigkeiten ihren spezifischen Sinn erhalten.7 So verstanden wäre also „Kultur“ nichts Äußeres, nichts, was man sehen, untersuchen und beschreiben kann, sondern das Innere oder Implizite, der jeweilige „Code“, nach dem die Vergegenständlichungen geschehen. 5 So etwa J. Baudrillard: „Kulturen sind wie Sprachen. Jede ist unvergleichlich, ein abgeschlossenes Kunstwerk für sich... Man kann sie nicht am Universellen messen.“ („Das ist der vierte Weltkrieg“. Spiegel-Gespräch. zit. nach: http://www.us-aussenpolitik.de/interviews/baudrillard.html.) 6 Vgl. W. Welsch: „Es gibt zwar noch eine Rhetorik der Einzelkulturen, aber in der Substanz sind sie alle transkulturell bestimmt. Anstelle der separierten Einzelkulturen von einst ist eine interdependente Globalkultur entstanden, die sämtliche Nationalkulturen verbindet und bis in Einzelheiten hinein durchdringt.“ (Netzdesign der Kulturen. In: Zeitschrift für Kulturaustausch 1/2002: Der Dialog mit dem Islam. www.ifa.de/ zfk/themen/ 02_1_islam/ dwelsch.htm) 7 In „Über Gewißheit“ nennt L. Wittgenstein sie den „überkommenen Hintergrund, auf welchem ich zwischen wahr und falsch unterscheide.“ (Werkausgabe Band 8, Frankfurt/Main 1984, 94) Zur neuen Dimension der Globalisierungskritik 33 Ein solcher Kulturbegriff versteht unter Kulturen weder separate und in sich verschlossene Inseln noch das offene Meer, in dem sich all das, was Menschen aus sich und der Welt machen, mischt und verbindet. An die Stelle solcher Bilder träte vielmehr die Metapher einer „semantischen Maschine“, die die kognitiven, praktischen und ästhetischen Tätigkeiten der Menschen in einer je eigentümlichen Weise bedeutungsvoll ‚verarbeitet’. 2. Wahrnehmungs- und Beurteilungsmuster des „Eigenen“ und des „Anderen“ Auf der Grundlage dieses Kulturbegriffs lässt sich der dritte Typus der Globalisierungskritik, der Kritik „von außen“, nun als ein „Konflikt von Kulturen“ verstehen. Dieser Konflikt erklärt sich so aus dem einfachen Umstand, dass es auf der Erde offenbar nicht nur eine, sondern mehrere solcher „Maschinen“ gibt, die die stattfindende Globalisierung nach verschiedenen Codes verarbeiten. Und die Verschiedenheit dieser ‚Programme’ resultiert ihrerseits daraus, dass diese Codes sich auf den verschiedenen Teilen der Erde bisher relativ autonom konstituiert haben. Dass die Globalisierung zwischen den Kulturen einen Konflikt erzeugt, bedeutet dann in negativer Hinsicht, dass es offenbar keine universelle „Hypermaschine“ gibt, die diese verschiedenen Programme zu koordinieren und semantische Ähnlichkeiten zu erzeugen vermag. Anders gesagt: es gibt keine globale Instanz, die die stattfindende Globalisierung zu einem Diskurs formiert. Was daher die Ausdrücke wie „Eigentum“, „Recht“ oder „Regierung“ bedeuten, unterliegt einer verschiedenen, je eigentümlichen Codierung. – In positiver Hinsicht lässt sich der Konflikt der Kulturen als eine Bedrohung der jeweiligen „Lebensform“ oder des je eigenen „semantischen Codes“ deuten, die durch den Globalisierungsprozess erzeugt wird: Je weiter dieser Prozess fortschreitet, d.h. je mehr die ökonomischen Beziehungen, die rechtlichen Strukturen und die kulturellen Produkte sich erweitern, angleichen und vermischen, desto weniger können diese stattfindenden Veränderungen in den jeweiligen Diskurs integriert werden, und umso mehr werden sie als Gefahr des Verlusts der eigenen Bedeutung gebenden Instanz verstanden. Diese Art der Globalisierungskritik verweist demnach auf einen Umschlagspunkt, wo die Herstellung des Weltmarkts, die Vereinheitlichung der Rechtsnormen und die Vermischung der Lebensweisen in die Bedrohung des je Eigenen umschlägt; wo also die Kraft der Kulturen schwindet, das 34 Alexander von Pechmann Andere in spezifischer Weise bedeutungsvoll zu integrieren, wo die Akkulturation in Dekulturation umschlägt und die Kommunikation und Kooperation abbricht. An die Stelle der Transformationen, Diffusionen und „Überlappungen“ (Ram A. Mall) tritt so der Bruch: Die Globalisierungsprozesse können nicht mehr als Erweiterungen der eigenen Handlungsmöglichkeiten gedeutet werden, sondern werden als feindselige Handlungen beurteilt, die gegen das Unverfügbare der eigene Kultur gerichtet sind, und die daher zur Verteidigung des je eigenen diskursbildenden Codes zwingen. Dieser Umschlagspunkt der Kooperation in Konfrontation folgt den „soziomoralischen Grundgesetzen“, wie sie K.O. Hondrich genannt hat, welche in der „Stunde der Gefahr“ greifen: der Präferenz für die eigene Kultur und der kollektiven Solidarität mit ‚seinesgleichen’.8 Unter der Bedingung verschiedener ‚Codes’ führt die Globalisierung offenbar zwangsläufig zum Konflikt der Kulturen. So hat sich etwa in Indien seit der Verabschiedung der Kongresspartei von der Politik des „Dritten Wegs“ und mit der Öffnung der Kapital- und Warenmärkte in den 90er Jahren eine Re-Hinduisierung der indischen Gesellschaft vollzogen. Die Sangh Parivar, das Netzwerk der Hindu-Organisationen, gewann in dem Maße Einfluss, in dem die indische Gesellschaft für die globalen Prozesse geöffnet wurde. Dieses Netzwerk lässt sich jedoch nicht als eine Kraft verstehen, die auf die Bewahrung vormaliger Zustände und Lebensweisen gerichtet ist, sondern ist eine, auch militant agierende, Organisation, die angesichts der Globalisierung für das Unverfügbare des eigenen, indischen Diskurses kämpft9. – In vergleichbarer Weise findet in Russland derzeit eine mit K.O. Hondrich, Unschuld und Sühne – Zum Sinn des Krieges, FAZ, 8.12.2001, 8. – Diese ‚soziomoralische Regel’ hat übrigens schon Herodot in den Historien III aufgestellt: „Wenn man alle Völker der Erde aufforderte, sich unter all den verschiedenen Sitten die trefflichsten auszuwählen, so würde jedes doch die eigenen allen anderen vorziehen. So sehr ist jedes Volk davon überzeugt, dass seine Lebensformen die besten sind.“ Ihr folgt auch der Kupferstich ‚Il retourne chez égaux’ (er kehrt zurück zu seinesgleichen), den Rousseau seiner „Abhandlung über die Ungleichheit“ voranstellte. Der Stich zeigt, wie ein Hottentotte, den die Holländer europäisch erzogen, in mehreren Sprachen unterrichtet und sogar bis nach Indien geschickt hatten, die europäische Kleidung ablegt, vor den Gouverneur tritt und erklärt, er wolle wieder zu ‚seinesgleichen’ zurückkehren. 9 Den ‚Umschlag’ von Kooperation in Konfrontation hat ein aufsehenerregender Artikel in der Hindu-Zeitschrift Organiser mit dem Titel: „Angry Hindu! Yes, why not?“ beredt zum Ausdruck gebracht: „My temples“, schreibt der anonyme Autor, „have been desecrated, destroyed. Their sacred stones are being trampled under the aggressor’s feet. My gods 8 Zur neuen Dimension der Globalisierungskritik 35 der Globalisierung einhergehende Umstrukturierung der politischen Landschaft statt, die das vormalige Rechts-Links-Schema der Politik abgelöst hat. Diese Umorientierung hat ihren signifikanten Ausdruck in der Erklärung der Kommunistischen Partei gefunden, wonach unter den Bedingungen der Globalisierung „die Hauptsache nicht [mehr] der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit“ sei, sondern „der weiter gefasste Widerspruch zwischen den Kräften von Kosmopolitismus und Patriotismus“10. Dieser „Patriotismus“ versteht sich jedoch nicht als eine konservative Bewegung zur Restitution der Vergangenheit – sei es des Zarenreichs oder der Sowjetunion –, sondern sieht sich im Kampf um die Selbständigkeit des eigenen Diskurses unter Globalisierungsbedingungen. – Ebenso zeigt der durch die islamische Kultur geprägte Raum nach dem Ende der Phase einer säkularen und nationalen Politik des „Dritten Wegs“ zwischen Kapitalismus und Sozialismus und seiner Einbindung in die Welthandelspolitik den Vorgang der Re-Islamisierung.11 Auch dieser Vorgang kann nicht als eine Wieder-holung are crying.“ Der Grund aber sei der gutgläubige Schlaf gewesen: „For so long – for too long – I was lost in a deep coma. I saw nothing. I heard nothing, felt nothing – even when my motherland was cut off... I now realise that I had been too good for this world of ‚hard reality’. I believed that others would respect my gods and temples as I respected other’s ... But alas, again and again I was deceived. I was betrayed, I was stabbed in the back ... I know now a bit of the ways in the world. And I have decides to speak to others in the language they understand ... And, finally, I have come to the value of my anger itself!“ (zit. nach: C. Six, Hindu-Nationalismus und Globalisierung. Die zwei Gesichter Indiens: Symbole der Identität und des Anderen, Frankfurt/Main 2001, 100 f.) – Auf das Neuartige dieses Diskurses verweist der indische Philosoph J. Alam in: Die Aneignung von Tradition. Koloniale und postkoloniale Debatten. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 4, Berlin 1999, 617-631. 10 zit. nach: G. Neunhöffer, Luxemburg in Russland. Warum es die Globalisierungskritik in der Ex-Sowjetrepublik so schwer hat. In: Blätter des Informationszentrums 3. Welt (IZ3W), Wo steht die Bewegung? Eine Zwischenbilanz der Globalisierungskritik, Freiburg 2002, 10. 11 Diese Parallelität hebt H. Fürtig hervor: „Historischer Zufall oder nicht, bestechend ist die zeitliche Übereinstimmung der Herausbildung und Reife dieser dritten Generation [islamischer Reformer] mit der rasant beschleunigten Globalisierung im ausgehenden 20. Jahrhundert... In der Quintessenz bedeutet dies, dass weder Kolonialismus noch Imperialismus den Muslim in seiner eigentlichen Substanz und Identität so gefährdeten wie die Globalisierung. Den Kolonial- wie den imperialistischen Mächten ging es um die Muslime als Arbeitskräfte und Konsumenten beziehungsweise (später) als ‚Verfügungsmasse’ im Kalten Krieg. Wenn sich im Verlauf der jahrzehntelangen Einflussnahme in den islamischen Ländern eine prowestliche beziehungsweise ‚verwestlichte’ Schicht herausbildete, so blieb sie doch immer Minderheit. Globalisierung durchdringt jedoch alle 36 Alexander von Pechmann vormaliger kultureller Zustände, sondern muss als eine neuartige Bewegung der Re-Etablierung des islamischen Diskurses unter Globalisierungsbedingungen verstanden werden.12 – Schließlich ist auch in der westlichen Kultur das bislang Selbstverständliche der Globalisierung ins Szenario des Kampfs ums Eigene umgeschlagen. Hier war die Zerstörung des Welthandelszentrums und der Angriff auf das Pentagon das Ereignis, durch das sich die westliche Kultur angesichts der Bedrohung durchs Böse zur Verteidigung des Eigensten, von „freedom, democracy, and free enterprise“13, herausgefordert sah. Seither scheint auch in der westlichen Kultur, insbesondere in den Vereinigten Staaten, der Vorgang einer Re-Ideologisierung stattzufinden, der die globalen Beziehungen nicht mehr nur nach Gesichtspunkten des Interesses und der Nützlichkeit, sondern nach moralischen Kriterien in „gut“ und „böse“14, und die globalen Akteure in „Freunde“ und „Feinde“ unterscheidet. So verstanden ist also die neue Dimension der Globalisierung weder diese selbst noch die ihr immanente Kritik. Vielmehr ist das eigentlich Neue der Konflikt, den die Globalisierung zwischen den Kulturen erzeugt, und der sich eben darum als so unerbittlich zeigt, weil es nicht mehr nur um dieses oder jenes Interesse, sondern um das Unverfügbare des je eigenen Diskurses geht.15 Lebensbereiche ...“ (Islam, Islamismus und Terrorismus. In: Utopie Kreativ 135, Berlin 2002, 22 ff.) 12 Auf das Post-nationale dieser Re-Islamisierung weist H. Mowlana, Professor an der School of International Service in Washington, hin: „In vielen Fällen hat der Staat als solcher in der Gesellschaftsstruktur keinen Platz mehr. Statt dessen gewinnen Gemeinschaftsführer wie die ‚ulama’ (religiöse Führer und Gelehrte) an Einfluss, da Regierungen dazu neigen, äußeren Einflüssen nachzugeben. So wurde ein ‚ulama’ wie Ayatollah Ruhollah Khomeini zum Vermittlungskanal zwischen Volk und Staat, der im Namen der ‚ummah’, aber auch der Nation agierte....“ (Die Vereinigten Staaten und der Islam: Ein Kulturkonflikt? In: IfA – Zeitschrift für Kulturaustausch 1/2002) 13 G.W. Bush: The National Security Strategy of the United States of America (NSS), Washington 2002. Introduction. zit. nach: www.whitehouse.gov/nsc/nssintro.html. 14 Vgl. G.W. Bush: „Some worry that it is somehow undiplomatic or impolite to speak the language of ‚right and wrong’. I disagree. Different circumstances require different methods, but not different moralities." (West Point, New York, 1.6.2002. zit. nach: www.whitehouse.gov/nsc/nss2.html). 15 Der Vollständigkeit halber sei in Bezug auf die „Asiatisierung Asiens“ auf den Artikel verwiesen: K.-G. Riegel, „Asiatische Werte“ – Asiatierungsdebatte im Kontext der Globalisierung. In: Zeitschrift für Politik 4, München 2001, 397-426. Zur neuen Dimension der Globalisierungskritik 37 3. mögliche Szenarien der künftigen Weltgesellschaft Geht man nicht wie die Modernitätstheorie davon aus, dass die genannten Konflikte und ihre Potentiale aus gewissen Anpassungsschwierigkeiten traditionaler Kulturen an den objektiven Geschichtsprozess der Modernisierung resultieren, sondern sieht in ihnen Gegensätze und Widersprüche, die durch diesen Prozess selbst erzeugt werden, so erscheinen angesichts der Konflikte (mindestens) drei Lösungsszenarien als möglich: a. Der „Vierte Weltkrieg“16; der Hobbes’sche Naturzustand eines künftigen Weltbürgerkriegs, der aus dem Zerfall der bisherigen nachkolonialen Weltordnung einhergeht. In diesem Zustand kämpfen freilich nicht mehr – wie im englischen Bürgerkrieg – Individuen oder Sekten um die Erhaltung ihrer Identität und auch nicht mehr – wie in der Zeit des Nationalismus und des (Anti-)Kolonialismus – Nationalstaaten um die Erhaltung oder die Gewinnung ihrer Souveränität, sondern die verschiedenen Kulturen, wie S. Huntington dies angenommen hat, die sich unter den Bedingungen der Globalisierung der Wirtschaftsweise, der Rechtsstrukturen und der Lebensweisen historisch erstmals im Kampf um die Erhaltung ihres je eigenen ‚Codes’ befinden. In diesem Kampf aber zählt nicht ‚das Recht’ oder die jeweilige ‚Wahrheit’, sondern allein der Erfolg. Und so wie Hobbes sagt, dass im Naturzustand der eine über mehr Kraft, der andere über mehr Verstand verfügt17, so mag in diesem Weltbürgerkrieg die eine Kultur ein Mehr an materiell-technischen Mitteln aufbringen, das die andere durch ein Mehr an geistigen oder spirituellen Ressourcen, oder an List, Mut oder Opferung des eigenen Lebens kompensiert.18 In diesem globalen Kampf um ‚Sein oder Nichtsein’ ist absehbar, dass sich unterschiedliche Koalitionen und Konfliktlinien bilden werden, und dass wohl die Kulturen untergehen werden, 16 So u.a. Eliot A. Cohen, Professor für Strategische Studien und Berater der USRegierung (Wall Street Journal, 20.11.2001). Betrachtet man allerdings die drei ersten Weltkriege als in ihrem Kern europäische Kriege, so wäre dieser der erste Weltkrieg. Er wäre, wie der Zapatistenführer Marcos behauptete, "ein wahrhaft planetarischer Krieg, der schlimmste und grausamste Krieg, und er wird vom Neoliberalismus gegen die ganze Menschheit geführt" (zit. nach: W.F. Haug: Weltkrieg gegen den Terror? In: www.gegenentwurf-muenchen.de/globterr.htm) 17 Th. Hobbes, Leviathan, 13. Kap., Stuttgart 1983, 112 f. 18 Vgl. dazu die Diskussion um die sogenannten „asymmetrischen Kriege“: M. van Crefeld, Die Zukunft des Krieges, München 1998; H. Münkler, Die neuen Kriege, Berlin 2002. 38 Alexander von Pechmann die nicht die Ressourcen aufbringen, ihre spezifische Diskursform unter den globalen Bedingungen aufrechtzuerhalten.19 Dieses Szenario wäre als ein globaler und weltbürgerlicher Zustand anzusehen, weil sich keine der Kulturen mehr dem Kampf um ihr Selbst entziehen kann; aber er ist kein friedlicher, weil weder eine Kultur den anderen ihren ‚Code’ aufzuzwingen vermag noch Prinzipien existieren, die allgemein anerkannt und gleichförmig ausgelegt und verstanden werden. In diesem Zustand ist vielmehr jede Partei gleichsam in die Höhle ihres „kulturellen Selbsts“ verstrickt und kann daher die anderen nur als dessen (potentielle oder aktuelle) Bedrohung wahrnehmen. b. Der Verzicht auf Globalisierung und der Rückzug des jeweiligen Imperiums auf die von ihm beherrschbare Sphäre. Ein solcher Zustand der globalen Befriedung durch eine Art der Limesbildung entspräche, historisch gesehen, dem „Westfälischen Frieden“, der den europäischen Bürgerkrieg beendete. Freilich müsste für die Befriedung des Konflikts heute der umgekehrte Satz gelten: cuius religio, eius regio. Die Welt würde so aufgeteilt in verschiedene, von einander abgeschottete Sphären, in denen jeweils ein anderer Code herrscht: das Kapital, Allah, Mamotschka Rossia usw. – Allerdings erscheint diese Art der Konfliktlösung durch die Aufteilung des globalen Raumes in ein je ziviles ‚Innen’ und ein barbarisches ‚Außen’ als wenig wahrscheinlich. Denn der Verzicht auf Globalisierung entspränge so nur einer äußeren machtpolitischen Konstellation oder einer momentanen Interessenlage; er gehorchte nur der Not, aber nicht dem eigenen Trieb, weil zumindest der westlichen Kultur, wie angenommen, die Universalisierung ihres ‚Codes’ wesenseigen, und sie daher grenzenüberschreitend ist. Für sie ist die Moderne, wie es drohend heißt, ein allemal „unvollendetes Projekt“. c. Als dritte – und intellektuell wohl interessanteste – Lösung wäre der gleichsam „Hegelsche Zustand“ der Anerkennung denkbar, der aus dem Kampf der Kulturen um Anerkennung selbst hervorgeht. Ein solcher künf19 Den monotheistisch geprägten Kulturen dürfte es in diesem globalen Kriegszustand leichter fallen als anderen, ein klares und deutliches Bild sowohl für das Eigene als auch für das bedrohlich Fremde zu finden: das Satanische als das moralische Gegenprinzip, vorgestellt als „Schurke“ oder „Terrorist“ oder als der „Große Verführer“. Schwerer freilich dürften sich Kulturen tun, die auf keinen solchen moral-ontologischen Dualismus gegründet sind und daher Schwierigkeiten haben, sowohl ihr ‚Selbst’ als auch den ‚Feind’ klar zu benennen. Zur neuen Dimension der Globalisierungskritik 39 tiger Zustand lässt sich heute jedoch nicht mehr geschichtsphilosophisch als das zu erwartende, zu erhoffende oder zu prognostizierende ‚Ende’ oder ‚Ziel der Geschichte’ antizipieren. Denn in diesem Kampf der Kulturen ist es ja gerade umstritten, was denn das „übergreifend Allgemeine“ sei, das sich im Antagonismus des Partikularen verwirklichte.20 Insofern zeigen die Fehlprognosen, die vom „Ende der Geschichte“ erzählt haben, dass die Zukunft der Menschheit offenbar nicht mehr wie im europäisch-westlichen Kontext als ein künftiger Sieg der „Vernunft“ über die Mächte der Unvernunft oder der „Freiheit“ über die Gewalten der Unfreiheit gedacht werden kann. Ein solcher Zustand der Anerkennung müsste vielmehr – hegelisch gedacht – aus der Not des Kampfes der Kulturen selbst hervorgehen.21 Er müsste in der Unausweichlichkeit gegründet sein, die sie zwingt, ihr Selbst aufzugeben, d.h. „das eigene Heiligste“, wie Ulrich Beck dies formuliert hat, „für die Kritik durch andere (zu) öffnen“.22 Und er kann nicht darin bestehen, in den anderen Kulturen nur das Gleichartige zu erkennen, sondern darin, diese in ihrer Andersartigkeit und Fremdheit, d.h. in ihrem Selbstsein, anzuerkennen.23 Ein solcher Zustand der gegenseitigen Anerkennung aber 20 Dem entspricht, wenn H. Mowlana den Westen in Hinblick auf die islamische Kultur warnt: „Letztendlich wird es Aufgabe des Westens und besonders der Vereinigten Staaten sein, sich mit den Tatsachen der modernen Welt anzufreunden und die Grundsätze und die Geschichte anzuerkennen, auf die sich die islamische Zivilisation gründet. Jeder Versuch des Westens, die innere Veränderung der islamischen Welt zu beschleunigen oder zu modifizieren, wird aller Wahrscheinlichkeit nach in einer Katastrophe enden.“ (Die Vereinigten Staaten und der Islam, a.a.O.) 21 In der „Phänomenologie des Geistes“ beschreibt Hegel den Kampf um Anerkennung folgendermaßen: „Das Verhältnis der Selbstbewußtseine ist also so bestimmt, dass sie sich selbst und einander durch den Kampf auf Leben und Tod bewähren. – Sie müssen in diesen Kampf gehen, denn sie müssen die Gewissheit ihrer selbst, für sich zu sein, zur Wahrheit an dem andern, und an ihnen selbst erheben ... Das Individuum, welches das Leben nicht gewagt hat, kann wohl als Person anerkannt werden; aber es hat die Wahrheit seines Anerkanntseins als eines selbständigen Selbstbewusstseins nicht erreicht.“ (Frankfurt/Main 1970, 116) 22 U. Beck, Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus – Antworten auf die Globalisierung, Frankfurt/Main 1997, 149. 23 Diese andere Art der Anerkennung beschreibt J. Habermas in „Die Einbeziehung des Anderen“, die er allerdings nicht auf Kulturen, sondern auf Personen bezieht: „Der gleiche Respekt für jedermann erstreckt sich nicht auf gleichartige, sondern auf die Person des Anderen oder der Anderen in ihrer Andersartigkeit.“ (Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie, Frankfurt/Main 1996, 7: H.v.m) 40 Alexander von Pechmann bedürfte, kontrafaktisch, eines gleichsam transkulturellen Perspektivenwechsels, der nicht mehr nur vom Eigenen aus sich und andere erkennt, sondern der auch „von dem Eigenen des Anderen aus(geht) und von ihm aus den Blick zurück auf das Eigene ... richte(t)“.24 Ein solcher auf die gegenseitige Anerkennung der Anderen in ihrer Andersartigkeit gegründeter „planetarischer Vertrag“ mag angesichts der gegenwärtigen Konflikte heute als ein Sollens-Prinzip formuliert und postuliert werden können. Was er aber in concreto als ein künftiger Vertragszustand bedeuten könnte, scheint nur als das mögliche Resultat des Kampfes der Kulturen bestimmbar zu sein.25 Denn ein solcher Zustand der gelungenen Anerkennung setzt nicht nur die Kenntnisnahme der anderen Kulturen voraus, sondern auch die Existenz eines transkulturellen und gemeinsamen Codes, der die globalisierte Welt zu Einem Diskurs formiert. Dieser aber fehlt heute; und sein Fehlen provoziert den Kampf der Kulturen. 24 So J. Matthes in: Interkulturelle Kompetenz. Ein Konzept, sein Kontext und sein Potential. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 3, Berlin 1999, 415. – Zu diesem Perspektivenwechsel genügt daher nicht, wie J. Galtung in Bezug auf die westliche Kultur selbstkritisch meint, „sich im eigenen Spiegel zu betrachten“ (Die Zukunft der Menschenrechte. Vision: Verständigung zwischen den Kulturen, Frankfurt/Main 2000, 138). Er muss vielmehr über das Selbstbezügliche hinaus den Zwang enthalten, sich auch im Spiegel des Anderen zu betrachten. 25 Die Schwierigkeit, einen solchen Vertrag zu formulieren, dürfte nicht zuletzt in der Aporie bestehen, daß er als Vertragszustand auf der Gemeinsamkeit, als Zustand der Anerkennung jedoch auf der Andersartigkeit des Gewollten gründen müßte. Wolfgang Melchior Die Alte Weltordnung: die Neugestaltung der Welt nach Kulturen Denn wenn man einmal mit dem Einfluss entweder gesellschaftlicher oder natürlicher Zufälle auf die Verteilung unzufrieden ist, dann wird man durch Nachdenken dazu geführt mit beidem unzufrieden zu sein. Vom moralischen Gesichtspunkt aus erscheint beides als gleich willkürlich. John Rawls, Theorie der Gerechtigkeit Thema dieser Untersuchung ist eine Kritik der Globalisierung aus einem anderen Blickwinkel. Ich greife hier nicht bestimmte empirische Entwicklungen auf und an, wie dies andere Autoren mit größerem Sachverstand bereits getan haben und es täglich tun. Vielmehr hat dieser Artikel eine Theorie der globalisierten Welt zum Gegenstand, deren self-fulfilling prophecy – so die Hypothese – zu einem Konfliktpotenzial ungeheueren Ausmaßes geführt hat und weiter führen wird. Insofern verschiebe ich hier die Themenstellung von einer Kritik der Globalisierung hin zu einer Kritik der führenden Theorie der Globalisierung, für die momentan einige Evidenz zu sprechen scheint. Das Unternehmen möchte ich als ideologiekritisch bezeichnen. Die neuen Verteilungskonflikte, wirklich neu? Politische Auseinandersetzungen, ob friedlich oder kriegerisch ausgetragen, waren schon immer Verteilungskämpfe. Während des Kalten Krieges bedeutete Globalisierung nichts anderes als die möglichst große Ausweitung von Einflusssphären zweier unterschiedlicher politisch-ökonomischen Systeme. Die Ontologie der Verteilung und ihre Kriterien waren klar: verteilt wurden Primärgüter (Macht, Geld, Güter, Ressourcen) auf Nationalstaaten, die sich entweder dem einen oder anderen Block zurechneten. Die Kohäsion innerhalb der Blöcke wurde durch freiwillige Partizipation (freiwillige Assoziation durch Vertrag aufgrund zweck-mittel-rationaler Überlegungen) hergestellt oder durch unmittelbare (militärische) Bedrohung oder mittelbar ökonomische Druckmittel erzwungen. Im Kalten Krieg hatten die meisten 42 Wolfgang Melchior Staaten die Wahl zwischen wenigstens drei Alternativen: Ost, West oder blockfrei. Mit dem Ende des Kalten Krieges verlaufen die Konfliktlinien neuer Verteilungskämpfe heute nicht mehr zwischen Blöcken mit unterschiedlichen politischen und ökonomischen Systemen, sondern entlang ethnisch-religiös geprägter Kulturkreise. Das neue Verteilungsspiel findet nicht mehr zwischen zwei Wirtschaftssystemen, sondern zwischen Kulturen oder kulturell identifizierbarer Ethnien statt. Allerorten wird der Kampf der Kulturen ausgerufen. Das behaupten zumindest die Vertreter von Theorien, die in dieser Untersuchung thematisiert werden sollen. Sie sollen im Folgenden mit dem Begriff kulturessentialistische Theorien bezeichnet werden. Diese Untersuchung setzt sich drei Aufgaben: 1. Zum ersten beschäftigt sie sich mit der Analyse dieser kulturessentialistischen Theorien. 2. In einem zweiten Schritt wird die theoretisch-philosophische Verortung dieser Theorien vorgenommen und gezeigt, dass sie im Kommunitarismus liegt. Ergebnis wird sein: Kulturessentialistische Theorien a la Huntington sind die konsequente einzelwissenschaftliche Weiterentwicklung des kommunitaristischen Paradigmas. 3. Schließlich wird gezeigt werden, dass und inwiefern dieses Paradigma erstens nur als ein ideologischer Reflex der gegenwärtigen globalen Konflikte gelten kann (vor allem weil es Ursache und Wirkung verwechselt oder anders: die Epiphänomene für die Causa nimmt) und dass bzw. inwiefern es zweitens nicht zur Lösung dieser selbstgeschaffenen Konflikte beitragen kann. Dabei werden zwei Hypothesen aufgestellt und mit Plausibilität angereichert: der Kommunitarismus besitzt nicht den Status einer deskriptiven Theorie und er bietet keine echte Theorie der Verteilungsgerechtigkeit. 1. Was sind kulturessentialistische Theorien? Wenden wir uns zunächst den Theorien zu, die ich als kulturessentialistisch bezeichne. In ihnen treten nicht mehr Individuen (Liberalismus) oder soziale Klassen (Marxismus) als Akteure von Verteilungskonflikten, sondern ethnisch-kulturell geprägte Ganzheiten auf. Die Alte Weltordnung: die Neugestaltung der Welt nach Kulturen 43 Ergebnisse dieser kulturessentialistischen Theorien sind bereits in die Einzelwissenschaften eingedrungen: In der Geschichtswissenschaft erklärte Goldhagen den Holocaust mit dem Begriff eines in der deutschen Kultur tief verankerten eliminatorischen Antisemitismus und nennt seinen Ansatz anthropologisch1; Politologen reden vom Kampf der Zivilisationen, um die New World Order in den Griff zu bekommen2; Vertreter der NIE (New Institutional Economics) unter Ökonomen wenden sich den sog. non-price institutions zu3 und entdecken den Zusammenhang von Ethnizität und Ökonomie4; und auch Soziologen und Psychologen entdecken neuerdings die Grenzen des liberalen Individualisierungsbegriffs und betonen die „solidarische Bezogenheit“ des einzelnen, seine Einbettung in gemeinschaftliche Wertsysteme.5 Nicht zuletzt hat die Ethnologie, gerade in den USA und Deutschland, den Kulturbegriff wiederentdeckt6. Gemeinsam sind allen diesen Theorien wenigstens folgende Annahmen: - Eine essentialistisch-deterministische Auffassung von Kultur und Gemeinschaft: Kultur bzw. die in einer Gemeinschaft geteilten, tradierten Wertüberzeugungen sind für die Mitglieder dieser Gemeinschaft ein hinreichend identitätsstiftendes Moment. Pointierter gesagt vertreten diese Theorien das Primat der Kultur in bezug auf Identitätsbildung. 1 Goldhagen: Hitler’s Willing Executioneers, 1st ed., New York 1997. Ich möchte Goldhagens Ansatz hier weder stützen noch kritisieren. An dieser Stelle kommt es lediglich darauf an, den Bezug zum kulturessentialistischen Theoriengeflecht herzustellen. „Anthropology“, insbesondere die „Cultural Anthropology“, werden in den USA alle Ansätze genannt, die hierzulande innerhalb der Kulturethnologie abgehandelt würden. 2 S.P. Huntington: The Clash of Civilizations. Remaking of New World Order, New York 1996. 3 Stellvertretend hierfür: J. Buchanan. 4 siehe Thai Landa: Trust, Ethnicity and Identity. Beyond the New Institutional Economics of Ethnic Trading Networks, Contract Law, and Gift Exchange, Ann Arbor 1995; Joel Kotkin: Tribes. How Race, Religion, and Identity Determine Success in the New Global Economy, New York 1993. Review unter: http://wjcohen.home.mindspring.com/otherclips/tribes.htm. 5 Vgl. die Arbeiten von U. Beck und H. Keupp. 6 siehe C. Bruman: Writing for Culture. Why a successful Concept should not be discarded, in: Current Anthropology, 40, Febr. 1999, Supplement, 1-27. Man beachte auch den sich anschließenden Kommentarteil, der ein guten Überblick über Pro- und Against-Culture-Vertreter in der Ethnologie gibt. Nicht unerwähnt bleiben soll in diesem Zusammenhang auch die Schaffung völlig neuer Fächer wie „Interkulturelle Kommunikation“ in den 90er Jahren, so etwa geschehen an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. 44 Wolfgang Melchior - Eine holistische und platonistische Auffassung von Gesellschaftlichkeit: im vorigen Absatz wurde nur von Gemeinschaft anstatt Gesellschaft geredet. Das hatte seinen Grund: der Begriff der Gesellschaft im engeren Sinne soll im Folgenden als rein nominalistisches Universum verstanden werden. Im Sinne der liberalistischen Ideentradition (Hobbes, Locke, Smith, Bentham, Mill, Kant, Rawls; Kantianismus, Utilitarismus, Spieltheorie) soll der Begriff der Gesellschaft nur als Aggregat von Individuen und deren Einzelinteressen aufgefasst werden (auch mereologische Vorstellung von Gesellschaft genannt). Demgegenüber soll Gemeinschaft ein holistisches und platonistisches Universum7 bezeichnen, in dem das Ganze mehr als die Summe ihrer Einzelinteressen umfasst und dieses Ganze die konkreten Einzeldinge transzendiert. Das über die mereologische Summe Hinausweisende ist nichts anderes die Kultur selbst. In ihre Geschichte und Tradition ist die Gemeinschaft eingebettet. - Diese definitorische Unterscheidung mag im Deutschen vielleicht arbiträr erscheinen, bezieht sich jedoch auf die im Englischen selbstverständliche Unterscheidung zwischen society und community. Kulturtheorien vertreten stets eine platonistische Ontologie, und Gemeinschaft bezeichnet dabei ein holistisches Ganzes. - Die Auffassung von Kultur und Gemeinschaft als einem mehr oder weniger geschlossenen Ganzen (Kulturmonadismus), welches Nationalstaaten, Gesellschaften und andere bekannte soziale Entitäten übergreift. Kultur ist weder ein Luhmannsches soziales System innerhalb einer Gesellschaft noch ist sie eindeutig bestimmten Individuen zuzuordnen. - Die traditionalistische Auffassung von gemeinschaftlicher Kohäsion: die kohäsiven, den Zusammenhalt einer Gemeinschaft sichernden Merkmale liegen nicht in ihrer Integrationskraft und der Universalisierbarkeit ihrer Werte, sondern in ihrer Ethnizität und Religion. Kulturtheorien ist die Betonung von Geschichtlichkeit und Tradition wichtig. - Die daraus folgende Überzeugung, dass ein Werteuniversalismus nicht haltbar ist: oder umgekehrt die Überzeugung, dass nur partikularistische Wertesysteme Geltung haben. Bestritten wird hier die Geltung einer universalisti- 7 Ich verwende hier den Begriff des Platonismus nach W. Stegmüller: Das Universalienproblem einst und jetzt, Darmstadt 1978. Die Alte Weltordnung: die Neugestaltung der Welt nach Kulturen 45 schen Ethik, also von Normen, die unabhängig von einer bestimmten Kultur und Gemeinschaft begründet werden können. - Die Überzeugung, dass die – frühere und/oder heutige – Konflikte (conflict, clash oder Kampf) kulturell verursacht sind: Dies wird einmal in trivialer Weise so verstanden, dass es nun einfach Kulturen als ganze sind, die an den globalen Verteilungskämpfen teilnehmen (die neuen Spieler im Verteilungskampf), und zum zweiten in einer kulturfundamentalistischen Weise so, dass Kulturen einander genuin widersprechende, auf Selbsterhaltung und in einem Hobbes’schen Kampf ums Überleben stehende Entitäten sind.8 2. Wes Geistes Kind? Der Kommunitarismus macht Karriere Im Folgenden soll gezeigt werden, dass diese Klasse von Überzeugungen ihren philosophisch-theoretischen Ort und Ursprung im Kommunitarismus finden. Dort wurden bereits Ende der 70er Jahre die Weichenstellungen gesetzt, nach denen heute die Fahrpläne der Einzelwissenschaften gestrickt sind. Kulturtheorien essentialistischer Provenienz, wie sie oben kurz charakterisiert wurden, sind Ergebnis eines kommunitaristischen Siegeszugs. Zentraler Ausgangspunkt kommunitaristischer Betrachtungen war die Frage nach der Identität. Der Paradigmenwechsel, der hier stattfand, war von der Theorie der individuellen Wahl autonomer Individuen hin zu einer essentialistischen Theorie von Mitgliedschaft. Dieser Weg soll hier kurz abgegangen werden. Der Angriff der Kommunitaristen galt zunächst der Theorie des liberalen Selbst. M. Sandel hatte in seinem Werk Liberalism and the Limits of Justice (1974) das liberale Selbst als un-encumbered, atomistisch und freischwebend kritisiert. Vielmehr, so Sandel, sei das Individuum von Geburt an eingebettet in eine Vielzahl gesellschaftlicher Zusammenhänge. Der Kommunitarismus hielt der liberalen Theorie des autonomen Subjekts schlicht die gesellschaftliche Praxis entgegen9. 8 9 Diese Auffassung vertritt etwa A.v. Pechmann in dieser Nummer. Als ob die modernen Theoretiker des Liberalismus wie J. Rawls dies nicht selbst gewusst hätten: die Theorie des autonomen Selbst sollte einen methodologischen Zweck innerhalb des liberalistischen Systems erfüllen und war niemals als adäquate deskriptive Theorie von Gesellschaft gemeint. Siehe dazu auch M. Walzer: The Communitarian Crique of Liberalism, in: Political Theory, Vol. 18, No.1, 1990, 6-23. 46 Wolfgang Melchior Nach der Kritik des liberalen Selbst wandte sich der Kommunitarismus dann daran, eine eigene Theorie von Verteilungsgerechtigkeit aufzubauen. Ihr Ergebnis war die Beseitigung des Prinzips individueller Wahlfreiheit und ihre Ersetzung durch das Prinzip der kommunitären Mitgliedschaft. Im einem ersten Schritt wurde Mitgliedschaft (membership) als Primärgut definiert. In M. Walzers Gerechtigkeitskonzept der Komplexen Gleichheit fungiert Mitgliedschaft als Primärgut, als Bedingung der Möglichkeit von Verteilung10. Dass dies nicht in einem trivialen Sinne verstanden werden darf, wurde in einem zweiten Schritt durch die Anreicherung des Gemeinschaftskonzepts deutlich. Heute, glaubt man den Kommunitaristen, hat der einzelne keine Wahlfreiheit mehr (Walzer: „Wir sind nicht frei geboren“), sondern er ist, aufgrund seiner Geschichte, seiner Religion und nicht zuletzt seiner Kultur, bereits determiniert durch die pure Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft. Einfach gesagt: wer in einer christlichen, jüdischen oder islamischen Gemeinschaft geboren wird, hat schlichtweg gar keine andere Wahl als eine christliche, jüdische oder islamische Identität zu entwickeln. Mit der Kantischen Autonomie (zuletzt noch von J. Rawls vertreten) wurde derart gründlich aufgeräumt, dass heute nur noch vom unverfügbaren Zwang oder unfreiwilligen Assoziationen die Rede ist: „Es gibt vier Arten unverfügbarer Zwänge ... Alle werden bereits sehr früh in unserem Leben errichtet. Sie drängen uns, ja zwingen uns in Assoziationen einer bestimmten Art hinein.“11 Ein paar Absätze weiter lesen wir: „Der zweite Zwang besteht in der kulturellen Determiniertheit der verfügbaren Assoziationsformen.“12 Während postmoderne Theorien noch dem Wunschtraum nachh(ä)ingen, (alle?) Individuen könnten sich ihre Identität und die Wiesen ihrer sozialen Interaktion frei und patchworkartig (H. Keupp) zusammenbasteln oder Posttraditionalisten uns glauben machen woll(t)en, Tradition sei zur bloßen Sitte und Gewohnheit geronnen (A. Giddens), haben Kommunitaristen die10 Vgl. hierzu M. Walzer: Spheres of Justice, 1983, 33: “The primary good that we distribute to one another is membership in some human community.” Es darf an dieser Stelle betont werden, dass Walzer sicherlich zu den most liberal communitarians gehört. Der argumentativen Fairness halber habe ich Walzer als exemplarisch für die kommunitaristische Theorie herangezogen. 11 M. Walzer: Vernunft. Politik und Leidenschaft. Defizite liberaler Theorie, Frankfurt 1999, 13. 12 Ebd., 17. Die Alte Weltordnung: die Neugestaltung der Welt nach Kulturen 47 sen Individuen bereits ein kulturelles Apriori übergestülpt und sammeln posttraditionalistische wie postmoderne Theorien als Teil einer westlichen Gemeinschaft wieder ein. In der Ausweitung ihrer Kritik bestritten Kommunitaristen den universalen Geltungsanspruch von Normen, wie er von der liberalistischen Ideentradition vertreten wurde. Das war nur konsequent: in einer Ontologie, in der die Akteure nicht gleiche und freie Individuen oder Gesellschaften, sondern ungleiche, durch je unterschiedliche Kulturen determinierte Gemeinschaften sind, kann es keine universell gültigen Normen geben. Deswegen vertreten Kommunitaristen eine partikularistische Auffassung von Normenbegründung. Ethische Normen sind nicht nur auf dem Boden einer bestimmten Gesellschaft verstehbar, sondern auch nur innerhalb dieser gültig. Walzer hat dies eindrucksvoll in seinem Werk „Interpretation and Social Criticism“ dargelegt. Die Alternativen sind klar: hie individuelle Autonomie, dort gesellschaftlich-kulturelle Determination, hie Universalismus, dort Partikularismus. Der Kulturessentialismus ist damit nur mehr eine Spielart des Kommunitarismus oder wenn man so will, seine konsequente einzelwissenschaftliche Weiterentwicklung. Hierbei sind drei Entwicklungen zu beobachten: - zum einen wird der Begriff der Gemeinschaft immer enger mit dem Kulturbegriff verknüpft, - zum zweiten wird der Kulturbegriff immer intensiver religiös und ethnisch aufgeladen, - zum dritten wird immer mehr der antagonistische Charakter von kulturellen Gemeinschaften betont. Bestanden die ersten beiden Punkte in der direkten Anwendung kommunitaristischer Vorgaben, so ist der letzte Punkt einem Mangel kommunitaristischer Theorien geschuldet. Hatte die nominalistisch-liberale Theorie kein Problem, ihre Verteilungsgrundsätze nicht nur innerhalb, sondern auch zwischen Gesellschaften anzuwenden, indem sie einfach die Akteure nicht mehr mit Individuen, sondern mit Staaten identifizierte13, wird dies für 13 In utilitaristischen oder spieltheoretischen Betrachtungen tauchen die Akteure oder Mitspieler nicht mit bestimmten oder besonderen, sondern abstrakten Merkmalen auf. 48 Wolfgang Melchior kommunitaristische Theorien zum genuinen Problem. Gemäß des Mitgliedschaftsprinzips kann Verteilungsgerechtigkeit nur innerhalb von Gemeinschaften Anwendung finden. Die Anwendung dieser Prinzipien auf interkommunitäre Beziehungen ist nach kommunitaristischem Universalisierungsverbot untersagt. So ist es kein Wunder, dass sich kommunitaristische Ansätze bis dato weitgehend zum Problem internationaler Verteilungsgerechtigkeit, ja internationaler Konfliktlösungen per se ausgeschwiegen haben.14 Wendet man jedoch Walzers System Komplexer Gleichheit trotzdem auf internationale Verteilungskonflikte an, so erlaubt es nicht nur maximale Ungleichheit, sondern stellt auch keinen Mechanismus bereit, unter dem umstrittene Güter verteilt werden sollen. Im System Komplexer Gleichheit gelten lediglich zwei Prinzipien: Das Dominanzverbot und die Erlaubnis zum Monopol. Einzig untersagt ist es Güter, die in einer der insgesamt 11 Sphären (Mitgliedschaft, Sicherheit, Wohlstand, Geld und Waren, Ämter, Arbeit, Freizeit, Erziehung, Sippe und Liebe, Anerkennung, politische Macht sowie göttliche Gnade) angehäuft wurden, dazu zu verwenden, Güter in anderen Sphären zu erwerben. Dagegen sind Monopole ausdrücklich erlaubt, allerdings nur innerhalb ein und derselben Gütersphäre. Kulturessentialistische Theorien haben diesen Mangel aufgegriffen und reagieren konsequenterweise mit dem Konzept der Kampf der Kulturen. Wo es keine Verfahren gibt, nach denen Kulturen umstrittene, knappe Güter verteilen sollen, bleibt nur noch der Kampf oder ein andauernd schwelender Konflikt. Bis hierhin dürfte also klar geworden sein: Der theoretische Ort heutiger kulturessentialistischen Theorien liegt im Kommunitarismus. Er hatte den Begriff Gemeinschaften als essentialistische, holistische und deterministische Entitäten in den Gesellschaftswissenschaften15 verankert. Entscheidend für sie ist, dass alle Mitspieler mit gleichen Voraussetzungen ausgestattet sind. 14 In diesem Zusammenhang vielleicht verdächtig, wenn auch nicht hohe argumentative Kraft beanspruchend, sei erwähnt, dass einzig M. Walzer sich diesem Thema in seinem Werk „Just and Unjust Wars“ (1977) angenommen hat. 15 Ein kleiner Treppenwitz der Geschichte: Was früher „Gesellschaftswissenschaften“ hieß, soll heute nur mehr „Kulturwissenschaften“ heißen. Die Alte Weltordnung: die Neugestaltung der Welt nach Kulturen 49 Der Kommunitarismus selbst vertritt keine politische Theorie eines Kulturkampfes, diente dieser aber durch zwei Umstände als Steigbügelhalter: zum einen besitzt er keine Theorie der Verteilungsgerechtigkeit und besitzt deswegen auch keine Theorie zur Lösung von Verteilungskonflikten. Zum anderen hat er diesem Mangel niemals ausdrücklich abgeholfen und sich über Konfliktlösungsprinzipien ausgeschwiegen – kein Wunder, verbot ihm dies doch seine genuin partikularistische Normentheorie. Durch den Nebel hindurch die globalen Konflikte sehen Exkurs: die europäische Verwirrung Die Stärke kommunitaristisch-kulturessentialistischer Ansätze liegt nun darin, dass sie für die europäische Linke wie konservative Rechte attraktiv erscheinen muss. Die Linke sieht in ihnen ein langersehntes Instrument, mit der bürgerlichen Ideologie des autonomen Subjekts aufzuräumen. Das Primat des Gesellschaftlichen wird dann auch weniger als Vorrang kultureller Wertesysteme (Überbau) als vielmehr bestimmter ökonomischer Systeme (Sein) verstanden16. Die Rechte hingegen reinterpretiert die Idee vom Primat der Gemeinschaft als kohäsive Volksgemeinschaft und sieht im Kommunitarismus den Partner der Idee, dass die Zugehörigkeit zu einer Wertegemeinschaft vor anderen Konzepten der Identitätsbildung (soziale Klasse, liberales Individuum) Vorrang habe. Die Verwirrung ist haarsträubend; sie fing damit an, den ethnischkulturellen Begriff der Gemeinschaft (community) mit dem der politischen Begriff der Gesellschaft (society) zu verwechseln. Für die amerikanischen Väter des Kommunitarismus war dieser Unterschied ebenso selbstverständlich wie das in der amerikanischen Geschichte tief verankerte Verständnis für die Beziehung zwischen ethnisch-kulturellen Gemeinschaften und der civil society17. Solche Beziehungen existieren in der europäischen Geschichte 16 So etwa verstehe ich E. Treptows Verteidigung des Kommunitarismus in seinen Seminaren an der LMU München. 17 Vgl. hierzu H. Joas: Gemeinschaft und Demokratie in den USA. Die vergessene Vorgeschichte der Kommunitarsimus-Diskussion, in: M. Brumlik/H. Brunkhorst (Hg): Gemeinschaft und Gerechtigkeit, Frankfurt/Main 1993, 3-11: „Aber der große Unterschied [des Kommunitarismus in den USA und Europa] liegt darin, daß der Diskurs über die Gmeinschaft in den USA Bestandteil der Selbstverständigung einer liberalen Gesellschaft war und ist, während er in Deutschland – und das ist unabhängig von der Ge- 50 Wolfgang Melchior schlichtweg nicht. Weitere Schieflagen entstanden, als verschiedene Ergebnisse des Kommunitarismus aufgegriffen wurden: Soziales Engagement, Selbsthilfe, Bürgergesellschaft waren Schlagworte, mit denen die sog. low communitarians (Etzioni et al.) die Theorie des big government der liberals angriffen und die communities der USA wieder auf ihre eigenen Strukturen zurückführen wollten. Übertragen auf Europa wurden daraus genau die Forderungen nach Sozialabbau, Eigenengagement und Selbsthilfe, die heute sozialdemokratische von konservativer Politik kaum mehr unterscheiden lassen. Konnte man jedoch den Kommunitarismus noch als inneramerikanische Debatte abtun, so ist er heute durch seine – geographische wie theoretische – Expansion im Gewande des Kulturessentialismus nicht mehr zu übersehen. 3. Zur Kritik eines „Kampfs der Kulturen“ Die kulturessentialistischen Theorien sind realer Schein, ideologisches Abbild des Vorgefundenen. Wahr ist, dass sich tatsächlich die Verteilungskämpfe weltweit zunehmend nach kulturellen Mustern ausrichten. Falsch jedoch ist, dass kulturelle Verschiedenheit deren Ursache sind. Die wahren neuen Konfliktlinien verlaufen zwischen Globalisierungsgewinnern und Globalisierungsverlierern. Kultur kommt erst dann ins Spiel, wo sie als kohäsive und schlagkräftige Macht diesen Verlierern im politischen Kampf nützlich erscheint. Kulturessentialistische Theorien verwechseln deswegen die politischen Instrumente und die Oberflächenphänomene mit den ökonomischen Ursachen der Konflikte. Kulturessentialistische Theorien greifen diese Ideologien auf und nehmen den gesellschaftlichen Schein für bare Münze. 3.1 Ein immanentes Argument Wenn – ceteris paribus – Kulturen tatsächlich die Ursache moderner Verteilungskämpfe sein sollen und sie historisch invariante Merkmale aufweisinnung der einzelnen Beiträger – über einen langen Zeitraum im Rahmen einer im wesentlichen illiberalen Gesellschaft stattfand“. Ebenso L. Probst: Gesellschaft vs. Gemeinschaft? Zur Tradition des dichotomischen Denkens in Deutschland, in: Politik und Zeitgeschichte, B 36/37, 30. August 1996, 1319. Die Alte Weltordnung: die Neugestaltung der Welt nach Kulturen 51 sen18, dann darf gefragt werden, warum nicht die gesamte Geschichte eine Geschichte von Kulturkämpfen ist. Soweit ersichtlich, vertritt nämlich keine kulturessentialistische Theorie diese Konklusion. Der Grund ist klar: die einzig konsequenten Theorien des Kulturkampfes sind die eines Oswald Spengler oder Rassentheorien, wie sie Ende des vorletzten und Anfang des letzten Jahrhunderts formuliert wurden. Vor dieser theoretischen Konsequenz scheuen die Kulturessentialisten und Kommunitaristen ganz offensichtlich zurück. Auf diesen Einwand könnten Kulturessentialisten/Kommunitaristen den Ball des ceteris paribus auffangen, indem sie auf die neue globale Situation verweisen. Zum ersten Mal in der Geschichte fänden sich heute alle Kulturen in einem gemeinsamen Raum wieder (One World Argument). Was früher nebeneinander koexistierte, sehe sich heute plötzlich in einen Zusammenhang gestellt. Doch auch dieser modifizierte Kulturessentialismus auf globaler Basis geht nicht auf: denn der gemeinsame Raum, die One World betrifft ja nicht nur die Kulturen, sondern auch Wirtschaft, Politik, Tourismus und viele weitere Sphären. Ebenso gut könnte man behaupten, der Tourismus sei die Ursache moderner Konflikte, weil es zum ersten Male einen Massentourismus in globalem Maßstab gibt. Anders ausgedrückt: das Faktum der One World, das die Globalisierung geschaffen hat, ist kein hinreichender Grund zur Erklärung der Kämpfe. Und es darf weiterhin gefragt werden, warum manche Kulturen in diesen globalen Verteilungskämpfen gar nicht als Teilnehmer auftreten? Wenn nämlich das universe of discourse der Verteilungskämpfe aus Kulturen besteht, dann müssen auch alle Kulturen dort als Akteure auftreten. Spieltheoretisch ausgedrückt: manche Kulturen werden offensichtlich nicht als Mitspieler anerkannt. Eine Begründung dafür findet man bei kulturessentialistischenkommunitaristischen Theorien vergebens, müssten sie doch zu folgendem Ergebnis kommen: wichtig für den Status als Akteur im Verteilungskampf ist nicht ihr kulturelles Sein, sondern das politische und ökonomische Interesse des Weltmarktes an ihren Produkten und Ressourcen. Und ergo 18 Historische Invarianz scheint zumindest der kleinste gemeinsame Nenner zu sein, auf den sich kulturessentialistische Theorien einigen können. Demgegenüber ist die gesellschaftliche Invarianz (Homogenität von Kultur innerhalb einer Gemeinschaft) umstritten. 52 Wolfgang Melchior müssten sie einräumen, ihre kulturessentialistischen Argumentationen seien nur vorgeschoben. 3.2 Kultur – wirklich homogen und invariant? Einige intuitive Vorbemerkungen seien mir gestattet: Kulturessentialisten tun so, als ob die Kulturen a priori existierten. Dem ist keineswegs so. Das gilt sowohl für Theorien der Kultur wie für das kulturelle Selbstverständnis der Akteure. So sieht etwa Huntington in Clash of Civilizations einmal 10, dann wieder 8 und zum Schluss nur noch zwei Kulturkreise („the West and the Rest“); von weiteren derzeit kursierenden Auswüchsen von Kulturdefinitionen ganz zu schweigen. Der Grund hierfür liegt auf der Hand: der Kulturbegriff besitzt kein hinreichend genaues Abgrenzungskriterium. Bezieht er sich auf objektive Produkte und Tätigkeiten, haftet ihm immer der Hauch von Zirkularität an: Basis des Kulturbegriffs ist dann stets das Je-Eigene. Dies ist etwa gut ablesbar in der Geschichte der Ethnologie, in der lange Zeit Kultur mit einer ganz bestimmten Art zivilisatorischer Praktiken des Westens/Nordens gleichgesetzt wurde.19 Heute findet man immer wieder als Abgrenzungskriterien für Kultur wenigstens die beiden Merkmale von Religion und Ethnizität. Doch damit läuft der Kulturbegriff in das nächste Problem: er muss ein Ganzes beschreiben, das wenigstens die Kriterien von Homogenität und Kohäsion erfüllt. War es früher so, dass alle nicht-europäische Kulturen diese beiden Kriterien verfehlten, so ist heute genau umgekehrt: die westlichposttraditionale Gesellschaften, wie wir sie im Westen vorfinden, besitzen gerade nicht diesen Grad von Homogenität und Kohäsion. Würden wir deswegen bestreiten, dass der Westen eine Kultur besitzt? Ähnlich bestellt ist es mit dem Selbstverständnis der Akteure einer Kultur: der Kulturbegriff unterstellt invariante Muster, denen auch die Mitglieder der jeweiligen Kultur tatsächlich unterworfen sein sollen. Interessanterweise wird dies oft von eben diesen bestritten: Mancher Afrikaner würde sich wehren gegen Huntingtons Begriff der African Culture, und auch Europäer 19 Vgl. hiezu etwa Hans Fischer (Hg): Ethnologie, Berlin 4. Aufl. 1992; K.-H. Kohl: Ethnologie – die Wissenschaft vom kulturell Fremden. Eine Einführung, München 2000. Die Alte Weltordnung: die Neugestaltung der Welt nach Kulturen 53 sehen in letzter Zeit immer mehr kulturelle Unterschiede zu einer Western Culture made in USA.20 Nach nahezu hundert Jahren moderner Ethnologie, in der hermeneutische Prinzipien zu einem immer besseren Verständnis der Kulturen gelangten, scheint man jetzt das Rad wieder zurückdrehen zu wollen und oktroyiert ganzen Regionen des Globus bestimmte Kulturbegriffe auf. Zum Kern der Sache: Insgesamt betrachtet, lassen sich wenigstens zwei Typen von Kulturbegriffen in der Debatte beobachten: - solche, die Kultur an bestimmten, abgrenz- und angebbaren Einstellungen, Lebensäußerungen und Artefakten einer Gesellschaft festmachen. Beispiele dieser Gruppe sind: Luhmanns Konzept des kulturellen Systems, Marx’ Theorie des Überbaus, evolutionistische und ethologische Konzepte von Kultur; - solche, die Kultur als holistische Gesamtheit (man verzeihe mir den Pleonasmus) aller Einstellungen, Lebensäußerungen und Artefakte einer Gemeinschaft betrachten. Kultur fällt hier tendenziell mit dem Begriff der Gemeinschaft zusammen. Darunter lassen sich zwei Untergruppen ausmachen: objektivistische und subjektivistische. Zu den objektivistischen Kulturkonzepten zählen all solche, die als interkulturelles Abgrenzungskriterium nur beobachtbare Lebensäußerungen und Artefakte zulassen. Beispiele hierfür sind: Huntingtons Zivilisationskonzept oder ethnischreligiöse Konzepte von Kultur. Zu den subjektivistischen zählen all solche, die Kultur primär als Gesamtheit von nicht-objektiven Einstellungen und Überzeugungen sehen. Ein Beispiel dafür gibt v. Pechmann hier in diesem Heft, indem er Kultur als das „unverfügbar Innere“ oder das „Dispositiv“ interpretiert.21 Kulturessentialisten verwenden stets einen expansiven Begriff von Kultur, lassen sich also in der zweiten Gruppe wiederfinden22. Prinzipiell sind Fra20 21 Siehe dazu den Artikel von M. Knoll in diesem Heft. Zwischenformen objektivistischer und subjektivistischer Konzepte sind in letzter Zeit im Zusammenhang mit dem Wittgensteinschen Konzept der „Lebensform“ entstanden. 22 Daraus folgt, dass ich, Kulturessentialisten kritisierend, einen Begriff von Kultur favorisiere, der sich in der ersten Gruppe wiederfinden lässt. Attraktiv erscheint mir Luhmanns Begriff des kulturellen Systems, wobei ich den metaphysischen Ballast von systemischer Geschlossenheit und Autopoiesis abwerfen würde. 54 Wolfgang Melchior gen der Ontologie unentscheidbar und sind pragmatisch zu lösen: ob Kultur wirklich in einem platonischen Himmel unabhängig von ihren subjektiven wie objektiven Instanzen existiert oder nicht, mögen andere entscheiden. Etwas anderes ist es jedoch, was daraus gefolgert wird – und da „hört der Spaß auf“. Wer Kultur zu einer eigenen, irgendwelche Dinge hervorbringenden Substanz hypostasiert (z.B. einer „semantischen Maschine“), entzieht sie a priori und prinzipiell zwei dimensionalen Betrachtungsweisen: 1. einer historischen: Kultur als Substanz existiert ewig und invariant. Das widerspricht jedoch all unseren Erfahrungen mit und in der Kultur und auch sämtlichen Ergebnissen der Kulturwissenschaften. Kultur selbst ist sehr wohl historischen Änderungen unterworfen. 2. einer ethischen: wenn Kultur unabhängig von Handlungsträgern existiert, ist sie auch als Ganzes deren Verantwortung und der Veränderbarkeit entzogen. Mit den Kulturessentialisten – das Rad der Geschichte zurückdrehend – sind wir wieder dort angekommen, wo wir Ende des letzten Jahrhunderts waren: westliche Kultur besteht aus „Herrenmenschen“ und der/die „NegerIn“ ist nun mal ein Sklavenmensch – egal, was der/die einzelne will und tut.. 3.3 Missing link: Warum Kampf oder Konflikt? Die Konfliktthese kommt in der Regel in zwei Spielarten daher: a. entweder Kulturen stünden prinzipiell miteinander im Konflikt oder b. Kulturen führten einen andauernden Selbstbehauptungskampf. Oben hatte ich die kulturelle Konfliktthese mit dem Fehlen einer Theorie der Verteilungsgerechtigkeit – also innertheoretisch – erklärt. Das Argument besagte, dass Kulturessentialisten infolge ihrer eigenen Prämissen zu einem Begriff des Kampfes der Kulturen kommen müssen. Sehen wir uns die Prämissen genauer an: die Akteure des Verteilungsspiels bei Kulturessentialisten sind selbstgenügsame, geschlossene, partikulare Einheiten, die sich plötzlich in einer Welt wiederfinden und daher keine Verfahren zur Schlichtung dieser Konflikte besitzen. Dies Argument der Kulturessentialisten ist stimmig und klingt prima facie plausibel. Die Struktur meiner Gegenargumente ist empirischer und prinzipieller Art. Im ersten möchte mich dem Thema Verteilungskonflikt zuwenden und die Prämisse der „kulturellen Geschlossenheit“ aufgreifen. Prinzipiell und in Die Alte Weltordnung: die Neugestaltung der Welt nach Kulturen 55 der Geschichte ablesbar gibt es wenigstens drei Möglichkeiten, in denen Akteure eines Verteilungskonflikts miteinander umgehen können23: 1. sie haben ein gegenseitiges Desinteresse, 2. sie kooperieren miteinander, 3. sie verharren in einem andauernden Konflikt miteinander24. Zusammengenommen mit der Geschlossenheitsprämisse würde man eigentlich eher erwarten, Kulturessentialisten entscheiden sich für Alternative 1. Denn warum sollte ein mehr oder weniger geschlossenes kulturelles System den Kampf mit anderen Kulturen aufnehmen, wenn es ständig nach Selbstgenügsamkeit strebt? Bestimmte – vor allem linke – Kulturessentialisten antworten darauf mit der Bedrohungshypothese: behauptet wird, es gibt eine Kultur (die westliche), die alle anderen Kulturen – existenziell – bedroht. Abgesehen davon, dass hier zu klären wäre was „bedrohen“ meint25, gibt es auch hier wieder verschiedene Strategien für eine bedrohte Kultur, darauf zu reagieren:26 - sie arrangiert sich und passt sich an (Assimilation); - sie entwickelt universalistische Theorien als Instrumente einer politischen Auseinandersetzung (Universalisierung); - sie versucht die Oberhoheit zu erlangen (Dominanz); - sie isoliert sich (Isolation). Soweit mir ersichtlich, werden diese Alternativen von Kulturessentialisten noch nicht einmal ansatzweise in Betracht gezogen, was vermuten lässt, hier gehe es nicht um empirisch-deskriptive Betrachtungen, sondern schlichtweg um die Formulierung politisch-agitatorischer Parolen. 23 Beispiele und empirische Belege für alle Alternativen lassen sich in der Geschichte genügend anführen. 24 Zwei Dinge sind hier anzusprechen: 1) Interessanterweise schließen genau diesen Fall alle philosophischen und ökonomischen Theorien aus: dort gibt es immer ein Outcome, ein Ergebnis, welches als Endbedingung dient. 2) Der Begriff des andauernden Konflikts kann an dieser Stelle nicht genauer geklärt werden. Er schließt prinzipiell sowohl friedliche als auch kriegerische Auseinandersetzungen ein, unterstellt jedoch, dass letztlich alle andauernde Konflikte kriegerisch enden. 25 So meinen manche, die Mc-Donaldisierung sei bereits eine kulturelle Bedrohung. Für Islamisten sei – so wird fernsehweise verbreitet – westliche Musik eine kulturelle Bedrohung. 26 Siehe hierzu die Marginalitätstheorie von S. Rothman/S.R. Lichter: Roots of Radicalism, 1982. 56 Wolfgang Melchior Die Missing links für eine Theorie des Kampfes der Kulturen ergeben sich dann wie folgt: - sie erklärt nicht, warum es notwendig zu Konflikten der Kulturen kommt, wenn es – theoretisch wie empirisch – auch andere plausible Alternativen gab und gibt; - und sie erklärt nicht, warum es notwendig zur gewaltsamen Austragung dieser Konflikte kommt. 4. Eine Erklärung Aus dem Vorigen sollte klar geworden sein, dass die Geschichte kulturessentialischer Theorien bereits mit dem Kommunitarismus in den 70er Jahren und damit bereits vor dem Ende des Kalten Krieges und auch vor den gegenwärtigen Anti-Globalisierungskonflikten27 beginnt. Daraus könnte sich die Vermutung ergeben, es handele sich bei diesen Theorien weniger um deskriptive als um präskriptive Konzepte. Diese Vermutung klang bereits zuvor in der Kritik dieser Konzepte des öfteren an. Gestützt wird sie weiterhin durch den Umstand, dass es empirisch grundsätzlich unentscheidbar ist, ob die Theorie der Autonomie des Individuums oder die Theorie der Mitgliedschaft wahr – d.h. eine wahre Gesellschaftstheorie – ist. Kulturessentialisten wie Huntington könnten darauf mit dem Einwand entgegnen, ihre Theorien seien prognostisch. Dagegen lässt sich zunächst nichts Prinzipielles einwenden. Allerdings treten nahezu sämtliche kulturessentialistischen Betrachtungen als Empfehlungen auf, d.h. sie geben Anleitungen, wie zukünftige (politische) Handlungen auszurichten seien. Wir kennen für dieses Phänomen einen Begriff: self-fulfilling prophecy: Kulturessentialisten empfehlen den politisch Verantwortlichen ihre Handlungen so auszurichten, als ob es den Kampf der Kulturen bereits gäbe. Die Folge ist das aktive Betreiben von Konflikten/Kriegen unter eben dieser Losung. Möglich war und ist dies nur, weil der Kommunitarismus bereits in den 70er Jahren dafür den Boden bereitete. Die Transponierung amerikanischkommunitärer Strukturen auf die gesamte Welt erscheint den mittlerweile 27 v. Pechmann macht diese Konflikte sogar erst Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts fest. Siehe hierzu seinen Artikel in diesem Heft. Die Alte Weltordnung: die Neugestaltung der Welt nach Kulturen 57 kommunitaristisch entrenched politisch Verantwortlichen als nicht allzu weiter Schritt, ja geradezu als selbstverständlich. Damit ist jedoch der Kampf der Kulturen keine notwendige Entwicklung eines globalen Systems der Kulturen, also keine Eigenschaft dieses Systems, sondern die Folge einer interessegeleiteten, intendierten Politik.28 Kulturessentialisten verwechseln damit die besonderen, politisch-ökonomischen Interessen mit den allgemeinen Bestimmungen von Kultur. Ergebnis sind die Entwicklungen, die wir heute beobachten: der Aufstand indigener Gruppierungen und Gemeinschaften, die vom Verteilungsschema a priori ausgeschlossen sind. Diese Aufstände finden jedoch nur dort statt, wo zwei Bedingungen erfüllt sind: 1. diese Gemeinschaften müssen auf hinreichend große Kohäsionskräfte zurückgreifen können: in der fragmentierten Kulturlandschaft Afrikas fehlt es an solchen Kohäsionskräften; in Lateinamerika haben wir es mit lokalen, aufflackernden Aufständen indigener Gruppierung zu tun; allein im „Kulturraum“ Islam hat sich mit der islamistischen Strömung eine buchstäblich schlagkräftige, mit hoher Kohäsion ausgestattete AntiGlobalisierungsbewegung entwickeln können. 2. sie müssen explizit als Gegner der westlichen Globalisten „anerkannt“, d.h. sie müssen für sie von hegemonialem Interesse sein. Die Ideologie dabei Es ist sicher richtig, dass bestimmte kulturelle Handlungsregeln mehr oder weniger die Fähigkeit besitzen, sich an die globalistischen Bedingungen anzupassen; dies setzt jedoch diese Kulturen nicht per se als kulturelle Entitäten in einen Konflikt zu anderen und macht Kulturen noch nicht zu den Hauptakteuren globaler Verteilungskämpfe. Es ist das eine zu sagen: „Hier sehe ich eine Gemeinschaft, deren Tradition und Geschichte diese oder jene Produktionsweisen hervorgebracht haben, und diese Produktionsweisen lassen sie global ins Hintertreffen geraten, da der Weltmarkt nach anderen Produktionsweisen fragt“. Das andere – wie von kommunitaristischkulturessentialistischen Theorien behauptet: „Hier sehe ich eine Gemein- 28 Mit Luhmann gesprochen könnte man sagen: nicht das System ‚Kultur’ besitzt das Konfliktpotenzial, sondern die Systeme ‚Politik’ und ‚Ökonomie’. 58 Wolfgang Melchior schaft, und diese steht in einer globalisierten Welt sui generis in einem Konflikt mit allen anderen Gemeinschaften“. Was im zweiten Fall aus dem Blick gerät ist schlichtweg der Umstand, dass es momentan ein ökonomisches System ist, das allen anderen von vorneherein die Bedingungen des Verteilungskampfes diktiert. Die kulturessentialistischen Theorien unterstellen ein Principle of Fairness: sie argumentieren so, als ob alle Gemeinschaften tatsächlich gleiche und freie Ausgangsbedingungen haben29. Genau dies ist nicht der Fall. Die ideologische fallacy des Kulturessentialismus ist – ähnlich wie im Kulturrelativismus – demnach exakt das, was er den universalistischen Theorien des Liberalismus immer vorgeworfen hat: nämlich anzunehmen, Gemeinschaften gingen von gleichen und fairen Startbedingungen aus. Während der Liberalismus dies jedoch als explizite und lediglich methodologische Prämisse30 betrachtet, ist dies im kulturessentialistischkommunitaristischen Konzept implizit und als empirische Hypothese formuliert. 5. Die neuen ideologischen Konfliktlinien: Der Aufstand des Partikularen gegen die Universalismen und die Kritik Die neuen Frontlinien der globalen Welt verlaufen ideologisch zwischen Universalismus und Partikularismus. Es geht um die schlichte Frage, ob wir in Zukunft Gemeinschaften als möglichst kleine Einheiten oder als möglichst große Einheiten schaffen wollen. Die Vertreter partikularistischer Konzepte, die sich bis hinunter zur postmoderne Individualmonade vorgearbeitet haben, führen ins Feld, das Andere, das Nicht-Identische, das Besondere gegen das überformende Ganze zu verteidigen. Sie betonen, dass die Geschichte universalistischer Gesellschaftstheorien – Liberalismus, Libertinismus, Sozialismus, Marxismus – den einzelnen, statt ins Licht der Freiheit, in noch größere Knechtschaft geführt habe. Diesem Misstrauen gegen die großen Metaerzählungen nachgebend, wollen sie das Partikulare wieder in sein/ihr Recht setzen. Dazu gehöre zuallererst seine/ihre Anerkennung, zweitens das selbstzweifelnde 29 Zur Erinnerung: J. Rawls hatte damals das Principle of Fairness als theoretische Hypothese formuliert und nicht als Teil einer deskriptiven Theorie. 30 Dies meint etwa Rawls, wenn er sein System des Urzustands als Hypothese begreift. Die Alte Weltordnung: die Neugestaltung der Welt nach Kulturen 59 Hinterfragen der eigenen Bedingungen und drittens das Ziel, das Andere aus dessen eigenen Bedingungen heraus zu verstehen. Im Aufstand gegen die Moderne sollen nach und nach alle universalistischen Konzepte und Normen als falsche Ideologien entlarvt werden. Zu diesen partikularistischen Konzepten gehören alle momentan „herrschenden Paradigmen“: - Kommunitarismus und kulturessentialistische Theorien - Cultural Explanation Theories - Postmoderne. Ihre Gegner sind die universalistischen Konzepte: - Sozialismus, Marxismus - Liberalismus - Libertinismus - Kritischer Rationalismus. Das Feld partikularistischer Theorien ist dem gemäß sehr breit gestreut, lässt sich jedoch in zwei Gruppen einteilen: - Der politisch korrekte Partikularismus: dieser argumentiert aus der ethischen Position eines globalen Pluralismus und wendet sich gegen jede Art von Hegemonialismus. Universalität wird hier dem Verdacht ausgesetzt, hegemoniale Geltungsansprüche durchzusetzen. Interessanterweise verschränken sich im politisch korrekten Partikularismus zwei Tendenzen: die Forderung nach interkulturellem Pluralismus mit der nach intrakulturellem Uniformismus: Das verwundert denn auch nicht, denn die pluralistische Forderung wird erst valide, wenn hinreichend abgrenzbare kulturelle Einheiten geschaffen sind. - Der hegemoniale Macht-Partikularismus: dieser erklärt, dass mit dem Ende universeller Verteilungskriterien eben das Geltung besitze, was sich qua Stärke durchsetzen lasse. Paradigmatisch wird uns dieser Partikularismus zur Zeit von den USA um die Ohren gehauen. Partikularistische Theorien waren angetreten, das Besondere zu schützen. War in der partikularistischen Tradition das Besondere stets im Überformten, in der Minderheit, dem Schutzlosen – kurz: dem Gegenstand von Herrschaft – gesehen worden, wird es im kulturessentialistischen Paradigma auch zur Rechtfertigung für Herrschaft verwendet: mit dem Ende der Wahlfreiheit gibt es jetzt eben auserwähltes Besonderes, das qua Macht Herr- 60 Wolfgang Melchior schaft über das Andere auszuüben berechtigt ist. Möglich wird dies nur – und das ist entscheidend –, wo eine allgemeingültige Theorie der Verteilungsgerechtigkeit VORHER konterkariert wurde und durch eine nur mit partikularem Geltungsanspruch ausgestattete ersetzt wurde – wie im Falle der kommunitaristischen Tradition. Die aktuelle und uns nicht mehr lange beschäftigende Frage, ob die USA oder die UNO als Konfliktlösungsmedium einzusetzen sei, trifft hier ins Zentrum der Fragestellung: es geht darum, ob partikulare Interessen sich qua Macht durchsetzen oder universelle und allgemeingültige Standards und Verfahrensweisen zur Konfliktlösung herangezogen werden sollen. Letztlich haben wir nur die Wahl zwischen zwei präskriptiven Pfaden: Der partikularistische Pfad der kleinen Einheiten hat bis dato viel zu Verständnis des Anderen und Besonderen geleistet; aber er bedarf einer universalistischen Korrektur, wollen wir nicht im Kampf aller gegen alle untergehen, in dem nur der Stärkere überleben wird. Es geht daher um eine Methodenfrage: Statt mit der prinzipiellen Verschiedenheit der Kulturen zu beginnen, sollten wir wieder mit der prinzipiellen Gleichheit der Gemeinschaften/Kulturen starten und von diesem Prinzip aus nach allgemeingültigen, universell anwendbaren, unparteilichen, öffentlichen, einstimmigen und entscheidbaren Kriterien suchen. Denn vom Standpunkt der Ethik ist das Besondere, wie Talente oder Glaubensüberzeugungen, zweitrangig.31 31 Ansätze zu solch universalistischen Konzepten gibt es bereits in der interkulturellen Philosophie. Siehe dazu H. Kimmerle: „Auf der philosophischen Seite, auf die ich mich hier beschränke, gibt es Ansätze zu gemeinsamer Arbeit zwischen europäischen und afrikanischen Fachvertretern, die von dem Bewußtsein prinzipieller Gleichheit ausgehen. Es geht um einen Dialog im Sinne eines geduldigen und methodisch geleisteten Aufeinander-Hörens und der Arbeit an gemeinsam interessierenden und organisierten Projekten. Eine interkulturelle Philosophie, die auf solche Weise entsteht, kann auf der Ebene interkontinentaler Multikulturalität zu einer prinzipiellen Gleichheit beitragen, auch wenn im ökonomisch-politischen und technologisch-zivilisatorischen Bereich Verhältnisse der Ungleichheit und der Abhängigkeit fortbestehen.“ (Multikulturelle Gesellschaft und interkulturelle Philosophie. Bemerkungen im Anschluß an einige Studienreisen nach Afrika südlich der Sahara, in: Widerspruch 21, 1991, 24). Mohamed Turki Arabische Vernunft versus Westliche Vernunft? Zur Rationalitätsdebatte in der arabisch-islamischen Welt* In der arabisch-islamischen Welt ist seit mehr als einem Jahrhundert eine öffentliche Diskussion im Gange, die das Verhältnis der arabisch-islamischen Gesellschaften zur Moderne thematisiert. Kernpunkt dieser Diskussion ist die Frage nach der Spezifität des arabisch-islamischen Diskurses und seiner Beziehung zum Modernisierungsprozess in Europa. Als die zwei großen arabischen Denker, die diese Kontroverse unter dem Gesichtspunkt des Rationalismus bzw. Säkularismus auf der einen Seite und dem des islamischen Reformismus bzw. Traditionalismus auf der anderen Seite weitgehend geprägt haben, sind Farah Antun und Muhammad Abdu zu nennen1. Diese innerarabische Debatte sah sich dabei mit der europäisch-westlichen Behauptung konfrontiert, dass islamische Gesellschaften sich bei ihrem Anschluß an die Moderne schwer tun, weil der Islam ein grundlegendes Hindernis für diesen Anschluß darstelle, da er den Rahmen der Rationalität überspringe und sich auf der Ebene der Offenbarung bewege. Diese Behauptung, die bereits von Hegel formuliert2 und dann von den Orientalisten – namentlich von E. Renan3 – übernommen und verbreitet wurde, hat sich im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts im Westen, aber auch unter den a- * Der Artikel ist in englischer Sprache erschienen in: W. Ruf (Hg), Islam and the West Judgments, Prejudices, political Perspectives, Münster 2002. 1 T. Tizini (Hg), Farah Antun: Ibn Rushd wa falsafatuhu ma’a nusus al munazara baina Muhammad ’Abdu wa Farah Antun, Beirut 1988; A. Flores, Secularism, Integralism and Political Islam. The Egyptian Debate. In: Middle East Report 183, 1993, 32-38. 2 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte de Philosophie, Frankfurt/Main 1971, Bd. 19, 518. 3 E.Renan, Averroes et L’Averroisme, essai historique, ed. Calmann Levy, Paris 1882, VIII. 62 Mohamed Turki rabisch-islamischen Intellektuellen bei ihrer Auseinandersetzung mit dem Islamismus fortgesetzt.4 In den letzten Jahrzehnten nun hat sich diese Debatte im Zuge der sich deutlich abzeichnenden Islamisierungstendenzen in Staat und Gesellschaft – die iranische Revolution und ihre Auswirkung auf die islamische Welt, die Afghanistankriege, der Machtwechsel im Sudan und die dramatischen Ereignisse in Algerien – und in Folge des im Westen angekündigten ‚Kampfes der Kulturen‘5 verschärft. Sie hat unter den Intellektuellen in der Frage um Säkularisierung oder Islamisierung von Gesellschaft und Staat zur Polarisierung der Positionen geführt. Die einen sind zu Befürwortern einer radikalen Kritik und Überwindung der hemmenden Strukturen des Islams geworden; sie verlangen eine totale Säkularisierung der Gesellschaft als ‚historische Notwendigkeit‘, wie etwa der ägyptische Philosoph Fuad Zakkariya6. Die anderen treten als Verfechter einer Aufrechterhaltung des status quo bzw. einer Rückbesinnung auf die Prinzipien des islamischen Glaubens auf, die schon die Grundzüge der Rationalität beinhalten und in ihrer praktischen Handhabung zur Entfaltung der islamischen Kultur und Zivilisation beigetragen haben. Nach deren Verständnis verleiht der Islam der Gesellschaft eine identitätsstiftende Prägung, die der ständigen Gefahr einer Überfremdung durch Verwestlichung und des Verlustes der eigenen Wertvorstellungen entgegenwirken kann. Diese Meinung wird gleichermaßen von den meisten Islamisten und Traditionalisten vertreten. Um diese beiden Positionen genauer beleuchten zu können, und zwar in Hinblick auf die Beschaffenheit einer ‚arabischen‘ oder ‚islamischen Vernunft’, die der ‚westlichen Vernunft’ entgegenstehe, bedarf es jedoch der Dekonstruktion und der Freilegung der jeweiligen Strukturen des Wissens und des sittlichen Handelns innerhalb der arabisch-islamischen Kultur. Sie zeigt, daß und wie die ihr zugrundeliegenden Paradigmen verschieden sind und von keiner einheitlichen Instanz bestimmt werden. Um die AmbiguitäZu den Begriffen Islamismus und Fundamentalismus, siehe: A. Hartmann, Der islamische ‚Fundamentalismus‘, Wahrnehmung und Realität einer neuen Entwicklung im Islam. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 4.Juli 1997, 4 ff. 5 S.P. Huntington, Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, München, Wien 1996. 6 F. Zakkariya, Säkularisierung – eine historische Notwendigkeit. In: M. Lüders (Hg), Der Islam im Aufbruch? Perspektiven der arabischen Welt, München 1992, 228-246. 4 Arabische Vernunft versus westliche Vernunft? 63 ten solcher Konzepte sichtbar zu machen, wird diese Thematik im Folgenden anhand von zwei maghrebinischen Denkern erörtert und kritisch betrachtet. 1. Mohammad Abid Al-Gabiri und die ‚Kritik der arabischen Vernunft‘ Dem Anspruch einer grundlegenden Kritik am ‚zeitgenössischen arabischen Denken‘ folgend, unternimmt es der marokkanische Philosoph Muhammad Abid Al Gabiri, die Genese, die Struktur und die politischen Ausprägungen dieses Denkens eingehend zu untersuchen. In Anlehnung an Kants Kritikprogramm hat er sich in den 80er Jahren mit den erkenntnistheoretischen Paradigmen des arabisch-islamischen Diskurses auseinandergesetzt. Sein dreibändiges Werk Kritik der arabischen Vernunft (Nakd al-’Akl al-’arabi‘) legt sowohl die epistemischen Fundamente des arabisch-islamischen Kulturerbes als auch die Mechanismen seiner Konstituierung frei.7 Unter dem Begriff der ‚arabischen Vernunft‘ faßt Al Gabiri demnach „die Summe der Prinzipien und Regeln, die von der arabisch-islamischen Kultur ihren Angehörigen als Grundlage zur Aneignung von Wissen geboten wird, um sich danach als Erkenntnissystem in einer bestimmten historischen Phase zu etablieren und unbewußt fortwirken zu können“8. Es handelt sich also um Strukturen des Denkens und Handelns, die ihre eigene Rationalität im Laufe der Zeit gewonnen haben und nicht unbedingt den Paradigmen und Kategorien der ‚westlichen Vernunft‘ entsprechen oder ihr unmittelbar entnommen sind. Ausgehend von dieser Voraussetzung unterscheidet Al Gabiri drei verschiedene Erkenntnissysteme, die der arabischen Vernunft zugrunde liegen und sie unterschiedlich prägen. Er kennzeichnet sie mit den drei arabischen Begriffen: Bayan, Irfan und Burhan. Al Gabiri, Muhammad ’Abid, Naqd al-’Aql al-’arabi (Kritik der arabischen Vernunft), Bd. 1: Taqwin al-Àql al-’arabi, (Genese der arabischen Vernunft), Beirut 1984. (Im Weiteren unter ‚Genese der arab. Vernunft’ zitiert). 8 Al Gabiri, Muhammad ’Abid, Naqd al-’Aql al-’arabi, Bd. 2: Bunyat al Aql al Arabi, Dirasa tahlilyya naqdiyya li-nuzum al-ma’rifa fi-th-thaqafa al-àrabiyya (Struktur der arabischen Vernunft, eine analytische und kritische Untersuchung der Erkenntnissysteme in der arabischen Kultur) Beirut 1986, 555. (Im Weiteren unter ‚Struktur der arab. Vernunft’ zitiert). 7 64 Mohamed Turki – Bayan bedeutet das Offensichtliche. Hier ist der Begriff ein Synonym für den offenbarten und tradierten Text (Koran und Hadith) und seine Exegese. – Irfan kennzeichnet die Gnosis, d.h. die Mystik und alle esoterischen Wissenschaften, die mit ihr verbunden sind. – Burhan umfaßt alle Erkenntnisse, die der demonstrativen Beweisführung und Begründung unterworfen sind. 1. Betrachtet man diese drei Paradigmen bzw. epistemischen Systeme näher, so läßt sich erkennen, dass Al Gabiri unter den Begriff Bayan alles subsumiert, was mit dem tradierten Text mittelbar oder unmittelbar zusammenhängt: Sprache und Grammatik, aber auch Rechtswissenschaft und spekulative Theologie. Diese Wissensbereiche bilden ein einheitliches System, das sich hauptsächlich auf den heiligen Text bezieht und ihn rational zu begründen versucht. So gelangt man mithilfe des Analogieschlusses vom Sichtbaren auf das Verborgene (Qias al Schahid ’ala-al Ghaib), des Igtihad (Bemühen um das Wissen) und des Igma‘a (Konsens) zu Erkenntnissen, die zusammen mit den tradierten Texten die islamischen Wissenschaften ausmachen.9 Was die Genese und Entwicklung dieser Wissenschaften betrifft, so erklärt Al Gabiri, dass sie sich in den ersten drei Jahrhunderten nach der Offenbarung des Korans konstituiert haben, dass dann aber das sog. ‚Tor des Igtihad’ geschlossen wurde und keine nennenswerten Erkenntnisse mehr erfolgten. Man habe sich mit einer bloß formalen Handhabung des Analogieschlusses begnügt und somit die Frage der Gültigkeit der Wissensprinzipien bei ihrer Anwendung auf die Wirklichkeit außer Acht gelassen. Dies führte unter anderem zum Stillstand der hermeneutischen Exegese wie zur Verfestigung des ‚Taqlid‘, d.h. zum Festhalten am tradierten Wissen und seiner mechanischen Wiederholung, die zu einer Art ‚Scholastik‘ ausartete. So gesehen, stellt der Bayan eine gewisse Rationalität religiöser Prägung dar. Al Gabiri nennt sie ‚das religiöse Denkbare’ (Al Ma‘qul ad-dini), das im Laufe der Zeit zum Dogma erstarrt und somit seine Gültigkeit eingebüßt habe. Hier sieht er schon den ersten Ansatz für eine kritische Bestandsaufnahme des religiösen Diskurses einschließlich der geschichtlichen Überliefe- 9 Al Gabiri, Genese der arab. Vernunft, 335; Struktur der arab. Vernunft, 23 ff. Arabische Vernunft versus westliche Vernunft? 65 rung, um das kulturelle und religiöse Erbe aus dem Fanggriff des ‚Taqlid‘ zu befreien. 2. Zur zweiten Dimension der Erkenntnis, dem ‚Irfan‘, der mit ‚Gnosis‘ übersetzt werden kann, zählt Al Gabiri vor allem die mystischen Erfahrungen des ‚Tasawif‘, das schiitische Denken und seine ismailitische Deutung des Islams, die Illuminationsphilosophie sowie Alchimie, Zauberei und Astrologie. All diese Arten des Wissens entspringen seiner Ansicht nach einem System, das sich zwar an die Vernunft anlehnt, jedoch keinen rationalen Prinzipien folgt, weil es sich an manichäischen und hellenistischen Vorstellungen orientiert, die ein esoterisches Wissen mit irrationalem Hintergrund bilden. Al Gabiri nennt dieses System ‚das rationale Nicht-Denkbare‘ (Al la ma‘qul al ’aqli), da es sich um ein Produkt des menschlichen Denkens handelt, das sich mit der religiösen Tradition vermischt hat und eine Zwischenstufe zwischen Offenbarung und rationalem Wissen einnimmt.10 – Diese Einschätzung teilt er übrigens mit der Islamwissenschaftlerin A. Schimmel, für die ebenfalls „nicht intellektuelles Wissen ... das letzte Ziel der Sufis, sondern existentielle Erfahrung“ sei, und die in Bezug auf die theologischen Traktate hinzufügt, die Sufis wüßten, „dass es nicht auf die schwarzen Buchstaben ankam, sondern darauf, ‚das Weiße zwischen den Zeilen zu lesen’, d.h. den inneren Sinn der Worte, wie er von Generation zu Generation weiter gegeben wurde, zu erfassen“.11 Aufgrund der Unklarheit der Prinzipien und des eklektischen Charakters ihrer Bestimmung werden die auf den ‚Irfan‘ gegründeten Erkenntnisse von Al Gabiri scharf angegriffen und für nicht nachvollziehbar gehalten. Er rechnet sie deshalb nicht zu den ‚genuin islamischen Wissenschaften‘. Im Gegenteil, sie haben nach seinem Verständnis in besonderem Maße zum Verfall der arabischen Vernunft beigetragen. Insofern erscheint es ihm als dringlicher denn je, sich von diesem Paradigma zu trennen und sich den wissenschaftlich nachprüfbaren und apodiktischen Prinzipien zuzuwenden, die den heutigen Gegebenheiten Rechnung tragen. 3. Beim dritten epistemischen Erkenntnissystem, dem Burhan, handelt es sich um „ein Wissen, das ausschließlich dem geistigen Vermögen des Men10 11 Al Gabiri, Struktur der arab. Vernunft, 253 ff. A.Schimmel, Sufismus. Eine Einführung in die islamische Mystik, München 2000, 9. 66 Mohamed Turki schen und seiner natürlichen Kräfte entspringt“.12 Es umfasst die gesamten Wissenschaften, welche die arabische Kultur vom griechischen Gedankengut übernommen und weiterentwickelt hat. Diese sind vor allem die Mathematik und Naturwissenschaften, Astronomie und Medizin, aber auch die Logik und Metaphysik, d.h. all jene Wissensbereiche, die der logischen Beweisführung und der empirischen Erfahrung unterworfen sind. Al Gabiri bezeichnet das auf dem ‚Burhan‘ gegründete System als ‚das rationale Denkbare‘ (al Ma‘qul al ’aqli), da es auf rationalen Prämissen aufgebaut ist, und seine erkenntnistheoretischen Ergebnisse mit Hilfe empirischer Experimente nachgeprüft werden können.13 Diese rationale und kritische Betrachtungsweise verfolgt Al Gabiri bis zu ihren Wurzeln in der Philosophiegeschichte und den islamischen Wissenschaften zurück. Er kommt zum Schluß, dass sie bereits im philosophischen und geschichtswissenschaftlichen Feld des andalusischen und maghrebinischen Denkens von Ibn Hazm, Ibn Rushd und Ibn Khaldun vorliegt. Sie müsse jedoch mit den gegenwärtigen wissenschaftlichen Methoden in Einklang gebracht werden, um wieder in Geltung zu kommen. Hier liegen zweifellos die Präferenzen Al Gabiris, der in diesem letzten epistemischen Paradigma die Bedingungen für eine rationale und kritische Analyse des gesamten arabischen Kulturerbes für gegeben hält und sie als Möglichkeit zur Überwindung der Krise, in der sich das arabisch-islamische Denken gegenwärtig befindet, in den Blick nimmt. Die Voraussetzung einer solchen Überwindung ist für Al Gabiri jedoch der epistemologische Schnitt (la coupure épistémologique), der bei der Aneignung und Lektüre des Kulturerbes mit der Struktur der arabischen Vernunft im Zeitalter des Verfalls und mit ihren Ausläufern im zeitgenössischen Denken vollzogen werden müsse. Denn die bisherigen Versuche seien aufgrund ihrer veralteten und unkritischen Verfahrensweise gescheitert. Es sei deshalb notwendig, einen neuen methodischen Ansatz in Angriff zu nehmen, der sich am Modell der modernen Wissenschaften anlehnt und diese Aufgabe im Rahmen der Geisteswissenschaften zu erfüllen vermag. Dieser – von G. Bachelard für die Naturwissenschaften verlangte und dann von den Strukturalisten wie M. Foucault und L. Althusser auf die Gesell12 13 Al Gabiri, Struktur der arab. Vernunft, 384. Al Gabiri, Genese der arab. Vernunft, 334. Arabische Vernunft versus westliche Vernunft? 67 schaftswissenschaften angewandte – ‚epistemologische Schnitt’ wird von Al Gabiri als alternative Interpretationsmethode herangezogen, um die gesamte arabische Geistesgeschichte zu untersuchen und dadurch die Strukturen der arabisch-islamischen Vernunft zu dekonstruieren. Dazu fordert er als ersten Schritt, Abschied vom bisherigen Erkenntniskriterium des Analogieschlusses bei der Beurteilung und Betrachtung der eigenen Geschichte zu nehmen: es darf keine Projektion der Vergangenheit auf die Zukunft, dem Analogieschluß vom ‚Sichtbaren‘ auf das ‚Verborgene‘ gemäß, erfolgen. Stattdessen müsse die Vergangenheit auf ein bloßes Untersuchungsobjekt der Geschichtswissenschaft reduziert und dürfe nicht weiterhin zum Modell für die Gestaltung der Zukunft gemacht werden. Gleichzeitig dürfen die zur Analyse herangezogenen Texte nicht allein nach ihrer Bedeutung befragt werden, sondern müssen auch nach der ideologischen Funktion untersucht werden, die sie vermittelt haben. Sie können so Auskunft über das Denken in ihrer Entstehungszeit geben und so einen Beitrag zur Geschichtskenntnis liefern. Denn heute, so Al Gabiri, gehe weniger um den Wahrheitsgehalt des mittelalterlichen Geisteserbes als vielmehr um den ideologischen Hintergrund, in dem sich zugleich eine politische Aussage verbirgt. Aus diesen Thesen läßt sich der Schluß ziehen, daß Al Gabiris Projekt einer Kritik der arabischen Vernunft das Ziel verfolgt, nicht allein die traditionellen Strukturen des arabisch-islamischen Denkens und Wissens aufzudecken und zu beleuchten, sondern zugleich eine Erneuerung der Denkweise der zeitgenössischen arabischen Intellektuellen einzuleiten, deren Tragweite im hermeneutischen Verfahren der Lektüre des Kulturerbes sichtbar wird. Es geht ihm also, um mit Kant zu sprechen, um eine Neubegründung der Denkungsart, die allerdings nicht, wie bei Kant, im Allgemeinen verfolgt wird, sondern auf das Feld der arabisch-islamischen Geistesgeschichte eingeschränkt ist. Al Gabiri zieht dabei keine Parallelen zu anderen Modellen des Denkens wie etwa der Aufklärung oder der Postmoderne; er fragt vielmehr nach den Bedingungen und Ursachen des Verfalls eines Denkens wie des arabisch-islamischen, das vormals die höchste Stufe der Rationalität erreicht hatte. Der Erfolg dieses Vorhabens hängt freilich vom Grad der Bereitschaft der arabischen Intellektuellen ab, sich neue wissenschaftliche Interpretationsmethoden anzueignen und sie kritisch anzuwenden. So schreibt er am Schluss des zweiten Bandes seines Werkes: „Der Erfolg der Erneuerung – 68 Mohamed Turki Tahdith – der arabischen Vernunft und der Neubegründung des islamischen Denkens, um die wir uns bemühen, hängt nicht nur davon ab, in welchem Umfang wir die zeitgenössischen Wissenschaften und methodischen Errungenschaften vor und auch nach dem 20. Jahrhundert adaptieren, sondern wohl in erster Linie davon, inwieweit wir in der Lage sind, die kritische Haltung Ibn Hazms, den Rationalismus Ibn Rushds, die Prinzipienlehre Ashshatibis und das Geschichtsbewußtsein Ibn Khalduns wiederzuerlangen. Diese rationalistischen Tendenzen sind für uns unerläßlich, wenn wir unsere Beziehung zu unserem Erbe auf eine Weise neu definieren wollen, die es uns ermöglicht, uns dergestalt darin einzubinden, dass Raum für Kreativität (Ibda‘) geschaffen wird, für eine Kreativität der arabischen Vernunft innerhalb der Kultur, in der sie sich herausgebildet hat. Ohne den kritisch-rationalistischen Umgang mit unserem Erbe werden wir keinesfalls in der Lage sein, dem Rationalismus in unserem zeitgenössischen arabischen Denken, das bald als ‚fundamentalistisch‘ (Usuli), bald als ‚salafitisch‘ charakterisiert wird, breiteren Raum zu verschaffen“.14 So betrachtet, scheint Al Gabiri den schon geebneten Weg des Rationalismus erkenntnistheoretisch wie ideologisch einzuschlagen und konsequent voranzutreiben. Dies wird noch offensichtlicher bei seiner Kritik am Mißbrauch des Islams durch den religiösen Extremismus bzw. Islamismus. So machte in einem Beitrag für die schweizerische Zeitschrift ‚du‘: Islam und Extremismus, die missbrauchte Irrationalität deutlich, wie der religiöse Extremismus mit der Lehre des Islams selektiv vorgeht, indem er bei seiner Bezugnahme auf die Lehre oder ihre Begründung den historischen Kontext außer Acht läßt. Er schließt: „Der Extremismus, unter dem die islamische Welt heute leidet, hat nichts mit dem Islam zu tun. Auch wenn seine Parolen dem Islam entnommen sind. Dieser Extremismus wendet die Religion nur zum Erreichen politischer Ziele an. Deshalb müssen Ursache und Lösung des Extremismus auch in der Politik gesucht werden.“15 – Al Gabiri stimmt darin mit der Orientalistin A. Hartmann überein, wenn sie schreibt: „Nicht der Islam selbst, sondern die herrschenden politischen Strukturen und wirtschaftlich-sozialen Ungleichgewichte regionalen und globalen Zu14 Al Gabiri, Struktur der arab. Vernunft, 552. Zit. nach: A.v. Kügelgen, Averroes und die arabische Moderne, Ansätze zu einer Neubegründung des Rationalismus im Islam, Leiden 1994, 270. 15 Du. Die Zeitschrift der Kultur, Zürich 1994, 153. Arabische Vernunft versus westliche Vernunft? 69 schnitts stellen das Haupthindernis auf dem Weg zur Herstellung von Menschenrechten und Demokratie in der islamischen Welt dar. Nicht der Islam selbst, sondern der status quo der islamischen Länder gefährden die nationale und internationale Stabilität und damit den Weltfrieden“.16 Daraus wird ersichtlich, dass in einer Zeit der Globalisierung die Thematik der Rationalität und der ‚Kritik der arabischen Vernunft‘ nicht losgelöst vom globalen Rahmen verhandelt werden kann. Sie bedarf ihres Kontrapunktes, nämlich der Kritik der ‚westlichen Vernunft‘, wie sie sich in ihrer gegenwärtigen Entfaltung und Ausprägung äußert. 2. Arkouns Ansatz zur ‚hegemonialen Vernunft’ Die Aufgabe einer kritischen Beleuchtung auch der ‚westlichen Vernunft‘ hat bereits der inzwischen emeritierte algerische Professor für ‚islamische und Ideengeschichte‘ an der Sorbonne, Mohammed Arkoun, in Angriff genommen. In seinem Beitrag ‘Westliche‘ Vernunft kontra ‚islamische‘ Vernunft? Versuch einer kritischen Annäherung vertritt Arkoun die These, dass die gegenwärtig herrschende Rationalität des Westens im Grunde nichts anderes als das Zeichen einer hegemonialen Vernunft sei, welche die Welt geopolitisch und geohistorisch unterteilt, um sie zu beherrschen. Nach der römischen Maxime ‚divide et impera’ habe sie die Welt in ein Zentrum und eine Peripherie geteilt, wobei der Westen mit seiner technologischen und industriellen Entwicklung sowie seiner polit-ökonomischen Macht das Zentrum bildet, während die übrige Welt zur marginalisierten Peripherie gehört. Diese Dichotomie scheint für die Vernunft gleichfalls zu gelten, wenn sie in eine ‚westliche‘ und eine ‚islamische‘ unterteilt und dabei dem Westen die Rationalität zugerechnet wird, dem Islam hingegen der Irrationalismus. So jedenfalls hat S. Huntington es eingeschätzt,17 der dem ‚westlichen Universalismus‘ den Rest der Welt, speziell den ‚Islam und China‘, gegenüberstellt. Für Arkoun sind solche Zuordnungen jedoch unsachgemäß und unzutref- 16 A. Hartmann, Islam und Islamismus contra Demokratie? Einführung und Fragen zum politischen Denken im Islam. In: B-O. Bryde, H. Dubiel, C. Leggewie (Hg), Triumph und Krise der Demokratie, Vorlesungen, Gießen 1995, 154. 17 S. Huntington, Kampf der Kulturen, a.a.O., 294 ff. Eine kritische Einschätzung des Buches gibt D. Senghaas in: Die fixe Idee vom Kampf der Kulturen. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 2/1997, 215-221. 70 Mohamed Turki fend, weil sie genau so wenig wie auch die Gegenüberstellung von ‚säkularem’ und ‚religiösem’ Denken den Kern des Problems erfassen. Was unter die Begriffe der ‚Moderne’ oder der ‚Rationalität’ heute subsumiert wird, bezeichnet Arkoun als die entfesselte Kraft der hegemonialen Vernunft, die zwar dem Westen als dem Zentrum der Macht „Fortschritt aus Technologie und Produktivität, Industrialisierung und Geldstreben“ beschert, aber zugleich den Rest der zur Peripherie herabgestuften Welt wirtschaftlich ausbeutet, militärisch unterjocht und sie am Anschluß an die ‚Gutes verheißende‘ Moderne hindert. Denn die Werte, die die Moderne im Zuge der Aufklärung hervorgebracht hat, wie Emanzipation und Freiheit, die Menschenrechte und den wissenschaftlichen Fortschritt, sind der Peripherie erst vorenthalten und danach nur bedingt weitergegeben worden. Arkoun verlangt deshalb eine Revision der Paradigmen, die unsere Denkweise bestimmen, damit die Sachzusammenhänge genauer erkannt werden und gegen solch dualistisches Denken vorgegangen werden kann. „Um die Gewalttätigkeit zu verstehen, die unser Jahrhundert (das 20. Jhdt., M.T.) erschüttert hat, müssen wir ohne falsche Rücksichtnahme und frei von Polemik die wirksame Kraft der hegemonialen Vernunft zu verstehen versuchen“.18 Das heißt: die der Rationalität innewohnenden Strukturen und sie begleitenden negativen Mechanismen müssen aufgedeckt und analysiert werden, um die historische Wahrheit wiederherstellen zu können. Dieser Entwurf ist nicht neu; Arkoun hat daran seit Jahrzehnten gearbeitet. So schrieb er schon 1973 in seinem Buch „Essais sur la pensée islamique“ unter der Überschrift L’islam face au développement: „Die wahre wissenschaftliche Forschung besteht darin, die wirklichen Probleme zu stellen, und nicht so sehr darin, kurz- oder langfristige Lösungen zu entwerfen“.19 Er spricht hier von den ‚faux problèmes‘, die seit den 50er Jahren im Zuge der raschen technologischen und industriellen Entwicklung und der Vertiefung der Kluft zwischen Zentrum und Peripherie entstanden sind. Sie drücken sich in den Gegensätzen aus wie: entwickelt-unterentwickelt, fortschrittlichrückständig, reich-arm, Westen-Dritte Welt. Aus eben diesen Korrelationen 18 M. Arkoun, „Westliche“ Vernunft kontra „islamische“ Vernunft? Versuch einer kritischen Annäherung. In: Der Islam im Aufbruch, a.a.O., 264. 19 M. Arkoun, Essais sur la pensée islamique, Paris 1973, 297. (Im Weiteren als ‚Essais’ zitiert.) Arabische Vernunft versus westliche Vernunft? 71 lassen sich die falschen Bezeichnungen und Stereotypen wie ‚westlichearabische‘ oder ‚rationale-islamische’ Vernunft ableiten. Zur Überwindung solcher Denkschemata schlägt Arkoun einige Bedingungen vor; unter anderem die Aufhebung der Korrelation ‚OrientOkzident’, die wissenschaftliche Aufarbeitung der verschiedenen Schichten der islamischen Tradition sowie die genauere Betrachtung der dialektischen Wechselwirkung von wirtschaftlicher Entwicklung und kultureller Entfaltung. Das Instrumentarium für seine Methode entnimmt er der angewandten bzw. strukturalen Anthropologie und der Linguistik, die dem postmodernen Dekonstruktivismus den Weg geebnet haben. Aufgrund der genannten Postulate und der neuen wissenschaftlichen Vorgehensweise kann das erkenntnistheoretische Feld nicht mehr linear bearbeitet werden. Es bieten sich vielmehr mehrere Dimensionen an, die das Objekt der Betrachtung näher beleuchten können. So erweist sich z.B. der gegenwärtige epistemologische Schnitt, der zwischen der westlichen und der islamischen Welt besteht, nicht als das Zeichen einer kulturellen Differenziertheit, sondern spiegelt die Distanz zwischen den Völkern des postindustriellen Zeitalters und den noch an archaischen Strukturen festhaltenden Gesellschaften wider.20 Auf diese Weise gelangt man über die soziopolitischen, ökonomischen und historisch-anthropologischen Analysen zu differenzierteren Ergebnissen und Schlußfolgerungen als mit dem dualistischen Prinzip. Was die Korrelation von ‚westlicher‘ und ‚islamischer‘ Vernunft betrifft, so betont Arkoun, dass beide Vernunftarten denselben Anspruch auf Hegemonie erheben: „Die islamische Vernunft, in ihrer theologisch-juristischen Ausprägung des 7. bis 13. Jahrhunderts, war ihrerseits eine hegemoniale Kraft wie auch die christliche Vernunft jener Zeit“.21 Sie galt als Herrschaftsinstrument, dessen man sich bediente, um machtpolitische Ziele durchzusetzen. Wenn daher Islamisten oder andere Intellektuelle heute auf jene Vernunft des sog. ‚goldenen Zeitalters’ Bezug und sie für sich in Anspruch nehmen, dann geschieht dies nach derselben Logik, mit der sich die ‚westliche Vernunft’ behauptet. Mit Arkouns Worten: „Die ‚islamische‘ Vernunft der Gegenwart erhebt den Anspruch, die an den Westen verlore20 21 M. Arkoun, Essais, 308. M. Arkoun, „Westliche“ Vernunft kontra „islamische“ Vernunft?, a.a.O., 269. 72 Mohamed Turki ne Hegemonie zurückzugewinnen“22 – auch wenn ein solcher Anspruch unter den gegebenen Umständen jeglichen Realitätsbezugs entbehrt und so auf den negativ utopischen Charakter der Weltanschauung seiner Vertreter hindeutet. Aus diesem Grund tritt Arkoun für eine kritische Vernunft ein, welche an jeder Art hegemonialer Vernunft Kritik übt, um damit ein neues Verständnis vom Menschen wie von der Gesellschaft und Religion zu ermöglichen. „Kritische Vernunft meint Beseitigung jedweder Hegemonie, sei es im theologischen, juristischen, ökonomischen oder politischen Bereich“.23 Eine radikale Kritik der islamischen Vernunft könne daher nicht allein die Aufgabe haben, die fremdbestimmenden Strukturen der Gesellschaft aufzudecken und zu entlarven, sondern müsse ebenso die internen hemmenden Mechanismen ans Licht bringen und zu überwinden trachten. In dieser Hinsicht fällt unter seine Kritik auch Al Gabiris Ansatz einer ‚Kritik der arabischen Vernunft‘, der sich von der Last hegemonialer Vernunft offenbar noch nicht befreit hat und der Faszination des arabischen Kulturerbes erlegen ist. Sie impliziert zudem eine klare Absage, avant la lettre, an all jene neuen Ideologen, die, wie S. Huntington, den ‚Kampf der Kulturen‘ predigen und dabei die eigene Vernunft nicht nur zum Maß aller Dinge erheben, sondern sie auch verherrlichen und mit allen Mitteln zu verwirklichen trachten. Ohne direkt Bezug darauf zu nehmen, knüpft Arkoun an Traditionen der ‚Kritischen Theorie‘ der ‚Frankfurter Schule‘ an. Sein Ansatz einer nichthegemonialen Vernunft erinnert an das Programm der Dialektik der Aufklärung, das von Th.W. Adorno und M. Horkheimer eingeleitet wurde und im späteren Werk des letzteren Zur Kritik der instrumentellen Vernunft24 besonders deutlich zum Ausdruck kam. Dennoch überwiegt in Arkouns methodischer Vorgehensweise die ‚Dekonstruktion‘ der postmodernen Denker, die sich eingehend mit den Mechanismen und Machtstrukturen von Diskursen befaßt haben. Ebenda, 269. Ebenda, 268. 24 M. Horkheimer, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, hg. von A. Schmidt, Frankfurt/Main 1967. 22 23 Arabische Vernunft versus westliche Vernunft? 73 3. Metakritische Bemerkungen Es ist das unverkennbare Verdienst der beiden Denker, sich um die Diagnose der gegenwärtig herrschenden Vernunft zu bemühen. Sie haben die Mechanismen der hegemonialen Vernunft sowohl im Allgemeinen, d.h. im globalen Maßstab, wie im Besonderen, im zeitgenössischen arabischen Denken, aufgedeckt und kritisiert. Al Gabiri wie Arkoun weisen auf die bestehende Krise der Rationalität samt ihren unterschiedlichen Ursachen und negativen Auswirkungen hin. Dennoch sind die von ihnen vorgeschlagenen Modelle zur Überwindung dieser Krise nicht gänzlich überzeugend, weil sie jeweils innerhalb eines monistisch konstruierten Denkmodus erfaßt worden sind, der für sich selbst Wahrheit beansprucht und infolgedessen andere Modelle ausschließt. So setzt sich Al Gabiri mit der Frage der Rationalität im arabischislamischen Denken und Kulturerbe auseinander mit dem Ziel, eine Dichotomie zwischen dem Denkmodus des Maschreqs und dem des Maghrebs zu konstruieren und daraus eine rationale Überlegenheit des letzteren gegenüber dem ersten abzuleiten. Dieses Verfahren schließt jedoch einen nicht zu unterschätzenden Teil des rationalistischen Kulturerbes im Islam aus, der im Maschreq entstanden und auch für die philosophische und wissenschaftliche Ausrichtung im Maghreb grundlegend gewesen ist. Das deutlichste Beispiel hierfür ist die systematische Aufarbeitung der aristotelischen Werke durch Al Farabi, der ‚der zweite Lehrmeister‘ (nach Aristoteles) genannt worden ist, bevor beide von Ibn Ruschd ausführlich gelesen und kommentiert wurden. Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn der erste Herausgeber der Schriften von Al Farabi, der Orientalist F. Dieterici, diesen zum eigentlichen Begründer der arabisch-islamischen Philosophie erhoben25 und sein Werk gebührend gewürdigt hat. Auch wäre die Kritik der andalusischen und maghrebinischen Denker wie Ibn Baga, Ibn Tufail oder Ibn Ruschd an den Widersachern der philosophischen Anschauungen aus dem Raum des Maschreqs ohne die Bezugnahme auf deren Werke und Wirken nicht erfolgt. Denn die wichtigsten philoso25 F. Dieterici, Al Farabi als Begründer der arabischen Philosophie. In: Al-Farabis Abhandlung ‚Der Musterstaat‘ aus Londoner und Oxforder Handschriften, hg. und übertr. von F. Dieterici, Nachdruck der Ausgaben von Leiden 1895 und 1900, Hildesheim, Zürich, New York 1985. 74 Mohamed Turki phischen Hauptschriften von Ibn Ruschd sind als direkte oder indirekte Repliken der Schriften von Ibn Sina und Al Ghazali auf der Basis rationaler Argumentation und Demonstration konzipiert und verfasst worden. Daher kann, was Al Gabiri leider nicht beachtet, die rationale Beweisführung weder methodisch noch erkenntnistheoretisch einseitig für das maghrebinische Denken beansprucht werden. Sein falscher Monismus führt ihn infolgedessen zu einer eindimensionalen Lektüre des arabisch-islamischen Kulturerbes, die weniger der Wahrheitsfindung als der Ideologie dient.26 Anders als Al Gabiri bemüht sich Arkoun bei der Behandlung dieser Problematik um eine kritische Distanz gegenüber den von ihm fokussierten Paradigmen. Sie gelingt ihm zum Teil auch bei seiner Analyse und Kritik der ‚islamischen Vernunft’, da er die Spezifische einer solchen Vernunft nicht zu definieren unternimmt, sondern ihre Besonderheit vielmehr auf dem Hintergrund eines bestimmten Ensembles von Inhalten sprachlicher, religiöser und kultureller Provenienz herausstellt. Er kommt deshalb zum Schluß, dass „eine radikale Kritik der islamischen Vernunft nicht zu trennen ist von der Analyse hegemonialer Strukturen in den islamischen Gesellschaften“.27 Allerdings beschränkt sich Arkoun auf die negativen Felder der islamischen Vernunft und deren Problembereiche, ohne sie jedoch in Beziehung zur ‚westlichen Vernunft’ zu bringen, die ihrerseits die ‚islamische Vernunft’ als eine Herausforderung für sich und ihre Wertvorstellungen beurteilt. Insofern bleiben seine Betrachtungen auf der Ebene einer kritischen Bestandsaufnahme der vorherrschenden Strukturen islamischer Vernunft stehen, anstatt auch Lösungen für die Aufhebung der hegemonialen Mechanismen in beiden Modellen zu entwickeln. Auch wenn er am Ende seines Aufsatzes die Frage aufwirft: „Was ist zu tun? Welche Haltung kann die Vernunft in einem Umfeld voller dramatischer Herausforderungen einnehmen?“, so antwortet dann doch bloß in der Form eines Appells an die islamischen Intellektuellen, ihren Beitrag zur Verwirklichung eines neuen historischen Modells zu leisten, „das den Hoffnungen und Sehnsüchten von 26 A.v. Kügelgen, Averroes und die arabische Moderne, a.a.O., 280 ff. – Die Autorin fasst in ihrer Studie die wichtigsten kritischen Einwände gegen Al Gabiris Interpretation seitens der zeitgenössischen arabischen Intellektuellen zusammen. 27 M. Arkoun, „Westliche“ Vernunft kontra „islamische“ Vernunft?, a.a.O., 271. Arabische Vernunft versus westliche Vernunft? 75 Menschen unterschiedlicher Kulturen glaubwürdig Rechnung trägt“.28 Er bleibt so hinter den von ihm zuerst gestellten Erwartungen zurück. Bereits 1973 hatte Arkoun in dem schon erwähnten Artikel L’islam face au développement diese grundsätzliche Frage aufgeworfen: „Wie lassen sich dem menschlichen Geist die Bedingungen und die Mittel zur permanenten Wiedergewinnung seiner Freiheit sichern, die von einer ständigen Überwindung der Formen, der Rahmen, der Themen, der Bedeutungen, der Verfahren und der Stile ausgeht, welche eine Tradition, d. h. einen Ort der Wiederholung, der Aufbewahrung und der Eingeschlossenheit, zu konstituieren versuchen?“29 Hier scheint Arkoun nach den Bedingungen der Möglichkeit für eine Befreiung des menschlichen Geistes von den ihm auferlegten Zwängen zu fragen, die er als Grundvoraussetzung für die Emanzipation des Menschen schlechthin versteht. Aus dieser Sicht aber werden Paradigmen wie die einer ‚westlichen‘, ‚arabischen‘ oder ‚islamischen Vernunft’ als bloß ideologische Konstrukte wahrgenommen und entsprechend widerlegt, weil sie von den jeweiligen geographischen, historischen und politischen Positionen des Benennenden abhängig sind und einen Ausschlußcharakter für diejenigen implizieren, die nicht dazugehören. Hier formuliert Arkoun ein Vorhaben, das nicht nur in der Kritik an den bestehenden und herrschenden Strukturen besteht, die die Vernunft an einen bestimmten Ort oder an eine gewisse Tradition binden und einschließen, sondern fordert deren radikale Überwindung. Es gleicht Kants Aufsatz Zur Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? vor mehr als zwei Jahrhunderten. Und genauso wie in dieser Schrift geht es auch heute noch um die Befreiung der Vernunft aus der selbst verschuldeten wie fremdbestimmten Unmündigkeit, deren Bedingungen freilich der jeweiligen Situation angepaßt sein müssen. Im gegenwärtigen Zeitalter der Globalisierung der Wirtschaftssysteme und der medialen Vernetzung wirkt die ‚westliche‘ Vernunft zwar weiterhin als hegemonial; aber sie fordert zugleich die Menschheit zu einem globalen Denken heraus, das weder monistisch noch dualistisch verfahren darf, sondern das sich interkulturell entfaltet und globale Lösungen für die brennenden Menschheitsprobleme sucht. Dieses Denken kann den Dialog zwischen den Kulturen ebenso fördern wie es die Interaktion der verschiedenen 28 29 Ebenda, 274. M. Arkoun, Essais sur la pensée islamique, a.a.O., S.305, (H.v.m.). 76 Mohamed Turki Denksysteme vorantreibt, so dass aus ihm keine hegemoniale Vernunft mehr entspringt, sondern eine universale, aus ethischer und ‚geschichtlicher Verantwortung‘30 handelnde Vernunft entsteht, die angesichts der ‚neuen Welt-Un-Ordnung‘31 die Menschheit sowohl vor einem ‚Kampf der Kulturen‘ als auch vor einer planetarischen Bedrohung zu retten trachtet. Sie mag heute als Utopie erscheinen; dennoch gehört das Vertrauen in einen solchen Wandel der Vernunft zur Leitidee des ‚Prinzips Hoffnung‘. Anzeige WIDERSPRUCH Münchner Zeitschrift für Philosophie Nr.38 Ökologische Ästhetik Konrad Lotter: Traditionelle und ökologische Naturästhetik Jost Hermand: Ökologiebewußte Ästhetik Norbert Walz: Die Erlösung der Natur Wolfgang Thorwart: Der moderne Künstler Manuel Knoll: Zu Michel Foucaults Genealogie des modernen Subjekts Wolfgang Habermeyer: Für einen Lehrer ... und viele Rezensionen philosophischer Neuerscheinungen erhältlich in allen uni-nahen Buchhandlungen Preis: 6.- EUR 30 W. Schmied-Kowarzik, Denken aus geschichtlicher Verantwortung, Wegbahnungen zur praktischen Philosophie, Würzburg 1999, 25. 31 W. Ruf, Die neue Welt-Un-Ordnung, Vom Umgang des Sicherheitsrats mit der Souveränität der „Dritten Welt“, Münster 1994. Charme I. Sucharewicz Die israelische Entwicklung – multikulturelle Gesellschaft und übergeordnete Kultur „Wenn anderswo ein Mensch plötzlich zu gackern beginnt, nimmt man an, dass er den Verstand verloren hat. In Israel nimmt man an, dass er ein Neueinwanderer aus der südlichen Mandschurei sei, der sich in seiner Muttersprache verständlich zu machen sucht. Und wenn er sich Spinat in die Haare schmiert, darf man die Möglichkeit nicht ausschließen, dass es sich hier um eine alte bolivianische Volkssitte handelt.“ Ephraim Kishon Für ein gewisses Land eine bestimmte Kultur festzulegen, ist immer ein schwieriges Unterfangen; denn je nach Interpretation fällt die Definition von Kultur anders aus. Besonders schwierig freilich ist die Darstellung der israelischen Kultur; denn der junge Staat ist von den unterschiedlichsten traditionellen, religiösen, nationalen und ideologischen Einflüssen geprägt. Trotz dieser Schwierigkeiten wird im folgenden versucht, die israelische Kultur zu charakterisieren, um Einsicht in aktuelle Tendenzen der israelischen Gesellschaft zu gewinnen. Die zentrale Fragestellung: „Multikulturelle Gesellschaft oder übergreifende Kultur“ wird im letzten Teil mit: „beides“ beantwortet. Eine eindeutigere Antwort läßt die gegenwärtige Situation in Israel nicht zu; denn das Land spaltet sich weder in kleine Gruppen auf, noch hat sich eine einheitliche Kultur herausgebildet, welche die Unterschiede der Einwanderer gänzlich aufheben würde. 1. Historischer Rückblick Unter der osmanischen Herrschaft lebten in Palästina, im sog. „Alten Yishuw“, bereits vereinzelt Juden. Sie waren hauptsächlich Jemeniten, die vor Repressalien geflohen oder religiösen Wortführern ins ‚Heilige Land’ gefolgt waren, um dort auf die messianische Erlösung zu warten. Die ersten organisierten Einwanderungswellen werden von Historikern verschieden 78 Charme I. Sucharewicz datiert und in ihrem Ausmaß unterschiedlich eingeschätzt. Nach vorherrschender Meinung wird als Beginn der ersten großen Einwanderungswelle, der ersten Aliya, die durch antijüdische Pogrome in Russland ausgelöst wurde, das Jahr 1881 angegeben. Außer osteuropäischen Juden wählten in dieser Zeit auch arabische Juden, welche gleichfalls unter ihren Regimen zu leiden hatten, Palästina als Zufluchtsort. Die Zahl der Einwanderer in dieser Zeit wird auf etwa 20.000-30.000 geschätzt. Die Einwanderer errichteten landwirtschaftliche Siedlungen, die ihren sozialistischen Idealen entsprachen. Sie betrachteten sich als Pioniere, denen im Laufe der Zeit größere Volksmassen folgen würden. Den entscheidenden Wandel des Projekts der nationalen Wiedergeburt in Palästina bewirkten die Einwanderer der zweiten Aliya der Jahre 1904 bis 1914. Ungefähr 35.000 bis 40.000 Juden, die zum großen Teil den erneuten russischen Pogromen entflohen waren, folgten den zionistischen Aufrufen. Die zumeist osteuropäischen Juden hielten am Aufbau landwirtschaftlicher Siedlungen fest und gründeten die ersten Kibbuzim. Dabei verwirklichten sie sowohl sozialistische Vorgaben als auch sicherheitspolitische Ziele, indem sie die Siedlungen, die auch der Verteidigung dienten, an strategisch wichtigen Punkten errichteten. Die dritte Aliya setzte ab 1919 ein und endete 1923. 35.000 osteuropäische Juden fanden dabei den Weg ins Heilige Land. Erst die vierte Aliya bewirkte eine grundlegende Änderung der gesellschaftlichen Zusammensetzung. In den Jahren 1924 bis 1929 emigrierten viele Angehörige des Mittelstandes (Kleingewerbetreibende, Händler) aus Polen und anderen europäischen Ländern. Das Besondere war, dass sie nicht aus zionistischen Erwägungen – also ideologischen Gründen –, sondern aufgrund wirtschaftlicher Diskriminierung in ihrem Ursprungsland auswanderten. Die Wahl Palästinas als Zielort hatte weitaus weniger mit religiöser Verbundenheit oder Traditionsbewusstsein zu tun, als mit der Tatsache, dass die USA (bis dato beliebtestes Fluchtland) kurz zuvor ihre Einwanderungsbestimmungen verschärft hatten. Circa 62.000 Menschen fanden ihren Weg nach Palästina. Mit der fünften Aliya in den Jahren 1932 bis 1938 erreichten 197.230 Menschen das Heilige Land. Die deutschen, tschechischen und österreichischen Juden, die noch rechtzeitig dem NS-Regime entkommen konnten, entschieden sich für die urbanen Zentren des Landes. Die israelische Entwicklung 79 Die Staatsgründung Israels im Jahre 1948 führte nicht zu einer Zäsur der gesellschaftlichen Entwicklung, sondern bewirkte in gewisser Weise die vorläufige Festschreibung bestehender Einflüsse. Erst in der Folgezeit kam es zu teilweise tiefgreifenden Wandlungen der israelischen Gesellschaft. Erste Anzeichen der Umstrukturierung, die zum heutigen Bild der israelischen Kultur erheblich beitrugen, waren insbesondere die Einwanderungswellen der 80er und 90er Jahre aus Russland und Äthiopien, die demographisch wie kulturell Verschiebungen zur Folge hatten. Bei den russischen Immigranten handelte es sich zum erheblichen Teil um Nichtjuden, die die Gelegenheit nutzten, ihr Heimatland zu verlassen. Dementsprechend war ihre religiöse oder emotionale Bindung an die israelische Gesellschaft eher gering. Mittlerweile hat sich eine Art Symbiose eingestellt: auf der einen Seite profitieren die osteuropäischen Neuankömmlinge von den günstigen Bereitstellungen (Unterkunft, Arbeit, Sprachkurse, etc.) der Regierung, die eine bequeme Existenzgrundlage sichern; auf der andern Seite fand eine breite akademische und künstlerische Schicht, insbesondere Ärzte und Musiker, Eingang in die israelische Gesellschaft. Derzeit ist der Grad ihrer Integration ambivalent zu bewerten. Während einige mit uneingeschränkter Bereitschaft eine Anknüpfung an die Gesellschaft erstreben, scheint ein Großteil die russischen Traditionen nicht aufzugeben, wie insbesondere sein Festhalten an der eigenen Sprache zeigt. Dementsprechend hat sich mittlerweile eine Art russischer Subkultur etabliert, die oftmals fernab von der israelischen Kultur existiert. Die äthiopischen Einwanderer hingegen stellten die israelische Gesellschaft anfangs vor ein gänzlich unbekanntes Phänomen. Denn erstmals kam eine Gruppe ins Land, deren zivilisatorischer Grad sich drastisch von der übrigen Gesellschaft unterschied. Viele der äthiopischen Einwanderer kannten keine moderne Technologie und bekamen bei ihrer Einreise erstmals Flugzeuge und Autos zu Gesicht. Erstaunlicherweise ist es dennoch rasch gelungen, sie an die Normen und Technologien der modernen Gesellschaft heranzuführen. Die zweite Generation der Äthiopier betrachtet sich mittlerweile als vollständig integrierten Teil der israelischen Gesellschaft. 2. Definitionsversuch des Kulturbegriffs in Israel aus heutiger Sicht Eine Definition der israelischen Kultur muss problematisch bleiben, weil schon in der Bestimmung „Wer ist Jude?“ kein Konsens besteht. Während 80 Charme I. Sucharewicz orthodoxe Juden eine religiöse Zuordnung streng nach dem talmudischen Gesetz auslegen, hat es in Israel immer wieder Bestrebungen gegeben, dieses Gesetz zu liberalisieren, wenn nicht gar fallen zu lassen. So brachte ein Knessetabgeordneter den Entwurf ein, es solle jedem selbst überlassen sein, sich als Jude zu definieren. Bis heute konnte darüber noch keine Übereinstimmung erzielt werden, so dass der Minimalkonsens herrscht, dass zumindest die Mutter jüdisch sein müsse. Zudem ist die Unterscheidung zwischen jüdischer und israelischer Kultur bzw. zwischen Religiösen und Säkularen problematisch. Ebenso erschwert die Existenz israelischer Araber eine genaue Zuordnung der vorherrschenden Kultur. Diese zum Teil eklatanten Vorstellungsabweichungen werden auch in der bislang ungelösten Debatte über eine einheitliche Verfassung erkennbar. Bis jetzt ist es der Regierung nicht gelungen, auch nur ansatzweise eine Konstitution zu verabschieden, so dass die Grundzüge der Gesellschaft nach wie vor nur durch einzelne Gesetze mit verfassungsrechtlichem Rang vorgegeben werden. Seit ihrer Existenz ist die israelische Gesellschaft von Heterogenität geprägt. Dass es bei all den Unterschieden der nationalen Herkunft, der Glaubensintensität und der ideologischen Ausrichtung dennoch gelang, einen innerisraelischen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten, dafür lassen sich im wesentlichen drei Gründe benennen. Einer der wichtigsten Faktoren für den starken israelischen – aber auch universaljüdischen – Zusammenhalt ist historisch bedingt: Verfolgungen, Pogrome und Antisemitismus führten dazu, dass die jüdische Kultur auch in der Diaspora gepflegt wurde. Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Israelis beruht daher keineswegs nur auf der Religion, sondern zum erheblichen Teil auch auf dem historischen Leidensweg des Volkes wie der Vertreibung durch die Ägypter, den Siegen der Philister und später der Ammoniter oder der Zerstörung der beiden Tempel (586 v. Chr. durch die Babylonier, 70 n. Chr. durch die Römer). All diese Erinnerungen des Schreckens übten über viele Jahrhunderte eine historisch-gesellschaftliche Kraft aus, die zur kollektiven Bindung führte. Der Holocaust symbolisiert das gesamte Leid der Geschichte des jüdischen Volkes. Im Zuge der Säkularisierung wird das erfahrene Leid allerdings nicht mehr als göttliche Determination bzw. verdiente Strafe oder Sühne interpretiert, sondern als profane Geschichte angenommen. Der säkulare Zionismus brach mit der Tradition, Judenverfolgungen als gottge- Die israelische Entwicklung 81 wolltes Schicksal wahrzunehmen. Die kollektive Leidensempfindung erfasste alle Bürger Israels, so dass unter sephardischen Juden mittlerweile die gleiche Identifizierung mit den Opfern nachweisbar ist wie bei aschkenasischen Juden. Israelis orientalischer Herkunft – sie bilden mittlerweile fast die Hälfte der israelischen Bevölkerung – waren im Gegensatz zu den Europäern vom Holocaust kaum betroffen. Sie litten vielmehr in den nordafrikanischen und westasiatischen Gesellschaften unter Anfeindungen in dem Maße, wie der Konflikt zwischen Zionisten und Palästinensern die gesamte arabische Welt erfasste und dort insbesonders in den 40er Jahren zu Judenverfolgungen führte. Als sich der zionistisch-arabische Gegensatz nach der Staatsgründung zuspitzte, stieg auch die Intensität des Willens der orientalischen Juden, sich gegenüber der einstigen Heimat abzugrenzen. Zum zweiten beruht die jüdische Identifizierung über die rein religiöse Zuordnung hinaus auf dem Gefühl der Volkszugehörigkeit. Dies Gefühl mag als wichtigster Schlüssel für den Überlebenswillen der jüdischen DiasporaGemeinden über lange Zeit gedient haben. Als im 18. Jahrhundert durch Moses Mendelssohn die jüdische Aufklärung in beinahe allen europäischen Ländern einsetzte, begann ein starker Trend zur Assimilierung, der bis heute insbesondere in Westeuropa anhält. Die Euphorie über die neu erlangten Rechte der wirtschaftlichen und später auch politischen Gleichstellung ebnete den Weg für eine zunehmende Säkularisierung, während bis dato die talmudischen Gesetze einen zentralen Stellenwert im jüdischen Alltag eingenommen hatten. Diese hatten zum einen der bewussten Abgrenzung von der nichtjüdischen Umwelt gedient; zum anderen waren die religiösen Lehren der einzige Bereich gewesen, der ungehindert ausgelebt werden konnte. Als im Zuge der Emanzipation den Juden dann fast sämtliche Berufswege offen standen, und sie allmählich ins gesellschaftliche Leben integriert wurden, standen die religiösen Bindungen im Wege. In der Folgezeit unternahm ein Großteil der jüdischen Gemeinden den Versuch, sich der nichtjüdischen Umwelt äußerlich (Kleidung, Wohngebiet) und innerlich (Studien, weltliches Wissen) anzupassen. Doch trotz der allmählichen Assimilierungstendenzen riss das einigende Band der Volkszugehörigkeit nie ab, wie etwa die Solidarisierungsaktionen mit den verfolgten Juden in anderen Ländern verdeutlichen. Aus heutiger Sicht kommt noch ein dritter Faktor hinzu: die exponierte geographische Lage des Staates Israel. Die israelische Identität wird nicht zu- 82 Charme I. Sucharewicz letzt durch die äußere Bedrohung und die beachtlichen Aufbauleistungen geprägt, die sowohl trotz als auch wegen der Bedrohung erbracht wurden. Äußere Gefahren wirkten und wirken in dreifacher Weise nach innen positiv: integrierend, motivierend und mobilisierend. So ermöglicht die externe Bedrohung die schnelle Integration von Neueinwanderern, die existentiell wichtige Beiträge leisten wie etwa zur Vergrößerung der nach wie vor zahlenmäßig geringen jüdischen Bevölkerung oder durch die allgemeine Wehrpflicht. Die äußere Bedrohung durch die arabischen Nachbarn bzw. durch die arabischen Israelis führt zur inneren Solidarisierung. So gilt – wie in den meisten Ländern – traditionell der Primat des Konsenses in Kriegszeiten. Weder parteiübergreifende Streitigkeiten noch andere Einflüsse vermögen in Krisenperioden den innerisraelischen Zusammenhalt zu erschüttern. Die Lehre, die man aus jahrtausendlangen Verfolgungen und Demütigungen zog, lautet eindeutig: Nie wieder Opfer. Sie erklärt die außergewöhnlich kompromisslose Einigkeit bei äußerer Bedrohung. Paradoxerweise liegt jedoch genau hierin eine Gefahr für das Weiterbestehen der israelischen Gesellschaft. Denn ein Minimalkonsens, der von äußerer Bedrohung linear abhängt, bricht in Friedenszeiten auseinander. Da dem jungen Staat eine Periode der Sorgenfreiheit jedoch noch nicht beschert war, bleibt der Testfall abzuwarten. 3. Errungenschaften und Probleme der israelischen Gesellschaft Eine grundsätzliche Bilanz muß die heutige israelische Gesellschaft aus zwei Perspektiven beurteilen. In einigen Bereichen kann dem Staat eine Vorbildfunktion zugesprochen werden. Es ist Israel gelungen, sich als einziger stabiler demokratischer Staat im Nahen Osten zu etablieren und – auch wenn dies vor allem von der deutschen Linken und Rechten vermehrt angezweifelt wird – am Prinzip der Rechtsstaatlichkeit festzuhalten. Ein weiterer Grund gibt Anlaß zur Anerkennung der israelischen Leistungen: die hohe gesellschaftliche und politische Bereitschaft zur Integration der Neueinwanderer. Jahr für Jahr werden in einem unvergleichlichen Kraftakt Neuankömmlinge sozial, politisch und wirtschaftlich integriert. Einwanderung wird gemeinhin als moralisch wertvoll erachtet; der Begriff für Einwanderung „Aliya“ (Aufstieg) verdeutlicht dies. So entstehen fast monatlich wie selbstverständlich neue Siedlungen, um den Immigranten schnellstmöglich Wohnorte anzubieten. Dass dabei nicht ein sprichwörtlich gewordener mel- Die israelische Entwicklung 83 ting pot als Vorbild dient, ist begrüßenswert. Das Ziel besteht nicht in einer künstlichen Zwangsassimilierung, sondern in der natürlichen Eingliederung in die Gesellschaft. Der Gründer des modernen politischen Zionismus Theodor Herzl sprach sich in „Der Judenstaat“ für die Beibehaltung von Sprachen und Wertvorstellungen der Einwanderer aus mittel- und westeuropäischen Ländern aus. Auch wenn das Hebräische heute de jure die offizielle Amtssprache bildet, so wird jeder aufmerksame Beobachter in Tel Aviv feststellen können, dass dort russisch, deutsch, französisch und englisch wie selbstverständlich gesprochen wird, und dass ein marokkanischer oder irakischen Akzent ebenso gewöhnlich geworden ist. Heutzutage existieren auf erstaunlich natürliche Weise verschiedenste kulturelle, ideologische, politische und religiöse Traditionen nebeneinander: Orthodoxe, Sephardim, Aschkenasim, ehemalige Sozialisten und Kommunisten, arabische Christen, Muslime, Rumänen, Thais und andere mehr. Das israelische Parlament, die Knesset, ist der anschaulichste Schauplatz dieser salad bowl. Kaum ein anderes Land weist derart unterschiedliche kleine Splitterparteien auf, welche die zahlreichen Gruppierungen der israelischen Gesellschaft repräsentieren. Zum zweiten gilt in Israel unangefochten der Wert der sozialen und familiären Bindungen. Die Einbindung der älteren Generation ist vorbildlich und läßt auf Verbreitung hoffen. Während in den meisten Industriestaaten zu Weihnachten die Selbstmordrate am höchsten ist, gilt es in Israel als selbstverständlich, an Festtagen Nachbarn, Alleinstehende und Bekannte einzuladen. Bei allen Errungenschaften dürfen jedoch die Schattenseiten nicht übersehen werden. Noch scheint die Israelis ein einigendes Band zusammenzuhalten. Doch in den letzten Jahren haben sich innergesellschaftliche Spannungen intensiviert. Die oft nur latent beklagte Benachteiligung der sephardischen Juden gegenüber den und durch die Aschkenasim ist nur einer der potentiellen Konfliktherde. Weitaus schwieriger dürfte sich das Verhältnis der säkularen Mehrheit gegenüber der zunehmend fanatisch werdenden orthodoxen Minderheit gestalten. Ein systemimmanenter Fehler israelischer Politik liegt in der niedrigen Sperrklausel (1,5 %) zum Einzug in die Knesset, der religiösen Parteien ein unproportional hohes Mitspracherecht in den Koalitionsregierungen ermöglicht. Momentan formieren sich Gegengewichte, wie die Shinui-Partei, deren primäres Wahlkampfziel die Herausdrängung der Reli- 84 Charme I. Sucharewicz giösen aus der Politik beinhaltet. Die Geschichte Europas hat gelehrt, dass die Trennung von Staat und Kirche unabdingbare Voraussetzung für einen stabilen Frieden ist. Es ist zu hoffen, dass diese Einsicht sich langfristig auch in der muslimischen Welt durchsetzen wird. Für die weitere Entwicklung der israelischen Gesellschaft bleibt gleichermaßen zu hoffen, dass die ratio über die religio siegen und damit eine Basis für eine im Kantschen Sinne vernunftgemäße Politik geschaffen wird. Der augenscheinlichste und explosivste Zündstoff liegt freilich im sich verschärfenden israelisch-palästinensischen Konflikt. Zwar sind die Palästinenser ein realer Bestandteil der Gesellschaft, der in der Praxis jedoch kaum integriert ist. Umgekehrt wird von Palästinensern eine friedliche Koexistenz durch Anschläge auf die Zivilbevölkerung sabotiert. Bei der Suche nach Lösungen dieses Dilemmas sind allerdings oberflächliche oder einseitige Berichterstattungen, wie sie im Westen oft vorgenommen werden, wenig hilfreich. Hier kann nur eine unvoreingenommene historische Betrachtung dieses Konfliktes dessen Komplexität und die immer wiederkehrenden Sackgassen verdeutlichen. Für religiöse oder geschichtsbewusste Juden hatte der 1948 gegründete Staat Israel einen kaum tolerierbaren Geburtsfehler: Er entstand nicht auf dem einstigen biblischen Boden von Judäa und Samaria. Die Eroberungen des Sechs-Tage-Krieges im Juni 1967 machten aus Israel zwar geographisch einen ursprünglich jüdischen, demographisch aber einen jüdisch-arabischen Staat. Damit war der biblische Geburtsmakel beseitigt; er wurde jedoch durch die moralische Bürde des Besatzerstatus ersetzt. Tragischerweise machte sich Israel 1967 durch einen schuldlosen Verteidigungsangriff zum Schuldigen. Daher bleibt die Lösung des Konfliktes mit der palästinensischen Bevölkerung die dringlichste Aufgabe, die sich der Politik Israels heute stellt. Besprechungen Bücher zum Thema Elmar Altvater/Birgit Mahnkopf Globalisierung der Unsicherheit. Arbeit im Schatten, Schmutziges Geld und informelle Politik, Münster 2002 (Westfälisches Dampfboot), geb., 393 S., 24.80 EUR. Das Buch ist eine Fortsetzung der Arbeit über die „Grenzen der Globalisierung”, die die Autoren im gleichen Verlag veröffentlicht haben und die bereits im Widerspruch 31 rezensiert wurde. An der ökonomischen Theorie von Karl Marx orientiert, untersuchen Altvater und Mahnkopf in dieser Arbeit nun die Entwicklung der Globalisierung unter dem Aspekt der Auflösung der Normen hin zu einer „Informalität“ der Arbeit, des Geldes und der Politik. Unter „Informalität“ verstehen sie dabei die Unabhängigkeit von den Regelwerken und Vorschriften der staatlichen Institutionen, die durch die Prozesse der Internationalisierung weitgehend umgangen werden können. Diese neuen Möglichkeiten der Informalität dienen wirtschaftlichen Organisationen rückwirkend als Druckmittel, um von den Nationalstaaten die Lockerung bzw. Auflösung ihrer bisherigen sozialen Normen zu fordern. Für den Einzelnen bringen die Informalitäten so in erster Linie ein hohes Maß an persönlicher und sozio-ökonomischer Unsicherheit. Die gesellschaftlichen Institutionen, die solche Sicherheiten traditionell garantiert haben, werden im Zuge der Globalierung mehr und mehr geschwächt oder ganz aufgelöst. Die Autoren beschreiben, wie in diesem Prozess immer mehr Teile der gesellschaftlichen Arbeit in Bereiche verlegt werden, die gesetzlichen Regelungen und sozialen Absicherungen nicht mehr zugänglich sind; wie das Geld in verschiedener Hinsicht immer weniger kontrollierbar wird: zum einen nimmt der Anteil der Schattenwirtschaft („Schwarzgeld”) zu und damit auch der Bedarf an „Geldwäsche”; zum anderen lösen sich auch die staatlichen Absicherungen der Währungen auf, die so zunehmend zu Spielbällen eines informellen Weltmarkts werden. Als Folge entwickeln sich da, wo ein Mangel an offizieller Tauschwährung mit internationaler Geltung herrscht, neue Binnentauschmärkte. In der Politik hingegen werden die zentralen Entscheidungen zunehmend weniger von den gewählten Volksvertretern und immer häufiger von wirtschaftlichen Organisationen gefällt. Diese stattfindende Informalisierung mit Auflösung der Normen muss jedoch, so die Autoren, für die Individuen nicht nur Nachteile haben. Durch sie könnten verkrustete soziale Strukturen aufgebrochen, das Recht liberalisiert und die Gesell- 86 Bücher zum Thema schaft insgesamt offener gestaltet werden. Mit Bedauern müssen Altvater und Mahnkopf konstatieren, dass die gegenwärtige Informalisierung jedoch fast ausschließlich zum Nachteil der großen Mehrheit stattfindet: Soziale Netze werden aufgelöst, Einkommen werden unsicherer, die Lebensplanung wird erschwert oder völlig unmöglich gemacht; die Mitwirkung des Einzelnen an wichtigen Entscheidungen über und in den demokratischen Instanzen wird mehr und mehr zurückgedrängt. Diese Abhandlung über eines der wichtigsten Teilprobleme der Globalisierung verarbeitet das Material zahlreicher Untersuchungen und bietet selbst umfangreiche Untersuchungen; dabei verzichten die Autoren nicht auf soziale und gesellschaftliche Bewertungen. Percy Turtur Dan Diner Feindbild Amerika. Über die Beständigkeit eines Ressentiments, München 2002 (Propyläen), geb., 238 S., 20.- EUR. In den politischen Diskursen der Bundesrepublik Deutschland gilt eine antiamerikanische Weltanschauung offiziell als verpönt. Eine genauere Betrachtungsweise – so die These Dan Diners, früher aktives Mitglied des „Sozialistischen Büros“ in Frankfurt und heute Professor für Neuere Geschichte in Jerusalem und Leipzig – zeigt jedoch, dass sich trotz dieses institutionalisierten Konsenses tradierte antiamerikanische Einstellungen se- dimentiert haben und oft, zumindest untergründig, das Bild der Vereinigten Staaten mitprägen. Überdies, so eine weitergehende Überlegung Diners, zeigen gerade die Reaktionen auf den 11. September, dass sich „angesichts eines mit dem Verfall der Sowjetunion offenbar gewordenen Paradigmenwechsels“ und damit des Verlusts des Angebots eines einfacheren, verlangsamten Modernisierungsprozesses, „vor allem in Ländern und bei Intellektuellen der vormaligen Dritten Welt, insbesondere im Bereich des arabisch-muslimischen Kulturzusammenhangs, Haltungen herausbildeten, die sich nicht allein aus einer durchaus mit ernst zu nehmenden Argumenten vorgetragenen Ablehnung amerikanischer Politik speisen“ können, sondern sich „ein Vorgang abspielt, der gewisse Ähnlichkeiten mit frühen Reaktionsmustern europäischer Traditionsgesellschaften Amerika gegenüber aufweist – freilich mit erheblichen, den Stadien der jeweiligen Säkularisierung geschuldeten Verschärfungen“ (10/11). So erblickt Diner in den religiös motivierten Anschlägen des 11. September einen „sakralen Akt“, in dem eine aufgrund technologischer Unterlegenheit und der Notwendigkeit, moderne soziokulturelle Produktionsbedingungen schaffen zu müssen, unter Säkularisierungsdruck stehende Religionsgemeinschaft ein Zeichen ihrer unvergänglichen Superiorität gegenüber der verruchten westlichen Zivilisation, für die die USA als Synonym steht, setzen wollte. Diese, im Prozess der „Globalisierung“ universal gewordene, Synony- Bücher zum Thema misierung der USA mit einer „ohnehin zwiespältigen“ Moderne, vor allem ihrer dunklen Seite, spielt sich – wie schon in der traditionellen dichotomischen Metaphorik von „Alter Welt“ und „Neuer Welt“ anklingt – bestimmend auf einer projektiven Ebene ab: Wie ein positives Amerikabild für Zukunft steht, fungiert es im Negativen – aus der Perspektive auf Herkunft beruhender Traditionsgesellschaften – als Projektionsfläche „eigener Verfallsängste“ und „abgespaltener Teile von Selbsthass“. In dieser Ambivalenz betrachtet, repräsentiert Amerika nicht das „Fremde“, sondern das „Andere“. Da dieses Reaktionsmuster sich eben im europäischen Kulturraum herausgebildet hat, ist es legitim, dass Diners Analyse diesen ins Zentrum seiner Untersuchung stellt. Schwerpunktmäßig gilt sein Interesse wiederum Deutschland, da, so die These Dan Diners, es nicht nur aufgrund der negativen Erfahrungen zweier Weltkriege, sondern auch einer traditionellen antiwestlichen Einstellung den Anschein habe, „als ob das antiamerikanische Ressentiment in den politischen Mentalitäten Deutschlands tiefer sitze als anderswo in Europa“, beispielsweise den klassischen westlichen demokratisch-bürgerlichen Gesellschaften Englands Diners Untersuchung, oder Frankreichs.die er bescheiden einen „polemischen Essay ohne akademischen Anspruch“ nennt – polemisch wohl im Sinne einer methodischen Zuspitzung –, verweist unverkennbar auf das komplexe historiographische Erkenntnismodell seines grandiosen Hauptwerks „Das 87 Jahrhundert verstehen“ (siehe Rezension in: Widerspruch 35), auf den Stellenwert, den er den sich in Bildern sedimentierenden und zu decodierenden „langen Gedächtnissen“ und Ungleichzeitigen beimisst. So wird nachvollziehbar, warum Diner die Wirkungen antiamerikanischer Ressentiments oft als das Resultat von Verdrängungen, Verkehrungen, Abspaltungen, Wiederholungszwängen, Exkulpierungen oder narzisstischen Kränkungen deutet. Beispiele wären etwa die assoziative Verknüpfung der Irakkriege mit den so bezeichneten „anglo-amerikanischen“ Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg, oft im Verbund auftretend mit dem ultrareaktionären landserideologischen Klischee amerikanischer Wehruntüchtigkeit bei rein technischer Überlegenheit oder die Etikettierung des zweifelsohne verbrecherischen Vietnamkriegs als Nazi-Verbrechen, wie es in dem Slogan „USA/SA/SS“ zum Ausdruck kam. Diner ist sich der Problematik seines Ansatzes bewusst. Gerade angesichts der Verschränkung von „amerikafeindlicher Metaphorik als Ausdruck von Weltanschauung und Ressentiment einerseits“ und empirisch oft gut belegter „Kritik an tatsächlich kritisierenswerten Auswüchsen in den Vereinigten Staaten, an Missständen der politischen Kultur, Sozialstruktur, Wirtschaftsgebaren“ (25) andererseits, erweist es sich als erforderlich, in einer differenzierten Analyse den kontextuellen Bezug herauszuarbeiten, um zwischen „blindem Ressentiment“ und reflek- 88 Bücher zum Thema tierter „geschichtsbewusster Kritik“ unterscheiden zu können. Seine auf breites Quellenstudium gestützten Untersuchungen führen den Historiker in die Romantik zurück, um von dort aus die Traditionen und Wirkungen amerikafeindlicher Stereotype bis in die Gegenwart zu verfolgen. Grundmuster sind der Vorwurf des Utilitarismus und Materialismus, die manichäisierende Gegenüberstellung von Kultur und technisch-rationalistischer Zivilisation und ein darauf basierender Überlegenheitsdünkel sowie die Klage um den Niedergang gewachsener Werte und Autoritäten und die Verwerfung liberaler Anaschauungen. Die typische „Denunziation der Phänomene der Zirkulation als Ursprung allen Unheils“, die schon bei Werner Sombart einem Verständnis von „Kapitalismus“ entspricht, das nicht als Produktionsverhältnis bestimmt ist, weist eine signifikante Affinität von Antiamerikanismus und Antisemitismus auf, die bereits Max Horkheimer erkannte. Die auf die „Neue Welt“ projizierten Modernisierungs- und Entfremdungserfahrungen evozieren Bilder, die in ihrer Ambivalenz von Amerikabegeisterung und -feindlichkeit keinen Widerspruch bilden. So betrachtet Dan Diner die Weimarer Republik als „einerseits in hohem Maß industriell und kulturell amerikanisiert“, andererseits als „eigentliches Treibhaus ideologisch aufschießender Amerikafeindlichkeit“ (41). Selbst die Nazis, die im Amerikanismus den Ausdruck „jüdischer Weltherrschaft“ erblickten und in bekannter Dünkelhaftigkeit dem „verjudeten und vernegerten Mischvolk“ jede Fähigkeit absprachen, konnten ihre Bewunderung für amerikanische Technik und Massenkultur nicht verhehlen. Obwohl Diner einer linken, von der Aufklärung inspirierten Betrachtungsweise Amerikas attestiert, komplexer und ambivalenter zu sein als die einer rückwärtsgewandten Kulturkritik, deckt er, trotz des unterschiedlichen Bezugsrahmens von „Herkunft“ und „Gesellschaftskritik“, Befangenheiten in „oft den selben Codes“ und in „gleichen oder ähnlichen Bildern“ auf. Diese in der Tat frappierenden Parallelen finden sich beispielsweise gleichermaßen bei Heine, Clara Zetkin, dem frühen Enzensberger oder anderen Kursbuchautoren wie in einer „antiimperialistischen“ nationalistischen Umdeutung des Zweiten Weltkriegs in der DDR. Diner ist dennoch weit davon entfernt, einem idealisierten Bild Amerikas zu erliegen. Sieht er doch gerade jenes über sich hinausweisende amerikanische Zukunftsmodell einer multiethnischen und multikulturellen „universalen Republik“, das sich einer Verhaftetheit in Herkunft und Tradition überlegen weiß, durch eine in der Folge des 11. September in Gang gesetzte territoriale Politik gefährdet, die sich im Inneren in der Gestalt einer – allerdings, so Diner, nicht wesenstypischen – repressiven Staatlichkeit, außenpolitisch im Bestreben, Territorialitäten zu schaffen, sowie in einer unilateralistischen Tendenz der Verbindung von isolationistischer und interventionistischer Politik äußert. Bücher zum Thema Georg Koch 89 90 Bücher zum Thema Terry Eagleton Was ist Kultur? Eine Einführung aus dem Englischen von H. Fliessbach, München 2001 (C.H. Beck), engl. Br., 190 S., 17,50 EUR. Titel und Gliederung des Buches versprechen eine Einführung. Es beginnt mit der Etymologie des Wortes, einer kurzen Geschichte des Begriffs, den Krisen, denen das gegenwärtige Interesse an der Kultur entspringt sowie den Methoden des Zugangs („Versionen der Kultur“). Im Hauptteil werden drei Probleme diskutiert, die die Aktualität und Brisanz des Begriffs ausmachen: „Kultur in der Krise“, „Kulturkriege“ und „Kultur und Natur“. Den Schluss bildet ein Plädoyer für die Ausbildung einer gruppen- oder klassenübergreifenden „gemeinsamen Kultur“, das sich gegen T.S. Eliots Aufspaltung in eine (ästhetisch-geistige) Kultur der Elite und eine („Habitus“-) Kultur der Massen wendet und Raymond Williams Definition der Kultur als das „kollektive Produkt aller“ (166) weiterdenkt. Tatsächlich ist das Buch zugleich weniger und mehr als eine Einführung. Weniger, weil es zwar eine Reihe von Kulturtheorien zitiert – Eagleton bezieht sich auf Herder und Schiller, Nietzsche und Freud, vor allem aber auf englischsprachige Autoren wie Coleridge, Matthew Arnold, F.R. Leavis, R. Williams, T.S. Eliot u.a. – aber nicht eigentlich entfaltet und diskutiert. Der Leser bleibt über die Reichweite, die philosophischen Hintergründe, die ideologische Stoßrichtung weitgehend im Unklaren; ihre Kenntnis wird eher vorausgesetzt als dass sie vermittelt würde. Mehr, weil Eagleton über eine bloße sachliche Einführung hinaus vor allem im eigenen Namen spricht, d.h. eine eigene Kulturtheorie darlegen möchte, deren philosophische Grundlagen zwischen einem undogmatischen Marxismus und einem ebenso undogmatischen, „abgebrühten“ Postmodernismus angesiedelt sind. Bezeichnend für Eagletons Marxismus ist, dass er die drei hauptsächlichen Kulturbegriffe, die das 19. Jh. hervorgebracht hat – Kultur als utopische Kritik der kapitalistischen Zivilisation; Kultur im Plural als Bezeichnung nationaler Lebensformen; Kultur als „höhere“ Kultur, d.h. als Kunst und Philosophie – dialektisch miteinander verbinden möchte. Damit wird Kultur zu einer Art „immanenter Kritik“, die zugleich von der Gesellschaft produziert und gegen die Gesellschaft (in ihrer bestehenden Form) gerichtet ist, d.h. „der Gegenwart den Spiegel vorhält und sie an Normen misst, die sie selbst hervorgebracht hat“ (35). Bezeichnend für Eagletons Postmodernismus ist, dass er die Kultur als Lehre von der Differenzierung des Menschen versteht, als Gegenbewegung und Protest gegen die egalisierenden Tendenzen der modernen Ökonomie, Politik und Wissenschaft. Eine andere Dialektik sieht Eagleton in der Gegenwart am Werk, in der sich das Besondere der westlichen Kultur zum Allgemeinen der globalen Kultur erhebt. Je mehr der Westen „jede Alternative zu sich selbst niederwalzt“, desto schwächer Bücher zum Thema wird am Ende seine eigene Identität; indem sich ein System absolut setzt, verschwindet es und zerfällt in unendliche Differenzen. „Postmodernismus ist das, was geschieht, wenn das System bis zu dem Punkt anschwillt, wo es alle seine Gegensätze in sich aufzuheben scheint und daher kein System mehr ist.“ (103) Auf verschiedenen Ebenen macht Eagleton auf das prinzipiell Widersprüchliche des Kulturbegriffs aufmerksam: als zugleich deskriptiver und normativer Begriff; als zugleich Ausdruck und Kritik der Gesellschaft; als zugleich Verbindendes, d.h. Bewusstsein der eigenen Identität und Trennendes, „wofür man tötet“ (57); als Spiritualität, Esoterik („hohe Kultur“) und als Ware oder Konsum („Massenkultur“); als Kultur oder absoluter Wert und als Kultur des alltäglichen Umgangs miteinander, d.h. als Komplex von Sitten, Gebräuchen, Überzeugungen und Praktiken einer bestimmten Gruppe von Menschen. Die zwischen so unterschiedlichen Disziplinen wie Philosophie und Soziologie, Politik und Geschichte, Ethnologie und Kunst geführte Diskussion schwankt zwischen einem außerordentlich weiten (Kultur = alles, was vom Menschen produziert ist) und einem überaus engen Kulturbegriff („Firmenkultur“, „Polizeikultur“ etc.). Eagleton sieht und benennt das Problem wohl. In seinen Ausführungen kommt er aber letztlich auch nicht darüber hinaus, dafür ist seine Darstellung zu unsystematisch, zu wenig begrifflich. Beachtenswert ist die Bestimmung des Verhältnisses von Kultur und 91 Natur. Eagleton argumentiert sowohl gegen die Naturalisten, die die Kultur als Funktion der Natur begreifen und auf die jeweiligen Naturverhältnisse zurückführen, als auch gegen die Kulturalisten, die die Natur für restlos aufhebbar und in Kultur überführbar halten. Seine These: Der Mensch ist „zwischen Kultur und Natur eingezwängt“, die „Natur (ist) durch Kultur geprägt“ aber „auch resistent gegen sie“ (139/140). Einerseits schießt die Kultur in ihrer Beherrschung der Natur über das hinaus, was der Mensch zum Überleben benötigt, gewinnt ein Eigenleben und sogar ein Potential der Selbstzerstörung; andererseits wird die Natur zur letzten Einspruchsinstanz gegen die Unterdrückung, die in jeder Kultur auch enthalten ist. An sich selbst, so Eagleton, ist die Kultur unpolitisch; politisch wird sie erst unter konkreten historischen Bedingungen, im Zusammenhang mit dem Kampf um Hegemonie und Widerstand (171). Die Stärke der essayistischen, oft assoziativen Schreibweise des Buches liegt in ihrem Witz. Man freut sich über geistreiche Metaphern und Vergleiche, über Seitenhiebe auf Tony Blair und die „besseren Tage“ der britischen Labour Party, auf die „pathologische Angst der Amerikaner vor dem Rauchen“ (126) – Eagleton führt sie auf die Fetischisierung des Körpers zurück, der sich dem amerikanischen Traum der kulturellen Selbstschöpfung des Menschen entzieht – oder auf Richard Rorty, der sein Fett abkriegt, wo immer er im Text auftaucht. Oft schlägt das Geist- 92 Bücher zum Thema reiche allerdings auch ins Manierierte um. Wenn Eagleton den Horazschen Satz „Nichts Menschliches ist mir fremd“ aktualisiert und in den Satz umformuliert „Jede Bananenrepublik ist heute imstande, unseren Profit zu gefährden“ (69), mag das zwar brillant sein, man versteht aber nicht recht, was er eigentlich besagen soll. Konrad Lotter Heinz Kimmerle Interkulturelle Philosophie zur Einführung Hamburg 2002 (Junius), 167 S., 11.50 EUR. Im vorliegenden Buch gibt H. Kimmerle, bis 1995 Inhaber des Lehrstuhls für Grundlagen der interkulturellen Philosophie an der Universität Rotterdam und Beirat der Gesellschaft für interkulturelle Philosophie, einen einführenden Überblick über dieses neu entstandene Gebiet. Ein solches sei, wie Kimmerle einleitend schreibt, in der Tatsache begründet, dass die verschiedenen Kulturen heute „weniger denn je hermetisch voneinander abgegrenzt“ (7) sind. Die Globalisierung macht die Beschäftigung mit anderen Kulturen schlicht notwendig. Was aber ist interkulturelle Philosophie, und wie versteht sie sich? Etabliert hat sie sich nicht zuletzt aus der Frustration, dass die „offiziellen Vertreter der westlichen Philosophie ... nur selten bereit zu sein (scheinen), sich für die Denkweisen in anderen Kulturen zu öffnen und mit ihnen in Austausch zu treten“ (8). Insofern re- sultiert sie aus der Kritik am traditionellen Eurozentrismus der Philosophie, die nicht nur provinziell um die Beantwortung der von ihr selbst gestellten Fragen kreist, sondern die auch in kolonialer Tradition „andere Kulturen ... als unfähig erachtet, die besondere geistige Anstrengung der Philosophie zu vollbringen“ (8 f.). Dieser kolonialen Tradition setzt die interkulturelle Philosophie, so Kimmerle, einen „Begriff der Philosophie“ entgegen, „bei dem diese mit dem Menschsein und menschlicher Kultur als solcher in einem wesensmäßigen Zusammenhang steht“ (127). Folglich vollzieht sich interkulturelles Philosophieren nicht im intrakulturellen Monolog, sondern im interkulturellen Dialog, dessen Ansätze Kimmerle paradigmatisch anhand der Dialoge mit östlichen, islamischen, lateinamerikanischen, afrikanischen und anderen Philosophien vorstellt. In diesem Sinne ist also das Projekt einer interkulturellen Philosophie als eine entschiedene Öffnung und Erweiterung des „philosophischen Gesprächs“ zu verstehen, das im Prinzip alle Kulturen einbezieht. Zweitens aber ist interkulturelle Philosophie auch das Nachdenken über solches Tun. Ist sie und versteht sie sich als Teilgebiet der Kulturwissenschaften, das sich nicht, wie die Philosophie selbst, mit den harten Themen der Logik, der Sprache oder des Seins befasst, sondern sich auf dem offenen und weiten Feld exotischer Kulturen tummelt, deren Denkweisen sie untersucht? Oder versteht sie sich als eine Art Universalphilosophie, die zeigen will, dass das Philosophieren an jedem Bücher zum Thema Ort, in allen Kulturen Heimat hat? Oder ist sie gar eine Art Metakritik der Philosophie, die deren Ansprüche auf Wahrheit und Letztbegründung zurückweist? Eigenartigerweise nimmt Kimmerle solche Metakritik zwar auf, wenn er zu ihren Ahnen Heidegger, Adorno und Wittgenstein als Kritiker der Philosophie zählt – was zumindest Heidegger dazu geführt hatte, sein eigenes Denken nicht mehr „Philosophie“ nennen zu können –; mit seiner These jedoch, Philosophie sei gar keine „europäisch-westliche Angelegenheit“ (44), sondern gehöre zum „Menschsein“ überhaupt und sei daher in allen Kulturen zuhause, fällt er hinter deren Kritik der Philosophie wieder zurück. Kimmerle versteht „als Philosophie jede Deutung der Welt und des menschlichen Lebens ..., die mit dem Anspruch auf rationale Begründbarkeit unternommen wird“ (54; H.v.m.) – ohne allerdings zu erläutern, was dieser Ausdruck unabhängig vom Kontext der europäischen Philosophie bedeuten könnte, und ohne in solchem Anspruch – anders als jene Kritiker – ein Problem zu sehen. Die Folge solcher Verortung der Philosophie im Menschsein überhaupt ist, wie mir scheint, eine Aporie im Konzept der interkulturellen Philosophie, wie Kimmerle es vorstellt. Denn weil es, antikolonialistisch, nachweisen will, dass alle Kulturen fähig seien und waren, die „besondere geistige Anstrengung der Philosophie zu vollbringen“ (9), wird in den verschiedenen Kulturen das aufgesucht, was jenem Begriff von Philosophie 93 entspricht, und worüber das philosophische Gespräch geführt werden kann. Auf der anderen Seite aber leugnet Kimmerle ausdrücklich nicht, dass es in anderen Kulturen „auf Dauer Unverstandenes“ (14) gebe, und dass solches „nicht Verstehbare im Kontext einer fremden Kultur gegebenenfalls stehen zu lassen und zu respektieren“ (15) sei. Damit aber wird eben dieser Kontext ‚zerrissen’, weil in ihm das, worin sich der „Anspruch auf rationale Begründbarkeit“ zeigt, säuberlich von dem getrennt wird, was als fremd und nicht verstehbar erscheint; obgleich in diesem Kontext selbst solches nicht oder nicht auf diese Weise getrennt ist. Kimmerle will, so scheint mir, alle Welt zu Philosophen machen, indem er das Allgemeinverständliche vom Spezifischen der jeweiligen Kultur als dem Fremden, Unverständlichen, Nicht-Dialogfähigen abtrennt. Praktisch äußert sich dies Trennverfahren, wenn er insbesondere in seiner Darstellung des islamischen Kontexts wenig Verständnis für das Fremdartige des Fundamentalismus aufbringt, umso mehr aber für einen ‚liberalen Islam’, der sich weniger theologisch als philosophisch artikuliert. Solches Vorgehen mag – aus westlicher Sicht – ja aus mancherlei Gründen als gerechtfertigt erscheinen; aber es ist fraglich, ob es dem selbst gesetzten Anspruch dient, das ‚Gespräch’ der Kulturen zu fördern, oder ob es dieses nicht vielmehr blockiert. Könnte der Grund solcher Aporie in dem Umstand liegen, dass Philosophen geneigt sind, die Lösung der Weltprobleme in der Philosophie zu su- 94 Bücher zum Thema chen; dass andere Kulturen dies jedoch nicht so sehen? So erscheint es dem Rezensenten als offene Frage, ob die sich etablierende interkulturelle Philosophie die Gegenwart der Philosophie in aller Kultur beschwört, wie Heinz Kimmerle dies tut; oder ob sie nicht einen Standpunkt jenseits aller Kulturen einzunehmen hätte, der von R.A. Mall so schillernd als der einer „orthaften Ortlosigkeit“ bezeichnet worden ist, und der in den Denkweisen der Kulturen nach Verbindendem und Trennendem, nach ihren ‚Überlappungen’ wie nach ihren ‚Verpackungen’, sucht. Trotz dieser gleichsam internen Kritik ist Kimmerle mit dem Band ein so umfassender wie kompakter Überblick über den derzeitigen Stand dieses neuen Zweigs der Philosophie gelungen, dass er nicht zuletzt wegen der darin verarbeiteten Literatur jedem Interessierten nur empfohlen werden kann. Alexander von Pechmann Robert Kurz (Hg) Marx lesen. Die wichtigsten Texte von Karl Marx für das 21. Jahrhundert, Frankfurt 2000 (Eichborn), Ln., 431 S., 25.90 EUR. Marx ist tot, begraben, ...und vergessen? Die den Neoliberalismen geschuldete Globalisierung boomt, schwingt von einem Höhepunkt zum höheren. So scheint es, jedenfalls schien es so. Ganz überraschend kam der Absturz nicht; außer viel Gier und Geschwätz gab es nur wenig Substanz. Der Neoliberalismus ist vielleicht noch nicht ganz tot, aber Marx regt sich schon wieder, vom Scheintod erweckt durch die verlustreichen Erfolge der new economy, aber auch durch den Abtritt der einstigen Apologeten. Folgt man Robert Kurz, steht Marx vor einem Comeback aus schierer Not-wendigkeit. Diesem Revival der abgesungenen Theorie Marx‘ zum Durchbruch zu verhelfen und damit (s)einen Beitrag zur Überwindung der gerade im 20. Jahrhundert unsäglich gewordenen Krise des Kapitalismus zu leisten, fühlt sich der als Präsentator und Kommentator, gelegentlich auch als Interpret und Übersetzer agierende Autor verpflichtet. Wodurch man sich zugleich in die alt-vertraute Problematik der ‚richtigen‘ MarxRezeption hineinversetzt fühlt, die mit dem erfolgreichen Comeback erneut erblühen dürfte. Totgesagtes lebt Kurz eben nimmt länger. allerdings in Anspruch, den ‚anderen‘, den ‚negativen Systemkritiker‘, kurz den ‚unbekannten‘ Marx aus den hinterlassenen riesenhaften Textmassen zu extrahieren. Auf der Strecke bleibt dadurch der die Geschichte der vergangenen 150 Jahre prägende, von Arbeiterbewegung, Sozialdemokratie und Realsozialismus geradezu zwanghaft verkürzte ‚Marx des Marxismus‘, der kaum noch etwas zu sagen hat. Der ‚unbekannte Marx’ weist dagegen explizit über jene ‚abgeschlossene‘ Epoche hinaus, weil er an uneingestandene Tabugrenzen der Moderne rührt, die innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsform niemals zu bewältigen Bücher zum Thema sein werden. Ganz einfach ist dieses doppelschichtige Verständnis nicht aufzulösen, aus vielen Gründen, vor allem aber, weil Marx sich selbst nicht immer ganz treu war – weil er sich (als opportunistischer Tagespolitiker?) nicht immer treu sein wollte, oder aber weil er seine Widersprüchlichkeit nicht immer in voller Konsequenz erkannte; ein anspruchsvolles Unterfangen, das Autor wie Leser fordert, dessen Dialektik Marx jedoch gewissermaßen selbst herausfordert. Um Licht in die nicht leicht zu durchschauenden Zusammenhänge zu bringen, geht Kurz von einem ‚doppelten‘ Marx aus, dem ‚exoterischen‘ Chefideologen eines nur vordergründig antikapitalistischen Klassenkampfes und dem ‚esoterischen‘ Theoretiker, der den Kapitalismus durch die kategoriale Kritik seiner elementaren Wesensbestimmungen (wie Arbeit, Wert, Geld, Ware, Markt, Recht, Staat etc.) als Fetisch entlarvt. Diesen Marx als ‚okkulten‘ Denker zu apostrophieren, der klaren Aussagen oft widerstand, wäre allerdings treffender; denn an der (widersinnigen) Verbreitung von Geheimwissen dürfte ihm kaum gelegen haben. Kurz zeichnet den ‚exoterischen‘ Denker Marx als ModernisierungsTheoretiker, der durch seine Analyse und Agitation der (in Deutschland) noch unterentwickelten kapitalistischen Produktionsweise zu deren allmählicher Reifung beitrug. In dieser Sicht gerät die Auseinandersetzung zwischen Proletariat und Bourgeoisie zum Klassenkampf wie zugleich zum Motor der kapitalistischen Modernisierung und Durchsetzung, auch 95 wenn diese im Gegensatz zur Perzeption der Protagonisten gestanden haben mag. Jedenfalls war die Auseinandersetzung nicht gegen den Kapitalismus, vielmehr auf die politische, rechtliche, soziale, kulturelle Emanzipation der Arbeiterschaft im Kapitalismus gerichtet. Geradezu paradox trat dies als nachholende Entwicklung in den östlichen (später auch südlichen) kapitalistischen Peripherien zutage, die sich als ‚antikapitalistischer Entwicklungskapitalismus‘ (oder Staatskapitalismus) darstellten, wobei die marxistischen Arbeiterparteien die beiden diametralen Funktionen gleichzeitig wahrzunehmen hatten. Dieser ‚exoterische’ Marx, der von seinen Apologeten bewusst reduziert wurde auf den bloß immanenten Kritiker des Kapitalismus, gehört spätestens seit der Geschäftsaufgabe des ersten kommunistischen Großversuchs der Geschichte an, hat Bedeutung nur noch insoweit, als er verschränkt und vermengt bleibt mit der Analyse des ‚esoterischen’ Theoretikers, dem Kurz angesichts der Misere des globalen Kapitalismus befreiende Kompetenz zumisst. Sehr viel interessanter als der ‚exoterische’ Marx, der über Lassalle in die revisionistisch-reformistische Praxis der Sozialdemokratien führte, mit der die Arbeiterbewegung im Kapitalismus geradezu aufging, ist also der Theoretiker der finalen kapitalistischen Krise, der von Kurz so genannte ‚esoterische‘ Marx, der die stummen Apriori des warenproduzierenden Systems zum Gegenstand seiner Analyse macht. Dieser ‚esoterische‘ Marx kritisiert 96 Bücher zum Thema nicht mehr die dem Kapitalismus immanenten Mängel, er kritisiert den Kapitalismus prinzipiell, als ein System, das in der Befolgung seiner Ansprüche an einem objektiven inneren Selbstwiderspruch zerbrechen muss. In der Deutung Kurz‘ ist der zentrale Begriff dieser Kritik der des ‚Fetischismus‘, weil Marx damit die Rationalität des scheinbar Selbstverständlichen zum Fremden, Falschen und Erklärungsbedürftigen macht; dadurch wird die kategoriale Kritik der kapitalistischen Ökonomie möglich und nötig. Besondere Bedeutung erlangt dabei, was Marx als ‚automatisches Subjekt‘ bezeichnet, die kapitalistische ‚Fetisch-Gottheit‘, die aus Gründen der Konkurrenz zwingend fordert, den größten Teil des in Geld zurückverwandelten Mehrwerts wieder in den kapitalistischen Reproduktionsprozess auf erweiterter Stufenleiter zu reinvestieren. Die Erweiterung der Produktion um dieses Zwanges, eines irrationalen Selbstzwecks willen, wirkt nicht nur destruktiv auf Mensch und Natur, denen tote, ökonomisierte Dinge gegenübertreten, die als axiomatische Selbstverständlichkeit behandelt werden, sie führt auch dazu, dass abstrakte Arbeit überflüssig wird; die Grenze der Arbeitsgesellschaft aber ist logisch identisch mit der Kurz Grenze siehtdesdiese Kapitalismus. Grenze mit der mikroelektronischen Revolution schon bald erreicht – aber was dann? Es ist – zu – einfach, zu sagen, an die Stelle von Fetisch-Verhältnissen müsse gesellschaftliches Bewusstsein, müsse ein von selbstbestimmten Institutionen organisierter Entschei- dungsprozeß jenseits von Markt und Staat, müsse das Ende der kapitalistisch erzeugten Großkatastrophen, die Überwindung der kapitalistischen Zumutungen an die Menschen und die Natur treten. Denn dabei steht nicht nur infrage, wie die – von Marx nicht mehr gelieferte – Blaupause in concreto aussehen könnte, es geht insbesondere um das soziale Subjekt, das diese Veränderungen bewirken könnte. Denn auf die Selbstzerstörung des Kapitalismus, die durch den Bezug auf dessen logische Grenzen suggeriert wird, zu warten, hieße die Großkatastrophen geduldig hinzunehmen; und wohin die Reformulierung einer kritischen Theorie führt, für die der Autor plädiert, bleibt bis auf weiteres offen. So überzeugend die Analyse, so frustrierend die angebotenen Optionen. Die fehlende Perspektive, die freilich auch der hier übergangene ‚revolutionäre‘ Marx nicht wirklich hätte zu bieten vermögen, stimmt jedenfalls nicht gerade hoffnungsfroh, auch weil die Akzeptanz einer wiederbelebten Marx-Rezeption, insbesondere durch die jüngeren Generationen, auf die der Autor ein wenig baut, verloren gehen könnte. Zu dieser fehlenden Akzeptanz beitragen dürfte auch, dass Robert Kurz auf den ‚ökologischen‘ Marx, den es zumindest in rudimentären Aussagen gibt, vollständig verzichtet hat. Die Rezeption wird – unnötig – aber vor allem dadurch erschwert, dass Kurz es nicht versteht oder nicht für nötig hält, Marx, den schon viele Generationen kaum richtig zu verstehen gelernt haben, klar und verständlich Bücher zum Thema darzustellen. Damit sind selbstverständlich nicht die zahlreich abgedruckten Text-Passagen aus Marxschen Werken gemeint, die der Schrift den – nicht nur appellativ gemeinten – Titel gaben, sondern die diesen Auszügen vorangestellten Kompilationen und Interpretationen des Autors, die häufig so schwer verständlich sind wie die Texte Marx‘, die zudem zumindest für Einsteiger kaum auffindbar sein dürften, weil Kurz auf den Bezug zu Standardausgaben (MEW oder MEGA) verzichtet. Dieser Einwände ungeachtet: ‚Marx lesen‘ lohnt sich immer wieder! Bernd M. Malunat Werner Seppmann Das Ende der Gesellschaftskritik? Die ‚Postmoderne’ als Ideologie und Realität, Köln 2000 (Papyrossa), geb., 300 S., 18.41 EUR. Werner Seppmann, Jahrgang 1950, hat auf dem zweiten Bildungsweg Philosophie und Sozialwissenschaften studiert und viele Jahre mit dem Marxisten Leo Kofler, der stets den theoretischen Ansätzen von Georg Lukács verpflichtetet blieb, zusammengearbeitet. Seit einiger Zeit ist er Mitherausgeber der ‚Marxistischen Blätter’. Nachdem er bereits nach dem Ideologiecharakter des StrukturMarxismus und nach der realen und Bewusstseinsmäßigen Irrationalisierung und Brutalisierung der spätbürgerlichen Gesellschaft erfolgreich gefahndet hat, widmet er sich in seiner 97 neuesten Publikation dem Phänomen der Postmoderne. Seppmann findet hierbei den gesellschaftlichen Resonanzboden, als dessen Ideologie die Postmoderne fungiert, in der objektiven Realität des Spätkapitalismus, dessen Ökonomie sich als sämtliche gesellschaftliche Segmente subsumierende Teilrationalität präsentiert. Diese realen Entfremdungszustände, Irrationalismen, Brüche und Ambivalenzen werden subjektiv im regressiven Alltagsbewusstsein verankert und unreflektiert als naturläufige hingenommen: „Der entwickelte Kapitalismus als eine Vergesellschaftungsweise, die die Rationalität in den Teilbereichen extrem gesteigert hat, das Zusammenspiel der technischen wie auch der sozialen Kräfte aber dem blinden Zufall überantwortet, bringt permanent Entfremdung und verdinglichte Bewußtseinsformen hervor. Obwohl die handelnden Menschen intensiv aufeinander bezogen sind, dominiert bei ihnen der Eindruck der sozialen Isolation. Die Wahrnehmung des Anderen bleibt durch die Konkurrenzsituation geprägt, ... durch die Wirkungen des Warenfetischismus erleben die Menschen das von ihnen selbst konstituierte und reproduzierte Sozialverhältnis ‚als ein außer ihnen existierendes Verhältnis von Gegenständen’ (Marx). Die soziale Welt wird als bedrohlich und lebensfeindlich erfahren... Die gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus erscheinen den Menschen auf der Ebene des Alltagsbewußtseins als „naturförmig“ und unüberwindbar.“ (157) Diese Handlungstendenzen und Be- 98 Bücher zum Thema wusstseinsmechanismen werden von den postmodernen Denkern nun wiederum auf der Ebene der Theorie perpetuiert und als quasi menschliche Konstanten und fundamentale Schranken verewigt, indem der gesellschaftliche Kontext ihrer Genese ignoriert wird. So schlägt die vermeintliche Kritik an gesellschaftlichen Zuständen durch die Verabsolutierung von (mitunter berechtigten) Erkenntnisschranken und Partialerkenntnissen sowie der Ontologisierung gesellschaftlicher Tendenzen in etwas um, was der Lukács der “Zerstörung der Vernunft“ die indirekte Apologetik genannt hätte (und somit in der Tradition der anti-aufklärerischen, ultrakonservativen bis präfaschistischen Philosophie von Schlegel über Nietzsche bis Heidegger steht). Seppmann erarbeitet diesen undialektischen Lapsus als ein zentrales Merkmal postmodernen Denkens und zeigt dies u.a. an Derrida, Lacan, Lyotard, Beaudrillard und Foucault: „Weil von den Menschen ... die gesellschaftliche Realität als perspektivloser Zustand erlebt wird, sind direkte Formen der Apologie nicht mehr möglich. Das machtfunktionale Bewußtsein erfüllt seine stabilisierende Rolle ..., indem es das sozial erzeugte Mißbehagen als Konsequenz einer prinzipiellen Absurdität und Ausweglosigkeit der menschlichen Existenz verklärt und auf diesem Weg die bestehende Gesellschaftsform von ihrer Verantwortung für den aggressionsgeprägten und ungerechten Zustand der Welt entlastet. Weil der Fortschritt bürgerlich nicht mehr gedacht werden kann, wird er pauschal negiert.“ (153) „... nach dem Verständnis Foucaults (hat sich) jeder Befreiungsversuch immer als eine raffiniertere und intensivere Form der Unterdrückung und Reglementierung erwiesen.“ (227) Weiterhin setzen nach Seppmann die Postmodernen vor die aktuellen Krisenphänomene einfach nur positive Vorzeichen, indem sie zwar an reale Tendenzen anschließen, aber aufgrund ihrer Fokussierung auf das Moment vor dem Zusammenhang und auf die Differenz vor der Totalität den gesellschaftlich produzierten Rahmen übersehen und die Zusammenhänge verdrängen statt zu durchdringen. Ihre Beschreibung der Phänomene verlässt daher die Gefühlsebene nicht, sondern bestätigt diese und verabsolutiert sie; sie verschafft dem resignativen Alltagsbewusstsein, das die aus der sozialen und ökonomischen Ohnmacht resultierenden Ängste mit hedonistischen Freiheitsphantasien kompensieren muss, nicht nur lebensphilosophischen Trost, sondern auch „wissenschaftliche“ Weihen. Damit aber wird genau jener disponible, fungible und regressive Subjektivitätstypus theoretisch zum Vorbild erklärt, der exakt zur herrschenden gesellschaftlichen Situation passt, in der die Krisenmomente der spätkapitalistischen Gesellschaft auf das Individuum abgewälzt werden. In einer verdinglichten, dem Warenfetischismus unterstehenden Welt perpetuieren also die Postmodernen diese Zustände in der Theorie und affirmieren sie als Fundament individueller Selbstbestimmung: „Den Menschen ... wird nahegelegt, zu lernen, mit den Widersprüchen zu leben, die Bücher zum Thema soziale Bedrohung als etwas unveränderliches zu akzeptieren und sich den wechselnden Ansprüchen anzupassen.“ (66) „Es vollzieht sich ... die ideologische Unterwerfung in einer Form, die von der Psychoanalyse als Identifikation mit der Ursache des Leidens beschrieben wird: Um sich von der krisengeprägten Wirklichkeit zu “emanzipieren“, passt sich das postmodern konditionierte Bewußtsein ihr an.“ (66) Ein Plädoyer für eine dialektische Gesellschaftstheorie, die im Sinne von Karl Marx (aus dem die Postmoderne ja gerne eine hegelianisierenden Popanz macht) fähig ist, die postmodernen Kritikmomente in einen objektiv-realen wie theoretischen Konstituierungszusammenhang zu bringen, und somit diese erst adäquat in Geltung setzt, beschließt das Buch. Es ist schade, dass Seppmann eher einen allgemeinen Überblick über den gesellschaftlichen Zusammenhang und die ideologischen Fallstricke der Postmodernen gibt, ohne eine genaue Auseinandersetzung mit den einzelnen Denkern zu wagen (wie dies z.B. Lukács’ „Zerstörung der Vernunft“ ausführlich unternommen hat). Auch wären dem Buch ein Namensregister sowie Fußnoten mit präzisen Literaturangaben zu gönnen gewesen; und ich wage die Behauptung, dass kluge Gedanken durch zahlreiche Ausrufezeichen nicht besser und referierte dumme Ausführungen durch den inflationären Gebrauch von Anführungsstrichen nicht dümmer werden. Dennoch ist mit dem Buch, wie mit dem von Alan Sokal und Jean Bricmont sowie Terry Eagletons Schrif- 99 ten über Ideologie und Ästhetik, ein bedeutender Anfang einer aktuellen Kritik der kritischen Kritik gemacht worden, dessen Lektüre, wie die aller Publikationen von Werner Seppmann, dringend empfohlen wird. Reinhard Jellen Charles Taylor Die Formen des Religiösen in der Gegenwart. IWM-Vorlesungen zu den Wissenschaften vom Menschen, aus dem Englischen v. Karin Wördemann, Frankfurt/ Main 2002 (Suhrkamp), 102 S., 8 EUR. Charles Taylor (geb. 1931) umkreist in seinen Werken immer wieder das Thema der menschlichen Identität. Beginnend 1975 in seiner umfangreichen Untersuchung zu Hegel („Hegel“, „Hegel and Modern Society“) betonte er die Notwendigkeit einer Revision des modernen liberalistischen Menschenbildes, in dem das Individuum völlig unvermittelt und aus freien Stücken seine Identität formieren soll. Mit der Aufforderung, menschliche Identität im „kulturellen Milieu“ zu verankern, schwenkte er mit den Publikationen „What's Wrong with Negative Liberty?“, vor allem aber mit „Sources of the Self“ in die Phalanx kommunitaristischer Kritik am liberalen unencumbered self (uneingebetteten/unverankerten Selbst) ein. Später in den späten 80er und 90er Jahren betonte er – ähnlich wie Honneth, aber unabhängig von diesem – den Begriff der Anerkennung (recogni- 100 Bücher zum Thema tion) als identitätsbildendes Moment. Anerkennung bezog er dabei auch politisch auf das Selbstbestimmungsrecht kultureller Gruppierungen und ging sogar so weit, in seinem Kampf für die Unabhängigkeit Quebecs gegen den kanadischen Premierminister Trudeau anzutreten. Auch der vorliegende Band „Formen des Religiösen“ behandelt das Thema der kulturellen Verankerung menschlicher Identität, diesmal unter dem Blickwinkel religiöser Überzeugungen. Dabei knüpft Taylor an die Fragestellungen an, die bereits in „Sources of the Self“ aufgeworfen und behandelt wurden. Dort wurde nach der Fundierung einer Ethik ohne theistische Basis – genauer: nach dem Ende theistischer Systeme – gefragt und die neuen moralischen Quellen in dem festgemacht, was Taylor expressivistische (expressivist) Formen von Moral nannte. In „Formen des Religiösen“ wird dieser Ansatz wieder fruchtbar gemacht. Formen des Religiösen ist eine Ausarbeitung von Vorlesungen, die Taylor am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen im Jahr 2001 hielt. Ausgangslage und Quelle Taylors Überlegungen ist die 1902 erschienene Schrift des Pragmatisten William James (1842-1910) „Die Vielfalt religiöser Erfahrung“ (Varieties of Religious Experiences), die heute noch in den USA als wegweisende Kulturtheorie angesehen wird. Über die Hälfte des Buches sind James’ Theorie der Religion gewidmet. Darin versucht Taylor ihn als „Philosoph der Schwelle“ zu entdecken, der die Moderne als einen Ort beschreibt, in dem „Sinnhorizonte“ verloren gingen/gehen. James antwortete, so Taylor, mit einer Theorie von Religiosität, deren wirklicher Ort klar auf Seite „der individuellen Erfahrung und nicht im körperschaftlich verfassten Leben“ lag. Wenngleich James die Religion als Ganzes gegen jeden Agnostizismus verteidigen wollte, seine Ansichten über deren Verortung sind für Taylor dennoch modern: die Trennung von Gesellschaft, Staat und Religion wird nicht nur anerkannt, sondern auch propagiert. Im Rückgriff auf James’ laizistische Theorie, die Religion als Ort persönlicher Erfahrung angesehen, sieht Taylor zwei Tendenzen: 1. das öffentliche Leben unterliegt einer immer stärker werdenden Säkularisierung, oder anders formuliert: der soziale Rahmen duldet zunehmend weniger die Wiederspiegelung bestimmter Glaubensüberzeugungen; 2. Spiritualität im Sinne personaler Religion schafft immer weniger kollektive Bindungen, oder anders formuliert: Religiosität wird zunehmend personaler und individueller. In der Ableitung seiner eigenen expressivistischen Theorie von Religiosität bedient sich Taylor einer geschichtlich-systematischen Methode. Er betrachtet die historischen Paradigmen von Religiosität nach dem Verhältnis Individuum, Gesellschaft und Religion: 1. Vor-Durkheimsche Auffassung von Gesellschaft und Religion: in dieser noch verzauberten Welt ist das Sakrale allgegenwärtig. Gottes Vorsehung und Plan ist in Gesellschaft und Bücher zum Thema Kosmos unmittelbar präsent. 2. Paläo-Durkheimsche oder barocke bzw. katholische Auffassung von Gesellschaft und Religion: hier ist das Sakrale nur mehr im politischen Gemeinwesen präsent und zwar als Idee der sittlichen Ordnung (Locke). Die Kirche als körperschaftlicher Ausdruck des Sakralen selbst ist mit der Gesellschaft deckungsgleich. Die Zugehörigkeit zur Kirche wird mit der Zugehörigkeit zur Gesellschaft als politisch-sittlichem System gleichgesetzt. 3. Neo-Durkheimsche oder protestantische Auffassung von Gesellschaft und Religion: hier taucht zum ersten Mal das Moment der individuellen Wahl von Religion auf. Mit ihr aber auch die Idee, dass es religiöse Überzeugungen geben kann, die nicht den Anspruch erheben, in einer körperschaftlichen Struktur für alle Menschen zu enden. Denominationen wie die Methodisten verstanden sich bewusst als Kirche für Wenige, eben nur für die, die die gleichen individuellen Erfahrungen teilten. Ergebnis war das, was Bellah „civil religion“ nannte. Die Trennung von Kirche und Staat war ihr historisches Ergebnis. 4. Post/Nicht-Durkheimsche, expressivistische oder moderne Auffassung von Gesellschaft und Religion: In den Durkheimschen Auffassungen war noch das Verhältnis von Individuum, Gesellschaft und Religion konstitutiv: das Individuum definierte sich zu einer Gesellschaft zugehörig, indem es religiöse Überzeugungen mit ihr teilte und diese Überzeugungen an einem Gott, einer Vorsehung 101 festhielten. In der modernen expressivistischen Form von Religion wird das Moment der individuellen Wahl noch mehr gestärkt und es schwindet das Moment der Konfessionalität. Der Einzelne erlebt Spiritualität als Je-Eigenes – unabhängig von der Spiritualität anderer – und er erlebt es ohne den Rahmen des Sakralen sei es Kirche oder Staat. Größter Katalysator der expressivistische Auffassung von Religion ist für Taylor die heutige individuelle Konsumkultur, insbesondere die Jugendkultur seit den 60er Jahren. Hier wurde die Ablehnung des Sakralen, der großen Beziehungsrahmen wie Kirche und Staat, mit dem Verweis auf das Recht auf individuelle Wahl und Selbstbestimmung begründet. Der Begriff des Privaten wurde als das Recht definiert, eigene Wahlentscheidungen zu treffen, aber auch als die Pflicht anderer, diese unbedingt zu akzeptieren („Prinzip der Nichtverletzung“). Was die heutige Spiritualität selbst betrifft, sieht sich Taylor weltweit in seiner These radikaler Individualisierung bestätigt: konfessionelle Religionen befinden sich auf dem Rückzug, die Zahl derer, die an etwas persönlich Göttliches glauben, steigt. In diesem neuen Band erfasst Taylor ein vorderhand soziologisch abgehandeltes Thema auch in seiner historischen Dimension und erschließt so neue gesellschaftsphilosophische Horizonte des Themas. Trotz des unbestreitbaren Faktums, dass die Bedeutung konfessioneller Religion in der Moderne schwindet, erscheint Taylors Verortung neuer 102 Bücher zum Thema Gemeinschaftlichkeit und Religion im Konsum als recht vorschnell. Sind doch die horizontalen Bindungen freiwilliger Assoziationen zu schwach und in Staat und Gesellschaft zu unwirksam. Würde Taylor diese Schwäche expressivistischer Religiosität anerkennen, dann müsste er zum Ergebnis kommen, dass das Religiöse in der Gegenwart selbst auf dem Rückzug ist. Das jedoch mag man vielleicht für den Westen behaupten können; für andere Regionen der Erde ist es keineswegs schon entschieden. Wolfgang Melchior Slavoj Zizek Die Tücke des Subjekts Frankfurt/Main 2001 (Suhrkamp), geb., 548 S, 32,80 EUR. Die Globalisierung verlangt nach Schriften, die aufs Ganze gehen. Großtheorien sind wieder gefragt. Überall gibt es mittlerweile Arbeitsgruppen zum „Empire“, dem neuen Buch von Hardt und Negri. Das ist gut so. Aber es gibt ein Buch, das noch viel besser ist: „Die Tücke des Subjekts“ von Slavoj Zizek, Professor für Philosophie in Ljubljana. Leider fehlt im deutschen Titel der Untertitel: „The Ticklish Subject. The Absent Centre of Political Ontology“. Das Buch beginnt mit einer Anspielung auf ein mehr als 150 Jahre altes Werk, das damals die Welt erschüttern wollte. „Ein Gespenst geht um in der westlichen Wissenschaft, das Gespenst des cartesianischen Subjekts. Um es auszutreiben, haben sich alle wissenschaftlich-akademischen Mächte zu einer heiligen Allianz zusammengeschlossen...“ (7) Was dann folgt ist in der Tat so etwas wie ein kommunistisches Manifest; aber eines der speziellen Art, ein kommunistisches Manifest des Subjekts: „Es geht ... nicht darum, zum Cogito in der Weise zurückzukommen, in der dieser Begriff das moderne Denken beherrscht hat (in Form eines sich selbst transparenten, denkenden Subjekts also), sondern seine vergessene Rückseite ans Licht zu bringen...“ (8) Zizeks Frage lautet in der Tat, was heute Subjektivität noch bedeuten kann, warum wir auf diese Vorstellung zurückgreifen müssen, wenn wir – angesichts des globalisierten Kapitalismus und seiner Folgen – auch nur ansatzweise wieder politisch werden wollen. Um dabei jedoch weder in die Rolle des Hofnarren zu verfallen, dessen wahre Aussagen folgenlos bleiben, noch in die des Schurken, der in der Geste absoluter Ehrlichkeit – wie ein echter Realo – zynisch den freien Markt verteidigt, müssen wir uns um eine dritte Haltung, ein tertium datur umsehen. „Vielleicht“, meint Zizek, „können die Konturen dieses tertium datur mittels einer Bezugnahme auf das grundlegende ‚Vermächtnis Europas’ aufgezeigt werden“ – ohne dass dabei jeder selbstbewusste Linken sofort nach der Pistole greift und beginnt, „Beschuldigungen auf den protofaschistischen eurozentristischen Kulturimperialismus abzufeuern“. Ist es möglich, „sich eine linke Aneignung der europäischen politischen Tradition vorzustellen?“ (286) Genau das macht Zizek. Dass Bücher zum Thema zek. Dass das auf knapp 550 Seiten nicht ohne Gedränge und Verknappung möglich ist, versteht sich von selbst. Das Buch gliedert sich in drei Teile: Erst begibt er sich auf die Spuren des deutschen Idealismus (Heidegger, Hegel, Kant), dann befasst er sich mit der französischen post-althusserschen politischen Philosophie (Badiou, Ranciere, Laclau und Balibar) und setzt sich schließlich mit den Cultural bzw. Gender Studies (Butler, Giddens, Beck) auseinander. Gehen wir mitten hinein in Zizeks Ansatz. Hegels Wahrheit des absoluten Subjekts ist für ihn, Zizek, nichts weiter als das Nichts. Warum? „Dieses Nichts steht letztlich für das Subjekt selbst, das heißt, es ist der leere Signifikant ohne Signifikat, der das Subjekt repräsentiert. Das Subjekt ist somit nicht direkt in der symbolischen Ordnung enthalten: Es ist gerade als der Punkt in ihr enthalten, an dem die Signifizierung zusammenbricht.“ Durch das Subjekt als leeren Signifikanten werde jedoch „das Subjekt nicht einfach in dessen Netzwerk eingebaut; vielmehr wird gerade sein Ausschluss (signalisiert durch die Tatsache, dass es für diesen Signifikanten kein Signifikat gibt) darin inkludiert, wird dadurch markiert, registriert.“ (154 f.) Es gibt also kein substantielles Subjekt für Zizek. Es ist das Nichts; aber gerade dies bedeutet nicht, dass es unerheblich oder „bedeutungslos“ wäre. Denn dieses ausgeschlossene Nichts sind wir selbst; die, die markiert, registriert werden. Wie das? – Ersetzen wir im vorigen Zitat das Wort „Netzwerk“ 103 durch „Gesellschaft“, dann wird der Gedanke deutlicher: Wir sind, was wir werden; und wir werden, was wir sind, durch die Gesellschaft. Wir schreiben uns in dieses Nichts ein durch das, wie wir mit Gesellschaft umgehen, und wie sie mit uns umgeht. Bei Hegel ist dieser Prozess auf philosophischer Ebene durch das Verhältnis von absoluter und konkreter Allgemeinheit gekennzeichnet. Konsequenterweise trägt daher Zizeks zweiter Teil den Titel „Die zersplitterte Allgemeinheit“. Denn durch nichts wird die gegenwärtige Phase der Weltgeschichte auf der Ebene des Subjekts klarer gekennzeichnet, als dass die Allgemeinheit in (nicht mehr?) verbundene „Unter-Allgemeinheiten“, in „Subkulturen“ zerfällt. Für Zizek ist es daher klar, dass „der wahre linke Universalismus keine Rückkehr zu irgendeinem neutralen allgemeinen Inhalt bedeutet (zu einem allgemeinen Begriff der Menschlichkeit o. ä.); vielmehr bezieht er sich auf ein Allgemeines, das nur in seinem partikularen Element zu existieren beginnt ... in einem Element, das strukturell deplatziert, ‚aus den Fugen’ ist. Innerhalb eines gegebenen gesellschaftlichen Ganzen ist es genau dasjenige Element, das daran gehindert wird, seine volle partikulare Identität zu aktualisieren, die für seine allgemeine Dimension steht.“ (312) Im 19. Jahrhundert noch hatte ein solches spezielles „Element“ die Kraft, in ihrer konkreten Allgemeinheit der wahren, absoluten Allgemeinheit zum Durchbruch zu verhelfen. Dieses Element war das Ge- 104 Bücher zum Thema spenst, das das „Kommunistische Manifest“ meinte. „Um Marx’ klassisches Beispiel aufzunehmen, steht ‚Proletariat’ nicht deshalb für die allgemeine Menschheit, weil es die am tiefsten stehende und am meisten ausgebeutete Klasse wäre, sondern weil deren bloße Existenz ein ‚lebendiger Widerspruch’ ist, das heißt, weil es die grundsätzliche Schieflage und Inkonsistenz des kapitalistischen gesellschaftlichen Ganzen verkörpert.“ (312 f.) – Heute jedoch sehe die Sache etwas anders aus. Als Beispiel für ein solches zeitgenössisches „Element“ dient Zizek eine der schillerndsten Randgruppen unserer Zeit: „Lange Zeit glaubten die Befürworter der sexuellen Befreiung, die sexuelle Repression der Monogamie sei für den Kapitalismus notwendig. Heute wissen wir, dass der Kapitalismus Formen ‚perverser’ Sexualität nicht nur tolerieren, sondern diese auch aktiv auslösen und ausbeuten kann... Und wenn dasselbe Schicksal die queeren Forderungen erwartet? („queer“ meint die Identitäten all derer, die quer zur sog. ‚Normalität’ stehen; W. H.) Das augenblickliche Wuchern von unterschiedlichen sexuellen Praktiken und Identitäten ... ist alles andere als eine Bedrohung des gegenwärtigen Regimes der Biomacht (um Foucaults Begriffe zu verwenden). Gerade diese Form von Sexualität wird durch die derzeitigen Bedingungen des globalen Kapitalismus erzeugt, die klarerweise jenen Subjektivitätsmodus favorisieren, der durch multiple wechselnde Identifikationen charakterisiert ist.“ (314 f.) Wer heute also nicht in die Falle unbewusster Affirmation tappen will, weil er immer noch der Ansicht ist, dass das, was ist, falsch und inhuman und daher abzuschaffen sei, wird sich im Bemühen, das eigene „Nichts“ zur Konstruktion des eigenen Ichs mit Inhalten zu füllen, nach anderen Quellen umsehen müssen. Zizek knüpft dazu an den Streit um die ‚Frankfurter Schule’ an und stellt uns vor die „Wahl zwischen Adorno/Horkheimer und Habermas“. Dessen Bruch mit Adorno und Horkheimer bestehe darin, dass er den Grundbegriff der Dialektik der Aufklärung zurückgewiesen hat. Für ihn werden Phänomene wie totalitäre politische Regime oder die Entfremdung des modernen Lebens nicht durch die dem Projekt der Aufklärung innewohnende Dialektik hervorgerufen, sondern durch dessen inkonsequente Realisierung. Im Gegensatz dazu halten Adorno und Horkheimer an dem dialektischen Verfahren fest, die beunruhigenden Exzesse dieses Projekts selbst als die symptomatischen Punkte zu lesen, an denen sich die Wahrheit des gesamten Projekts zeigt: Für sie besteht die „einzige Möglichkeit, die Wahrheit irgendeines Begriffs oder Projekts zu erreichen, ... darin, sich der Stelle zuzuwenden, an der das Projekt fehlging.“ (479) Im Kapitel über die politische Ökonomie, dem spannendsten und auch verständlichsten Teil des Buches mit dem bezeichnenden Titel „Um die politische Ökonomie geht es, Dummkopf!“ spricht Zizek dann aus, worin der Kern des heutigen „globalen Projekts“, das fehlgeht, besteht, und was Bücher zum Thema ihm, also Zizek, eigentlich am Herzen liegt: die Erneuerung der alten Forderung, den Kapitalismus endlich abzuschaffen. Bei all den Fragen um eine zweite Moderne, eine nicht vollendete Moderne, die Anerkennung der Subkulturen und der sog. „Patchwork-Identitäten“ wurde nämlich vergessen, was gleich geblieben ist. „Anstatt also die neuen Freiheiten und Verantwortlichkeiten zu bejubeln, die uns die ‚zweite Moderne’ beschert hat, ist es viel wichtiger, sich darauf zu konzentrieren, was sich in dieser ganzen globalen Verflüssigung und Reflexivität gleich bleibt und genau diesem Im-Fluss-Befindlichen als Antriebsmotor dient: die unerbittliche Logik des Kapitals... Weit davon entfernt, mit dem Abgrund seiner Freiheit konfrontiert, das heißt, mit der Bürde der Verantwortung beladen zu werden, die von keiner helfenden Hand der Tradition oder der Natur gemildert werden kann, ist das heutige Subjekt vielleicht mehr denn je im Griff eines unerbittlichen Zwanges, der in der Tat sein Leben bestimmt.“ (490) Nun ist freilich die Forderung, den Kapitalismus abzuschaffen, weil er ein inhumanes System darstellt, nicht neu. Dazu bedurfte es und bedarf es der Individuen, die das wollen wollen. Dies zweifache „wollen“ drückt aus, dass dieses Wollen kein einmaliger Akt, den das Individuum eines Morgens vollziehen könnte. Es hat vielmehr zutiefst mit dem zu tun, was das Individuum sich selbst ist, was es aus sich als dem leeren, dem randständigen und irgendwie doch dazu- 105 gehörigen, Signifikanten macht. Warum die Freiheit nicht einfach gewählt werden kann, zeigt Zizek klar auf: Er zeigt, in welche Sackgassen wir geraten, wenn wir „Freiheit“ meinen und die Frage des Subjekts als bereits gelöst oder überflüssig erachten. „Die Tücke des Subjekts“ ist ein großes und wichtiges Buch. Allen, die am herrschenden System etwas auszusetzen haben, sei es mit Nachdruck ans Herz gelegt. Allerdings hat die Sache einen kleinen und einen großen Haken. Der kleine ist, dass zumindest die deutsche Ausgabe kein Namensregister und kein Literaturverzeichnis besitzt. (Und ich dachte, auch der Suhrkamp-Verlag hätte inzwischen Computer.) Bei weiteren Auflagen muss dies berücksichtigt werden. Der große Haken ist, dass es sehr schwer zu lesen und zu verstehen ist. Man braucht Zeit und Muße und einiges an Vorwissen. Vor allem braucht man eine gute Kenntnis der Theorie Jacques Lacans, auf die auf fast jeder Seite Bezug genommen wird. Zizeks Buch verlangt daher mehr „Übersetzungsarbeit“ als Hardts und Negris „Empire“. Alle Gegner der Globalisierung sollten es trotzdem versuchen. Warum? Weil vor der Handlungsanleitung noch immer die Analyse kommt, und weil man dann auch Hardt und Negri besser versteht. Denn in diesem Fall geht es um nicht mehr oder weniger als um die Analyse dessen, was wir sind: Subjekte. Wolfgang Habermeyer Kim Lan Thai Thi „Warum ging Bodhidharma gen Osten?“ Ein Koan zur Lehrbiografie Wenn ich die Augen zumache und versuche, einen Moment an den Ursprung meines Geisteslebens zurückzudenken, so sehe ich mich zunächst als Kind im Schoß meiner Großmutter schlummern – es war kein dogmatischer Schlummer nach Kantischer Art, sondern ein sinnlich angenehmerer –, ihrer singend rezitierenden Stimme zuhörend: „Nhan chi so tinh ban thien, tinh tuong can tap tuong vien“. Es war der erste Satz im Buch der Lehre von Konfuzius. Er besagt, daß die menschliche Natur im Ursprung gut ist, daß diese gute Natur jedem innewohnt, und erst die Erfahrung den Menschen von ihr entfernt! Natürlich habe ich in jenen Stunden nichts davon verstanden. Mir ist nur für immer die sanfte Stimme der gutmütigen alten Dame von der königlichen Familie Vietnams aus der Kaiserstadt Hue im Herzen zurückgeblieben. Das Wort „Thien“ – GUT – klang wohltuend wie der direkt in mein Ohr dringende warme Herzschlag der lieben Frau. Es war gut und beruhigend wie jener tiefer Gongklang aus der Pagode nahe unserem Haus, der jeden Abend das Rezitieren des Meta-sutras – des Sutras des Mitgefühls – meiner Mutter vor dem Einschlafen begleitete. Rezitierte Buddhistische Sutren und das gesungene konfuzianistische Lehrbuch liegen meinem Herzen-geist (Tam) zugrunde, ohne daß ich zunächst davon begrifflich etwas verstanden hatte. Doch Jahre später stellte ich mit angenehmem Erstaunen fest, daß mich meine Großmutter bereits in meiner Kindheit neben vielen Wiegenliedern in die konfuzianische Lehre und meine Mutter in die buddhistische Lehre eingeführt hatten. Beide Frauen waren Witwen, deren Männer als Opfer des vietnamesischen Krieges früh verstorben waren. Sie haben mich aber einerseits nach der Überlieferung des von Menzius traditionell ausgelegten Konfuzianismus sowie andererseits des Amidismus der buddhistischen Mahayana-Richtung sanft in den Schlaf gewiegt. – Die andere Hälfte der Lehre des Konfuzius, die zu Menzius’ Interpretation gegen- „Warum ging Bodhidharma gen Osten?“ 107 sätzliche Auslegung des Tzuanzu, nach der die menschliche Natur vom Ursprung böse ist, erfuhr ich erst später am Gymnasium im Unterricht der traditionellen chinesisch-vietnamesischen Geistesgeschichte, aber auch in der politisch-philosophischen Debatte im gesellschaftlichen Leben einer Vietnamesin, deren Land das gleiche Schicksal des ehemaligen Deutschlands erfuhr, geteilt in zwei von gegensätzlichen Ideologien beherrschten Hälften: einer sozialistischen und einer kapitalistischen. Ich bin also in einem Land geboren, dessen Geschichte von verschiedensten kulturellen Strömungen getragen ist: aufgrund der 1000 Jahre langen chinesischen Herrschaft wurde das geistige Leben der Vietnamesen bis zum 9. Jhdt. durch den Konfuzianismus und den Taoismus bestimmt; und gleichzeitig beeinflußte der Buddhismus die vietnamesische Lebensanschauung mit der Lehre von der Befreiung vom Leiden, sprich: vom Leiden eines unterdrückten Volkes. Während der tausendjährigen Unabhängigkeit wurde so trotz Fremdherrschaft das ungebrochene Nationalbewußtsein immer wiederhergestellt. Danach wurde während der fast 100 Jahre langen französischen Kolonialherrschaft (von 1884 bis 1954) der Einfluß der westlichen Zivilisation unvermeidbar; aber gleichzeitig prägte der ununterbrochene nationale Befreiungskampf im vietnamesischen Geist jene Sehnsucht nach Selbständigkeit und Behauptung der kulturellen Unabhängigkeit. Mit der Teilung Vietnams (1954) in das kommunistisch-demokratische Nordvietnam und das republikanische Südvietnam entbrannte dann während eines halben Jahrhunderts die Auseinandersetzung zwischen dem Marxismus, der geistigen Grundlage des Aufbaus und des Kampfs gegen den amerikanische Imperialismus, und dem von den sog. neo-kolonialistischen amerikanischen Mächten unterstützten Kapitalismus. Zu den „Opfern“ dieses Konfliktes kann man die vietnamesische Tradition des Geistes zählen. Ich bin also in einer der bewegtesten Perioden der Geschichte meines Landes herangewachsen: in den 40er Jahren erklärte Ho Chi Minh die Unabhängigkeit Vietnams von der französischen Kolonialherrschaft, die erst 1954 mit dem Sieg von Dien Bien Phu auf der Konferenz in Genf anerkannt wurde. 1954 mußte der König Bao Dai unter dem Druck der Amerikaner und Franzosen abdanken, und sein eigener – zunächst auch von den Amerikanern aufgestellter – Ministerpräsident Ngo Dinh Diem übernahm die Rolle des Staatsoberhaupts von Südvietnam. Die ideologische Ausei- 108 Kim Lan Thai Thi nandersetzung zwischen Nord und Süd nahm deutlich eine kriegerische Gestalt an. Ich bin aber auch in einer Stadt geboren, die hundert Jahre lang das feudale Zentrum des traditionellen, kulturellen und geistigen Lebens darstellte: die Kaiserstadt Hue in Zentralvietnam, deren Lebensstil zum Teil mein Denken beeinflußte. An einem solchen Ort war es nicht ungewöhnlich, neben dem politischen Trubel die Frage nach der menschlichen Natur zu erörtern oder zu besingen, wie meine Großmutter es getan hat; denn das Streben der Menschen in dieser Stadt war, allen wirtschaftlichen und politisch-gesellschaftlichen Schwierigkeiten zum Trotz, auf das Ideal als Lebensziel gerichtet, sich nach dem Vorbild des Konfuzius zum Philosophen ausbilden zu lassen. „Philosoph“ ist hier jedoch eher als „der Weise“ nach asiatischer Vorstellung, nicht aber als rein intellektueller Denker zu verstehen. Als Kind einer traditionell buddhistisch-konfuzianischen Großfamilie kaiserlicher Abstammung sah ich mich an dieser Lerntradition orientiert. Zunächst aber erlebte ich Enttäuschungen angesichts der Unterentwicklung des Landes. Unsere Zuflucht in den alten Lehren zu suchen, lehnten wir junge Menschen ab. Es bot sich an, sich mit dem Marxismus und anderen westlichen Denkrichtungen auseinanderzusetzen. Die Begegnung mit der westlichen Kultur geschah bereits in der Schule, wo wir unsere Fächer nach französischem Erziehungsmuster auswählen und uns zum Abitur vorbereiteten mußten. Ich kann heute keine Erklärung für meine eigenartige Entscheidung geben, erst Mathematik und dann Philosophie gewählt zu haben. Ich war die einzige Frau meiner Klasse, die sich für das Studium der Philosophie – so unpraktisch und unökonomisch – entschied. Aber ich weiß, daß mich in dieser Zeit die Konfrontation mit der westlichen Philosophie sehr bewegte. Sie überzeugte mich zunächst mit Descartes’ Denkweise, „klar und deutlich“ zu denken; und besonders die Methode der Analyse und das systematische Denken schienen mir den richtigen Weg zur Wahrheit zu zeigen. Damals artikulierte sich die Sehnsucht nach einer totalen und endgültigen Lösung auf allen Gebieten des Lebens meiner Heimat: individuell-existentiell, sozial und politisch; der Durst und der Hunger nach einem vollkommenen Wissen, das allein die Philosophie in ihrer klassischen Bedeutung zu befriedigen vermochte. Es war eine durch und durch berechtigte Hoffnung, die ich während des Philosophiestudiums an der philoso- „Warum ging Bodhidharma gen Osten?“ 109 phischen Fakultät der Universität Hue hegte und pflegte. Der Lerneifer war wie selbstverständlich. Die Erwerbung einer Licence en Lettre in Philosophie umfaßte die verschiedensten Gebiete der westlichen Philosophie: Metaphysik, Logik, Ethik, Staatsphilosophie, Soziologie, Psychologie, Psychopathologie und Geschichte der Philosophie; während die östliche Philosophie stiefmütterlich und fast wie eine Nebensache behandelt wurde. Der Einfluß der westlichen geistigen Strömungen von der griechischen Philosophie über Descartes, Kant, Hegel, Marx bis zum französischen Positivismus und Heideggers Existentialismus war gewaltig. Die Auffassung, es gebe nur EINE Philosophie, nämlich die westliche Philosophie, klang aus dem Mund der in Frankreich ausgebildeten vietnamesischen Professoren wie ein blindes Dogma der Kirche. Zu dieser Zeit wäre ich sogar bereit gewesen, meine eigene kulturelle Identität zu verleugnen, wenn mich nicht 1963 das politische Engagement in einer studentischen Bewegung, die sich gegen die Diskriminierung des buddhistischen Glaubens der Südvietnamesen durch das Diem-Regime zugunsten des Katholizismus richtete, zu meinem eigenen Ursprung zurückgeholt hätte. Ich war damals Gründungsmitglied des Studentenvereins des Buddhistischen Sanghas in Hue, als das Verbot verkündet wurde, dass Buddhisten zu Buddhas Geburtstag ihre Flagge nicht mehr vor dem Haus als Zeichen der Begrüßung der Geburt von Gautama Buddha zeigen durften. Dieser gewaltlose Hungerstreik für die Gleichberechtigung der 85% Buddhisten der südvietnamesischen Bevölkerung kostete mich zwar 3 Monate Haft ohne Gerichtsurteil; er brachte mir jedoch ungewöhnlich viele Einsichten in die buddhistische Lehre, die ich bis dahin nur der Familientradition gemäß ausübte, ohne in der Gewaltlosigkeit (ahimsa) und im Mitgefühl (meta) für den Mitmenschen die buddhistischen Tugenden zu erkennen. Diese Zeit des Engagements gab mir die wundervolle Gelegenheit, das Wesen des vietnamesischen Buddhismus in seiner wahrhaftigen Lebendigkeit zu erfassen, in der das ethische Handeln nicht vom theoretischen Wissen zu trennen ist, sie vielmehr die Ganzheit des Seins ausmachen. Zum ersten Mal wurde ich mir zu dieser Zeit der Verblendung des Einflusses der westlichen Philosophie bewußt; und ich ahnte, eine Reise zur Rückkehr nach innen anzutreten, die auch als eine „Reise nach Osten“ zu verstehen ist. Ich widmete mich bei bekannten Mönchen im Land dem Studium des Buddhismus. 110 Kim Lan Thai Thi Diese „Reise nach Osten“ wurde nach dem Absolvieren der Licence en Lettre in Philosophie und einem sich anschließenden Jahr der Lehrtätigkeit für Philosophie am Gymnasium mit einer anderen verkoppelt und begleitet, nämlich mit der „Reise nach Westen“: 1965 bekam ich vom DAAD ein Stipendium für das Studium in Deutschland. Das Merkwürdigste dieser Studienreise verdient hier vor allem Erwähnung: gerade am Standort Deutschland nahm ich Abschied von der westlichen Verblendung, von Griechenland, vom dogmatischen Marxismus und von Hegel, – Hegel, der die chinesische Philosophie als „Kindheit der Philosophie“ betrachtet hatte. Ich begann mit Hegel – um mit Hegels Hochmut über die chinesische Philosophie zu sprechen – Hegel zu vergessen! Nichts wie raus aus dem Nebel des dogmatischen Schlummers, des Mißverständnisses der Philosophie von Ost und West! „Der dicke Nebel im Gebirge Lo Son und die hohen Wogen auf dem Fluß Triet Giang! Nicht dorthin reisen zu können machte mich unendlich krank Nun bin ich dort angekommen und entdecke nichts Besonderes außer Dem dicken Nebel in Lo Son und den hohen Wogen von Triet Giang!“ So heißt es in den berühmten Versen von To Dong Pha, einem ZenDichter der Tangzeit. Doch für mich war es das höchste Glück, an der deutschen Quellen, befreit von allen Vorurteilen, die größten deutschen Philosophen untersuchen zu können. Dabei konnte ich nach und nach den Wesensunterschied zwischen westlichem und östlichem Denken entdecken, der gerade in den philosophischen Schlüsselbegriffen besteht. Denn die Asiaten legen keinen Wert darauf, ein System der Ontologie festzulegen. Eine ontologische Begründung dient ihnen nur dazu, das ethische Handeln zur Wirksamkeit zu bringen, d.h. zu realisieren. Allein aus diesem Grund ist die ontologische Begründung von funktionaler Bedeutung, und zwar derart, daß sie sich in das Nichtsein der Dinge erschöpft, d.h. aus der aktiven Teilnahme am Werdeprozeß der Dinge zur Ganzheit der Wirklichkeit. Im westlichen Denken aber wird das Sein in Sein und Nichts gespaltet, und so das Nichts zur Tragödie verdammt. Im chinesischen Denken aber besteht kein Sein; und daher auch nicht das fatale Nichts eines Nihilismus. Das Tao, der „Weg“, ist als Grundlage des Werdens nicht zu trennen vom „Te“, der ethischen Realisierung. In diesem ethischen Handeln besteht kein: „Warum ging Bodhidharma gen Osten?“ 111 „es soll ...“ als Grundsatz. „Te“ ist vielmehr als die Verwirklichung des Taos, als dessen andere Seite, zu sehen. Beide bilden eine dynamische Einheit, so daß aus dem „In-Bewegungsetzen“ des Tao das ethische Handeln sich vollzieht und umgekehrt; gerade in dieser ethischen Realisierung zeigt sich das Tao im Licht. Die Morallehre des „Te“ verdient daher eine Erklärung, gehört zur Sprache, zum Lernen. Das Tao zu realisieren, ist am besten im Schweigen. Beide, Tao und Te, liegen der Natur des Menschen zugrunde, sind Weg und Tun eines Menschen, der Inbegriff von Menschlichkeit und Sittlichkeit. Daher sollen wir beim Begriff „Mensch“ nicht dem des „Individuums“ verfallen, der ja der Grund der Schwierigkeit ist, das Obengesagte über Tao zu verstehen. So bedeutet das chinesische Schriftzeichen „yen“ sowohl „Mensch“ als auch „zwei“ oder „Mensch und Mitmensch“; „Ich und Du“ sind nach der buddhistischen Auffassung eins. Im Denken des Konfuzius besteht keine Unterscheidung zwischen dem „ästhetisch Unverbindlichen“ und dem „ethisch Verbindlichen“, oder, um mit Jaspers zu sprechen, „dem Schönen und dem Guten“. Das Schöne ist nicht schön, ohne gut zu sein; und das Gute ist nicht gut, ohne schön zu sein. Musik und Ritus fordern die Entfaltung der Natur des Menschen. Und das Wissen um die Einheit von Tao und Te bedeutet das Wissen der Ganzheit des Seins. Dieses Wissen kann nicht als begriffliches Wissen betrachtet werden, sondern als eine Art von „pris de conscience“, vom Bewußtsein des Ganzen. Es ist verschieden von der westlichen Philosophie, die mit Nachdruck das Bewußtsein, nicht aber das Bewußtwerden betont. Im buddhistischen und chinesischen Sinne ist dies Bewußtwerden nicht ontologisch zu verstehen, so als werde hier ein Objekt oder ein Subjekt wie ein Begriff gebildet. Vielmehr ist das Tao, das ‚Reale’ oder der ‚Grund der Immanenz’, die Bezeichnung für etwas, das mit einer solchen Evidenz bereits vorliegt, daß wir es, obwohl wir es – oder besser: –, weil wir es immer vor Augen haben, nicht mehr sehen. Diese Evidenz verdeutlicht ein Zen-Dialog: Ein Schüler fragt Meister Chao Chou: „Was ist der Weg?“ Chao Chou: „Er liegt vor deinen Augen.“ Der Schüler fragt: „Was ist der wahre Weg?“ Chao Chou: „der alltägliche.“ 112 Kim Lan Thai Thi In diesem Sinne sagt Wittgenstein: „Möge Gott dem Philosophen die Fähigkeit geben, einzudringen in das, was vor allen Augen liegt.“ Gerade in der Auffassung des Grundes besteht der Unterschied zwischen westlicher und östlicher Philosophie: im gewöhnlichen Sinn wird der Begriff des „Grundes“ wie der Hintergrund eines Bildes oder wie das Kapital als Reserve benutzt. Wie aber kann man dieses Reale unter dem BegrifflichMonumentalen der künstlichen Zusammenstellungen westlicher Philosophie erfassen? Entrinnt damit der Philosophie nicht etwas Wesentliches; und ist der Plan der Immanenz mit Deleuze nicht doch stillschweigend als die Idee des Chaos verstehen, wie er dies in „Qu’est ce que la Philosophie“ beschreibt ? Im chinesischen Denken heißt Tao der Weg, der nicht zur Wahrheit führt, sondern den wir passieren; er ist der Weg der Vitalität, der Lebensfähigkeit und der Fahrbarkeit: der Philosoph konzipiert; aber der Weise überquert! Im buddhistischen und chinesischen Denken ist der Weise derjenigen, der sich in der richtigen Mitte befindet; einem Standort der Immanenz, wo alle Möglichkeiten, auch die extremsten, offen sind, wo keine Position festgelegt wird, sondern sich der Wechsel, der Widerspruch vom einen Pol zum anderen, ohne Behinderung vollziehen kann. Der Weise ist offen für jedes „so sein“ und „also“. Nach taoistischer Auffassung ergreift der Weise das Tao in der Art, wie es kommt, erscheint, passiert, in seinem „Von sich selbst so sein“; also beliebig und je nach dem, wie ein hervorgebrachter Klang. Es wird nicht mehr gesucht zu wissen, indem wir dauernd die Objekte zu determinieren versuchen, sondern sich spontan bewußt zu werden – des Grundes der Immanenz, der das Denken mit dem Sein verbindet. Meine Rückkehr zum Osten auf der Reise nach Westen war Moment der Verinnerlichung der eigenen Philosophie. Sie ist wie ein Spiegel, in dem die eigene Philosophie zur Schau gestellt wird und woraus die schöpferische Kraft zum sinnvollen Dialog hervorgebracht werden soll. Während der Untersuchung der Transzendentalphilosophie Kants, die ich als Thema meiner Dissertation wählte, konnte ich neben meiner Bewunderung für diesen Philosophen die unüberwindbare Kluft zwischen der Theorie und der Praxis, zwischen Denken und Sein feststellen, die die Krise der westlichen Philosophie in ihrer Verarmung und Erstarrung mitverursacht. Sie beugt sich, wie ein zeitgenössischer französischer Philosoph feststellt, im Erstarrtwer- „Warum ging Bodhidharma gen Osten?“ 113 den auf ihre eigene Falten. Europa bleibe „von der Weisheit nur noch der Schutt oder die Hirtengötter wie Pyrrhon, Montaigne und den Stoikern.“1 Diese Erstarrung ist auch der Grund meines Nachdenkens über meine jetzige Lehrtätigkeit an der Münchner Universität: wie kann ich den Studenten die Vitalität der Philosophie von Ost und West vermitteln; es ihnen ermöglichen, das Vermögen der Heilung durch vollkommenes Wissen zu erschließen und nicht in der Krankheit der konzeptuellen Erstarrung zu verharren? Einige bescheidene Schritte habe ich im Lauf der Lehrjahre gemacht – von manchen Kollegen als nicht zur Philosophie gehörend getadelt. Aber die fünf Minuten „ruhig zu sitzen und auf das Atmen zu achten“ vor dem Beginn der Diskussion und die Wochenenden mit Meditation und Begegnung im Gespäch wurden von den Studenten immer auf- und angenommen als zu den fruchtbarsten Momente ihres Philosophiestudiums gehörend. Die Weisheit muß passierbar sein. Die Liebe zur Weisheit und Wahrheit sollte mehr denn je entfaltet werden, besonders in dieser Zeit, in der Macht und Haß wie noch nie mit erschreckendem Geschrei die Welt beherrschen. 1 Francois Julien, Le sage est sans idee ou l´autre de la Philosophie, S. 9, editions du seuil, 02/1998, aus der Reihe „L´ordre philosophique“ Besprechungen Neuerscheinungen Hannelore Bublitz Judith Butler. Zur Einführung Hamburg 2002 (Junius), brosch. 155 S., 12.50 EUR. Die Macht befindet sich genau dort, wo das Subjekt sich authentisch und souverän wähnt (20). Soziale Tatsachen ..., Effekte diskursiver Praktiken ... rufen den Anschein hervor, dass es sich um Natur handelt, die unabhängig und vor aller Kultur existiert (26 f.). Die Trennung von Natur und Kultur löst sich ... auf (30). Diese Sätze enthalten in nuce die Themen, mit denen Judith Butler sich auseinandersetzt. Was dabei auf der Strecke bleibt, sind scheinbare Gewissheiten. Dass weitere Handlungsspielräume jenseits gesellschaftlicher Konventionen zu gewinnen sind, zeigt Hannelore Bublitz in ihrem Überblick über Butlers Werk. Ein Ansatzpunkt für Butlers Überlegungen ist der Körper, der für uns – entgegen landläufiger Meinung – nicht biologisches Urgestein ist (39). Vielmehr materialisiert sich in ihm Gesellschaft und ihre symbolische Ordnung. Er unterliegt Schematisierungen, Bildern, Glaubens- und Wissenssystemen, wobei die Regeln der Wissensproduktion in Beziehung zu den Machtverhältnissen in der Gesellschaft stehen (42). So wird die Zwei-Geschlechtlichkeit als anatomisch-biologische Kategorie durch Einfügung polarisierender Zäsuren in einem Kontinuum von Geschlechtsmerkmalen erreicht (60). Dies geschieht über Sprechakte, die zitatförmig Konventionen wiederholen und sich auf ihre Autorität berufen. Die so hergestellten (Geschlechts)Normen werden performativ bestätigt. Performative Sprechakte sind Handlungen; sie spiegeln oder festigen nicht nur eine gegebene soziale Wirklichkeit oder Machtstruktur, sondern sie rufen das, was sie benennen, ins Leben (33). In der Formung des biologischen Körpers entsprechend der kulturell definierten Vorstellung eines Geschlechtskörpers sieht Butler den wesentlichen Mechanismus einer diskursiven Macht. Diese Macht wirkt in der Verfestigung von Begriffen, Kategorien und Klassifikationen zu einem behaupteten körperlichen Natursubstrat und wird als solche nicht mehr sichtbar (51). Vielmehr scheint es umgekehrt, als ob gesellschaftliche Vorstellungen sich aus biologischen Fakten ergäben. Der Körper als Naturtatsache – das ist die Voraussetzung, die Butler durch ihr Dekonstruktionsverfahren in Frage stellt (44). Diese Einsicht, dass die angebliche ‚Natur’ immer schon Ergebnis – und nicht Voraussetzung – kultureller Erkenntnis ist, bildet, wie Hannelore Bublitz hervorhebt, wie keine andere ein unüber- Neuerscheinungen windbares Hindernis für die Aufnahme der Butlerschen Thesen (56). Denn der Körper gilt als das Authentische, als die Bastion, die als das subjektiv Widerständige unwiderstehlich erscheint und gegen die Zwänge von Kultur und Gesellschaft verteidigt wird – auch von Feministinnen. Weswegen Butlers Ablehnung der Unterscheidung von Sex und Gender, die sich aus ihrer Theorie konsequent ergibt, ihr nicht zuletzt aus dem feministischen Lager heftige Schelte eingebracht hat. Was Butler in Bezug auf den Körper durchexerziert, führt sie auch bei der Auseinandersetzung mit dem Subjekt bzw. mit der Psyche fort. Sie geht davon aus, dass gesellschaftliche Diskurse dem Subjekt vorgängig sind, es übersteigen und es ohne sein Wissen hervorbringen. Subjektivierung erscheint als paradoxe Machtform: Der Entwurf, die Bildung des Subjekts als reflexive Instanz und seine Unterwerfung unter Konstruktionsweisen und Technologien der Macht bilden einen Vorgang (98). Der Diskurs ist also die produktive, die gleichzeitig erzeugende und unterwerfende Macht, die dem Individuum eine soziale Existenz gibt (101). Nach Butler erzeugen Diskurse aber auch selbst Widerstände gegen sie bzw. gegen die Machtstrukturen, deren Produkt sie sind. Normen, Rituale und Konventionen verändern sich, indem sie dekontextualisiert werden und damit Bedeutungen und Funktionen erhalten, für die sie gar nicht bestimmt waren (95). Das kulturell konstituierte Subjekt ist demnach in der Lage, das kulturell vorgegebene 115 „Drehbuch“ umzuschreiben (87). Dabei wird das Wort in der neuen Anwendung, die sein früheres Wirkungsgebiet zerstört, zum Instrument des Widerstands (97). In derartigen Ausführungen sehen einige Kritikerinnen Butlers nur einen „semiotischen Guerillakrieg“ (118). Bei der Rezeption von Butlers Theorien ist gerade im deutschsprachigen Raum darauf hingewiesen worden, dass vor allem die historischgesellschaftliche Fundierung ihrer machttheoretischen Analysen mangelhaft sei. Hannelore Bublitz gibt Judith Butler in einem Interview Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Sie setzt damit das „i“-Tüpfelchen auf einen klar dargestellten Überblick über Butlers Grundgedanken. So ist das Buch zu einer äußerst gelungenen Einstiegshilfe in deren Werk geworden. Jadwiga Adamiak Manfred Frank Selbstgefühl. Eine historisch-systematische Erkundung, Frankfurt/Main 2002 (Suhrkamp), brosch., 279 S., 11.- EUR. Im Gegensatz zu Selbsterhaltung, Selbstbestimmung oder gar Selbstbewusstsein zählt der Ausdruck „Selbstgefühl“ sichtlich nicht zum Arsenal der Schlüsselbegriffe philosophischer Moderne. Obwohl, wie die anderen erwähnten Termini, ebenfalls in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geprägt – mithin in jener geistesgeschichtlich höchst entscheidenden Epoche, in der sich der 116 Neuerscheinungen Spannungsbogen von „Kritik und Krise“ (Reinhart Koselleck) als die basale Bedingung explizit modernen Philosophierens herauskristallisierte – hat das Thema des Selbstgefühls seither offenbar nur eine marginale Rolle gespielt. Für das mehr oder minder spurlose Verschwinden des Selbstgefühls aus dem philosophischen Diskurs lassen sich eine Reihe ganz unterschiedlicher Gründe benennen. Zweifelsohne die Hauptursache für diese Entwicklung liegt jedoch in der eigenartigen Ambivalenz, ja enigmatischen Abgründigkeit, die den semantischen Gehalt dieser Begriffskonstruktion ausmacht und ihren Gebrauch im Rahmen rationaler, diskursiv überprüfbarer Argumentation außerordentlich erschwert. Sinnigerweise war es ausgerechnet jene schillernde Unschärfe und idiosynkratische Verschlossenheit, welcher, hauptsächlich in der deutschsprachigen Philosophie ab 1770, der Ausdruck Selbstgefühl seine, allerdings nur zeitweilige, Popularität verdankte. Denn die beiden maßgeblichen Protagonisten dieses philosophischen Begriffs, Johann Gottfried Herder und Friedrich Heinrich Jacobi, schufen diesen Terminus zumal deshalb, weil dadurch jenes „unvordenkliche“ und letztlich numinose Fundamentalprinzip artikuliert werden konnte, das es erlaubte – dem ernüchternden Befund von Kants Metaphysikkritik zum Trotz – die disparaten Sphären von Wissen und Glauben, Reflexion und Intuition, Epistemologie und Ontologie (wieder) miteinander zu verschmelzen. Der von Jacobi und Herder entworfene Interpretationsansatz übte vor allem auf die Dichter und Denker der deutschen Romantik eine kaum zu überschätzende Faszination aus. Schien ihnen doch, vermöge dieses Begriffes, die gleichermaßen ihrer philosophischen wie ästhetischen Produktion zugrundeliegende Synthese von Poesie und Wissenschaft, subjektiver Innerlichkeit und transzendentaler Spekulation nun auch theoretisch abstrakt legitimierbar. Insofern gestattet der philosophisch eher dunkle Begriff des Selbstgefühls zumindest einen erhellenden und aufschlussreichen Einblick in die deutschen (Denk-)Verhältnisse um 1800. In seiner jüngsten Publikation setzt sich Manfred Frank, ein ebenso ausgewiesener Kenner der romantischen Geisteswelt wie der modernen Selbstbewusstseinstheorien von Fichte bis Sartre und darüber hinaus, mit dem rätselhaften Sujet „Selbstgefühl“ auseinander. Der in Tübingen lehrende Philosoph möchte darin nicht bloß eine ausgreifende Sondierung der wechselvollen Rezeptionsgeschichte dieses Ausdrucks vornehmen, sondern, wohl erstmalig im deutschen Sprachraum, zudem in eine konzentrierte Debatte der systematischen Problemkonstellationen eintreten, welche dieser wunderliche Gegenstand aufwirft. Hierzu bietet sich nach Frank insbesondere die Kommentierung einer Textsammlung an, die ihm zufolge „den bedeutendsten philosophischen Beitrag der Frühromantik“ darstellt: die 1797 von Novalis angefertigten „Fichte-Studien“. Mag auf den ersten Blick die Wahl Franks Neuerscheinungen auch abseitig und esoterisch anmuten, so weiß der Autor sie sehr wohl plausibel zu machen. Stellen doch die „Fichte-Studien“ des 25-jährigen Friedrich von Hardenberg, die aus seiner intensiven Auseinandersetzung mit Fichtes „Wissenschaftslehre“ hervorgegangen sind, ein philosophisches Projekt vor, das sich dezidiert von Fichtes rationalistischer Konstruktion des „Ich“ abwandte und das Selbstgefühl in den Rang einer, nein der philosophischen Grundkategorie überhaupt erhob: „Die Filosofie ist ursprünglich ein Gefühl. Die Anschauungen dieses Gefühls begreifen die filosofischen Wissenschaften.“ Ungeachtet des eindrucksvollen Kenntnisreichtums von Manfred Franks „historisch-systematischer Erkundung“ hinterlässt die Lektüre des Buches dennoch einen zwiespältigen Eindruck. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass es zwar einerseits eine immense Fülle begriffsgeschichtlicher Details, philosophiehistorischer Verweisungszusammenhänge und eine hochdifferenzierte, bisweilen allerdings geradezu scholastisch anmutende Beweisführung vor dem Leser aufhäuft, aber andererseits ebenso naheliegende wie gleichzeitig grundsätzliche Fragestellungen entweder nur streift oder gleich völlig ausspart. So thematisiert der Verfasser das eklatante Solipsismusproblem jeder auf das Selbstgefühl gegründeten Aussage genauso wenig wie die daraus notwendig resultierende Grundsatzfrage, ob nicht allein schon deshalb das Selbstgefühl als ein philosophisch ernstzunehmender Begriff ausscheidet. 117 Indem Manfred Frank dieserart die Existenz „eines ungegenständlichen Selbst- und Seinsgefühls“ schlichtweg hypostasiert, bleiben die Ausführungen seiner Abhandlung insgesamt im Bannkreis idealistischer Selbstbespiegelung befangen. Insofern trifft ironischerweise auf seine Veröffentlichung zu, was er selbst im Hinblick auf die philosophische Diskussion des Selbstgefühls abschließend konstatiert: „Blickt man auf die neueste Literatur zur Debatte, so deutet alles darauf hin, dass das Geheimnis noch nicht gelüftet ist. Ja, es sieht nicht einmal so aus, als sei – begriffliche Verfeinerungen abgerechnet – ein wesentlich tieferes Problemverständnis erreicht worden.“ Thomas Wimmer Otfried Höffe (Hg.) Aristoteles: Politik Reihe: Klassiker Auslegen, Bd. 23, Berlin 2001 (Akademie Verlag), 218 S., 19.80 EUR. Sechs Jahre nach dem Band zur Nikomachischen Ethik ist in der von Otfried Höffe herausgegebenen Reihe Klassiker Auslegen nun auch ein Band zur Politik des Aristoteles erschienen. Der Kommentar enthält zwölf Aufsätze von zehn Autoren, von denen drei in englischer Sprache verfasst sind. Ähnlich wie der 1991 von David Keyt und Fred D. Miller, Jr. herausgegebene Companion To Aristotle’s Politics fokussiert der kooperative Kommentar auf die zentralen Begriffe und Argumentationen von Aristoteles’ Politik. Noch stärker als sein Vorgänger 118 Neuerscheinungen folgt er dabei deren Aufbau und ordnet die enthaltenen Texte exakt den kommentierten Büchern und Kapiteln zu. Gerade da Aristoteles’ Werk höchstwahrscheinlich ein „loosely connected set of essays“ (Keyt/Miller) darstellt, ist diese Vorgehensweise besonders angemessen. Otfried Höffe, der Herausgeber des Bandes, hat neben dem Einführungstext und einem Aufsatz über Aristoteles’ Politische Anthropologie auch den Schlusstext verfasst. Darin wendet er sich gegen die „Versuche, Aristoteles zum Ahnherrn des Kommunitarismus zu machen“. Im Gegensatz dazu interpretiert er Aristoteles als „Vordenker des politischen Liberalismus“, als welcher er sich „in seiner Platonkritik, in der Betonung von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit und in seinem Plädoyer für den ,Rechtsstaat’“ erweist (11). Diese Interpretation ist keineswegs unproblematisch. So lehnt Aristoteles, wie Höffe selbst einräumt, die politische Freiheit „im negativen Sinn“ (189) ab, die als Willkürfreiheit den Bürgern erlaubt, so zu leben, wie sie wollen. Auch die von Aristoteles thematisierte und von Höffe zur Unterstützung seiner Interpretation angeführte „positive politische Freiheit, die demokratische Partizipation“ (191) der Bürger, die im Wechsel regieren und regiert werden, versteht Aristoteles keineswegs als gleiche Freiheit. So schließt Aristoteles in den Büchern VII und VIII, in denen er seine Wunschpolis thematisiert, die Mehrzahl der männlichen Bevölkerung, die Bauern, die Handwerker und die Tagelöhner, vom Bürgerrecht und damit von der politischen Partizipation aus (Frauen und Sklaven von Natur bleiben wegen der von Aristoteles angenommenen anthropologischen Ungleichheit sowieso außen vor). Aristoteles’ zentrales Argument für diesen Ausschluss, dass die arbeitenden Bevölkerungsschichten keine Muße und deshalb einen Mangel an den für das politische Leben erforderlichen Tüchtigkeiten haben, ist auch für seine Reflexionen über Verteilungsgerechtigkeit in der politischen Sphäre aus Buch III relevant. So teilt Aristoteles bei der Frage nach der gerechten Verteilung von Ämtern und Ehren keineswegs die demokratische Auffassung der Freigeborenen, dass deren Freiheit allein ein relevantes Wertkriterium und damit ein legitimer Anspruchsgrund auf Ämter und Ehren ist. Als einen solchen erkennt er letztlich nur die Tüchtigkeit eines Bürgers an, insbesondere die ethischen Tüchtigkeiten in Verbindung mit der Klugheit. Wie bereits erwähnt, können diese Tüchtigkeiten für ihn allerdings nur von den Wenigsten, die über die nötige Muße verfügen, vollkommen verwirklicht werden kann. Die sich daraus für Aristoteles in der Wunschpolis ergebende Partizipationsbeschränkung ist für ihn somit auch ein Gebot der Gerechtigkeit, was es nochmals erschwert, ihn als „Vordenker des Liberalismus“ Eckart Schütrumpf zu interpretieren. bemerkt in seinem Aufsatz über Verfassungen und politische Institutionen (IV 1-16) zurecht, dass Verfassungen, die wie Aristoteles’ Wunschpolis von der Tüchtigkeit bestimmt sind, zu seiner Zeit bereits Neuerscheinungen der Vergangenheit angehören (122). Dessen ist sich Aristoteles wohl bewusst. So äußert er nach einem kurzen Abriss über die geschichtliche Verfassungsentwicklung: „Da gleichzeitig die Staaten auch größer wurden, so kann heute wohl nicht mehr leicht eine andere Staatsform entstehen als die Demokratie“ (1286 b 2022). Da Aristoteles die Augen vor der zeitgenössischen Realität nicht verschließen will, wählt er nach der Auslegung von Schütrumpf in den Büchern IV-VI der Politik einen „ganz neuen Ansatz der Verfassungsbetrachtung“ (122). Diese Bücher differenzieren für Schütrumpf also nicht, wie häufig interpretiert wird, die in Buch III entwickelte Verfassungstheorie, sondern sind ein verfassungstheoretischer Neuansatz. Sie enthalten „grundsätzliche methodische Erwägungen“, die für Schütrumpf sogar „den wichtigsten Beitrag des Aristoteles zu seiner politischen Philosophie darstellen“ (135). Grundprinzipien des neuen Ansatzes sind für ihn etwa, dass „die praktische Intention und die Rücksicht auf das Realisierbare dominierend“ sind und dass der „Gesetzgeber und leitende Politiker, von denen in Pol. III nur ganz am Rande die Rede war“, als die zentralen Persönlichkeiten politische Reformen durchführen sollen. Dabei orientieren sie sich nicht „an den Prinzipien distributiver Gerechtigkeit, sondern an dem, was nützlich und angemessen ist“ (122f.). Auch wenn Schütrumpfs Interpretation einige bedenkenswerte Argumente für sich geltend machen kann, ist damit noch nicht das letzte Wort zu der Frage über den inneren 119 Zusammenhang der acht Bücher der Politik gesprochen. Manuel Knoll Otfried Höffe Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung, München 2001 (C.H. Beck), 126 S., 7.50 EUR. Otfried Höffe ist Professor für Philosophie und Leiter der Forschungsstelle Politische Philosophie in Tübingen sowie Herausgeber der Reihe „Denker“ im Beck Verlag und hat in letzter Zeit die Bücher „Demokratie im Zeitalter der Globalisierung“ (1999) und „Kleine Geschichte der Philosophie“ (2001) veröffentlicht. Mit „Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung“ soll auf 126 Seiten eine „kultur- und epochenübergreifende Einführung in Begriff und Geschichte“ „von der Frühzeit des Menschen bis in das heutige Zeitalter der Globalisierung“ und eine „historisch und systematisch kompetente Darlegung“ eines „zentralen Grundsatzes des menschlichen Zusammenlebens“ vorgelegt werden. Wer meint, es bräuchte ein übermenschliches Genie, um auf so gedrängtem Platz eine sowohl umfassende wie adäquate Darstellung des Themas Gerechtigkeit zu geben, die zum einen zeitlich die Entwicklung vom Altertum bis in die Gegenwart nachzeichnet und zum anderen semantisch die Dimensionen der Begriffe Gerechtigkeit, Skepsis, Naturrecht, Verfahrensgerechtigkeit, Justiz, politischer Gerechtigkeit, Menschenrechten, Strafgerechtigkeit, soziale Ge- 120 Neuerscheinungen rechtigkeit, Toleranz und globale Gerechtigkeit auslotet, und die bei all dem dies noch verständlich macht, mag sich gleich wieder beruhigen: Das Buch schafft dies in keiner Weise. Bei der Lektüre fällt erst einmal der Hang auf, größtenteils im Guido Knopp’schen Theorie-Light-Format nur knapp und dogmatisch zu dozieren statt den Gegenstand, wie es einer philosophischen Einführung wohl anstände, argumentativbegründend zu entwickeln. So beschränkt sich Höffe von vornherein darauf, die verschiedenen gerechtigkeitstheoretischen Positionen nur darzulegen, ohne ihren semantischen Gehalt zu überprüfen. Mag dies bei der Darstellung ephemerer gerechtigkeitsgeschichtlicher Theoreme aus Platzgründen noch angehen, so gerät dies bei der Beschreibung elementarer und aktueller Gerechtigkeitsmodelle wie der Verteilungs- und Tauschgerechtigkeit, der Menschenrechte, der Freiheits-, Sozial- und Kulturrechte, der sozialen Gerechtigkeit und der globalen Gerechtigkeit zu einem nicht unbeträchtlichen Fiasko: Dort, wo die Darstellung konkret werden müsste, werden keine Untersuchungen unternommen, sondern nur die von Sachwissen weitgehend befreiten Theoreme und eine über aller Empirie schwebende Wunschliste präsentiert, die dem Leser, der um das Verständnis ringt, was Gerechtigkeit bedeuten könnte, nicht gerade erleichtert. Man hat oft den Eindruck, dass anstelle einer philosophischen Einführung in das Thema Gerechtigkeit die privaten Vorstellungen des Autors zu diesem Sujet (die wohl einer dezidiert konservativ-liberalen Auffassung des Gegenstands entsprechen) gegeben werden. Und auch diese werden – als ob es keine anderen Positionen geben könne – nur dargelegt und – wo überhaupt – argumentativ höchst zweifelhaft untermauert. So möchte man beispielsweise doch den Sinn erfahren, wenn zum Thema der „sozialen Gerechtigkeit“ Höffes Plädoyer für einen „Paradigmenwechsel“ weg vom Verteilungs- hin zum Tauschprinzip, das sein gesamtes Buch durchzieht, mit der „Binsenwahrheit“ begründet wird, dass „die zu verteilenden Mittel ... erst erarbeitet und im Fall der Arbeitsteilung wechselseitig getauscht werden müssen“, um dann der weiteren Voraussetzung zu bedürfen, dies gelte freilich nur, „solange man keinen nur ökonomischen Tauschbegriff“ verwendet (85). Abgesehen von dem logischen Trick, erst einen ökonomischen Tauschbegriff einzuführen (und ihn mit der Arbeitsteilung gleichzusetzen), um dann mit einem nicht-ökonomischen, der von Marcel Mauss entlehnt wird, fortzufahren, übersieht Höffe die andere, nicht minder gültige Binsenwahrheit, dass zumindest in warenproduzierenden Gesellschaften, bevor überhaupt produziert wird, die Mittel zur Produktion schon verteilt sind. Was wiederum zur Folge hat, dass die einen mit ihrem Einkommen ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, während die anderen ihr Vermögen zur Aneignung der durch die Arbeit erzeugten Profite verwenden können. Dies aber müsste doch seinerseits Konsequenzen fürs The- Neuerscheinungen ma der sozialen Gerechtigkeit haben. Nun soll der „argumentationsstrategische Vorteil“ des Tausches darin bestehen, „daß die Verteilungsprinzipien umstritten sind, der Grundsatz der Tauschgerechtigkeit, die Gleichwertigkeit im Geben und Nehmen dagegen nicht“ (68). Er sei, wie Höffe versichert, „entwicklungsgeschichtlich ... zunächst innerhalb der Familie und der Großfamilie“ aufgetaucht (69, vgl. auch 87), – während der Rest der Welt, der allerdings mit dem profanen ökonomischen Tauschbegriff operiert, meint, zumindest in der Familie finde kein Warentausch statt. Höffe, so scheint es, setzt ständig Tausch und Warentausch in eins. Und der Verdacht liegt nahe, dass er mit seiner Absicht, den Tauschbegriff nicht nur ökonomisch zu deuten, genau diesen universalisiert. Er hat die Formen des Tausches offenbar schon dermaßen internalisiert und anthropologisiert, dass er nun gezwungen ist, ihn gleichsam als ‚Naturtatsache’ auch auf soziale Beziehungen anzuwenden, die von sich aus keiner Logik des Warentauschs unterliegen. Er ordnet so den Lebenshorizont der Menschen vollständig dem Tauschprinzip unter. Ein weiterer Vorteil der Tausch- vor der Verteilungsgerechtigkeit soll sein: „Während jeder Verteilung wegen ihrer Asymmetrie ein maternalistischer oder paternalistischer Charakter anhaftet, besteht das Grundmuster der Kooperation unter Gleichen in der Wechselseitigkeit, also dem Tausch.“ (86) Das mag so sein. Aber davon, dass in der Marxschen Theorie etwa die Menschen in der Zirkulations- 121 sphäre des Tausches zwar in der Tat gleich, in der Produktionssphäre aber ungleich sind, und dass die Gleichheit innerhalb der Tauschlogik genau von dieser Ungleichheit abstrahiert, die dann aufgrund ihrer Gleichbehandlung in eine potenzierte Ungleichheit umschlagen kann, von solchen Gerechtigkeitsproblemen ist Höffes Argumentation weitgehend befreit. Was es für seine Theorie der Tauschgerechtigkeit bedeuten könnte, wenn sich ergäbe, dass der Zirkulation real die Produktionssphäre vorgeordnet ist, in der die Mittel bereits ungleich verteilt sind, so dass die einen arbeiten, die anderen aber arbeiten lassen, d.h. schon die Produktion eine Frage der Verteilung ist, die nicht mit der bloßen Arbeitsteilung zusammenfällt, darüber zerbricht sich Höffe zumindest in diesem Buch nicht den Kopf. Er rät stattdessen, nicht zu übersehen, „daß Sozialleistungen nicht bloß die Entmachtung von Solidargemeinschaften kompensieren, sondern sie auch verursachen können. Im übrigen sind auch berechtigte Sozialleistungen nur in Ausnahmefällen ohne Gegenleistung als Geschenk berechtigt. Denn im Unterschied zur Menschenliebe ist die Gerechtigkeit auf Wechselseitigkeit ausgelegt. Im Rahmen seiner Möglichkeiten ist deshalb kommunale Arbeit des Sozialhilfeempfängers nicht unangemessen, zumal sie seine Selbstachtung – man verdient sich die Hilfe – steigern kann.“ (77) Darüber hinaus meint Höffe: „Die soziale Gerechtigkeit gebietet schon deshalb keine gleichen Ergebnisse (‚Ergebnisgerechtigkeit’, besser: Er- 122 Neuerscheinungen gebnisgleichheit), weil man sie aus eigener Verantwortung auch verspielen kann. Auch verlangt sie, weder Unterschiede der Begabung noch des Arbeitseinsatzes zu verleugnen.“ (88) Soziale Differenzierungen, so muss man dies verstehen, entstehen offenbar ausschließlich durch unterschiedliche Begabung und Fleiß. Höffe wechselt so nach Belieben die unterschiedlichen Ebenen der Abstraktion; er changiert von ‚abstrakt gleich’ zu ‚konkret ungleich’, wie es ihm paßt: Sind die sozialen Hierarchien erst einmal aus den unterschiedlichen Befähigungen abgeleitet („Herr und Knecht“ würden „neutraler“ durch „Menschen mit unterschiedlicher wirtschaftlicher Begabung“ ausgedrückt; 62), kann der abstrakte Begriff der Tauschgerechtigkeit etabliert werden, der die sozialen Hierarchien ignoriert. Zum Schluss beschwört Höffe, der sich wundert, dass global der Reichtum ungleich verteilt ist und „erstaunlicherweise oft die ressourcenreichsten Länder unter Armut leiden“ (105), für die Fragen der globalen Gerechtigkeit die gute alte Weltrepublik des Immanuel Kant, die „ein politisches Ideal“ sei, „dessen Verwirklichung nicht nur gerechtigkeitstheoretisch geboten ist, sondern zu dem die Weltgesellschaft schon tatsächlich unterwegs ist“ (105), und fordert eine „anamnetische Gerechtigkeit“ ein: „Die Fairneß gegen die Opfer verlangt von der Weltgesellschaft, sich nicht mit der Erinnerung an einige besonders gravierende Verbrechen zu begnügen und sie keinesfalls selektiv wahrzunehmen. Daß gewisse Geno- zide tief ins Weltgedächtnis eingegraben, andere dagegen kleingeredet oder verdrängt werden, ist ein elementares ‚anamnetisches Unrecht’ an den Opfern.“ (109) In Sachen Völkermord, scheinen die Ausführungen nahezulegen, sollen sich andere erst einmal um ihre Balken im Auge kümmern, bevor sie sich über die deutschen Splitter Sorgen machen. Ähnlich politisch-praktische Vorschläge weiß Höffe auch in Fragen der Einwanderungspolitik zu machen: „Weder dürfen friedliche Ausländer schon an der Grenze – von den Staatsorganen oder mit staatlicher Duldung – beraubt, willkürlich ins Gefängnis geworfen oder gar versklavt werden, noch dürfen sie, einmal ins Land eingelassen, dem Schutz des Zivil- und Strafrechts entzogen werden.“ (103) Alles in allem: Das in edler Geisteseinfalt geschriebene politische Pamphlet als eine kompetente philosophische Einführung in das Thema Gerechtigkeit zu verkaufen, ist von einem verlegerischen samuraiesken Wagemut, dem man höchste Bewunderung zollen muß. Deshalb: Jeder, der erfahren will, wie eine philosophische Einführung nicht sein sollte, muss einen Blick in dieses Büchlein wagen. Reinhard Jellen Gerd Irrlitz Kant Handbuch. Leben und Werk, Stuttgart / Weimar 2003 (Metzler-Verlag), 562 S., 49,90 EUR. Irrlitz befasst sich nur beiläufig in sei- Neuerscheinungen seiner Vorrede mit der Perspektive des Handbuches: es soll Kants Gesamtwerk als Einheit umreißen. Das Lehrbuch bietet neben der Biografie und der Beschreibung des geistigen Klimas, in dem Kant lebte, eine chronologische Zusammenfassung von Kants Werken und den seiner Zeit aktuellen Stand der philosophischen Diskussion. Den übersichtlich gegliederten Abschnitten fügt Irrlitz stets einige Hinweise auf Sekundärliteratur bei. Anhand des Stichwortverzeichnisses im Anhang kann man die kantischen Schlüsselbegriffe jeweils in deren werkgeschichtlichen Zusammenhang aufsuchen. Zusätzlich wird in dem Kapitel über die „Kritik der reinen Vernunft“ aufschlussreich Kants Sprache und deren Leitbegriffe beschrieben. Irrlitz zeichnet das Kant-Handbuch als einziger Autor. Neben der Problematik dieses Unterfangens, nämlich der Gefahr der Überforderung des Verfassers, hat dies doch den Vorteil, dass dem Leser ein ständiger Perspektiven- und Paradigmenwechsel verschiedener Autoren erspart bleibt. Irrlitz schränkt seine Darstellung auf Kants Werk und dessen zeitgenössische Einflüsse ein. Diese Enthaltsamkeit erscheint auf den ersten Blick sinnvoll, auch wenn sie denjenigen politischen Aspekt von Kants Werk beschneidet, der vor allem in Hinblick auf seine Wirkungsgeschichte interessant und mit eben dieser verwachsen ist. Dass aber der außergewöhnliche und extreme geschichtliche Anspruch – tatsächlich ernst genommen – kaum zu verwirklichen ist, wird von Irrlitz bedauerlicherweise 123 nicht thematisiert. Kurios erscheint in diesem Zusammenhang der Hinweis auf Kants Stellung zur Französischen Revolution als Antithese von Nietzsches hundert Jahre späterer Verkündigung der ewigen Wiederkunft: „Eine Eigentümlichkeit der Kantschen Auffassung der Französischen Revolution besteht auch darin, dass er wohl meinte, solche wesentlichen Ereignisse der Weltgeschichte geschehen eigentlich nur ein Mal. Danach ist deren zeitgemäßes Erfordernis im öffentlichen Bewusstsein (‚Enthusiasmus‘) schlechthin so verankert, dass sich die Resultate der ursprünglichen Erneuerungsform in anderen Staaten auf reformerischem Wege weiter verbreiten.“ (41) Am Vergleich zur historisierenden Aufführungspraxis alter Musik mag die geschichtsphilosophische Problematik des Kant-Handbuches deutlicher werden: Wie viel Mühe kostet die Rekonstruktion alter Musikstücke, angefangen bei den Instrumenten und deren Stimmung, der Akustik, der zeitgenössischen Aufführungspraxis, den Hörgewohnheiten jetzt und damals und der unterschiedlichen Auffassung von Dynamik – um nur einige Faktoren zu nennen. Das Ergebnis solcher historisch-kritischen Exekution ist im Idealfall Befremdung, Wahrnehmung der geschichtlichen Distanz, oder auch die Tatsache, dass man sich in eine andere Zeit versetzt fühlt. Über weite Strecken, wie auch im gelungen biografischen Teil des Handbuchs, in dem Irrlitz gekonnt den historischen Raum der Aufklärung im kantischen Königs- 124 Neuerscheinungen berg evoziert, gelingt dies. In solchen Bereichen stellt er eine solche bewusste Distanz her, die die geschichtliche Vermittlung begünstigt. Andere Stellen des Handbuchs sind kaum verständlich ohne eine genaue Kenntnis der Originaltexte oder deren Parallellektüre. Für Kantinteressierte ist das Buch in jedem Fall lesenswert. Michaela Homolka Ulrike Kleemeier Grundfragen einer philosophischen Theorie des Krieges Berlin 2002 (Akademie Verlag), geb., 339 S., 49.80 EUR. Kleemeiers Buch ist aus einer Habilitationsschrift hervorgegangen, überarbeitet und mit Mitteln und Unterstützung der Clausewitz-Gesellschaft gedruckt worden. Wie es sich im wissenschaftlichen Diskurs gehört, will sich Kleemeier dem „Krieg“ distanziert und objektiv nähern, einen „adäquaten Kriegsbegriff“ vorschlagen (20). Damit verbundene Reflexionen über Begriffsbildungen sind Garnitur. In der Einleitung wird kurz eine Begriffsgeschichte abgehandelt, in der wichtige Autoren und Fragen wie die nach dem gerechten Krieg nicht fehlen dürfen. Kleemeier benennt ihr Raster, mit dessen Hilfe sie die von ihr behandelten Autoren untersuchen wird: Ob Clausewitz in die Reihe von Platon und Hobbes gehört? Auf S. 32 glimmt eine Ahnung vom Zeitbezug der Theorien und Rechtfertigungssysteme zu Kriegsfragen auf, denen dann jedoch nirgends nachgegangen wird. Wie denn überhaupt die brisanten politischen Fragen mit Gegenwartsbezug in den Fußnoten zu verschwinden scheinen. Intensiv wird Platon diskutiert. Die in der „Politeia“ dargestellte Theorie der Gerechtigkeit wird bezüglich der „Wächter“ aber nur auf die Kategorie der „Krieger“ verengt. Wie nebenbei werden militärische Wörter wie „Waffengang“ und „Streitkräfte“ in die Darstellung eingespeist. Kleemeiers Analyse legt nahe, Militärs, die philosophieren, wären die besseren Herrscher, weil sie nicht mit der Maßlosigkeit des Erwerbsstrebens verquickt seien. (Gen. Reinhardt, Gebirgsjäger, promovierter Philosoph und Mitglied der ClausewitzGesellschaft könnte sich über diese Ehrerbietung nur freuen.) Wird hier argumentativ ein neues Pflänzchen des Militarismus gehegt und gepflegt? Wen würde es wundern, wo inzwischen doch Bomberpiloten „zur Arbeit fliegen“. Ist dies das moderne „wahre Soldatentum“, das Kleemeier verteidigt (99)? Wozu der Mann am Laptop beim Durchspielen verschiedener Strategien „Tapferkeit“ benötigt, entzieht sich der Ahnung des Rezensenten. Moderne „Rechtfertigungen“ wie die, ein Krieg könne als „Strafaktion“ gegen ungerechte Staaten aufgefaßt werden, können mit Platon (nach Kleemeier) argumentativ begründet werden. (73) Gleiches gilt für den Krieg gegen Zivilbevölkerungen, sofern diese ein verbrecherisches Regime getragen haben. Ob dies eine Aufregung wert gewesen wäre? Die bei Platon vorhandenen Ansät- Neuerscheinungen ze, das maßlose Erwerbsstreben als Quelle der Kriegsbereitschaft zu sehen, wären wert, weiter verfolgt zu werden. Ob das Streben nach maximalem Gewinn und die Zusammenballung von Macht in Wirtschaftsorganisationen nicht in der Lage sind, alle „Werte“ auszuhebeln? Eingehend werden Hobbes „Naturgesetze“ des menschlichen Handelns diskutiert. Die Aporie, ein mechanistisches Selbstverständnis mit Verpflichtungen zu Verhaltensweisen zu verbinden, kann auch Kleemeier nicht überzeugend auflösen. Streckenweise liest sich Hobbes „Modellkrieg“ wie das erste Hintergrundbild des Homo oeconomicus. Kleemeier arbeitet heraus, daß das Soldatentum in Hobbes’ gedanklichem Rahmen keinen Platz haben könnte; sie zeigt aber nicht, was daraus folgen kann: Militär als Staat im Staate, besondere Belohnungen für Soldaten, wie etwa für deutsche Generäle unter Hitler. Schließlich gilt, daß der eigene Tod in einem „egoistischen Grundmodell des Menschen“ keine wählbare Alternative ist. Hier wird es deshalb notwendig, zu Clausewitz überzugehen, der die soldatischen Tugenden kennt und intensiv würdigt. Auch Hobbes sollte man nicht kritiklos darstellen, sondern die von ihm beobachteten kriegerischen Zustände mit den geschichtlichen Fakten vergleichen. Es gab nie einen Krieg aller gegen alle, Kriege waren immer Handlungen von Organisationen, ob Fürsten oder Gesellschaften, Kirchen oder Königen. Insofern sind sie an die Voraussetzung der Konzentration von Macht gebunden. Organisations- 125 handeln in anthropologische Beschaffenheit umzudeuten, ist ein immer wieder angebotenes ideologisches Mittel („Seht, ihr seid nicht besser“), um in individuelle Schuld umzubiegen, was Ausfluß kollektiven Handelns ist. Philosophische Grundfragen einer „Theorie des Krieges“, im Altertum beginnend über Hobbes bis Clausewitz, zu diskutieren, ist gewagt, wohl aber Programm. Die beiden ersten bieten als prominente Philosophen den ehrwürdigen Hintergrund, um über Philosophie sprechen zu können und damit Clausewitz aufzuwerten. Aus Clausewitz, den man nach der Darstellung Kleemeiers wohlwollend als Verfasser einer Managementlehre der Kriegsführung betrachten könnte, wird offen erkennbar ein Vehikel, um den Beruf des Soldaten mit kritischer politischer Komponente ins rechte Licht zu rücken. Generäle erhalten hier den Status intuitiv genialer Unternehmer Schumpeterschen Typus („schöpferische Zerstörung“). In der mangelnden kritischen Distanz der Texte Kleemeiers wird dem Rezensenten deutlich, für welche edlen Helden das Herz der Professorin schlägt. Jedenfalls wird v. Weizsäckers verzweifeltes Ringen um „Wege aus der Gefahr“ in den 80er Jahren mit seinem Blick auf die Studien über „Kriegsfolgen und Kriegsverhütung“ nicht einmal mehr im Literaturverzeichnis erwähnt. Kleemeier rehabilitiert die soldatische Gedankenwelt, die sich offenbar seit Clausewitz bis in die Bundeswehr hinein erhalten hat. Und dies, obwohl sich Clausewitz’ Äußerungen wie „Kampf bis 126 Neuerscheinungen zum letzten Blutstropfen“ auch für den „totalen Krieg“ des Dritten Reichs haben instrumentalisieren lassen. Unerfindlich bleibt für mich, wie man so unbefangen über Krieg, Kriegsführung, Kriegstheorie, Charakterstärke und Mut im Krieg reden kann, wenn man nur ein wenig über die Leiden im Krieg, über spezifische Waffentechnologien, Optimierung der „Tötung von Weichzielen“ erfahren hat. Für Clausewitz jedenfalls hat die Angst nur den Rang eines „Störfaktors“ im „reinen Krieg“. Was bringt dies Buch? – Das Reden über Krieg wird nüchtern, distanziert, fußnotenartig. Irgendwie gewöhnt man sich daran. Man kann in Gesprächen einspielen, schon Platon habe gesagt, dass... – Wie in der Weimarer Republik werden Platon und Hobbes zur höheren Weihe des Militärs benutzt, damals zur Untermauerung des totalitären Staates. – Ich erkenne keine philosophische Analyse, sondern ein erneutes Umgraben der Traditionsbestände mit einhergehender Entgeschichtlichung. Ob Clausewitz den Weberschen Machtbegriff vorweg genommen hat, ist sehr unwichtig zu wissen. – An einigen Stellen könnte man sagen, Platon habe vorweg gedacht, im Krieg werde das erste Opfer die Wahrheit (Als ob das was hülfe!). – Clausewitz wird drastisch aufgewertet und fast liebevoll als „der General“ tituliert. Ich fürchte, man wird das Buch in nicht fernen Tagen in die Literatur zur „geistigen Mobilmachung“ einordnen müssen. Die Autorin ist klug und hat sich einen neuen Markt gesucht. Die sich um die Bundeswehr entwickelnden Vereine und Organisationen bedürfen ab und an der tieferen Besinnung durch Vorträge, die sich mit den zitierten Koryphäen trefflich garnieren lassen. Wundersam ist nur, warum nicht auf Kant „zurückgegangen wird“. Oder sind solche Auslassungen Programm? Heutige Soldaten suchen nach seelischer Aufrüstung, nicht nach dem Säen von Zweifeln an ihrer Existenzberechtigung. Und so ist es nur folgerichtig, wenn dem Reservistenverband etwas zur Tapferkeit bei Clausewitz vorgetragen werden kann (Quelle: VII. Forum Junger Reserveoffiziere im Sanitätsdienst, Sprecher: Hauptmann L. Bresan, Referat: PD Dr. habil. U. Kleemeier). Oder sind sie es gar leid, von Politikern in ihrem Können gegängelt zu werden? Wolfgang Teune Manuel Knoll Theodor W. Adorno – Ethik als erste Philosophie München 2002 (Fink-Verlag), brosch., 264 S., 24.90 EUR. Auf dem Umschlag von Manuel Knolls Studie über Adornos Moralphilosophie ist eine Reproduktion des berühmten Guernica-Gemäldes von Pablo Picasso zu sehen. Gemalt hat es der kubistische Avantgardist und Kommunist als Reaktion auf die faschistischen Bombenangriff der spanischen Stadt Guernica 1937. In dem monumentalen Bild steckt allerdings Neuerscheinungen mehr als nur das Antikriegsbild, das heute gerne unbedarft von der Friedensbewegung nutzbar gemacht wird. Picassos Bild ist zugleich und vor allem lesbar als Kritik einer Dialektik der Aufklärung: im Schein der Lampensonne winden sich die Opfer der Gewalt, im Lichtkegel der Aufklärung schlägt Vernunft in Barbarei um. Ein Jahrzehnt später veröffentlichen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno ihre ‚Dialektik der Aufklärung’ genannten philosophischen Fragmente. In der akademischen AdornoRezeption wurde die darin entfaltete Geschichtsphilosophie als Grundfigur einer Philosophie gedeutet, die die dringliche Frage, wie und ob nach Auschwitz noch Philosophie möglich ist, nur negativ beantworten kann – indem Philosophie in der ‚Ästhetischen Theorie’ mündet. So wurde die späte Ästhetik Adornos zum Höhepunkt eines Denkens, dass doch eigentlich keine Höhepunkte kennt. Sowenig Picassos Guernica auf seine „Ästhetik“ reduzierbar ist (nach der es heute zum farblich passenden Wohnzimmerschmuck gemodelt wurde), wenngleich es doch nur vermittels der Ästhetik sich entschlüsselt, so versucht Knoll, Adorno vom engen Interpretationskorsett des Ästhetischen zu befreien, um in der Fluchtbahn eben des Ästhetischen ein anderes, bislang vernachlässigtes Kernmotiv seines Denkens freizulegen: eine Ethik als erste Philosophie. „Da die Aufgabe der Ästhetik für Adorno darin besteht, den Wahrheitsgehalt der Kunstwerke durch die auf die umfassende philosophische Theorie gestützte Interpretation zu gewinnen, 127 unterstellt er sie gleichermaßen dem Primat der Ethik. Seine Ästhetik lässt sich demzufolge als materialistische und utopisch hedonistische Ästhetik unter dem Primat der Ethik charakterisieren“ (248), resümiert Knoll. Von erster Philosophie und vom Primat der Ethik bei Adorno zu sprechen, ist nicht unproblematisch, auch deshalb, weil seine kritische Theorie eigentlich unter dem Vorzeichen einer letzten Philosophie steht. Das bestätigten auch die bisherigen Untersuchungen zum Thema, vor allem Gerhard Schweppenhäusers ‚Ethik nach Auschwitz’, in der Adornos Ansatz als „negative Moralphilosophie“ gekennzeichnet wird. Doch Knoll unternimmt es, diesen Ansatz zu radikalisieren, indem er zeigt, dass sich gewissermaßen die negative Philosophie der Moral begründet im Primat einer ethischen, wenn auch verstellten Forderung an Praxis, dem neuen kategorischen Imperativ, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Ethik als erste Philosophie meint, Adorno als materialistischen Theoretiker zu lesen, der den Impuls seines Denkens im Abschaffen des Leidens und in einer Verteidigung des Hedonismus findet. Ethik als Kern der Philosophie Adornos zu verstehen und nicht als einen systematischen Aspekt, heißt bei Knoll schließlich, Adornos kritische Theorie der Gesellschaft als durchaus auf verändernde Praxis angelegte, zumindest dahin utopisch zugespitzte zu interpretieren: im Sinne einer hedonistischen Sozialutopie. Primat der Ethik zielt auf Kritik; als 128 Neuerscheinungen Selbstkritik der Vernunft ist diese Ethik wesentlich Praxis des Denkens. Und solches Denken ist im Sinne des Knollschen Begriffs der Ethik Objektivation des Leidens: das leistet Philosophie wie Kunst (und hier geht es auch um das Guernica-Bild Picassos), die sich in einer kritischen Geschichtsphilosophie konzentrieren (so das Kapitel IV über „Geschichtsphilosophie als Erkenntnis der Gründe des Leidens und der Ungerechtigkeit“). In den darauffolgenden Kapiteln entwickelt und aktualisiert Knoll Adornos Philosophie, gerade als ethische, als radikale Kritik der kapitalistischen Gesellschaft, deren utopischer Gegenentwurf weit über die bloße Abschaffung des Verwertungszusammenhangs hinausweist und trotzdem beim dringlichsten bleibt: ein Leben ohne Angst und ohne Hunger. Adorno galt die Möglichkeit von (sozialer) Praxis auf unabsehbare Zeit vertagt. Wenn Knoll gleichwohl als den ethischen Kern der kritischen Theorie Adornos das praktische Motiv freilegt, argumentiert er nicht nur mit Adorno gegen ihn, sondern verteidigt ihn vor allem gegen seine Liebhaber. Roger Behrens Martha C. Nussbaum Konstruktion der Liebe, des Begehrens und der Fürsorge. Drei philosophische Aufsätze, übers. von J. Schulte, Stuttgart 2002 (Reclam), 233 S., 5.60 EUR. Die in Chicago lehrende feministi- sche und politische Philosophin Martha C. Nussbaum wurde in Deutschland lange als Geheimtipp gehandelt. Das lag u.a. daran, dass bis vor kurzem wenige ihrer Schriften übersetzt vorlagen. Der vom Reclamverlag edierte Band Konstruktion der Liebe, des Begehrens und der Fürsorge macht nun die Autorin in Deutschland sicher weiter bekannt, stellt aber auch nur eine Auswahl des EssayBandes Sex and Social Justice vor, den die Autorin 1999 in den USA veröffentlichte. Zuvor erschien auf Deutsch als Buch nur Gerechtigkeit oder Das gute Leben (Suhrkamp 1999), das ebenfalls eine Sammlung von Aufsätzen ist, die vor allem Nussbaums politische Ethik offeriert. Um den politischen Liberalismus der Gegenwart weiterzuentwickeln, rekurriert Nussbaum in Abgrenzung zu MacIntyres Tugendethik einerseits kritisch auf Aristoteles und eine Ethik des guten Lebens; andererseits bezieht sie sich positiv auf eine „menschliche Natur“, was in der Ethik lange als verpönt galt. Schließlich geht es ihr um die Grenzen rationalistischer Konstruktionen deontologischer (gesetz- und pflichttheoretischer) Moralen und um ihre Vermittlung mit dem gesellschaftlichen Kontext. Die neueren Arbeiten Nussbaums greifen mehr in die feministische Debatte ein. Nussbaums Verständnis von Feminismus ist durch fünf Merkmale gekennzeichnet: Internationalismus, Humanismus, Liberalismus, ein Interesse an der sozialen Prägung von Präferenzen und Wünschen sowie das Interesse am mitfühlenden Verstehen. Der Zusammenhang dieser Neuerscheinungen Merkmale geht im deutschen Band allerdings etwas verloren. Leider wurden nur drei der insgesamt fünfzehn Essays in die deutsche Auswahl übernommen, so dass Nussbaum mehrfach auf die anderen Essays verweisen muss, um den Zusammenhang ihrer Überlegungen anzudeuten. Dies steht im Kontrast zu den durchweg differenzierten und vielschichtigen Argumentationen der Essays. Der Eingangsessay Die feministische Kritik des Liberalismus verteidigt den Liberalismus gegen feministische Frontalangriffe, die Nussbaum für unangebracht hält, da sie die Leistungen der liberalistischen Tradition verkennen. Dies verwundert zunächst, wo doch die Zeiten neoliberaler Globalisierung Frauen keine Emanzipationsgewinne zu bringen scheinen. Nussbaum bezieht sich allerdings nicht auf den „ganzen“ Liberalismus, sondern nur auf eine bestimmte Spielart. Persönlichkeit, Autonomie, Rechtsansprüche, Würde und Selbstachtung sind Begriffe und gleichzeitig normative Bezugspunkte einer liberalen Tradition, an die Nussbaum anknüpfen will. Diese sieht sie in der zentralen Anschauung des Liberalismus von der Gleichwertigkeit aller Menschen begründet. Der Liberalismus sei deshalb nicht nur gegen den Feudalismus, sondern gegen alle sozialen Ordnungen gerichtet, die sich auf moralisch belanglose Kriterien (Hautfarbe, physische Stärke/Schwäche, Geburt ...) beziehen. Nussbaums feministischer Liberalismus bzw. liberalistischer Feminismus fügt diesen moralisch belanglosen Kriterien das 129 Merkmal „Geschlecht“ hinzu. Allerdings solle – im Gegensatz zur Tradition – Gleichheit nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im Privaten gelten. Dieser „radikale Liberalismus“ helfe nach Nussbaum gerade auch den Frauen, die als Teil der Familie keine Achtung als Einzelperson erfahren. Auch wenn dies zu wünschen wäre, erscheint problematisch, dass Nussbaum auf einen (zugeschnittenen) Liberalismus setzt, dessen Kritik der Repression wohl nicht zu hintergehen, aber für die Probleme moderner Macht vielleicht zu einfach ist. Dies macht gespannt auf den nächsten Essay. Der Aufsatz Verdinglichung liest sich wie ein Kommentar zur bekannten Formel des kategorischen Imperativs von Kant, demzufolge jede Person „jederzeit zugleich als Zweck sich selbst“ und „niemals bloß als Mittel zu gebrauchen“ ist. Dieses Instrumentalisierungsverbot gilt jedoch nur insoweit, als die zweite Person von der ersten ausschließlich als Mittel gebraucht wird. Jemanden als Mittel für eigene Zwecke zu gebrauchen ist daher durchaus statthaft; dann nämlich, wenn er/sie zugleich als Selbstzweck, d.h. als kommunikatives Subjekt, behandelt wird, das Stellung nehmend in meine Zwecke eingreifen kann. Da Verdinglichung im feministischen Kontext allein negativ konnotiert wurde (Frauen werden von Männern instrumentell wie austauschbare Dinge nur zur sexuellen Befriedigung behandelt), versucht Nussbaum eine Differenzierung des Begriffs. Anhand literarischer wie journalistischer Bei- 130 Neuerscheinungen spiele – von D.H. Lawrence über James Joyce bis hin zum „Playboy“ –, in denen Personen dargestellt werden, die zur sexuellen Befriedigung anderer Personen verdinglicht werden, diskutiert sie, ob es Verdinglichungen geben kann, in denen zwar Instrumentalisierung oder Austauschbarkeit stattfindet, die aber dennoch als „gutartig“ bestimmt werden kann. Ihre These ist, dass der soziale Kontext der Beziehungen zwischen verdinglichendem Subjekt und verdinglichtem Objekt entscheidet, ob es sich um eine „gutartige“ oder um eine „schändliche“ Verdinglichung handelt. „Gutartige“ finden sich nach Nussbaum z.B. bei Lawrence’ Lady Chatterley, da sich die Romanfiguren dort zwar oft auf ihre Geschlechtsteile reduzieren, aber diese Reduktion in einen Kontext wechselseitiger Achtung und symmetrischer Verdinglichung eingebettet ist. „Gutartige“ Verdinglichungen, so Nussbaum, seien nicht nur unvermeidlich, sondern auch ein bereicherndes Element des menschlichen Sexuallebens. „Schändliche“ Verdinglichungen hingegen bestünden immer dann, wenn das Objekt dauerhaft (und nicht nur punktuell) instrumentalisiert bzw. der Zerstörung anheim gegeben wird und der soziale Kontext nicht von wechselseitiger Achtung geprägt ist. Nussbaums Analyse der (sexuellen) Verdinglichung ist insbesondere gegen ein zu grobschlächtiges Verständnis des Phänomens im amerikanischen Feminismus (Andrea Dworkin, Catherine McKinnon) gerichtet. Bei ihrem Versuch zu differenzieren, übergeht sie allerdings, dass der Verdinglichungsbegriff auch eine über den unmittelbaren sozialen Kontext hinausweisende Bedeutung besitzen kann. Ihre eher handlungstheoretischen auf die Einzelnen orientierten Argumente unterstellen, dass eine Person eine andere verdinglicht. Eine Verdinglichung der gesamten Interaktion und Subjektpositionen durch eine allgemeine gesellschaftliche Form bleibt unthematisiert. Der abschließende Essay, der auch dem Buch den Titel gibt, beschäftigt sich mit der Konstruktion der Liebe, des Begehrens und der Fürsorge. In einer Reihe von Beispielen aus verschiedenen Epochen und Kulturen geht es Nussbaum in diesem wohl interessantesten der drei Aufsätze um die soziale Prägung von Gefühlen und Verhalten. Zwar sei die Prägung durch einen biologischen Rahmen begrenzt, dieser aber sei doch sehr weit. Sie zeigt, wie Gesellschaften Regeln für die Gefühlsäußerungen aufstellen, wie normative Urteile über Gefühle variieren und so auch die Benennung in Taxonomien grundsätzlich verschieden ist. Schließlich betont Nussbaum, dass auch die individuelle Lebensgeschichte die Gefühle der einzelnen beeinflusst, und dass die Varianzen innerhalb einer Kultur nicht unterschätzt werden dürfen. Entgegen einer Trennung von Gefühl und Verstand tritt Nussbaum für die kognitive Analyse der Gefühle ein, die aber, gerade in Bezug auf das Begehren, nicht von als natürlich gelten könnenden Rahmenbedingungen zu lösen sind. Die Konsequenzen dieser allgemein Neuerscheinungen bleibenden Einschränkung führt Nussbaum an dieser Stelle nicht weiter aus; man kann hier nur auf ihre Gifford Lectures über Emotionen verweisen. Auch hinsichtlich der Konstruktion des sexuellen Begehrens wie auch der Geschlechtskörper („Körperteile interpretieren sich nicht selbst“, 201) bleiben ihre Ausführungen eher anregend, und ihre normativen Appelle sind nicht fundamental neu. Festzuhalten ist aber, dass in der Zwischenzeit auch Positionen, die wie Nussbaum positive Subjektphilosophie betreiben, die Einsichten von Foucault, Butler u.a. aufgenommen haben, und dass so die Geschlechterdebatte auf einer neuen Stufenleiter geführt werden kann. Unabhängig von den Positionen, die Nussbaum vertritt, sind ihre gebildeten Essays gerade der Geschlechterforschung in Deutschland zu empfehlen, die derzeit eher Vorgärten einzäunt und beackert, als sich an allgemeine Fragestellungen wie denen von Nussbaum zu versuchen. Fritjof Bönold / Norbert Walz Richard Rorty Wahrheit und Fortschritt Frankfurt/Main 2003 (Suhrkamp), kart./br. 515 S., 15.- EUR. „‚Es gibt keine Wahrheit.’ Was könnte das heißen? Warum sollte irgend jemand dergleichen behaupten?“ Mit diesen für viele Philosophen immer noch ketzerischen Sätzen lässt Richard Rorty seine Ausführungen über Truth and Progress (1998) beginnen, einer Sammlung von Aufsätzen aus 131 den 90er Jahren, die in deutscher Übersetzung nun auch als Taschenbuch vorliegen. In drei Abschnitten beschäftigt sich der amerikanische Philosoph mit dem erkenntnistheoretischen Problem der Wahrheit, mit den Perspektiven moralischen Fortschritts sowie dem möglichen Beitrag einer pragmatisch orientierten Philosophie zu einem richtig verstandenen Fortschritt. Die Quintessenz dieser Überlegungen könnte man so zusammenfassen: Werden die oben aufgeworfenen Fragen im Geiste intellektueller Redlichkeit ernst genommen und wohl erwogen, dann könnte die Relativierung alter Wahrheitsansprüche geradewegs zu einem Medium menschlichen Fortschritts werden. Dazu hat die Philosophie endlich von einer Obsession Abschied zu nehmen, die wirkmächtig am Anfang ihrer langen abendländischen Geschichte steht: von der Platonischen Vorstellung, das wahre Wesen der Dinge ergründen zu müssen. Man mag diesen Willen zur Wahrheit verstehen – sein Ziel wird er niemals erreichen können. Dem „An-sich-Sein der Dinge“ kommt menschliche Vernunft nicht näher. In Auseinandersetzung u.a. mit Hilary Putnam, John Searle und Charles Taylor wendet sich Rorty gegen die Korrespondenztheorie der Wahrheit in ihren verschiedenen Varianten. Es gibt keinen archimedischen Punkt, von dem aus unser Denken die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit nachweisen könnte. Die Anwendungsbedingungen des Begriffs Wahrheit sind notorisch relativ. Konsequenterweise verzichtet Rorty denn 132 Neuerscheinungen auch seinerseits darauf, eine Definition von „Wahrheit“ vorzulegen. Es geht ihm allein um die Zurückweisung falscher Wahrheitsansprüche – in bewusst „despektierlichem“ Ton, wie Rorty mit der ihm eigenen Ironie anmerkt. Das muss keineswegs zu einem totalen Relativismus führen. Auch philosophischer Fortschritt ist so noch möglich, nur eben nicht als Annäherung an ewige Wahrheiten. Er zeigt sich vielmehr in einem Zuwachs an Phantasie und Kreativität im Umgang mit den verschiedenen Perspektiven. Und nicht zuletzt vermag er dem zentralen politischen Ziel des Liberalen zu dienen: einem kulturellen Wandlungsprozess, dem Wandel unserer „geistigen Gewohnheiten“ hin zum von Rorty seit langem propagierten Ideal einer Kultur der Toleranz und der Vermeidung von Grausamkeit. Diesem moralischen Fortschritt widmet sich Rorty im zweiten Abschnitt des Buches. Dass es im westlichen Kulturkreis zu einer allgemeinen Anerkennung der Menschenrechte gekommen ist, hat nichts mit einem Fortschritt der Vernunft zu tun, im Zuge dessen man im Okzident einer moralischen Wahrheit näher gekommen sei als in anderen, weniger „vernünftigen“ Kulturen. Menschenrechte muss man nicht letztbegründen, sondern durchsetzen. Die Frage, ob es solche Rechte wirklich gibt, ist, so Rorty, „witzlos“, das beständige Bemühen um deren philosophische Fundierung die Obsession von „Quasiplatonikern“. Wenn immer wieder versucht wird, die Achtung vor der Würde des Menschen normativ-anthropologisch zu begründen, also aus der Behauptung einer spezifisch menschlichen Eigenschaft abzuleiten, dann ist das zum einen ein naturalistischer Fehlschluss, zum anderen geht es an den Quellen moralischen Handelns völlig vorbei. Das Einzige, aber unendlich Wichtige, was Philosophie zum moralischen Fortschritt beitragen kann, ist es, unsere moralischen Intuitionen zu „resümieren“, bewusst zu machen und so zu stärken. Mit letztbegründeten Einsichten hat das nichts zu tun. Unser Zuwachs an moralischem Wissen – das heißt für Rorty: eine Erhöhung unserer Empfindsamkeit – ist daher nicht der Beschäftigung mit Moralphilosophie zu verdanken, sondern vielmehr dem „Hören trauriger und rührseliger Geschichten“. „Onkel Toms Hütte“ hat zur Stärkung von Mitgefühl und Menschlichkeit ungleich mehr beigetragen als alle moralphilosophischen Traktate zusammen. Dass ein solches moralisches Lernen, wie auch die westliche Menschenrechtskultur im besonderen, auf ganz bestimmte kulturelle Kontexte angewiesen ist, gesteht Rorty zu. Umso wichtiger ist es gerade dann, alle falschen Hoffnungen auf kontextunabhängige Begründungen aufzugeben und eine solche Kultur in ihren „geistigen Gewohnheiten“ zu pflegen und zu stärken. Man könnte auch sagen: Nicht die Platonische Schau ewiger Ideen, sondern das Aristotelische Ethos der politischen Gemeinschaft verbürgt die Gerechtigkeit. Man kann trefflich darüber streiten, ob es zwischen Letztbegründung und Neuerscheinungen Nonkognitivismus nicht doch einige bedenkenswerte Zwischenformen moralphilosophischer Evidenz geben könnte. Für seine Sicht der Dinge kann Rorty aber das entscheidende pragmatische Argument geltend machen: Nach dem Kriterium der „Leistungsfähigkeit“, also dem des erfolgreichen Verhinderns von Leiden und Grausamkeit, sind die „traurigen Geschichten“ ungleich wichtiger für den moralischen Fortschritt. Wenn es uns wirklich um den leidenden Menschen geht und nicht um den Sieg im Wettstreit der analytisch saubersten Begrifflichkeiten (die ja doch nie „wahr“ sein werden), dann in der Tat sind nicht die von Platon auserkorenen Kontrahenten, die Sophisten und rationalen Egoisten, das Problem, sondern – in Rortys entwaffnender Anschaulichkeit – der alle Disputation verweigernde Nationalsozialist oder „der ritterliche und ehrenwerte Serbe, nach dessen Ansicht die Muslime nichts anderes sind als beschnittene Hunde“. Vielleicht müsste Rorty dann aber auch konsequenter Weise hinzusetzen: Sie sind nicht nur unser „Problem“, sie sind – was ein ironischer Liberaler nicht gerne hört – unsere Feinde. Rorty wirbt für seine pragmatische Auffassung von Philosophie, wie auch für den „Vorrang der Demokratie vor der Philosophie“, in einer gedanklichen Leichtigkeit, die nicht mit Beliebigkeit zu verwechseln ist. Dennoch muss er die Frage beantworten, was nach all dem unter Philosophie (noch) zu verstehen ist. Philosophen sind für Rorty Personen, „die Platon, Kant und die übrigen Autoren des 133 abendländischen Kanons lesen und über die in diesen Texten aufgeworfenen Fragen nachdenken“ – die aber, so könnte man mit Hegel variieren, nicht mehr der Versuchung erliegen, ein nur Bedingtes, Endliches zu einem falschen Absoluten zu erheben. Weil es aber ein „wahres“ Absolutes für Rorty erst recht nicht geben kann, hat sich der Philosoph in den notorischen Begrenzungen seines allzu endlichen Geistes einzurichten. Letzte Antworten gibt es hier nicht mehr zu finden. Umso wichtiger aber ist es, sich den „vorletzten“ Fragen menschlicher Existenz undogmatisch zu stellen. Christian Schwaabe Michael Ruoff Schnee von Morgen – Das Neue in der Technik Würzburg 2002 (Königshausen & Neumann), 140 S., 12.- EUR. Wie will man über das Neue schreiben? Zunächst bleibt gar nichts anderes, als über das Alte zu schreiben bzw., im Sinne von Hegels Eule der Minerva, die ihren Flug erst in der Abenddämmerung beginnt, das zu thematisieren, was nicht mehr neu ist, was es aber mal war, beispielsweise als die Allmacht Gottes dem abgeschlossenen Kosmos der Antike die Chance zu Neuem eröffnete. Oder als der Künstleringenieur der Renaissance begann, sich kreativ zu entfalten. Oder als bei Marx die Maschine der historischen Entwicklung auf neue Sprünge verhalf. Doch Michael Ruoff beschränkt 134 Neuerscheinungen sich in seiner ausgezeichneten Analyse des Neuen in der Technik keineswegs auf solche Aspekte des Historischen. Wie aber soll man über das schreiben, was noch kommt, was sich aber nicht berechnen, ja nicht mal wirklich erahnen lässt, nämlich über das Unbestimmte? Dazu tragen weder die Innovationsforschung noch jedwede Spielart von Fortschrittstheorien bei. Statt dessen befragt Ruoff die Technik als ein System, dessen zentrales Merkmal der Offenheit den Weg zum Neuen aufschließt. Insofern entsteht das Neue aus einer systemischen Entwicklungsfähigkeit der modernen Technik, die sich ob ihrer Offenheit indes schwerlich prognostizieren lässt. Trotz solcher begrifflichen Anklänge verliert sich Ruoff glücklicherweise weder zu sehr in der Systemtheorie selbst noch umkreist er bloß vage einen notorisch dunkel bleibenden Begriff von Emergenz. Vielmehr stützt er sich primär auf den pragmatischen Informationsbegriff Ernst von Weizsäckers. Wohin führt die Analyse? Natürlich kann Ruoff am Ende keine Auskunft darüber geben, was denn nun nach eingehender Betrachtung en detail das Neue sei. Hätte er das Neue auf einen Begriff gebracht, dann wäre es schlicht nichts Neues mehr. Er beschränkt sich auf eine Topologie des Unbestimmten – ein Wort, das das Neue charakterisieren soll, in dem sich das Mögliche anweist. Daraus erwachsen allerdings nicht unerhebliche Konsequenzen für die Technik und jedes technikphilosophische Denken. Denn wenn sich das Neue als unbestimmt erweist, dann lässt sich nicht voraussagen, wohin die technische Entwicklung sich wenden wird. Technik als gegenüber dem Neuen offenes System schwächt nicht nur die Prognosekapazität, sondern macht vor allem die Gestaltbarkeit der Zukunft durch Vorausplanung immer fragwürdiger – um die es in der Technik doch ursprünglich mal ging. Diese Tendenz verschärft sich noch, wenn die neuen Technologiewissenschaften wie die Genetik immer umfänglicher in natürliche Prozesse und Gegenstandsbereiche eindringen, so dass sich mit ihrer steigenden Komplexität zunehmende Kontingenzen verbinden. Der sich immer stärker vergrößernde Wissenszuwachs erhöht nicht die Prognosekapazität, sondern schwächt sie, weil mit immer mehr Informationen auch notwendigerweise immer mehr Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen diesen Informationen entstehen, die sich immer schwieriger vorausberechnen lassen. Das erklärt auch, warum Francis Bacon als erfolgreichster Utopist aller Zeiten den instrumentell hochgerüsteten Zukunftsforschern des 20. Jahrhunderts überlegen bleibt. Schnee von Morgen trifft hier einen sehr sensiblen Nerv der Zeit. Das Problem der Informationsgesellschaft erscheint nicht mehr als verselbständigte instrumentelle Vernunft Horkheimers, nicht mehr als schlichte technische Herrschaft über das Denken Heideggers, nicht mehr als ethische Gestaltbarkeit des technischen Fortschritts im Dienste einer zukünftigen Menschheit bei Hans Jonas. Derartige Diagnosen im 20. Jahrhun- Neuerscheinungen dert haben sich entweder überlebt oder realisiert und stören nicht mehr. Bis auf weiteres aber könnte die zunehmende Kontingenz der technischen Entwicklung stören, das Neue, nach dem sich alle sehnen, und das doch alle Planungen zunichte macht. Oder sollte uns Ruoffs Diagnose hoffen lassen? Hans-Martin Schönherr-Mann 135 136 Neuerscheinungen Peter Trawny Die Zeit der Dreieinigkeit Untersuchungen zur Trinität bei Hegel und Schelling, Würzburg 2002 (Königshausen & Neumann), 229 S., 29,50 EUR. In Zeiten der Unsicherheit liebt man bekanntlich den Halt gebenden „Blick zurück“. Der Autor des vorliegenden Buches, seiner überarbeiteten Habilitationsschrift, bekennt denn auch im Vorwort freimütig, dass die „Zeit der Dreieinigkeit“, die dem Buch den Titel gab, vergangen ist: „Ich betrachte mein Buch als eine Erinnerung an ein Denken, das [noch] behaupten konnte, ‚bei sich zu Hause zu sein’“ (8). Nun hat ein solch distanzierender Zugang zur Thematik und Problematik der Hegelschen und Schellingschen Philosophie, zumindest im deutschsprachigen Raum, den Vorteil, nicht ‚aktualisieren’ zu müssen und sich den Kämpfen der Schulen zwischen und um Hegel und Schelling entziehen zu können. Sie kann sich insofern ‚vorurteilsfrei’ ihrem Untersuchungsgegenstand zuwenden. Dass dem Autor dies letztlich nur teilweise gelungen, zeigt das Ende seiner Untersuchung. Trawny gelingt zur anstehenden Thematik ein überzeugender Zugang und Einstieg: der ontologische Gottesbeweis, der aus dem Begriff Gottes auf dessen Existenz schließt. Denn dieser Beweis ist für beide Philosophiekonzeptionen zentral. Für Hegel ist Gott „eben dies, dass sein Begriff und sein Seyn ungetrennt und untrennbar sind.“ (34) Er ist so die „absolute Realität“ (ebd.). Für Schel- ling, der gerade durch die Kritik am „ontologischen Argument“ seine eigene „positive Philosophie“ bestimmt, ist es zumindest in historischer Hinsicht „für die ganze neuere Philosophie bestimmend geworden“ (SW I, 10, 14). Trotz dieser Differenz unternehmen es beide, Hegel wie Schelling, diesen ‚bewiesenen’ bzw. ‚sich beweisenden’ Gott als den christlichen, d.h. den dreieinigen, Gott auszulegen. Für Hegel, dem Trawny sich zuerst zuwendet, drückt der ontologische Gottesbeweis, wenn auch unvollkommen, das Prinzip der Philosophie aus: nämlich dass Vernunft ist. Dies aber müsse so trinitarisch gedacht werden, so wie der Christengott dreieinig ist. Was in der christlichen Religion in der Dreieinigkeit von Vater, Sohn und heiligem Geist vorgestellt werde, sei in der Logik als „Sphäre der immanenten Trinität zu denken“ (50; H.v.m.). Trawny widerspricht nun zurecht den Ansichten, Hegel habe seinen Begriff vom „Begriff“ gleichsam nachträglich auf das christliche Gottesbild angewandt, um ihn dadurch zu erläutern oder aus ihm die Trinität Gottes abzuleiten (50). Er konstatiert demgegenüber ein anderes, engeres Verhältnis zwischen Logik und Religion und spricht vom „theologischen Motiv, das Hegels ‚Wissenschaft der Logik’ von Anfang an begleitet“ habe (45). Er macht dies an Hegels „Lehre vom Begriff“ bzw. dessen „drei Momenten“, der Allgemeinheit, der Besonderheit und der Einzelheit, fest und zitiert: „Das Allgemeine ist daher die freye Macht; es ist es selbst und greift über sein An- Neuerscheinungen deres über; aber nicht als ein gewaltsames, sondern das vielmehr in demselben ruhig und bey sich selbst ist. Wie es die freye Macht genannt worden, so könnte es auch die freye Liebe, und schrankenlose Seeligkeit genannt werden, denn es ist ein Verhalten seiner zu dem Unterschiedenen nur zu sich selbst, in demselben ist es zu sich selbst zurückgekehrt.“ (45) Wenn Trawny dazu anmerkt, dass dies Zitat „an das Verhältnis von Gott Vater und Sohn erinnert“ (ebd.), dann ist dies zu wenig. Wer nur etwas mit der Trinitätsdebatte vertraut ist, erkennt in diesem Begriff vom Allgemeinen unschwer eine der möglichen Lösungen des Trinitätsproblems: der Vater als die freie Macht, die den Sohn, das von ihm gezeugte Andere, „übergreift“ und durch den heiligen Geist, die Liebe, im Anderen zugleich bei sich bleibt. Darüber hinaus wäre es für eine Untersuchung der Trinität bei Hegel zweifellos angebracht gewesen, wenn Trawny diesem Verhältnis von Logik und Religion nicht nur anhand Hegels Lehre vom Begriff, sondern auch seiner Methode überhaupt nachgegangen wäre. Er zitiert zwar Hegels Diktum: „Die Logik ist insofern metaphysische Theologie, welche die Evolution der Idee Gottes in dem Äther des reinen Gedanken betrachtet“ (49); aber er zieht daraus nicht die Konsequenz, in Hegels Dialektik selbst das christliche Trinitätsmotiv zu erkennen. Denn wenn Hegel in der Einleitung zu seiner „Wissenschaft der Logik“ die Methode der Wissenschaft so beschreibt, dass das Andere oder das „Negative“, wie er hier sagt, 137 nicht das „abstrakte Nichts“ des Parmenides ist; es aber auch weder das platonische ‚Mehr oder Weniger’ noch das, was neuplatonisch dem Einen ‚ausfließt’; wenn es aber auch nicht – jüdisch – dem Einen, der schlicht bei sich ist, und auch nicht – spinozanisch – dem All-Einen zukommt; sondern wenn Hegel dieses Andere als die „bestimmte Negation“ bestimmt, in die das Eine oder „Positive“ „fort-geht“, „über-geht“ oder „sich ent-zweit“; es in dieser „EntZweiung“ aber bei sich bleibt, und im Resultate daher „wesentlich das enthalten ist, woraus es resultiert“, – dann kann nicht nur diese Art der Negation als Negation der Negation, sondern auch Hegels Überzeugung, dass diese Methode die „wahre“ sei, gar nicht anders verständlich gemacht werden, als dass für ihn eben das christlich Trinitarische das an und für sich Wahre ist. So verstanden hat Hegels Dialektik nicht nur ein „theologisches Motiv“, sondern ist in ihrem Fundament christlich. Sie widerspricht darin sowohl dem heidnischen wie dem jüdischen Denken des Absoluten. Trawny stellt diesbezüglich zwar zurecht fest, dass für Hegel „ein Gott jenseits der Logik ... kein oder jedenfalls nicht der christliche Gott ist“ (50); aber er verdeutlicht nicht, dass der christliche Gott in der Logik, er diese Logik selbst ist. Diese, wie mir scheint, mangelnde Durchdringung mag daran liegen, dass Trawny ein anderes Interesse verfolgt, dass nämlich in solchem Denken sich für Hegel zugleich auch heilsgeschichtlich „die Zeit erfüllt“ (Galater 4, 4). Denn für ihn ist die 138 Neuerscheinungen Zeit und die Geschichte eben dies, dass der dreieinige Gott nicht nur vorgestellt und verehrt wird, sondern im menschlichen Geist zum Bewusstsein seiner selbst kommt. Daher ist für Hegel die jetzige Zeit, die Gegenwart, die „Zeit der Dreieinigkeit“. Der „mittlere und spätere“ Schelling hingegen verhält sich kritisch gegenüber dem ontologischen Gottesbeweis. Trawny stellt den Einwand, den er in „Zur Geschichte der neueren Philosophie“ formuliert hat, überzeugend dar: ein Gott, der existieren muss, ist kein freier Gott; denn er kann nicht nicht existieren. Für Schelling ist Gott daher nicht einfach das Sein, sondern der „Herr des Seyns“. Er ist nicht nur das notwendig Existierende, sondern „das frei wollende Wesen“ (133). Trawny folgert daraus, dass sich für Schelling das Göttliche nicht, wie bei Hegel, in der Struktur des Logischen, sondern im Faktischen, in der Geschichte als dem Handeln Gottes offenbart. Unklar lässt Trawny allerdings, worein nun Schelling das ChristlichTrinitarische solcher Geschichte setzt. Besteht es, wie er in den „Weltaltern“ schreibt, in dem geschichtlichen Faktum, dass ‚wir’ in ‚unserem’ Kulturkreis „von Kindheit auf“ christlich denken und „seine Lehren für das ganze Leben eine fast unabweisbare Gegenwärtigkeit erhalten“ (136)? Oder gilt, dass es das Christliche schon „von Ewigkeit her“ gegeben habe, „noch ehe eine Welt da war“ (137), so dass eine gleichsam vorgeschichtliche Trinität anzunehmen wäre? Wie aber verträgt sich dieser Gedanke mit der Geschichtlich- keit göttlicher Offenbarung? Oder aber ist es so, dass Geschichte überhaupt nur christlich, d.h. trinitarisch, gedacht werden könne, weil „jede Geschichte, die dies wirklich ist, ... drei große Unterscheidungen (hat), nämlich Anfang, Mitte und Ende, oder: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ (140 f.)? Und will Schelling damit sagen, dass die Geschichte zwar objektiv nur faktisch ist, dass sie aber als begriffene, als System, allemal nur christlich sein könne? Trawny lässt dies im Dunkeln. Er macht vielmehr mit Hinweis auf W. Schulz deutlich, dass dieses Ungelöste ein Strukturelement der Schellingschen Spätphilosophie selbst sei. Denn während Hegels Philosophieren sich als System erfüllt, habe Schelling solche Einsichtigkeit verneint „und die ‚Gründung’ des Ganzen in der ‚grundlosen Freiheit’ Gottes anerkannt.“ (189) Von Hegel her gebe es deshalb keine Möglichkeit, sinnvoll nach der Zukunft zu fragen, da für ihn die Gottesherrschaft nichts ausstehendes, sondern wirklich ist. Für Schelling jedoch, dem das Zukünftige Strukturmoment von Geschichte ist, sei die Zukunft offen. Seine „Philosophie der Offenbarung“ verherrlicht nicht die Gegenwart, sondern begreift sie als „zerrissene Welt“ und ihr Heil als noch ausstehend. Sie sei „grundsätzlich eine eschatologische, also auf Zukunft bezogene Philosophie. Zeit und Geschichte werden grundlegend von der Zukunft her verstanden.“ (181) Darum aber sei für Schelling auch nur dasjenige Christentum, das die Erfüllung der Zeit in der Zukunft erblickt, die „wahre Religion“ Neuerscheinungen (181). Während Hegel also Geschichte von Jesus her denkt, durch den die göttliche Vernunft wirklich geworden sei, denkt Schelling sie vom Parakleten, dem Künder des kommenden Zeitalters, her. Dieses Zukunftsbezugs wegen aber sei, lässt Trawny durchblicken, das Schellingsche Denken der Gegenwart adäquater. Am Ende seines Buches verlässt der Autor seine historische Untersuchung und geht so weit, dem gegenwärtigen Denken die jesuanische Botschaft vom kommenden Gottesreich – ganz unabhängig von aller Trinitätsdiskussion – als zukünftiges Denken anzuempfehlen. Wenn, so Trawny, die gegenwärtige „Pluralisierung und Globalisierung der Wohn- und Denkräume ... die Kennzeichen einer radikal gottverlassenen und d.h. nihilistischen Welt sind, dann ist jedes Nachdenken über Gott eine bloß sentimentaler Beschäftigung“ (210). Wenn es aber eine Heilung in der Zeit gebe, dann komme sie aus der Zukunft; ein einzigartiges Zukunftswissen aber enthalte die Predigt Jesu; denn diesem Wissen habe sich „noch keine philosophische Theorie ... als überlegen erwiesen“ (211). Dieser schließliche Distanzverlust zum Gegenstand bzw. das Schwanken zwischen historischer Untersuchung und aktualisierender Anempfehlung macht Trawnys Buch zweideutig. In der ersten Hinsicht bleibt manches, wie ich zumindest anhand Hegels Logik angedeutet habe, oberflächlich und vieles unausgeführt. Hinsichtlich des letzteren jedoch, Trawnys Empfehlung der „frohen Botschaft“ als Heilmittel der Gegen- 139 wart, bräuchte es eingestandenermaßen dieses Werks „zur Trinität bei Hegel und Schelling“ gar nicht. Alexander von Pechmann Christoph Türcke Erregte Gesellschaft. Philosophie der Sensation, München 2002 (C.H. Beck), geb., 327 S., 29.90 EUR. „Der Drang, neue Gesellschaftstypen auszurufen, ist ein typisches Merkmal der Sensationsgesellschaft und ist nicht neu.“ (9) Die kapitalistische Gesellschaft reproduziert ihre Existenzgrundlage immer wieder neu, indem sie ständig neue Bereiche kapitalistischer Akkumulation hervorbringt und bis in die letzten Winkel der Menschheit und in immer mehr Bereiche der menschlichen Lebenswelten vordringt, um sie der Warenproduktion zu unterwerfen. Dies hat zur Folge, dass das Erscheinungsbild der kapitalistischen Gesellschaft sich in immer schneller werdenden Zyklen verändert. Die Versuche, diese Phänomene zu beschreiben und zu typologisieren, zählen Legion. Nun versucht sich Türcke am Wandel der öffentlichen Kommunikation. Sein Anspruch ist hoch. In Guy Debords „Die Gesellschaft des Spektakels“ sieht er die Vorformulierung eines Grundgerüsts einer zu analysierenden erregten Gesellschaft. Türcke will allerdings in kritischer Absicht über Debord hinausweisen, indem er den immanenten Zusammenhang von Ästhetisierung und deren gesellschaftlicher Grundlage als etwas grundsätzlich 140 Neuerscheinungen Zusammengehöriges versteht, was eine gründliche Reflektion der Begriffe erforderlich mache. Das Buch ist der Versuch, dem Phänomen der massenmedialen Reizüberflutung anhand des Begriffs des Sensationellen analytisch beizukommen. Türcke arbeitet zunächst die Besonderheiten des Sendungszwanges, sowohl der Nachrichtenproduzenten als auch der Rezipienten, aus. Im Prozess, in dem zu Anfang die Nachricht einmal etwas mitteilte, was wichtig war und nun wichtig ist, weil sie mitteilen kann oder zu können beansprucht, veranschaulicht Türcke für diese Sphäre die kapitalistische Warenlogik. Den Sendern stehen die Rezipienten gegenüber, die aus dem Einerlei herausragen wollen, in dem sie zunehmend dazu gezwungen sind, sich durch das Sensationelle bemerkbar zu machen. Leider verliert Türcke sich dann aber im nebulösen Jargon Heideggers, statt seiner erfreulich unzeitgemäßen Präferenz für die kritische Theorie nachzugehen. Zu oft wird der mäandernde Begriff des „Da“ (44) bemüht, um in weitläufigen Beschreibungen der existentiellen Verortung des Individuums im Gesellschaftlichen auf die Spur zu kommen. Auch das „Umkreisen“ der „schillernde(n) Bedeutungsvielfalt“ des heideggerschen „Da“ (78) trägt zur Analyse der vorgetragenen Phänomene nichts bei. Ärgerlicherweise werden einige überbewertete Ereignisse, wie die vorgeblich angestiegene Gewaltbereitschaft von Halbwüchsigen an Schulen, das mittlerweile fast in Vergessenheit geratene Sendeformat Big Brother, S-Bahnsurfing und schließlich der vollkommen konstruiert wirkende Zusammenhang von Tatoo, Piercing und Amok als Ausdrucksformen „prometheischer Wut“ (72) bemüht. Hier sitzt Türcke dem kulturpessimistischen Geraune über vermeintliche, manchmal auch tatsächliche, niemals aber die Jugend beherrschende Trends und vorübergehende Hipps auf, ohne dabei über das tatsächliche Ausmaß der beschriebenen Phänomene Rechenschaft abzulegen. Originell und anschaulich reflektiert Türcke aber dann den Begriff des Sensationellen. Er entwickelt – ausgehend von de Cusas Verknüpfung des Staunens und der Seltenheit in der sensatio (93) – die Ausrichtung J. Lockes und G. Berkeleys auf die Sensation als Grundlegung des begreifenden Denkens und legt die SubjektObjekt-Dialektik zwischen sinnlicher Reflektion und Sensation dar. Bei Berkeley sieht Türcke das „esse est percipi“ bereits ausformuliert, das im Zwang zum globalen Sendezwang zu überraschendem Wahrheitsgehalt gefunden habe. (105) Schließlich sei in Berkeleys „Kurzschluss“ der Herleitung der Existenz Gottes aus der Überwältigung des Geistes durch die unmittelbare Sensation eine Parallelität zur heutigen Situation zu ziehen, in der die Sensation Weltsinn ist. Freilich sieht Türcke den Gott in der elektronischen Apparatur säkularisiert. In diesem Abschnitt, wie auch in der historischen Reflektion über den Zusammenhang vom entstehenden Weltmarkt des Merkantilismus und dem Aufstieg der Nachricht zur Ware, gewinnt die Türckesche Argu- Neuerscheinungen mentation an Stringenz. Aufregend ist die Archäologie, die Türcke im besten Sinne kritischer Theorie hinsichtlich des Sensationellen betreibt. Am Beispiel des Briefschreibers J. H. Campes legt er die europäische Rezeption der Französischen Revolution als Entstehung einer Weltöffentlichkeit dar. (112) Hier trete die Verschränkung von emanzipatorischen Elementen und der Überreizung und Abstumpfung vor dem Hintergrund der Nachrichtenüberflutung zum ersten Mal nachvollziehbar zu Tage. Im großartigen Kapitel einer kritisch gewendeten psychoanalytischen und neurologischen Grabung menschlicher Historie arbeitet Türcke die grundlegenden Mechanismen des Wiederholungszwanges und der traumatischen Gewalterfahrung als Stifterin des Gedächtnisses heraus, die den Schritt des audiovisuellen Schocks zur absoluten Sensation anzeigt. Weniger überzeugend ist allerdings sein Versuch, der Marxschen Fetischkritik am Warencharakter die zusätzliche Dimension einer theologisch-metaphysischen Doppelbewegung im Prozess der Abbildung moderner Bildproduktion zu verleihen, um von ersten photographischen Versuchen die Brücke zum modernen „Bildschock“ (177) zu schlagen. Als generelles Problem stellt sich, dass selbst in Zeiten der Reizüberflutung doch immer sowohl die Potenz und das Interesse als auch die Möglichkeit und Kompetenz einer Wirklichkeitsaneignung besteht. Mir scheint dies ein Residuum menschlicher Neugierde zu sein, vor dem auch die Übermacht der elektroni- 141 schen Medien ihren Schrecken verliert. So bleiben denn auch Türckes Ausblicke auf die politisch praktische Dimension recht dünn. Er versucht zwar am Beispiel der symbolischen Aktionen von Greenpeace das Gegenfeuer zur Herrschaft der Reizflut und des Bildschocks darzustellen; vielleicht wäre hier jedoch eine ausführlichere Reflektion der Praxis der „Tute Bianche“ (321) ertragreicher gewesen. Kurz streift er auch noch den Terrorangriff auf New York. Eine kritische Analyse der wohldurchdachten Ästhetik der Praxis dieser Gruppen hätte zudem fruchtbar sein können, um das grundsätzlich Andere einer emanzipatorischen Bewegung herauszustellen. Freilich ist dies weniger Türcke anzukreiden als vielmehr Ausdruck der derzeitigen Abstinenz sozialrevolutionärer emanzipatorischer Praxis. Hieran lässt sich auch am besten der Unterschied zu Guy Debords Gesellschaft des Spektakels festmachen, das einer der Glutpunkte des massenhaften Aufbegehrens der 60er Jahre war und dadurch von selbst über sich hinausgewiesen hat. Davon sind wir heute weit entfernt. Dies merkt man Türckes Buch an, das eher eine Zusammenstellung verschiedener begrifflicher Reflektionen und essayistischer Überlegungen zum gegenwärtigen Zustand und zur Entstehung des aktuellen Zustandes gesellschaftlicher Kommunikation ist. Jonas Dörge 142 Neuerscheinungen Rainer E. Zimmermann Subjekt und Existenz. Zur Systematik Blochscher Philosophie, Berlin und Wien 2001 (Philo-Verlag), brosch., 282 S., 27.50 EUR. Mit seinem Beitrag ‚Kognition als Selbstlektüre der Natur‘ (Widerspruch 29) hat Rainer E. Zimmermann einen bündigen Umriss seines systematisch-theoretischen Projekts gezeichnet: es geht ihm als Naturwissenschaftler und Philosoph gleichermaßen um die Übersetzung der Kantischen Frage „Was ist der Mensch?“ in eine radikal materialistische Denkfigur, nach der im Menschen eine sich selbst lesende und erkennende Natur zu sich selber kommt. Als Naturwissenschaftler und Mathematiker verfolgt Zimmermann hierbei den Ansatz einer Theory of Everything, in kosmologischer Hinsicht etwa gut verständlich in Lee Smolins ‚Warum gibt es die Welt?‘ (München 1999) nachzulesen, die er philosophisch mit der Linie der „Aristotelischen Linken“ stützt. Inwiefern dabei schon mittelalterliches Denken beiherspielt, ist in dem von Zimmermann herausgegebenen Band „Naturphilosophie im Mittelalter“ (Cuxhaven/Dartford 1998) und der zusammen mit KlausJürgen Grün herausgegebenen Zeitschrift „System & Struktur“, vor allem der Sonder-Doppelnummer zum 800. Todestag von Averroes, erschienen unter dem Titel ‚Hauptsätze des Seins. Die Grundlegung des modernen Materiebegriffs‘ (Cuxhaven/Dartford 1998), nachzulesen. Auch durch die idealistische Philosophie führt diese Kraftlinie des qualita- tiven und dialektischen Materiebegriffs: Zimmermann spricht davon, dass Denken Materieform ist. Für Schellings Naturphilosophie hat er dies in „Die Rekonstruktion von Raum, Zeit und Materie“ (Bern, Berlin et al. 1998) entwickelt. Unschwer ist zwischen den Namen Aristoteles, Averroes und Schelling der Name Ernst Blochs zu finden, der den Materiebegriff bisher am radikalsten konzipierte (vgl. dazu die posthume Schrift ‚Logos der Materie‘, Frankfurt/Main 2000). In „Subjekt und Existenz“ widmet sich Zimmermann nun dem Blochschen Denken, unternimmt es, es in seiner Systematik zu ergründen und Parallelen zu anderen Philosophien, insbesondere Sartres, nachzuzeichnen. Das Buch soll zugleich Einführung sein; und ist es auch nicht unbedingt dem Neuling unvermittelt anzuraten, so sind doch ein Glossar der griechischen und lateinischen Begriffe, ein Verzeichnis ausgewählter Blochzitate und die kleine Chronologie Blochs eine gute Hilfe, um sich in dem Buch wie in der kritischen Philosophie Blochs zu orientieren. Der vielleicht zentralste Begriff der Blochschen Philosophie, an dem Zimmermann hier seine Systematik entwirft, ist die Ontologie des Nochnicht-seins; mit dieser Ontologie ist der Materiebegriff als prozessual zu verstehen, beziehungsweise ist auch das Verstehen prozessual zu begreifen (noch einmal: Denken ist Materieform). Bei Bloch heißt der Anfang der Philosophie: „Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.“ Das sind die ersten Spuren, die Neuerscheinungen Zimmermann zum subjektiven Ausgangspunkt macht. Die Entfaltung der Systematik der Blochschen Philosophie impliziert derart den Blick auf die Logik des Blochschen Denkens, auf die material-materialistische Logik selbst – als Systemphilosophie. Sie führt im Ausblick an die Ränder des Horizontes einer Philosophie der Zukunft, einer „Rückgewinnung der Metaphysik“: als „Theorie der universalen Evolution“, schließlich als „Identität der Geschichte an ihrem Ziel“. Paradoxerweise und nicht ohne Problematik steht diese materialistische Systemphilosophie im Schatten der materialistischen Kritik des Antisystems; Systemphilosophie will an Totalität utopisch retten, was sich im 20. Jahrhundert realgeschichtlich im Terror offenbarte. Eine Theorie der universalen Evolution muss auch auf die Dialektik der Aufklärung reflektieren, darf das Grauen nicht zynisch in den Weltplan subsumieren. Zimmermann macht zum methodischen Postulat die Emergenz, die Insichtnahme des Welthaften. Dringend zu diskutieren ist, ob dies nicht korrigiert werden muss durch den objektiven Ausdruck, die Sichtverstellung des Verblendungszusammenhangs. Wäre also mit Blochs Transzendieren ohne 143 Transzendenz als Utopie der Weltheimat (und zwar als Reflex auf die Heimatlosigkeit des Menschen) nicht vielmehr ein Emergieren ohne Emergenz zu reflektieren? (In dieser Hinsicht hatte ja Günther Anders an Bloch eine ähnliche Kritik geübt wie an Heidegger, die beide, der eine humanistisch-progressiv, der andere faschistisch-reaktionär die Welthaftigkeit der Existenz postulieren.) Zimmermann betont den „PatmosAspekt“ der Blochschen Philosophie, das potenziell Rettende: „Fundierte Hoffnung wird vor allem durch die treue Betrachtung der Tendenz klug.“ (53) Die Tendenz wird hier von der „Erbschaft dieser Zeit“ aus betrachtet, in der Mitte der 30er Jahre; schon ein halbes Jahrzehnt später zerbricht diese Tendenz im blanken Terror, der bis heute in jede Hoffnung seine Wunde schlägt. Die Forderung nach einer Identität der Geschichte an ihrem Ziel ist als theoretisches Programm nur dann haltbar, wenn die Identität der Geschichte mit ihrer Vergangenheit zu ihrem Recht kommt: Erst in diesem Eingedenken des eben Nichtidentischen wird es möglich, die Welt zu reparieren (Tikkun, und nicht Heimat). Roger Behrens AutorInnen JADWIGA ADAMIAK, Dipl.-Volkswirtin, Journalistin, München ROGER BEHRENS, M.A., Lehrbeauftragter am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg FRITJOF BÖNOLD, Dipl.-Pädagoge, Doktorand der Pädagogik, Nürnberg JONAS DÖRGE, Politikwissenschaftler, Kassel WOLFGANG HABERMEYER, Dr. phil., freier Mitarbeiter des Bayr. Rundfunks, Lehrbeauftragter für Ethnologie an der LMU, München MICHAELA HOMOLKA, Dr. phil., Kirchseeon REINHARD JELLEN, M.A., Doktorand der Philosophie, München MANUEL KNOLL, Dr. phil., Lehrbeauftragter am für Politische Wissenschaft der LMU und der Hochschule für Politik, München ALEXANDER VON PECHMANN, Dr. phil., Lehrbeauftragter für Philosophie an der LMU und VHS München HANS-MARTIN SCHÖNHERR-MANN, Dr. phil., Dr. rer. pol. habil., Privatdozent für Politische Philosophie, München CHRISTIAN SCHWAABE, Dr. phil., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der LMU, München CHARME INA SUCHAREWICZ, M.A., Studentin der Politischen Wissenschaften am Geschwister-SchollInstitut der LMU, München WOLFGANG TEUNE, Unternehmensberater, Monheim KIM LAN THAI-THI, Dr. phil., Lehrbeauftragte für komparative europäisch-buddhistische Erkenntnistheorie an der LMU München GEORG KOCH, M.A., Antiquar und freier Autor, München MOHAMED TURKI, Dr. phil., Dozent für Philosophie an der Universität Tunis KONRAD LOTTER, Dr. phil., Privatgelehrter, München PERCY TURTUR, M.A., freier Autor, München BERND M. MALUNAT, freiberufl. Politikwissenschaftler, München NORBERT WALZ, M.A., Doktorand der Philosophie, Nürnberg WOLFGANG MELCHIOR, M.A., Doktorand der Philosophie, Unternehmensberater, Publizist, München THOMAS WIMMER, M.A., freier Autor und Herausgeber, München Impressum Widerspruch Münchner Zeitschrift für Philosophie 23. Jahrgang (2003) Herausgeber Münchner Gesellschaft für dialektische Philosophie, Tengstr. 14, 80798 München Redaktion Jadwiga Adamiak, Reinhard Jellen, Manuel Knoll, Georg Koch, Wolfgang Melchior (Internet), Konrad Lotter (verantw.), Alexander von Pechmann, Franz Piwonka, Percy Turtur Verlag Widerspruch Verlag, Tengstr. 14, 80798 München. Tel & Fax: (089) 2 72 04 37; e-mail: [email protected] Erscheinungsweise halbjährlich / ca. 500 Exemplare Gestaltung: Percy Turtur, München ISSN 0722-8104 Preis Einzelheft: 6.- EUR Abonnement: 5.50 EUR ( zzgl. Versand) Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. – Für unaufgefordert zugesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. – Nachdruck von Beiträgen aus Widerspruch ist nur nach Rücksprache und mit Genehmigung der Redaktion möglich. http://www.widerspruch.com WIDERSPRUCH Münchner Zeitschrift für Philosophie Nr.39 Kritik der Globalisierung außereuropäische Perspektiven Afe Adogame: eine afrikanische Perspektive Oliver Kotzlarek: Zur Kritik der Moderne in Lateinamerika Norbert Walz: Die Erlösung der Natur Raúl Claro Huneeus: Das „Memorandum“ der Heinrich-Böll-Stiftung Thies Boysen / Markus Breuer: Ausverkauf der Ethik? Ram Adhar Mall: zwischen Asien und Europa ... und viele Rezensionen philosophischer Neuerscheinungen erhältlich in allen uni-nahen Buchhandlungen Preis: 6.- EUR