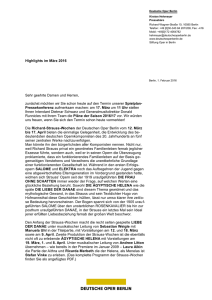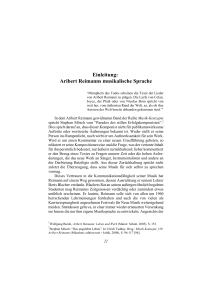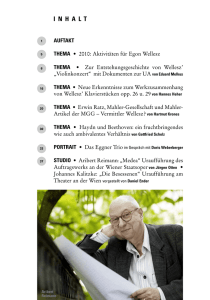Der Himmel über Berlin ist weit, und besonders am Rand, im
Werbung
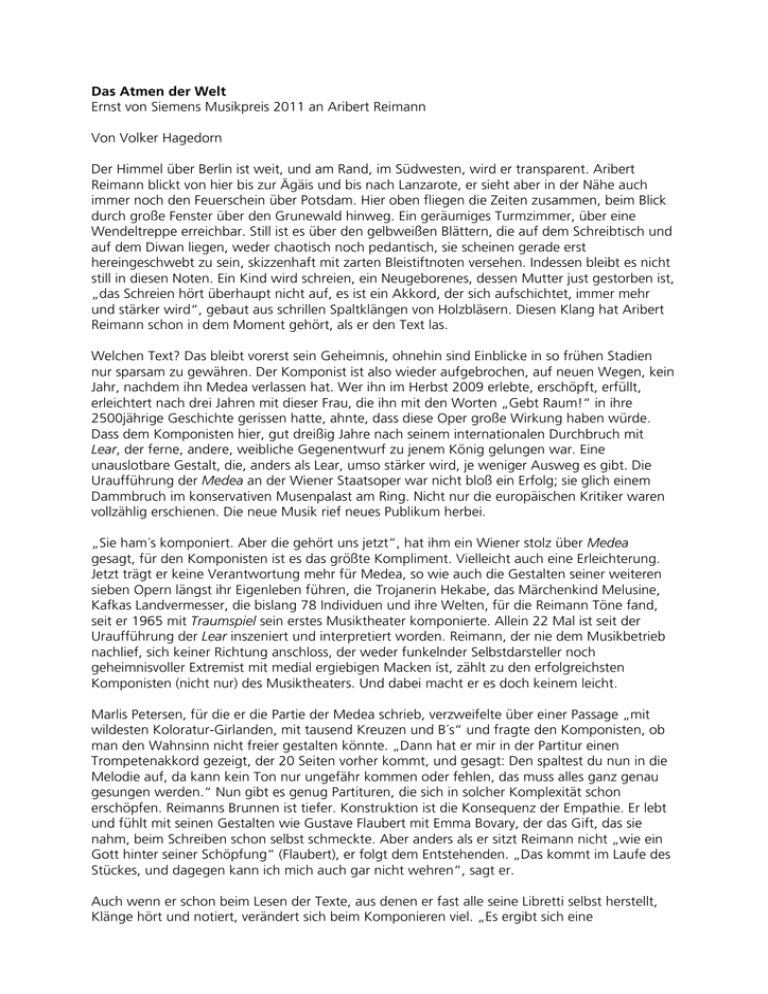
Das Atmen der Welt Ernst von Siemens Musikpreis 2011 an Aribert Reimann Von Volker Hagedorn Der Himmel über Berlin ist weit, und am Rand, im Südwesten, wird er transparent. Aribert Reimann blickt von hier bis zur Ägäis und bis nach Lanzarote, er sieht aber in der Nähe auch immer noch den Feuerschein über Potsdam. Hier oben fliegen die Zeiten zusammen, beim Blick durch große Fenster über den Grunewald hinweg. Ein geräumiges Turmzimmer, über eine Wendeltreppe erreichbar. Still ist es über den gelbweißen Blättern, die auf dem Schreibtisch und auf dem Diwan liegen, weder chaotisch noch pedantisch, sie scheinen gerade erst hereingeschwebt zu sein, skizzenhaft mit zarten Bleistiftnoten versehen. Indessen bleibt es nicht still in diesen Noten. Ein Kind wird schreien, ein Neugeborenes, dessen Mutter just gestorben ist, „das Schreien hört überhaupt nicht auf, es ist ein Akkord, der sich aufschichtet, immer mehr und stärker wird“, gebaut aus schrillen Spaltklängen von Holzbläsern. Diesen Klang hat Aribert Reimann schon in dem Moment gehört, als er den Text las. Welchen Text? Das bleibt vorerst sein Geheimnis, ohnehin sind Einblicke in so frühen Stadien nur sparsam zu gewähren. Der Komponist ist also wieder aufgebrochen, auf neuen Wegen, kein Jahr, nachdem ihn Medea verlassen hat. Wer ihn im Herbst 2009 erlebte, erschöpft, erfüllt, erleichtert nach drei Jahren mit dieser Frau, die ihn mit den Worten „Gebt Raum!“ in ihre 2500jährige Geschichte gerissen hatte, ahnte, dass diese Oper große Wirkung haben würde. Dass dem Komponisten hier, gut dreißig Jahre nach seinem internationalen Durchbruch mit Lear, der ferne, andere, weibliche Gegenentwurf zu jenem König gelungen war. Eine unauslotbare Gestalt, die, anders als Lear, umso stärker wird, je weniger Ausweg es gibt. Die Uraufführung der Medea an der Wiener Staatsoper war nicht bloß ein Erfolg; sie glich einem Dammbruch im konservativen Musenpalast am Ring. Nicht nur die europäischen Kritiker waren vollzählig erschienen. Die neue Musik rief neues Publikum herbei. „Sie ham´s komponiert. Aber die gehört uns jetzt“, hat ihm ein Wiener stolz über Medea gesagt, für den Komponisten ist es das größte Kompliment. Vielleicht auch eine Erleichterung. Jetzt trägt er keine Verantwortung mehr für Medea, so wie auch die Gestalten seiner weiteren sieben Opern längst ihr Eigenleben führen, die Trojanerin Hekabe, das Märchenkind Melusine, Kafkas Landvermesser, die bislang 78 Individuen und ihre Welten, für die Reimann Töne fand, seit er 1965 mit Traumspiel sein erstes Musiktheater komponierte. Allein 22 Mal ist seit der Uraufführung der Lear inszeniert und interpretiert worden. Reimann, der nie dem Musikbetrieb nachlief, sich keiner Richtung anschloss, der weder funkelnder Selbstdarsteller noch geheimnisvoller Extremist mit medial ergiebigen Macken ist, zählt zu den erfolgreichsten Komponisten (nicht nur) des Musiktheaters. Und dabei macht er es doch keinem leicht. Marlis Petersen, für die er die Partie der Medea schrieb, verzweifelte über einer Passage „mit wildesten Koloratur-Girlanden, mit tausend Kreuzen und B´s“ und fragte den Komponisten, ob man den Wahnsinn nicht freier gestalten könnte. „Dann hat er mir in der Partitur einen Trompetenakkord gezeigt, der 20 Seiten vorher kommt, und gesagt: Den spaltest du nun in die Melodie auf, da kann kein Ton nur ungefähr kommen oder fehlen, das muss alles ganz genau gesungen werden.“ Nun gibt es genug Partituren, die sich in solcher Komplexität schon erschöpfen. Reimanns Brunnen ist tiefer. Konstruktion ist die Konsequenz der Empathie. Er lebt und fühlt mit seinen Gestalten wie Gustave Flaubert mit Emma Bovary, der das Gift, das sie nahm, beim Schreiben schon selbst schmeckte. Aber anders als er sitzt Reimann nicht „wie ein Gott hinter seiner Schöpfung“ (Flaubert), er folgt dem Entstehenden. „Das kommt im Laufe des Stückes, und dagegen kann ich mich auch gar nicht wehren“, sagt er. Auch wenn er schon beim Lesen der Texte, aus denen er fast alle seine Libretti selbst herstellt, Klänge hört und notiert, verändert sich beim Komponieren viel. „Es ergibt sich eine Konstruktion, mit der ich was machen muss. Mit ihrer Hilfe muss ich dem nachgehen, was ich mir vorstelle.“ Die Spannung zwischen Vision und Konstruktion macht auch und gerade die einsamsten, entblößtesten Linien zwingend. Oft hat man den Eindruck, es könne gar nicht anders sein, und spürt doch, dass die Kohärenz einem Weg folgt, den einer erst finden musste. Ein Netz solcher Wege scheint Reimanns verschiedene Welten organisch zu verbinden, und eine prägende Eigentümlichkeit taucht sehr früh auf. Die mal bizarr gezackt springenden, mal in engen Intervallen gebogenen Gesangslinien, kadenzhaft ausgreifend, Sprache bis an die Grenze auslotend, hört man schon in den „Kinderliedern“ nach Werner Reinert, 1961 komponiert. Reimanns allererste Komposition ist ein vokaler Alleingang. Mit zehn Jahren schreibt er einen Gesang ohne Begleitung, angeregt von der Sopranpartie des Knaben in Kurt Weills Schuloper Der Jasager, die er in zwei Tagen auswendig gelernt hat. Angeregt auch vom Gesangsunterricht, den seine Mutter Irmgard angehenden Profis erteilt, und vom Vater Wolfgang, der den Berliner Staats- und Domchor leitet. Mit Bach, Schubert und Gesangsübungen wächst der Junge auf „wie mit Essen und Trinken“. Die Kompositionsversuche werden begrüßt, hier muss keiner gegen unverständige Eltern angehen. Dafür aber gegen die Übermacht der Kriegserlebnisse, die ihn, 1936 in Berlin geboren, nie verlassen werden, der Tod seines älteren Bruders bei einem Bombenangriff, die Vernichtung Potsdams, wohin die Familie aus Berlin geflohen ist, die weitere Flucht über die Dörfer. Mit diesen Traumata setzt er sich bis heute auch in der Musik auseinander; „es gibt immer wieder Stationen, wo einen das erwischt“. Als die Eltern den Zwölfjährigen mitnehmen in eine Aufführung von Paul Hindemiths Mathis, löst die realistische Darstellung der Bauernkriege mit brennenden Dörfern Entsetzliches bei ihm aus, Erinnerungen an die Flucht wenige Jahre zuvor, „als wir den Russen immer einen halben Tag voraus waren und immer, wenn wir abends ein anderes Dorf erreicht hatten, das Dorf von mittags schon brennen sahen. Ich erinnere mich, dass ich nach Mathis den ganzen Weg von der Oper bis Zehlendorf in der S-Bahn geheult habe. Ich konnte das damals nicht trennen“. Später hat er die entsetzlichen Erlebnisse seiner Kindheit in seine Musik gelassen, hineinlassen müssen, besonders in die reduzierten, verbrannten Klänge der Oper Troades und in das Feuer, das gleichsam aus Medeas Kopf heraus einen Palast entzündet, ein heißkaltes Umschlagen von Schmerz in sich jagend ablösende Vertikalen. Wer darin das Klischee vom „Leidenskomponisten“ bestätigt hören will wie jene Journalisten, die Reimann fragten, ob er auch lachen könne, reduziert seine (Opern-)Kunst auf eine Eindeutigkeit, von der sie ähnlich weit entfernt ist wie die Musik des von ihm „am meisten bewunderten“ Mozart. Man stilisierte Reimann auch zum Konservativen gegenüber einer von Boulez und Nono dominant definierten Avantgarde. Dass seine Libretti den Dramen oder (wie bei Kafka) dramatisierten Texten großer Dichter von Shakespeare bis Lorca folgen, genügte für den Vorwurf der „Literaturoper“. Heute meint dieser Begriff einfach die musiktheatralische Umsetzung literarischer Texte, aber bis in die 90er Jahre geißelte man damit die „lineare Erzählstruktur“, das Festhalten am bürgerlichen Bücherregal. „Gut, dass ich durchgehalten habe“, sagt Reimann. „Ich brauche zumindest den Handlungsklammerfaden, die Auseinandersetzung von Menschen innerhalb der Musik. Und ich kann nur in der Sprache schreiben, die ich BIN.“ Beim Weg zu dieser Sprache hat ihm niemand so geholfen wie sein Lehrer Boris Blacher, der einerseits erkannte und ermunterte, wo diese Sprache sich abzeichnete, und wenn es nur mal vier Takte einer Violinsonate waren. Der andererseits „schimpfte, dass ich eine Neigung zum Ostinato hatte und sagte, so, jetzt zerschneiden wir diesen Satz in Teile, versuchen Sie mal, die durcheinanderzubringen“. Er regte den Schüler an, „eine Sprunghaftigkeit des Formalen zu entwickeln, aus der man Überformen schaffen kann.“ Zur Vokalmusik hat er ihn nicht ermuntert, im Gegenteil. „Er sagte, Sie haben zu viele Lieder geschrieben. Gehen Sie weg vom Text in die absolute Musik. Sie dürfen sich nicht immer nur von der Bilderwelt eines Textes inspirieren lassen. Das war für mich sehr wichtig.“ Auch bei der Arbeit an einer Oper distanziert er sich vom Text. „Ich lese den Text und gehe damit um. Er geht in mich rein und ich vergesse ihn. Und dann komponiere ich und setze den Text wieder hinein.“ Schon in der intimsten Szene seiner frühen, zweiten Oper, der Melusine des 35-Jährigen, hat man den Eindruck, dass eigentlich das kleine Orchester die Liebe zwischen Graf und Melusine „macht“, es atmet in Akkordschichtungen, gelassen wechselnden Konstellationen von Farben und Intervallen. Wobei eine erotische Intensität entsteht, die umso lauterer ist, als diese Bewegungen von jeglichem Liebesszenenstereotyp, von aller Stimmungsbeschwörung unendlich weit entfernt sind. Sie haben, durchkonstruiert und materialhaft, auch etwas Daseiendes wie eine Landschaft. Darin aber lässt der Komponist das Paar die Poesie Yvan Golls singen, zuerst einander ablösend und dann gemeinsam (wie man es schon in Monteverdis Poppea erlebt), wobei ihre Linien so zögernd wie gewiss ihren Weg in diesem Atmen suchen. Weder vorher noch nachher hat Reimann so ein „Liebesduett“ geschrieben, das auch sonst seinesgleichen sucht. Es ist etwas darin, das einen in und durch die Traurigkeit der Liebe führt. Da kommt, später zunehmend mit jeder von Reimanns Opern, ein strukturelles, stark am Orchester orientiertes Denken zusammen mit einem Gefühl für Stimmen, wie es kein anderer lebender Komponist hat und wohl auch nicht haben kann. Nicht nur ist er ja mit Stimmen und deren Ausbildung am gewaltigen Repertoire aufgewachsen; er wurde, mit 22 Jahren, auch Korrepetitor und Klavierbegleiter von Dietrich Fischer-Dieskau, später auch anderer großer Solisten wie Catherine Gayer, für die Melusine entstand. Das machte ihn nicht nur finanziell unabhängig vom Erfolg seines Komponierens, es vertiefte die Sensibilität für Möglichkeiten und Grenzen des Singens, und es bewahrte ihn vorm Autismus des ausschließlich Schaffenden. „Ich brauchte auch den reproduktiven Umgang mit Musik: sich selbst auszuschalten und in einen anderen hineinzudenken. Deshalb habe ich auch so gern unterrichtet.“ Die Zusammenarbeit mit Fischer-Dieskau gipfelte in einem der größten Opernerfolge des späteren 20. Jahrhunderts, eben jenem Lear, an dem Giuseppe Verdi gescheitert war und dessen Titelpartie der Komponist, 41 Jahre alt, für „seinen“ Bariton schrieb. Die Partitur erweist sich, je besser die Orchester mit ihr klarkommen, immer mehr als Verselbstständigung gegenüber dem Libretto, das Claus H. Henneberg nach Shakespeare schrieb. Kaum denkbar, dass das heute ein Kritiker als „Handlungsbegleitmusik“ erleben könnte wie noch vor einem Jahrzehnt. Ungeheuer, was da gleich anfangs treppab in die Tiefe führt, wie zwingend die Gesangslinien daraus folgen, wie das Orchester Welt wird. Die brutalen Blöcke wie die feinen Träume, die bronzenen Schmerzschläge, die brennenden Klagen sind wie verbunden mit der essenzführenden Schicht, über der die Unterschiede der Epochen gering werden. „Hätte es nicht länger ertragen können“, schrieb der Komponist, als er fertig war. Vom Lear musste er sich erholen, „ich habe mich über einen Liederzyklus und das Streichtrio langsam vorangetastet“. Geradezu gezeitenhaft folgen den Opernarbeiten kleinere Formate. Zahlreiche nichtszenische Vokalwerke hat er komponiert – von Zyklen für Stimme allein wie Eingedunkelt nach Paul Celan bis zum Requiem für Solisten, Chor und Orchester. Größter Werkkomplex sind aber rund siebzig Stücke für Stimme und Klavier, die Reimann auch deshalb zum „Retter des Klavierlieds“ machten, weil sie das Genre immer neu erfinden. Die gewaltige Bibliothek in seiner Wohnung ist die eines Lesers, der den Hintergrund der Worte sucht. Etwa in Shine and dark (1989) für Bariton und linkshändig zu spielendes Klavier, ein Zyklus, in dem frühe Gedichte von James Joyce dem Weltgewicht des späteren Joyce ausgesetzt scheinen und zu größter Dringlichkeit komprimiert sind. Artifizielles schlägt um in Archaisches, das man geradezu voraussetzungslos versteht. So etwas kann man auch in seiner Instrumentalmusik erleben, und doch ist sie ganz anders. Rund 40 Werke „absoluter“ Musik schrieb Aribert Reimann, deren Abstraktion mitunter wie ein Gegenentwurf zum Kommunizierenden seiner Vokalmusik wirkt: Hochgetrieben in dünne Luft, bis ins kaum Fassbare fein verzahnt. Für Reimann ist das vokale vom rein instrumentalen Komponieren „total getrennt. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Eine literarische Vorlage als Hintergrund eines Instrumentalwerks wäre eine erweiterte Tondichtung, damit kann ich überhaupt nichts anfangen.“ Dennoch führen die Instrumentalwerke immer auch Spuren oder Vorahnungen der Opernarbeit mit sich. Im Streichtrio, mit dem er sich vom Lear erholte und dessen Blockhaftigkeit in komplexes Filigran auflöst, finden sich auch Ansätze von Szenen. Und das Violinkonzert für Gidon Kremer, dessen Solist sich wie an hohen Mauern abarbeitet, scheint einen Aspekt der Oper Das Schloss nach Franz Kafka zu konzentrieren, die Reimann kurz zuvor beendet hatte. Die Ausweglosigkeit, die dort auch groteske Komik entfaltet, wirkt im Violinkonzert fast unerbittlich. „Es war ein langer Weg, vom Schloss wegzukommen“, gesteht Reimann, „es hat mich sehr verfolgt“. Auch von Bernarda Albas Haus musste er sich mit einem Orchesterwerk „befreien“, wie er sagt. Die beklemmende Oper nach Federico García Lorca beschränkt die Solopartien auf Frauenstimmen und das Orchester auf Bläser ohne Hörner, Celli und vier Klaviere, teils verfremdet durch Gummi in den Saiten. „Ich hatte große Schwierigkeiten, aus dieser Klangklaustrophobie wieder herauszukommen, ich konnte kaum schreiben.“ Der Weg zum Orchesterklang führte ihn zu den „Zeit-Inseln“ von 2004, deren gleißende Geigenbänder über Bläserstößen einen fernen Horizont zeigen. „Ohne das hätte ich Medea niemals schreiben können.“ Und jetzt? Aribert Reimann verlässt den Rhythmus seiner Gezeiten. Er komponiert ohne den Weg über andere Genres schon wieder Musiktheater. Der Akkordschrei eines Neugeborenen, den er im Berliner Turmzimmer skizziert, gehört allerdings zu einem Werk, „das mich von dem Umgang mit Oper, den ich bisher gehabt habe, vollkommen wegbringt“. Drei Stücke von Maurice Maeterlinck, soviel verrät er nun doch, drei Einakter, Personen wie Schachfiguren, die sich „absolut emotionslos“ begegnen, deren „innerer Vibrationszustand“ dem Orchester überlassen ist. Eine Versuchsanordnung, eine Abstraktion? Es scheint, als wolle sich Reimann einmal nicht identifizieren mit seinen Gestalten. Es geht ihm, auch, um eine Situation, in der „von unsichtbaren Leuten etwas diktiert wird, an die man nicht herankommen kann. Da sind wir im Heute.“ Den Schluss möchte er so schreiben, „dass man das Gefühl hat, es gibt irgendwo, nicht hier, eine Hoffnung. Eine andere Welt, die weit entfernt ist.“