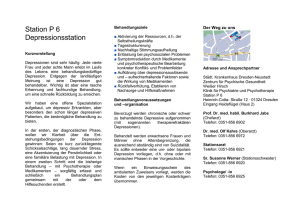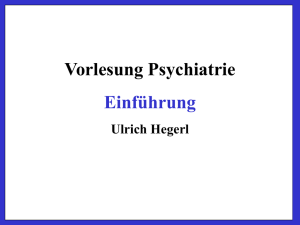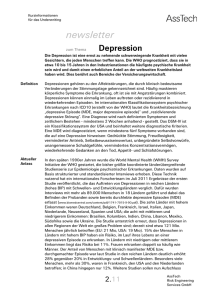Perspektive ArbeitsWelt - Psychische Gesundheit 2030
Werbung

Perspektive ArbeitsWelt Berlin, 24. September 2015 Politische und unternehmerische Verantwortung für psychische Erkrankungen ausbauen „Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu viel zu tun. Lass uns später weiter reden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Muss nur noch kurz die Welt retten, noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel“, singt Tim Bendzko. Dass dieser Song zum Hit wurde, zeigt: Mit der schnelllebigen Arbeitswelt sind Überforderung und Anspruchsdenken an uns selbst und von außen in unseren Lebensalltag eingezogen. Nicht selten hat das Depressionen zur Folge. Nach aktuellen Berechnungen der WHO werden Depressionen innerhalb der nächsten fünf Jahre die zweithäufigste Volkskrankheit sein. Schon jetzt leiden in Deutschland rund drei Millionen Menschen unter ihnen. Die Depression ist die bedeutendste psychiatrische Störung bei Menschen im erwerbsfähigen Alter. Rund jeder zehnte Arbeitnehmer in Europa fehlte deswegen schon einmal bei der Arbeit. Durchschnittlich 40 Arbeitstage ist ein Depressionskranker während einer akuten Episode nicht am Arbeitsplatz, so der BKK Gesundheitsatlas 2015 „Blickpunkt Psyche“. Depressionen verursachen in Deutschland direkte und indirekte Kosten von rund 22 Milliarden Euro. Diese Fakten bestimmten das Thema „Mentale Gesundheit ist Wohlstand“ der zweiten Konferenz „Psychische Gesundheit 2030“. Im Vorfeld des 12. Europäischen Depressionstages benannten namhafte Experten die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen im Umgang mit der Krankheit. Sie formulierten klare Anforderungen an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Arbeit sei der Schlüssel zur Lösung vieler Herausforderungen unserer Gesellschaft. Das gelte auch für das Thema psychische Gesundheit, so die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Anette Kramme, MdB. Sie war Schirmherrin des Kongresses. Einerseits sei Arbeit gut für unser psychisches Wohlergehen und die Gesundheit. Arbeit strukturiere unser Leben, stärke das Selbstwertgefühl und helfe, wichtige soziale Kontakte zu vermitteln. Obwohl bei der Gestaltung menschengerechter Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten große Fortschritte erzielt worden seien, nähmen psychische Belastungen und Erkrankungen zu, so Kramme in ihrem Grußwort. Unternehmen müssen stärker auf Prävention setzen Die Folgen psychischer Belastungen sind in den Unternehmen deutlich zu spüren, erklärte der Wissenschaftler Prof. Dr. Tim Hagemann, Professor für Arbeits-, Organisations- und Gesundheitspsychologie sowie Prorektor der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. Neben der Zunahme stressbedingter Erkrankungen äußerten sich diese in einer hohen Fluktuation, Konflikten am Arbeitsplatz und einer verminderten Leistungsfähigkeit und Innovationskraft der Mitarbeiter. Bedingt durch das steigende Renteneintrittsalter und den wachsenden Fachkräftemangel sei ein dramatischer Anstieg der psychisch bedingten Arbeitsunfähigkeitstage zu verzeichnen. Der psychiatrische Patient verändert sich Prof. Dr. Hans Joachim Salize ist Leiter der Arbeitsgruppe Versorgungsforschung des Central Institute for Mental Health – Mental Health Services Research Group, Mannheim. Er rückte die große Gruppe der Menschen mit psychischen Störungen, die von der Arbeitswelt ausgegrenzt sind, in den Fokus. Die psychiatrische Versorgung marginalisierter Gruppen sei extrem defizitär, jedoch unter ethischen und finanziellen Gesichtspunkten unabdingbar und dringend geboten. Die Versorgung psychisch Kranker in Deutschland sei teuer und habe die höchsten Steigerungsraten im Gesundheitswesen. Salize kritisierte die mangelnde Evidenz zur Kosteneffektivität der Versorgung und das geringe Wissen über Effektivitätssteigerungs- oder Einsparpotenziale. Wenn der soziale Wandel von der psychiatrischen Versorgung entweder nicht oder nur schwerfällig erkannt werde, potenzierten sich die volkswirtschaftlichen Folgekosten durch die Vernachlässigung dieses Bedarfs. frage „IDEA: The Impact of Depression at Work in Europe Audit“. Teilnehmende waren 18- bis 64-jährige Erwerbstätige in sieben europäischen Ländern. Ihn habe alarmiert, dass von 1.000 Befragten „nur“ bei 19 Prozent schon einmal eine Depression diagnostiziert wurde. Wissenschaftler nähmen an, die Häufigkeit von Depressionen in der arbeitenden Bevölkerung sei deutlich höher als in der Studie ermittelt. Nach wie vor würden viele Menschen Symptome wie Vergesslichkeit und Konzentrationsstörungen nicht unmittelbar einer Depression zuordnen. Zudem hätte die IDEA-Umfrage ergeben, dass lediglich jeder vierte der Befragten seinen Arbeitgeber darüber informieren würde, wenn bei ihm eine Depression festgestellt würde. 31 Prozent sprachen sich klar dagegen aus, und 42 Prozent waren sich unschlüssig. Vergleichbare Ergebnisse wurden in allen EU-Staaten ermittelt. Deswegen hat sich im vergangenen Jahr eine Gruppe von Europaparlamentariern gegründet. Gemeinsam mit der EDA wollen sie das Thema Depression auf europäischer Ebene politisch bearbeiten. In dem gemeinsamen „Depression Manifesto“ werden wichtige Ansatzpunkte zur Verbesserung der Situation depressiv erkrankter Menschen detailliert beschrieben. Prävention – Behandlung – Rehabilitation Der Ärztliche Direktor der Burghof-Klinik Rinteln und Repräsentant für Deutschland der European Depression Association (EDA), Prof. Dr. Detlef E. Dietrich, präsentierte die Deutschlandergebnisse der EDA-Onlineum- Dr. Iris Hauth, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), wies nachdrücklich darauf hin, dass Depressionen rasch erkannt werden müssten, damit frühzeitig interveniert und den negativen Auswirkungen der Erkrankung entgegengewirkt werden könne. Wichtige Ansatzpunkte liefere die Dreierkette aus Prävention, Behandlung und Rehabilitation. Im Rahmen der Burn-out-Diskussion habe ihre Gesellschaft ein sogenanntes Stepped-Care-Modell für betriebliches Gesundheitsmanagement und Behandlung entwickelt. Das Modell bestehe aus fünf Stufen: 1. Gesundheitsförderung, 2. Überlastungserkennung, 3. individuelle Unterstützung, 4. gestufte Versorgung, 5. Wiedereingliederung. Prof. Dr. Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Leipzig, sah die Versorgungswirklichkeit kritisch. Das Problem sei nicht ein Mangel an wirksamen Behandlungsoptionen. Vielmehr herrschten große diagnostische und therapeutische Defizite. Die Depression ist für Hegerl die Krankheit mit dem größten Optimierungsspielraum. Hier bestünde dringender Handlungsbedarf. Hegerl, er leitet auch die European Alliance Against Depression, wies auf den dramatischen Anstieg der Frühberentungen aufgrund psychischer Erkrankungen hin. Von 1983 bis 2012 sei deren Anteil von knapp 9 auf rund 42 Prozent angewachsen. Populationsbasierte Studien zeigten allerdings, dass es keinen Zuwachs an psychisch Erkrankten gäbe. Für die günstige Entwicklung spräche auch der Rückgang der Suizide von etwa 18.000 im Jahr 1980 auf rund 10.000 im Jahr 2013. Prof. Dr. Hans-Ulrich Wittchen, Direktor des Instituts für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Technischen Universität Dresden, veranschaulichte das Ausmaß der Problematik psychischer Störungen. In Deutsch- land seien jedes Jahr 27,7 Prozent der Bevölkerung von mindestens einer Störung betroffen. Neben einem überwiegenden Anteil nicht definierter Erkrankungen lägen Angststörungen mit 9,8 und unipolare Depressionen mit 4,9 Millionen Betroffenen an der Spitze. In Europa und Deutschland würden trotz effektiver medikamentöser und psychotherapeutischer Verfahren je nach Land nur 30 bis 52 Prozent überhaupt vom Versorgungssystem erfasst, lediglich 8 bis 16 Prozent vom spezialisierten Sektor für psychische Störungen. Nur 2 bis 9 Prozent der Betroffenen erhielten eine minimal adäquate Therapie. Die Versorgungskapazität müsse entscheidend erhöht, bessere koordinierte Modelle entwickelt und konzertiert gehandelt werden. Nur so könnten Patienten früher und schneller in den Genuss der bestehenden effektiven Therapien kommen und qualitätsgesichert behandelt und versorgt werden. Engagement auf europäischer Ebene Experten aus Politik, Verbänden und Unternehmen diskutierten die Chancen und Möglichkeiten europäischer Ansätze für mehr psychische Gesundheit am Arbeitsplatz für den deutschen Arbeitsmarkt. Zu Beginn dieser Session wurde auf den OECD-Report „Fit Mind, Fit Job“ hingewiesen. Die Hälfte aller Anträge auf Arbeitsunfähigkeit werde aufgrund psychischer Probleme gestellt, so der Bericht. Die SPD-Europaabgeordnete Jutta Steinruck, sie ist Mitglied des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, erklärte, psychische Erkrankungen seien ein neues Thema auf der Agenda des Europäischen Parlaments. Auf die Herausforderungen einer sich permanent verändernden Arbeitswelt müssten aber Antworten gefunden werden. Steinruck betonte, die europäische Ebene habe hier nur eingeschränkte Kompetenzen. Sie könne Rahmenbedingungen erlassen und den Austausch von Best-Practice-Beispielen fördern. Die EU habe aber kein eigenes Recht, Gesetze zu initiieren. Steinruck warnte davor, eine Zweiklassengesellschaft von Arbeitnehmern zu erzeugen. Sicherheits- und Gesundheitsstandards müssten für alle gelten. Da sowohl in der Kommission als auch in den 28 EU-Mitgliedstaaten wenig an koor- dinierten Aktivitäten geschehe, habe sich im vergangenen Jahr eine fraktionsübergreifende Initiative von Parlamentariern gegründet, die sich als Depressionsbotschafter engagieren. Der Vorstand des BKK Dachverbandes, Franz Knieps, zitierte die Versorgungsreports der Krankenkassen. Diese zeigten, psychische Erkrankungen seien ein Topthema. Im Dialog mit der Politik sei erreicht worden, dass sich im Versorgungsstärkungsgesetz und bei der Krankenhausreform die Vergütungen psychotherapeutischer und psychiatrischer Leistungen, die Besetzung von ärztlichen und psychotherapeutischen Stellen sowie die Veränderungen bei der Bedarfsplanung am realen Bedarf orientierten. Illusorisch sei allerdings, zu erwarten, Gesetzesänderungen würden die Versorgungswirklichkeit automatisch verändern. Auch wenn die großen Firmen die Problematik erkannt hätten, mittlere und kleine Betriebe müssten für psychische Belastungen noch stärker sensibilisiert werden. Um dies zu erreichen, habe der Gesetzgeber die Kassen verpflichtet, auf Landesebene Koordinierungsstellen für die Vertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu schaffen, erklärte Knieps. Für Dirk Heidenblut, MdB, Berichterstatter „Psychiatrie und Psychologie“ der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, sei es nicht Aufgabe des Präventionsgesetzes, eine Enttabuisierung psychischer Erkrankungen zu erreichen. Es solle allerdings helfen, Möglichkeiten und Wege zu finden, die Krankheit zu verstehen, und sich so zu verhalten, dass Depressionen erst gar nicht entstehen. Im Präventionsgesetz habe man die Lebenswelt Arbeit sehr deutlich in den Fokus genommen. Denn, so Heidenblut, Ziel der Politik sei es, alle Lebenswelten – und damit auch die Depression – insgesamt zu betrachten. Isabel Rothe, Präsidentin der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, erklärte, es sei „höchste Zeit, sich endlich damit zu beschäftigen, wie die Reintegration psychisch Kranker in die Arbeitsorganisation gelingen kann“. Arbeitsschützer seien fest davon überzeugt, dass es Standards guter Arbeit gebe, die eine gesunde Psyche förderten, bzw. dass diese geschaffen werden könnten. Fazit dieser Diskussion Vereinzelte Best-Practice-Beispiele und Initiativen sind ein wichtiger Schritt. Entscheidend ist aber, auf politischer, unternehmerischer und gesamtgesellschaftlicher Ebene koordinierter und öffentlichkeitswirksamer zu arbeiten, damit das tatsächliche Ausmaß psychischer Erkrankungen erkannt und eine effizientere Versorgung geschaffen werden kann.