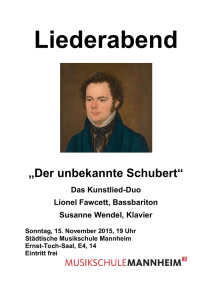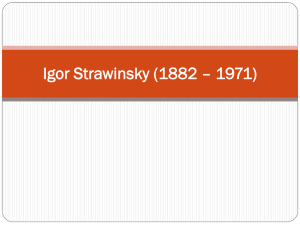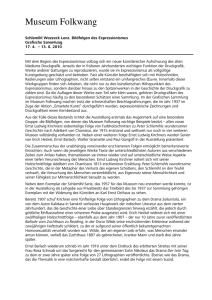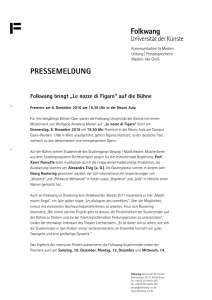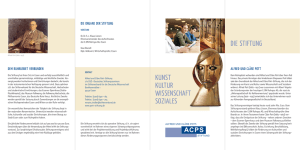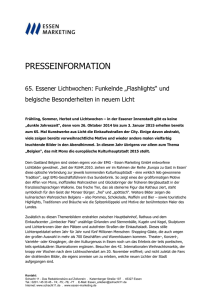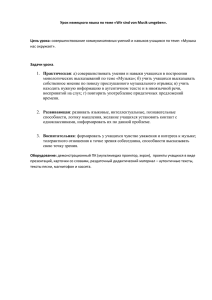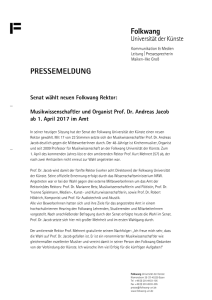Veranstaltungsprogramm
Werbung
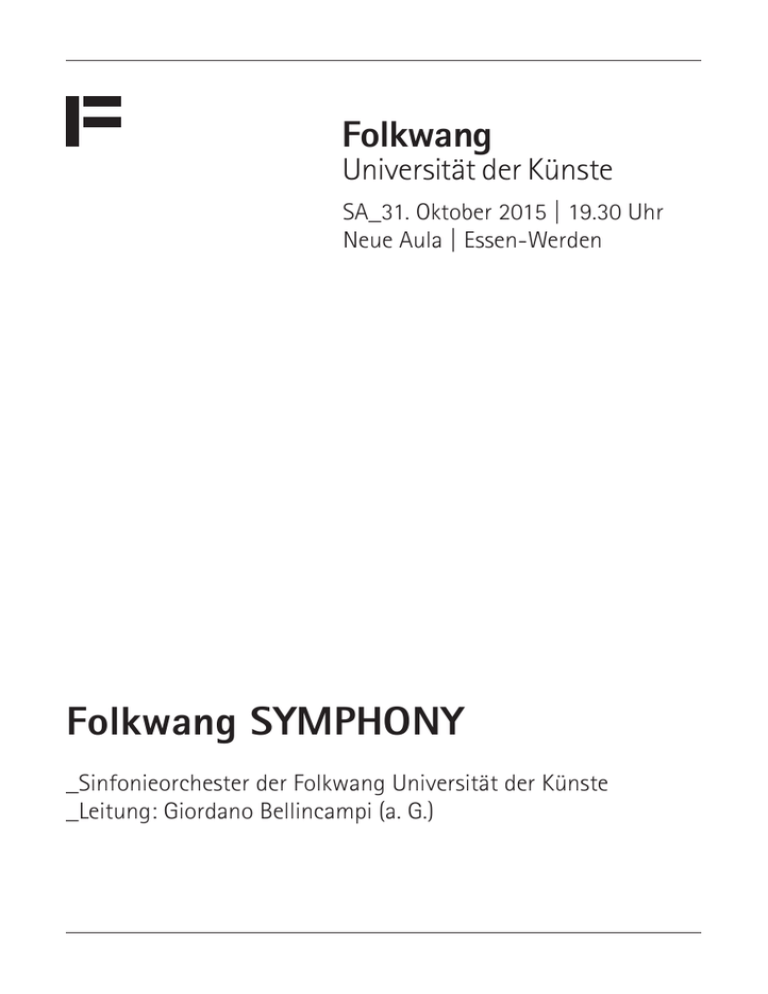
Folkwang Universität der Künste SA_31. Oktober 2015 | 19.30 Uhr Neue Aula | Essen-Werden Folkwang SYMPHONY _Sinfonieorchester der Folkwang Universität der Künste _Leitung: Giordano Bellincampi (a. G.) Carl Nielsen 1865 - 1931 Ouvertüre zum 2. Akt der Oper Saul und David (1901) Franz Schubert 7. Symphonie h-moll 1797 - 1828 Die Unvollendete. D 759 (1822) Allegro Moderato Andante con moto _Pause Igor Strawinsky Petruschka. Burleske in vier Szenen (1911) 1882 - 1971 Orchesterfassung vom Komponisten (1947) Bild I: Volksfest in der Butterwoche Bild II: Bei Petruschka Bild III: Beim Mohren Bild IV: Volksfest in der Butterwoche Folkwang SYMPHONY Konzertmeisterin: Jae A Shin Violine: Ezgi Su Apaydin, Slava Atanasova, Lea Brückner, Shih Hsiang, Chen, Jung Eun Hong, Yang-Hao Huang, Chae Eun Jeong, Min Ji Jin, Jeongmin Joo, Min Song Kang, Danbi Kim, Tae Hyung Kim, Eunsil Yu, Eunseo Known, Yae Jin Lee, Su Liu, Jae A Shin, Jong Min Song, Yen Mao Wang Viola: Ronja Sophie Brinkmann, Xue Han, Gi Yeob Kim, Suren Kirakosian, Jaakko Laivuori, Margot le Moine, Mairya Manassieva, Angel Munoz, Carmen Rodrigues Romero, Muriel Soulie Violoncello: Seong Woo Bae, Cecile Beutler, Hye Su Cha, Liang Yi Chen, So woul Kim, Botan Özsan, Gun Woo Park, Ghislain Portier, Iris Renner, Chisaki Samata, Raphael Stefanica, Robert Wheatly Kontrabass: Marta Fossas Mallorqui, A-reum Kim, Clara Pertierra, Dennis Pientak, Dominique Taudin Chabot Flöte: Marco Giardin, Charlotte Lindner, Tabea Stadelmeier, Xue Qing Wang Oboe: Saerom Jeong, Shinwoo Kang, Shaoyun Lai, Tamon Yashima Klarinette: Katrin Egging, Helen Meier, Chanyeh Park Fagott: Laila Börner, Hubert Mittermayer Nesterovskiy (a. G.), Yuto Suzuki Horn: Lok Yin Chan, Sangseon Kim, Renwei Liu, Dan Mo, Molly Wreakes Albert Marigó, Lukas Müller, Chieh Yang Posaune: Orlando Belo, Judith Duscha, Arthur Harder, Alberto Leon Prats, Bastian Robben, Joe Starbuck Tuba: Maximilian Grimm Harfe: Puke Günes, Natasche Ziegler Trompete: Schlagzeug: Shiau-Shiuan Hung, Eojin Kim, Jaeron Kim, Song Yi Kim, Jihyung Lee Klavier|Cembalo: Sara Matsuu Giordano Bellincampi Bellincampi wurde in Rom geboren und zog 1976 im Alter von elf Jahren mit seiner Familie nach Dänemark. Er studierte an der Königlich Dänischen Musikakademie in Kopenhagen Bassposaune und Dirigieren. Zunächst war er als Posaunist des Königlich Dänischen Orchesters engagiert, ehe er 1994 sein Debüt als Dirigent beim Odense Symphonieorchester gab. Foto: Andreas Köhring Seither ist er weltweit als Dirigent tätig, u. a. beim Toronto Symphony Orchestra oder der Deutschen Oper am Rhein (La Bohème, 2010). Er war u. a. Erster Gastdirigent beim Königlich Dänischen Orchester und dort von 2000 bis 2006 ebenfalls Musikdirektor. Sein Opern-Debüt gab Bellincampi im Jahr 2000 mit der Aufführung von Giacomo Puccinis La Bohème im Königlichen Opernhaus Kopenhagen. Es folgten zahlreiche Operndirigate weltweit, hauptsächlich mit Werken aus dem italienischen Repertoire wie La traviata oder Il trovatore. Giordano Bellincampi übernahm im Jahr 2005 ebenfalls die Position des Generalmusikdirektors der Dänischen Nationaloper in Aarhus. Anfang 2013 wurde er Nachfolger von Jonathan Darlington Generalmusikdirektor der Duisburger Philharmoniker. Folkwang SYMPHONY Folkwang SYMPHONY, das Sinfonieorchester der Folkwang Universität der Künste, setzt sich zusammen aus Studierenden aller Instrumentalklassen. Es besteht seit Gründung der Folkwangschule 1927. Angehende BerufsmusikerInnen erarbeiten hier Werke aller Stilepochen. Wechselnde GastdirigentenInnen sorgen für unterschiedlichste Erfahrungen und Akzente in der Orchesterarbeit an Folkwang. Das Konzert am 31. Oktober wurde vorbereitet mit Unterstützung von MusikerInnen der Duisburger Philharmoniker. Die Profis haben in verschiedenen Proben mit einzelnen Stimmgruppen von Folkwang SYMPHONY gearbeitet und zusammen musiziert. Hinweis: Ton- und Bildmitschnitte sind nicht gestattet! Redaktion: Kommunikation & Medien, Folkwang Universität der Künste Folkwang Universität der Künste | Klemensborn 39 | D-45239 Essen | Tel. +49 (0) 201.49 03-0 | www.folkwang-uni.de Punkte setzen ohne Ende Vorhang auf? Nein, nicht ganz. Carl Nielsen und Igor Strawinsky schrieben zwar für die Bühne – aber heute klingen ihre Werke im Konzertsaal. Das hört sich nach einem kleineren Tapetenwechsel an. Aber es bringt doch die Fragen mit sich: Was passiert, wenn Musik mal nicht aus dem Opern-Graben kommt? Was passiert, wenn sie im Konzertsaal allein gelassen wird – ganz ohne Handlung, ohne Protagonisten, ohne Bühnenbild? Ursprünglich komponierte der dänische Spätromantiker Carl Nielsen seine Ouvertüre als Vorspiel für den zweiten Akt der Oper Saul und David – einer Adaption der biblischen Geschichte um den jungen David und den eifersüchtigen König Saul. Die Ouvertüre steht bei Nielsen vor der Ankunft des riesigen Kämpfers Goliath, der bekanntlich besiegt wird durch Davids Steinschleuder. Wortlose Musik kann keine Handlungen erklären. Aber sie kann etwas, das kaum geringer zu schätzen ist. Sie kann Atmosphären schaffen, kann den Kampf des Guten gegen das Böse symbolisch untermalen, vielleicht auch illustrieren. Nielsen, den seine dänischen Zeitgenossen wegen seiner rabiaten Kompositionsart schon mal als „Wikinger“ bezeichneten, komponiert just das, was der Opernbesucher von einer Ouvertüre erwartet: Einen schmissigen Auftakt, der offen bleibt. Auf die Frage, wie man einen Auftakt komponiert, kann das Konzerthaus bessere Antworten geben als das Opernhaus. Hier gibt es keinen akustisch prekären Orchestergraben, wie in Bayreuth, wo über Wagners Kunsttempel das Leitmotiv „Hier gilt‘s der Kunst“ prangt. Im Konzerthaus könnte es heißen: „Hier gilt‘s der Musik“. Unsere Aufmerksamkeit kann sich ganz aufs konzentrierte Hören richten, auf musikalische Verläufe und Strukturen. Wodurch zeichnet sich nun ein Auftakt aus? Da wäre erstmal Carl Nielsens Aufführungsvorschrift „Allegro marziale“. Darunter stehen Fanfaren der Blechbläser, die das ganze Orchester schnell übernimmt. Kompositorisch naiv wäre die fünfminütige Vollbeschäftigung von Paukern, Streichern und Trompetern. Nach dem kräftigen Orchesterbeginn kommt ein kontrapunktisch differenzierter Zwischenteil, dessen Kontrast betont ist durch ein „ma tranquillo“. Am Ende seiner Ouvertüre setzt Nielsen zwar einen Punkt. Doch man spürt: Irgendetwas muss noch kommen. Heute ist es weder der Kampf von David und Goliath noch das ständige Konkurrieren von Saul und David. Dafür erklingt eines der Highlights der Symphonik des 19. Jahrhunderts, Franz Schuberts VII. Symphonie in h-moll. Hohe Kunst des Scheiterns: Schuberts Unvollendete Schubert begann die Komposition wohl Ende Oktober des Jahres 1822. Fertig wurde er nicht. Zum Glück der Nachwelt schaffte er immerhin ein Allegro Moderato und ein Andante con moto. Lange kursierten Vermutungen, dass Schubert das Werk vielleicht doch vollendet habe, indem er bewusst die klassisch symphonische Viersätzigkeit reduzierte auf zwei Sätze. Als man jedoch in den 1960er Jahren einige Partiturseiten eines offenbar abgebrochenen dritten Satzes in Form eines Scherzos fand, war der Beweis erbracht: Schubert kapitulierte. Seine Hürden stellte er zu hoch. Er fand keine kompositorischen Lösungen mehr für die Probleme, vor die er sich selbst gestellt hatte. Was waren das für Probleme? In den 1820er Jahren war das symphonische Terrain kein einfaches. Es gab diverse Tretminen oder im so genannten Neudeutsch: absolute no goes. Fehltritte konnten einerseits darin bestehen, Beethoven überbieten zu wollen. Angesichts der Qualität seiner Symphonien war das nahezu unmöglich. Andererseits: Alternative Wege waren schwer zu finden, da Beethoven ein weites Feld spannte in Form seiner so verschiedenen Symphonien wie der kräftigen Eroica, der bedächtigen Vierten, der schicksalsträchtigen Fünften und der idyllischen Sechsten, der Pastorale. Schon der Beginn von Schuberts Unvollendeten mutet seltsam an. Ein Unisono, ein gemeinsames Zusammenklingen, ist es wie beim Dänen Carl Nielsen. Doch es kommt nicht vom ganzen Orchester, sondern nur aus grüblerischen Tiefen von Celli und Kontrabässen. Beethoven überfiel seine Hörer, riss sie mit und hinein in einen Strudel wirbelnder Klangmassen. Schubert unterbricht den Fluss. Nach dem düsteren Anfang kommt eine lang gezogene, typisch Schubertsche Melodie, dann ein schönes Ländlerthema, das jäh abbricht – gerade dann, als man sich schön eingeschwungen hat. Etwa 80 Jahre nach der Unvollendeten sollte Gustav Mahler die Wiener-Walzer und Kaffeehaus-Mentalität symphonisch persiflieren. Schubert ist schon nah dran an der Kritik gediegenen Bürgertums – ob bewusst oder unbewusst, bleibt offen. Dieser erste Satz der Unvollendeten ist gespickt mit Innovationen und personalstilistischen Besonderheiten. In der Durchführung gibt es keinen Dualismus, keine Auseinandersetzung mit erstem und zweitem Thema. Schubert komponiert fast monothematisch, beharrt geradezu paranoid auf dem Ausgangsmotiv, lässt es hartnäckig kreisen bis zu dessen totaler Erschöpfung. Und dann der zweite Satz, dieses „Andante con moto“! Wieder kommt das Ländlerthema aus dem ersten Satz. Wieder kommen diese so beredten Abgründe zwischen Beschaulichkeit und tiefernster Dramatik. Theodor W. Adornos schrieb einmal, dass der Schönberg Schüler Anton Webern in einer Phrase einen ganzen Roman ausdrücken könne. Schubert gelingt ganz ohne Worte Ähnliches. Erst am 17. Dezember 1865 kam die Unvollendete zu ihrer ersten Aufführung im Wiener Musikvereinssaal unter Leitung von Johann Herbeck. Eduard Hanslick, der berühmte Musikkritiker und Theoretiker, lobte das Werk, indem er es über das „Raffinement“ von Orchestrierungen Richard Wagners stellte. Ein anonymer Kritiker der Allgemeinen Musikalischen Zeitung war vorsichtiger. In seiner Rezension zeigen sich sowohl Respekt vor Schubert, aber auch die von Beethovens Symphonik abgeleiteten Bewertungsmaßstäbe: Wir können nach einmaligem Hören hier nur so viel sagen, dass auch uns besonders der erste Satz entzückend schön erschien, dass wir in dem Andante wohl ebenfalls den köstlichsten Ideen begegneten, dass wir aber hier den Organismus, die Architektonik nicht sofort zu übersehen vermochten. Das Stück schien uns an formellen Mängeln (Längen) zu leiden. Doch sagen wir das blos als unsern augenblicklichen Eindruck. Komponieren mit Versatzstücken: Strawinskys Petruschka Über Igor Strawinsky äußerte sich die Kritik nicht so vorsichtig. Legendär sind die Skandale um den Sacre du Printemps während und nach dessen Uraufführung im Pariser Théâtre des Champs-Élysées im Jahr 1913. Einen „Höllenlärm“ habe es gegeben, meinten einige Anwesende der ersten Aufführung, wobei sie weniger die wuchtigen Orchesterbeiträge meinten, sondern die lauten Tumulte im Publikum. In der Presse der nächsten Tage fanden sich harsche Verrisse, in denen „desagréable“, also „unangenehm“, noch eines der freundlicheren Wörter war. Ursprünglich ein Ballett, wird der Sacre meist als Konzertfassung gespielt. Das gleiche gilt für das zwei Jahre vorm Sacre entstandene Ballett Petruschka, das im Gegensatz zum jenem mit großem Erfolg 1911 in Paris gegeben wurde. Über seine Ansätze schrieb Stravinsky in seiner Autobiographie Leben und Werk: Bei dieser Arbeit hatte ich die hartnäckige Vorstellung einer Gliederpuppe, die plötzlich Leben gewinnt und durch das teuflische Arpeggio ihrer Sprünge die Geduld des Orchesters so sehr erschöpft, dass es sie mit Fanfaren bedroht. Daraus entwickelt sich ein schrecklicher Wirrwarr, der auf seinem Höhepunkt mit dem schmerzlich-klagenden Zusammenbruch des armen Hampelmannes endet. So dominant die Geschichte auch scheint – es wäre verfehlt, Petruschka einzig als Spiegel der Vorgänge eines russischen Puppenspiels zu betrachten, das ein Pendant ist zu unserem traditionellen „Kasperletheater“. Ursprünglich plante Strawinsky ein Klavierkonzert, als er die Arbeit an Petruschka begann. Erst durch die Anregung von Sergei Pawlowitsch Diaghilew, dem Gründer der Ballets Russes, änderte Strawinsky seine Konzeption. Er nahm den Kurs Richtung Ballett, ohne allerdings – die Dialoge von Klavier und Orchester deuten drauf hin – den Konzert-Charakter gänzlich aufzugeben. Nach dem „originären“ Ballett schrieb Strawinsky 1947 die heutige Konzertfassung. Speziell für die kleineren Orchester der Nachkriegszeit konzipiert, mag diese Version noch Einblicke geben ins tumultuöse Treiben auf russischen Jahrmärkten des Jahres 1830. Vor allem aber gibt sie aufschlussreiche Hinweise für Strawinskys Kompositionstechniken, die geprägt waren von Innovationen, von Experimenten, urwüchsig rhythmischen Kräften und unerhörtem Farbreichtum. Im Petruschka kommt – wie auch in anderen Werken Strawinskys – eine so genannte „Schablonentechnik“ zum Tragen. Ländlerthemen, Motive aus russischer Folklore und traditionell-akademische Kompositionstechniken überlappen sich, schließen abrupt aneinander an, laufen aus und treten wieder hervor. Strawinsky wollte sich von der Romantik befreien. Er bekannte sich des Öfteren zur modernen Sachlichkeit des frühen 20. Jahrhunderts. Tatsächlich fördert (und fordert) Petruschka das objektivere Betrachten. Oder anders: Distanz ist notwendig, um nicht zu jener zappelnden Marionette zu werden, die Igor Strawinsky an der ein oder anderen Stelle vielleicht vor Augen hatte. Torsten Möller Zitat von Peter Gülke Dieser Entwurf enthält so viel Kühnes, dass man sich vor Augen halten muss: im ersten Entwurf hat die Phantasie alle Lizenzen zum freien Herausfahren, braucht sich um Fragen der Vermittlung ins Ganze nicht zu kümmern. Welches Ganze hier entstanden wäre, lässt sich freilich nicht absehen. (…) Noch in den Unausgeglichenheiten dieses Fragments erscheint grell beleuchtet, was insgesamt in Schuberts reifem Werk an Aufbruch steckt – und an Möglichkeiten des Anschlusses an den späten Beethoven, welche später nie mehr realisiert worden sind. Fast möchte man eine innere Stimmigkeit darin erblicken, dass es Schubert nicht mehr möglich war, dieses Wagnis des kaum noch Sagbaren zum in sich gerundeten Werk ‚zurückzunehmen‘. Peter Gülke zu Schuberts Siebter Symphonie, der Unvollendeten