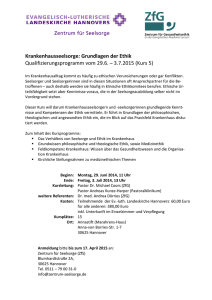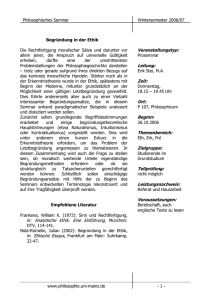Die Frommen in der Sozialen Arbeit Vermutlich ist noch niemand
Werbung

Die Frommen in der Sozialen Arbeit Vermutlich ist noch niemand dem Chirurgen begegnet, der einem freiwillig gesteht, er operiere professionell. Täte er’s, überfiele einen sogleich ein mulmiges Gefühl. Professionalität hingegen gilt den in Sozialer Arbeit Tätigen (sagt man so?) ungebrochen als Gütesiegel erster Klasse. Wer wagte daran zu zweifeln, wenn Soziale Arbeit sich zur Wissenschaft gemausert hat (warum nicht, wenn’s sogar eine Theaterwissenschaft gibt)? Die massive Aufrüstung ihres Begriffarsenals fördert zwar nicht immer sachliche Klärung, setzt aber doch ein ansehnliches Imponierpotential frei – man lese einschlägige Definitionen Sozialer Arbeit. Mit ihrer Verwissenschaftlichung ist es so weit gekommen, dass sie nun fragt, ob sie denn eine Ethik oder eine Moral oder beides brauche und, falls ja, welche denn. Ein erstaunlicher Sachverhalt! Nicht nur, weil viele ihrer Fachbegriffe vollgepfropft sind mit ethischen Implikationen, ohne die sie keinen Meter weit käme. „Exklusion“, „Armut“, „Benachteiligung“, „Diskriminierung“ – sie alle enthalten einen normativen Kern, der den Appell zu ihrer Beseitigung unausgesprochen mit sich führt. Aus ihnen resultiert der stille moralische Konsens der im Berufsfeld Tätigen (ethische Reflexion heisst darum zunächst, dies zu benennen). Erstaunlich ist die Frage nach der Notwendigkeit von Ethik aber auch, weil Soziale Arbeit ihren Anfang mit eben einem ethisch−moralischen, ja religiösen Impuls genommen hat: bei der „caritas“, der Liebestätigkeit, dem Samariterdienst, der bürgerlichen Philanthropie. Es waren insbesondere die frommen Pietisten und ihre Nachfolger im 19. und 20. Jahrhundert, die sich unermüdlich Hilfsbedürftigen zugewandten. Sie distanzierten sich vom Intellektualismus der orthodoxen Glaubenslehre und verwandelten ihn in lebendige Innerlichkeit und tätige Praxis: „Wir wollen uns gerne wagen,/in unseren Tagen/der Ruhe abzusagen/die's Tun vergisst./Wir wollen nach Arbeit fragen,/wo welche ist,/nicht an dem Amt verzagen,/uns fröhlich plagen/und uns're Steine tragen auf's Baugerüst“, so der Graf von Zinzendorf in jenem Lied, das Max Weber seiner „Protestantischen Ethik“ vorangestellt hat. Fast Jahr um Jahr haben diese Pietisten und ihre Nachfolger „mit den Augen gedeutet auf mancherlei“, Hand angelegt und soziales Werk um soziales Werk geschaffen, bis der Staat sie übernahm, der heute all die sozialen Projekte bewilligen und v.a. finanzieren soll. Berufung zum Dienst Eine fern gewordene Zeit! So fern wie die Sprache jener Frommen. Sie wussten noch nichts von Empathie und Motivation, sondern sprachen höchst unwissenschaftlich von Mitleid, Erbarmen, Anteilnahme, Trost, Zuspruch, Ermahnung, Fürbitte, Segen und Liebestätigkeit. Sie waren halt bloss Laien auf dem Helfertrip, die in überschäumender Motivation gegen das erste Gebot der Professionalität verstiessen: Sie konnten sich nicht abgrenzen. Wie auch? Sie empfanden eine Berufung zum Dienst und machten aus dem Helfen keinen Beruf und schon gar nicht einen Job mit Pflichtenheft und Arbeitszeitkontrolle. Vornehm gewordene Familien verbergen ihre niedrige Herkunft. So scheint auch die Soziale Arbeit zu verfahren, die, dem Marxschen Geschichtsschema nicht unähnlich, ihre Geschichte unterteilt in eine caritative Vorgeschichte naiven Helfens und eine eigentliche höhere Geschichte, die mit den Schulen für Sozialarbeit beginnt und immer weiter schreitet bis zu den Weihen des Promotionsrechts. Sichtbare Vertreter dieser höheren Geschichte waren etwa jene kirchlichen Sozialarbeiter, die sich auf die reine Fachlichkeit beriefen und mit der Kirche weiter nichts am Hut haben mochten. Dies geschah freilich in jenen dem aktuellen Zeitgeist bereits wieder fern gewordenen Jahren, in denen man noch nichts von Corporate Identity wusste, sondern im 1 Gegenteil auf Distanz ging zum Arbeitgeber. Negativfolie des professionellen Sozialarbeiters war der Diakon, ein frommer, gutmütiger Mann. Seine fachliche Kompetenz stand im umgekehrten Verhältnis zu seinem Missionseifer und dem Willen, Menschen Gutes zu tun. Er hatte noch keinen blassen Dunst von Klientsystemen und auch nicht von der Mikro−, Meso− und Makroebene, sondern er sah sich als Glied der Gemeinde, er sprach vom Bruder und vom Nächsten, von Blinden, Lahmen, Krüppeln, Kranken und Tagelöhnern, von der Reich−Gottes−Arbeit, vom Aufbau der Gemeinde, der sich seither zur Gemeinwesenarbeit oder Organisationsentwicklung gemausert hat. Am barmherzigen Samariter hatte er sein Vorbild; vor einem unter die Räuber gefallenen Klientsystem hätte es ihn gegraut. Kirchlicher Einfluss Mit der Entwicklung zu staatlichen Fachhochschulen sind die Fäden, die die Ausbildung in Sozialer Arbeit mit ihrer kirchlichen und christlichen Herkunft verbinden, dünner geworden (anders als in Deutschland, wo es weiterhin evangelisch oder katholisch geprägte Hochschulen gibt). Eine ihrer zentralen Traditionen verliert sich in der Sprachlosigkeit. Das mag der Lauf der Geschichte sein. Nur kontrastiert diese Entwicklung mit einem anderen Phänomen. Wer mit Studierenden Sozialer Arbeit über ihre Herkunft und ihre Motivationen spricht, verspürt oft, wie sehr hinter ihrer Berufsmotivation die treibende Kraft religiöser Herkunft, die Bindung an Gemeinschaften, der Einfluss von Verwandten, Freunden, Vorbildern wie Pfarrer wirkt. Sie sind auch dort präsent, wo Studierende sich davon zu lösen, der Enge und dem Druck konfessionell geprägter Milieus zu entfliehen suchen. Doch noch in der (gelungenen) Distanzierung bleiben Züge der Herkunft präsent – eine Normativität in der Lebensführung, eine Ernsthaftigkeit, ja ein Rigorismus in der Verfolgung gesetzter Ziele, die vielleicht nicht mehr religiöser, sondern etwa ökologischer oder politischer Art sind. Selbst heute in den Zeiten der weltanschaulichen Neutralität und des religiösen Pluralismus sieht sich eine stattliche Zahl Studierender als gläubige Christen, verankert in den Traditionen des Pietismus, verbunden mit landes− oder freikirchlichen Gemeinschaften, die man faute de mieux als evangelikal bezeichnet. Doch sie behalten dies für sich. Fast könnte es scheinen, sie hätten keinen Platz mehr in der Welt der Hochschule. Während es geradezu einfach, fast chic ist zu sagen, man interessiere sich für Buddhismus und Spiritualität (worunter man bequemerweise nichts Genaueres versteht), ist es viel schwieriger, sich als dezidierter Christ zu outen. Leicht scheint man verbohrt. Es kann allerdings sein, dass Frommen wie Wissenschaftern dieser Zustand gleichermassen recht ist. Er erlaubt nämlich eine fein säuberliche Trennung von Wissenschaft und Glaube. Zwei Wissenssysteme koexistieren friedlich und lassen einander in Ruhe. Das eine frönt dem Szientismus und das andere Glaubensüberzeugungen, die von bedrohlicher Kritik (wie etwa seitens der Theologie) verschont werden. Das eine fragt sich, welche Ethik es denn brauche (und wird vermutlich, welche Überraschung, bei Verantwortung, Solidarität und Gerechtigkeit landen), und das andere geht seinen von einer langen Geschichte geprägten Weg, übt sich in professioneller Fachlichkeit und denkt sich seine Sache dabei. So leben beide glücklich nebeneinander. Hektor Leibundgut, geb. 1943, Theologe, seit 1984 Dozent am jetzigen Studiengang Soziale Arbeit der BFH, unterrichtet Philosophie, Theologie und Sozialethik, sowie Berufsethik an der TSA der Schule für Soziale Arbeit, Zürich; Chefredaktor der „Reformatio. Zeitschrift für Kultur, Politik, Religion“ (www.reformatio.ch). 2 www.avenirsocial.ch 3