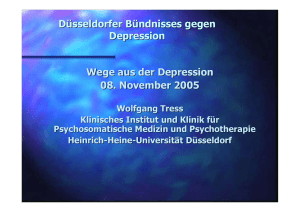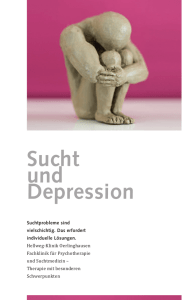vollständige Diplomarbeit
Werbung
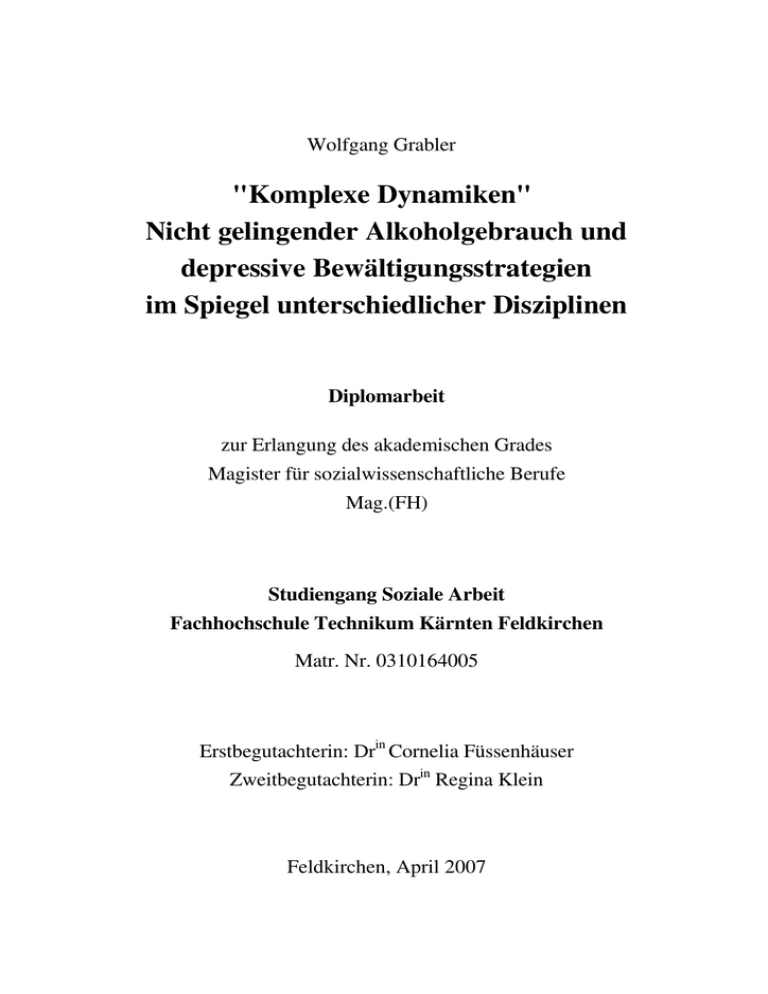
Wolfgang Grabler "Komplexe Dynamiken" Nicht gelingender Alkoholgebrauch und depressive Bewältigungsstrategien im Spiegel unterschiedlicher Disziplinen Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Magister für sozialwissenschaftliche Berufe Mag.(FH) Studiengang Soziale Arbeit Fachhochschule Technikum Kärnten Feldkirchen Matr. Nr. 0310164005 Erstbegutachterin: Drin Cornelia Füssenhäuser Zweitbegutachterin: Drin Regina Klein Feldkirchen, April 2007 Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungskommission vorgelegt und auch nicht veröffentlicht. Feldkirchen, 28. April 2007 Zusammenfassung Anliegen: Vor dem Hintergrund biopsychosozialer Faktoren, die für die Phänomene der Alkoholabhängigkeit und der Depression in ihrer Entstehung und ihrem Verlauf ausschlaggebend sein können, sollen biologische, psychische und soziale Bedeutungen abgeklärt werden. Daneben soll der komplexe Zusammenhang zwischen Alkoholabhängigkeit und Depression dargestellt werden. Eine multidisziplinäre Sichtweise stellt die Phänomene dar, vergleicht sie und bringt diese miteinander in Verbindung. Dabei wird die Bedeutung der Lebensbewältigung im Alltag hervorgehoben, der als Schnittstelle der subjektiven Erfahrungs- und Bewältigungsmuster mit den sie bedingenden „objektiven“ gesellschaftlichen Strukturen verstanden wird. Somit wird der gesellschaftliche Ort für diese Phänomene aufgeschlossen, um diese speziellen Verhaltensweisen zu verstehen. Ergebnisse und Schlussfolgerungen: Alkoholabhängigkeit und Depression sind Bewältigungsstrategien, die sich wechselseitig beeinflussen können. Diese Phänomene können als Anpassungsverhalten an anomische Verhältnisse betrachtet werden. Durch ein Ungleichgewicht individueller und sozialer Ressourcen kann es zu einer psychosozialen Missbalance kommen, die Menschen mit allen Mitteln ausgleichen wollen, sei es durch riskanten Alkoholgebrauch und/oder depressiven Verhaltensweisen. Für die Entstehung und den Verlauf dieser Phänomene und somit auch für Hilfs- und Versorgungssysteme sind soziale Faktoren ausschlaggebend. Schlüsselwörter: Lebensbewältigung - Risikogesellschaft - Alltag - nicht gelingender Alkoholgebrauch - Depression Abstract Objective: Against the background of the biopsychosocial phenomenon of high-risk alcohol consumption and depression, the meaning of biological, psychic and social factors is to be determined in development and progress of those phenomena. Besides, the complex relation between high-risk alcohol consumption and depression is to be demonstrated. A multi disciplinary, theoretical view is presented, compared and pulled together. The view is embedded in modern society that can provoke high-risk attitudes and risky coping strategies. In a social-pedagogical approach, the relevance of coping with given circumstances in peoples Everyday Life is highlighted. Everyday Life represents the interface between subjective interpretative and coping patterns and the „objective” given circumstances. To understand these special behavioural patterns the significance of modern society needs to be unclosed. Results and conclusions: High-risk alcohol consumption and depression are coping strategies that influence mutually. These phenomena are adaptive behaviour to anomy in society. The disparity of individual and social resources can lead to psychosocial instability, which the subjects want to balance even with high-risk alcohol consumption or depressive attitudes. Therefore, the social relevance for those phenomena regarding to development, progress and treatment is important. Keywords: Coping with Life - Risk Society - Everyday Life - high-risk alcohol consumption - depression Inhalt 0. Einleitung .................................................................................................. 6 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch ....................................................... 13 1.1 Begriffsklärungen .............................................................................. 14 1.1.1 Alkoholismus/Alkoholabhängigkeit ........................................... 14 1.1.2 Sucht............................................................................................ 15 1.1.3 Nicht gelingender Alkoholgebrauch ........................................... 16 1.2 Erklärungsansätze und Typologien ................................................... 20 1.2.1 Genetische Dispositionen............................................................ 20 1.2.2 Biologische Modelle ................................................................... 22 1.2.3 Psychologische Erklärungsmodelle ............................................ 23 1.2.4 Klinische Sozialarbeit ................................................................. 31 1.2.5 Typologien und Verlaufsformen................................................. 33 1.3 Gesellschaft und Alkohol .................................................................. 37 2. Depressive Bewältigungsstrategien ........................................................ 45 2.1 Begriffsklärungen .............................................................................. 46 2.1.1 Depression/depressive Störung ................................................... 48 2.1.2 Depressive Episode ..................................................................... 49 2.1.3 Major Depression ........................................................................ 51 2.1.4 Depressive Bewältigungsstrategien ............................................ 53 2.2 Erklärungsansätze und Verlaufsformen ............................................ 56 2.2.1 Biologische Erklärungsansätze ................................................... 58 2.2.2 Psychologische Erklärungsansätze ............................................. 62 2.3 Depressive Bewältigungsstrategien und Gesellschaft....................... 66 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien ............................................................................... 73 3.1 Zusammenhang beider Phänomene................................................... 74 3.2 Die Rolle der Gesellschaft................................................................. 82 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit............................................................ 90 4.1 Kritik am Krankheitskonzept............................................................. 94 4.2 Professionelle Handlungsstrategien................................................. 102 4.2.1 Prävention.................................................................................. 105 4.2.2 Repression ................................................................................. 108 4.2.3 Therapie und Überlebenshilfe................................................... 109 4.3 Ausblick........................................................................................... 116 Literaturverzeichnis................................................................................... 119 0. Einleitung 0. Einleitung Die beiden chilenischen Neurobiologen, Maturana und Varela legten in ihrem Buch „Der Baum der Erkenntnis“ eindrucksvoll dar, dass menschliche Wesen nur in der Sprache menschliche Wesen sind, „und weil wir über die Sprache verfügen, gibt es keine Grenzen dafür, was beschrieben, vorgestellt und miteinander in Zusammenhang gebracht werden kann“ (Maturana/Varela 1987: 229). Diesem Grundsatz werde ich folgen, und in meiner Diplomarbeit die beiden Phänomene „nicht gelingender Alkoholgebrauch“ und „depressive Bewältigungsstrategien“ beschreiben, vorstellen und miteinander in Zusammenhang bringen. Überblickend möchte ich voranstellen, dass die von mir verwendeten Begriffe des „nicht gelingenden Alkoholgebrauchs“ und der „depressiven Bewältigungsstrategien“ auf das Konzept der Alltags- und Lebensweltorientierung, das vor allem von Hans Thiersch entwickelt wurde, und auf das Konzept der (Lebens)Bewältigung nach Lothar Böhnisch hinweisen. Diese von mir gewählten Termini sind also eingebettet in einen theoretischen Zusammenhang (vgl. Habermas 1990: 12). Die Sichtweisen unterschiedlicher Disziplinen sollen dazu beitragen ein umfassenderes Bild dieser Phänomene zu bekommen: Alltag beschreibt neben einem praktischen und problematischen Ort, auch „einen theoretischen Ort, also eine Schnittstelle, an der sich unterschiedliche Theoriestränge und Diskussionslinien kreuzen“ (Schulze 1996: 71). Alltag ist nicht nur durch Wiederholungen gekennzeichnet, sondern auch durch Unzulänglichkeiten, Misslingen und durch Entwicklungsmöglichkeiten und Verbesserung (vgl. Schulze 1996: 71 ff.). Das von mir in der Begrifflichkeit angedeutete bewältigungs- und lebensweltorientierte Professionsverständnis versucht neben allen vorgegebenen gesellschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen zunächst auf das Subjekt in seinen Verhältnissen hinzuweisen, ohne dabei zwingen zu wollen, Angebote zu machen und Optionen für einen gelingenderen Alltag zu eröffnen (vgl. Böhnisch/Schröer/Thiersch 2005: 122 f.). In dieser Arbeit werden beide Geschlechter in der Verwendung einer pluralisierten Form von Hauptwörtern durch ein großes I angesprochen: Wenn also beispielsweise von 6 0. Einleitung „SozialarbeiterInnen“ die Rede ist, sind damit mehrere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, oder eben eine Sozialarbeiterin und ein Sozialarbeiter gemeint. Bei der Verwendung des Singulars habe ich mich vor allem wegen der besseren Lesbarkeit des Textes entschieden, nur die weibliche Form zu verwenden. Wenn nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, kann damit sowohl eine weibliche, als auch eine männliche Personen gemeint sein. „Die Sozialarbeiterin“ spricht also sowohl weibliche als auch männliche VertreterInnen dieser Berufsgruppe an. Erkenntnisinteresse und Fragestellung Die Aufgabe von Wissenschaft kann es nicht sein, endgültige Wahrheiten zu finden und somit ist es auch nicht das Ziel dieser Diplomarbeit eine neue Wahrheit zu finden. Der Versuch, eine vollständige Antwort auf die Fragen der Entstehung dieser Phänomene zu geben, wäre wie Simon treffend formuliert größenwahnsinnig und verrückt (vgl. Simon 2002: 12). Vielmehr steht für mich im Vordergrund, Erklärungsansätze für diese Phänomene herauszuarbeiten und mir die Frage zu stellen, womit wir es hier zu tun haben und wie die Komplexität dieser Phänomene so vereinfacht werden kann, „um Sinnzusammenhänge und Erklärungen konstruieren zu können“ (ebd.), die für die Arbeit mit AdressatInnen nützlich sein können. Ich bin mir der Problematik und der Komplexität dieses Themas sehr wohl bewusst. Die Erklärungsansätze für die von mir dargelegten Phänomene werden nicht zu einer neuen Wahrheit führen, vielleicht aber zu neuen Wahrheitssegmenten. Dahinter liegt die Überlegung, dass sich Fragen nur beantworten lassen, indem ich eine Neuformulierung dieser Phänomene in andere Kategorien vorschlage, die sich von denen unterscheiden, die in der ursprünglichen Formulierung dieser Frage gebraucht wurden (vgl. Maturana 2000: 330). Ich habe mich also entschieden, die Definitionen „nicht gelingender Alkoholgebrauch“ statt Alkoholismus oder Alkoholabhängigkeit und „depressive Bewältigungsstrategien“ statt Depression oder depressive Störung als primären Zugang zu verwenden. Damit kann sich eine neue Sichtweise auf die Beschreibung der Phänomene ergeben, die in Teilen der Fachwelt mit Begriffen wie Alkoholabhängigkeit/Alkoholismus oder Depressi- on/depressive Störung ausgedrückt werden. 7 0. Einleitung Maturana geht davon aus, dass eine Theorie innerhalb des gebrauchten Vokabulars einen Sachverhalt beschreiben kann und dabei gleichzeitig wesentliche Aspekte des Gesamtgeschehens außer acht lässt – Sprachgebilde sind demzufolge systemische Gebilde, die in sich geschlossen und zirkulär sind (vgl. Lempke 1990: 22). Der Begriff Alkoholismus etwa lässt sich mit einer Sprache der Moral, einer pathologisierenden Sprache (Sprache der Medizin) oder einer psychotherapeutischen oder psychologischen Sprache beschreiben – alle Ergebnisse werden aber immer nur Teilsegmente eines Phänomens liefern können (vgl. ebd.). Es hängt mit der Perspektive der sprachlichen Welterschließung zusammen wie sprachund handlungsfähige Subjekte etwas in der Welt wahrnehmen und damit zurechtkommen (vgl. Habermas 1998: 215). Durch eine Neuformulierung der von mir beschriebenen Phänomene können mitunter die Schwierigkeiten, die sich aus einer rein krankheitsorientierten Sichtweise ergeben, teilweise aufgehoben werden. Dennoch ist es nicht ganz möglich auf die geläufigen Definitionen Alkoholismus/Alkoholabhängigkeit oder Depression/depressive Störung zu verzichten, da diese landläufig die Phänomene beschreiben, mit denen ich mich in dieser Arbeit beschäftige. Außerdem werden diese Definitionen gerne von verschiedenen Bezugswissenschaften der Sozialen Arbeit, wie beispielsweise der Medizin, in ihrer Darstellung verwendet. Wenn ich also diese medizinischen Begriffe verwende, sollen dabei lediglich charakteristische Verhaltens-, Fühl- und Denkmuster beschrieben werden (vgl. Simon 2002: 12). 8 0. Einleitung Forschungszugang Eine multidisziplinäre, theoretische Arbeit scheint mir für diese Diplomarbeit aufgrund der vielschichtigen, sich wechselseitig beeinflussenden biopsychosozialen Faktoren angebracht zu sein. Eine empirische Arbeit würde bei der Darstellung dieser Phänomene und deren Zusammenhänge zu umfassend ausfallen und müsste sich somit zu sehr auf einzelne Faktoren konzentrieren. Eine empirische Arbeit würde für konkretere Fragen Sinn ergeben, wenn beispielsweise die Zufriedenheit von betroffenen NutzerInnen mit ihren Therapieerfahrungen in Kärnten untersucht werden sollte. Die vorliegende Diplomarbeit könnte somit auch als theoretischer Rahmen für eine empirische Arbeit nützlich sein. Die umfassende Literatur aus den Gebieten der Medizin, der Psychologie, der Soziologie, der Sozialen Arbeit aber auch der Philosophie, Biologie oder Neurowissenschaften ergeben in einer theoretischen Arbeit die Chance, ein ganzheitlicheres Bild auf diese Phänomene zu geben, die nicht reduktionistisch betrachtet werden sollten. Bei einer multidisziplinären Sicht auf die Phänomene des nicht gelingenden Alkoholgebrauchs, depressiver Bewältigungsstrategien und deren möglichen Zusammenhänge, kann Soziale Arbeit eine integrative Funktion übernehmen, um die Ganzheit eines Menschen in seinem Dasein besser zu berücksichtigen. Mit dieser Arbeit soll einem Reduktionismus auf einzelne Sichtweisen bezüglich der möglichen Ursachen, dem Verlauf und der Bedeutung dieser Phänomene entgegentreten werden. Eine reduktionistische Abgrenzung schädigt die Lebensganzheit des Menschen, zudem wird durch eine einseitige Konzentration auf Einzelheiten der komplexe Zusammenhang des nicht gelingenden Alkoholgebrauchs und/oder depressiver Bewältigungsstrategien außer Acht gelassen. Das Konzept der Lebensbewältigung von Böhnisch und der Ansatz einer alltags- und lebensweltorientierten Sozialen Arbeit, wie sie vor allem von Thiersch entwickelt wurde, bietet sich für die Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen an. Sie zeigen den Bezugspunkt der Sozialen Arbeit in der Lebenswelt und im Alltag der Menschen auf, die in ihren gegebenen Verhältnissen nach psychosozialer Handlungsfähigkeit streben (vgl. Galuske 2002a: 24; vgl. Böhnisch/Schröer/Thiersch 2005: 125). Dabei wird das Zusammenwirken von biopsychosozialen Faktoren in den Mittelpunkt gestellt und versucht die 9 0. Einleitung lebensweltliche Dynamik des Handelns aufzuschließen und pädagogisch zu transformieren (vgl. Böhnisch/Schröer/Thiersch 2005: 126). Soziale Arbeit kann in diesem speziellen Feld versuchen, ihre AdressatInnen ganzheitlicher zu betrachten und diese Phänomene als alltägliche, normale Lebensbewältigungsstrategien zu sehen, die im Kontext sozialer, psychischer und biologischer Faktoren begründet sein können (vgl. Thiersch 1995: 121). Solche speziellen Lebensbewältigungsmuster sollten zunächst als das betrachtet werden, was sie eigentlich sind: eine Möglichkeit, Aufgaben und Probleme, wie sie sich Menschen im Alltag stellen, bewältigen zu können. Solche Muster gehen zunächst einher mit anderen Deutungs- und Handlungsmuster. Schwierig wird es dann, wenn diese Muster dominant und zum alles beherrschenden Thema werden. Dann kann laut Thiersch von Sucht oder von einer psychischen Störung gesprochen werden (vgl. Thiersch 1995: 124). Im Umgang mit AdressatInnen Sozialer Arbeit ist es daher nötig, diese Lebensbewältigungsstrategien nicht als „nicht normal“ oder „abweichend“ im Sinne einer auf Normen basierenden, defizitären Sichtweise zu betrachten, sondern ressourcenorientiert als alltägliche, dem jeweiligen Menschen in seiner speziellen Lebenslage durchaus verständliche Verhaltensweisen. Die Darstellung verschiedener Sichtweisen ermöglicht es auch, mögliche Ursachen und Bedeutungen der Phänomene zu benennen und diese in der Arbeit mit AdressatInnen Sozialer Arbeit nutzbar zu machen. Dennoch und unabhängig von meinen Überlegungen ist vorab festzuhalten, dass die Hilfe, die Menschen zu Recht bei den als belastend oder bedrohlich bewerteten Problemen erwarten können, und die ihnen dann auch nach dem wissenschaftlichen Standard der Medizin, Psychologie und der Sozialen Arbeit gewährt werden kann, derzeit noch immer abhängig davon ist, ob diesen Phänomenen die Kategorie einer Krankheit zugemessen wird oder nicht. Bei allen Überlegungen ist es notwendig betroffenen Menschen über Aushandlungsprozesse immer die bestmögliche Behandlungsqualität zu eröffnen, anzubieten und schließlich auch zu gewähren (vgl. Schlösser 1995: 33). Darüber hinaus sollte Soziale Arbeit selbstbewusst ihr hermeneutisches Denken und die daraus gewonnenen Einsichten in die Spezifik lebensweltlicher Erfahrungen auch vor dem Forum naturwissenschaftlicher Vernunft darstellen, verteidigen und nutzbar machen für die Anliegen ihrer AdressatInnen (vgl. Jung 2002: 160). 10 0. Einleitung Aufbau der Arbeit Im ersten Kapitel gehe ich auf unterschiedliche Erklärungsansätze des nicht gelingenden Alkoholgebrauchs ein. Zuerst werden verschiedene Begriffe geklärt, danach biologische, psychische und soziale Faktoren in Bezug auf Entstehung und Verlauf vorgestellt. Dabei werden mitunter Erklärungsansätze kritisch betrachtet und wie etwa im Kapitel „Psychologische Erklärungsmodelle“ unterschiedliche, beinahe schon gegensätzliche Ansätze gegenüber gestellt. Das zweite Kapitel befasst sich in ähnlicher Weise mit depressiven Bewältigungsstrategien. Der Blick ist dabei wie in der gesamten Arbeit auch, generell auf eine psychosoziale und gesellschaftliche Einbettung konzentriert, um einer rein psychiatrischen (biologischen) Sichtweise entgegenzutreten. Mir ist wichtig, in der Verwendung von Sprache sensibel zu sein, da Sprache Realitäten schafft, die bald als objektive, menschenunabhängige Wirklichkeit angesehen wird. Besonders auf dem Gebiet der Psychiatrie und Medizin, die sich zwar bemüht neben biologischen auch psychosoziale Faktoren in der Beschreibung ihrer Phänomene einzubringen, besteht meiner Ansicht nach die Gefahr, allgemein akzeptierte Kriterien der Wirklichkeitsanpassung als Gradmesser der geistigen Gesundheit oder Gestörtheit eines Menschen geben zu wollen (vgl. Watzlawick 2005b: 91). Die psychiatrische Sichtweise stellt insofern eine Hintergrundfolie dar, die kritisch hinterfragt wird. Im dritten Kapitel wird der komplexe Zusammenhang zwischen nicht gelingendem Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien dargestellt. Dabei werden unterschiedliche Erklärungsansätze vorgestellt und ein Hauptaugenmerk auf die Rolle der Gesellschaft gelegt. Depressive Leere und die Füllung dieser Leere scheinen ein neues Phänomen massiver Identitätsprobleme zu sein. Depressionen und Sucht können als die Kehrseite der Freiheit, aus unzähligen Möglichkeiten seine eigene Identität gestalten zu können, gesehen werden (vgl. Ehrenberg 2004: 124). Das vierte Kapitel widmet sich Perspektiven der Sozialen Arbeit. Nach einer kritischen Betrachtung des Krankheitskonzepts, setze ich mich mit professionellen Handlungsstrategien auseinander. In ihrer Arbeit werden auch SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen zunehmender mit Menschen konfrontiert sein, die diese oft schwer nachvollziehbaren Verhaltens- und Bewältigungsmuster aufweisen und somit eines besonderen, professionellen Verständnisses bedürfen. Die hier vorgestellten Erklärungsansätze haben für eine 11 0. Einleitung professionelle Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin höchstens den Status, Inbegriff von Vorkenntnissen zu sein, auf die sie in den immer wieder neu bzw. anders zu kontextualisierenden, individuellen Fällen für eine gelingendere Handlungspraxis als Reflexionszusammenhang zurückgreifen kann (vgl. Dewe/Otto 2002: 194). 12 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Für alkoholische Getränke als Drogen, die süchtig machen können, herrscht in der Bevölkerung ein sehr geringes Problembewusstsein vor. Im Hinblick auf die gesamte Drogenproblematik werden in Österreich am häufigsten und selbstverständlichsten alkoholische Getränke konsumiert (vgl. Eisenbach-Stangl 1993: 53). Dem Spitzenplatz der ÖsterreicherInnen beim Alkoholkonsum entspricht auch ein Spitzenplatz bei alkoholbezogenen Problemen. Die spezifischen Konsumgewohnheiten der ÖsterreicherInnen erhöhen das Risiko für zahlreiche Problematiken wie nicht gelingenden Alkoholgebrauch (im Folgenden synonym für Alkoholabhängigkeit/Alkoholismus verwendet) und/oder depressive Bewältigungsstrategien (synonym für Depressionen/depressive Störungen) (vgl. Eisenbach-Stangl 1993: 55). Der hohe Alkoholkonsum der ÖsterreicherInnen ist keineswegs nur ein Phänomen der Erwachsenenwelt. Laut Feldkirchner Jugendstudie 2004 (Autrata/Scheu 2004) findet bei Feldkirchner Jugendlichen im Alter von 10 - 20 Jahren auch der Konsum legaler Drogen, wie Alkohol, in beträchtlichem Ausmaß statt, mit allen daraus abzuleitenden Gefährdungslagen (vgl. Hönig/Scheu 2006: 70). 64,1% der befragten Jugendlichen trinken in zum Teil größeren Mengen Alkohol. Von denen, die täglich Alkohol konsumieren, trinken etwa 14% mehr als 2 Liter Bier (oder vergleichbare Alkoholmengen) pro Tag. 20,7% der Befragten gaben an, bereits vor dem Erreichen des 10. Lebensjahres erstmals Alkohol getrunken zu haben. Bis zum Alter von 16 haben etwa 56% der Befragten zum ersten Mal Alkohol getrunken (vgl. Hönig/Scheu 2006: 71). Die Studie konstatiert bei Feldkirchner Jugendlichen aufgrund des frühen Alkohol-Erst-Kontakts und des hohen Konsums von alkoholischen Getränken ein ernstzunehmendes Gefährdungspotential (vgl. Hönig/Scheu 2006: 71). Auch bei der Moosburger Jugendstudie 2006 (Autrata/Hohenwarter/Scheu 2006) gaben 76,3 % der Befragten an, gelegentlich oder sogar jeden Tag in zum Teil größeren Mengen Alkohol zu konsumieren (vgl. Hönig/Scheu 2006: 89). Was diese Studien belegen, ist seit Siegmund Freud nichts Unbekanntes mehr: Ein scheinbar spezifisches Phänomen ist in Wirklichkeit ein generelles (auch in der Kindheit anzutreffendes) (vgl. Rudolph 2000: 251). Trotzdem irritieren solche Ergebnisse wie 13 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch einstmals die Aussagen Siegmund Freuds, mit denen er darstellen wollte, dass das Sexualleben keineswegs nur die Erwachsenenwelt betrifft: „Jetzt werden Sie die Perversionen allerdings in einem anderen Lichte sehen und deren Zusammenhang mit dem menschlichen Sexualleben nicht mehr verkennen, aber auf Kosten welcher Überraschungen und für ihr Gefühl peinlicher Inkongruenzen! Sie werden gewiss geneigt sein, zuerst alles zu bestreiten, die Tatsache, dass die Kinder etwas haben, was man als Sexualleben bezeichnen darf, die Richtigkeit unserer Beobachtungen und die Berechtigung an dem Benehmen der Kinder eine Verwandtschaft mit dem, was späterhin als Perversion verurteilt wird, zu finden“ (Freud 1999b: 321). 1.1 Begriffsklärungen 1.1.1 Alkoholismus/Alkoholabhängigkeit Beim Begriff Alkoholismus handelt es sich um keine nosologische Einheit, sondern um einen Kollektivausdruck für eine ganze Familie von Problemen, die mit Alkohol verwandt sind (vgl. Uhl 2001: 53). Eine, die zu dieser Familie gehört, ist die Depression. Die Bezeichnung Alkoholismus wird als Ausdruck für das chronische, kontinuierliche Trinken oder den periodischen übermäßigen Konsum von alkoholischen Getränken verwendet. Alkoholismus ist durch mehrere Faktoren gekennzeichnet, vor allem aber durch eine beeinträchtigte Kontrolle über das Trinken, häufige Episoden von Vergiftungen durch Alkohol und die gedankliche Beschäftigung mit diesem Stoff und seinem Konsum trotz nachteiliger Konsequenzen (vgl. Dilling 2002: 9). Magnus Huss verwendete 1849 die Bezeichnung Alkoholismus als erster (vgl. ebd.). Im 19. Jahrhundert wurde der Begriff Alkoholismus als Gesamtheit der durch Alkohol und alkoholischen Getränke verursachten Leiden und Krankheiten verwendet (vgl. Falck 1855: 294). Damals wurde schon versucht, Alkoholismus in verschiedene Bereiche bezüglich der Typen und Verlaufsformen zu unterteilen: „Nach ihrem Verlaufe, so wie nach sonstigen Verhältnissen zerfallen dieselben in chronische, acute, so wie in acuteepisodische, (…)“ (Falck 1855: 294). Zu dieser Zeit wurde vor allem auf die körperlichen Folgen des Alkoholismus hingewiesen, auch auf so genannte Nervenleiden, wie Demenz, Manie, Halluzinationen, „Hirnerweichung“, „Selbstmordtrieb“ etc., die mit dem übermä14 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch ßigen Gebrauch von alkoholischen Getränken verbunden wurden (vgl. Falck 1855: 304 ff.). Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden vor allem auf die körperlichen Folgen des lang anhaltenden schweren Trinkens hingewiesen. Schließlich wurde mit verschiedenen Typologien versucht jeden Alkoholkonsum zu kennzeichnen, der zu Schädigungen führt (körperlich, psychisch oder sozial; individuell oder gesellschaftlich relevant) (vgl. Dilling 2002: 9). Die Bezeichnung Alkoholismus war dennoch stets sehr ungenau und mehrdeutig. Im ICD-10 wird der Begriff deshalb nicht mehr verwendet und unter der Bezeichnung des Alkoholabhängigkeitssyndroms (F10.2) geführt. Diese Bezeichnung sollte von der akuten Intoxikation (F10.0) und dem schädlichen Gebrauch (F10.1.) unterschieden werden. Nach ICD 10 sollte eine Abhängigkeitsdiagnose nur dann gestellt werden, wenn mindestens 3 der folgenden Kriterien während des letzten Jahres vorhanden waren: starker Wunsch oder Zwang zum Konsum, verminderte Kontrollfähigkeit, körperliches Entzugssyndrom, Nachweis einer Toleranz, Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen und anhaltender Substanzkonsum trotz negativer Folgen (vgl. Dilling et al. 2000: 92f.). 1.1.2 Sucht Der Begriff der Sucht wurde von der WHO im Jahr 1963 durch „Missbrauch“ und „Abhängigkeit von Substanzen“ ersetzt. Die Begriffsänderung zielte darauf ab, die klinischmedizinisch bedeutsamen Süchte genauer zu beschreiben (vgl. Tretter 1998: 128). Gegenüber diesem Versuch ist kritisch festzuhalten, dass dadurch die Bedeutung der Substanz ein zu starkes Gewicht gegeben wurde. Obwohl der Suchtbegriff vor allem aus medizinischer Sicht als unscharf und umgangssprachlich gesehen wird (vgl. Krausz/Haasen 2004: 13), wird dieser Terminus aber in den letzten Jahren, auch im wissenschaftlichen Kontext wieder häufiger verwendet und umfasst sowohl stoffgebundene wie auch nichtstoffgebundene Süchte (wie etwa Glücksspiel, Magersucht, Kaufsucht) (vgl. Feuerlein et al. 1998: 6). In Definitionen süchtigen Verhaltens gehen auch soziale und psychische Aspekte in Zusammenhang mit exzessivem Substanzgebrauch hervor, die aber meist psychosoziale Probleme als Folge und nicht als Bedingungen süchtigen Verhaltens verstehen (vgl. Tretter 1998: 128). Ob etwa soziale Bedingungen oder Chancen des Individuums und freie 15 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Entfaltungsmöglichkeiten schon vor der Ausbildung von Sucht eingeengt waren, geht aus den Definitionen von Sucht meist nicht hervor. Sucht steht für ein unabweisbares Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand auf Kosten biopsychosozialer Ressourcen (vgl. Tretter 1998: 128). Dieses unabweisbare Verlangen kommt auch im Sammelbegriff der französischen Bezeichnung für Sucht zur Geltung: „les toxicomanies“. Manie bezeichnet das Getriebensein, das Betroffensein und Ausgeliefertsein der Betroffenen. Manie ist auch die Bezeichnung für eine psychische Störung. Hier lässt sich in ersten Ansätzen ein Zusammenhang mit Depression erkennen (vgl. Musalek 2004: 3). 1.1.3 Nicht gelingender Alkoholgebrauch Zunächst einmal will ich den Begriff des „nicht gelingenden Alkoholgebrauchs“ kritisch betrachten. Vielleicht mag der Eindruck entstehen, dass mit dieser Begrifflichkeit der Versuch gestartet wird, ein puritanisches Konzept vom gelingenden Leben zu postulieren (Thiersch 1995: 125). Auch könnte jemand vielleicht einwenden, dass mit Metaphern der Schwäche, des Defizits oder des Nicht-Gelingens ein bestimmtes (defizitäres) Menschenbild vermittelt wird (vgl. Herriger 2002: 70). Das Empowerment-Konzept zeichnet ein Bild von einem Menschen, als kompetenten Konstrukteur eines gelingenden Alltags: „Der Konsument sozialer Dienstleistungen wird hier nicht mehr (allein) im Fadenkreuz seiner Lebensunfähigkeiten und Hilflosigkeiten wahrgenommen“ (ebd.). Dem habe ich grundsätzlich nichts hinzuzufügen, dennoch schließt diese Sicht nicht aus, dass eine Strategie gelingen oder eben auch nicht gelingen kann. Den Menschen rein von einem idealistischen, positiven, perfekten Standpunkt aus zu betrachten, dem alles gelingt, aber nichts misslingt, halte ich für wenig realistisch und sogar für gefährlich. Menschen machen auch Fehler. Eine Strategie darf auch einmal nicht gelingen, frei nach dem Motto von Cicero bzw. Dörner et al. „cuiusvis hominis est errare“ - „Irren ist menschlich“ (Cicero 1856: 1370; Dörner et al. 2004: 11). Den Begriff „nicht gelingender Alkoholgebrauch“ habe ich gewählt, weil damit m. E. die biopsychosoziale Ebene treffender ausgedrückt wird als bei den Begriffen Alkoholismus/Alkoholabhängigkeit und Sucht. Dieser Begriff drückt aus, dass es sich bei diesem Phänomen um ein Bewältigungsverhalten handelt, das als Ausdruck des Strebens der 16 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Menschen in ihrer Leiblichkeit, nach psychosozialer Handlungsfähigkeit in unserer „Risikogesellschaft“ (Beck 1986) gesehen werden kann (vgl. Böhnisch 2001b: 29). Risikofreies Verhalten ist selten geworden, und doch sind Menschen darauf angewiesen, dass ihnen ständig jemand sagt, wo die Gefahren lauern, welche negativen Konsequenzen bestimmte Verhaltensweisen nach sich ziehen können, und wie der Alltag gelingender bewältigt werden kann (vgl. Rauschenbach 1992: 31). Neben Sozialer Arbeit wollen diese Aufgaben verschiedene Bezugswissenschaften, wie Medizin, Psychologie oder Soziologie übernehmen, deren oft unterschiedliche Zugänge ein umfassenderes Bild ergeben können. Bei aller Berechtigung institutionalisierter Hilfen ist es notwendig, die Autonomie und Mündigkeit der Menschen zu wahren. Diese Aufgaben wollen aber auch verschiedene selbsternannte, aus der „Psychowelle“ hervorgetreten „ExpertInnen“, wie „GeistheilerInnen“, „KartenlegerInnen“, „SchamanInnen“ oder sonstige „LebensberaterInnen“ auch mithilfe von TV, Telefon oder Internet übernehmen. Eine Wurzel für die „Psychowelle“ liegt eben darin, dass gesellschaftliche Krisen als individuelle erscheinen (Beck 1986: 159). Die Expertin zur Frage, ob eine Strategie gelingender oder nicht gelingend ist, sollte das Subjekt bleiben. Eine Subjektorientierung macht es nötig, den Menschen im Kontext der Erfahrung seiner Wirklichkeit, als ein handlungsfähiges, emotionales und reflexives Wesen zu sehen (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2002: 169; vgl. Richter 2006: 99). Bei aller Konzentration auf das Individuum darf also der gesellschaftliche, alltägliche, lebensweltliche Kontext der Subjekte nicht außer Acht gelassen werden. Die individuelle Dimension des Subjekts kann ohne diese anderen Seiten nicht verstanden werden (vgl. Richter 2006: 100). Darauf weist schon die Bedeutung der lateinischen Wurzel von Sub-ject hin: subiecta bzw. sub-iectus heißt übersetzt, die bzw. der unter etwas geworfen ist, im strengeren Sinne unterworfen oder ausgesetzt ist (vgl. Stowasser/Petschenig/Skutsch 1997: 487). Das meint, dass Menschen in ihrer vollen Sinnlichkeit, in ihrem Erleben und ihrer Erfahrung der Wirklichkeit mit ihrer Umwelt verknüpft sind. Es wäre absurd sich ein kontextloses Subjekt oder auch einen subjektlosen Kontext vorzustellen (vgl. Schreiber 1999: 22). Der Alltagsbegriff von Thiersch impliziert, dass ein Mensch in jedem Moment seiner Gegenwart nur in den Dimensionen seiner räumlichen Erfahrung, in seinem zeitlichen Kontinuum und in den Dimensionen seiner sozialen Kontexte heraus begriffen werden kann 17 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch (vgl. Thiersch 1992: 50f.). Die Einheit von Kontinuum und Kontext stellt gleichsam die Bühne, den Ort vor, auf der Menschen in historisch gewordenen und veränderbaren Formen und Rollen miteinander agieren (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2002: 170). Auf dieser Bühne strengen sich Menschen an um sich selbst zu inszenieren, zu behaupten, darzustellen, anzupassen oder zugewiesene Rollen zu übernehmen. Die verschiedenen Formen des Alkoholgebrauchs oder auch von Depressionen erscheinen in diesem Kontext immer auch als „Ergebnis einer Anstrengung in den gegebenen Verhältnissen zurecht zu kommen, und müssen darin zunächst respektiert werden, auch wenn die Ergebnisse für den Einzelnen und seine Umgebung unglücklich sind“ (Thiersch/Grunwald/Köngeter 2002: 169). Alltäglichkeit, als ein Moment der Strukturen des Alltags, kann einerseits als ein heuristisches Prinzip, als Rahmenkonzept, das im Konzept der Lebensweltorientierung ihren Ausdruck findet, benutzt werden. Andererseits meint es einen spezifischen Modus des Verstehens und Handelns, eine spezifische Art die Wirklichkeit zu erfahren (vgl. Thiersch 1992: 46). Sie agiert außer in der erfahrenen Zeit und im erfahrenen Raum, auch in erfahrenen sozialen Bezügen, wie Familie, Nachbarschaft, Verwandtschaft oder Gemeinde. Die zur Lebensbewältigung notwendigen Ressourcen und Unterstützungen in schwierigen Lebenssituationen werden hier traditionellerweise gesucht und gefunden. Durch die Erosion von traditionellen Familien-, Nachbarschafts-, oder solidarischen Strukturen, sind Menschen mehr und mehr darauf angewiesen ihre sozialen Ressourcen selbst zu inszenieren (vgl. Thiersch 1992: 50 f.). Alkohol, der kulturell gesehen, auch die Funktion sinnstiftender Identität im Eingebundensein in sozialen Beziehungen hatte, wird somit für manche zum Mittel der Wahl, soziale Bezüge, soziale Ressourcen herzustellen. Der Alltag im Hinblick auf Alkoholgebrauch ist durch eine doppelte Dimension geprägt. Alltag ist einerseits durch Wiederholungen, Überschaubarkeit, Vertrautheit, durch Routinen und Rituale geprägt: Alltäglichkeit ist also mitunter in Bewältigungsmustern pragmatisch geprägt, das den Menschen eigentlich zur Aufrechterhaltung einer elementaren Ordnung dient, also auch Halt und Sinn verleiht (vgl. Thiersch 1986: 16 f.). Diese Bewältigungsmuster werden ausgehandelt und gelten zwischen den Beteiligten eines sozialen Gefüges (vgl. Thiersch 1986: 17). Alltag ist aber nicht nur durch Wiederholungen und 18 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Routinen geprägt, sondern auch durch Entwicklungschancen, Verbesserung, Neues, Unüberschaubares und durch Unzulänglichkeiten und Misslingen (vgl. Schulze 1996: 74). Die speziellen Handlungs- und Deutungsmusterhaben, wie nicht gelingender Alkoholgebrauch oder auch depressive Bewältigungsstrategien haben immer auch einen gesellschaftlichen Charakter. Die Lebenswelt ist bestimmt durch eine Dialektik des Gelingenden und Verfehlten, als Ergebnis einer Anstrengung, in den gegebenen Verhältnissen zurecht zu kommen (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2002: 169 f.). Diese Verhältnisse drücken eine Bedingtheit aus, der ein Mensch in seiner sozialen Existenz unterworfen ist. Erfahrene Wirklichkeit ist immer durch gesellschaftliche Strukturen und Ressourcen bestimmt (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2002: 170). In unserer Gegenwart ist die Lebenswelt geprägt durch neue Ungleichheiten, die nicht mehr nach dem Schema von sozialen Klassenunterschieden gesehen werden können, sondern in einer neuen Unmittelbarkeit von Gesellschaft und Individuum (vgl. Beck 1986: 158). Gesellschaftliche Probleme schlagen unmittelbarer in psychische Dispositionen um, es herrscht eine neue Unmittelbarkeit von Krise und Krankheit in dem Sinn, dass gesellschaftliche Krisen als individuelle erscheinen, und immer weniger in ihrer Gesellschaftlichkeit wahrgenommen werden (vgl. Beck 1986: 158 f.). Pluralisierung ist ein Stichwort, in denen sich neue Widersprüchlichkeiten erkennen lassen. Pluralisierung von Lebenslagen meint die Unterschiedlichkeit von Lebensstrukturen, also die Unterschiedlichkeit von Strukturen in Wien und Feldkirchen, in Stadt und Land, von Ost und West, Nord und Süd, für Frauen und Männer, Mädchen und Burschen, AusländerInnen, EmigrantInnen und „eingeborenen“ ÖsterreicherInnen (vgl. Thiersch 1992: 20). Mit Pluralisierung ist die Unterschiedlichkeit von Lebensbedingungen verbunden. Die Grunddifferenzen können aber nicht einfach nur mehr im Sinne ökonomischer, beruflicher oder statusbezogener Merkmale ausgemacht werden, sondern sind differenzierter und vielschichtiger (vgl. Thiersch 1992: 21). Gruppen und Individuen werden zugemutet, ihre Lebensräume bewusst zu inszenieren und den Entwurf des eigenen Lebensplans vor sich und anderen zu verantworten. Dabei wird Lebensbewältigung eine anstrengende Angelegenheit (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2002: 171). Menschen sind zur Bewältigung von Problemlagen auch zu sozialen und politischen Koalitionen gezwungen. Koalitionen werden aber punktuell, situations- und 19 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch themenspezifisch und wechselnd mit unterschiedlichen Gruppen aus unterschiedlichen Lagen geschlossen und wieder aufgelöst (vgl. Beck 1986: 159). In einer individualisierten Gesellschaft kommt es zu einer eigentümlichen Pluralisierung, zu neuen, bunten Konflikten und Koalitionen (vgl. ebd.). 1.2 Erklärungsansätze und Typologien 1.2.1 Genetische Dispositionen Die Psychiatrie ist bei der Entstehung süchtigen Verhaltens teilweise durchaus überzeugt von genetischen Dispositionen. Dies wird mittels zahlreich durchgeführter Familienstudien zu untermauern versucht (vgl. Gastpar et al. 1999: 28). Aus solchen Studien geht beispielsweise hervor, dass insbesondere Alkoholismus familiär gehäuft auftritt. Ist ein Elternteil von Alkoholismus betroffen, ist das Risiko für die Kinder für diese Abhängigkeit höher, als bei gesunden Elternteilen (vgl. ebd.). Auch Zwillingsuntersuchungen und Adoptionsstudien ergeben eindeutige genetische Komponenten (vgl. ebd.). Kontrollierte Verlaufsstudien, wie etwa von Zerbin-Rüdin (1985), zeigten bei Söhnen von AlkoholikerInnen, die gleich nach der Geburt adoptiert wurden und keinen Kontakt zu ihren biologischen Eltern mehr hatten, dass sie im Vergleich zu adoptierten Kindern von nicht alkoholabhängigen Eltern ein 4-fach höheres Alkoholismusrisiko aufwiesen. Söhne von alkoholabhängigen Menschen, die zu Hause aufwuchsen erkrankten dabei aber nicht häufiger an Alkoholismus als ihre adoptierten Brüder. Studien an eineiigen Zwillingen zeigten, dass die Konkordanzrate für Alkoholismus etwa 60% beträgt (vgl. Tretter 1998: 132 f.). KritikerInnen sehen die Ergebnisse solcher Untersuchungen als ziemlich widersprüchlich, sprechen sich wegen großer Differenzen in den Ergebnissen, die methodenbedingt aufgrund unterschiedlicher Stichproben und Diagnosekriterien verursacht werden, zusammenfassend höchstens für eine gewisse genetische Komponente als Determinante von Alkoholabhängigkeit aus (vgl. Köhler 2000: 56; vgl. Tretter 1998: 133). In der Frage, ob es ein so genanntes „Suchtgen“ gibt, haben ForscherInnen bislang trotz intensiver Bemühungen ein solches zu entdecken, noch keine Beweise liefern können. Weder konnten bei Alkoholabhängigen Besonderheiten im Genom, noch Besonderheiten in bestimmten Genen nachgewiesen werden (vgl. Köhler 2000: 56). 20 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Das Beispiel der genetischen Dispositionen als ursachenorientierte Erklärungssätze für so manche Störungen und Abweichungen, kann als Suche nach den „eigentlichen Ursachen“ angesehen werden. Diese Suche setzt möglichst früh an, im Erbgut oder zumindest in der frühkindlichen Erfahrung, bis gewisse ExpertInnen eben auf die „wirklich grundlegende Ursache“ stoßen, die für die jeweilige Perspektive passt (vgl. Böhnisch 1994: 175). Diese Hypothesen sind so groß und unüberschaubar, zumal von den geschätzten 50.000 bis 100.000 Genen, die das Erbgut eines Menschen ausmachen, bislang erst ein wenig mehr als 2000 identifiziert sind (vgl. Schott 2000: 326). Die Hauptursachen der Abhängigkeitsentwicklung können trotz des Fortschritts der neurobiologischen Forschungen zu physiologischen Mechanismen ohnehin nicht aufgedeckt werden. Bei diesen Befunden kann es sich nur um Korrelate der Abhängigkeitsentwicklung handeln. Auch bei einem eventuellen Nachweis einer genetischen Basis würde die Frage stehen bleiben, welchen Nutzen dieser im Umgang mit den Menschen haben könnte. Psychosoziale Aspekte werden weiterhin immer ein wichtiger Bereich für die Arbeit mit Betroffenen bleiben (vgl. Tretter 1998: 135). Genetische Einflussfaktoren, die auf das Verhalten einwirken, sind alles andere als unveränderlich und ein für alle mal festgelegt. Die Menschen sind ihren Genen niemals restlos ausgeliefert, denn „genetische und Umwelteinflüsse wirken absolut untrennbar zusammen [und] zwischen Anlage und Erziehung entfaltet sich von den ersten Augenblicken der Entwicklung an eine dynamische Wechselwirkung“ (Solms/Turnbull 2007: 230). Es wäre ein voreiliger und gefährlicher Schluss, sofort auf eine erbliche Belastung alleine zu schließen, wenn beispielsweise ein Elternteil oder beide alkoholabhängig waren (vgl. Brandt 1975: 110). Die Umwelteinflüsse von Kindern aus suchtbelasteten Familien können einen ungünstigen Umweltfaktor darstellen und ihre Entwicklung beeinflussen, jedoch ist ein Mensch in seinen Handlungs- und Deutungsmustern prinzipiell immer wandlungsfähig. Durch die Mobilisierung und Eröffnung innerer und äußerer Ressourcen sind gelingerende Muster der Lebensbewältigung möglich (vgl. Brandt 1975: 110f.). 21 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch 1.2.2 Biologische Modelle Ein Kernpunkt biologischer Theoriebildung zur Abhängigkeit ist die Annahme eines so genannten Belohnungssystems im Gehirn, auf das der Alkohol in verschiedenartiger Weise Einfluss nimmt (vgl. Küfner/Bühringer 1997: 463). Hier werden vor allem neurochemische Prozesse für die Entstehung von Abhängigkeit verantwortlich gemacht. Hierbei wesentlich ist die Annahme, dass Alkohol unter anderem die Fähigkeit besitzt, seinen Konsum positiv zu verstärken (vgl. Heinz et al. 2003: 47). Unter positiver Verstärkung wird verstanden, dass der Alkoholkonsum positive Wirkungen auslöst, die die weitere Einnahmewahrscheinlichkeit erhöhen. Verantwortlich dafür ist die drogeninduzierte Stimulation einer Dopaminfreisetzung in einer Region des Gehirns, die als wesentlicher Teil des so genannten (dopaminergen) Belohnungs- oder Verstärkungssystems gesehen wird (vgl. ebd.). In diesem Zusammenhang spielt auch das so genannte endorphinerge System eine wesentliche Rolle. Die euphorisierende Wirkung des Alkohols wird einer Aktivierung endophinerger Neuronen zugeschrieben. Durch Freisetzung der Endorphine wird die Aktivität dopaminerger Neuronen indirekt stimuliert (vgl. Gastpar et al. 1999: 35). Dadurch ergeben sich verschiedene Hypothesen, die beispielsweise besagen, dass die Ausschüttung der Endorphine den Wunsch nach weiterem Alkohol, zuletzt nach exzessiven Mengen verstärkt. Der Mensch entwickelt somit eine Toleranz (vgl. Gastpar et al. 1999: 35). Toleranz kann „als Rechtsverschiebung der Dosiswirkungskurve nach wiederholter Drogeneinnahme“ beschrieben werden (Gastpar et. al. 1999: 34). Durch die wiederholte Einnahme der Substanz beginnt sich der Körper also daran zu gewöhnen und das bewirkt ein vermindertes Ansprechen, was eine Dosissteigerung erforderlich macht, um die gleiche Wirkung zu erzielen (vgl. Pschyrembel 2002: 1667). Toleranz lässt sich unter anderem auch dadurch erklären, dass auf neuronaler Ebene die Wirkung der Droge direkt abgeschwächt wird, was z.B. zur Verminderung der Verstärkerwirkung führt (vgl. Gastpar et al. 1999: 34). Auch eine serotonerge Funktionsstörung wird mit der Entwicklung und dem Verlauf der Alkoholabhängigkeit in Zusammenhang gebracht (vgl. Heinz et al. 2003: 81). Interessant dabei ist, dass eine serotonerge Funktionsstörung mit negativen Gefühlszuständen, wie 22 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Depressivität verbunden wird. Der Aktivität des serotonergen System kommt eine wesentliche Rolle bei Handlungsmustern wie Nahrungsaufnahme und Verdauung, Entspannung, Wachstum, Schlaf und passives Verhalten zu (vgl. ebd.). So kann es sein, dass bei erhöhter seretonerger Transmission die Situation subjektiv eher als positiv empfunden wird, bei verminderter Transmission eher als negativ, sodass sich depressive Verhaltensmuster bzw. erhöhter Alkoholkonsum erklären lassen können (vgl. Heinz et al. 2003: 82). In diesem Zusammenhang wird noch darauf hingewiesen, dass eine serotonerge Störung sowohl primär bestehen kann, als auch durch chronischen Alkoholkonsum hervorgerufen werden kann (vgl. ebd.). Dieses Transmittersystem hat also in neurobiologischen Erklärungsansätzen eine Bedeutung auch beim Zusammenhang zwischen Alkoholabhängigkeit und Depression. Medizinisch-biologische Modelle haben mit der Entwicklung von Medikamenten, die komplexe Aktivitäten des Gehirns beeinflussen, zum Erfolg bei der Behandlung der Alkoholabhängigkeit oder auch von Depressionen beigetragen. Solche Modelle stehen aber im Verdacht durch eine reduktionistische Sichtweise psycho-soziale Faktoren auszublenden und das Heil vor allem in Medikamenten und in der Abstinenz zu sehen (vgl. Lempke 1990: 21f.; vgl. Clausen et al. 1997: 77f.). 1.2.3 Psychologische Erklärungsmodelle Sucht als erlerntes Verhalten Psychologische Erklärungsansätze verstehen exzessiven Alkoholkonsum mitunter auch als erlerntes Verhalten, das allgemeinen Lernprozessen unterliegt und von der Persönlichkeitsausgestaltung, den Lebensumständen und Sozialisationsbedingungen bestimmt wird. Betont wird hier vor allem die entspannende, entlastende und somit die belohnende Wirkung des Alkohols. Je häufiger also Alkohol getrunken wird und darauf eine Belohnung wie Entspannung folgt, umso mehr wird angenommen, dass Alkoholtrinken sich als Verhalten verfestigt (vgl. Kryspin-Exner 1998: 374). Alkoholabhängigkeit wird hier als eine Verhaltensstörung bezeichnet. Der Alkohol wurde aufgrund seiner mit ihm verbundenen positiven Erfahrungen zum klassisch konditionierten Verstärker, und mittels negativer Verstärker kann dieses Verhalten wieder umkonditioniert werden (vgl. Küfner/Bühringer 1997: 466). 23 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Neuerdings verstehen sich die Verhaltenspsychologie oder der Behaviorismus als Teilbereiche der Sozialpsychologie. Diese Lerntheorien gehen davon aus, dass prinzipiell jeder Mensch alles erlernen, aber auch wieder verlernen kann, sofern die entsprechenden Umweltbedingungen hergestellt werden (vgl. Frey/Greif 1997: 40). Behavioristen interessieren sich für die Regelhaftigkeiten, mit der Verhaltensweisen in bestimmten Reizsituationen auftreten, z.B. wann, unter welchen Umständen ein Mensch Alkohol trinkt. Auf welchen Reiz X folgt vorhersehbar die Reaktion Y. Hier wird daher auch von Reiz-Reaktionspsychologie gesprochen (vgl. Engelkamp et al. 2006: 2). Die klassische Konditionierung wird als eine grundlegende Form des Lernens betrachtet, bei der ein Reiz oder ein Ereignis das Auftreten eines anderen Reizes oder Ereignisses vorhersagen kann (vgl. Zimbardo/Gerrig 1999: 209). Das klassische Konditionierungsmodell besagt, dass neutrale Stimuli wegen ihrer Koppelung mit der Alkoholzufuhr selbst zu Auslösern für das Trinken werden können (vgl. Kryspin-Exner 1998: 374). Eine Geburtstagsfeier oder ein Gasthaus als neutraler Stimulus, verbunden mit Alkoholkonsum kann also dazu führen, dass eine Geburtstagsfeier oder ein Gasthaus immer mit Alkoholkonsum in Verbindung gebracht werden und somit als Auslöser für das Trinken fungieren. Wie beim Pawlowschen Hund wird also ein vormals neutraler Stimulus für einen Menschen zum Auslöser für ein bestimmtes Verhalten. Hier wird bekräftigt, dass die Kopplung eines Verhaltens mit einem positiven Verstärker die Auftretenswahrscheinlichkeit dieses Verhaltens erhöht. Dieses allmächtige Verstärkerprinzip wird aber durch verschiedene Befunde in Frage gestellt. So wurde beispielsweise nachgewiesen, dass Kinder einen Teil ihres Interesses verlieren, wenn ihnen Belohnungen von außen für die Ausführungen versprochen werden. Hier tritt also der Fall ein, dass die positive Wirkung sich umkehrt (vgl. Rudolph 2000: 254). Problematisch ist auch das Menschenbild, das durch behavioristische oder ähnliche Ansichten vermittelt wird. Der Mensch gilt als ein von außen, durch gewisse Umweltreize in seinen Reaktionen gesteuertes Wesen. Nach Ansicht von Lazarus hat der radikale behavioristische Standpunkt, die Psychologie als Wissenschaft vom Verhalten definierte, die psychologische Forschung und Theoriebildung über 50 Jahre dominiert und ernsthaft behindert (vgl. Lazarus 2005: 231). 24 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Für die Entwicklung und Aufrechtrechterhaltung der „Verhaltensstörung“ Alkoholabhängigkeit wird dem Belohnungssystem eine wesentliche Rolle zugesprochen (vgl. Scholz/Steinberger 2004: 121). Das Belohnungssystem wird als ein Funktionssystem verstanden, das für spezielle Verhaltens- und Konsummuster verantwortlich ist und dementsprechend eine hohe Bedeutung für die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Suchtprozessen hat (vgl. ebd.). Die Betroffenen entwickeln demnach ein meist lebenslang andauerndes Suchtmittelverlangen, das selbst nach jahrelanger Abstinenz durch verschiedene biopsychosoziale „Turbulenzen“ wieder einsetzen kann (vgl. Scholz/Steinberger 2004: 121/129f.). Durch solche Überlegungen liegen Meinungen begründet, die eine lebenslange Abstinenz fordern und etwa kontrolliertes Trinken als zu risikoreich einschätzen (vgl. Küfner/Bühringer 1997: 476f.). „Krankheitseinsicht“ wird so zum Ziel und/oder Vorraussetzung einer erfolgreichen Therapie und lässt sich folgendermaßen definieren: Die betroffene Person muss ein erstes Problembewusstsein entwickeln und die Vorstellung eines kontrollierten Trinkens aufgeben (vgl. Küfner/Bühringer 1997: 477). In der Neurowissenschaft wird heute statt vom Belohnungssystem mehr vom so genannten SUCH-System gesprochen, das mit Neugierde, Interesse und Erwartung zusammenhängt (vgl. Solms/Turnbull 2007: 130). Dieses System wird bei sexueller Erregung und anderen Appetenzzuständen, wenn es jemanden beispielsweise nach einem Glas Rotwein gelüstet, aktiviert. Gewisse Bedürfnisse werden von hypothalamischen Systemen erzeugt und diese Bedürfnisse aktivieren das SUCH-System (vgl. Solms/Turnbull 2007: 130ff.). Wenn also, um es anders auszudrücken, „die Systeme, die als Bedürfnisdetektoren fungieren, registrieren, dass einer der von ihnen überwachten homöostatischen Mechanismen nicht mehr im „Normbereich“ ist, aktiviert sie Such- oder Appetenzverhalten, um ihn zu korrigieren“ (Solms/Turnbull 2007: 132). Da das SUCH-System sehr beliebig und unkoordiniert nach „irgendetwas da draußen“ sucht, muss es mit anderen Systemen interagieren: Das SUCH-System ist mit dem Gedächtnissystem aufs engste verbunden; eine solche Erweiterung wird in der Neurowissenschaft als LUST-System bezeichnet, das früher als Belohnungs- oder Verstärkungssystem definiert wurde (vgl. Solms/Turnbull 2007: 133). Die Funktion dieses Systems hat mit der Befriedigung der Bedürfnisse, die das SUCH- 25 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch System aktivieren zu tun und die Stimulierung wird durch das Endorphin gesteuert (vgl. Solms/Turnbull 2007: 133f.). Das SUCH- und das LUST-System sind so beschaffen, dass sie Lernen fördern bzw. motivieren, die Fähigkeiten zu erwerben, die zur Befriedigung innerer Bedürfnisse in der Außenwelt notwendig sind. Die belohnende Eigenschaft motiviert auch, die Arbeit zu leisten, die zur Realisierung der biologischen Bedürfnisse notwendig sind (vgl. Solms/Turnbull 2007: 135f.). Die Lust um der Lust willen erfüllt jedoch keinen biologischen Zweck und Drogen regen das SUCH-System an und wecken dadurch künstliche Erwartungen oder stimulieren direkt die Lustzentren. Alkohol und andere Drogen erzeugen laut Solms und Turnbull „pseudobefriedigende Verhaltensweisen (und entsprechende lustvolle Sensationen), die keinen biologischen Zweck erfüllen“ (Solms/Turnbull 2007: 136). Die Gefahr liegt nun darin, dass die Präokkupiertheit mit der Droge alles andere, auch alle übrigen biologisch nützlichen Verhaltensweisen ausschalten kann. Das SUCHund das LUST-System können sich an Alkohol gewöhnen und immer mehr Mengen werden erforderlich, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Alkohol kann unter anderem das Gehirn und das Körpergewebe auch auf andere, direktere Weise schädigen (z.B. Vergiftungserscheinungen) (vgl. Solms/Turnbull 2007: 328f.). Die Coping Theorie Die Coping Theorie stammt ursprünglich aus der Stressforschung und ist eine wesentliche Grundlage für das Konzept der (Lebens-)Bewältigung in der Sozialen Arbeit (vgl. Böhnisch 2001b: 31). Die Coping Theorie geht laut Böhnisch „von dem Befund aus, das die Bewältigung von Stresszuständen und kritischen Lebensereignissen so strukturiert ist, dass der Mensch aus somatisch aktivierten Antrieben heraus nach der Wiedererlangung eines Gleichgewichtszustandes um jeden Preis strebt“ (ebd.). Das sozialpädagogische Konzept der Lebensbewältigung ging also ursprünglich aus der Coping Forschung hervor, wurde aber von Böhnisch von Beginn an in den Kontext des Strukturwandels des Sozialstaats gestellt (vgl. Lenz/Schefold/Schröer 2004: 11). Die Einschätzung von Böhnisch über die Coping Theorie ist etwas verkürzt und meines Erachtens ungenau. Auch deshalb werde ich diese Grundlage des Konzepts der (Lebens-)Bewältigung etwas näher beleuchten. 26 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Bewältigung oder Coping umfasst nach Lazarus und Launier (1978/1981) die Anstrengungen einer Person, mit stressrelevanten Situationen fertig zu werden (vgl. Jerusalem 1990: 14). Diese Anstrengungen können grundsätzlich zwei unterschiedliche Funktionen erfüllen (vgl. ebd.): • eine positive Veränderung der Problemlage oder • eine Verbesserung der emotionalen Befindlichkeit. Diese Funktionen können wiederum durch vier unterschiedliche Arten von Bewältigung angestrebt werden (ebd.): • Informationssuche, • direkte Handlung, • Unterdrückung von Handlungen und • intrapsychische Prozesse. Weiters werden Aspekte der zeitlichen und thematischen Orientierung differenziert (Bewältigung vergangener Ereignisse/Verlust - Bewältigung zukünftiger Ereignisse/Herausforderung oder Bedrohung), sowie unterschieden, ob die Veränderungen eher die Umwelt oder die eigene Person betreffen (vgl. Jerusalem 1990: 14). Weitere Ausdifferenzierungen dieses Modells schlagen acht empirisch ermittelte Arten von Bewältigungsversuchen vor (vgl. Jerusalem 1990: 15): • konfrontative Bewältigung, • kognitive Distanzierung, • Selbstkontrolle, • Suche nach sozialer Unterstützung, • Übernahme von Verantwortung, • Fluchtvermeidung, • problembezogene Lösungsversuche und • positive Neueinschätzungen. 27 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Die Entstehung von stressrelevanten Ereignissen hängt dabei stark mit den subjektiven Bedeutungen bestimmter Situationen zusammen, die sich aus Bewertungsprozessen von Menschen in ihrer Beziehung zur Umwelt ergeben (vgl. Lazarus 2005: 233 ff.). Bewertungen werden dabei im Wesentlichen auf zwei Weisen vorgenommen: Es kann sich dabei um einen überlegten und weitgehend bewussten Prozess handeln oder aber um einen intuitiven, automatischen und unbewussten (vgl. Lazarus 2005: 246). Von somatisch aktiviertem Antrieb, wie Böhnisch zu sprechen, halte ich in diesem Zusammenhang als nicht passend, obgleich es verwundern mag, dass viele Bewertungsprozesse mit einer großen Geschwindigkeit zustande kommen (vgl. ebd.). Nicht die Situation an sich ist für Stress ausschlaggebend, sondern die Art und Weise wie Menschen bestimmte Situationen bewerten. Menschen beurteilen ihre Beziehung zur Umwelt ständig im Hinblick auf die Implikationen, die sich daraus für ihr Wohlbefinden ergeben (vgl. Lazarus 2005: 235). In der Lazarusschen Sichtweise von Bewertung handelt es sich um einen modifizierten Subjektivismus. Menschen stehen dabei in Auseinandersetzung mit zwei komplementären Bezugssystemen: Das Geschehen soll so realistisch wie möglich gesehen werden, um es bewältigen zu können - und das Geschehen soll im bestmöglichen Licht gesehen werden, um nicht Hoffnung und Zuversicht zu verlieren; Bewertung ist ein Kompromiss zwischen dem Leben, wie es ist und wie Menschen es gern hätten. Eine erfolgreiche Bewältigung hängt von beiden Aspekten ab (vgl. Lazarus 2005: 235). Lazarus hebt beim Akt des Bewertens zwei Formen hervor: primäres und sekundäres Bewerten (vgl. Lazarus 2005: 236). Der Begriff primäre Bewertung wird für die anfängliche Einschätzung der Ernsthaftigkeit einer Situation verwendet (vgl. Zimbardo/Gerrig 1999: 376). Es zeigt also einen Prozess auf, in dem es darum geht, ob ein Geschehen für die Wertvorstellungen, Zielverpflichtungen und Überzeugungen einer Person bezüglich sich selbst und der Welt, sowie für ihre situationsbedingten Absichten relevant ist – und wenn ja, in welcher Weise (vgl. Lazarus 2005: 236). Die wesentliche Frage, die sich ein Mensch hier stellt ist die, ob etwas auf dem Spiel steht, und falls ja, was hat der Mensch dann zu erwarten. Steht aber nichts auf dem Spiel bzw. ist die Transaktion für das Wohlbefinden nicht von Belang, hat sich die Angelegenheit erledigt (vgl. Lazarus 2005: 238). 28 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Wird nun eine stressrelevante Situation als herausfordernd, bedrohlich oder schädigend bewertet, kommt es in aktiver Wechselbeziehung zu dieser primären Bewertung, in der sekundären Bewertung zur Frage, was gegen eine gestörte Person-Umwelt Beziehung getan werden kann (vgl. Lazarus 2005: 238 f.). Hier überprüft die Person anhand verfügbarer Bewältigungsmöglichkeiten, welche körperlichen, psychologischen, sozialen oder materiellen Ressourcen sie besitzt, die zur Bewältigung eingesetzt werden können (vgl. Jerusalem 1990: 11). Dabei können beispielsweise soziale Unterstützungssysteme, körperliche Gesundheit, eigene Fähigkeiten, Vertrauen, Geld oder Selbstwirksamkeit Aspekte sein, die bei der Bewältigung hilfreich sind (vgl. ebd.). Schädigungsbewertungen beziehen sich dabei auf einen Schaden, der bereits entstanden ist, können aber auch Bedrohungskomponenten für die Zukunft beinhalten, wobei Bedrohungsbewertungen sich auf die Möglichkeit beziehen, dass ein Schaden in der Zukunft eintritt (vgl. Lazarus 2005: 238 f.). Eine Situation wird dann als herausfordernd bewertet, wenn sich die Person aufgefordert und in der Lage fühlt, erfolgreich gegen Hindernisse anzugehen und sich dem Kampf vielleicht sogar freudig zu stellen (vgl. Lazarus 2005: 239). Ob eine Person eher zur Bedrohungsbewertung oder zur Herausforderungsbewertung neigt, hängt eng mit Selbstvertrauen oder Selbstwirksamkeit zusammen (vgl. ebd.). Selbstwirksamkeit wird beschrieben, als die subjektive Überzeugung eines Individuums, ein bestimmtes Verhalten ausüben zu können (vgl. Jonas/Brömer 2002: 278). Von der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit hängt es ab, für welche Verhaltensweisen sich Individuen entscheiden, wie viel Energie sie in die betreffende Verhaltensweise investieren, ob verhaltensförderliche oder -hinderliche Kognitionen ablaufen, welches Ausmaß an Stress erlebt wird und wie sie mit Rückschlägen fertig werden (vgl. ebd.). Je mehr also eine Person, sich die Überwindung von Gefahren und Hindernissen zutraut, desto eher wird sie sich herausgefordert anstatt bedroht fühlen; Gefühle der Unzulänglichkeit führen eher zur Bedrohungsbewertung (vgl. Lazarus 2005: 239). Solche Beurteilungen und die persönliche Bedeutung, die eine Person einer gestörten Person-Umwelt Beziehung beimisst, stellen den zentralen kognitiven Unterbau des Bewältigungshandelns dar (vgl. Lazarus 2005: 238). 29 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Bewältigung wird als fortwährend sich wandelnde kognitive und verhaltensbezogene Anstrengung beschrieben, um bestimmte externer und/oder interner Anforderungen zu handhaben, die von den betroffenen Menschen als Ressourcen belastend oder überlastend bewertet werden (vgl. Lazarus 2005: 239 f.). Laut Lazarus gibt es keine Bewältigungsstrategie, die unter allen Umständen effektiv oder ineffektiv wäre. Die Effektivität jeder Bewältigungsstrategie ist kontextbezogen und hängt von der Person selbst, vom Belastungsgrad, von der Art der Bedrohung ab. Sie hängt weiters von der Form des angestrebten Resultats ab, also davon, ob es sich um subjektives Wohlbefinden, soziale Funktionsfähigkeit oder körperliche Gesundheit handelt (vgl. Lazarus 2005: 240). Es gibt zwei Hauptfunktionen der Bewältigung, die Lazarus als problemfokussiert und emotionsfokussiert bezeichnet (vgl. Lazarus 2005: 242). Beide Funktionen sollten aber nicht einfach als eigenständige Typen des Bewältigungshandelns verstanden werden, denn diese können sich durchaus wechselseitig bedingen (vgl. Lazarus 2005: 243). Außerdem macht es keinen Sinn, die eine Funktion als nützlicher zu bezeichnen als die andere, sondern es ist das „Zusammenwirken von Denken, Wollen, Gefühlen, Handeln und den Realitäten der Umwelt, das darüber entscheidet, ob die Bewältigung zum Erfolg führt oder nicht“ (Lazarus 2005: 244). Die emotionsfokussierte Funktion der Bewältigung zielt laut Lazarus „darauf ab, die mit der Stresssituation verbundene Emotion zu steuern, indem man es beispielsweise vermeidet, über die Bedrohung nachzudenken, oder indem man sie neu bewertet, ohne die belastende Situation selbst zu verändern“ (Lazarus 2005: 242). Solche Bewältigungsstrategien zielen auf eine subjektiv empfundene bessere Befindlichkeit ab, beeinflussen den Stressor (vorerst) nicht und können beispielsweise Aktivitäten, wie Alkoholgebrauch bzw. Drogeneinnahme sein (vgl. Zimbardo/Gerrig 1999: 383). Infolge solcher Bewältigungsversuche kann es auch zu Neubewertungen der Situation kommen, etwa weil wegen der Handlungen der Person sich die Problemlage verändert hat oder durch Nachdenken neue Bewältigungsstrategien entdeckt wurden (vgl. Jerusalem 1990: 11 f.). Speziell aufgrund von Rückmeldungen kann es nun zu einer neuerlichen kognitiven Bewertung kommen, die sich inhaltlich nicht von den primären und sekundären Bewertungen unterscheiden (vgl. Jerusalem 1990: 13 f.). Der Stressor kann durch 30 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Neubewertungen wirksam bewältigt werden, es kann zu neuen Bewältigungsstrategien kommen oder die Person hält (trotz negativer Rückmeldung) an der ursprünglichen Bewältigungsstrategie fest (vgl. Lazarus 2005: 242 f.; vgl. Jersualem 1990: 14; vgl. Zimbardo/Gerrig 1999: 376). 1.2.4 Klinische Sozialarbeit Klinische Sozialarbeit versteht sich als Sozialarbeit, die bei Krankheiten, Behinderungen oder psychosozialen Krisen gefordert ist, wobei die Arbeit im Krankenhaus ein Element klinischer Sozialarbeit darstellt (vgl. Ansen/Gödecker-Geenen/Nau 2004: 18). Sie ist bei der Frage nach der Entwicklung einer Abhängigkeit auf theoretische Konzepte und Modelle ihrer Bezugswissenschaften angewiesen (vgl. Pauls 2004: 35). Klinische SozialarbeiterInnen müssen in einem multiprofessionellem Team mit anderen Professionen kommunizieren können, und daher auch Ergebnisse anderer Disziplinen über biologische und psychische Aspekte von Erkrankungen zur Kenntnis nehmen (vgl. Homfeldt/Sting 2006: 199). Klinische Sozialarbeit hat daneben den Anspruch ihren Ort in der Lebenswelt ihrer KlientInnen zu haben und ihre Praxis über Aushandlungsprozesse mit den Betroffenen zu organisieren (vgl. Dörr 2005: 87). Aufgrund der grundsätzlichen Einmaligkeit jedes Menschen können psychische oder psychosoziale Phänomene wissenschaftlich nur statistisch zusammengefasst werden. Eine zusammenfassende Beurteilung mehrerer Individuen erlaubt schließlich die Erarbeitung von Typen und bestimmter Charakteristika, die aber nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Individuum gelten können (vgl. Lempp 1996: 52). Der Kasuistik geht es hier um den normativen, beurteilungs- und entscheidungsrelevanten Gehalt eines je besonderen Falls (vgl. Hörster 2006: 61). Aus ihrem Verständnis heraus, erklärt klinische Sozialarbeit die Anfälligkeit für eine Krise, Störung oder Krankheit aus einer biopsychosozialen Perspektive als das „Ergebnis einer Störung des Zusammenspiels von sozialem Zusammenleben (und sozialen Regeln) mit dem individuellen (psychologischen) Erleben und Verhalten und der leiblichen (biologischen) Existenz“ (Pauls 2004: 35). Bei der Ursachenklärung orientiert sie sich also an dem Zusammenwirken von Faktoren auf diesen drei Ebenen. Dabei sieht sie in der Ent31 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch stehung von Krankheiten einen Zusammenhang mit einem Mangel an sozialer Zuwendung und psychosozialem Wohlbefinden und spricht sich für eine stärkere Integration der sozialen Dimension im Gesundheitswesen aus (vgl. Pauls 2004: 45). Die soziale Dimension muss zwar stärker verankert werden, darf aber auch nicht dazu führen, dass soziale Probleme zwar thematisiert, der Lösungsansatz aber wiederum am einzelnen Individuum festgemacht wird (vgl. Homfeldt/Sting 2006: 200). Klinische Sozialarbeit spricht sich gegen einen Reduktionismus auf eine der drei Ebenen aus, auch gegen den Reduktionismus auf soziale Faktoren. In der Entstehung von Störungen orientiert sich klinische Sozialarbeit eng an entwicklungspsychologischen Grundlagen. Dabei wird der Mensch als ein (mit-)konstruierendes Subjekt gesehen, das aktiv seine Umwelt entdeckt und strukturiert. In Verbindung mit systemischem Denken bedeutet das, dass der Mensch und seine Umwelt ein Gesamtsystem bilden, in dem beide aktiv und in ständiger Veränderung sind. Dabei führen Veränderungen in einem Teil zu Veränderungen in anderen Teilen und im Gesamtsystem, und diese wirken wiederum auf den ersteren zurück (vgl. Pauls 2004: 56). Eine Schwierigkeit in der klinischen Sozialarbeit im Bereich von Krankenhäuser ist, dass das medizinische Krankheitsmodell von Sucht, an dem sich viele SozialarbeiterInnen im Krankenhaus orientieren (müssen), vielfach im Widerspruch zu Aussagen vieler als süchtig klassifizierten Menschen steht. Diese subjektiven Aussagen lassen sich nicht mit der äußeren Beurteilung ihres Zustands vereinbaren. Die Diskrepanz zwischen medizinischem Wissen und der erfahrenen Wirklichkeit und der empfundenen Normalität auf Seiten der Betroffenen, wird häufig als ein Verlust einer Selbsteinschätzung gedeutet und führt zur Interpretation, die diese Fehleinschätzung als Teil der psychischen Störung und damit als Krankheit definiert (vgl. Wolf 2003: 94). Eine Kasusitik, in der sich Relevanzen eines Einzelfalls auf unterschiedlichen Ebenen reflektieren lassen, sollte weg von einer Überbetonung der „Naturgesetzlichkeit“ der Medizin, hin zu einer stets situativ erkundenden Besonderheit des Kommunikations- und Behandlungsprozesses kommen (vgl. Hörster 2006: 61). 32 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch 1.2.5 Typologien und Verlaufsformen Typologie und Verlaufsform nach Jellinek Typologien versuchen alkoholabhängige Menschen nach unterschiedlichen Gesichtspunkten zu klassifizieren. Jellinek gilt als ein Pionier der Alkoholismusforschung, der durch seine Auswertung von 2000 Erfahrungsberichten in den 1960er Jahren den für die Versicherungsträger relevanten Krankheitscharakter von Alkoholismus begründete, und auf dessen Basis er ein Phasenmodell entwickelte (vgl. Tretter 1998: 130). Jellineks Typologie und Phasenmodell genießen auch in Österreich die weiteste Verbreitung in der Arbeit mit alkoholabhängigen Menschen (vgl. Feuerlein et al. 1998: 205). Jellinek unterschied neben NichttrinkerInnen und AlkoholkonsumentInnen eben auch alkoholabhängige Menschen, die er in fünf Typen von Alpha - Epsilon einteilte (vgl. Preinsberger 2004: 167). : • Alpha-Typ (Konflikttrinker) • Beta-Typ (Gelegenheitstrinker) • Gamma-Typ (süchtiger Trinker) • Delta-Typ (Gewohnheitstrinker) und • Epsilon-Typ (Quartaltrinker). Bei vielen Studien haben sich laut Feuerlein et al. zumindest die Unterteilungen in Gamma- und Delta-Typ bewährt und bestätigt (vgl. Feuerlein et al. 1998: 205). Verschiedene innere und äußere Bedingungen sollen zu diesen Trinkmustern führen. Beim Delta-Typ sind die gute Verfügbarkeit und der soziale Aufforderungscharakter etwa durch FreundInnen oder ArbeitskollegInnen ausschlaggebend für die Suchtentwicklung (vgl. Tretter 1998: 130). Dieser Typ trinkt gerne den ganzen Tag über, ihm wird aber dennoch die Fähigkeit zur Abstinenz zugesprochen (vgl. Preinsberger 2004: 167). Verschiedene Berufsgruppen, wie KellnerInnen, GastwirtInnen oder BerufsfahrerInnen sollen besonders oft dieses Trinkmuster entwickeln (vgl. Tretter 1998: 130). Psychische und physische Schäden treten bei diesem Typ eher schleichend auf und ein so genanntes Ent33 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch zugssyndrom kann z.B. erst bei einem alkoholbedingten Unfall auftreten (vgl. Tretter 1998: 130). Beim Gamma-Typ wurde eine hypothetische und empirisch unzureichend bestätigte Rekonstruktion der Verlaufsphase entwickelt (vgl. Tretter 1998: 131). Diese Phaseneinteilung wurde kritisiert, da die Symptome nicht immer nacheinander, sondern auch gleichzeitig auftreten können. Dennoch findet diese Phaseneinteilung in der Praxis der Arbeit mit alkoholabhängigen Menschen Verwendung (vgl. Feuerlein et al. 1998: 209). Jellinek teilte den Verlauf zur Entwicklung eines süchtigen Trinkverhaltens (GammaTyp) in vier Phasen ein: • präalkoholische oder voralkoholische Phase, • prodromal oder Anfangsphase, • kritische Phase und • chronische Phase. Die voralkoholische Phase ist gekennzeichnet von einem Stadium positiver Trinkerfahrungen, die nach Steigerung der Alkoholmenge zur Entwicklung einer Alkoholtoleranz führt. Schließlich nehmen negative Konsequenzen des Trinkens zu und der Alkohol wird subjektiv immer bedeutsamer (vgl. Tretter 1998: 131). In der Anfangsphase entwickeln sich so genannte Gedächtnislücken selbst ohne Alkohol konsumiert zu haben. Durch Schuld- und Schamgefühle kommt es häufiger zu heimlichem Trinkverhalten, das wiederum Erleichterung für negative Gefühle verschafft (vgl. ebd.). In der kritischen Phase kommt es zu einem Kontrollverlust. Der abhängige Mensch ist nun nicht mehr in der Lage mit dem Trinken aufzuhören und der Alkohol wird zum Hauptthema (vgl. Tretter 1998: 130f.). In der chronischen Phase wird das regelmäßige Trinken zur Vermeidung von Entzugserscheinungen notwendig. Hier treten unter anderem immer öfter depressive Störungen, Angstzustände oder Halluzinationen auf, die Betroffene aber nicht davon abhalten, weiter exzessiv alkoholische und alkoholhältige Substanzen zu sich zu nehmen. Das soziale Le34 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch ben ist geprägt von einem starken Abbau und in der Öffentlichkeit gelten erst Menschen in diesem Stadium als AlkoholikerInnen („SandlerInnen“), obwohl dieses Stadium oft schon ein Endstadium bedeutet (vgl. Tretter 1998: 132). Weitere Typologien Simmel etwa unterschied 1948 aus psychoanalytischer Sicht vier verschiedene Gruppen von chronischen Trinkern (vgl. Jansche 2003: 108). Der soziale Trinker könne ohne Alkohol aufgrund des Triebverzichts ohne entsprechende Sublimierungsmöglichkeiten schwer kommunizieren. Durch das Trinken werden bei ihm auch Gefühle der Unzufriedenheit unterdrückt (vgl. ebd.). Der reaktive Trinker will durch den Alkoholkonsum einer unangenehmen Realität entkommen. Damit möchte er ein künstliches Glück erleben (vgl. ebd.). Der neurotische Trinker flieht letzten Endes vor sich selbst. Die neurotischen Konflikte werden auf den Ödipuskomplex zurückgeführt. Damit will dieser Typ gegen Kastrationsängste ankämpfen und hat den Wunsch, die von den Eltern unterdrückte Lust der infantilen Onanie wiederzuerlangen (vgl. ebd.). Schließlich wird hier noch die „echte Alkoholsucht“ beschrieben. Dabei kommt es zum Zerfall der Ichfunktion, zur Realitätsverleugnung, zum Verlust der Selbstkontrolle, der Freisetzung von Hass und dessen Reintrojektion mittels Selbstzerstörung (vgl. Jansche 2003: 108f.). Cloninger et al. entwickelten eine zwei Typen Einteilung, die von genetischen, altersmäßigen, psychischen und anderen sozialen Faktoren bestimmt ist (vgl. Preinsberger 2004: 168). Schuckit entwickelte 1985 eine interessante Unterscheidung in Subtypen von primärem und sekundärem Alkoholismus. Beim primären Alkoholismus entwickle sich eine Alkoholabhängigkeit vor dem Auftreten anderer psychiatrischen Störungen. Beim sekundären Alkoholismus entwickle sich eine Alkoholabhängigkeit aufgrund psychiatrischer Grunderkrankungen (vgl. ebd.). Auch die Typologie nach Lesch sieht in seinem vier Typen Modell aus den 1990er Jahren im Typ II etwa die Alkoholeinnahme als Bewältigungsstrategie bei Konflikten und als Selbsttherapie bei Angst und Unruhe. Bei Typ III wird das Thema behandelt: „Alkoholeinnahme zur Behandlung psychiatrischer Zustandsbilder“. Hier nimmt er an, dass Alko- 35 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch holeinnahme als Selbstmedikation z.B. bei affektiven Störungen verwendet wird (vgl. ebd.). Die Typologie nach Barbor et al. schlägt auch eine Einteilung in zwei Typen vor, die ähnlich wie Cloninger et al. in altersmäßig frühen und spätem Beginn bzw. schlechten und guten Verlauf unterscheiden (vgl. Preinsberger 2004: 168f.). Aus Typologien wie den eben vorgestellten, wurden unter anderem verschiedene Screeninginstrumente bzw. Fragebogentest entwickelt, die ein mögliches Alkoholproblem, das klinische Relevanz besitzt, aufzeigen sollen (vgl. Preinsberger 2004: 169). Bei den betrachteten Typologien hat sich die Typologie von Jellinek besonders durchgesetzt, die auch die Diagnosekriterien der Alkoholabhängigkeit (Alkoholabhängigkeitssyndrom) beeinflusst hat. An dieser Stelle sollte aber bedacht werden, dass es einen klaren Unterschied zwischen sprachlicher Beschreibung von Typologien oder Diagnosen und Verhalten gibt, ähnlich wie der Unterschied zwischen Speisekarte und Essen oder zwischen Landkarte und Landschaft (vgl. Simon 2002: 167). In sprachlichen Beschreibungen ist ein relativ hohes Maß an Eindeutigkeit erreichbar, das Verhalten aber bleibt stets vieldeutiger. Die binäre Unterscheidung (alkoholabhängig - nicht alkoholabhängig) in der sprachlichen Beschreibung verneint all das, was außerhalb der Grenzen solcher Unterscheidungen liegt. Gekonnte Formen von Abhängigkeit sind denkbar, wenn sie eingebettet sind in andere Formen der Lebensbewältigung (vgl. Thiersch 1995: 125). Das unbedingte Gebot zur selbstgelebten, absoluten Alkoholabstinenz bei alkoholabhängigen/depressiven Menschen verliert somit für mich seine Gültigkeit (vgl. Schlösser 1990: 32). In einer sich veränderten Welt, die stark von Phänomenen wie Individualisierung und Pluralisierung (Beck 1986) geprägt ist, sollte es doch auch bezüglich der Therapieangebote einen Platz geben, in dem sowohl Abstinenz als auch begrenzte und kontrollierte Trinkformen gleichwertig gegenüberstehen. Das Leben betroffener Menschen kann mitunter auch mit depressiven oder melancholischen Aspekten lebbarer werden (vgl. Lempke 1990: 22f.). Aus einer Statik voraussetzenden Begrifflichkeit entwickeln sich Paradoxien, wie die Verwechslung von Speisekarte und Essen. Das Hilfszeitwort „sein“ sollte auch in der 36 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Diagnostik verboten werden, denn es ist nichts auf unserer Welt, alles wird und vergeht (vgl. Simon 2002: 171 ff.). 1.3 Gesellschaft und Alkohol Subjektive Bewältigungsstrategien, die auch mit dem Risiko des Scheiterns verbunden sein können, werden von einer individualisierten und pluralisierten Gesellschaft nahezu herausgefordert (vgl. Böhnisch 2001b: 30). Alkoholgebrauch in all seinen Ausprägungen ist demnach nur vor dem Hintergrund einer „süchtigen Gesellschaft“ (Thiersch 1995: 119 ff.) zu sehen. Alkoholgebrauch verweist vor diesem Hintergrund auf ein spezielles Deutungs- und Handlungsmuster, das als ein Moment im Bündel an Lebensbewältigungsstrategien zu sehen ist. Schließlich kann aber diese ursprünglich zur Bewältigung des Alltags dienende Strategie alle anderen Strategien herabsetzen, entwerten und so dominant werden. Letztendlich wird dadurch die Bewältigung der alltäglichen Lebensaufgaben verunmöglicht und der Alkoholkonsum zum alles beherrschenden und (lebens)bedrohlichen Faktor in der Existenz (vgl. Reinl/Füssenhäuser/Stumpp 2004: 175). Parsons definiert Gesellschaft „als den Typ eines sozialen Systems, dessen Kennzeichen ein Höchstmaß an Selbstgenügsamkeit (self-sufficiency) im Verhältnis zu seiner Umwelt, einschließlich anderer sozialer Systeme, ist“ (Parsons 2003: 16). Der Kontext gesellschaftlicher Selbstgenügsamkeit betrifft die Gesellschaft als Handlungssubsystem, die physische Umwelt und die individuelle Persönlichkeit der Mitglieder. Eine Gesellschaft ist also in diesem Sinne nur selbstgenügsam, als sie auf einen angemessenen Beitrag ihrer Mitglieder zum Funktionieren der Gesellschaft zählen kann (vgl. Parsons 2003: 17). Welche Typen des sozialen Systems wünschenswert sind, hängt von jeweiligen Wertmustern oder kollektiven Vorstellungen ab. Für Parsons definiert der Konsens der Mitglieder über die Wertorientierung bezüglich ihrer Gesellschaft, die Institutionalisierung von Wertmustern (vgl. ebd.). Gesellschaft ist dabei evolutionären Wandlungsprozessen, einer „ fortschreitenden Entwicklung zu höheren Systemstufen“ ausgesetzt (Parsons 2003: 40). Laut Parsons befinden sich komplexe Gesellschaften in fortwährendem Wandel (vgl. Scheuch 2003: 210). 37 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Unsere heutige Gesellschaft ist von der Auflösung vorgegebener sozialer Lebensformen geprägt, das Individuum ist außerdem durch neue institutionelle Anforderungen, Kontrollen und Zwänge herausgefordert, ein eigenes Leben zu führen, etwas zu tun, sich aktiv zu bemühen mit all den Bedeutungen und Folgen dieses Strukturwandels für das Individuum und die Gesamtgesellschaft (vgl. Beck/Beck-Gernsheim 1994: 11 ff.). Daraus ergibt sich für die Soziale Arbeit die Notwendigkeit, von der traditionellen Normbindung und Fixierung auf abweichendes Verhalten wegzugehen, hin auf eine eigenständige, und bezogen auf eine sich in stetigem Wandel befindlichen gesellschaftlichen Wirklichkeit, angemessene Interpretation bestimmter Phänomene (vgl. Böhnisch 2001b: 30). Aus dem gesellschaftlichen Wandel heraus ergeben sich „riskante Freiheiten“ (Beck/Beck-Gernsheim 1994). Menschen riskieren psychosoziale Grenzerfahrungen, es ergeben sich psychosoziale Modernisierungsrisiken, wie: Sinnkrisen, Orientierungsverlust, Ausstieg in die Innerlichkeit oder Flucht in neue Lebensphilosophien, existentiell bedrohte Lebenskrisen, Trauer, Schmerz, quälende Ungewissheiten oder extensiver, Lebensressourcen zerstörender Alkoholgenuss (vgl. Rauschenbach 1992: 38 f.). Normalität pluralisiert sich scheinbar, „bis sie als durchschnittlicher Orientierungsmaßstab, an dem man glaubt, sich anlehnen zu können, von dem man sich aber auch stilisiert absetzen kann, von selbst verschwindet“ (Rauschenbach 1992: 39). „Abweichendes Verhalten“ bekommt dadurch eine andere Bedeutung. Solches Verhalten weist laut Böhnisch als öffentlich etikettiertes und sanktioniertes Verhalten auf ein Bewältigungsverhalten hin, das als subjektives Streben nach Handlungsfähigkeit und psychosozialer Balance in kritischen Lebenssituationen und -konstellationen hinweist (vgl. Böhnisch 2001: 11). Wenn aber „abweichendes Verhalten“ als eine Übertretung von einer von anderen definierten Norm und in weiterer Folge als Symptom eines Willendeffektes, das einen Normalwillen postuliert, interpretiert wird, ergibt sich eine große Problematik mit diesem Begriff Wenn schon von devianten oder dysfunktionalen Verhalten gesprochen wird, müsste fairerweise der Bemessungsmaßstab offen gelegt werden, von dem aus ein Verhalten disqualifiziert wird oder nicht (vgl. Seubert 2005: 66). Die Begriffe „alkoholkrank“, „Alkoholikerin“ und im weiteren Sinne auch „Alkoholismus“, „Alkoholabhängigkeit“ und „süchtige Person“ spiegeln die Gefahren wider, die 38 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch durch den sozialpädagogischen Gebrauch des Begriffes Devianz oder abweichendes Verhalten beleuchtet werden. Durch solche soziale oder kulturelle Stigmata werden Menschen oft stark beeinträchtigt und als von der Norm abweichend gesehen. Der Begriff abweichendes Verhalten weist somit auf die Probleme der sozialen Ächtung und des subjektiven Scheiterns des Bewältigungshandeln hin; zeigt auf wie dünn und zerbrechlich die soziale Bindung des Menschen an die Gesellschaft ist und auch, wie Gesellschaft pathogene Strukturen hervorrufen kann (vgl. Böhnisch 2001: 13f.). Theorien, Erkenntnisse, Ideen, Mythen und Handlungsanleitungen in Bezug auf Menschen mit riskantem Alkoholgebrauch und/oder depressiven Verhalten können sich gesellschaftlich produziert, ideell und praktisch durchsetzen, und wie im Feld der Psychiatrie ersichtlich, zu hegemonialen, also nicht mehr hinterfragbaren Legitimationen werden (vgl. Quensel 2004: 14). Der Umstand, wie unsere Gesellschaft Wissen produziert und verfestigt kann pathogene Strukturen hervorrufen. In diesem Zusammenhang ist die von Watzlawick beschriebene Studie von Rosenhan (1981) „On being sane in insane places“ („Gesund in kranker Umgebung“) bemerkenswert (vgl. Watzlawick 2005b: 89ff.): Rosenhan und einige seiner Mitarbeiter ließen sich im Rahmen eines Abschlussberichtes für ein Forschungsprojekt freiwillig in eine Nervenklinik aufnehmen. Sie gaben vor, Stimmen zu hören und wünschten daher psychiatrische Behandlung. Gleich nach der Aufnahme bekräftigten sie, keine Stimmen mehr zu hören und verhielten sich völlig „normal“. Sie bekamen aber alle die Diagnose „Schizophrenie in Remission“ und niemand von ihnen wurde als Pseudopatient entlarvt. Jede ihrer Verhaltensweisen wurde als weiterer Beweis für die Richtigkeit der Diagnose gewertet. Die Diagnose orientierte sich also nach Watzlawick nicht an beobachtbaren Tatsachen, sondern erschuf eine Wirklichkeit sui generis, die dann alle klinischen Maßnahmen notwendig machte und rechtfertigte (vgl. Watzlawick 2005b: 89). Diese Gefahr bestehen auch bei der Betrachtung der Phänomene des nicht gelingenden Alkoholgebrauchs und depressiven Bewältigungsstrategien. Ein bestimmter Kontext kann aus einem Menschen eine „Alkoholikerin“ oder „Depressive“ machen, nicht nur in der Psychiatrie. Auch bei (angehenden) SozialarbeiterInnen fällt öfters die Tendenz auf, gewisse Verhaltensweisen zu pathologisieren, die dann unter Umständen durch komplexe 39 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Etikettierungsmechanismen im Sinne des labeling approaches Annahmen bestätigen und eigene Realitäten schaffen. Was als normal und abweichend gilt, ist immer nur in bestimmten (gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen) Kontexten denkbar. So kann ein Weinfachmann täglich große Mengen an alkoholischen Getränken zu sich nehmen ohne jemals als alkoholabhängig betrachtet zu werden bzw. alkoholabhängig zu sein. „Es ist einfach sein Beruf, Wein zu trinken“, so eine mögliche Argumentation. Eine arbeitslose Person hat es eigenartigerweise schwerer nicht als alkoholabhängig etikettiert zu werden, wenn sie mittags täglich gerne Bier trinkt. Vielfach liegen solche Meinungen auch in der unreflektierten Annahme begründet, dass Arbeitslosigkeit lediglich als Folge einer Alkoholabhängigkeit, nicht aber auch als dessen Bedingung verstanden wird. Dazu haben wesentlich biologische Theorien, wie das geläufige Modell von Jellinek beigetragen, die leicht dazu verführen, Arbeitslosigkeit oder beruflichen Abstieg nur als Produkt bzw. als soziales Symptom der Alkoholabhängigkeit zu sehen und sie damit zu einem somatisch-medizinischen Problem zu machen (vgl. Henkel 1990: 36). Psychiatrische Diagnosen können eben nur in bestimmten Kontexten gesehen werden Wer in Indien etwa als heilig gilt, kann im Westen leicht als Schizophrener diagnostiziert werden (vgl. Watzlawick 2005b: 90). Ein nicht unbedeutender Faktor in der Entstehung und dem Verständnis von nicht gelingendem Alkoholgebrauch sind die jeweiligen soziokulturellen Rahmenbedingungen und Wertorientierungen. Der gesellschaftliche Umgang mit Alkohol ist in diesem Zusammenhang entscheidend. Die Klassifikation nach D.J. Pittmanns versucht Gesellschaften nach Alkoholkonsumtoleranzen zu klassifizieren, um die Variable der gesellschaftlichen Toleranz für Alkoholabhängigkeit zu diskutieren (vgl. Peters 1995: 62). Diesbezüglich lässt sich moderne Gesellschaft in vier Kulturformen einordnen (vgl. Preinsberger 2004: 163f.). • Abstinenzkulturen: Vor allem in islamischen Kulturkreisen wird darauf beharrt jegliche Herstellung und Genuss von Alkohol zu verbieten. 40 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch • Ambivalenzkulturen: Hier wird der Konsum von Alkohol gewissen örtlichen und zeitlichen Beschränkungen unterworfen und in der Öffentlichkeit beschränkt. Demgegenüber tritt heimliches auch konflikthaftes Trinken, wie etwa zu Hause in den Vordergrund. Die Einstellung zum Alkohol ist hier ambivalent (Länder wie England oder einige skandinavische Länder). • Permissivkulturen: Der Genuss von Alkohol ist weit verbreitet und erlaubt, jedoch werden „abweichender“ Alkoholgebrauch und seine negativen Konsequenzen abgelehnt und tabuisiert. Fast die gesamte Bevölkerung trinkt Alkohol in kleineren Mengen, vor allem Wein. Alkoholgebrauch ist kulturell eingebettet und wird meist mit Mahlzeiten assoziiert (mediterrane Länder wie etwa Italien). • Permissiv-funktionsgestörte Kulturen: Hier wird auch exzessives Trinken gebilligt. In reiner Form soll dieser vierte Typ nicht vorkommen, einige Länder, wie unter anderem auch Österreich oder Deutschland dürften eine Mittelstellung zwischen den beiden letztgenannten Kulturformen einnehmen. In der westlichen Kultur konnte sich im Gegensatz zu etwa einigen islamischen Ländern die Droge Alkohol durchsetzen und somit den Status der Legalität bewahren (vgl. Tretter 1998: 202). In Österreich gibt es immer wieder Anlässe wo auch exzessiver Alkoholgebrauch gebilligt, ja teilweise sogar wünschenswert ist (Faschingssitzungen, Studententreffs, Konzerte, Geburtstagesfeiern, Weihnachtsfeiern, Sylvester, Feuerwehrfeste etc.). In Österreich ist Alkoholkonsum fester Bestandteil der Alltagskultur und es besteht ein relativ freier Markt für alkoholische Getränke, deren Distribution kaum geregelt ist. Alkohol ist relativ günstig zu bekommen und praktisch rund um die Uhr erhältlich (vgl. Preinsberger 2004: 159). Organisierte Trinkexzesse bleiben als fester Bestandteil unserer Kultur erhalten. In diesem Zusammenhang erinnere ich nur an das Münchner Oktoberfest oder andere Feste mit Rauschgelagen (vgl. Tretter 1998: 207). Dennoch wird in der Öffentlichkeit exzessives Alkoholtrinken zwiespältig gesehen. Diese „doppelbödige“ Haltung erinnert an den Bacchuskult bei den Römern. Auch hier wurden neben der positiven Darstellung des Trinkens auch bereits Auseinandersetzungen wegen der Trunksucht als Laster und Problem geführt (vgl. Preinsberger 2004: 158). Die Kulturgeschichte des Alkohols reicht vermutlich schon bis etwa 7000 v. Chr. zurück (vgl. Preinsberger 2004: 157). Seit diesem Zeitpunkt spielt der Alkohol in verschiedenen Ge41 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch sellschaften und Kulturen eine bedeutende Rolle als Genuss- und Rauschmittel bei kultischen, religiösen und sonstigen gesellschaftlichen und privaten Anlässen. Dabei ist die Einstellung zum Alkohol meist ambivalent und reicht von Verherrlichung bis zum Verbot und Strafe für Alkoholgebrauch. Wenn Österreich eine Mittelstellung zwischen einer permissiven und einer permissivfunktionsgestörten Kultur einnimmt, so wäre Alkoholabhängigkeit hierzulande kein Normbruch. AlkoholismusforscherInnen orientieren sich kaum noch an der These, dass Alkoholabhängigkeit eine Reaktion auf exzeptionelle soziale Bedingungen ist, vielmehr stehe die Situationsabhängigkeit im Vordergrund (vgl. Peters 1994: 62). Bislang ist es aber noch nicht gelungen, die soziale Verteilung alkoholkonsum- und alkoholabhängigkeitsbegünstigender Situationen zu empirisch ermittelten überrepräsentierten Merkmalen, wie „Männer sind unter AlkoholikerInnen überrepräsentiert“ ins Verhältnis zu setzen (vgl. Peters 1995: 63). Nicht gelingender Alkoholgebrauch ist also kein Phänomen, das erst in der Risikogesellschaft (Beck 1986) aufgetreten ist und lässt sich auch nicht nur mit dem Phänomen der Individualisierung und Pluralisierung erklären, obwohl Individualisierungsprozesse riskante Handlungsmuster und -konstellationen scheinbar notwendig machen (vgl. Beck/Beck-Gernsheim 1994: 12ff.). Von daher ist für unsere heutige Gesellschaft Individualisierung und Pluralisierung der Lebensformen durchaus von Bedeutung. Individualisierung meint die Auflösung vorgegebener sozialer Lebensformen und neue institutionelle Vorgaben mit dem besonderen Aufforderungscharakter, ein eigenes Leben zu führen. Das Individuum wird in eine neue, unbekannte Freiheit von Wahlmöglichkeiten für die Gestaltung seiner eigenen Biografie gestoßen und verantwortlich gemacht. Individualisierung bedeutet dabei keineswegs einen gesellschaftsfreien Raum, sondern ist eben durch eine starke Regelungsdichte der modernen Gesellschaft gekennzeichnet (vgl. Beck/Beck-Gernsheim 1994: 12). Die Pluralisierung der Lebenslagen ist gekennzeichnet durch unterschiedliche Vorraussetzungen und Ungleichheiten, die Optionen, Chancen und Grenzen bezüglich dieser Wahlmöglichkeiten zur Teilhabe an der gesellschaftlichen Entwicklung aufzeigen (vgl. 42 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch BfJFFG 1990: 28ff.). Individualisierung und Pluralisierung machen den eigenen Lebensplan zu einem riskantem Projekt: Aus einer Vielzahl von Möglichkeiten müssen sich Menschen zurecht finden und diese individuellen riskanten Freiheiten sich selbst und anderen gegenüber verantwortlich nutzen (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2002: 171). In unserer heutigen Gesellschaft müssen die Chancen, Gefahren und Unsicherheiten der Biografie nun von den einzelnen selbst wahrgenommen, interpretiert, entschieden und bearbeitet werden (vgl. Beck/Beck-Gernsheim 1994: 15). Durch diese neuen Unsicherheiten fühlen sich immer mehr Menschen überfordert, belastet oder gekränkt (vgl. Thiersch 1995: 126) und entwickeln riskante, dominant werdende Bewältigungsmuster, nehmen z.B. Zuflucht zur vermeintlichen Sicherheit des Alkohols oder ziehen sich von diesen neuen, gesellschaftlich konstruierten, vorgegebenen Anforderungen ganz zurück und entwickeln so die für Depressionen typischen Verhaltenssymptome (vgl. Hammen 1999: 12). Die Alkoholabhängige gilt wie andere Drogensüchtige als diejenige, die „die Grenzen zwischen „alles ist möglich“ und „alles ist erlaubt“ überschreitet (Ehrenberg 2004: 263f.). Sie radikalisiert die Figur des freien Individuums und steht symbolhaft dafür, dass der zeitgenössische Individualismus der Triumph des privaten Menschen, wenn auch des tief unglücklichen ist (vgl. Ehrenberg 2004: 264ff.). Modernes Leben ist durch verschiedene gesellschaftliche Prozesse, etwa durch die spezialisierte Funktion der Arbeitsteilung in hohem Maße segmentiert. Die Lebenswelt setzt sich aus verschiedenen Lebensfeldern, Lebensräumen und den damit verbundenen entsprechenden Rollen und Funktionen zusammen, in denen unterschiedliche Lebenskonstellationen und individuelle Lebensentwürfe riskiert und ausgehandelt werden müssen (vgl. Grunwald/Thiersch 2004: 20ff.). Aus diesen unterschiedlichen, zerstückelten Lebensentwürfen heraus, haben die Menschen das Bedürfnis nach Kohärenz, das Bedürfnis ihr Leben als sinnstiftende Einheit zu sehen (vgl. Grunwald/Thiersch 2004: 22). Thiersch konstatiert, dass in unserer Gesellschaft Belastungen und Herausforderungen vielfältig angelegt sind und nicht gelingender Alkoholgebrauch, wie auch andere Aufgaben und Schwierigkeiten der Lebensbewältigung, sich aus den Strukturen der modernen Gesellschaft ergeben (vgl. Thiersch 1995: 126). Unsere Gesellschaft ist bestimmt als eine 43 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch Gesellschaft der Ungleichheiten im Hinblick auf Arbeitstrukturen, Geschlecht oder Generationen. Weiters ist sie bestimmt durch das Gewicht von Großorganisationen und großräumigen Regelungen, die Funktionalität und Rationalität ihrer Mitglieder fordern und die Konkurrenzanstrengungen notwendig erscheinen lassen, um sich in ihr zu behaupten und durchzusetzen (vgl. Thiersch 1995: 127). Dabei zielen die Lebensverhältnisse auf Individualisierung der Lebensführung und Pluralisierung der Lebenslagen hin, die die Menschen zu „riskanten Freiheiten“ (Beck/Beck-Gernsheim 1994) führen (vgl. Thiersch 1995: 127). Einerseits provoziert unsere Gesellschaft durch Frustrationen und Desorientierungen den Alkoholgebrauch, andererseits legt sie ihn sogar nahe, weil sein Gebrauch auch positiv bestärkt wird (vgl. Thiersch 1995: 129). Selbst im Hinblick auf die Gesundheitskosten, die sich aus den Folgeschäden durch den Alkoholgebrauch für die Gesellschaft ergeben, bleibt etwa Bier aus wirtschaftstheoretischer Sicht als Billigware einer der wichtigsten „Einstiegsdrogen“ (vgl. Tretter 1998: 235). Die Politik gegenüber illegalen Drogen entpuppt sich angesichts der schwachen staatlichen Regulationen für Bedingungen des Alkoholgebrauchs nur als ein unberechtigt übertonter Nebenschauplatz (vgl. ebd.). Illegale Drogen werden so zu Sündenböcken für das Elend von Abhängigkeit und Kontrollverlust in der ganzen Breite von Suchtproblemen (vgl. Thiersch 1995: 132). Politik und öffentliche Verwaltung scheinen mit der Industrie durch bestimmte Interessen verwoben zu sein − das zeigt sich beispielsweise in der Werbung für alkoholische Getränke. Die Werbung gibt vor und suggeriert, dass nur die „Dummen“ ihre Chance versäumen. Angebote zu einem angenehmen und attraktiven Leben werden von KonsumentInnen erwartet und genutzt, für gesundheitliche Probleme sind sie dann aber selbst verantwortlich und es wird von ihnen erwartet diese in sozialverträglicher Form zu bekämpfen (vgl. Thiersch 1995: 129 f.). Unsere Gesellschaft ist laut Thiersch im Glauben an das Machbare, Verfügbare, an das Herstellbare gegründet. So ist es auch nicht verwunderlich, geplant und gezielt gewisse Kompetenzen, Erlebnisse und Stimmungen durch den Gebrauch von Alkohol herbeiführen zu wollen. Alkoholgebrauch erscheint als „charakteristische Spielart des typisch modernen Konzepts von Lebensbewältigung“ (Thiersch 1995:130). 44 2. Depressive Bewältigungsstrategien 2. Depressive Bewältigungsstrategien Der Philosoph Wilhelm Schmid beschreibt in seinem Buch „Philosophie der Lebenskunst“, dass Melancholie in der Welt der Wissenschaft nie besonders geschätzt wurde, „da sie, zweifelnd an allem, den Optimismus des „Wissens“ nicht teilte“ (Schmid 1998: 391). In der modernen Gesellschaft kam es aufgrund sich wandelnder gesellschaftlicher Interessen zu einem Bedeutungswandel der Melancholie, als einem Zustand, der gefährlich und daher zu vermeiden ist. Im ausgehenden 20. Jahrhundert gilt die Melancholie nun als Krankheit der Depression, um deren Heilung unzählige Therapeuten bemüht sind. Schmid beschreibt Melancholie als gesellschaftliches, kulturelles Phänomen, deren Symptome dann auftreten, wenn der menschliche Anspruch ins Maßlose getrieben wird. Der Rückzug wird als eine Alternative zu einem blinden Aktivismus gesehen (vgl. Schmid 1998: 386). Melancholie ist laut Schmid unter anderem eine Rückbesinnung und Sehnsucht auf eine auch in der Kindheit erlebte, innerliche Kultur des Raumes, in einer vom Fortschrittsschub und Erwachsensein geprägten Kultur der Zeit, gekennzeichnet durch eine leise Trauer über den verlorenen Raum. Somit wird die Melancholikerin als ein Subjekt einer Lebenskunst aufgefasst, die auf der Suche nach dem wahren Leben ist, aber keinen Anspruch auf eine letzte Wahrheit hat und skeptisch gegen Hoffnungen auf das große Glück ist. Eine Melancholikerin kann in der Zeit nicht leben und findet in ihren Widersprüchen eher nur Leiden (vgl. Schmid 1998: 387). Eine Melancholikerin ist von der Lächerlichkeit und Vermessenheit der Phänomene der Individualisierung und Pluralisierung, oder wie Schmid es ausdrückt, vom Anspruch des Subjekts auf Selbstmächtigkeit und eigene Lebensführung überzeugt und geht davon aus, dass im Grunde alles ohne Grund und bedeutungslos ist (vgl. Schmid 1998: 387 ff.). Heutzutage, in einer krampfhaft optimistischen Kultur der universellen Information und Kommunikation, wird trotz psychiatrischer Krankheitszuschreibungen der Depressionen ein Bedürfnis spürbar, „die Melancholie wieder zum Bewusstsein von der Nichtigkeit der Welt zu erheben“ (Schmid 1998: 391). Schmid will dabei die Melancholie als eine Form reflektierter Lebenskunst auffassen, ohne sie therapieren zu wollen, aber ihr doch etwas zu geben, um sie lebbarer zu machen (vgl. Schmid 1998: 391 f.). 45 2. Depressive Bewältigungsstrategien Besonders auch in der Malerei, Musik oder der Literatur bringen Menschen ihre Schwermütigkeit, ihre Angst und zugleich ihre Sehnsucht und ihr Potential zum Ausdruck, sei es um ihr Leben mit der Melancholie zu bewältigen, sei es um damit gegen sie anzukämpfen. Steinhilper erinnert in diesem Zusammenhang an Tschaikowsky, Schubert oder Debussy, an Munchs oder Dürers „Melancholia“, oder an die Schriftsteller Greene oder Burger (vgl. Steinhilper 1990: 9). Die Melancholie hat laut Ehrenberg ein doppeltes Schicksal: Einerseits ist sie ein Charakteristikum des genialen Menschen und seit der Romantik Symbol für Erhabenheit und Tragik einer Künstlerin. Andererseits, was „normale“ Menschen betrifft, ist sie eine Krankheit (vgl. Ehrenberg 2004: 31). So genannte negative Gefühle oder Gedanken werden von Teilen der Gesellschaft oft entwertet. Positive und negative Gefühle als solche positiv oder negativ und damit als erstrebenswert bzw. nicht erstrebenswert zu bezeichnen, halte ich für unangemessen. Eine traurige, niedergedrückte Stimmung hat ebenso wichtige Aussagekraft wie eine freudige Stimmung und ist Teil des Lebens (vgl. Steinhilper 1990: 14). Eine Melancholikerin, so Ehrenberg, flüchtet nicht vor ihrer Krankheit, sondern bejaht sie und zieht ihren Nutzen und ihr Ansehen daraus (vgl. Ehrenberg 2004: 32). Auch Angst ist Teil des Lebens. In Riemanns „Grundformen der Angst“ (2003) beschreibt die Angst vor der Selbstwerdung, erlebt als Ungeborgenheit und Isolierung, eine depressive Persönlichkeitsstruktur (vgl. Riemann 2003: 15). Diese Persönlichkeitsstruktur will als Normalstruktur mit gewissen Akzentuierungen und als ein Teilaspekt eines ganzheitlichen Menschenbildes verstanden werden. Aus dieser können sich allerdings Zerrformen oder Extremvarianten ergeben (vgl. Riemann 2003: 17f.). 2.1 Begriffsklärungen Depressive Störungen zählen in unserer Zeit laut MedizinerInnen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen (vgl. Kronmüller/Mundt 2000: 282). Eine Kenntnis der Depression scheint mir für SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen wichtig in ihrer Arbeit mit psychisch beeinträchtigten Menschen zu sein (vgl. Klosinski 2005: 1446). Hier ist es 46 2. Depressive Bewältigungsstrategien auch wichtig, die Entwicklungen und Ergebnisse verschiedener Disziplinen zu skizzieren und auch kritisch zu beleuchten. Wer als depressiv im Sinne einer medizinischen Diagnose gilt, also psychisch krank ist, kann nicht so eindeutig festgelegt werden. Der psychiatrische Krankheitsbegriff setzt laut Klosinski das Bestehen von Normverhaltensregeln voraus, die bedeutenden (inter)kulturellen und gesellschaftlich konstruierten Schwankungen unterliegen (vgl. Klosinski 2005: 1447). Auch bei der Bewertung von depressiven Störungen spielt das Verhältnis von Normalität und Abweichung eine Rolle. Mit diesen Begriffen werden eigentlich soziale Verhaltensmuster klassifiziert, die als soziale Normen die Moral einer Gesellschaft bilden (vgl. Bettmer 2005: 1). Während Bettmer bereits im 20. Jahrhundert eine zunehmende Autonomie des Subjekts auch gegenüber moralischen Ansprüchen sieht (vgl. ebd.), erkennen Beck/Beck-Gernsheim angesichts fehlender gesellschaftlicher Schranken und Grenzen im Zeitalter der Individualisierung, statt Autonomie eher Anomie (vgl. Beck/BeckGernsheim 1994: 19). So gesehen besteht eine Ambivalenz zwischen subjektivem Krankheitsbegriff und medizinisch (gesellschaftlich) definierten Krankheitsbegriff. Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass einige Betroffene scheinbar uneinsichtig sind oder keinen Leidensdruck haben, obwohl sie nach medizinisch-psychiatrischem Standpunkt her akut krank und gefährdet sein müssten (vgl. Klosinski 2005: 1447). Diese Ambivalenz kennzeichnet das Streben nach der Suche nach der objektiven Wirklichkeit, die von Naturwissenschaften so gerne angestrebt wird. Wenn aber der zwischenpersönliche Kontext (etwa zwischen Ärztin und Patientin), der lebensweltliche Kontext oder interkulturelle Probleme, in denen sich ein so genannter psychiatrischer Zustand manifestiert, außer Acht gelassen wird, wird Depression oder psychische Krankheit zu Eigenschaften eines Individuums, das der Behandlung bedarf, und die Behandlung wird laut Watzlawick dann zu einer Wirklichkeitsverzerrung sui generis (vgl. Watzlawick 2005: 96). Das Außerachtlassen dieser Kontexte ist die Grundlage vieler psychiatrischer Diagnosen, die aus der Perspektive des medizinischen Krankheitsmodells bzw. der Annahme einer Organstörung (des Gehirns oder der Seele), gemacht werden (vgl. ebd.). 47 2. Depressive Bewältigungsstrategien Ich bin der Meinung, dass sich durch das Konzept der Lebensbewältigung in unserer, anomischen Risikogesellschaft auch im Hinblick auf so genannte Depressionen, integrierende Perspektiven ergeben, die das Leben für Betroffene lebenswerter und gelingenderer werden lassen können. In den risikoreichen, ressourcenverzehrenden Anstrengungen heutiger Bewältigungsanforderungen, seine Identität, sein Selbst zu bilden, liegen Affinitäten zwischen Gesellschaft und Depression. In der heutigen Gesellschaft, in der eine neue Norm vorherrscht, die jede zur persönlichen Initiative auffordert und die jede verpflichtet sie selbst werden zu müssen, ist das Bild einer depressiven Person, dass sie nicht voll auf der Höhe ist und erschöpft ist von der Anstrengung, sie selbst sein zu müssen (vgl. Ehrenberg 2004: 4). Die Angst vor der Selbstwerdung wird in der heutigen Gesellschaft ersetzt durch die Erschöpfung, selbst sein zu müssen. Angst manifestiert sich zwar in der Depression, durch die Entdeckung angstlösender Antidepressiva wurden jedoch alle diejenigen Krankheitsbilder, bei denen die Angst im Vordergrund stand, als Depressionen eingestuft (vgl. Ehrenberg 2004: 170). Das führte dazu, dass die Tendenz sich verstärkte, Angst-Störungen unter Depressionen einzuordnen, und das nur aus dem Grund verfügbarer Psychopharmaka (vgl. ebd.). Der Erfolg der Antidepressiva gab den ExpertInnen auch recht, dass zwar niemand so richtig wusste wie Depression definiert werden sollte, aber es musste sich um etwas handeln, was durch Antidepressiva geheilt werden konnte (vgl. Ehrenberg 2004: 177). Der Erfolg der Antidepressiva beruht auf ihrer Funktion, dass sie den Menschen die Lebensfreude wiedergeben, die vom modernen Leben ständig attackiert wird (vgl. Ehrenberg 2004: 113). 2.1.1 Depression/depressive Störung Der Begriff der Depression geht auf Cullen im Jahr 1800 zurück (vgl. Kronmüller/Mundt 2000: 282). Im Lateinischen bedeutet deprimere nieder- und herabdrücken bzw. unterdrücken oder herabwürdigen (vgl. Stowasser/Petschenig/Skutsch 1997: 150). Dieses lateinische Verb drückt aus, wie sich depressive Menschen manchmal selbst beschrieben: Sie fühlen sich „down“, niedergeschlagen und bedrückt, dazu kommt eine auffallend große Reizbarkeit besonders bei Kindern und die Herabwürdigung des Selbst bzw. Selbstwertverlust (vgl. Hammen 1999: 10; vgl. Ehrenberg 2004: 141). 48 2. Depressive Bewältigungsstrategien Der Begriff der depressiven Störungen wird benutzt, um unterschiedliche psychische und physische Befindlichkeiten und Zustände zu benennen, wie schuldbeladene Zurückgezogenheit und Deprimiertheit voller Selbstvorwürfe und Selbsterniedrigung; Deprimiertheit, die von Agitiertheit und nach außen gerichtetem Vorwurf und einer kritisierenden Haltung begleitet wird; Resignation, Hoffnungs- und Hilflosigkeit; (Auto)Destruktivität; innere Leere mit dem „Gefühl der Gefühllosigkeit“ (vgl. Mentzos 2001: 13f.). Als Hauptsymptome werden von medizinischer Seite gedrückte Stimmung, Hemmung von Denken und Antrieb und körperlich-vegetative Störungen angegeben (vgl. Laux 2001: 73). Betroffene schildern in diesem Zustand eine Unfähigkeit zu handeln, die nötigsten alltäglichen Dinge zu verrichten, zu schlafen oder zu fühlen und berichten auch über körperliche Schmerzen bis zur völligen Erschöpfung (vgl. Hammen 1999: 7f.). Bei der Beschreibung depressiver Störungen aus psychiatrischer Sicht will ich mich auf die 2 Hauptkategorien konzentrieren - der so genannten depressiven Episode (nach ICD10) und der majoren Depression (nach DSM-IV) (vgl. Kronmüller/Mundt 2000: 282). Daneben gibt es eine Fülle anderer Kategorien, die das breite Spektrum affektiver Störungen, die grob in Depression und Manie eingeteilt werden können, betrachten. Was aber bei allen affektiven Störungen als Hauptsymptome gilt, ist eine Veränderung der Stimmung oder der Affektivität, meist zur Depression hin, mit oder ohne begleitende Angst, oder zur gehobenen Stimmung (Manie). Die meisten anderen Symptome gelten laut ICD10 dabei als sekundär oder im Zusammenhang mit diesen Veränderungen leichter zu verstehen (vgl. Dilling et al. 2000: 131). 2.1.2 Depressive Episode Depressive Episoden werden nach ICD-10 je nach Schweregrad in leichte, mittelgradige und schwere depressive Episoden eingeteilt. Die betroffene Person leidet dabei gewöhnlich unter gedrückter Stimmung, Interessenverslust, Freudlosigkeit und einer Verminderung des Antriebs. Die Verminderung der Energie führt dabei zu erhöhter Ermüdbarkeit und Aktivitätseinschränkung. Bereits nach kleinen Anstrengungen tritt deutliche Müdigkeit auf (vgl. Dilling et al. 2000: 139). 49 2. Depressive Bewältigungsstrategien Andere häufige Symptome sind (ebd.): 1. verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, 2. vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, 3. Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit (sogar bei leichten depressiven Episoden), 4. negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, 5. Suizidgedanken, erfolgte Selbstverletzung oder Suizidhandlung, 6. Schlafstörungen, 7. verminderter Appetit. Für die Diagnose depressiver Episoden müssen die Symptome mindestens zwei Wochen lang bestehen, in besonderen Ausnahmen auch weniger (vgl. Dilling et al. 2000: 140). Typische Merkmale des somatischen Syndroms, das ebenso auch „biologisches“ oder melancholisches Syndrom genannt werden könnte, und dessen Bezeichnung auch von KlinikerInnen kritisch betrachtet wird, sind (vgl. Dilling et al.2000: 131/140): 1. Interessenverlust oder Verlust der Freude an normalerweise angenehmen Aktivitäten. 2. Mangelnde Fähigkeit, auf eine freundliche Umgebung oder freudige Ereignisse emotional zu reagieren. 3. Frühmorgendliches Erwachen; zwei oder mehr Stunden vor der gewohnten Zeit. 4. Morgentief. 5. Der objektive Befund einer psychomotorischen Hemmung oder Agitiertheit. 6. Deutlicher Appetitverlust. 7. Gewichtsverlust, häufig mehr als 5% des Körpergewichts im vergangenen Monat. 8. Deutlicher Libidoverlust. Laut WHO ist das somatische Syndrom dann zu stellen, wenn wenigstens vier der genannten Symptome eindeutig feststellbar sind (vgl. ebd.).Die diagnostische Leitlinie sieht vor, dass über einen Zeitraum von 2 Wochen vier bis neun Symptome - je nach Schweregrad der depressiven Episode - vorhanden sein müssen, um eine Diagnose zu stellen (vgl. Hammen 1999: 17). 50 2. Depressive Bewältigungsstrategien 2.1.3 Major Depression Die Kriterien laut American Psychiatric Association: 1994 (DSM-IV) für die Episode einer Major Depression verlangen „eine depressive Stimmung für die meiste Zeit des Tages, an fast allen Tagen“, die über mindestens zwei Wochen beobachtbar sein müssen (vgl. Saß/Wittchen/Zaudig 1999: 31). Daneben muss die depressive Stimmung von mindestens vier zusätzlichen Symptomen begleitet werden, die im Folgenden aufgelistet werden (vgl. Saß/Wittchen/Zaudig 1999: 31f.; vgl. Hammen 1999: 16). 1. deutlich vermindertes Interesse oder Freude an allen oder fast allen Aktivitäten, an fast allen Tagen, für die meiste Zeit des Tages (entweder nach subjektiven Ermessen oder von anderen beobachtet); 2. deutlicher Gewichtsverlust ohne Diät oder Gewichtszunahme (z.B. mehr als 5% des Körpergewichts in einem Monat) oder verminderter oder gesteigerter Appetit an fast allen Tagen. Beachte: Bei Kindern ist das Ausbleiben der zu erwartenden Gewichtszunahme zu berücksichtigen; 3. Schlaflosigkeit oder vermehrter Schlaf an fast allen Tagen; 4. psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung an fast allen Tagen (durch andere beobachtet); 5. Müdigkeit oder Energieverlust an fast allen Tagen; 6. Gefühle von Wertlosigkeit oder übermäßige oder unangemessene Schuldgefühle an fast allen Tagen; 7. verminderte Fähigkeit zu denken oder sich zu konzentrieren oder verringerte Entscheidungsfähigkeit an fast allen Tagen (entweder nach subjektivem Ermessen oder von anderen beobachtet); 8. wiederkehrende Gedanken an den Tod (nicht nur Angst vor dem Sterben), wiederkehrende Suizidvorstellungen ohne genauen Plan, tatsächlicher Suizidversuch oder genaue Planung eines Suizids. Eine psychiatrische Diagnose mag hilfreich sein als Leitidee, um Menschen andere sinnlose Maßnahmen oder Behandlungen zu ersparen. Sie ist aber immer eine künstliche Übereinkunft und erfasst nie die Wirklichkeit eines Menschen (vgl. Dörner et al. 2004: 201). Als Leitidee kann sie nur ein Modell für die Beschreibung der psychisch-körperlich51 2. Depressive Bewältigungsstrategien sozialen Auffälligkeit liefern (vgl. ebd.). Ein Modell entspricht also dem, was es beschreibt nur unvollkommen. Die Darstellung der Phänomene der Depression wird allgemein auch mit negativen Gefühlen oder Emotionen bzw. tendenziell mit scheinbar nicht vorhandenen Emotionen oder mit einem „Gefühl der Gefühllosigkeit“ beschrieben. Dass solche Beschreibungen aber erhebliche Schwierigkeiten bereiten, kommentiert Lazarus. Er ist der Auffassung, dass der Trend in der Emotionspsychologie zwischen positiven und negativen Emotionen scharf zu trennen und so zu tun, als handle es sich um Gegensätze, unglücklich ist (vgl. Lazarus 2005: 257). Solch eine Aufspaltung verzerrt die Substanz der betreffenden Emotionen und die komplexen Bedeutungen, die jeder einzelnen innewohnt (vgl. ebd.). Lazarus spricht sich dafür aus, Emotionen nicht als etwas zu betrachten, dem jeweils separate und eigenständige Existenz zukommt, wo sie doch vielmehr voneinander abhängen (vgl. Lazarus 2005: 258). Liebe, die Emotion, die für viele eine eher positive Bedeutung hat, kann durchaus negativ getönt sein, wenn sie beispielsweise nicht erwidert wird (vgl. Lazarus 2005: 257). Auch zwischen Wut und Scham besteht eine enge Beziehung. In dieser Beziehung kann Wut ein Weg sein, um Scham zu bewältigen. Wut bedeutet hier, dass die Schuld für eine Verfehlung auf eine andere Person verlagert wird, und so entsteht das Gefühl sich selbst und seine Beziehungen besser unter Kontrolle zu haben (vgl. Lazarus 2005: 258). Lazarus will damit andeuten, dass durch einen plötzlichen Wechsel des Geschehens oder der selbst hervorgebrachten Neubewertung, die eine Emotion in eine andere übergehen kann. Solche Abhängigkeiten können aber nicht erfasst werden können, wenn die Emotionen separat betrachtet werden (vgl. ebd.). Jemanden als emotionslos zu beschreiben, kann gefährlich werden. Eine Person ohne Emotionen würde niemals handlungsfähig sein können, wäre kalt, unmenschlich und als menschliches Wesen völlig untauglich (vgl. Lazarus 2005: 260). Laut Lazarus wäre ein solcher Mensch kein Wesen aus Fleisch und Blut, sondern eine Maschine. Er appelliert, dass wir die Idee zurückweisen sollten, dass ein idealer Mensch einer sei, der nur denkt und nicht fühlt. Gedanken können zwar ohne wesentliche Beteiligung von Emotionen entstehen, aber nicht umgekehrt. Emotionen sind für Lazarus „komplexe, organisierte Subsysteme, die sich aus Gedanken, Überzeugungen, Bedeutungen, 52 2. Depressive Bewältigungsstrategien Erfahrungen und physiologischen Zuständen zusammensetzen. Sie hängen von Bewertungen ab, die von unserem Kampf herrühren, in der Welt zu bestehen und zu gedeihen, und die uns diesen Kampf erleichtern“ (ebd.). 2.1.4 Depressive Bewältigungsstrategien Ich bin der Meinung, dass sich durch das Konzept der Lebensbewältigung in der von Individualisierung und Pluralisierung geprägten Risikogesellschaft auch im Hinblick auf so genannte Depressionen integrierende Perspektiven ergeben können, die das Leben für Betroffene lebenswerter und gelingenderer werden lassen können. Depression als Bewältigungsstrategie zu bezeichnen, scheint mir auch aus dem Grund angebracht zu sein, weil das Konzept der Lebensbewältigung auf subjektive Deutungs- und Handlungsmuster im Kontext gesellschaftlichen Wandels und des Alltags verweist. Das Krankheitsbild einer Depression wird von einer psychomotorischen Verlangsamung und von Schlafstörungen bestimmt, wobei die Konsequenz dabei das psychische Leiden ist (vgl. Ehrenberg 2004: 200f.). Der depressive Rückzug deutet auf ein Handlungsmuster hin, mit dem das Subjekt sein Überleben sichern und schützen möchte, wenn es nicht mehr kämpfen kann (vgl. Ehrenberg 2004: 201). Freud versteht unter Trauer „die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal usw.“ (Freud 1999a: 429). Im Trauerprozess kann ein Mensch nach und nach den erlittenen Verlust bewältigen, indem die betroffene Person auf das verlorene Liebesobjekt verzichtet, sich also davon trennt (vgl. Solms/Turnbull 2007: 280). Anstelle der Trauer tritt bei manchen Menschen die Melancholie auf, die „seelisch ausgezeichnet [ist] durch eine tief schmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses für die Außenwelt, durch den Verlust der Liebesfähigkeit, durch die Hemmung jeder Leistung und die Herabsetzung des Selbstgefühls, die sich in Selbstvorwürfen und Selbstbeschimpfungen äußert und bis zur wahnhaften Erwartung von Strafe steigert“ (ebd.). In der Depression kann eine betroffene Person im Unterschied zur Trauer den Verlust nicht adäquat bewältigen, da sie den Verlust verleugnet (vgl. Solms/Turnbull 2007: 280). Laut Freud liegen die Wurzeln der Melancholie im Verlust eines - aus primär narzisstischen Gründen gewählten - Objekts als Liebesobjekt (vgl. Freud 1999a: 429ff.; vgl. Mitscher53 2. Depressive Bewältigungsstrategien lich/Mitscherlich 2004: 39). Bei der narzisstischen Bindung wird das Liebesobjekt behandelt, als wäre es ein Teil des Selbst. Der Verlust des Liebesobjekts wird verleugnet, indem sich die Person mit ihm identifiziert. Schließlich resultiert die Depression aus der Internalisierung der Grollgefühle gegenüber dem Objekt, das den Menschen verlassen hat, wobei die Narzisstin das internalisierte Objekt mit einer gnadenlosen Rachsucht einer verschmähten Liebhaberin angreift (vgl. Solms/Turnbull 2007: 280). Was den laut Freud krankhaften Zustand der Melancholie von Trauer unterscheidet ist die Störung des Selbstwertgefühls (vgl. Freud 1999a: 429). Das internalisierte Objekt kann derart heftig angegriffen werden, dass dies bis zum Suizidversuch bzw. bis zum erfolgten Suizid führt (vgl. Solms/Turnbull 2007: 281). Beim Bezugsrahmen des sozialpädagogischen Konzepts der Lebensbewältigung kommt als eine Grunddimension der Bewältigungsproblematik eine tiefenpsychisch eingelagerte Erfahrung des Selbstwertverlusts hervor (vgl. Böhnisch 2002: 203). Weitere Grunddimensionen, um die Bewältigungsproblematik an diesen entlang aufzuschließen und einer sozialpädagogischen Analyse zuzuführen sind laut Böhnisch (ebd.): • die Erfahrung sozialer Orientierungslosigkeit, • die Erfahrung des fehlenden sozialen Rückhalts und die • handlungsorientierte Suche nach Formen sozialer Integration, in die das Bewältigungshandeln sozial eingebettet und in diesem Sinne normalisiert werden kann. Im Mittelpunkt des Interesses des Bewältigungskonzepts steht die misslungene Balance zwischen psychischem Selbst und sozialer Umwelt, aus der heraus Menschen soziale Aufmerksamkeit auch durch antisoziale bis hin zu sozial- oder selbstdestruktiven Handlungen suchen. Die Menschen suchen ihre selbstwertstabilisierende Handlungsfähigkeit auch durch normverletzende Verhaltensweisen zu erlangen (vgl. ebd.). Depression kann beispielsweise eine „gesunde“ und angemessene Bewältigungsstrategie bzw. „Reaktion“ auf einen überaus massiven Verlust sein (vgl. Solms/Turnbull 2007: 283). Manche Menschen können die schwierigen Gefühle, die mit der Bewältigung eines Verlustes verbunden sein können nicht ertragen und versuchen sich so vor der unerträglichen Situation auf je individuelle Weise zu schützen (vgl. Solms/Turnbull 2007: 282). Depression kann auch auf ein Ergebnis vorangegangener Bewältigungsstrategien hindeuten. Solche Strategien, die Menschen anwenden, um ihren Selbstwert zu stabilisieren oder 54 2. Depressive Bewältigungsstrategien zu erhöhen, können sich aufgrund mangelnder oder nicht vorhandener Ressourcen als nicht gelingend erweisen und weitere, noch vorhandene Ressourcen gefährden und zerstören. Depression weist auf die kräfteraubenden Anstrengungen hin, welche die Lebensbewältigung im Alltag, mit der Aufforderung die eigene Identität zu bilden und die Initiative zu ergreifen, abverlangt (vgl. Ehrenberg 2004: 278). Die Menschen werden sozusagen von der Bewältigung überwältigt (vgl. Solms/Turnbull 2007: 280f.). Das Verheerende an depressiven Bewältigungsstrategien, die auch von der modernen Gesellschaft herausgefordert und provoziert werden, ist ihr bestimmtes Ziel: die Selbstachtung, die systematisch selbst herabgesetzt wird, bis das Ich sozusagen völlig entleert ist (vgl. Ehrenberg 2004: 79f.). Depressive Bewältigungsstrategien haben auch sozialintegrativen Charakter. Sie deuten auf ein Bewältigungshandeln hin, das auf der Suche nach Formen sozialer Integration ist, in der dieses Verhalten normalisiert und sozial eingebettet werden kann und in diesem Sinne normalisiert wird, wie es etwa bei bestimmten Jugendkulturszenen zu beobachten ist (vgl. Coutandin 1998: 174ff.). Die ärztlichen, psychopharmakologischen und psychosozialen Unterstützungen, auf die depressive Menschen in der Regel zählen können, wären ein weiterer Aspekt, der hier zu berücksichtigen sein könnte. Tiefenpsychologisch betrachtet, liegt hier in Ansätzen der Verdacht auf einen so genannten „Krankheitsgewinn“ nahe, der als primärer Krankheitsgewinn davon ausgeht, dass aufgrund inadäquater Bewältigungsversuche, die Angst und Konfliktspannung so groß wird, dass durch die Entstehung von Symptomen eine innere psychische Entlastung gefunden wird (vgl. Vetter 2001: 92). Als sekundärer Krankheitsgewinn wird der Gewinn bezeichnet, den ein kranker Mensch aus den Symptomen zieht, die ihm objektive Vorteile verschaffen (vgl. ebd.). Leid mit Gewinn in Verbindung zu bringen, kann jedoch problematisch sein und darf daher nur als ein Aspekt in der Komplexität von Depressionen angesehen werden. Krankheitsgewinn sollte nicht moralisierend verwendet werden, in dem Sinne dass die Frage nach der Krankheit, auch die Frage nach der Schuld impliziert. Besonders durch molekularmedizinische Grundlagen im Hinblick auf genetische Bedingungen psychischer Stö55 2. Depressive Bewältigungsstrategien rungen, zeichnet sich die Gefahr ab, dass möglicherweise ein Missachten des genetischen Befundes - im Hinblick auf Reproduktion, Ernährung, Lebensgewohnheiten - vielleicht als irrationales, schuldhaftes Verhalten gewertet werden könnte, das schließlich entsprechende Sanktionen nach sich ziehen kann (vgl. Schott/Tölle 2006: 509). Eine interessante Frage ist, welchen immateriellen und materiellen „Krankheitsgewinn“ die Gesellschaft oder verschiedene Berufsgruppen durch die Behandlung und Erforschung von Krankheiten zieht, die ihr objektive Vorteile verschaffen. Legen die anomischen Verhältnisse in unserer Gesellschaft nicht auch solche speziellen Handlungs- und Deutungsmuster nahe, auf die sich die Gesellschaft durch die Institutionalisierung von Hilfesystemen anzupassen versucht? Psychiater beispielsweise hatten schon historisch gesehen auch bestimmte Interessen der Gesellschaft zu wahren: Im Zeitalter von Erbbiologie und Rassenhygiene etwa waren sie als Sachwalter sozialpolitischer bzw. politökonomischer Interessen besonders an der Erhaltung und Verbesserung der Volksgesundheit interessiert (vgl. Schott/Tölle 2006: 505). Das ethische Dilemma ist in der Frage nach individuellen und gesellschaftlichen Interessen letztlich auch heute nicht aufzuheben: Angesichts der Frage nach Sachzwängen, der Frage nach der Gefährdung Dritter oder der Frage nach der Erprobung möglicherweise wirksamer Pharmaka an Freiwilligen oder auch an nichteinwilligungsfähigen Menschen erscheint die Menschenwürde manchen ExpertInnen nicht mehr absolut unantastbar (vgl. Schott/Tölle 2006: 506f.). 2.2 Erklärungsansätze und Verlaufsformen Eine Depression fällt nicht einfach vom Himmel herunter oder entsteht aus einer Laune der Natur aus sich selbst heraus. Dafür wird der obsolete Begriffe „endogen“ verwendet, der nichts anderes ausdrückt, als dass es sich eigentlich nicht erklären lässt: „nicht somatisch begründbar“ - „nicht psychogen“ (vgl. Tölle/Windgassen 2003: 42). Depressive Symptome können auch der Abwehr früher Affekte dienen und haben beispielsweise die Aufgabe Wut- und Angstimpulse abzuwehren (z.B. bösartig - eskalierende Krisensituationen, Gewalt) (vgl. Schreiber 1999: 122) oder spiegeln das angesichts der Individualisierung neue, unmittelbare Verhältnis von Individuum und Gesellschaft wider, 56 2. Depressive Bewältigungsstrategien das geprägt ist durch Erfahrungen von Risiko, Unsicherheiten (insecurities, lack of safety, uncertainties), Zukunftsängsten, Ohnmacht (vgl. Rauschenbach 1992: 41; vgl. Beck 1996: 20 f.). In Ahnlehnung an Thierschs „Drogenprobleme in der süchtigen Gesellschaft“ (Thiersch 1995: 126 ff.) könnte hier von „Depressionen in der depressiven Gesellschaft“ gesprochen werden. Genauso wie nicht gelingender Alkoholgebrauch stellt die Depression auch ein spezifisches Deutungs- und Handlungsmuster dar, das gewisse Sinnzusammenhänge der betroffenen Menschen beschreibt und auch sozialer Isolation entgehen will. Daneben sollte aber auch eine prinzipielle Verantwortung der Betroffenen erkannt werden, oder anders ausgedrückt: Das Subjekt ist es, das sein depressiv sein lebt, es herstellt, also „nicht nur Opfer, auch Täter ist“ (Dörner et al. 2004: 205). Die Wahrnehmung einer solchen Verantwortung eröffnet auch Chancen und Potentiale zur Veränderung. Dabei darf natürlich nicht der depressionsfreundliche gesellschaftliche und alltägliche Kontext außer Acht gelassen werden. Die Entstehung einer Depression ist, wie auch von Medizin und Psychiatrie anerkannt wird, als multifaktoriell bedingt zu sehen (vgl. Laux 2001: 78). Bereits vor mehr als 30 Jahren schrieb Hippius, der damals an der Universitäts-Klinik in München tätig war, dass Depressionen multifaktoriell bedingt sind, mit der daraus resultierenden Forderung, in der Therapie die biopsychosoziale Ebene gemeinsam und gleichzeitig berücksichtigen zu müssen (vgl. Hippius 1972: 49). Trotzdem hält er Medikamente für das wichtigste Behandlungsprinzip, und auf der Ebene der somatischen Depressionsbehandlung, vor allem bei „medikamentenresistenten“ PatientInnen, empfiehlt er drastische Maßnahmen. Neben Elektrokrampftherapien schenkt Hippius auch der so genannten Psychochirurgie, die für die Behandlung von Depressionen eine Art der Lobotomie empfiehlt, anerkennende Beachtung (vgl. Hippius 1972: 51). Der Schwerpunkt liegt in der Psychiatrie trotz aller Erkenntnisse eindeutig auf der somatischen Ebene. Kritische Stimmen multifaktorieller Modelle weisen heute beispielsweise daraufhin, dass eine zentrale Problematik solcher Modelle darin liegt, ihre sämtlichen Faktoren einer empirischen Bewährung zu unterziehen, und verbreiten somit eine Ten- 57 2. Depressive Bewältigungsstrategien denz, sich auf bewährte, nachvollziehbare somatische Faktoren zu beziehen (vgl. Hautzinger 1997: 190f.). Bei einer multifaktoriellen Sicht spielen biologische, psychische und soziale Faktoren eine Rolle (vgl.: Laux 2001: 79). Die einzelnen Bedingungen, die bei der Entstehung von Depressionen ausschlaggebend sein können, werde ich im Folgenden darstellen. 2.2.1 Biologische Erklärungsansätze Mit diesen Erklärungsansätzen, gehe ich auf genetische, somatische und neurobiologische Faktoren bei der Entstehung von Depressionen ein. Außerdem erwähne ich in diesem Unterkapitel aufgrund ihrer “biologischen Relevanz“ die Bindungstheorie von Bowlby. ForscherInnen auf dem Gebiet der Psychiatrie sind sich aufgrund vielfältiger Untersuchungen großteils einig darüber, dass depressive Störungen familiär gehäuft auftreten (vgl. Maier et al. 2000: 374). Außerdem soll es eine Reihe anderer Anhaltspunkte geben, die es notwendig erscheinen lassen, sich mit den biologischen Ursachen von depressiven Störungen auseinanderzusetzen. Diese Gründe sind laut Hammen unter anderem (vgl. Hammen 1999: 75): • Körperliche Veränderungen (z.B. Schlaflosigkeit oder übermäßiger Schlaf) und • neurochemische Hypothesen (Erfolg der Elektroschocks, Erfolg der Antidepressiva). • Bestimmte Substanzen können depressive Störungen auslösen und • auch gewisse Krankheiten und Kopfverletzungen lösen depressive Störungen aus. Diese Gründe, die für eine biologische Ursache depressiver Störungen sprechen, hängen meines Erachtens mit psychosozialen Faktoren zusammen und sprechen nicht unbedingt z.B. für eine Vererbung von Genen, wie es manche ForscherInnen aufgrund von Familienstudien annehmen (vgl. Maier et al. 2000: 385ff.). Viel plausibler erscheint mir, dass der psychosoziale Kontext einer Familie etwa mit „gestörter“ Kommunikationsstruktur, zu einer depressiven Störung führen kann (vgl. Watzlawick et al. 2003 insbs. Kapitel 3 Gestörte Kommunikation: 72 - 113). 58 2. Depressive Bewältigungsstrategien Don D. Jackson hat hierzu ein bemerkenswertes Modell der Familienhomöostasis entworfen (vgl. Watzlawick et al. 2003: 128). Dieses besagt unter anderem, dass die Besserung von Menschen mit depressiven Störungen oft drastische Rückwirkungen auf die Familie hat. Jackson betrachtete also auch depressive Störungen als homöostatische Mechanismen, deren Funktion es ist, das gestörte System (Familie) wieder in seinen, wenn auch noch so prekären oder pathologischen Gleichgewichtszustand zu bekommen (vgl. ebd.). Watzlawick et al. beschreiben Familie als ein System, das „stabil in bezug auf gewisse seiner Variablen“ ist, „wenn diese Variablen die Tendenz haben, innerhalb bestimmter festgelegter Grenzen zu bleiben“ (ebd.). Dabei gehen die Autoren davon aus, dass das Verhalten jedes einzelnen Familienmitglieds vom Verhalten aller anderen abhängt und etwa depressive Familienmitglieder, ob sich ihr Zustand nun verbessert oder verschlechtert, fast immer eine Rückwirkung auf das psychische, soziale oder physische Wohlbefinden anderer Angehöriger haben (vgl. Watzlawick et al. 2003: 128f.). Auch bei Angehörigen alkoholabhängiger Menschen ist es ein weit verbreitetes Phänomen, dass diese in vielen Fällen selbst hilfsbedürftig werden und häufig Symptome so genannter Stresserkrankungen entwickeln (vgl. Klein 2005: 70). Pathologische Familien sind laut Watzlawick et al. besonders widerstandsfähig gegen Veränderungen und zeigen eine erstaunliche Fähigkeit, ihren Status Quo zu erhalten (vgl. Watzlawick et al. 2003: 134). Sucht und andere psychische Störungen können in diesem Zusammenhang durchaus auch generationsübergreifend quasi „genetisch vererbt“ sein (vgl. Cirillio et al. 1998: 142ff.). Daneben gibt es zahlreiche Hypothesen, die sich für einen gestörten Zusammenhang zahlreicher Transmittersysteme, wie Noradrenalin, Serotonin, Dopamin oder Azetylchonin aussprechen (vgl. Henn 2000: 411 - 418). Gestützt werden solche Hypothesen auch auf den Erfolg so genannter Antidepressiva, die gezielt bestimmte Botenstoffe beeinflussen und unter anderem stimmungsaufhellende und angstlösende Effekte haben können (vgl. Wornig 2004: 57). Neurochemische Hypothesen gingen auf zufällig beobachtete gehobene oder gedrückte Stimmungen bei PatientInnen mit anderen Erkrankungen, nach Eingabe bestimmter Medikamente zurück. Später erwiesen sich diese Medikamente zufällig als gewisse Boten59 2. Depressive Bewältigungsstrategien stoffe beeinflussende Medikamente (vgl. Henn 2000: 410). Außerdem waren die ExpertInnen überzeugt, dass aufgrund der Einführung der Schocktherapie seit den 1930er Jahren und deren Erfolg bei der Therapie, psychische Krankheiten durch andere Mechanismen erklärt werden müssten, als durch die früher angenommenen anatomischen Ansätze, die sich auf die Lokalisation von Verletzungen beschränkte (vgl. Ehrenberg 2004: 69f.). Durch die aufkommende Psychopharmakologie in den 1950er Jahren wurde es möglich zu verstehen, dass Störungen nicht durch eine Veränderung an einem bestimmten Ort des Gehirn hervorgerufen wird, sondern durch einen dynamischen Prozess: Dynamik klingt nach Veränderung und nach Heilbarkeit (vgl. Ehrenberg 2004: 70f.). Nun war sich die Psychiatrie klar: Psychische Krankheiten haben ihre Ursache in einer Funktionsstörung des Affekts, nicht in einer Verletzung und sie sind dynamisch und nicht statisch (vgl. Ehrenberg 2004: 71). Daneben gibt es noch Theorien, die besagen, dass die rechte Gehirnhälfte etwa auf negative und die linke auf positive Emotionen spezialisiert ist. Läsionen der linken Hirnhälfte verringern daher die Fähigkeit, positive Gefühle zu empfinden, und verursachen Depressionen (vgl. Solms/Turnbull 2007: 275). Umgekehrt müsste nach dieser Hypothese nun gelten, dass Läsionen der rechten Hirnhälfte Depressionen verhindern könnten, da so negative Gefühle verringert werden müssten. Solche Hypothesen sind zu vereinfacht und charakteristisch für eine klinisch-anatomische Methode. Solche Überlegungen sollten im Zusammenhang mit dem menschlichen Gefühlsleben prinzipiell kritisch betrachtet werden (vgl. Solms/Turnbull 2007: 276f.). Die Dynamiken des menschlichen Gefühlslebens sind doch komplexer, als dass sie sich auf Verletzungen dieses oder jenes Bereiches des Gehirns zurückführen lassen (vgl. Solms/Turnbull 2007: 277). Es ist beispielsweise interessant, dass Läsionen ein und derselben Hirnhälfte gegensätzliche emotionale Reaktionen hervorrufen können (vgl. Solms/Turnbull 2007: 280ff.). Zu erwähnen ist an dieser Stelle auch das Beklagen von Bowlby, der von einem Kidnapping des Begriffs biologische Psychiatrie durch jene spricht, die sich mit biochemischen und genetischen Faktoren psychischer Krankheiten befassen. Für ihn sind Theorien über die psychische Entwicklung nicht weniger biologisch als die Forschungen über Neurotransmitter (vgl. Holmes 2006: 208). Die so genannte Bindungstheorie versucht das 60 2. Depressive Bewältigungsstrategien Psychische und Subjektive mit dem Biologischen und Objektiven zu vereinen und geht davon aus, dass Aspekte der Umwelteinflüsse, also Beziehungen, als Ergebnisse unterschiedlicher Interaktionsmuster eine wichtigere Rolle als Instinkt oder genetische Ausstattung spielen (vgl. Holmes 2006: 130). Bindung, bezogen auf den Zustand und die Qualität der individuellen Bindungen, kann in sichere und unsichere Bindung unterteilt werden. Sich gebunden zu fühlen heißt, sich sicher und geschützt zu fühlen. Unsichere Bindungen sind geprägt aus einer Mischung ambivalenter Gefühle, wie etwa intensive Liebe und Abhängigkeit, Angst vor Ablehnung (vgl. Holmes 2006: 88). Die Verbindung zwischen Trennungsangst und depressiven Affekten wurde neurowissenschaftlich bestätigt (vgl. Solms/Turnbull 2007: 144ff.). Hierbei wird ein System im Gehirn (das so genannte PANIK-System), das scheinbar in einem direkten Zusammenhang mit der sozialen Bindung und der mütterlichen Versorgung steht, verantwortlich gemacht. Die Neurochemie dieses Systems wird von körpereigenen Opioiden gesteuert (vgl. Solms/Turnbull 2007: 144). Diese Opioide haben auch eine schmerzreduzierende Wirkung. Die Trennung von einem Liebesobjekt reduziert die Wirkung der Opioide im PANIK-System, was die Separation und den Verlust „schmerzhaft“ machen und was in einigen Fällen zu einer klinischen Depression führen kann (vgl. Solms/Turnbull 2007: 144ff.). Bei Menschen entwickelt sich Bindungsverhalten auch ohne die traditionellen Aussichten auf Belohnungen einer physischen Befriedigung (vgl. Bowlby 2006a: 212 f.). Die Funktion des Bindungsverhalten ist für Bowlby am wahrscheinlichsten - evolutionär bedingt die der Gewährung von Schutz und Sicherheit (vgl. Bowlby 2006a: 218 ff.). Die Bindungstheorie geht gestützt durch Beobachtungen davon aus, dass der Mensch seit seiner Geburt ein soziales Wesen ist, das prompt auf soziale Reize reagiert und sich rasch in sozialer Interaktion engagiert (vgl. Bowlby 2006a: 211 f.). Die Bindungstheorie hat einen Beitrag zur Vorstellung über die psychosozialen Ursachen der Depression geleistet. Diese Theorie nimmt an, dass ein früher Verlust der Mutter, oder einer anderen primären Bindungsperson zu einer höheren Vulnerabilität bei kritischen Lebensereignissen führen kann, die die Menschen anfälliger für Depressionen macht. Aus Bowlbys Untersuchungen geht beispielsweise hervor, dass bei Personen, die in der Kindheit einen Verlust einer wichtigen Bindungsperson durch Tod erlitten haben, mehr als 61 2. Depressive Bewältigungsstrategien andere dazu disponiert sind, eine psychiatrische Störung zu entwickeln, und dass bei diesen Menschen die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie schwere depressive Störungen entwickeln (vgl. Bowlby 2006b: 287). Je früher und plötzlicher der Verlust der primären Bindungsperson erlitten wurde, desto größer die Wahrscheinlichkeit einer Depression (vgl. Holmes 2006: 216). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kein einzelnes „biologisches“ System ursächlich für die Entstehung einer depressiven Störung verantwortlich zu sein scheint (vgl. Henn 2000: 419 /426). Die Dynamiken sind noch komplexer als der dynamische Prozess, der sich in verschiedenen Bereichen des Gehirns abspielt und der zu einem Boom sozial akzeptierter Drogen, wie Benzodiazepine, Neuroleptika und Antidepressiva geführt hat (vgl. Ehrenberg 2004: 70). Im Folgenden stelle ich das (früher) viel beachtete Konzept der gelernten Hilflosigkeit vor und im Kapitel „Life events“ gehe ich auf die Diskussionen ein, welche Rückwirkungen schwierige Lebenssituationen auf die kognitive und somatische Ebene haben können. 2.2.2 Psychologische Erklärungsansätze Das Konzept der gelernten Hilflosigkeit Das Konzept der gelernten Hilflosigkeit geht auf tierexperimentelle Versuche zurück, aus deren Forschungsergebnissen mittels konditionierter Bestrafung von Hunden Rückschlüsse auf die Ursachen von Depressionen bei Menschen gezogen wurden (vgl. Meyer 2000: 20 ff./43). Bei den Tierexperimenten wurde einer Gruppe von Tieren an einem Tag kontinuierlich Stromstößen ausgesetzt, denen sie nicht entkommen konnten, die andere Gruppe erhielt jedoch keine Schocks (vgl. Meyer 2000: 21). Am folgenden Tag wurden die Tiere in eine so genannte Shuttle Box gesperrt, die in zwei Teile getrennt war. In einem Teil der Box wurden die Tiere Stromstößen ausgesetzt, die auch durch Lichtsignale angekündigt wurden, im anderen Teil der Box gab es keine Stromstöße. Die Tiere konnten also den Stromstößen selbst noch vor deren Beginn entkommen, wenn sie beim Lichtsignal in den anderen Teil der Box sprangen (vgl. Meyer 2000: 23). Daraus ergab sich, dass ein typischer 62 2. Depressive Bewältigungsstrategien Hund aus der Gruppe, die in der Vorphase unvermeidbaren Schocks ausgesetzt wurden, sich wenig gegen die verabreichten Schocks wehrte und schließlich kauernd und winselnd den Schock passiv ertrug, bis er beendet wurde. Die Hunde der anderen Gruppe, die im Vorfeld keinen Schocks ausgesetzt waren, verhielten sich aktiv und suchten zielführende Lösungen, den Schocks zu entkommen, bis sie lernten, in den anderen Teil der Box zu springen, um den Schocks dauerhaft zu entkommen (vgl. Meyer 2000: 24 f.). Aus diesen Experimenten ergab sich der Begriff der gelernten Hilflosigkeit als Bezeichnung für Erwartungs- und Anreizmechanismen (vgl. Meyer 2000: 29). Schließlich wurden auch bei Humanexperimenten analoge Verhaltensweisen bei Menschen beobachtet. ForscherInnen vertraten schließlich die Auffassung, dass die Theorie der gelernten Hilflosigkeit das Entstehen von Depressionen erklären kann. Sie stelle auch deren Grundlage für die Behandlung dar, zumal Gemeinsamkeiten zwischen Symptomen der Hilflosigkeit und Depressionen postuliert wurden (vgl. Meyer 2000: 42 ff.). Depressive würden jene Techniken der Anpassung nicht mehr anwenden können, die für die Überwindung von schmerzlichen Situationen notwendig sei, stattdessen haben sie Hilflosigkeit erlernt (vgl. Jantsche 2003: 15). Hilflosigkeit entwickle sich dann, wenn ein Individuum lernt, dass es keinen Zusammenhang zwischen Reiz und Reaktion gibt, dass Reagieren eben zwecklos ist (vgl. Wornig 2004: 76). Ein depressiver Mensch könne seinen Zustand aufgrund der erlernten Hilflosigkeit nicht mehr ändern und verfalle so in Passivität, Trübsal und Hoffnungslosigkeit (vgl. Jantsche 2003: 16). Die Theorie der gelernten Hilflosigkeit wurde öfter wegen gewisser Unzulänglichkeiten revidiert, und erweiterte sich dadurch vor allem um die Hoffnungslosigkeitsperspektive (vgl. Meyer 2000: 98 f.). Hoffnungslosigkeit umfasst demzufolge eine negative Ereigniserwartung und eine Hilflosigkeitserwartung (vgl. Meyer 2000: 99). Bei der Theorie der gelernten Hilflosigkeit ist ersichtlich, dass Seligman (1975) mit dem zentralen Konzept des Kontrollverlustes/Nichtkontrollierbarkeit von Ereignissen zwar einen theoretischen Bezugsrahmen für die Genese und Aufrechterhaltung depressiver Störungen vorstellt (vgl. Braukmann/Filipp 1995: 234 f.). Seine Modellkonstruktionen 63 2. Depressive Bewältigungsstrategien stützen sich aber fast nur auf laborexperimentelle Studien, und eine Generalisierung auf Fälle, wie sie im ökologischen Kontext vorkommen, ist umstritten (vgl. Braukmann/Filipp 1995: 235). Life events Die Erforschung von Lebensereignissen (life events) stellte sich als eine effektive Methode heraus, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie die externe Umgebung zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Depressionen beitragen kann (vgl. Brown 2000: 462). Dabei wird das Hauptaugenmerk auf die Bedeutung der Ereignisse für das Individuum und deren emotionalen Auswirkungen gerichtet (vgl. ebd.). Außerdem wird den andauernden Belastungen Beachtung geschenkt, die entweder durch ein Ereignis ausgelöst werden (Tod des Ehegatten führt zu finanziellen Problemen) oder zu einem Ereignis führen (Eheprobleme führen zur Trennung) (vgl. ebd.). In der von Bowlby kommentierten Studie „The Origins of Depression“ von Brown/Harris (1978) studierten die Autoren zwei Hauptgruppen von Patientinnen (vgl. Bowlby 2006b: 239 - 249). Die erste befand sich wegen kürzlich aufgetretener Depressionen in psychiatrischer Behandlung und umfasste 114 Frauen im Alter von 18 - 65 Jahren. Die zweite waren zufällig aus der Gemeinde - gleiche Altersgruppe, gleicher Innenstadtbezirk - ausgewählt worden und umfasste 485 Frauen. Diese wurde noch einmal unterteilt, und es ergab sich somit aus der Gemeindegruppe die Untergruppen: chronische Fälle (psychiatrische Symptome mindestens ein Jahr) und Onset Fälle (psychiatrische Symptome weniger als ein Jahr). Somit ergaben sich folgende Gruppen (vgl. Bowlby 2006b: 242): • Patientinnengruppe: 114 Frauen, • Chronische Fälle: 39 Frauen, • Onset Fälle: 37 Frauen, • Übrige „normale“ Gemeindegruppe: 382 Frauen. Bei der Untersuchung jüngerer Lebensereignisse wurde die Gruppe der chronischen Fälle nicht berücksichtigt und eine Zahl an Lebensereignissen, die für eine „durchschnittliche“ Frau wahrscheinlich erhebliche, emotionale Bedeutung haben, ausgewählt und anhand von Interviews untersucht, ob ein solches Ereignis bei den Frauen innerhalb eines Jahres 64 2. Depressive Bewältigungsstrategien aufgetreten ist. Danach wurde eine Reihe von Einschätzungen vorgenommen. Die Forscher gingen dabei streng nach wissenschaftlichen Kriterien vor, um jede Beeinflussung zu vermeiden (vgl. Bowlby 2006b: 242 ff.). Bei der Patientinnengruppe erlebten 61 % mindestens ein schwerwiegendes Ereignis, bei der Onset Gruppe 68% und bei der Vergleichsgruppe 20%. Die Prozentsätze für mindestens zwei schwerwiegende Ereignisse betrugen nach obiger Reihenfolge: 27, 36 und 9% (vgl. Bowlby 2006b: 243). Die Forscher kamen nach einer statistischen Korrektur zu dem Ergebnis, dass „bei nicht weniger als 49% der Patientinnen das schwerwiegende Ereignis von echter kausaler Bedeutung bei der Verursachung einer Depression war“ (ebd.). Ohne ein solches Ereignis wäre also eine Depression zumindest für eine lange Zeit und wahrscheinlich überhaupt nicht aufgetreten, so Bowlbys Schlussfolgerung (vgl. ebd.). Interessant dabei ist, dass als schwerwiegendes Ereignis vor allem jene Ereignisse beurteilt wurden, die mit einem Verlust oder einen drohenden Verlust, vor allem einer Person, aber auch der Arbeitstelle, der Wohnung oder des Haustieres verbunden waren (vgl. Bowlby 2006b: 243 ff.). Solche Verlusterfahrungen und andere kritische Lebensereignisse können ursächlich als auslösende Wirkungskraft, als Verwundbarkeits-Faktor oder als Faktor, der Schwere und Form der Depression beeinflusst, zu depressiven Störungen beitragen (vgl. Bowlby 2006b: 247 f.). Die Life-event-Forschung sieht in kritischen Lebensereignissen einen möglichen Faktor, der zur Entstehung von depressiven Störungen beitragen kann (vgl. Braukmann/Filipp 1995: 234). Das Beziehungsgefüge zwischen der Konfrontation mit kritischen Lebensereignissen und depressiver Symptomatik ist aber noch weitgehend unklar und die Wirkzusammenhänge noch nicht ausführlich genug ausgearbeitet (vgl. Braukmann/Filipp 1995: 247). Wohlbefinden etwa lässt sich nicht an materiellen Ressourcen und äußeren Lebensbedingungen festmachen. Das subjektive Wohlbefinden muss nicht die äußeren Lebensbedingungen direkt widerspiegeln. Trotz zum Teil stärkster materieller, physischer und psychischer Beeinträchtigungen wurde das eigene Wohlbefinden bei einer Studie vom MaxPlanck-Institut von älteren Menschen trotzdem zum Großteil positiv beurteilt (vgl. Halisch/Geppert 2000: 121). Ausschlaggebend hierbei sind vor allem die subjektiven Bewer- 65 2. Depressive Bewältigungsstrategien tungen der Lebensumstände und Situationen und die eigene Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Halisch/Geppert 2000: 144 ff.). 2.3 Depressive Bewältigungsstrategien und Gesellschaft Die moderne Gesellschaft ist geprägt durch eine zunehmende, abstrakt bleibende Globalisierung und eine zunehmende, konkret spürbare Individualisierung (vgl. Ehrenberg 2004: 267). Mit dem Leiden, dass sich aus Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten ergibt, müssen Menschen selbst zurechtkommen oder die Hilfe von ExpertInnen in Anspruch nehmen (vgl. ebd.). Gegen die Globalisierung anzukämpfen und Gerechtigkeit einzufordern, ist schwierig: Der Groll richtet sich laut Ehrenberg gegen einen selbst (Depression als Autoagression) oder gegen einen Sündenbock (Mobbing) (vgl. Ehrenberg 2004: 267f.). Die Welt scheint aufgrund der Fülle der schwierigen Situationen, die Menschen Tag für Tag zu bewältigen haben, praktisch völlig unberechenbar und das Verhalten muss ständig entsprechend moduliert und reguliert werden (vgl. Solms/Turnbull 2007: 148). Soziale Arbeit versteht sich laut Böhnisch als „gesellschaftlich institutionalisierte Reaktionen auf typische psychosoziale Bewältigungsprobleme in der Folge gesellschaftlich bedingter sozialer Desintegration“ (Böhnisch 2002: 199). Die Bewältigungsleistung der Menschen tritt angesichts der neuen Aufgaben, ihre Identitäten und Visionen, ihre Vergangenheiten und Zukunftsperspektiven neu zu entwerfen, auszuarbeiten, zu verflechten und zu kombinieren an ihre Grenzen (vgl. Beck/Bonß/Lau 2004: 17). Es besteht ein Unterschied zwischen Individualisierung und Pluralisierung der Lebensformen und der Zunahme der Autonomie: Durch die Pluralisierung von Wahlmöglichkeiten geht auch die Gefahr einer Vereinzelung des individuellen Subjekts im Geflecht anonymisierter Sozialbeziehungen einher, die die individuelle Freiheit des Subjekts nicht gerade erhöht, zumal es auch auf andere Subjekte angewiesen ist (vgl. Honneth 2002: 142f.). Die Risikogesellschaft eröffnet den modernen Menschen unbegrenzte Möglichkeiten, die er aber nicht wirklich beherrschen kann. Freud dachte, der Mensch wird neurotisch, weil er den Verzicht, den die Gesellschaft fordert, nicht ertragen kann. Der moderne 66 2. Depressive Bewältigungsstrategien Mensch im Wandel der Gesellschaft wird depressiv, weil er die Illusion ertragen muss, dass ihm alles möglich ist (vgl. Ehrenberg 2004: 277f.). Das Verhältnis von Ertrag und Aufwand, das von den Menschen Kreativität und persönliche Autonomie, Flexibilität und Lust an der professionellen Leistung erwartet, ist bis aufs Äußerste gespannt (vgl. Neckel/Dröge 2002: 100f.). Die Ressourcenverteilung des Marktes orientiert sich weniger an Leistungsmaßstäben, sondern ist vielmehr bestimmt durch eine zahlungskräftige Nachfrage, der Maximierung eigennütziger Vorteile im Medium schwankender Börsenkurse, Spekulationen etc. (vgl. ebd.). „Die wirklich Erfolgreichen scheinen die zu sein, die sich am geschicktesten von Fehlschlägen distanzieren und anderen die Verantwortung zuschieben“ (Sennett 2000: 103). Das Risiko, das auch mit dem Risiko des Scheiterns verbunden ist, wird zu einer alltäglichen Notwendigkeit, wobei das Eingehen von Risiken etwas anderes ist, als das heitere Abschätzen der Möglichkeiten, die die Gegenwart bietet (vgl. Sennett 2000: 108). Nach Sennett wohnt allem Risiko ein Drift inne, dem mathematisch wie beim zufälligen Würfeln, die Qualität einer Erzählung fehlt, bei der ein Ereignis zum nächsten führt und dieses bedingt. Alles fließt, aber scheinbar weiß niemand wohin (vgl. Sennett 2000: 109). Vor dem Hintergrund des soziologischen Befunds einer Risikogesellschaft wird das Bewältigungskonzept geradezu herausgefordert (vgl. Böhnisch 2005: 30). In einer individualisierten Gesellschaft steht die multiple Suche nach biografischer Handlungsfähigkeit im Vordergrund in der Auseinandersetzung mit psychosozialen Krisen und in sozialen Konflikten (vgl. Böhnisch 2005: 29 f.). Der gesellschaftliche Bezugspunkt ist dabei auf die gesellschaftliche Einbettung, die stetige Suche des Menschen nach sozialer Integration gerichtet (vgl. ebd.). Dabei werden im so genannten digitalen Kapitalismus „die Spezies der Überflüssigen“ hervorgebracht; es ergeben sich Prozesse der Freisetzung (vgl. Böhnisch 2005: 31). Durch Probleme arbeitsteilig bedingter sozialer Desintegration sowie durch Erosion und Spaltung der Lebenswelten, ergibt sich für Böhnisch in Ahnlehnung an Mennicke (1926) für Menschen die Freisetzung in ein ungewisses, doppelbödiges Soziales, mit dem sie zurechtkommen müssen (vgl. Böhnisch 2002: 201). Es kommt zu einer Bewältigungsspannung in der Gesellschaft, wenn Individuen auf biografische Perspektiven setzen und gleichzeitig damit rechnen 67 2. Depressive Bewältigungsstrategien müssen, dass diese immer wieder ökonomisch verworfen werden können (vgl. Böhnisch 2005: 31). Die beiden Gesichter der Depression am Ende des 20. Jahrhunderts sind laut Ehrenberg die Unsicherheit der Identität und das gehemmte Handeln (vgl. Ehrenberg 2004: 199). Depression verkörpert somit die Schwierigkeiten und Probleme, die sich für Menschen in ihrem Innenleben und ihrem Körper aus der neuen Normativität ergeben, die die Norm der Disziplin und der Verbotes überwunden hat (vgl. ebd.). In der Gesellschaft gelten Freiheitsverlust und Sinnverlust als existentielle Herausforderungen für einzelne Personen, und innerhalb der zerrissenen sozialen Ordnungen bleibt nur die absurde Hoffnung eines trotzigen Individualismus (vgl. Habermas 1998: 209). Nur dem starken, auf sich gestellten Individuum kann es in Ausnahmefällen gelingen, der zerrissenen Gesellschaft einen einheitsstiftenden Lebensentwurf entgegenzusetzen und im Anblick der unlösbaren sozialen Konflikte lässt sich für das Individuum Freiheit bestenfalls privat, in der eigenen Biografie verwirklichen (vgl. ebd.). Aber auch das Private, das in den Alltag der Menschen eingebunden ist, kann eine depressionsfreundliche Landschaft darstellen (vgl. Dörner et al. 2004: 195). Dörner et al. sind der Ansicht, dass Menschen aufgrund einer zerrissenen Gesellschaft „umso mehr ihr Streben nach Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung auf den dafür sozial funktionslosen und daher ziemlich ungeeigneten Privatbereich“ verschieben (ebd.). Dadurch entstehen gewisse Fehler: Menschen wollen nicht erst einmal alleine leben, um sich der eigenen Unabhängigkeit zu vergewissern, sondern suchen gleich von der Geborgenheit des Elternhauses aus die Partnerin fürs Leben. Dadurch aber bleiben sie zu wenig selbst- und welterfahren. „Sie überstrapazieren das höchstvergängliche Liebesgefühl für ihre Beziehung, verwechseln beides, ziehen in eine zu kleine einengende Wohnung, vergessen ihre bis dahin bestehenden gleichgeschlechtlichen Freundschaften, was sich spätestens in der ersten Partnerkrise rächt, kapseln sich von ihren Nachbarn ab, bekommen ein bis zwei Kinder und leben die Isolation zu zweit “ (Dörner et al. 2004: 196). Dörner et al. sind der Ansicht, dass Menschen fast ausschließlich im Rahmen einer Beziehung zu zweit depressiv werden können (vgl. Dörner et al. 2004: 197). 68 2. Depressive Bewältigungsstrategien Familie ist ausgezeichnet durch einen Doppelcharakter: Einerseits soll Familie eine moderne, gesellschaftliche Funktion übernehmen, die ausgerichtet ist auf Arbeitsfähigkeit oder Konkurrenzfähigkeit, andererseits soll sie eine gleichsam naturgegebene, vorgesellschaftliche Einheit bilden, die den Menschen Zuneigung, Liebe, Geborgenheit, einen Raum privater Intimität bietet (vgl. Lenz/Böhnisch 1999: 59 f.). Die sozialen Probleme und Lebensschwierigkeiten, die Mitglieder in die Familie hineintragen, bleiben für die Öffentlichkeit tabu. Dadurch kann es zu Überforderungen und internen Belastungen kommen, die aber nicht nach außen getragen werden und somit für öffentliche Hilfen zunächst unerreichbar bleiben (vgl. Lenz/Böhnisch 1999: 60). Somit kann es in der Familie zu problematischen Bewältigungsmustern kommen, die im Kontext mit anderen Mustern, beispielsweise Alkoholgebrauch, familiäre Gewalt, soziale Blockierungen oder Isolierung, gesehen werden können (vgl. ebd.). Durch das Auflösen traditioneller sozialer Milieus klammern sich Menschen stärker an die Familie als emotionalen Halt. Was anderswo nicht mehr zu bekommen ist, soll die Familie bieten: Liebe, Wärme, Geborgenheit, Solidarität, Nähe (vgl. Lenz/Böhnisch 1999: 61). Für die Jugend nimmt Familie dabei einen immer höher werdenden Stellenwert ein, der für sie aber auch in einer emotionalen Ambivalenz von Erwartung und Enttäuschung geprägt ist. Die hohen, emotionalen Erwartungen an die eigene Familie, drücken sich durch schnelle Enttäuschung aus, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden (vgl. ebd.). Einen Hinweis im Hinblick auf depressive Bewältigungsstrategien und Alkoholgebrauch gibt dazu die Darstellung der majoren Depression bei Jugendlichen. Hier wird davon ausgegangen, dass bei Jugendlichen Alkoholkonsum und das Gefühl nicht verstanden und anerkannt zu werden häufig sind. Daraus kann es zu Abhängigkeit und zu einer Vernachlässigung der eigenen Person mit besonderer Überempfindlichkeit gegenüber Zurückweisungen in Liebesbeziehungen kommen (vgl. Selvini Palazzoli et al. 1996: 167). Selvini Palazolli et al. stellten interessanterweise fest, dass die Kindheit der Menschen mit der Diagnose einer majoren Depression häufig durch Überbehütung in der Familie, durch ein zuviel an Wärme, Zuneigung, Liebe, Zärtlichkeiten von allen möglichen Familienmitglieder und Verwandten geprägt war (vgl. Selvini Pallazzoli et al. 1996: 168). Kennzeichnend dafür war auch, dass diese Jugendlichen vielerlei Pflichten enthoben und zunehmend sozial isoliert waren. Diese Jugendlichen gaben auch an, wie unverstanden und vernach69 2. Depressive Bewältigungsstrategien lässigt sie sich fühlten und wie enttäuscht sie waren, dass ihnen Mutter und Vater ihre Wünsche nicht erfüllten (vgl. Selvini Pallazzoli et al. 1996: 168 f.). Gedanken an den Tod und pessimistische Zukunftsperspektiven, aber auch gedrückte Stimmung, Interessenverslust, Freudlosigkeit und eine Verminderung des Antriebs sind, wie ich bereits erwähnt habe, laut ICD-10 häufige Symptome einer so genannten depressiven Episode (vgl. Dilling et al. 2000: 139). Hier bietet Durkheim interessante Ansätze, dies auch im gesellschaftlichen Zusammenhang zu verstehen: „Niemand kann sich wohl fühlen, ja überhaupt leben, wenn seine Bedürfnisse nicht mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln einigermaßen in Einklang stehen. Andernfalls, wenn seine Bedürfnisse größer sind oder einfach anderer Art, werden sie immer unterdrückt werden müssen und ihre Befriedigung ist ohne Schmerz nicht möglich. Ein Bedürfnis aber, das nur unter Leiden befriedigt werden kann, wird kaum neu entstehen. Ein Drang, der niemals befriedigt wird, muss schließlich verkümmern, und da der Drang zu leben sich notwendig aus allen anderen Bedürfnissen ergibt, muss auch er schwächer werden, wenn die anderen nachlassen“ (Durkheim 1983: 279). Unwohlsein im Sinne einer Störung des Wohlbefindens würde laut Böhnisch in der heutigen Auffassung mit dem Stressbegriff umschrieben werden. „Anomische Sozialkonstellationen können Stresszustände auslösen“ (Böhnisch 2001a: 39). Das Individuum sieht sich in einen Zustand psychosozialen Ungleichgewichts versetzt, der gewisse Bewältigungsstrategien zur Erlangung eines Gleichgewichts notwendig macht. Gewalt, Depression, riskanter Alkoholgebrauch oder Selbstmord sind in Ahnlehnung an die Coping Theorie „Handlungen, die aus biografisch dominant gewordenen Bewältigungskontexten vor dem Hintergrund einer Reihe anomischer Stresssituationen hervorgehen“ (Böhnisch 2001a: 40). Das Individuum sieht sich aufgrund anomischer Verhältnisse in seiner sozialen Handlungsfähigkeit bedroht, das wiederum veranlasst Individuen ihre Handlungsfähigkeit um jeden Preis wiederherzustellen (ebd.). Wenn der vorhandene Schatz an (gelingenderen) Bewältigungsstrategien nicht ausreichend ist oder sich keine andere Möglichkeit bietet die eigene Handlungsfähigkeit wieder herzustellen, wird zu drastischeren Mitteln gegriffen, auch wenn dabei geltende Normen oder Regeln verletzt oder umgangen werden (vgl. Böhnisch 2001a: 40). Dabei kann es 70 2. Depressive Bewältigungsstrategien sich um Regelverletzungen krimineller Art, wie Diebstahl aber auch um Alkoholgebrauch, Depression oder Selbstmord handeln. Durch Zunahme der Dichte und des Volumens der Gesellschaft erhöht sich das Risiko pathologischer Erscheinungsformen sozialer Desintegration (vgl. Böhnisch 2002: 200 ff.). Arbeitsteilung ist ein Grund für die Abhängigkeit des Individuums von der Gesellschaft und sollte auch zur Befriedigung der Bedürfnisse möglichst vieler Menschen beitragen. Was innerhalb der Industriegesellschaft aber normal war - das Normalarbeitsverhältnis, die Normalfamilie, die Normalbiografie - wird brüchig, unverbindlich und ist nicht mehr zuverlässig kalkulierbar (vgl. Rauschenbach 1999: 235). Daraus ergeben sich neue Unsicherheiten und Ängste: Die Industriegesellschaft als dynamischer Systemzusammenhang von Wirtschaft, Politik, Wissenschaft löst die Industriegesellschaft als lebensweltlichen Erfahrungszusammenhang auf. So werden Menschen freigesetzt aus industriellen Sicherheiten und Standardlebensformen (vgl. Beck 1992: 186). Ein in den Institutionen geltendes Selbstbild konserviert einerseits aber die alten Sicherheiten und Normalitätsvorstellungen der Industriegesellschaft - daneben besteht jedoch eine davon abgespaltene Vielfalt lebensweltlicher Realitäten, die sich von diesen Vorstellungen immer weiter entfernt (vgl. ebd.). Daraus ergeben sich gewisse Problematiken: zum einen fallen immer mehr Menschen durch die Normalitätsmaschen des sozialen Sicherungsnetzes (working poor), zum anderen entfallen die lebensweltlichen Grundlagen der Institutionen und ihre Konsensformen, die diese getragen haben (vgl. Beck 1992: 186 f.). Das Verhältnis von Lebenswelt und Ökonomie gerät in ein Ungleichgewicht (vgl. Böhnisch/Schröer/Thiersch 2005: 175). Eine hoch differenzierte Arbeitsteilung führt zu einer von Rationalität geprägten Spezialisierung und zu einer sozialen Entwertung (vgl. Böhnisch 1994: 170). Die Gesellschaft produziert eine „Spezies der Überflüssigen“ (vgl. Böhnisch 2005: 31). Das kann unter anderem das Solidaritätsgefühl schwächen und zu sozialer Desintegration führen, auf die sich die Menschen strukturell, also nicht beabsichtigt, anpassen und sei es durch depressives Verhalten oder Suizid (vgl. Böhnisch 1994: 170). Die ökologischen Schreckensvisionen verursachen Unsicherheiten, Ängste, Risiken. Viele der produzierten Risiken sind wissensabhängig, unsichtbar, unberechenbar und univer71 2. Depressive Bewältigungsstrategien sell (vgl. Rauschenbach 1999: 237). So gesehen scheinen depressive Bewältigungsstrategien als Antwort auf gesellschaftliche Entwicklungen als ein normales und verständliches Deutungs- und Handlungsmuster, das wie jedes andere Deutungs- und Handlungsmuster auch zu sehen ist. Wie beim nicht gelingenden Alkoholgebrauch kann dieses Muster aber andere Lebensbewältigungsstrategien entwerten, beherrschen und sich so zum dominanten Lebensmuster entwickeln. Dann kann laut Thiersch von einer psychischen Störung gesprochen werden, die aber auch angesichts der gesellschaftlichen Verhältnisse als normal verstanden werden sollte (vgl. Thiersch 1995: 124). Psychische Störungen drücken immer etwas Normales, weil Menschliches aus: Irren ist eben menschlich (vgl. Dörner et al. 2004; vgl. Cicero 1856: 1370). 72 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien Das Phänomen, das ich hier vorstelle und beschreibe ist der komplexe Zusammenhang zwischen nicht gelingendem Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien. Nicht gelingender Alkoholgebrauch und depressive Bewältigungsstrategien treten sehr häufig gemeinsam auf. Die ExpertInnen in Psychiatrie und Psychoanalyse sind sich einig darüber, dass Suchtverhalten auf die eine oder andere Weise mit der Depression verknüpft ist: Die speziellen Handlungsmuster der Sucht erscheinen entweder als Äquivalente der Depression oder als Symptome in einer Depression (vgl. Ehrenberg 2004: 156). Die Beantwortung der berühmten Frage nach „Henne oder Ei“ ist nach Saint-Excupéry nicht nur für den kleinen Prinzen „sehr wunderlich“, sondern auch für den betroffenen Menschen, der auf einem fremden Planeten zu sein scheint, und nach der Frage, warum er trinkt, sich schließlich „endgültig in sein Schweigen“ verschließt (Saint-Exupéry o.J.: 42f.). Insbesondere für die Theorie bedeutsam ist hier unter anderem die, vor allem aus medizinischer Sicht vorgeschlagene Unterscheidung in primären und sekundären Alkoholismus. Dabei entwickeln sich beim primären Alkoholismus infolge übermäßigen Alkoholkonsums, die als Primärproblematik bezeichnet wird, in weiterer Folge z.B. psychische Probleme wie Depressionen (Sekundärproblematik). Vom sekundären Alkoholismus sprechen MedizinerInnen dann, wenn infolge psychischer Probleme, wie Depressionen (Primärproblematik) Menschen beginnen, in großem Umfang Alkohol zu trinken und dann davon abhängig werden (Sekundärproblematik) (vgl. Uhl 2001: 62). Das gleiche gilt - wenn auch umgekehrt - für die Begriffe der primären und der sekundären Depression. Abhängigkeit ist durch einen Verlust der Selbstbeherrschung auf der Verhaltensebene ausgedrückt. Auf der psychopathologischen Ebene ist Abhängigkeit eine Form des Dienens oder der Versklavung, und gehört in den Bereich der depressiven Persönlichkeit (vgl. Ehrenberg 2004: 154). Das Subjekt konstruiert sich kein Symptom oder einen Wahn, sondern es agiert einen Konflikt durch beispielsweise Suchtverhalten oder Selbstmordimpulse aus, um die depressive Leere auszufüllen, um sie zu kompensieren (vgl. Ehrenberg 73 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien 2004: 154f.). Nicht gelingender Alkoholgebrauch kann als Bewältigungsstrategie gesehen werden, um den sinkenden Selbstwert bei Depressionen zu stabilisieren, der bei Aussetzen der Alkoholeinnahme so bedroht sein kann, dass dies unter Umständen bis zum Selbstmord führt (vgl. Ehrenberg 2004: 155). Depression kann eine Ursache der Alkoholabhängigkeit sein, aber auch deren Folge, weil unter anderem Alkohol zu neurochemischen Veränderungen führt und weil gewisse Lebensweisen und Lebensumstände von alkoholabhängigen Menschen deprimierend sind (vgl. Ehrenberg 2004: 156). Das gemeinsame Auftreten von Depression und Alkoholismus ist durch zahlreiche Studien belegt worden. Bei der Frage nach einer primären Depression bei AlkoholpatientInnen beobachteten Autoren eine Häufigkeit zwischen 4 bis 12 % (vgl. Rainer 1990: 106)1. Häufiger tritt jedoch eine sekundäre Depression auf, bei der sich eine Depression aufgrund einer bereits bestehenden Alkoholabhängigkeit entwickelt hat. Zwischen 12 und 50% schwankte die Häufigkeit bei verschiedenen Studien (vgl. ebd.)2. Bei Beginn einer Entziehungs- oder Entwöhnungskur wurden zwischen 27 und 62% (vgl. Herbig 1990: 107)3 der PatientInnen als depressiv diagnostiziert und nach einer ambulanten oder stationären Behandlung von Alkoholabhängigkeit lag dieser Wert bei 28 bis 66% (vgl. ebd.)4. 3.1 Zusammenhang beider Phänomene Unterschiedliche Modelle sind zur Erklärung des gemeinsamen Auftretens von nicht gelingendem Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien denkbar (vgl. Herbig 1990: 114): 1. Theoretisch sind die beiden Phänomene voneinander unabhängig; 2. Alkoholabhängigkeit ist das Resultat einer durch die depressive Störung hervorgerufenen Selbstbehandlung/Bewältigungsstrategie; 3. Alkohol besitzt depressiogene Eigenschaften; 1 Woodruff et al. 1973: 7%; Cadoret/Winokur 1974: 12%; Tyndel 1974: 4%; Robins et al. 1977: 5%; Keeler et al. 1979: 8% 2 Woodruff et al. 1973: 51%; Cadoret/Winokur 1974: 41%; Robins et al. 1977: 28%; Winokur 1970: 28%; Fowler et al. 1980: 12%; Halikas et al. 1981: 24% 3 Equi et al. 1976: 45%; Weismann et al. 1980: 59%; Fine et al. 1980: 27%; Hesselbrock et al. 1983: 62% 4 Pottenger et al 1978: 60%; Zielinski et al. 1979: 42%; Keeler et al. 1979: 66% 74 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien 4. Die depressive Störung ist eine Coping-Strategie; 5. Beide Phänomene sind Ausdruck einer gemeinsamen Grunderkrankung; 6. Beide Phänomene sind Ausdruck einer gemeinsamen psychodynamischen Störung. Feuerlein et al. stellten eine weitere These auf: 7. Depressive Symptome ergeben sich durch einen Alkoholentzug (vgl. Feuerlein et al. 1998: 72). Bereits im 19. Jahrhundert wurde angenommen, dass ein Zusammenhang von Alkoholgebrauch und anderen „Leiden und Krankheiten“ besteht (vgl. Falck 1855: 293). Neben verschiedenen Organleiden wird im 19. Jahrhundert auch über einen so genannten „Selbstmordtrieb der Säufer“ hingewiesen, der auf Depressionen beim alkoholabhängigen Menschen verweist (vgl. Falck 1855: 304). Den Grund für diesen „Selbstmordtrieb“ sieht Falck „in einer krankhaften Stimmung des Körpers, die man füglich als Melancholie oder Tristimanie bezeichnen kann. Wird ein Säufer davon erfasst, so erweist er sich wortkarg, verschlossen, missvergnügt, nachdenkend und einsam, und verfällt auf Selbstmordgedanken, denen er kurz oder lang die That nachfolgen lässt“ (Falck 1855: 304 f.). Diese Überlegungen aus dem 19. Jahrhundert erinnern an so manche Überlegungen aus dem 20. Jahrhundert. So wird in einem vom Krankenhaus de La Tour herausgegebenem Sammelband darauf hingewiesen, dass beim Alkoholabhängigen nach der Zufuhr von Alkohol in späteren Stadien Depressionen auftreten. Hier werden dem Alkohol „depressiogene“ Eigenschaften zugeschrieben, aus denen heraus viele depressive Elemente, Situationen des Selbstmitleids und Selbstmordgefahr resultieren (vgl. Kryspin-Exner/Scholz 1998: 16). Beide Überlegungen beschreiben ein Phänomen das Rätsel aufgibt. Besitzt der Alkohol nun wirklich „depressiogene“ Eigenschaften, oder ist der Zusammenhang zwischen nicht gelingendem Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien nun doch etwas komplexer? Kryspin-Exner/Scholz sprechen von diesen depressiogenen Eigenschaften des Alkohols (vgl. Kryspin-Exner/Scholz 1998: 16). Dabei gehen die beiden Autoren von der These aus, dass Alkohol für eine nicht abhängige Alkoholkonsumentin in der ersten Phase der Alkoholisierung und auch für depressive Menschen eine stimmungsaufhellende Wirkung 75 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien hat (vgl. Herbig 1990: 106). Später aber stellen sich durch Toleranzentwicklung und Abhängigkeitsentwicklung verstärkt Depressionen und Angst ein (vgl. Kryspin- Exner/Scholz 1998: 16). Interessant ist die These, dass chronischer, übermäßiger Alkoholgebrauch Veränderungen im Gehirn bewirken kann, die zu psychischen Veränderungen führt (vgl. Feuerlein et al. 1998: 165). Eine der wichtigsten Folgeerscheinungen des übermäßigen Alkoholkonsums ist die so genannte alkoholassoziierte Hirnatrophie (vgl. Heinz/Batra 2003: 23). Dabei kommt es vermutlich zu einem Abbau von Gehirnsubstanz, der unter anderem zu Gedächtnisstörungen, kognitiven Defiziten und zu einer Beeinträchtigung der handlungsplanenden Kontrollfunktionen und des Arbeitsgedächtnisses - die letztlich Motivationsstörungen bedingen - führen kann (vgl. Heinz/Batra 2003: 23 ff.). Solche und ähnliche Gehirnfunktionsstörungen werden auch bei depressiven Menschen beobachtet. So kann es bei Depression zu kognitiven Defiziten und Antriebshemmungen kommen, wobei die Unterscheidung zu einer Demenz nicht immer einfach ist (vgl. Tölle/Windgassen 2003: 238). Wesentlich bei einer depressiven Störung dabei ist, dass die dadurch bedingten Defizite vielfach abklingen, aber auch bei einem Teil in eine Demenz übergehen können (vgl. ebd.). Heinz/Batra berichteten auch bei der alkoholassoziierten Hirnatrophie von einer zumindest teilweisen Rückbildung bei Alkoholabstinenz (vgl. Heinz/Batra 2003: 25). Auffallend bei unterschiedlichen Autoren ist, dass sowohl bei der alkoholassoziierten Hirnathrophie (vgl. Heinz/Batra 2003: 24), als auch bei depressiven Störungen (vgl. Hammen 1999: 89) Auffälligkeiten und Anomalien im frontalen Bereich des Gehirns beobachtet wurden. Der frontale Bereich wird neben der Steuerung kognitiver Funktionen, auch maßgeblich mit der Steuerung des limbischen Systems, das für Emotion und Motivation wesentlich zuständig sein soll, in Zusammenhang gebracht (vgl. Hammen 1999: 89). Hierbei ergeben sich Ansätze, die auf eine schädigende Wirkung des Alkohols auf das Gehirn schließen lassen, die schließlich auch für depressive Störungen auf der biologischen Ebene verantwortlich gemacht werden können. Dabei kann übermäßiger Alkoholgebrauch nur einer der Ursachen für hirnfunktionelle Veränderungen sein, die auf eine depressive Störung hinweisen. Auch nach Verletzungen oder Schlaganfällen in der 76 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien Frontalregion des Gehirns werden depressive Störungen beobachtet (vgl. Hammen 1999: 89). Die These, dass beide Phänomene Ausdruck einer gemeinsamen Grunderkrankung sind, wird damit begründet, dass ein allgemeiner, möglicherweise genetischer Faktor sowohl der Depression, als auch der Alkoholabhängigkeit zugrunde liegt. Aufgrund mangelnder Forschungsergebnisse konnte diese Annahme bisher noch nicht verifiziert werden. Zur Verifizierung bedarf es noch weiterer Forschungsergebnisse (vgl. Ditt- rich/Haller/Hinterhuber 2006: 233). Der Serotonin-Hypothese zufolge, die das Serotonin als den entscheidenden neurochemischen Faktor für das seelische Gleichgewicht einer Person betrachtet, werden Depressive in „hyposerotonische“ und „hyperserotonische“ PatientInnen eingeteilt (vgl. Ehrenberg 2004: 203). Beim ersten Typ überwiegt die Impulsivität, mit ihren explosiven Impulshandlungen, wie etwa Suchtverhalten, beim zweiten ist die Person massiv gehemmt. Die eine kann ihr Handeln nicht kontrollieren, bei der anderen ist die Handlung verhindert (vgl. Ehrenberg 2004: 203f.). Die Sprache der Apathie sind Ehrenberg zufolge „Zurückhaltung, Erstarrung, Bremsen, Aussetzen des Handelns“, wobei die Impulsivität ebenfalls in diesen Bereich gehört, da sie nicht das Gegenteil von Hemmung ist, sondern eine Maske, hinter der sich die Apathie versteckt, eine sekundäre Reaktion (vgl. Ehrenberg 2004: 204). Bei einer Studie von Birtchnell (1972) wurde ein Zusammenhang von Verlusterfahrungen und Trauerfällen in der Kindheit und Depression und Alkoholabhängigkeit festgestellt. Bowlby kommentiert die wesentlichen Funde: „Besonders evident ist eine erhöhte Inzidenz bei depressiven Zuständen und Alkoholismus; wird der Verlust der Elternteile getrennt betrachtet, so lässt sich feststellen, dass (a) die Inzidenz des Mutterverlusts vor dem zehnten Geburtstag signifikant erhöht ist bei depressiven Patienten männlichen und weiblichen Geschlechts, sowie bei weiblichen Alkoholikern, und dass (b) der Verlust des Vaters vor dem zehnten Geburtstag signifikant häufiger bei weiblichen depressiven und alkoholabhängigen Patienten, bei männlichen Patienten jedoch nicht signifikant häufiger ist“ (Bowlby 2006b: 286). 77 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien Kinder aus suchtbelasteten Familien werden darüber hinaus als große Gruppe für die Entwicklung eigener Missbrauchs- und Abhängigkeitsrisiken gesehen. Außerdem lässt sich bei Kindern alkoholabhängiger Eltern häufig eine Tendenz zu affektiven Störungen und zu niederer Selbstwirksamkeit und Selbstwerterleben bis hin zu psychosomatischen Beschwerden feststellen (vgl. Baumgärtner/Scharping 2006: 609). Das gegenwärtige Klassifikationsschema des ICD-10 erwähnt bezüglich des Abhängigkeitssyndroms (F 10.2) auch den dazugehörigen Begriff „Dipsomanie“ (vgl. Dilling et al. 2005: 92 ff.). Als Dipsomane wird hauptsächlich der von Jellinek später (1972) hinzugefügte Typ des Epsilon-Trinkers gekennzeichnet (vgl. Vetter 2001: 165). Bei diesem Typ wird häufig ein periodisch-phasenhaft auftretender starker Wunsch, oder eine Art innerer Zwang Alkohol zu konsumieren, beobachtet (vgl. Dilling et al. 2005: 93 f.). In dieser Phase trinkt ein Dipsomane über einen längeren Zeitraum ohne Kontrolle Alkohol, bis er betäubt ist oder kein Geld mehr hat. Danach weist dieser Typ wieder völlig normale Verhaltensweisen auf (vgl. Vetter 2001: 165). Dipsomanen benutzen angeblich „Alkohol quasi als Medikament gegen periodisch auftretende Spannungszustände und Depressionen, die ihrem Alkoholismus meistens zugrunde liegen“ (Vetter 2001: 166). Die hier zugrunde liegende These geht also davon aus, dass die primäre Problematik des so genannten Epsilon-Trinkers nicht sein exzessiver Alkoholgebrauch, sondern ein anderes psychisches Leiden, etwa eine Depression, ist. Eigentlich beschreibt Dipsomanie eine Unterkategorie der so genannten Monomanie, die früher in der traditionellen Terminologie der Psychopathalogie verwendet wurde und schon ebenso veraltet und fragenswürdig ist, wie die Begriffe Kleptomanie oder Pyromanie (vgl. Durkheim 1983: 43). Dieser Begriff taucht auch bei Thiersch auf: „Sucht wird Streben nach Steigerung im Gebrauch von Mitteln, nach Wiederholungen, wird Monomanie“ (Thiersch 1995: 125). Ein Monomane bezeichnete einen kranken Menschen, der geistig eigentlich gesund ist, bis eben auf den einen Punkt: Plötzlich überkommt ihn ein grundloser, absurder Drang z.B. zu trinken, zu stehlen etc., wobei seine übrigen Handlungen und Gedanken völlig korrekt sind (vgl. Durkheim 1983: 43f.). Obwohl die Auffassung der Monomanie als eigenständige Krankheit im Widerspruch zu neuen, wissenschaftlichen Erkenntnissen steht 78 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien und von heutiger psychiatrischer Seite abgelehnt wird, wird der Begriff der Dipsomanie noch immer im ICD-10 verwendet. Dieses periodisch auftretende, exzessive Trinken, das den Epsilon-Typ kennzeichnet, kann aber keinen eigenständigen Krankheitscharakter haben (vgl. Durkheim 1983: 47), und wird nun so erklärt, dass diesem eine Störung im psychischen Allgemeinzustand, wie etwa eine depressive Störung zugrunde liegen muss (vgl. Vetter 2001: 166). Die Selbstmedikationshypothese stellt bei psychologischen Erklärungsmodellen über den Zusammenhang zwischen nicht gelingendem Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien den bekanntesten Ansatz dar (vgl. Driessen et al. 1994: 42). „Die Erfüllung durch die Sucht ist die Kehrseite der Leere der Depression“ (Ehrenberg 2004: 152). Die Selbstmedikationshypothese stützt sich auf Begriffe wie Spannungs-Reduktionstrinken, Wirkungstrinken, Trinkmotivation oder Problemtrinken und geht davon aus, dass depressive Menschen vermehrt Alkohol zu sich nehmen, um sich in ihren Zuständen zumindest kurzfristig Erleichterung zu verschaffen. Sie stützt sich auf ältere Studien, wie die von Mayfield (1985), die dem Alkohol eine stimmungsaufhellende Wirkung bei depressiven Menschen zuschreiben (vgl. Herbig 1990: 113). KritikerInnen gehen davon aus, dass es aufgrund vielfältiger Trinkmotive jedoch nicht gelingen kann, einen empirischen Nachweis für den Gebrauch von Alkohol wegen depressiver Störungen zu erbringen (vgl. Driessen et al. 42 f.). Vielmehr wird neuerdings angenommen, dass Selbstmedikation als Phänomen der Alkoholabhängigkeit und nicht einer zugrundeliegenden depressiven Störung betrachtet werden sollte. Aus Untersuchungen ging hervor, dass alkoholabhängige Menschen stärker Alkohol zur Beseitigung depressiver Symptome einsetzten und dadurch ein höheres Ausmaß an kurzfristiger Besserung erfuhren, als Menschen mit einer depressiven Störung (vgl. Driessen et al. 1994: 43). Für Kohlberg ist Drogengebrauch in vielen Fällen ein Werkzeug „um Depressionen, die als eine innere subjektive Stimmung empfunden werden, zu überwinden“ (Kohlberg 2000: 134). Für Kohlberg dient der Gebrauch von Drogen der Auslösung subjektiver, innerer Gefühle und Zustände und ist für ihn keine Aktivität, der eine objektive Qualität zukommt (vgl. ebd.). Kohlberg springt hier in Ansätzen auf die Ebene der diskutierten Coping-Strategie bei Depressionen. Alkoholgebrauch, um mit depressiven Symptomen 79 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien fertig zu werden. Psychoanalytisch betrachtet ergebe das ein Bild von einer Kategorie von Menschen, die auf Frustrationen mit besonders emotionalen, ängstlichen, depressiven Veränderungen reagiert. Das Ich versucht seine Selbstachtung mittels euphorisierender Substanzen aufrecht zu erhalten, wobei die Euphorie die depressiven Erscheinungen zurückdrängt und so den Narzissmus eines depressiven Menschen nährt, der sich nun unverwundbar fühlt (vgl. Ehrenberg 2004: 155). Hier wäre auch der Einsatz von Medikamenten und nicht nur der Alkohol- oder Drogengebrauch kritisch zu hinterfragen: Gerät nicht hier der Mensch in einen Teufelskreis, wo durch das ständige Befüllen der inneren Leere der Mensch durch einen künstlichen Trick einen Mangel kompensiert, und schließlich auch wieder eine neue Abhängigkeit entsteht? (vgl. Ehrenberg 2004: 155f.). Psychoanalytisch orientiert erklärt sich der Zusammenhang aus einer Art „BoderlineStörung“. Eine „depressive Persönlichkeit“ ist unfähig, ihre Konflikte auszutragen und sie sich zu vergegenwärtigen. „Sie fühlt sich leer, zerbrechlich und kann Frustrationen nur schwer ertragen. Daher rührt ihre Neigung, Abhängigkeitsverhalten zu entwickeln und nach immer neuen Reizen zu suchen.“ (Ehrenberg 2004: 120). Bei dieser Persönlichkeit steht nicht ein Konflikt im Vordergrund, sondern sie gehört in den Bereich der so genannten Spaltung, die durch eine Art innerer Zerrissenheit gekennzeichnet ist (vgl. ebd.). Auch die These, dass sich depressive Symptome durch einen Alkoholentzug ergeben (vgl. Feuerlein et al. 1998: 72), wird mittels unterschiedlicher Studien einmal untermauert, ein anderes mal ins Gegenteil verkehrt. Bei verschiedenen Studien wurden zu Beginn einer Entziehungs- und Entwöhnungsbehandlung zwischen 27 und 62% der betroffenen Menschen unter Standardkriterien als depressiv diagnostiziert (vgl. Herbig 1990: 107)5. Nach dem Alkoholentzug zeigten sich höhere Werte depressiver Symptome, nämlich zwischen 42 und 66% /vgl. ebd.)6. Andere Studien wiederum ergeben, dass die Depressivität nach dem Alkoholentzug drastisch abnimmt (vgl. Driessen et al. 1994: 36)7. Denkbar für den Grund dieser unterschiedlichen Werte sind beispielsweise Qualitätsunterschiede in stationären oder ambulanten Settings, wie die Art der Kommunikation, die sich während der Therapie zwischen Adressatin und Setting entwickelt (vgl. Thiersch et al. 2000: 64) und unterschiedliche Behandlungsmethoden, wie Einbezug eines multipro5 Equi et al. 1976: 45%; Fine et al. 1980: 27%; Hesselbrock et al. 1983: 62%. Pottenger et al. 1978: 60%; Zielinski et al. 1979: 42%; Keeler et al. 1979: 66%. 7 Hamm et al. 1979: von 35% auf 5%; Nakamura et al. 1983: von 25% auf 5%. 6 80 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien fessionellen Teams oder auch Angehöriger, psychotherapeutische und soziale Maßnahmen, gleichzeitige Therapie depressiver Symptome etc.. Ein anderer Erklärungsansatz unterschiedlicher Ergebnisse bei Studien können sich selbst erfüllende Prophezeiungen und Erwartungshaltungen sein. In den Sozial- und Naturwissenschaften spielen Erwartungen oft eine Rolle, sie unterstützen, das herbeizuführen, was eigentlich erwartet wurde (vgl. Watzlawick 1998: 59). Ein Grundprinzip sich selbst erfüllender Prophezeiungen ist, dass durch falsche Erwartungen, die auf falschen Situationsdefinitionen beruhen, Verhaltensweisen hervorgerufen werden können, die das fälschlicherweise erwartete Ergebnis tatsächlich eintreten lassen und so den Beweis liefern, dass die Erwartung richtig war (vgl. Bierhoff 2006: 285). Als Beispiele führt Bierhoff Versuchsleitereffekte (die einseitigen Erwartungen der Versuchsleiter können die Ergebnisse verzerren) und Lehrererwartungseffekte (die positiven Erwartungen eines Lehrers können die Intelligenz und Leistung der Schüler steigern) an (vgl. ebd.). Solche und ähnliche Effekte können durchaus auch bei wissenschaftlichen Studien vorkommen, und haben darüber hinaus Einfluss auf den Behandlungserfolg und Prognosen. Die Zusammenhänge des Dreiecks von Eindrucksbildung, Selbstschema und soziale Interaktion, die sich wechselseitig beeinflussen und verändern, kommen hier zum Ausdruck (vgl. Bierhoff 2006: 284). In diesem Zusammenhang interessant ist auch das von Bandura (1982) entwickelte Modell der Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Driessen et al. 1994: 44). Selbstwirksamkeit ist bezogen auf die Selbsteinschätzung, dass die Person zur erfolgreichen Bewältigung bestimmter Aufgaben fähig ist (vgl. Bierhoff 2006: 183). Bei alkoholabhängigen Menschen kann das Ausmaß der Selbstwirksamkeitserwartungen bezüglich künftiger Abstinenz signifikant mit dem Verlauf nach der Behandlung korrelieren (vgl. Driessen et al. 1994: 44). Hier könnten auch hohe oder niedrige Kompetenzerwartungen an ÄrztInnen, Kliniken, Verlaufsmodelle etc., die sich auf den Verlauf günstig/ungünstig auswirken können, eine Rolle spielen (vgl. Bierhoff 2006: 184). Bei depressiven Menschen mit einer Alkoholproblematik wird das Modell der Selbstwirksamkeit diskutiert, da davon ausgegangen wird, dass negative Kognitionen und ein negatives Selbstbild typischerweise zur depressiven Symptomatik dazugehören (vgl. Driessen et al. 1994: 44). Es ist nun auf der psychodynamischen Ebene vorstellbar, dass beide Phänomene miteinander interagieren. 81 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien Ein negatives Selbstbild bei einer depressiven Störung korrespondiere mit mangelnder Selbstwirksamkeitserwartung bei Alkoholabhängigkeit (vgl. Driessen et al. 1994: 46). 3.2 Die Rolle der Gesellschaft Die „Erfahrungen der Ungleichheit, der Vergesellschaftung, der Konkurrenz und der Offenheit im Risiko führen zu vielfältigen Formen der Verunsicherung, Überforderung, Überbeanspruchung, des Ausbruchs“ (Thiersch 1995: 129). Der Mensch muss sich behaupten, das wiederum okkupiert alle Kräfte und macht auch bereit zu vielfältigen Formen der Unterstützung. Menschen sehnen sich nach Gemeinschaftlichkeit, in der sie angenommen werden und zuhause sein können, ebenso wächst das Bedürfnis nach intensiven, authentischen Erfahrungen (vgl. ebd.). Die Identitätsbildung wird zu einem neuen eigenverantwortlichen Projekt. Nicht gelingender Alkoholgebrauch und depressive Bewältigungsstrategien sagen etwas über die aktuelle Erfahrung der Menschen aus, die sich aus der Gefangenschaft des Subjekts durch Verbot und Disziplin im 19. Jahrhundert befreit sehen: Sie verkörpern die Spannung zwischen dem Bestreben und der Erwartung, selbst zu sein, und der Schwierigkeit, ein solches Projekt zu verwirklichen (vgl. Ehrenberg 2004: 157). Wenn Depression und Alkoholabhängigkeit nicht nur aus Symptomen bestehen, sondern auch als spezielle Deutungs- und Handlungsmuster verstanden werden, um die neuen Anforderungen an das Individuum zu bewältigen, können diese Phänomene als die Kehrseite einer neuen Normalität angesehen werden, die ihre spezifischen Probleme aufwirft. Die persönliche Souveränität bewirkt auch innere Belastungen, die sich im Januskopf der beiden Phänomene ausdrückt: Die Depression ist bestimmt durch das Bild der Unfähigkeit zu handeln und der Unfähigkeit Frustrationen zu ertragen – das andere Gesicht der Depression ist die Abhängigkeit, die maßlose Handlung, die aus der fehlenden Selbstbeherrschung resultiert (vgl. Ehrenberg 2004: 157). Aufgrund des Spannungsverhältnisses ökonomischer Interessen und sozialer Sicherheit ergibt sich die neue Schlüsselkategorie der sozialen Unsicherheit (vgl. Böhnisch 1994: 190). Davon betroffen sind nicht nur Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, Arbeitslose oder AlleinerzieherInnen, sondern auch höher Qualifizierte, die durch das Stichwort 82 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien des lebenslangen Lernens einem Prekariat und Arbeitslosigkeit entgehen wollen (vgl. Böhnisch 194: 191; vgl. Vester/Teiwes-Kügler 2006: 82). Im Folgenden stelle ich die Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ (Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975) vor. Sie wurde in den 1930er Jahren durchgeführt. Daraus ergibt sich aber auch eine Relevanz bezüglich der Auswirkungen der ökonomischen Situation und der von mir vorgestellten Bewältigungsstrategien für die heutige Zeit. Drogenkonsum wird von manchen als eine „natürliche biologische Antwort“ auf soziale Lebensbedingungen bewertet, die Stress oder Depressionen verursachen (vgl. Loviscach 1996: 83). Hier wird davon ausgegangen, dass Depressionen durch negative soziale Bedingungen verursacht werden und dass auf diesen Zustand mit vermehrtem Alkoholkonsum geantwortet wird. Die Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ (Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975) verdeutlicht sehr klar den Zusammenhang von veränderter ökonomischer Lage und veränderter (depressiver) Stimmung und verändertem Alkoholgebrauch. Marienthal war ein kleines Fabrikdorf in Österreich, wo 1830 erstmals eine Flachsspinnerei angesiedelt wurde. Die Fabriken wurden vergrößert und Arbeiterhäuser erbaut. Für die Kinder wurden eine Aufenthaltsstätte und eine Schule gebaut. Entlassungen kamen kaum vor und den Leuten ging es in dieser Zeit des Aufschwungs recht gut. Schließlich wurden noch eine Weberei und eine Bleiche angegliedert und es kam durch den Großbetrieb allmählich zu Gewerkschaftsgründungen und politisch, gewerkschaftlichen Kämpfen. Der Ort erlebte noch größeren industriellen Aufschwung und die Arbeiterorganisationen wuchsen. Marienthal war ein politisch lebendiger Ort. Der 1. Weltkrieg brachte Veränderungen in der Organisation der Fabrik mit sich. Trotz weiterem Ausbau, wurde im Jahr 1926 die Belegschaft auf die Hälfte reduziert. Vorerst glaubten die Menschen noch, die Lage würde sich schnell wieder beruhigen. Doch 1929 kam der Absturz: die Spinnerei, die Druckerei, die Bleiche wurden geschlossen und 1930 die Weberei und die Turbinen stillgelegt. Marienthal hatte zur Zeit der Untersuchung im Jahr 1931 knapp 1500 Einwohner, die in 478 Haushalten wohnten (vgl. Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 32 ff.). Insgesamt waren durch diese Situation plötzlich 367 Fa83 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien milien vollständig arbeitslos, bei 93 Familien hatte zumindest ein Familienmitglied Arbeit. 18 Familien genossen einen Abfertigung oder Pension (vgl. Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 39). In Marienthal folgte nach der Stilllegung der Fabrik 1929 eine deutliche Schockwirkung (vgl. Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 93). Mit einem Schlag änderte sich das Leben. Die Frauen standen vor der Frage, wie sie ihr Wirtschaftsgeld einteilen sollten und wie es möglich sein sollte mit einem Viertel des Einkommens zu wirtschaften. Die Männer bewerteten die Situation des zu Hause Sitzens als unerträglich (vgl. Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 93 f.). Zuerst glaubte ein Großteil der Menschen, sie müssten nun verhungern, doch dann gewöhnten sie sich allmählich an die Verhältnisse. Ein lähmendes Gefühl der Unabänderlichkeit und der Aussichtslosigkeit stellte sich laut den AutorInnen ein (vgl. Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 93). Die ökonomische Lage der Bevölkerung veränderte sich also zunächst, und zwar zum Schlechten: „Das liegt im Wesen des Arbeitslosengesetzes. Mit der Zeit wird die Arbeitslosenunterstützung von der Notstandshilfe abgelöst, die Notstandshilfe wird verringert und kann schließlich ganz eingestellt werden“ (ebd.). Dazu kam, dass sich das Haushaltsinventar, wie Schuhe, Kleider, Bettwäsche, Geschirr etc. ständig fortschreitend abnutzte, und für Neuanschaffungen kein Budget vorhanden war (vgl.: Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 94 ff.). Aus ihren Untersuchungen, wie Beobachtungen, Gesprächen, Lebensgeschichten, Protokollen schlossen die ForscherInnen auf vier „Haltungstypen“, die sie den Familien zuordneten. Diese Haltungen waren: ungebrochen, resigniert, verzweifelt, apathisch (vgl. Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 73). Die Kriterien für „ungebrochen“ waren dabei: „Aufrechterhalten des Haushaltes, Pflege der Kinder, subjektives Wohlbefinden, Aktivität, Pläne und Hoffnungen für die Zukunft, aufrechterhaltende Lebenslust, immer wieder Versuche zur Arbeitsbeschaffung“ (Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 71). Kriterien für „resigniert“ waren: „keine Pläne, keine Beziehung zur Zukunft, keine Hoffnungen, maximale Einschränkung aller Bedürfnisse, die über die Haushaltsführung hinausgehen, dabei aber Aufrechterhaltung des Haushaltes, Pflege der Kinder und bei alledem ein Gefühl relativen Wohlbefindens“ (Lazars84 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien feld/Zeisel/Jahoda: 70). Die beiden anderen Haltungen ließen sich laut ForscherInnen gemeinsam als „gebrochen“ bezeichnen, doch gab es hierbei dennoch große Unterschiede, die eine Aufteilung notwendig machten. In ihrer äußeren Lebensführung ließen sich dabei kaum Unterschiede bei der Gruppe der „Verzweifelten“ zu den anderen bereits vorgestellten erkennen. Wichtig war jedoch, dass diese die Situation subjektiv anders erlebten (vgl. Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 71). Die Kriterien für Verzweifelte waren: „Diese Menschen sind völlig verzweifelt, und nach dieser Grundstimmung erhielt die Verhaltensgruppe ihren Namen. Wie die Ungebrochenen und die Resignierten halten auch sie in ihrem Haushalt noch Ordnung, pflegen auch sie ihre Kinder. Diese Haushaltskriterien gehören auch notwendig zur Gruppe der Verzweifelten. Es kommen aber noch hinzu: Verzweiflung, Depression, Hoffnungslosigkeit, das Gefühl der Vergeblichkeit aller Bemühungen und daher keine Arbeitssuche mehr, keine Versuche zur Verbesserung sowie häufig wiederkehrende Vergleiche mit der besseren Vergangenheit“ (ebd.). Die Gruppe der „Apathischen“ schließlich unterschied sich von den anderen drei durch das Aufgeben des geordneten Hausstands: „Mit apathischer Indolenz lässt man den Dingen ihren Lauf, ohne den Versuch zu machen, etwas vor dem Verfall zu retten. Wir bezeichnen diese Gruppe auch als apathisch. Das Hauptkriterium für diese Haltung ist das energielose, tatenlose Zusehen. Wohnung und Kinder sind unsauber und ungepflegt, die Stimmung ist nicht verzweifelt, sondern indolent. Es werden keine Pläne gemacht, es besteht keine Hoffnung; die Wirtschaftsführung ist nicht mehr auf Befriedigung der wichtigsten Bedürfnisse gerichtet, sondern unrationell. In dieser Gruppe finden wir die Trinker des Ortes. Die Familie zeigt Verfallserscheinungen, es gibt viel Streit; Betteln und Stehlen sind häufige Begleiterscheinungen. Nicht für die weitere Zukunft, schon für die nächsten Tage und Stunden herrscht völlige Planlosigkeit. Das Unterstützungsgeld wird schon verbraucht, ohne dass bedacht würde, was in der übrigen Zeit geschehen soll“ (Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 71 f.). Die Gruppe der „Apathischen“ ist der heutigen Vorstellung von einem „depressiven Stupor“ sehr ähnlich: „Der Antrieb ist gehemmt, die Kranken können sich zu nichts aufraffen, 85 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien sind interesse- und initiativlos und können sich nur schwer oder gar nicht entscheiden. Häufig klagen sie über Angst und quälende innere Unruhe und fühlen sich hilf- und hoffnungslos. Die Hemmung von Antrieb und Psychomotorik kann sich bis zum depressiven Stupor steigern, bei dem die Kranken teilnahmslos und fast bewegungslos verharren“ (Möller/Laux/Deister 2001: 82 f.). Die Marienthal-Studie ergab zudem, dass sich von den vorerst beobachteten 100 Familien • 16 % als ungebrochen, • 48 % als resigniert, • 11 % als verzweifelt und • 25 % als apathisch erwiesen. Da die ForscherInnen in ihren weiteren Verlauf der Untersuchungen erkannten, dass in diesen 100 Familien tatsächlich alle gebrochenen Familien Marienthals eingeschlossen waren, kamen sie letztlich bei den insgesamt 478 Familien, unter Zusammenfassung der „Verzweifelten“ und der „Apathischen“ in die Gruppe der „Gebrochenen“, zu folgendem Ergebnis (Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 73): • 23 % ungebrochen, • 69 % resigniert und • 8 % gebrochen. Das Prinzip der Hoffnungslosigkeit überwiegte in Marienthal eindeutig. Der Faktor Abwanderung vor dem eigentlichen Ortschicksals kann hierbei auch eine Rolle spielen: „Wir sehen also, dass ein beträchtlicher Teil der Marienthaler Jugend – und wahrscheinlich gerade der energische und besonders lebensfähige – in unserer Erhebung nicht vorkommt, weil er abgewandert ist“ (Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 75). Der subjektive Eindruck der ForscherInnen von der Bevölkerung war aber trotzdem, dass „das ganze Ortsleben noch stärker durch die resignierte Haltung bestimmt“ war „als den oben gegebenen Zahlen entspräche. Die ungebrochenen und die gebrochenen Existenzen scheinen zurückzutreten gegenüber dem Eindruck einer als Ganzes resignierten Gemeinschaft, die zwar die Ordnung der Gegenwart aufrechterhält, aber die Beziehung zur Zukunft verloren hat“ (ebd.). 86 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien Die ForscherInnen stellten einen eindeutigen Zusammenhang der Verschlechterung der ökonomischen Lage und der Veränderung der Stimmung und Gesundheit her (vgl. Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 97 f.). Das durchschnittliche monatliche „Einkommen“ pro Mitglied einer Familie war (Lazarsfeld/Zeisel/-Jahoda 1975: 96): • Gruppe ungebrochen 34 Schilling, • Gruppe resigniert 30 Schilling, • Gruppe verzweifelt 25 Schilling, • Gruppe apathisch 19 Schilling. Außer des eindeutigen Zusammenhangs der ökonomischen Lage und der Stimmungslage, lässt sich für die ForscherInnen auch abschätzen, von welchen Gelddifferenzen die Haltung bereits beeinflusst wird, an welcher Stelle das subjektive Gefühl der Erträglichkeit aufhört: „Schon eine Differenz von 5 Schilling heißt, nur mehr mit Saccharin kochen können oder doch noch Zucker verwenden; die Schuhe in Reparatur geben können oder die Kinder von der Schule zu Hause lassen müssen; heißt, sich gelegentlich eine Zigarette zu 3 G [roschen] leisten zu können oder immer nur Stummel von der Straße aufklauben; 5 Schillinge mehr oder weniger, das bedeutet die Zugehörigkeit zu einer anderen Lebensform“ (Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 96). Dabei muss diesen Einkommenszahlen keine Gültigkeit über Marienthal hinaus kommen, meinten die ForscherInnen, da Verwahrlosung und Verzweiflung schon bei einer höheren Einkommensstufe einsetzen kann. Außerdem spiele der Vergleich mit der Umgebung „sicher eine große Rolle bei allen Fragen der Stimmung und Haltung“ (Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 97). Anomie wird beschrieben als ein Zustand sozialer Regellosigkeit, Normlosigkeit und mangelnder Bindung der Individuen untereinander in einer Gesellschaft, in der Menschen in ein gestörtes Verhältnis von Orientierung an den gewohnten Verhältnissen von gesellschaftlichen Zielen und den Mitteln zur Erreichung dieser Ziele kommen (vgl. Böhnisch 1994: 61 f.). Das Nebeneinander von sozial integrativen und desintegrativen Tendenzen kommt heutzutage auch in der ständigen Verschlechterung der ökonomischen Lage von Arbeitslosen zum Ausdruck, die von Kürzungen betroffen sind und sich mit anderen, deren Lage vielleicht besser ist, vergleichen müssen. Es ist denkbar, das Menschen die Stadien von vorerst noch „ungebrochen“ bis hin zu „apathisch“ durchlaufen, auch im Hin87 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien blick darauf, sich an solche anomische Zustände anzupassen, und sei es durch Strategien wie exzessiven Alkoholgebrauch und/oder Depression, oder wie bei Durkheim (1983) dargestellt, durch anomischen Selbstmord. In solchen Situationen wird so genanntes abweichendes Verhalten zum Anpassungsverhalten an eben diese anomische Zustände (vgl. Böhnisch 1994: 62). Aus anomietheoretischer Sicht ist nicht gelingender Alkoholgebrauch und die damit verbundenen veränderten emotionalen Zustände, auch bei Kindern und Jugendlichen eine gesellschaftlich bedingte Bewältigungsstrategie (vgl. Broekman 2000: 207). Die gesellschaftlich anerkannten Ziele treten aufgrund gescheiterter Versuche oder aufgrund zu geringer Ressourcen in den Hintergrund. So gesehen ist Passivität und Apathie gegenüber dem Wettbewerb um allgemeine, gesellschaftlich anerkannte Wertvorstellungen und der Rückzug auf den Konsum von Alkohol, ein Anpassungsverhalten an anomische Zustände (vgl. ebd.). Depressive Bewältigungsstrategien und nicht gelingender Alkoholgebrauch können als das „düstere Gesicht der zeitgenössischen Innerlichkeit“ gesehen werden, „in einem Kontext, in dem die Wahl die Norm ist und die innere Unsicherheit der Preis“ (Ehrenberg 2004: 278). Die Formel der souveränen Identität lautet nach Ehrenberg: „psychische Befreiung und persönliche Initiative, Unsicherheit der Identität und Unfähigkeit zu handeln“ (ebd.). Interessant bei der Marienthal-Studie ist auch die Hervorhebung der subjektiven Bewertung und Bedeutung der Situationen. Außerdem ergab sich in Marienthal durch den Verlust der Berufstradition ein neuer Stand: der Stand der Arbeitslosen. Dadurch kam es zu veränderten solidarischen Beziehungen, die sich in Abnahme des politischen Kampfes und Zunahme der persönlichen Gehässigkeit ausdrückte (vgl. Lazarsfeld/Zeisel/Jahoda 1975: 98). Auch die moderne Gemeinschaft wird geprägt durch einen Widerspruch, dass die Menschen zu gleicher Zeit bestrebt sind, emotionale Offenheit voreinander zu entwickeln, und sich gegenseitig zu kontrollieren. Das lokale Gemeinschaftsleben kann so zu einem Ort der Brüderlichkeit in einer feindlichen Welt, oft zum Ort des Brudermords werden (vgl. Sennett 2002: 379). Die Problematik sozialer Desintegration ist dem arbeitsteiligen Industriekapitalismus strukturell immanent und wirkt sich am Einzelnen aus. Dadurch kommt es zu psychosozi88 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien alen Bewältigungsproblemen (vgl. Böhnisch 2005: 24). Gerade heute entwickelt sich durch die Modernisierung der Industriegesellschaft ein anderes lebensweltliches Gesicht der Gesellschaft: andere Netzwerke, Beziehungskreise, Konfliktlinien oder politische Bündnisformen der Individuen (vgl. Beck 1992: 186). Bauelemente einer industriellimmanenten Traditionalität, wie etwa Klasse, Kleinfamilie, Berufsarbeit lösen sich auf (vgl. Rauschenbach 1992: 28). Schließlich kommt es zu einer Schwächung des Solidaritätsgefühls. Auch heute ist es wie in Marienthal in den 1930er Jahren durch den Verlust von Berufstraditionen zu einen neuen „Stand“ gekommen. In Ahnlehnung an Enzensberger (2000) spricht Böhnisch von einer neuen „Spezies der Überflüssigen“ (vgl. Böhnisch 2005: 31). Die im sozialen und wirtschaftlichen Wettbewerb Benachteiligten klagen zudem oft, sie würden mit zu wenig Respekt behandelt, was die Menschen verletzt und ihr Selbstwertgefühl ins Schwanken bringt (vgl. Sennett 2004: 11ff.). Wer in den Schatten des Wirtschaftswachstums gerät, wird als Mensch nutzlos, solange er nicht irgendeinen Arbeitsplatz hat oder mit dem Konsum beschäftigt ist (vgl. Illich 1978: 9). Solange Menschen wenigstens mit dem Konsum von Alkohol beschäftigt sind, stellen sie einen gewissen Wert dar: für Gastronomiebetriebe, für gewisse soziale Gruppen, für die Staatsfinanzen und den Markt. Arbeitslosigkeit zeichnet Menschen auch als andersartig aus und als Personen, die unfähig oder unwillig sind, sich einer gesellschaftlichen Norm zu unterwerfen. Das Entscheidende dabei ist die massive Attacke auf das Selbstwertgefühl, das mit Arbeitslosigkeit verbunden sein kann. Außerdem übersetzt sich finanzielle Ungleichheit für Arbeitslose oder andere Schlechtergestellte in sehr viele andere Defizite (vgl. Zilian 2005: 104f.). Illich (1972) spricht von einer „modernisierten Armut“, die dann eintritt, wenn die Intensität der Abhängigkeit vom Markt eine gewisse Schwelle erreicht hat. Angesichts eines frustrierenden Überflusses werden die Menschen ihrer Freiheit und Fähigkeit beraubt, autonom zu handeln und schöpferisch zu leben und werden beschränkt aufs Überleben im Kreislauf der Marktbeziehungen (vgl. Illich 1972: 7). Ohne Konsum zur Befriedigung der (durch den Markt erst geweckten) Bedürfnisse, „ohne den süchtigen Griff nach der Ware“ wird ein Leben unmöglich und der Mensch verliert angesichts seiner hilflosen Abhängigkeit und des institutionalisierten Expertentums den Geschmack selbst-vertrauender Bewältigung äußerer Gefahren und innerer Ängste (vgl. Illich 1972: 8 ff.; 65 ff.). 89 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit Der Begriff der Lebensbewältigung wurde von Böhnisch von Beginn an in den Kontext des Strukturwandels des Sozialstaats gesetzt (vgl. Böhnisch 2002: 202 f.). Im „digitalen Kapitalismus“ der durch einen tiefgreifenden Transformationsprozess der dominanten Wirtschaftsstruktur geprägt ist, ergeben sich neue Herausforderungsstrukturen an die Individuen (vgl. Lenz/Schefold/Schröer 2004: 9 ff.). Die Gesellschaft steuert angesichts beschleunigter und risikoreicher ökonomischer, ökologischer, demografischer, politischer, kultureller Verhältnisse in eine ungewisse Zukunft. Die technologiegesättigten Strukturen der Lebenswelt verlangen von den Menschen gleichsam habitualisiertes Vertrauen in das Funktionieren undurchschauter Techniken und Schaltkreise (vgl. Habermas 1998: 69). Wenn eine Ärztin beispielsweise ein Antidepressivum verschreibt, verlangt das vom Menschen Vertrauen in undurchschaubare Eingriffe in verschiedene Botenstoffsysteme. Die (mentalen) Folgen des Internets oder gewisser Medikamente, deren Gebrauch trotz gewachsenen Risikobewusstseins die alltäglichen Routinen nicht verunsichert, sind noch schwer abschätzbar (vgl. Habermas 1998: 70 f.). Die Spezialisierung macht in komplexen Gesellschaften jede Expertin vor der anderen zum Laien (vgl. Habermas 1998: 69). Illich wendet sich in seiner Expertenkritik personenbezogener Dienstleistungen gegen Hegemonien, die zuerst Bedürfnisse der Menschen erzeugen, sie sodann abhängig von ihnen machen, indem sie die Befriedigung der von ihnen geschaffenen Bedürfnisse für sich beanspruchen. Illich glaubt, dass durch ein besserwisserisches Expertentum die persönliche Kompetenz der Menschen auf selbst vertrauender Bewältigung untergraben wird (vgl. Illich 1978: 9/65 ff.). Auch Thiersch sieht den Alltag durch Intellektuelle bedroht, die aus der Macht ihrer gesicherten Profession heraus, Selbstverständlichkeiten nur problematisieren, um Nöte zu erzeugen, die wiederum ihre Hilfe nach sich ziehen muss (vgl. Thiersch 1986: 30). Lebensbewältigungsprozesse verlieren auch äußere Ressourcen, vor allem sozialstaatliche Stützung durch Rechte und Dienstleistungen (vgl.Lenz/Schefold/Schröer- 2004: 11). Das Ende des 20. Jahrhunderts stand im Zeichen der strukturellen Gefährdung eines sozialstaatlich gezähmten Kapitalismus und neuem sozial rücksichtlosem Neoliberalismus (vgl. Habermas 1998: 78). Auf der Seite der Arbeitskräfte ist einerseits eine „Renaissance eines Berufs90 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit ethos der guten Facharbeit“ beobachtbar, die vor allem durch ständig steigende Bildungsniveaus eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität fördert; auf Unternehmensseite gibt es andererseits aufgrund der internationalen Konkurrenz neoliberale Tendenzen zur Entwertung der Arbeit durch Kostendruck, Flexibilisierung und Arbeitszerlegung, um die Profitabilität des Kapitals zu stabilisieren oder zu steigern (vgl. Vester/Teiwes-Kügler 2006: 80). In diesem Spannungsverhältnis begründet das qualifizierte Arbeitsvermögen weniger soziale Sicherheit als früher und gerät in den Widerspruch immer profitablerer Verwertung der Arbeit. Neoliberale Strategien erhöhen den Druck zur Flexibilität, Kostensenkung, Arbeitszerlegung, Verkürzung von Entwicklungszeiten und Auslagerung der Arbeitsplätze in andere Länder. Bei FacharbeiterInnen entsteht so zunehmend das Gefühl, nur halbfertige Produkte auf den Markt bringen zu müssen (vgl. Vester/Teiwes-Kügler 2006: 82/88). Ob die aufs Spiel gesetzte Qualitätsproduktion und die damit verbundene sinkende KundInnen- und Arbeitskraftzufriedenheit ein Umdenken bewirkt, ist fraglich, stellt aber durchaus eine Chance dar (vgl. Vester/Teiwes-Kügler 2006: 82). Die These und vielfache Praxis der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts war, dass erst das Zusammenspiel von Sozialstaat und sozialen Bewegungen soziale Sicherheit gewährleisten konnte (vgl. Böhnisch 1994: 191). Wenn solche Normalitätsvorstellungen aber brüchig werden, wird das Vertrauen in das Kollektiv geschwächt, und die Einzelne sieht sich gewissen Unsicherheiten ausgesetzt (vgl. Böhnisch 1994: 190). Damit die Gewerkschaften Mitglieder erschließen, können sie „in ihrer Tarifpolitik nicht nur mehr von rationalen, ökonomischen Interessen an höheren Löhnen, geringeren Arbeitszeiten und sozialer Sicherheit ausgehen“ (Vester/Teiwes-Kügler 2006: 80). Diese stehen vor allem für entfremdete RoutinearbeiterInnen im Vordergrund, die vor allem wegen des Entgelts arbeiten müssen. Vielmehr lässt sich die identitätsbildende Bedeutung einer neuen, selbstbewussten Wiederbelebung eines „Berufsethos“ bei Facharbeitern beobachten, die meist auch in der Familienphase gewerkschaftliche Interessen aufweisen (vgl. Vester/Teiwes-Kügler 2006: 80 f.). Gewerkschaften übernehmen weniger die Funktion sozialer Sicherheiten, sondern bieten durch Aushandlungs- und Mitbestimmungsstrategien Alternativen an, die beispielsweise höhere Qualifikationen und Weiterbildungen als Beitrag zu höherer Produktivität vertraglich honorieren: Damit können sich gut qualifizierte ArbeitnehmerInnen ei91 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit nerseits gegen eine Entwertung ihrer Arbeit wehren, andererseits ist es eine Überlebensstrategie für ArbeitnehmerInnen, die sich durch Qualifizierungsmaßnahmen aus Lagen der Arbeitslosigkeit oder prekären Arbeitsverhältnissen befreien wollen (vgl. Vester/Teiwes-Kügler 2006: 82). Solche Versuche können gelingen oder auch misslingen. Obwohl die meisten BürgerInnen unseres Landes grundversorgt sind (und das auch im Sinne einer therapeutischen Grundversorgung), wird dennoch vielen die Teilhabe an weiteren gesellschaftlichen Entwicklungen und somit das Offenhalten eigener, biografischer Optionen verwehrt (vgl. Böhnisch 1994: 192). Der fortschreitende Prozess der Arbeitsteilung führt eben nicht nur zu einer psychosozialen Verunsicherung, sondern kann Menschen auch von der gesellschaftlichen Entwicklung abschneiden und damit entwerten, wie das am Phänomen der „Obsolenz“ von Humankapital spürbar ist (vgl. Böhnisch 1997: 233). Böhnisch spricht in diesem Zusammenhang von der 2/3 Gesellschaft: ein Drittel ist zwar physisch versorgt, aber getrennt von gesellschaftlichen Entwicklungschancen (vgl. Böhnisch 1994: 192). Durch das Primat der Ökonomie geht die soziale Einbettung des Leistungsprinzips zunehmend verloren. Die Gesellschaft spaltet sich in diejenigen, die dazu gehören, und diejenigen die nicht mithalten können oder wollen; sie spaltet sich in jenen die drinnen sind, und jenen die ausgeschlossen bleiben. Durch vorenthaltene, fehlende, defizitäre Gestaltungsressourcen kommt es zu großen Ungleichheiten und Überforderungen (vgl. Thiersch 1997: 22). Die neoliberale Botschaft geht auch einher mit einer unterschiedlich ausgeprägten Neoliberalisierung des Sozialstaats, wodurch sich die Teilhabe am gesellschaftlich produzierten Reichtum spreizt (vgl. Galuske 2002b: 225). Dabei entstehen neue Lebenslagen der Armut, der Nicht-Partizipation an der Gesellschaft und vorenthaltener Ressourcen (vgl. Thiersch 1997: 22). Die traditionelle Erwerbsarbeit nimmt zwar ständig ab, das führt aber nicht zwangsweise zu Massenarbeitslosigkeit, sondern die Arbeit wird vielmehr entgrenzt (vgl. Böhnisch/Schröer 2002: 158). Durch das Primat der Ökonomie ändert sich das Bild einer Arbeiterin, die zunehmend sozial entbettet bereits zu 50% in prekären und fragilen Arbeitsverhältnissen beschäftigt ist (vgl. Böhnisch/Schröer 2002: 168). Die ökonomisch funktionalisierte Arbeiterin wird infolge ökonomisch intendierter Transformationsprozesse von einer entfremdeten Arbeiterin zu einer zufriedenen Konsumentin 92 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit und schließlich zur Mitgestalterin in den neuen technologischen Vorgängen. Die früher noch lebensweltlich abgegrenzte Familie und das Private werden somit stärker in die Arbeitswelt hineingezogen und von ihr bestimmt. Nicht nur Arbeit und Freizeit gehen mehr und mehr ineinander über, die Arbeitsvorgänge sind weitgehend von Raum und Zeit unabhängig und so gehen auch Arbeits- und Konsumräume ineinander über: Mit der Arbeit ist scheinbar niemals Schluss (vgl. Böhnisch/Schröer 2002: 166f.). Alltäglichkeit ist eben auch geprägt durch gesellschaftliche Entwicklungstendenzen der Individualisierung und Pluralisierung und ihrer ungleichen Verteilung von Lebensressourcen, wie sie das Bild von der 2/3 und 1/3 Gesellschaft charakterisiert (vgl. Thiersch 1992: 47). Für Böhnisch bedeutet neue Armut einen Mangel an sozialer Sicherheit, der durch den Dauerstress gekennzeichnet ist, nicht in die Abhängigkeitsstrukturen sozialer Isolation zu geraten (z.B. Alkoholabhängigkeit und/oder Depression) (vgl. Böhnisch 1994: 193). Auch diese neuen Formen der Armut erzeugen anomische Konstellationen. Durch finanzielle und soziale Belastungen werden beispielsweise AlleinerzieherInnen, Arbeitslose, an kritischen Lebenssituationen Gescheiterte oder auch MigrantInnen von der gesellschaftlichen Entwicklung zunehmend abgeschnitten (vgl. Böhnisch 1997: 235; vgl. Böhnisch/Schröer 2001: 206 f.). Menschen sind zunehmender der gesellschaftlichen Entwicklung gegenüber „ausgesetzt“ und hilflos (vgl. Böhnisch 1994: 194). Auf gesellschaftliche Sicherheiten und Möglichkeiten und Hilfesysteme können sich Menschen immer weniger verlassen. Durch die Herauslösung aus herkömmlichen Integrationsformen, müssen sie mit den ihnen eröffneten neuen, unsicheren und ungewissen Optionen selbst sehen, wie sie ihr Leben bewältigen und dabei handlungsfähig bleiben (Böhnisch/Schröer 2002: 35). Es kann mitunter hilfreich sein, dass Menschen ihre Hilflosigkeit eingestehen können. Ein personelles Eingeständnis der Hilflosigkeit muss aber mit einem sozialen Eingeständnis korrespondieren, um der Hilflosigkeit eine soziale Abstützung und ein soziales Klima entgegenzustellen, in dem eine positive Integration der Hilflosigkeit möglich ist (vgl. ebd.). Von der Sozialen Arbeit müssen angesichts der brüchigen, sozialen Akzeptanz der menschlichen Hilflosigkeit Impulse ausgehen, damit die Gesellschaft dieses soziale Eingeständnis anerkennt. Dabei sollten SozialpädagogInnen fernab von fürsorgerischen Altlasten, sich von diesem sozialen Eingeständnis inspirieren lassen und sich in ihrer Arbeit 93 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit als Teil des Netzwerkes betrachten, in dem und aus dem soziale Geborgenheit und Halt erwachsen kann (vgl. Böhnisch 1994: 195 f.). 4.1 Kritik am Krankheitskonzept Bei einer historischen Betrachtung der Problematisierung des Alkoholkonsums fällt auf, dass auf übermäßigen Alkoholgenuss zu Beginn der Neuzeit vor allem mit moralischer Empörung reagiert wurde. Luthers Strafpredigten sind ein gutes Beispiel, wie auf vermehrten Alkoholkonsum reagiert wurde. Luther sah im Alkohol den Teufel „Sauf“, der durch politische Mächte bekämpft werden sollte (vgl. Loviscach 1996: 124f.). Im 19. Jahrhundert kam es durch Industrialisierung zu immer billigeren Spirituosen, der zu regelrechten Branntweinepidemien führte. Hier konkretisierte sich die Problematisierung des Alkoholkonsums zur sozialen Diskriminierung und Ausgrenzung. Das Problem wurde als Elendsalkoholismus zu einem Etikett der Unterschichten (vgl. Loviscach 1996: 126). So konnte das Elend als Folge des vermehrten Alkoholkonsums gesehen werden und nicht etwa als Folge von Ausbeutung (vgl. ebd.). Mit Hilfe von Suchtmodellen kam es schließlich zu einer individuellen Stigmatisierung. Das Suchtmodell beruht auf dem Grundgedanken, dass Alkohol von sich aus Sucht erzeugt, die über bestimmte Kriterien definiert (vgl. z.B. ICD-10) und als Krankheit diagnostiziert wird. Die Krankheitsdiagnosen haben ohne Zweifel einen Wert für die Therapie. Dennoch können sie für die betroffenen Menschen häufig ein handfestes Stigma bedeuten, die sich für diese oft wie eine zweite Krankheit, die erheblicher als die erste sein kann, auswirkt (vgl. Schott/Tölle 2006: 497ff.). Nun könnte argumentiert werden, jeder Mensch kann in seinem Leben einmal krank werden, an einer Grippe leiden oder depressiv und alkoholabhängig sein. Die Krankheit mache den Menschen heilbar. Sie ist der Wendepunkt, an dem das Unheil sich in Heil wandeln lasse (vgl. Brandl 1999: 144). Die Stigmatisierung wird aber verstärkt durch die Kodizes der psychiatrischen Krankheitslehre (ICD, DSM), deren bedingungslose Klassifikation der Diagnosen weniger die individuellen Bedürfnisse betroffener Menschen respektiert, sondern vielmehr im Sinne der Pharmakopsychiatrie ist (vgl. Schott/Tölle 2006: 500). 94 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit Die Medizin scheint die primäre Macht über die Definition, die Organisation und die Mittel und Praktika von gesellschaftlich als legitim anerkannten Lösungen der Probleme zu haben, die sich aus der Unterscheidung von gesund oder krank ergeben (vgl. Hitzler/Pfadenhauer 1999: 97). Das Monopolsystem Medizin tritt lückenlos in Erscheinung: Praxis, Forschung, Ausbildung liegen unter einer medizinisch kontrollierten Organisationsform. Darüber hinaus definieren MedizinerInnen Qualitätsstandards für ihr Hilfspersonal und legen den Status von ihren mit ihnen kooperierenden Berufsgruppen, wie PsychologInnen, SozialarbeiterInnen etc., als Hilfs- oder ZuarbeiterInnen fest (vgl. Hitzler/Pfadenhauer 1999: 98). Jedenfalls erkennt die Medizin, dass solche kooperierenden Berufsgruppen notwendig sind. Aber das Argument, dass die Medizin ab einem bestimmten Punkt keinen weiteren Zuwachs an Gesundheit mehr bringen kann, führt zur Gefahr, dass PatientInnen zu KlientInnen irgendeiner anderen Dienstleistungshegemonie, wie etwa auch der Sozialen Arbeit gemacht werden. Dadurch könnte sich das Problem, dass unabhängige Menschen um jeden Preis zu abhängigen KlientInnen gemacht werden, nur verschieben (vgl. Illich 1995: 170). Jede Form der Abhängigkeit kann bald zu einem Hemmschuh für autonome gegenseitige Gesundheitspflege, Lebensbewältigung oder Heilung werden (vgl. Illich 1995: 171). Aus der „Alkoholabhängigkeit“ beispielsweise kann eine „ExpertInnenabhängigkeit“ werden. Durch das zentrale Dreieck des neuen psychiatrischen Mainstreams, trat in den 1970er Jahren die Psychiatrie in das „biopsychosoziale“ Zeitalter ein (vgl. Ehrenberg 2004: 121). Abgesehen von den Vorteilen, die der Abschied vom Konfliktmodell, das Freud mitbestimmte hatte, galt nun der defizitäre Mensch, der eine Krankheit hat, als Objekt seiner Krankheit (vgl. ebd.). Es ist unwichtig, ob jemand in der Kindheit einen Mangel an Liebe erlebte, oder ob jemand an einem zu niedrigen Serotoninspiegel leidet: Ein depressiver Mensch braucht sich seinen Konflikten nicht zu stellen, denn er hat eine Krankheit, von der er befreit werden kann (vgl. ebd.). Psychoanalytisch betrachtet war ein Mensch ein Subjekt, eine handelnde Person, der sich seine Konflikte vergegenwärtigen konnte und dadurch in seiner Freiheit, sich so oder so zu entscheiden, gestärkt wurde (vgl. ebd.). 95 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit Speziell die Etablierung der Medizin beruht darauf, dass es gelungen ist, das Wissen der ÄrztInnen von den Deutungs- und Handlungsmustern der Menschen abzulösen und so deren Kontrolle zu entziehen (vgl. Hitzler/Pfadenhauer 1999: 98). Medizin erweist sich in modernen Gesellschaften, als Institution mit dem höchsten Definitionspotential von Gesundheit und Krankheit, die die subjektive Problemwahrnehmung von Menschen weitgehend unbeachtet lässt (vgl. Hitzler/Pfadenhauer 1999: 103). Alkoholismus wird von der WHO als eine Krankheit mit primär biologischer Verursachung und einem vorhersagbar natürlichen Verlauf betrachtet. Alkoholismus, der durch den Begriff des Alkoholabhängigkeitssyndroms ersetzt wurde, ist als eine Krankheit mit individuellen Kontrollverlust über das eigene Leben gekennzeichnet (vgl. Dilling 2002: 10). Das Konzept der Sucht als Krankheit und der Begriff der psychischen Krankheit im Hinblick auf Depressionen ist aber umstritten. Ein streng organischer, klinischer Krankheitsbegriff versteht Krankheit lediglich als körperliche Funktionsstörung. Das Phänomen der psychischen Krankheit kann damit aber nicht erfasst werden (vgl. Dörr 2005: 18). Auch die Erweiterung der Bestimmung um die psychologische Dimension scheint nicht ausreichend zu sein. Dennoch dominiert das biomedizinische Modell nach wie vor den Umgang mit Gesundheit und Krankheit in unserer Gesellschaft (vgl. Homfeld/Sting 2006: 69). Das biomedizinische Krankheitsmodell ist auch mitverantwortlich für soziale Ausgrenzung und Diskriminierung. Die Psychiatrie steht damit im Verdacht unter Ausklammerung psychosozialer Fragen, Formen repressiver sozialer Kontrolle zu praktizieren (vgl. Dörr 2005: 19). Durch die Individualisierung des Krankheitsmodells der Sucht oder der Depression wird letztendlich die Krankheit den einzelnen Individuen selbst zugeordnet, als Regelwidrigkeit oder als abweichendes Verhalten. Dies wiederum erfordert medizinische Maßnahmen, um die Leiden zu verhindern, zu beheben oder zu lindern. Die „devianten, abweichendes Verhalten“ zeigenden Individuen werden nun also isoliert, behandelt, gebessert oder bestraft (vgl. Fuchs-Heinritz et al. 1995: 137). Psychisches Leiden ist eben auch gesellschaftlich organisiert. In therapeutischen Ansätzen und in der Ursachenforschung ist auch in der Psychiatrie eine Annäherung an den Alltag/Lebenswelt erkennbar (vgl. Lempp 1996: 57). Auch in der Psychiatrie sind Entwick96 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit lungen bemerkbar, sich von einem übergreifenden, alle psychopathologischen Phänomene erklärenden Wissenschaftskonzept abzulösen. Doch gibt es durchaus Widerstände gegen solche Entwicklungen: Einerseits lassen sich diese durch eine Trägheit jeder einmal akzeptierten wissenschaftlichen Theorie erklären, andererseits besteht eine Angst vor den Konsequenzen eines solchen Paradigmenwechsels im Kontext des Krankheitskonzepts (vgl. Lempp 1996: 57 f.). Durch den Verlust der Bedeutung der Psychopathologie und der Psychotherapie in der Psychiatrie ergibt sich aber auch das Phänomen, dass die Frage welche zugrunde liegende Krankheit durch ein klinisches Bild angezeigt wird, durch die Frage abgelöst wird: Welches Antidepressivum soll eine Ärztin für diese oder jene Art von Depressionen verschreiben? (vgl. Ehrenberg 2004: 162). Es ist interessant, dass die Diagnose auch als Ursache von Krankheit gesehen werden kann (vgl. Rudolph 2000: 255). Im Sinne des Labeling Approaches bekommt ein betroffener Mensch das Etikett „alkoholkrank“ oder „psychisch krank“ (vgl.: Lamnek 1979: 219). Dieses Etikett wird sowohl von der Umwelt, als auch von der betroffenen Person selbst wahrgenommen, akzeptiert und auch in ihr Selbstbild integriert. Erst die Reaktionen der sozialen Umwelt machen der abweichenden Person ihren abweichenden Status bewusst und provozieren gerade diese Verhaltensweisen, die ihr zugeschrieben wurden. Entsprechende Erwartungen der Gesellschaft werden durch die Person perzipiert und ihnen gemäß handelt sie auch danach (vgl. Lamnek 1979: 219 f.). Der Labeling Approach nach Sack (1972) wendet sich gegen Ansätze, die abweichendes Verhalten als gegeben ansehen und nur noch nach Ursachen im Verhalten fragen (vgl. Fuchs-Heinritz et al. 1995: 388; vgl. Lamnek 1979: 229 ff.). Störungen, Krankheiten, Abweichungen stellen für die Betroffenen und Personen aus ihrem unmittelbaren Lebenszusammenhang ein Problem dar, auf das mit soziokulturellen normativen Zuschreibungen in einer kulturell spezifisch geregelten Form reagiert wird (vgl. Dörr 2005: 20). Solche Etiketten haben aber auch für alle Beteiligten eine praktische Seite. Durch die Ungenauigkeit des Begriffs Depression etwa, kann die betroffene Person ihren Zustand und die Ärztin ihre Handlungsweisen rechtfertigen, und das mit einer praktischen, gängigen Bezeichnung, die mit Sicherheit eine große Anzahl von Phänomenen ausdrückt, von denen bei weitem nicht alles bekannt ist (vgl. Ehrenberg 2004: 162f.). 97 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit Kleve geht davon aus, dass der Kreislauf von immer wiederkehrenden Verhaltensweisen oder die „Trivialität sozialer Problemlagen“, wie er es beschreibt, ihre Ursache nicht primär in den KlientInnen hat, sondern dass personale Eigenschaften und Selbstbeschreibungen immer gebunden an soziale Kontexte sind (vgl. Kleve 2003: 121). Im Hinblick auf Lebenskrisen sollten sich auch SozialarbeiterInnen an der Frage orientieren, ob die Wirklichkeiten der KlientInnen dazu prädestiniert sind, problemlösend zu wirken. Konstruktivisten schlagen vor, dass Menschen oder andere soziale Systeme, die unter ihren sinn- und bedeutungsgebenden Wirklichkeitskonstruktionen leiden, dazu angeregt werden sollten, sich passendere Wirklichkeiten zweiter Ordnung zu erschaffen. Watzlawick geht m.E. zu recht davon aus, dass es keine absolute Wirklichkeit gibt, sondern nur subjektive, zum Teil völlig widersprüchliche Wirklichkeitsauffassungen, von denen dann leichtfertig und naiv angenommen wird, dass die der „wirklichen“ Wirklichkeit entsprechen (vgl. Watzlawick 2005: 142). Vor allem in der Psychiatrie spielt die Wirklichkeitsauffassung als Gradmesser der Normalität eine besondere Rolle. Hier vermischen sich meist zwei sehr verschiedene Begriffe der Wirklichkeit, ohne genügend Rechenschaft darüber zu geben (vgl. ebd.). Die erste ist bezogen auf rein physische und weitgehend objektiv feststellbare Eigenschaften von Dingen und, laut Watzlawick, damit auf Fragen des so genannten gesunden Hausverstands oder des objektiven wissenschaftlichen Vorgehens bezogen; die zweite beruht auf die Zuschreibung von Sinn und Wert dieser Dinge und somit auf Kommunikation (vgl. Watzlawick 2005: 142 f.). Als Wirklichkeit erster Ordnung können jene Wirklichkeitsaspekte aufgefasst werden, die sich „vor allem auf experimentelle, wiederholbare und verifizierbare Nachweise beziehen“ (Watzlawick 2005: 143). Was aber bedeuten diese Tatsachen, was haben sie für einen Wert? Diese Fragen stellen den Zugang zur Wirklichkeit zweiter Ordnung dar. Die Wirklichkeit erster Ordnung etwa des Alkohols, also seine physischen Eigenschaften sind bekannt und verifizierbar. Die Bedeutung, die der Alkohol im menschlichen Leben spielt und dass diese Bedeutungen viele andere Aspekte unserer Wirklichkeit weitgehend bestimmen, hat mit seinen physischen Eigenschaften sehr wenig zu tun. Diese zweite Wirklichkeit des Alkohols aber ist es auch, die in einer bestimmten Gesellschaft über die Begriffe gesund oder krank im Umgang mit Alkohol oder bezüglich einer Depression entscheiden (vgl. ebd.). 98 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit Depression oder Melancholie haben für Menschen unterschiedliche Bedeutungen. So können es die einen als Lebensstil bezeichnen, und ein durchaus erfolgreiches und gelingendes Leben führen. In der Jugendkulturszene der Gothics etwa üben Melancholie und Todessehnsucht eine faszinierende Anziehungskraft aus (vgl. Coutandin 1998: 174 ff.). Rockgruppen wie „The Cure“ oder „Sisters of Mercy“ pflegen einen bewusst melancholischen Stil in ihren Liedern und ziehen damit Massen von „gesunden“ Fans an. Diese Jugendkulturszenen bieten unter anderem auch die Möglichkeit Gefühle wie Melancholie und Depression ausleben zu können und eröffnet somit einen akzeptierten Raum, um mit depressiven Stimmungen gemeinschaftlich umgehen zu können (vgl. Coutandin 1998: 179/184). Subjektiv gesehen können die von dieser Jugendkultur gerne und oft verwendeten Symbole für Trauer und Tod auch eine Hilfe sein, um mit Stimmungsschwankungen umgehen zu können (vgl. Coutandin 1998: 184). Die Menschen wollen die „die düsteren Seiten des Lebens nicht abwehren, sondern versuchen ihnen ins Gesicht zu schauen“ (ebd.). Gleichzeitig dienen diese speziellen Handlungs- und Deutungsmuster als Strategien, um sich von der Familie abzulösen, um den Horizont zu erweitern, um herauszukommen aus der familiären und kleinstädtischen Enge, um sich bewusst vom „Normalen“ abzusetzen, und um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass man/frau eben anders ist (vgl. ebd.). Für manche bedeutet Depression aber beispielsweise Ausweglosigkeit und Krankheit. Der eigentliche Wahn liegt in der Annahme, dass es eine „wirkliche“ Wirklichkeit zweiter Ordnung gibt und dass „Normale“ sich in ihr besser auskennen als „Geistesgestörte“ (Watzlawick 2005: 144). Die Wirklichkeiten zweiter Ordnung sollten nicht anhand eines Grades von Wirklichtsauffassungen beurteilt werden, aus dem sich für die Psychiatrie die Kategorien von geistiger Gesundheit oder Krankheit ergeben (vgl. Kleve 2003: 111). Der Psychiatrie fällt es dabei zunehmend schwerer, auf verbindende und allgemeingültige Kriterien für eine angemessene Wirklichkeitsanpassung Bezug zu nehmen (vgl. Kleve 2003: 112). Die Phänomene der Alkoholabhängigkeit und der Depression sind wie bereits schon angedeutet eingebettet in gewisse Bezugssysteme. Solche Bezugssysteme werden durch die 99 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit Grenzen der Sprache in ihre Schranken verwiesen und die Sprache bestimmt den wirklichkeitsschaffenden Diskurs (vgl. Kleve 2003: 112). Es ist nur möglich sich selbst als depressiv oder alkoholabhängig zu bezeichnen und die in einem Diskurs als dazugehörig angesehenen Symptome wahrzunehmen, wenn es in einem spezifischen Diskurs möglich ist das Wort „depressiv“ oder „alkoholabhängig“ zu verwenden (vgl. ebd.). Für die Soziale Arbeit ist es besonders wichtig darauf zu achten, mit welchen Worten Problemdefinitionen konstruiert oder beschrieben werden. Wenn sozialarbeiterische Beschreibungen der KlientInnen primär auf Worten basieren, die psychische Defizite bezeichnen, werden diese möglicherweise größere Schwierigkeiten haben, Verhaltensweisen oder Ressourcen an sich zu beobachten, die zur Problemlösung beitragen können (vgl. ebd.). Zudem ist festzuhalten, dass Suchterfahrungen und Depressionen Lebenserfahrungen sind, denen spätestens auch mit ihrer Überwindung Bedeutung und Sinn zukommt (vgl. Loviscach 1996: 37). Die Erfahrung von Krankheit, Schmerz und Tod wird durch bewusst gelebte Gebrechlichkeit, Individualität und soziale Offenheit des Menschen zu einem wesentlichen Bestandteil des Lebens (vgl. Illich 1995: 203). Solche und ähnliche Lebenserfahrungen können durchaus den eigenen Horizont erweitern und Chancen neuer, vielleicht auch gelingenderer Lebensbewältigungsstrategien oder Deutungsmuster eröffnen. Die Fähigkeit solche Lebenserfahrungen aber autonom zu bewältigen ist Grundlage der Gesundheit des Menschen, und sollte nicht von der bürokratischen Verwaltung seiner Intimsphäre so abhängig gemacht werden, dass er seine Autonomie, letztlich die Grundlage seiner Gesundheit aufgeben muss (vgl. ebd.). Hier ist auch Soziale Arbeit gefordert, die ihren AdressatInnen adäquate Chancen der autonomen Lebensbewältigung anbieten und eröffnen kann, ohne dabei Gefahr zu laufen, sie zu zwingen und letztendlich autonome Ressourcen zu zerstören. Das biomedizinische Paradigma ist bereits einer grundlegenden Kritik unterzogen worden (vgl. Homfeld/Sting 2006: 70). Vor allem wird auch Kritik daran geübt, dass der Mensch als Subjekt oder Handelnder hierbei weitgehend ausgeklammert wird (vgl. ebd.). Das Subjekt sollte aber auch in der Medizin wieder in den Vordergrund gerückt werden (vgl. Schott/Tölle 2006: 509). 100 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit Die Erweiterung biomedizinischer Modelle kommt etwa im Risikofaktorenmodell zum Ausdruck. Das so genannte Risikofaktorenmodell betrachtet Gesundheit oder Krankheit als multifaktorielles Geschehen und betrachtet neben körperbezogenen (Risiko) Verhalten, auch psychosoziale Faktoren. Hier ergeben sich vor allem Ansatzpunkte für verhaltens- und verhältnisbezogene Präventionsmaßnahmen. Im Rahmen des Stress-CopingParadigmas wird das soziale Leben auf verschiedene Weisen gesundheitsrelevant und Gesundheit beeinflussbar (vgl. Homfeld/Sting 2006: 72). Kritik kann geübt werden, dass nach diesem Modell Prävention vor allem über die Reduzierung von Risikofaktoren, wie etwa das Trinken verläuft und nicht die positiven Seiten von Risikoverhalten aufzeigt (vgl. ebd.). Die subjektive Bedeutung des Risikofaktors Alkohol etwa „bildet das Erleben des Risikoverhaltens im Hinblick auf Selbstwert und soziale Anerkennung (…), den strategischen Punkt, an dem sich Risikofaktoren und protektive Maßnahmen treffen, und wo sich entscheidet, ob Ansätze von Risikoverhalten immer wieder abgeschwächt werden und aufgehen können in sozial konformen Verhalten oder ob sie umschlagen in versteigerte riskante Lebensformen“ (Böhnisch 2001: 136). Trotz aller wissenschaftlichen und politischen Bestrebungen bleibt das medizinische Krankheitsmodell aufgrund juristischer, verwaltungstechnischer Regelungen und Finanzierungsbedingungen gesichert. Die Kritik am Krankheitsmodell könnte als Angriff auf die Ärzteschaft aufgefasst werden, die in Bezug auf psychische Krankheit den Anspruch auf Erkennung und Behandlung stellt und besitzt (vgl. Dörr 2005: 21). Das medizinische Krankheitsmodell fungiert als gesellschaftlich konstruierte Normschranke, die eben gewisse Verhaltensmuster als depressive Störung oder Alkoholabhängigkeit klassifizieren. Modelle und Konzeptionen psychischer Krankheit sollten notwendigerweise auch in der Sozialen Arbeit Teil des Diskurses sein. Sozialpädagogik als handelnde, kontextualisierende Wissenschaft erscheint Schreiber (1999) am geeignetsten zu sein, „eine Integration von lebensweltlich orientiertem Verstehen und darauf bezogener Hilfepraxis zu entwickeln“ (Schreiber 1999: 110). Psychische Störungen lassen sich nur unter Einbeziehung des gesellschaftlichen, lebensweltlichen Bedingungsgefüges verstehen. Der Mensch ist ein organisches, psychisches und soziales Wesen, das von außen wahrgenommen wird, sich innerlich erlebt und bewusst nach außen verhält. Somit bilden biologische, psychische und gesellschaftliche 101 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit Existenz einen Wirkzusammenhang. Der auf die eigene Lebenspraxis bezogene Ausdruck von psychischem Leiden ist eingebettet in soziale Sinnstrukturen. Zugleich ist er als ein Produkt der persönlichen Verarbeitung widersprüchlicher, gesellschaftlicher Anforderungen zu sehen. Psychische Störung ist gelebte Erfahrung (vgl. Dörr 2005: 21f.). Eine integrative Diagnostik umfasst soziokulturelle und historische Kontexte. Sie ist zudem angewiesen auf eine klinische Krankheitslehre, die Pathogenese multifaktoriell erfasst, also unter Berücksichtigung von lebensweltlichem Kontext, Biografie und Prozessen der Subjektentwicklung (vgl. Schreiber 1999: 110 f.). Durch das Augenmerk auf die Person, deren Biografie und Kontext, das Verhältnis von Nutzerin und (anderer) Expertin, den „Sinn“ der Krankheit und durch einen reflektierten Krankheitsbegriff, der sich gegen die Verengung in der naturwissenschaftlichen Medizin richtet, könnten die wissenschaftlichen Methoden wieder dem Subjekt „Mensch“ entsprechen, ohne ihn reduktionistisch als Objekt zu entwerten (vgl. Schott/Tölle 2006: 509f.). 4.2 Professionelle Handlungsstrategien Lebensweltorientierte Soziale Arbeit betont die Vielfalt der im Alltag zu bewältigenden Aufgaben und Probleme (vgl. Grunwald/Thiersch 2001: 1137). Das Ziel von Lebensweltorientierung und Lebensbewältigung ist, im Hinblick auf die Frage nach (wieder gewonnener) Handlungsfähigkeit der Menschen, ein gelingenderer Alltag (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2002: 164; vgl. Böhnisch 2002: 202). Dieses Ziel ist verbunden mit den Rechten auf Integration - verstanden als eine Lebenswelt ohne Ausgrenzung von gesellschaftlichen Entwicklungschancen - in der Anerkennung von Unterschiedlichkeiten auf der Basis elementarer Gleichheit und der Partizipation als Recht auf Mitbestimmungs- und Beteiligungsmöglichkeiten (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2002: 173f.). Dabei versucht Lebensweltorientierte Soziale Arbeit „Menschen im Medium ihrer erlebten, erfahrenen Deutungs- und Handlungsmuster durch Unterstützung, Provokation und Arbeit an Alternativen“ (Grunwald/Thiersch 2004: 5) in den Krisen heutiger, risikoreicher Normalität, neben den klassischen Aufgaben der Regulation von sozialen und entwicklungsbedingten Ungleichheiten, bei der Herstellung und Sicherung der persönlichen Ressourcen zu unterstützen: das Konzept der Lebensbewältigung tritt in den Vordergrund 102 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit sozialpädagogischen Handelns (vgl. Rauschenbach 1992: 51 f.; vgl. Grunwald/Thiersch 2001: 1141; vgl. Böhnisch 1994: 168 f.). Meine Darstellung versuchte bisher auch deutlich zu machen, dass es bei der Betrachtung der hier beschriebenen Deutungs- und Handlungsmuster hegemoniale Ansprüche gewisser disziplinärer Ideologien gibt, die den Anspruch haben, die „wahren Ursachen“ erkannt zu haben. Daraus ergibt sich durch eine disziplinär abgesicherte und institutionalisierte Definitionsmacht über die „wahren Ursachen“ für handlungs- und interventionsorientierte Disziplinen, die sich wie Soziale Arbeit an den Subjekten orientieren, eine gewisse Nachrangigkeit (vgl. Böhnisch 1994: 176). In einer solchen Problematik, die sich aus den von mir dargestellten Bewältigungsstrategien ergeben können, ist es aber kontraproduktiv, eine sozialpädagogische und klinisch-therapeutische Perspektive zu trennen. Die Hilfe, die Menschen in diesen Lebenslagen eröffnet werden kann, geht sowohl über rein klinisch, psychiatrisch orientierte Behandlungsstrategien, als auch über allgemeine Lebensberatung und Gestaltung des aktuellen sozialen Kontextes hinaus (vgl. Schreiber 1999: 24; vgl. Zingerle et al. 1998: 107). Dabei bestehen sowohl Möglichkeiten und deutlich sichtbare Grenzen von medizinisch und psychologisch begründeten Problemdefinitionen und Problemlösungsstrategien. Auch für die Soziale Arbeit bestehen diese Grenzen und Möglichkeiten, die sich für ihre Disziplin und Profession in Bezug auf Alkoholabhängigkeit und/oder Depression durch ihre Ansätze, Lösungsstrategien und bereits gewonnenen Erfahrungen in der Drogenarbeit und psychisch beeinträchtigten Menschen ergeben. Trotz aller Divergenzen sollten die (sich bereits erkennbaren) Konvergenzen multiprofessionell, im Sinne der AdressatInnen nutzbar gemacht werden (vgl. Bader/Hey/Stöver 1997: 309 f.). Alkoholgebrauch verweist laut Thiersch auf ein spezielles Deutungs- und Handlungsmuster im Leben eines Menschen (vgl. Thiersch 1995: 121). Auch der Rückzug in die Innerlichkeit, das Abkapseln von der Außenwelt, Schmerz, Angst, Leid, Erschöpfung, Überforderung, quälende Unsicherheiten, Gedanken an den Tod, negative Zukunftsperspektiven, die im Begriff der Depression zum Ausdruck kommen, weisen auf ein solches Handlungs- und Deutungsmuster hin. Dabei sollten diese Handlungs- und Deutungsmuster nicht abqualifiziert, sondern in ihren Motiven im Zusammenspiel verschiedener Hand103 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit lungsmuster und im Kontext der Biografie gesehen werden (vgl. Thiersch 1995: 122). Alkoholgebrauch, auch im Zusammenspiel mit Depression, ist demnach normaler Ausdruck eines Menschen zur Bewältigung spezifischer Aufgaben und Probleme seines Alltags. Alkoholgebrauch (und -missbrauch) ist „ein Mittel, um sich in den gegebenen Lebensaufgaben zu arrangieren, ein Deutungs- und Handlungsmuster“ (ebd.). Alkohol wird als Mittel benutzt, um unterschiedliche Muster der Lebensbewältigung zu ermöglichen (vgl. Thiersch 1995: 123). Die Bewältigungsleistung der AdressatInnen sollte zunächst als produktiv und schützend gesehen werden (vgl. Schreiber 1999: 115). Zunächst ist Alkoholgebrauch eingebettet in andere Formen der Lebensbewältigungen, als ein Moment im Insgesamt einer Lebensstrategie (vgl. Thiersch 1995: 124). Wenn aber Alkoholgebrauch zunehmend andere Strategien beherrscht und entwertet, kann es sich zum dominanten Lebensmuster entwickeln, und sich als nicht gelingendes Bewältigungsmuster herausstellen (vgl. Thiersch 1995: 125). Daraus ergibt sich eine doppelte Problematik: die Bewältigungsstrategien, wie Alkoholgebrauch oder Depression sind zwar für AdressatInnen möglicherweise produktiv, schützend, identitätsstiftend; zugleich können sie aber auch entwicklungsverhindernd und dysfunktional sein. Der Alkohol, auch im Hinblick auf Depression, mag den Menschen Daseinsgewissheit geben oder Schmerzen lindern. Zugleich kann er aber auch das Leben auf vielen Ebenen ruinieren (vgl. Schreiber 1999: 115). Lebensweltorientierte Soziale Arbeit erkennt solche Deutungs- und Handlungsmuster eben auch als widersprüchlich. So können diese als einengend, ausgrenzend und blockierend erfahren werden. In einer Dialektik von Gelingendem und Verfehltem besteht Lebensweltorientierte Soziale Arbeit in einem Widerspiel von Respekt und Destruktion auch auf eine notwendige Destruktion des Gegebenen im Namen gelingenderer Verhältnisse (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2002: 170). Das bedeutet, dass die Veränderung der Handlungs- und Deutungsmuster im Alltag einhergehen muss mit der Veränderung gesellschaftlicher Strukturen, die diese bestimmen (vgl. Thiersch 1986: 35). Welche Handlungsstrategien im individuellen Fall angezeigt sind, kann im Vorhinein und Allgemeinen nicht entschieden werden. Dazu ist im Hinblick auf einen gelingerenden Alltag ein mühsamer Prozess des Aushandelns unter allen Beteiligten notwendig, ohne Gefahr zu laufen 104 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit die Problemlösungsressourcen der AdressatInnen zu entwerten (vgl. Thiersch 1986: 40; 11). Gelingender können diese Bewältigungsmuster keineswegs nur wieder werden, indem diese Strategien „verboten“ werden, also z.B. der vollständige, lebenslange Verzicht von Alkohol nahe gelegt wird, sondern durchaus auch dann, indem diese Bewältigungsmuster wieder eingebettet werden in andere Strategien (vgl. Thiersch 1995: 125). Es geht also konkret um eine am Subjekt orientierte Hilfeplanung und -gestaltung, die jeden Fall anders sieht und unterschiedliche Möglichkeiten in Bezug auf eine gelingendere Lebensgestaltung mit oder ohne Alkohol eröffnet und aushandelt und dabei auch depressive Handlungs- und Deutungsmuster berücksichtigt (vgl. Reinl/Füssenhäuser/Stumpp 2004: 190 f.). Thiersch weist darauf hin, dass Probleme wie nicht gelingender Alkoholgebrauch und/oder depressive Bewältigungsstrategien nicht am Rand der Gesellschaft, sondern in ihrer Mitte präsent sind (vgl. Thiersch 1995: 120). So betrachtet können diese Deutungsund Handlungsmuster keinesfalls ein Verhalten darstellen, die Exklusion nach sich ziehen, sondern sie müssten im Gegenteil sozialintegrativen Charakter haben. Ein solches Verhalten ist nicht aus der Gesellschaft ausgrenzbar, und somit ergeben sich Chancen auf Integration und Stabilität (vgl. Böhnisch 1994: 172). In ihren Struktur- und Handlungsmaximen - der Prinzipien von Prävention, Alltagsnähe, Integration, Partizipation und Vernetzung - konkretisiert sich Lebensweltorientierte Soziale Arbeit (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2002: 173). Professionelle Drogenarbeit umfasst laut Thiersch vier Momente: Prävention, Repression, Therapie und Überlebenshilfe. Dabei sollte der Gesamtkontext dieses Konzepts gesehen werden, ohne den Versuch zu unternehmen, ein Moment gegen das andere auszuspielen (vgl. Thiersch 1995: 132). 4.2.1 Prävention Lebensweltorientierte Prävention, allgemein verstanden, „zielt auf die Stabilisierung und Inszenierung belastbarer und unterstützender Infrastrukturen und auf die Bildung und Stabilisierung allgemeiner Kompetenzen zur Lebensbewältigung“ (Thiersch/Grunwald/Köngeter 105 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit 2002: 173). Als spezielle Prävention versucht sie in rechtzeitiger und vorausschauender Sicht in sich abzeichnenden Krisen zu agieren (vgl. ebd.). Thiersch benutzt den Begriff Prävention im Hinblick auf Alkoholgebrauch „als Frage nach der Herstellung stabiler, belastbarer Verhältnisse, in denen sich Suchtmittelmissbrauch nicht ausbilden muss“ (Thiersch 1995: 133). Suchtprävention die AlkoholkonsumentInnen vom negativen Ende her versteht, hat gewisse Schwächen, räumt Thiersch ein (vgl. ebd.). Zuerst einmal muss erst etwas oder jemand zum realen Gegner erklärt bzw. konstruiert werden; der Alkohol oder der Alkoholgebrauch, die böse Peer Group, die Discotheken etc. (vgl. Quensel 2004: 75 f.). Dahingehend werden solche konstruierten Gegner als negativ, belastend, krankmachend, gefährlich, störend, hemmend beschrieben. Andere (positive) Seiten oder vielfältige Ambivalenzen werden meist ausgeblendet. Wenn ein solches Konzept versagt, wird die Schuld nicht dem Konzept bzw. der Expertin gegeben, sondern meist der Klientin zugeschrieben, die unwillig ist, Widerstand übt oder dagegen resistent ist (vgl. Quensel 2004: 76). Solche Konstruktionen der Gegner haben einen entscheidenden Nachteil: „Im humanwissenschaftlichen Therapie-Bereich dagegen geraten solche Konstruktionen zum zentralen Agens, das diesen Konstruktionen dann auch zum Leben, zur Realität verhilft; sei es durch unsere darauf fußende realen Aktionen, sei es, weil die Betroffenen im Guten (bei gelingender Therapie), wie auch im Bösen diese Zuschreibungen in ihr Selbstbild und in ihr darauf ausgerichtetes Handeln aufnehmen“ (Quensel 2004: 76). Der klassische Präventionsgedanke (primäre, sekundäre, tertiäre Prävention) fußt auf der Grundannahme, dass es verallgemeinerbare, gesellschaftlich anerkannte Vorstellungen gibt, was als abweichendes bzw. konformes Verhalten anzusehen ist (vgl. Böllert 2001: 1394). Außerdem sind gegenwärtige Präventionsmaßnahmen durch andere zahlreiche Schwierigkeiten, wie durch unklare Zielvorstellungen oder durch die Tatsache der Steigerung des Drogenkonsums trotz zunehmender Prävention, zum Scheitern verurteilt (vgl. Quensel 2004: 21 ff.; 35 ff.). Der Präventionsgedanke von Thiersch differenziert das klassische, in unterschiedlichen Dimensionen gestufte Präventionskonzept und geht darüber hinaus (vgl. Thiersch 1995: 133). Primäre Prävention zielt demnach „auf lebenswerte, stabile Verhältnisse, auf Verhältnisse also, die es nicht zu Konflikten und Krisen kommen lassen“ (BfJFFG 1990: 85). 106 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit Sekundäre Prävention zielt auf „vorbeugende Hilfen in Situationen, die erfahrungsgemäß belastend sind und sich zu Krisen aufwachsen können“ (ebd.). Damit behält der Präventionsbegriff auch für die Soziale Arbeit seine Attraktivität. Im Mittelpunkt einer solchen Präventionsvorstellung soll nicht nur der Einzelfall, sondern auch das ihm umgebende Milieu, das Gemeinwesen, schließlich die verschiedenen Dimensionen von Lebensverhältnissen stehen. Prävention soll sich somit auf die Ebene der Gesellschaftspolitik, auf die Ebene der Institutionen und auf die Ebene von Individualprogrammen beziehen (vgl. Böllert 2001: 1395; vgl. Thiersch 1995: 134 f.). Dabei sollten aber Präventionsarbeit vom Eigensinn ihrer Aufgaben aus und nicht von der Seite der Belastungen und Risiken begründet sein (vgl. BfJFFG 1990: 86). Vor dem Hintergrund, dass Kinder aus suchtbelasteten Familien, als große Gruppe für die Entwicklung eigener Abhängigkeitsrisiken angesehen werden, sollten vorhandene Hilfsstrukturen auch aus präventiver Sicht enger vernetzt werden. Um die Situation betroffener Kinder nachhaltig zu verbessern, ist es beispielsweise angezeigt, dass sich die Kommunikationsstruktur zwischen Sucht- und Jugendhilfe verbessert (vgl. Baumgärtner/Scharping 2006: 610). Eine Möglichkeit der Prävention ist auch die Schaffung attraktiver Lebensräume (vgl. Thiersch 1995: 134). Diese Notwendigkeit zur „Gestaltung des Sozialen“ (Autrata/Scheu 2006) wird durch ein Grundverständnis Sozialer Arbeit, das gestaltende Einflussnahme anstrebt, ausgedrückt (vgl. Autrata/Scheu 2006: 14 ff.). In Ahnlehnung an Nohl machen Autrata/Scheu deutlich: „Man kann die Probleme Jugendlicher nicht einfach dadurch beheben, dass den Jugendlichen eine gesellschaftskonforme Lebensweise pädagogisch nahe gelegt wird. Zu prüfen ist, ob gesellschaftlich für Jugendliche (und andere Bevölkerungsgruppen) überhaupt noch adäquate Lebensmöglichkeiten bereit stehen“ (Autrata/Scheu 2006: 15). Wenn dem nicht so ist, müssten entsprechende Möglichkeiten geschaffen werden (vgl. ebd.). Eine andere effektive Chance der Prävention liegt für Thiersch in Räumen „zur Gestaltung und Praktiken im Erkennen, im Handeln und vor allem auch in der Körpererfahrung“ (Thiersch 1995: 135). Dies bestätigt etwa die Feldkirchner Jugendstudie 2004 (Autrata/Scheu 2004), bei der als ein zentrales Ergebnis zu sehen ist, dass sich Jugendliche vor 107 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit allem mehr Sportangebote, schöne Plätze und Parks, Räume zur Unterhaltung und zum Verweilen wünschen und zum Teil auch bereit wären sich dort zu engagieren und mitzuarbeiten (vgl. Hönig/Scheu 2006: 72 f.). 4.2.2 Repression Aus präventiver Sicht scheint es nötig zu sein, den Alkoholkonsum stärker zu problematisieren (vgl. Tretter 1998: 235). Diese Einschätzung ergibt sich einerseits aus der ambivalenten, widersprüchlichen Einstellung hinsichtlich Politik und Recht zwischen illegalen und legalen Drogen, andererseits durch die, auch im Hinblick auf Depressionen zunehmenden individuellen, familiären, gesellschaftlichen Konsequenzen, die sich durch die Gewährung der höchstmöglichen Freiheit im Zugang zu Alkohol ergeben (vgl. Böllinger 2000: 26 f.). Die Bedingungen des Alkoholkonsums könnten staatlich auch stärker reguliert werden, damit das Elend der sich durch den Alkoholkonsum ergebenden Probleme nicht heruntergespielt und weniger dramatisch verhandelt wird als bei illegalen Drogen. Ansonsten wäre die Drogenpolitik und -diskussion im Hinblick auf illegale Drogen nur ein unberechtigt übertonter Nebenschauplatz (vgl. Thiersch 1995: 131; vgl. Tretter 1998: 235). Aus präventiver Sicht ist es nicht plausibel, dass legaler Drogenkonsum durch gesellschaftliche und politische Gegebenheiten (z.B. durch Werbung) forciert wird, während einige illegale Substanzen, die sich gegenüber Alkohol oder Zigaretten als weniger brisant herausgestellt haben, kriminalisiert werden (vgl. Schmidt/Hurrelmann 2000: 19). Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, eine Erhöhung von Alkoholsteuern zu diskutieren, die jedoch direkt in die Schadensregulierung für den Bereich der alkoholbedingten Probleme umgesetzt werden sollte (vgl. Tretter 1998: 235). Darüber hinaus gibt es zahlreiche politische Strategien der Alkoholprävention, die zu überdenken wären (vgl. Toomey/Wagenaar 2000: 132 ff.): • Strategien mit Auswirkungen darauf, wie, wann, und wo Alkohol verkauft wird (z.B. Beschränkung der Tankstellenverkaufszeiten, Schulung des Verkaufpersonals). • Strategien wie, wann, und wo Alkohol konsumiert wird (z.B. Beschränkung des Konsums in Stadien). 108 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit • Andere Strategien mit Auswirkungen auf den Alkoholpreis (z.B. Beschränkung von Flat-Rate Partys oder All Inclusive Partys). • Strategien mit Auswirkungen auf das soziale Umfeld (z.B. Warnetiketten wie auf Zigarettenschachteln, Beschränkungen und Platzierung von Alkoholwerbung). • Strategien der Umsetzung/Durchführung (z.B. Verwaltungsstrafgebühren, Pflicht zur Überprüfung der Regeleinhaltung, Sanktionen gegen Ausweisfälscher). • Strategien mit Auswirkungen auf die Verfügbarkeit bei Minderjährigen (z.B. Mindestalter, Beschränkungen von Alkopops, Verbot von Werbestrategien und Produkten, die bewusst Jugendliche ansprechen). Daneben wäre es im Bereich von Institutionen möglich, gewisse Richtlinien als Strategien zu implementieren, die Trinkmuster bei Jugendlichen und in der Allgemeinbevölkerung beeinflussen (vgl. Toomey/Wagenaar 2000: 140). Denkbar wäre hier z.B. ein freiwilliger Bann von Alkoholwerbung in Restaurants oder Hotels oder etwa der bewusste Verzicht von Alkoholausschank bei einer Sponsionsfeier oder anderen fachhochschulischen/universitären Veranstaltungen. Suchtpräventionspolitik sollte als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen werden, die eingebettet ist „in ein übergreifendes psychosoziales, kulturelles, ökologisches, ökonomisches und politisches Netz“ (Schmidt/Hurrelmann 2000: 20). Um zu einem neuen, differenzierten Umgang mit Alkohol oder anderen Drogen zu kommen, bedarf es „längerfristiger, differenzierter, fachlicher, politischer und gesellschaftlicher Diskussionen“ (Thiersch 1995: 135), die darauf abzielen die Menschen grundsätzlich zu befähigen und es ihnen zu ermöglichen ein selbstbestimmtes und verantwortungsbewusstes, gesundheitsgerechtes Leben in einer gesundheitsförderlichen Umwelt zu führen (vgl. Schmidt/Hurrelmann 2000: 20). 4.2.3 Therapie und Überlebenshilfe Im Sinne einer Therapie und Überlebenshilfe könnte es für in ihrer Handlungsfähigkeit beeinträchtigte Menschen bei ihren professionellen PartnerInnen mehr Unterstützung geben als bisher. 109 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit Derzeit ist das Hilfesystem im rehabilitativen Bereich beispielsweise in Kärnten im Krankenhaus de La Tour nur für Betroffene zugänglich, die über gut entwickelte psychosoziale Kompetenzen verfügen und so den Anforderungen der Institution gerecht werden. So wendet sich das Krankenhaus primär an abstinenzwillige Menschen, mit dem obersten Ziel der absoluten Abstinenz (vgl. Scholz et al. 1998: 77f.). Für die Behandlungsmaßnahmen der Beendigung der Alkoholeinnahme und der Erarbeitung einer „positiven Einstellung zur Suchtmittelabstinenz“ ist laut Scholz et al. ein “Mindestmaß von körperlicher und geistiger Mitarbeit erforderlich“: deswegen scheiden erst einmal „körperlich und psychisch Schwerkranke“ für eine Behandlung aus (vgl. Scholz et al. 1998: 77). Depressiven Menschen fällt es möglicherweise schwerer zu solch einer „positiven Einstellung“ zu kommen. Darüber hinaus müssen Entwöhnungswillige bis zum Beginn einer Therapie eine Wartezeit überbrücken und mit Hilfe (chef)ärztlicher Untersuchungen und regelmäßigen telefonischen Kontakten zur Institution den Weg bis zur Aufnahme in eine Entwöhnungsbehandlung bewältigen (vgl. Scholz et al. 1998: 77f.). Menschen, die über größere psychische und soziale Ressourcen verfügen, erhalten eine längerfristige Rehabilitationsmaßnahme. Diejenigen, die über solche Kompetenzen nicht verfügen, erhalten keine bzw. meist kurzfristige auf die körperliche Verfassung bezogene, medikamentöse Akut- oder Entgiftungsbehandlung in Einrichtungen, wie dem Zentrum für Seelische Gesundheit in Klagenfurt, der Abteilung für Neurologie und Psychosomatik in Villach oder anderen regionalen Krankenhäusern (vgl. Bader/Hey/Stöver 1997: 311; vgl. Scholz et al. 1998: 77). In Kärnten hat sich in Bezug auf die Versorgung der Menschen mit den von mir dargestellten Problematiken somit ein Zwei-Klassen-Behandlungssystem etabliert. Darüber hinaus beschränkt sich die Nachsorge auf Institutionen, die neben Einzelgesprächen zur Stützung oder Wiederbelebung der „mühsam erworbenen Bereitschaft zur völligen Abstinenz“, auch Nachbetreuungsgruppen anbieten, die vor allem aus ebenfalls zur Abstinenz motivierten Abhängigen besteht (vgl. Scholz/Zingerle/Oblak 1998: 101 f.). Diese mit dem Leidensdrucktheorem begründete, moralisch-ideologische Voraussetzung der Hilfegewährung steht in unüberbrückbaren Widerspruch zu einer Subjektorientierung an den AdressatInnen (vgl. Bader/Hey/Stöver 1997: 317). 110 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit In der Sozialpolitik in Kärnten bedarf es auch in Anbetracht der Zunahme der beiden Phänomene und der Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens von Abhängigkeit und Depression neuer Überlegungen. Das bestehende Hilfesystem für Menschen könnte durch ein bedarfs- und versorgungsorientiertes Hilfesystem ergänzt werden, das regionalisiert und vernetzt agieren müsste (vgl. Bader/Hey/Stöver 1997: 312 f.). Ein differenziertes Hilfsangebot macht die Vernetzung eines multiprofessionellem Hilfesystems nötig, das bedarfsorientiert je nach Dringlichkeit und Verlauf, einzelne Elemente eines Therapieprozesses flexibel nutzbar macht (vgl. Bader/Hey/Stöver 1997: 313f.). Diese Regionalisierung und Vernetzung betont unter anderem auch die in der Alltagsnähe intendierte Präsenz von Hilfen vor Ort (vgl. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2002: 174). Schon die unterschiedlichen Ausprägungen der Bewältigungsstrategien Alkoholgebrauch und/oder Depression, die Heterogenität bei Menschen mit nicht gelingendem Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien, machen es notwendig, NutzerInnen auch unterschiedliche Angebote in der Therapie zu eröffnen (vgl. Thiersch 1995: 136 f.). Lineare Entwicklungsmodelle, wie das von Jellinek (1960/1972) erweisen sich aufgrund unterschiedlicher Biografien, subjektiver Gründe und Bedeutungen dieser Bewältigungsstrategien, persönlicher Ressourcen und dem je eigenen Hintergrund biopsychosozialer Kontexte als äußerst schwierig in Bezug auf Verallgemeinerbarkeit und Nutzen (vgl. Reinl/Füssenhäuser/Stumpp 2004: 176). Die Therapie als primäre Frage nach der Heilung von der Sucht durch Abstinenz oder der verkürzenden Konzentration auf den Stoff Alkohol, verweist auf die Notwendigkeit neuer, überfälliger Angebote (vgl. Reinl/Füssenhäuser/Stumpp 2004: 173). In der Normalität gesellschaftlicher Strukturen und Erwartungen herrschen Affinitäten zum Alkoholgebrauch und der Depression in ihren unterschiedlichen Ausprägungen. Alkoholgebrauch und/oder Depression als spezielle Deutungs- und Handlungsmuster, um den eigenen Alltag zu bewältigen und sich mit den Lebensaufgaben arrangieren zu können, verweisen so verstanden auf soziale Phänomene (vgl. Reinl/Füssenhäuser/Stumpp 2004: 175). Alkoholgebrauch oder Depression primär als Strategien im Bündel der zahlreichen Bewältigungsstrategien des Alltags kann sich zur Sucht oder psychischen Störung steigern 111 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit und sollten keineswegs verharmlost oder heruntergespielt werden (vgl. Thiersch 1995: 124; vgl. Reinl/Füssenhäuser/Stumpp 2004: 175 f.). Dennoch braucht es neben unterschiedlichen Angeboten in ambulanter, teilstationärer und stationärer Therapie Erweiterungen bezüglich der Nachsorge und Begleitung im Lebensfeld (vgl. Thiersch 1995: 136). Es hängt also entscheidend vom sozialen Umfeld ab, das eine Nutzerin nach der Therapie vorfindet. Dieser Faktor ist nämlich bedeutsam, ob ein effektiver Therapieerfolg auch tatsächlich beständig bleiben kann, oder ob ein weniger erfolgreicher Therapieprozess letztlich doch noch zu einem veränderungswirksamen Resultat führen kann (vgl. Thiersch et al. 2000: 64). Die Effektivität stationärer Therapien, definiert als Veränderungswirksamkeit hinsichtlich Drogengebrauchs, Alltagsbewältigung und psychodynamischer Prozesse, scheint auch maßgeblich von der Art der Kommunikation abzuhängen, die sich während der Therapie zwischen Adressatin und Setting entwickelt. Es unterscheidet sich von einem weniger erfolgreichen Prozess, das durch Passivität und Anpassung an das vorgegebene Setting gekennzeichnet ist, insofern, dass sich hier im jeweiligen Setting durch einen intersubjektiven Prozess konkrete Antworten auf den je individuellen Kontext von Lebensbewältigung und Alkoholgebrauch ergeben können (vgl. Thiersch et al. 2000: 64). NutzerInnen, die ihren Alkoholgebrauch als nicht gelingend und/oder ihre depressiven Bewältigungsstrategien als belastend bewerten, kommen in Einrichtungen mit einer individuellen Anfrage und intendieren und erwarten bestimmte Veränderungen, bezüglich ihrer bisherigen Alltags- und Lebensgestaltung (vgl. Thiersch et al. 2000: 65). Es geht in der Therapie aus Sicht der NutzerInnen also um Veränderungsprozesse hinsichtlich neuer Einsichten und Handlungsmöglichkeiten in ihrer Lebensgestaltung (vgl. ebd.). Thiersch et al. kamen aufgrund empirischer Studienresultate zur Einschätzung, dass sich ein erfolgreiches Therapieresultat auf drei Ebenen zeigt (Thiersch et al. 2000: 73): 1. „In der subjektiven Einschätzung der AdressatInnen zu Verlauf und Resultat der Therapie. 2. In den Veränderungen hinsichtlich einer gelingenderen Alltagsbewältigung nach der Therapie auf der ganz konkreten Ebene, und zwar hinsichtlich folgender Dimensionen: a) Umgang mit Drogen; b) Gestaltung der Wohnverhältnisse; c) Ges- 112 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit taltung der Verhältnisse von Arbeit/Ausbildung; d) Freizeitgestaltung; e) Kontext sozialer Interaktionen und Beziehungen. 3. In den Veränderungen auf der psychodynamischen Ebene, bezogen auf Reflexionen, Einsichten und Perspektiven. Diese können sich unter anderem beziehen auf Veränderungen der Betrachtungsweise der eigenen Vergangenheit, wesentliche Einsichten über notwendige Lebensbewältigungsstrategien oder Selbstreflexion über den Kontext von Lebensproblemen, Drogengebrauch und Rückfallgefährdung. Grundsätzlich können sich die hier gemeinten Veränderungen sowohl auf eine Ebene beziehen, die bereits im konkreten Alltag ihre Umsetzung findet, als auch auf eine die noch unkonkret ist insofern, als die Veränderungen erst noch in der realen Lebensbewältigung umgesetzt werden müssen“. Ein Verständnis von nicht gelingendem Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien als spezifische Deutungs- und Handlungsmuster und eine darauf bezogene Therapie erfordern ein primär individuumsbezogenes Hilfesetting, das sich um die jeweiligen Fragen der NutzerInnen bemüht (vgl. Thiersch et al. 2000: 99). Im Therapieverlauf ist also eine stärkere Subjektorientierung gefordert, die sich unter anderem durch eine eigenständige, sozialpädagogisch orientierte Begleitung und Unterstützung des Therapie- und Ausstiegsprozesses ausdrücken soll (vgl. ebd.). Die einzelnen Bausteine einer umfassenderen, multiprofessionellen Therapie müssten individualisierender, also flexibler bezogen auf Ressourcen und Fragen der AdressatInnen zugeschnitten werden (vgl. Thiersch 2000: 100; vgl. Thiersch 1995: 137). Diese Einschätzungen werden auch vom Institut für Suchtforschung für eine Therapie bei der Doppeldiagnose Alkoholabhängigkeit und Depression geteilt. Ditt- rich/Haller/Hinterhuber (2006) stellen fest, dass standardisierte Therapieprogramme bei der Gruppe der alkoholabhängigen und depressiven Menschen kaum Erfolg versprechend sind, da es sich hier um eine sehr heterogene Gruppe handelt. Diese Menschen benötigen für sie individuell zugeschnittene, integrative Beratungs-, Therapie- und Rehabilitationsangebote, die wirksame Interventionen für Depressionen und Alkoholabhängigkeit kombinieren, modifizieren und integrieren (vgl. Dittrich/Haller/Hinterhuber 2006: 237). Dahingehend sollte es möglich sein, diese Menschen in einem Behandlungssetting umfas113 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit send zu behandeln. Dabei sollte sich die Gestaltung der Hilfsangebote an den individuellen Ressourcen, besser: am „subjektiven Standort“ (Thiersch et al. 2000: 81 f.) der Menschen orientieren (vgl. Dittrich/Haller/Hinterhuber 2006: 237). Für SozialarbeiterInnen ergibt sich aus diesen Verhältnissen die Notwendigkeit von einer Defizitorientierung hin zu einer Ressourcenorientierung mit lösungsorientierten Ansätzen zu kommen, die sich auf funktionierende Muster und Ressourcen ihrer AdressatInnen beziehen. Somit könnten auch dominantere Muster weniger beherrschend werden, und wieder eingebettet werden in andere Formen der Lebensbewältigung, um den Alltag gelingenderer bewältigen zu können (vgl. Thiersch et al. 2000: 100). Wesentliche Punkte für einen erfolgreichen Therapieprozess und ein erfolgreiches Resultat sind somit neben dem hohen Stellenwert der Kommunikationsprozesse bezüglich Passung an und Auseinandersetzung mit dem Setting, auch vorhandene und funktionierende Handlungsmuster, an die in der Therapie angeknüpft werden kann (vgl. Thiersch et al. 2000: 83; vgl. Füssenhäuser/Reinl/Stumpp 2001: 141). Weiters von Bedeutung sind Selbstwirksamkeitserwartungen (beispielsweise hoch/tief infolge weniger/vieler zuvor durchlaufener Therapien), konkrete und relativ realistische Zielvorstellungen der AdressatInnen, ein Gefühl der Akzeptanz und des Angenommenseins und die subjektive Eigendeutung der problematischen Verhaltensmuster im Kontext mit Fragen der Lebensbewältigung (vgl. Thiersch et al. 2000: 83 f.). Als der zentrale Punkt einer effektiven Therapie ist eine effektive Nachsorge anzusehen (vgl. Thiersch et al. 2000: 83). Der häufigste Grund für Misserfolge ist eine unveränderte soziale Situation (vgl. Dörner et al. 2004: 279). Eine individuell abgestimmte Hilfeplanung im Sinne einer Nachsorge beschreibt die Notwendigkeit der Brückenfunktion einer effektiven Therapie zwischen dem Leben vor der Therapie und dem Leben danach (vgl. Füssenhäuser/Reinl/Stumpp 2001: 141; vgl. Thiersch et al. 2000: 83). Im Hinblick auf die angedeutete Wichtigkeit der Nachsorge für eine effektive Therapie muss auch die Frage gestellt werden, wie sensibel handlungsorientierte Soziale Arbeit im Alltag agieren muss, um das Ziel eines gelingerenden Alltags zu verwirklichen. Die Intervention wird vor der Adressatin insofern beweispflichtig, dass sie nicht mehr Schaden als Nutzen bringt (vgl. Müller 1996: 105). 114 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit Angesichts der vielfältigen, auch ressourcenzerstörender Auswirkungen des nicht gelingenden Alkoholgebrauchs und/oder depressiver Bewältigungsstrategien sollte dennoch die Maxime verwirklicht werden, den Alltag bzw. die Lebenswelt vor besserwisserischem oder gar „wissenschaftlichen“ Zugriff zu schützen. Die spezifischen autonomen Ressourcen des Alltags müssen so respektiert werden, dass die eigenen gelingenderen Bewältigungsstrategien nicht verdeckt werden (vgl. Müller 1996: 105 f.). Eine radikale Forderung alltags- bzw. lebensweltorientierter Sozialer Arbeit ist die grundsätzliche autonome Zuständigkeit aller Menschen für ihren je eigenen Alltag (vgl. Grunwald/Thiersch 2003: 69). Dieser Respekt gebietet, dass Veränderungen immer einhergehen müssen mit der Kunst, die je individuellen Wahrheitsmomente im Alltag zu entdecken, bewusst und wach zu halten, zu stützen und zu mehren (vgl. Thiersch 1986: 39). 115 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit 4.3 Ausblick Lebensweltorientierte Soziale Arbeit orientiert sich an Individuen in ihren gegeben Verhältnissen und hat dabei die Anstrengungen der Menschen im Blick, in ihren je eigenen Kontexten zurecht zu kommen. Die dynamischen Prozesse, die zur Entstehung und Aufrechterhaltung der von mir dargestellten Phänomene beitragen können, sind komplex und mehrdimensional. Ich bin dabei von sozialen, psychischen und biologischen Faktoren ausgegangen, die sich wechselseitig beeinflussen und dabei einen Zusammenhang bilden. Die Bedeutung des gesellschaftlichen Wandels für die von mir dargestellten Phänomene ist offensichtlich. Trotz des neuartigen Wohlstands, der guten körperlichen Gesundheit, neuer Chancen und Perspektiven für die Menschen, ergibt sich aus den Verhältnissen unserer Gesellschaft mit Verstädterung, räumlicher Mobilität und das Aufbrechen emotionaler Beziehungen, das Anwachsen sozialer Anomie, die Veränderungen in den Familienstrukturen, das Zerbrechen der traditionellen Geschlechterrollen etc., ein Ansteigen dieser Phänomene (vgl. Ehrenberg 2004: 127). Die Menschen sind in der heutigen Gesellschaft gefordert sich zurecht zu finden und müssen dabei oft kräfte- und ressourcenraubende Anstrengungen unternehmen, um ihren Alltag bewältigen zu können. Wenn Ressourcen nicht ausreichend vorhanden, verbraucht sind oder zur Stützung nicht mehr angeboten oder eröffnet werden, kann ein Mensch schwer seine psychosoziale Stabilität und seine Handlungsfähigkeit aufrechterhalten. Es können sich somit leicht „psychische Störungen“ einstellen. Damit bin ich bei der nächsten Problematik, die sich für betroffene Menschen stellt: Psychiater fordern zwar eine Entstigmatisierung „psychisch Kranker“, die sich auf eine veränderte Einstellung einer scheinbar nicht betroffenen Allgemeinbevölkerung gegenüber „psychisch kranken“ Menschen richtet. Durch medizinische Definitionen im Medium von Krankheit und Gesundheit liegen solche Stigmata jedoch auch vielfach begründet. Allein die Bezeichnung „psychisch krank“ impliziert, dass etwa ein gesellschaftliches Problem zu einem individuellen Problem gemacht wird. Somit wird auch die Schuld oder medizinisch die Ursache der Krankheit in einem scheinbar kontextlosen Individuum gesucht, gefunden und behandelt. 116 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit Einige Schlüsselwörter der Sozialen Arbeit haben auch für die Psychiatrie eine wichtige Funktion, die Menschen wieder empathisch gegenüber vielfachen Irritationen anderer Menschen werden lassen kann. Begriffe wie Lebensbewältigung und damit verbunden Freisetzung, Entgrenzung oder Entfremdung, hätten beispielsweise gleichzeitig subjektund sozialstrukturelle Faktoren im Blick und könnten sich als gelingender im Umgang mit betroffenen Menschen erweisen. Vor dem Hintergrund einiger meiner Überlegungen würde ich zur Diskussion stellen, ob „psychische Krankheiten“ auf die hier dargestellten Phänomene nicht beispielsweise durch „Subjektirritationen“ ersetzt werden könnten. Die lateinische Wurzel von Irritation sagt schon sehr viel aus. So bedeutet „irrito“ erstens: erzürnen, aufbringen, böse machen; zweitens: reizen, antreiben, bewegen, und drittens: erregen, wecken, verursachen (vgl. Stowasser/Petschenig/Skutsch 1997: 279). Verbunden mit einem kontextbezogenen Subjektbegriff wäre dieser Begriff der sozialen, psychischen und biologischen Dimension der Phänomene näher und könnte somit auch das Stigmatisierungsproblem effektiver lösen. Mit Subjektirritationen würde ein weiterer Aspekt angesprochen werden: Der Mensch ist als Subjekt immer ein Subjekt im doppelten Sinne von Souverän und Untertan (vgl. Ehrenberg 2004: 277). Depressive Bewältigungsstrategien und nicht gelingender Alkoholgebrauch spiegeln laut Ehrenberg das unauffindbare Subjekt der Depression und das verlorene Subjekt der Abhängigkeit wider und erscheinen wie die Vorder- und Rückseite des souveränen Individuums, das glaubt, Regisseur seines Lebens zu sein, wo ein Mensch doch Subjekt im doppelten Sinn ist (vgl. ebd.). Auch die modernen Therapieformen mittels Antidepressiva können irritieren. Sie eröffnen eine doppelte Identität, die Menschen vor die Wahl stellt, sich für eine zu entscheiden. Wenn eine Person zugleich gesund ist, dank der Medikamente und krank ist ohne Medikamente, wer ist dann die wahre Person? (vgl. Ehrenberg 2004: 256). Wie die Entstehung und der Verlauf mehrdimensional zu sehen sind, so müsste auch die Behandlung und Versorgung betroffener Menschen mehrdimensional gesehen werden. Da die von mir dargestellten Phänomene sich in zunehmendem Maße an immer mehr Menschen bemerkbar machen, werden diese zu einem gesamtgesellschaftlichen Projekt. 117 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit Hier sind neben sozialpolitischen, sozialstrukturellen, bewusstseinsbildenden Maßnahmen, konkret auch verschiedene Disziplinen und Professionen gefordert. Zunächst ist es wünschenswert, dass die Kluft zwischen unterschiedlichen Perspektiven überbrückt wird und im gegenseitigen Respekt nach möglichen Lösungen gesucht wird, die trotz aller möglichen Abgründe, Verbindungen zwischen den umstrittenen theoretischen Konzepten aus Psychiatrie, Neurowissenschaft, Psychologie, Psychoanalyse, Soziologie und Sozialer Arbeit sucht und findet (vgl. Solms/Turnbull 2007: 20ff.). Die verschiedenen Professionen sollten idealerweise ein Netzwerk bilden, aus dem heraus die je individuellen materiellen und immateriellen Bedürfnisse betroffener Menschen erkannt, ausgehandelt und gewährt werden können. Die einzelnen Bausteine eines umfassenden Hilfs- und Versorgungssystems könnten sich so je nach Bedarf an Menschen richten, mit dem möglichen Ziel der psychosozialen Stabilität und Handlungsfähigkeit. Dabei sollte auch im Vordergrund stehen, betroffenen Menschen nicht ihre Krankheit, die sie haben zu nehmen, sondern sie insoweit mitwirken lassen, dass sie durch ausgehandelte Ressourcen imstande sein können ihr Leiden und ihr Leben gelingender zu bewältigen. 118 Literaturverzeichnis American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. Washington/DC 1994; (deutsch) Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen. DSM-IV, Göttingen 1996. Autrata, O./Scheu, B.: Jugend 2004 in Feldkirchen, Feldkirchen in Kärnten 2004. Autrata, O./Scheu, B.: Gestaltung des Sozialen durch die Soziale Arbeit, in: Autrata, O./Scheu, B. (Hg.): Gestaltung des Sozialen: Eine Aufgabe der Sozialen Arbeit, Klagenfurt/Laibach/Wien - Celovec/Ljubljana/Dunaj 2006, S. 9 - 54. Autrata, O./Hohenwarter, B./Scheu, B.: Jugend 2006 in Moosburg, Moosburg in Kärnten 2006. Bader, T./Hey, G./Stöver, H.: Aktuelle Trends in der sozialen Drogenarbeit und Drogenpolitik, in: Müller, S./Reinl, H. (Hg.): Soziale Arbeit in der Konkurrenzgesellschaft: Beiträge zur Neugestaltung des Sozialen, Neuwied/Kriftel 1997, S. 309 - 321. Baecker, J./ Borg-Laufs, M./ Duda, L./ Matthies, E.: Sozialer Konstruktivismus - eine neue Perspektive in der Psychologie. In: Schmidt, S.J. (Hg.): Kognition und Gesellschaft. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus 2, Frankfurt/Main 1992, S. 116 - 145. Bandura, A.: A self-efficacy mechanism in human agency, American Psychologist 37, 1982, S. 122 - 147. Baumgärtner, T./Scharping, C.: Kinder aus suchtbelasteten Familien, in: Otto, H.U./Thiersch, H. (Hg.): neue praxis: Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik, Lahnstein 6/2006, S. 609 - 629. Beck, U.: Risikogesellschaft: Auf dem Weg in die Moderne, Frankfurt 1986. 119 Beck, U.: Der Konflikt der zwei Modernen. Vom ökologischen und sozialen Umbau der Risikogesellschaft, in: Rauschenbach, T./Gängler, H. (Hg.): Soziale Arbeit und Erziehung in der Risikogesellschaft, Neuwied/Kriftel 1992, S. 185 - 202. Beck, U.: Das Zeitalter der Nebenfolgen und die Politisierung der Moderne, in: Beck, U./Giddens, A./Lash, S.: Reflexive Modernisierung: Eine Kontoverse, Frankfurt/Main 1996, S. 19 - 112. Beck, U./Beck-Gernsheim, E.: Individualisierung in modernen Gesellschaften – Perspektiven und Kontroversen einer subjektorientierten Soziologie in: Beck, U./BeckGernsheim, E. (Hg.): Riskante Freiheiten, Erstausgabe, Frankfurt/Main, 1994, S. 10 - 39. Beck, U./Bonß, W./Lau, C.: Entgrenzung erzwingt Entscheidung: Was ist neu an der Theorie reflexiver Modernisierung ?, in: Beck, U./Lau, C. (Hg.): Entgrenzung und Entscheidung, Frankfurt/Main 2004, S. 13 - 62. Bettmer, F.: Abweichung und Normalität in: Otto, H.U./Thiersch, H. (Hg.): Handbuch Sozialarbeit Sozialpädagogik, 3. Auflage, München 2005, S. 1 - 6. BfJFFG: Der Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (Hg.): Achter Jugendbericht. Bericht über Bestrebungen und Leistungen der Jugendhilfe, Bonn 1990. Bierhoff, H.W.: Sozialpsychologie. Ein Lehrbuch, 6., überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart 2006. Birtchnell, J.: Early Parent Death and Psychiatric Diagnosis, Social Psychiatry 7, 1972, S. 202-210. Böhnisch, L.: Gespaltene Normalität: Lebensbewältigung und Sozialpädagogik an den Grenzen der Wohlfahrtsgesellschaft, Weinheim/München 1994. 120 Böhnisch, L.: Sozialarbeit in einer anomischen Gesellschaft, in: Müller, S./Reinl, H. (Hg.): Soziale Arbeit in der Konkurrenzgesellschaft: Beiträge zur Neugestaltung des Sozialen, Neuwied/Kriftel/Berlin 1997, S. 229 - 236. Böhnisch, L.: Abweichendes Verhalten. Eine sozialpädagogische Einführung, 2. korrigierte Auflage, Weinheim/München 2001a. Böhnisch, L.: Sozialpädagogik der Lebensalter: Eine Einführung, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Weinheim/München 2001b. Böhnisch, L.: Lebensbewältigung: Ein sozialpolitisch inspiriertes Paradigma für die Soziale Arbeit, in: Thole, W. (Hg.): Grundriss Soziale Arbeit: Ein einführendes Handbuch, Opladen 2002, S. 199 - 213. Böhnisch, L.: Sozialpädagogik der Lebensalter: Eine Einführung, 4., überarbeitete Auflage, Weinheim/München 2005. Böhnisch, L./Schröer, W.: Pädagogik und Arbeitsgesellschaft: Historische Grundlagen und theoretische Ansätze für eine sozialpolitisch reflexive Pädagogik, Weinheim/München 2001. Böhnisch, L./Schröer, W.: Die soziale Bürgergesellschaft: Zur Einbindung des Sozialpolitischen in den zivilgesellschaftlichen Diskurs, Weinheim/München 2002. Böhnisch, L./Schröer, W./Thiersch, H.: Sozialpädagogisches Denken: Wege zu einer Neubestimmung, Weinheim/München 2005. Böllert, K.: Prävention und Intervention, in: Otto, H.U./Thiersch, H. (Hg.): Handbuch Sozialarbeit Sozialpädagogik, 2. völlig überarbeitete Auflage, Neuwied/Kriftel 2001, S. 1394 - 1398. 121 Böllinger, L.: Rechtliche Rahmenbedingungen einer präventiven Sucht- und Drogenpolitik, in: Schmidt, B./Hurrelmann, K. (Hg.): Präventive Sucht- und Drogenpolitik: Ein Handbuch, Opladen 2000, S. 25 - 40. Bowlby, J.: Bindung: Bindung und Verlust; Band 1, München/Basel 2006a. Bowlby, J.: Verlust. Trauer und Depression: Bindung und Verlust; Band 3, München/Basel 2006b. Brandl, G.: Mitmenschlichkeit kann uns heilen. Annäherungs-Versuche, Graz 1999. Brandt, G.A.: Psychologie und Psychopathologie für soziale Berufe: Arbeitsmittel für Studium und Unterricht, 10., unveränderte Auflage, Neuwied/Berlin 1975. Braukmann, W./Filipp, S.H.: Personale Kontrolle und die Bewältigung kritischer Lebensereignisse, in: Filipp, S.H. (Hg.): Kritische Lebensereignisse, 3. Auflage, Weinheim 1995, S. 233 - 251. Brown, G.W.: Die Rolle von Lebensereignissen als Ursache affektiver Störungen, in: Helmchen, H./Henn, F./Lauter, H./Sartorius, N. (Hg.): Psychiatrie der Gegenwart Bd. 5 Schizophrenie und affektive Störungen, 4. Auflage, Belin/Heidelberg/NewYork/Barcelona/Hongkong/London/Mailand/Paris/Singapur/Tokio 2000, S. 461 - 474. Brown, G.W./Harris, T.O.: Social origins of depression. A study of psychiatric disorder in women, New York 1978. Cadoret, R./Winokur, G.: Depression in alcoholism, Ann. New York Academy of Sciences 233, 1974, S. 34 - 39. Cicero, M.T.: Orationum Philippicarum: Liber duodecimus, in: Orelli, J.K./Baiter, J.G./Halm. K. (Hg.): M. Tullii Ciceronis opera quae supersunt omnia ex recensione, 122 Volumen secundum - Band 2, Turicum/Londinium/Amstelodamum MDCCCLVI Zürich/London/Amsterdam 1856, S. 1369 - 1379 [URL: http://www.google.at/books?vid=0VEH9z52tULdMcxuIvdgcA&id=WOTFcJirqWwC&pg=PA1370&lpg=PA1370&dq=Cicero+cuiusvis+hominis+es t+errare&as_brr=1#PPP6,M1, 20.04.2007]. Cirillo, St./Berrini, R./Cambiaso, G./Mazza, R.: Die Familie des Drogensüchtigen. Eine mehrgenerationale Perspektive, Stuttgart 1998. Clausen, J./Dresler, K.D./Eichenbrenner, I.: Soziale Arbeit im Arbeitsfeld Psychiatrie. Eine Einführung, 2., aktualisierte Auflage, Freiburg/Breisgau 1997. Coutandin, Ch.: Die Faszination des Todes und des Bösen am Beispiel eines Mädchens aus der “schwarzen Szene”, in: Schröder, A./Leonhardt, U.: Jugendkulturen und Adoleszenz: Verstehende Zugänge zu Jugendlichen in ihren Szenen, Neuwied/Kriftel 1998, S. 174 - 185. Dewe, B./Otto, H.U.: Reflexive Sozialpädagogik, in: Thole, W. (Hg.): Grundriss Soziale Arbeit: Ein einführendes Handbuch, Opladen 2002, S. 179 - 198. Dilling, H. (Hg.): Lexikon zur ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen. Begriffe der Psychiatrie und der seelischen Gesundheit, insbesondere auch des Missbrauchs psychotroper Substanzen sowie der transkulturellen Psychiatrie/WHO, Bern/Göttingen/Toronto/Seattle 2002. Dilling, H./Mombour, W./Schmidt, M.H. (Hg.): Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V(F) Klinisch-diagnostische Leitlinien/WHO, 4. durchgesehene und ergänzte Auflage, Bern/Göttingen/Toronto/Seattle 2000. Dilling, H./Mombour, W./Schmidt, M.H. (Hg.): Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V(F) Klinisch-diagnostische Leitlinien/WHO, 5., durchgesehene und ergänzte Auflage, Bern/Göttingen/Toronto/Seattle 2005. 123 Dittrich, I./Haller, R./Hinterhuber, H.: Alkoholismus und Depression, in: Neuropsychiatrie Band 20, Nr. 4/2006, S. 232 - 239 [URL: http://www.dustri.de/zd/ne/volltext/closed/06-04/ne04_232.pdf, 21.03.07]. Dörner, K./ Plog, U./Teller, Ch./Wendt, F.: Irren ist menschlich: Lehrbuch der Psychiatrie und Psychotherapie, 2., korrigierte Auflage, Bonn 2004. Dörr, M.: Soziale Arbeit in der Psychiatrie, München/Basel 2005. Driessen, M./Dieser, B./Dilling, H.: Depressive Störungen bei Alkoholismus in: Krausz, M./Müller-Thomsen, T. (Hg.): Komorbidität - Therapie von psychischen Störungen und Sucht: Konzepte für Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation, Freiburg/Breisgau 1994, S. 35 - 49. Durkheim, E.: Der Selbstmord, 1.Auflage, Neuwied/Berlin 1983. Ehrenberg, A.: Das erschöpfte Selbst: Depression und Gesellschaft in der Gegenwart, Frankfurt/Main 2004. Eisenbach-Stangl, I.: Legale und illegale Drogen in Österreich: Konsum und Probleme in: Brosch, R., Juhnke, G. (Hg.): Sucht in Österreich - Ein Leitfaden für Betroffene, Angehörige, Betreuer, Wien 1993, S. 51 - 59. Engelkamp, J./Zimmer, H.D.: Lehrbuch der Kognitiven Psychologie, Göttingen 2006. Enzensberger, H.M.: Das digitale Evangelium, in: Der Spiegel, Heft 2/2000. Equi, P.J./Jabara, R.F.: Validation of the self-rating depression in an alcoholic population, Journal of Clinical Psychology 32, 1976, S. 504 - 507. 124 Falck, D.C.: Die klinisch wichtigen Intoxikationen, in: Virchow, R. (Hg.): Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie, 2. Band. Erste Abtheilung: Intoxikationen, Zoonosen und Syphilis, Erlangen 1855, S. 1 - 336 [URL:http://www.google.at/books?vid=OCLC06905304&id=nTAAAAAAQAAJ&pg=R A1-PA1&lpg=RA1-PA1&dq=virchow#PPP6,M1, 21.02.07]. Feuerlein, W./Küfner, H./Soyka, M.: Alkoholismus - Missbrauch und Abhängigkeit: Entstehung - Folgen - Therapie, 5., überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart/New York 1998. Fowler, R.C/Liskow, B.I./Tanna, V.L.: Alcoholism, depression and life events. J. Affective disorders 2, 1980, S. 127 - 135. Freud, S.: Gesammelte Werke, Zehnter Band: Werke aus den Jahren 1913 - 1917, Frankfurt/Main 1999a. Freud, S.: Gesammelte Werke, Elfter Band: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, Frankfurt/Main 1999b. Frey, D./Greif, S.: Sozialpsychologie. Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen. 4. Auflage, Weinheim 1997. Fuchs-Heinritz, W./Lautmann, R./Rammstedt, O./Wienhold, H. (Hg.): Lexikon zur Soziologie, 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Opladen 1995. Füssenhäuser, C./Reinl, H./Stumpp, G.: ETRAD. Evaluation teilstationärer Rehabilitationseinrichtungen für Drogenabhängige, Tübingen 2001. Galuske, M.: Methoden der Sozialen Arbeit: Eine Einführung, 4. Auflage, Weinheim/München 2002a. 125 Galuske, M.: Flexible Sozialpädagogik: Elemente einer Theorie Sozialer Arbeit in der modernen Arbeitsgesellschaft, Weinheim/München 2002b. Gastpar,M./Mann, K./Rommelsbacher, H. (Hg.): Lehrbuch der Suchterkrankungen, Stuttgart/New York 1999. Grunwald, K./Thiersch, H.: Lebensweltorientierung, in: Otto, H.U./Thiersch, H. (Hg.): Handbuch Sozialarbeit - Sozialpädagogik, 2. völlig überarbeitet Auflage, Neuwied/Kriftel 2001, S. 1136 - 1148. Grunwald, K./Thiersch, H.: Lebenswelt und Dienstleistung, in: Olk, T./Otto, H.U. (Hg.): Soziale Arbeit als Dienstleistung: Grundlegungen, Entwürfe und Modell, München/Unterschleißheim 2003, S. 67 - 89. Habermas, J: Die Moderne - ein unvollendetes Projekt. Philosophisch-politische Ausätze 1977 - 1990, Leipzig 1990. Habermas, J.: Die postnationale Konstellation: Politische Essays, Frankfurt/Main 1998. Hahlweg, K./Ehlers, A.(Hg.): Enzyklopädie der Psychologie: Klinische Psychologie 2 Psychische Störungen und ihre Behandlungen, Göttingen/Bern/Toronto/Seattle 1997. Halikas, J.A./Herzog, M.A./Mirassou, M.M./Lyttle, M.D.: Psychiatric diagnoses among female alcoholics. Currents in Alcoholism 8, 1981, S. 283 - 291. Halisch, F./Geppert, U.: Wohlbefinden im Alter: Der Einfluss von Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugungen, Bewältigungsstrategien und persönlichen Zielen. Ergebnisse aus der Münchner GOLD-Studie, Max-Planck-Institut für Psychologische Forschung, München, in: Försterling, F./Siensmeier-Pelster, J./Silny, L.M. (Hg.): Kognitive und emotionale Aspekte der Motivation, Göttingen/Bern/Toronto/Seattle 2000, S. 121 - 152. 126 Hamm, J.E./Major, L.F./Brown, G.L.: The quantitative measurement of depression and anxiety in male alcoholics. American Journal of Psychiatry 136, 1979, S. 580 - 582. Hammen, C.: Depressionen: Erscheinungsformen und Behandlung, Bern/Göttingen/Toronto/Seattle 1999. Hautzinger, M.: Affektive Störungen - Kapitel 2 in: Hahlweg, K./Ehlers, A.(Hg.): Enzyklopädie der Psychologie: Klinische Psychologie 2 - Psychische Störungen und ihre Behandlungen, Göttingen/Bern/Toronto/Seattle 1997, S. 155 - 239. Heinz, A./Batra, A.: Neurobiologie der Alkohol- und Nikotinabhängigkeit, Stuttgart 2003. Henkel, D.: Arbeitslosigkeit und Alkoholismus in: Schwoon, D.R./Krausz, M. (Hg.): Suchtkranke. Die ungeliebten Kinder der Psychiatrie, Stuttgart 1990, S. 35 - 49. Henn, F.: Kapitel 19: Neurobiologie affektiver Störungen, in: Helmchen, H./Henn, F./Lauter, H./Sartorius, N. (Hg.): Psychiatrie der Gegenwart Bd. 5 - Schizophrenie und affektive Störungen, 4. Auflage, Berlin/Heidelberg/New York/Barcelona/Hongkong/London/Mailand/Paris/Singapur/Tokio 2000, S. 409 - 429. Herbig, R.: Depression und Alkoholismus in: Schwoon, D.R./Krausz, M. (Hg.): Suchtkranke. Die ungeliebten Kinder der Psychiatrie, Stuttgart 1990, S. 106 - 116. Hesselbrock, M.N./Hesselbrock, V.M./Tennen, H. et al.: Methodological considerations in the assessment of depression in alcoholics. Journal of Consulting and Clinical Psychology 51, 1983, S. 399 - 405. Hitzler, R./Pfadenhauer, M.: Reflexive Mediziner? Die Definition professioneller Kompetenz als standespolitisches Problem am Übergang zu einer „anderen“ Moderne, in: Maeder, Ch./Burton-Jeangros, C./Haour-Knipe, M. (Hg.): Gesundheit, Medizin und Gesellschaft: Beiträge zur Soziologie der Gesundheit; Santé, médecine et société: Contributions 127 à la sociologie de la santé; Health, Medicine and Society: Contributions to the Sociology of Health, Zürich 1999, S. 97 - 115. Hippius, H.: Zum Stand der Therapie der Depressionen in: Kielholz, P. (Hg.): Depressive Zustände: Erkennung, Bewertung, Behandlung, Bern/Stuttgart/Wien 1972, S. 49 - 58. Holmes, J.: John Bowlby und die Bindungstheorie, 2. Auflage, München/Basel 2006. Homfeldt, H.G./Sting, S.: Soziale Arbeit und Gesundheit. Eine Einführung, München 2006. Hönig, B./Scheu, B.: Sozialwissenschaftliche und -räumliche Studien, in: Autrata, O./Scheu, B. (Hg.): Gestaltung des Sozialen: Eine Aufgabe der Sozialen Arbeit, Klagenfurt/Laibach/Wien - Celovec/Ljubljana/Dunaj 2006, S. 65 - 95. Honneth, A.: Organisierte Selbstverwirklichung. Paradoxien der Individualisierung, in: Honneth, A. (Hg.): Befreiung aus der Mündigkeit: Paradoxien des gegenwärtigen Kapitalismus, Frankfurt/Main 2002, S. 141 - 158. Hörster, R.: Medizinische Kasuistik im pädagogischen Widerspruch, in: Otto, H.U./Sünker, H./Thiersch, H. (Hg.): Sozialwissenschaftliche Literatur Rundschau: Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Gesellschaftspolitik, SLR 53, Lahnstein 2/2006, S. 60 - 72. Illich, I.: Fortschrittsmythen: Schöpferische Arbeitslosigkeit - Energie und Gerechtigkeit Wider die Verschulung, Reinbeck/Hamburg 1978. Illich, I.: Die Nemesis der Medizin: Die Kritik der Medikalisierung des Lebens, 4., überarbeitete und ergänzte Auflage, München 1995. 128 Jahoda, M/Lazarsfeld, P.F./Zeisel, H.: Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit. Mit einem Anhang zur Geschichte der Soziographie, 1. Auflage, Franfurt/Main 1975. Jansche, A.: Alkoholismus und Depression. Psychodynamische Ätiologiekonzepte und spezifische Lebensereignisse, DA, Klagenfurt 2003. Jellinek, E.M.: The disease concept of alcoholism, New Haven 1960. Jellinek, E.M.: The disease concept of alcoholism, 5th ed., New Haven 1972. Jonas, K./Brömer, P.: Die sozial-kognitive Theorie von Bandura, in: Frey, D./Irle, M. (Hg.): Theorien der Sozialpsychologie. Band II: Gruppen-, Interaktions- und Lerntheorien, 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Bern 2002, S. 277 - 299. Jung, M.: Hermeneutik zur Einführung, Hamburg 2002. Keeler, M.H./Taylor, C.I./Miller, W.C.: Are all recently detoxified alcoholics depressed? American Journal of Psychiatry 136, 1979, S. 586 - 588. Klein, M.: Alkoholabhängigkeit in: Thomasius, R./Küstner, U.J. (Hg.): Familie und Sucht. Grundlagen - Therapiepraxis - Prävention, Stuttgart 2005, S. 52 - 59. Kleve, H.: Konstruktivismus und Soziale Arbeit: die konstruktivistische Wirklichkeitsauffassung und ihre Bedeutung für die Sozialarbeit/Sozialpädagogik und Supervision, Aachen 2003. Klosinski, G.: Psychiatrische Krankheiten in: Otto, H.U./Thiersch, H. (Hg.): Handbuch Sozialarbeit Sozialpädagogik, 3.Auflage, München 2005, S. 1146 - 1453. Kohlberg, L.: Die Psychologie der Lebensspanne, Frankfurt/Main 2000. 129 Köhler, T.: Rauschdrogen und andere psychotrope Substanzen. Formen, Wirkungen, Wirkmechanismen, Stuttgart/Berlin/Köln 2000. Krausz, M./Haasen, Ch.: Kompendium Sucht, Stuttgart/New York 2004. Kronmüller, K.T./Mundt, Ch.: Depressive Episoden Kapitel 14 in: Helmchen, H./Henn, F./Lauter, H./Sartorius, N. (Hg.): Psychiatrie der Gegenwart Bd. 5 - Schizophrenie und affektive Störungen, 4. Auflage, Berlin/Heidelberg/New York/Barcelona/Hongkong/London/Mailand/Paris/Singapur/Tokio 2000, S. 281 - 321. Kryspin-Exner, K./Scholz, H.: Alkoholismus-Fehlverhalten oder behandelbarer Krankheitsprozess in: Evangelische Stiftung de La Tour (Hg.): Die Alkoholkrankheit und andere Abhängigkeiten: Hintergründe - Verlaufsphasen - Folgeerscheinungen - Therapiekonzept, Treffen 1998, S. 13 - 23. Kryspin-Exner, I.: Alkoholismus in: Reinecker, H. (Hg.): Lehrbuch der Klinischen Psychologie. Modelle psychischer Störungen, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Göttingen/Bern/Toronto/Seattle 1998, S. 353 - 387. Küfner, H./Bühringer, G.: Alkoholismus, in: Hahlweg, K./Ehlers, A. (Hg.): Enzyklopädie der Psychologie: Klinische Psychologie 2 - Psychische Störungen und ihre Behandlungen, Göttingen/Bern/Toronto/Seattle 1997, S. 437 - 512. Lamnek, S.: Theorie abweichenden Verhaltens: Eine Einführung für Soziologen, Psychologen, Pädagogen, Juristen, Politologen, Kommunikationswissenschaftler und Sozialarbeiter, 7. Auflage, München 1979. Laux, G.: Affektive Störungen in: Möller, H.J./Laux, G./Deister, A.: Psychiatrie und Psychotherapie, 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage mit Video - CD - ROM, Stuttgart 2001, S. 73 - 105. 130 Lazarus, R.S.: Stress, Bewältigung und Emotionen: Entwicklung eines Modells, in: Muijsers, P. (Hg.): Stress und Coping: Lehrbuch für die Pflegepraxis und -wissenschaft, 1. Auflage, Bern 2005, S. 231 - 263. Lazarus, R.S./Launier, R.: Stress related transactions between person and environment, in: Pervin, L.A./Lewis, M. (ed.): Perspectives in interactional psychology, New York 1978, S. 287 - 327 [dt. Lazarus, R.S./Launier, R.: Stressbezogene Transaktion zwischen Person und Umwelt, in: Nitsch, J.R. (Hg.): Stress - Theorien, Untersuchungen, Maßnahmen, Bern 1981]. Lazarus, R.S.: A cognitively oriented psychologist looks at biofeedback, American Psychologist 30, 1975, S. 553 - 561. Lempke, G.: Suchtkonzepte und ihre Auswirkungen auf den Umgang mit Abhängigkeitserkranken in: Schwoon, D.R./Krausz, M. (Hg.): Suchtkranke. Die ungeliebten Kinder der Psychiatrie, Stuttgart 1990, S. 16 - 24. Lenz, K./Böhnisch, L.: Zugänge zu Familien - ein Grundlagentext, in: Böhnisch, L./Lenz, K. (Hg.): Familien: Eine interdisziplinäre Einführung, 2. korrigierte Auflage, Weinheim/München 1999, S. 9 - 63. Lenz, K./Schefold, W./Schröer, W.: Entgrenzte Lebensbewältigung: Sozialpädagogik vor neuen Herausforderungen, in: Lenz, K./Schefold, W./Schröer, W. : Entgrenzte Lebensbewältigung: Jugend, Geschlecht und Jugendhilfe, Weinheim/München 2004, S. 9 - 18. Loviscach, P.: Soziale Arbeit im Arbeitsfeld Sucht. Eine Einführung, Freiburg im Breisgau 1996. Maier, W./Schwab, S./Rietschel, M.: Genetik affektiver Störungen in: Helmchen, H./Henn, F./Lauter, H./Sartorius, N. (Hg.): Psychiatrie der Gegenwart Bd. 5: Schizophrenie und affektive Störungen, 4. Auflage, 131 Berlin/Heidelberg/New York/Barcelona/Hongkong/London/Mailand/Paris/Singapur/Tokio 2000, S. 373 - 407. Maier, S.F./Seligman, M.E.P./Salomon, R.L. (Hg.): Pavlovial fear conditioning and learned helplessness: Effects on escape and avoidance behaviour of (a) the CS-US contingency and (b) the independence of the US and voluntary responding, in: Campbell, B.A./Church, R.M. (Hg.): Punishment and aversive behaviour, New York 1969, S. 299 342. Maturana, H.R.: Biologie der Realität, 1. Auflage, Frankfurt/Main 2000. Maturana, H.R./Varela, F.J.: Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens, 12. Auflage, Bern/München 1987. Mentzos, St.: Depression und Manie. Psychodynamik und Therapie affektiver Störungen, 3. Auflage, Göttingen 2001. Mitscherlich, A./Mitscherlich, M.: Die Unfähigkeit zu trauern: Grundlagen kollektiven Verhaltens, 17. Auflage, München 2004. Möller, H.J./Laux, G./Deister, A.: Psychiatrie und Psychotherapie, 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage mit Video - CD - ROM, Stuttgart 2001. Müller, B.K.: Sozialpädagogischer Alltag und seine nächtliche Seite. Anmerkungen zum Verhältnis von psychoanalytischer Pädagogik und „alltagsorientierter“ Sozialpädagogik, in: Grunwald, K./Ortmann, F./Rauschenbach, T./Treptow, R. (Hg.): Alltag, NichtAlltägliches, und die Lebenswelt: Beiträge zur lebensweltorientierten Sozialpädagogik, Weinheim/München, S. 105 - 112. Musalek, M.: Die Diagnose Sucht. Entwicklung des Suchtbegriffs, Diagnose, Kriterien in: Brosch, R./Mader, R. (Hg.): Sucht und Suchtbehandlung. Problematik und Therapie in Österreich, Wien 2004, S. 3 - 15. 132 Nakamura, M.M./Overall, J.E./Hollister, L.E./Radcliff, E.: Factors affecting outcome of depressive symptoms in alcoholics. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 7, 1983, S.188 - 193. Neckel, S./Dröge, K.: Die Verdienste und ihr Preis: Leistung in der Marktgesellschaft, in: Honneth, A. (Hg.): Befreiung aus der Mündigkeit: Paradoxien des gegenwärtigen Kapitalismus, Frankfurt/Main 2002, 93 - 116. Pauls, H.: Klinische Sozialarbeit. Grundlagen und Methoden psycho-sozialer Behandlung, Weinheim/München 2004. Parsons, T.: Das System moderner Gesellschaften, 6. Auflage, Weinheim/München 2003. Peters, H.: Devianz und soziale Kontrolle. Eine Einführung in die Soziologie abweichenden Verhaltens, 2. Auflage, Weinheim/München 1995. Pottenger, M./Mc Kernon, J./Patrie, L.E. et al.: The frequency and persistence of depressive symptoms in the alcohol abusers. Journal of Nerve and Mental Disorder 166, 1978, S. 562 - 570. Preinsberger, W.: Alkohol in: Brosch, R., Mader R. (Hg.): Sucht und Suchtbehandlung. Problematik und Therapie in Österreich, Wien 2004, S. 157 - 176. Pschyrembel - Klinisches Wörterbuch, 259., neu bearbeitete Auflage, Berlin/New York 2002. Quensel, S.: Das Elend der Suchtprävention: Analyse - Kritik - Alternative, 1. Auflage, Wiesbaden 2004. 133 Rauschenbach, T.: Soziale Arbeit und soziales Risiko, in: Rauschenbach, T./Gängler, H. (Hg.): Soziale Arbeit und Erziehung in der Risikogesellschaft, Neuwied/Kriftel/Berlin 1992, S. 25 - 60. Rauschenbach, T.: Das sozialpädagogische Jahrhundert: Analysen zur Entwicklung Sozialer Arbeit in der Moderne, Weinheim/München 1999. Reinl, H./Füssenhäuser, C./Stumpp, G.: Drogentherapie aus lebensweltlicher Perspektive, in: Grunwald, K./Thiersch, H. (Hg.): Praxis Lebensweltorientierter Sozialer Arbeit: Handlungszugänge und Methoden in unterschiedlichen Arbeitsfeldern, Weinheim/München 2004, S. 173 - 193. Reuband, K.H.: Alkoholkonsum in der Bundesrepublik Deutschland: Eine empirische Bestandaufnahme in: Berger, H./Legnaro, A./Reuband, K.H. (Hg.): Alkoholkonsum und Alkoholabhängigkeit, Stuttgart 1980, S. 26 - 53. Richter, A.: Gefährliche Pädagogik - Kritische Bildung in neoliberalen Zeiten, in: Widersprüche: Zeitschrift für sozialistische Politik im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich, Heft 102, Dezember 2006, S. 99 - 112. Riemann, F.: Grundformen der Angst: Eine tiefenpsychologische Studie, 35. Auflage, München/Basel 2003. Robins, E./Gentry, K.A./Munoz, R.A./Marten, S.: A contrast of three more common illnesses with the ten less common in a study and 18 - months follow - up of 314 psychiatric emergency room patients. Archives of General Psychiatry 34, 1977, S. 269 - 281. Rosenhan, D.: Gesund in kranker Umgebung in: Watzlawick, P. (Hg.): Die erfundene Wirklichkeit, München 1981, S. 111 - 137. Rudolph, U.: Zur Sozialpsychologie psychologischer Forschung: Was ist eine interessante psychologische Theorie?, in: Försterling, F./Siensmeier-Pelster, J./Silny, L.M. (Hg.): 134 Kognitive und emotionale Aspekte der Motivation, Göttingen/Bern/Toronto/Seattle 2000, S. 239 - 258. Sack, F.: Definition von Kriminalität als politisches Handeln: der labeling approach, in: Kriminologisches Journal 1/1972. Saint-Exupéry, A. de: Der kleine Prinz, Zürich o.J.. Saß, H./Wittchen, H.U./Zaudig, M. (dt. Bearbeitung): Handbuch der Differentialdiagnosen DSM-IV, Göttingen/Bern/Toronto/Seattle 1999. Scheuch, E.K:: Sozialer Wandel. Studienskripten zur Soziologie, Band 1: Theorien des sozialen Wandels, 1. Auflage, Wiesbaden 2003. Schlösser, A.: Das Zweiklassensystem der Abhängigenversorgung in: Schwoon, D.R./Krausz, M. (Hg.): Suchtkranke. Die ungeliebten Kinder der Psychiatrie, Stuttgart 1990, S. 25 - 34. Schmidt, B./Hurrelmann, K.: Grundlagen einer präventiven Sucht- und Drogenpolitik, in: Schmidt, B./Hurrelmann, K. (Hg.): Präventive Sucht- und Drogenpolitik: Ein Handbuch, Opladen 2000, S. 11 - 23. Scholz, H./Steinberger, E.: Biologie der Sucht, in: Brosch, R./Mader, R. (Hg.): Sucht und Suchtbehandlung. Problematik und Therapie in Österreich, Wien 2004, S. 119 - 132. Scholz, H./Zingerle, H./Oblak, G.: Ein regionales Versorgungskonzept zur Langzeittherapie von Abhängigkeitserkrankungen, in: Krankenhaus de La Tour (Hg.): Die Alkoholkrankheit und andere Abhängigkeiten: Hintergründe - Verlaufsphasen - Folgeerscheinungen - Therapiekonzept, 4. überarbeitete Auflage, Treffen/Wolfsberg 1998, S. 101 - 104. Scholz, H./Zingerle, H./Kraschl-Seebacher, I./Rovere, H./Oblak, G.: Das Krankenhaus de La Tour, in: Krankenhaus de La Tour (Hg.): Die Alkoholkrankheit und andere Abhängig135 keiten: Hintergründe - Verlaufsphasen - Folgeerscheinungen - Therapiekonzept, 4. überarbeitete Auflage, Treffen/Wolfsberg 1998, S. 75 - 83. Schott, H.: Die Chronik der Medizin, Gütersloh/München 2000. Schott, H./Tölle, R.: Geschichte der Psychiatrie: Krankheitslehren - Irrwege - Behandlungsformen, München 2006. Schröer, W.: Sozialpädagogik und die soziale Frage, Weinheim/München 1999. Schulze, T.: Alltag und Lernen. Versuche einer Annäherung, in: Grunwald, K./Ortmann, F./Rauschenbach, T./Treptow, R. (Hg.): Alltag, Nicht-Alltägliches, und die Lebenswelt: Beiträge zur lebensweltorientierten Sozialpädagogik, Weinheim/München, S. 71 - 79. Seligman, M.E.P.: Helplessness. On depression, development and death, San Francisco 1975. Selvini Palazzoli, M./Cirillo, St./Selvini, M./Sorrentino, A.M.: Die psychotischen Spiele in der Familie, 2., in der Ausstattung veränderte Auflage, Stuttgart 1996. Sennett, R.: Der flexible Mensch: Die Kultur des neuen Kapitalismus, 7. Auflage, Berlin 2000. Sennett, R.: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität, Frankfurt/Main 2002. Sennett, R.: Respekt im Zeitalter der Ungleichheit, Berlin 2004. Seubert, W.: Zur symbolischen und politischen Funktion des Drogenkonsums, Diss., Berlin 2005 [URL: http://edocs.tu-berlin.de/diss/2005/seubert_walter.pdf, 05.03.07]. 136 Simmel, E.: Alcoholism and Addiction, in: Psychoanalytic Quarterly, 17, 1948, S. 6-13. Simon, F.B.: Meine Psychose, mein Fahrrad und ich: Zur Selbstorganisation der Verrücktheit, 9. Auflage, Heidelberg 2002. Solms, M./Turnbull, O.: Das Gehirn und die innere Welt. Neurowissenschaft und Psychoanalyse, Düsseldorf 2007. Stark, W.: Empowerment: Neue Handlungskompetenzen in der psychosozialen Praxis, Freiburg/Breisgau 1996. Steinhilper, R.: Depression: Herausforderungen an die Seelsorge, Stuttgart 1990. Stowasser, J.M./Petschenig, M./Skutsch, F.: Stowasser - Österreichische Schulausgabe: Lateinisch - deutsches Wörterbuch, Wien 1997. Thiersch, H.: Die Erfahrung der Wirklichkeit. Perspektiven einer alltagsorientierten Sozialpädagogik, Weinheim/München 1986. Thiersch, H.: Lebensweltorientierte Soziale Arbeit: Aufgaben der Praxis im sozialen Wandel, Weinheim/München 1992. Thiersch, H.: Lebenswelt und Moral: Beiträge zur moralischen Orientierung Sozialer Arbeit, Weinheim/München 1995. Thiersch, H.: Neugestaltung des Sozialen in der Konkurrenzgesellschaft, in: Müller, S./Reinl, H. (Hg.): Soziale Arbeit in der Konkurrenzgesellschaft: Beiträge zur Neugestaltung des Sozialen, Neuwied/Kriftel/Berlin 1997, S. 15 - 30. Thiersch, H./Füssenhäuser, C./Reinl, H./Stumpp, G.: Alltagswelten und pädagogisch therapeutischer Erfolg in Einrichtungen der Drogenarbeit (Abschlußbericht zum Teilprojekt 137 01 „Vergleichende klinische Erforschung der ambulanten und der stationären Kurz-, Mittel- und Langzeittherapie bei Drogenabhängigen”), Tübingen 2000. Thiersch, H./Grunwald, K./Köngeter, St.: Lebensweltorientierte Soziale Arbeit, in: Thole, W. (Hg.): Grundriss Soziale Arbeit: Ein einführendes Handbuch, Opladen 2002, S. 161 178. Thomasius, R./Küstner, U.J. (Hg.): Familie und Sucht. Grundlagen - Therapiepraxis Prävention, Stuttgart 2005. Toomey, T.L./Wagenaar, A.C.: Möglichkeiten alkoholbezogener Präventionspolitik in den USA, in: Schmidt, B./Hurrelmann, K. (Hg.): Präventive Sucht- und Drogenpolitik: Ein Handbuch, Opladen 2000, S. 129 - 149. Tölle, R./Windgassen, K.: Psychiatrie, 13., überarbeitete und ergänzte Auflage, Berlin/Heidelberg/New York 2003. Tretter, F.: Ökologie der Sucht. Das Beziehungsgefüge Mensch - Umwelt - Droge, Göttingen/Bern/Toronto/Seattle 1998. Tyndel, M.: Psychiatric study of one thousand alcoholic patients. Canadian Psychiatric Association Journal 19, 1974, S. 21 - 24. Uhl, A./Kopf, N./Springer, A./Eisenbach-Stangl, I./Kobrna, U./Bachmayer, S./Beiglböck, W./Preinsberger, W./Mader, R.: Handbuch Alkohol - Österreich, Zahlen, Daten, Fakten, Trends, 2., überarbeitete und ergänzte Auflage, Wien 2001. Vaillant, G.E.: The natural history of alcoholism. Harvard Univ. Press, Cambridge/Mass 1983. Vester, M./Teiwes-Kügler, C.: Die Neuen Arbeitnehmer und der neue industrielle Konflikt. Herausforderungen für die gewerkschaftlichen Strategien, in: Widersprüche: Zeit138 schrift für sozialistische Politik im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich, Heft 102, Dezember 2006, S. 79 - 98. Vetter, B.: Psychiatrie. Ein systemisches Lehrbuch für Heil-, Sozial- und Pflegeberufe, 6., überarbeitete und erweiterte Auflage, München/Jena 2001. Watzlawick, P.: Münchhausens Zopf oder Psychotherapie und Wirklichkeit, München 1992. Watzlawick, P.: Wie wirklich ist die Wirklichkeit. Wahn, Täuschung, Verstehen, 2. Auflage, München 2005a. Watzlawick, P.: Wirklichkeitsanpassung oder angepasste „Wirklichkeit“? Konstruktivismus und Psychotherapie in: Gumin, H./Meier, H. (Hg.): Einführung in den Konstruktivismus Band 5, 8. Auflage, München 2005b, S. 89 - 107. Watzlawick, P./Beawin, J.H./Jackson, Don D.: Menschliche Kommunikation - Formen Störungen Paradoxie, Nachdruck der 10., unveränderten Auflage, Bern 2003. Watzlawick, P.: Sich selbst erfüllende Prophezeiungen, in: Watzlawick, P/Kreuzer, F.: Die Unsicherheit unserer Wirklichkeit. Ein Gespräch über den Konstruktivismus, 6. Auflage, München 1998, S. 52 - 76. Weissman, M.M./Myers, J.K.: Clinical depression in alcoholism. American Journal of Psychiatry 37, 1978, S. 1304 - 1311. Winokur, G./Reich, T./Rimmer, J./Pitts, F.N.: Alcoholism III: Diagnosis and familial psychiatric illness in 259 alcoholic probands. Archives of General Psychiatry 23, 1970, S. 104 - 111. 139 Wolf, J.: Auf dem Weg zu einer Ethik der Sucht - Neurowissenschaftliche Theorien zur Sucht und deren ethische Implikationen am Beispiel der Alkohol- und Heroinsucht, Diss., Stuttgart 2003 [URL:http://deposit.ddb.de/cgibin/dokserv?idn=967219949&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filena me=967219949.pdf, 31.03.07]. Woodruff, R.A./Guze, S.B./Clayton, P.J./Carr, d.: Alcoholism and depression. Archives of General Psychiatry 28, 1973, S. 97 - 100. Wornig, S.: Psychoanalytische und sozialpsychologische Aspekte der Depression, DA, Klagenfurt 2004. Zielinsky, J.J.: Psychological test data of depressed, non-depressed and relapsed alcoholics receiving pharmalogical aversion. British Journal of Addiction 74, 1979, S. 63 - 70. Zilian, H.G.: Unglück im Glück: Überleben in der Spaßgesellschaft, Graz/Wien 2005. Zimbardo, P.G./Gerrig, R.J.: Psychologie, 7. neu übersetzte und bearbeitete Auflage, Berlin/Heidelberg/New York 1999. Zingerle, H./Petschniker-Berger, T./Bürger, G./Prochinger, M./Jungbauer, I./Pinteritsch, C./Peters, H.J./Moser, B./Adelt, I./Scholz, H.: Das therapeutische Team im Krankenhaus de La Tour, in: Krankenhaus de La Tour (Hg.): Die Alkoholkrankheit und andere Abhängigkeiten: Hintergründe - Verlaufsphasen - Folgeerscheinungen - Therapiekonzept, 4. überarbeitete Auflage, Treffen/Wolfsberg 1998, S. 106 - 109. 140