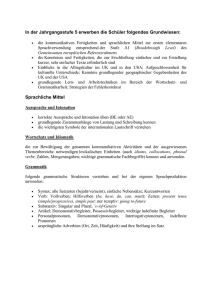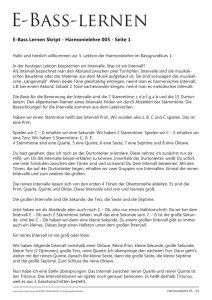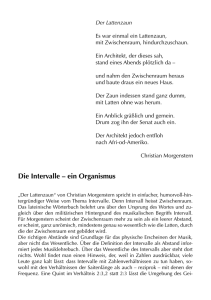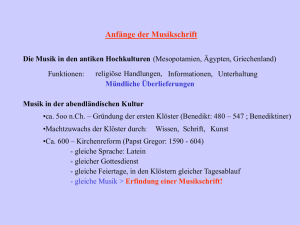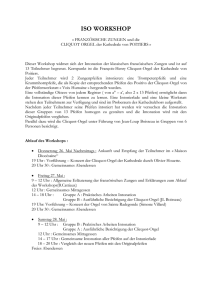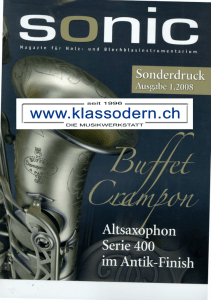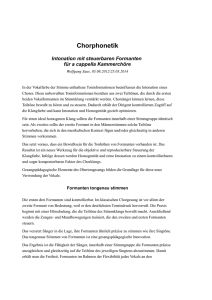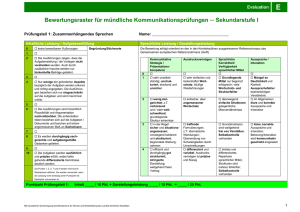Die reine Verführung, oder: Warum sinkt die Intonation bei A
Werbung
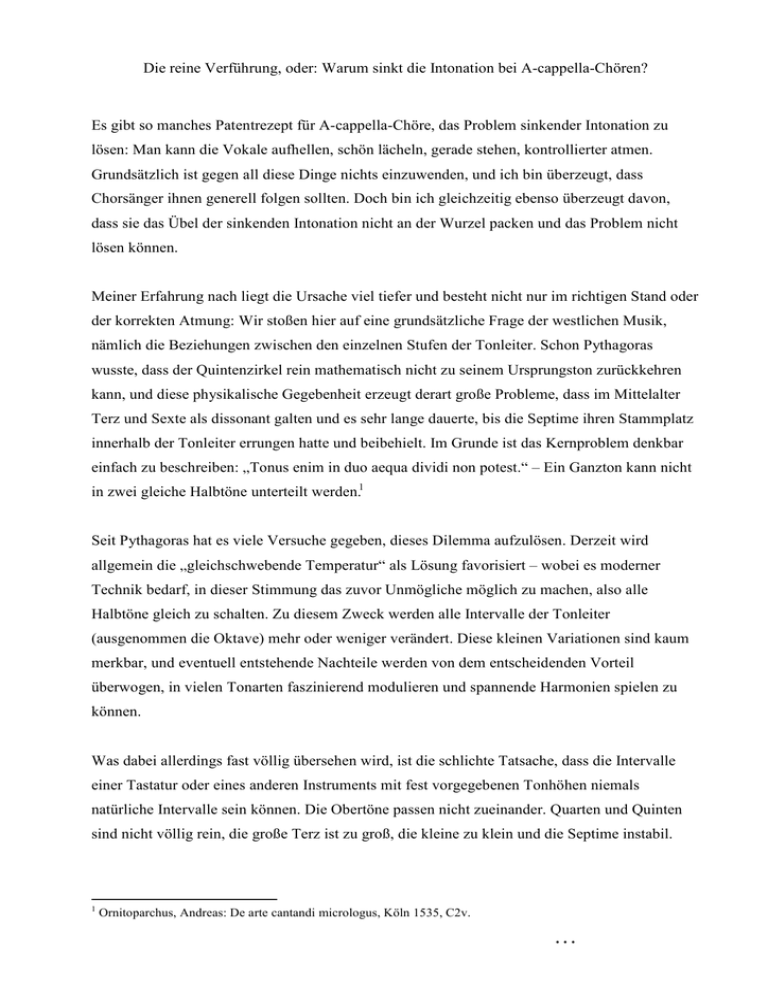
Die reine Verführung, oder: Warum sinkt die Intonation bei A-cappella-Chören? Es gibt so manches Patentrezept für A-cappella-Chöre, das Problem sinkender Intonation zu lösen: Man kann die Vokale aufhellen, schön lächeln, gerade stehen, kontrollierter atmen. Grundsätzlich ist gegen all diese Dinge nichts einzuwenden, und ich bin überzeugt, dass Chorsänger ihnen generell folgen sollten. Doch bin ich gleichzeitig ebenso überzeugt davon, dass sie das Übel der sinkenden Intonation nicht an der Wurzel packen und das Problem nicht lösen können. Meiner Erfahrung nach liegt die Ursache viel tiefer und besteht nicht nur im richtigen Stand oder der korrekten Atmung: Wir stoßen hier auf eine grundsätzliche Frage der westlichen Musik, nämlich die Beziehungen zwischen den einzelnen Stufen der Tonleiter. Schon Pythagoras wusste, dass der Quintenzirkel rein mathematisch nicht zu seinem Ursprungston zurückkehren kann, und diese physikalische Gegebenheit erzeugt derart große Probleme, dass im Mittelalter Terz und Sexte als dissonant galten und es sehr lange dauerte, bis die Septime ihren Stammplatz innerhalb der Tonleiter errungen hatte und beibehielt. Im Grunde ist das Kernproblem denkbar einfach zu beschreiben: „Tonus enim in duo aequa dividi non potest.“ – Ein Ganzton kann nicht in zwei gleiche Halbtöne unterteilt werden.1 Seit Pythagoras hat es viele Versuche gegeben, dieses Dilemma aufzulösen. Derzeit wird allgemein die „gleichschwebende Temperatur“ als Lösung favorisiert – wobei es moderner Technik bedarf, in dieser Stimmung das zuvor Unmögliche möglich zu machen, also alle Halbtöne gleich zu schalten. Zu diesem Zweck werden alle Intervalle der Tonleiter (ausgenommen die Oktave) mehr oder weniger verändert. Diese kleinen Variationen sind kaum merkbar, und eventuell entstehende Nachteile werden von dem entscheidenden Vorteil überwogen, in vielen Tonarten faszinierend modulieren und spannende Harmonien spielen zu können. Was dabei allerdings fast völlig übersehen wird, ist die schlichte Tatsache, dass die Intervalle einer Tastatur oder eines anderen Instruments mit fest vorgegebenen Tonhöhen niemals natürliche Intervalle sein können. Die Obertöne passen nicht zueinander. Quarten und Quinten sind nicht völlig rein, die große Terz ist zu groß, die kleine zu klein und die Septime instabil. 1 Ornitoparchus, Andreas: De arte cantandi micrologus, Köln 1535, C2v. ... -2Singt ein Chor mit instrumentaler Begleitung, löst sich das Problem scheinbar von allein. Die Instrumente geben die Intonation vor, die Stimmen folgen. Wird jedoch a cappella gesungen (oder schlimmer noch: setzt erst nach einem A-cappella-Teil die Instrumentalbegleitung quasi als Tonhöhenkontrolle wieder ein), fehlt den Stimmen jegliche Intonationsvorgabe. Es wäre vielleicht möglich, ein A-cappella-Stück mit Hilfe eines Tasteninstruments so einzustudieren, dass die Sänger durch ihr Tongedächtnis die korrekten Tonhöhen bei späterem A-cappella-Vortrag reproduzieren können. Aber letztlich wird der Chor immer die Töne singen wollen, die ihm „natürlich“ erscheinen – und das sind eben nicht die Töne der Tastatur. Stattdessen hören die Sänger genau aufeinander und beeinflussen sich gegenseitig. Um sich aneinander anzupassen und einen Wohlklang zu erzeugen, intonieren die Sänger intuitiv im Einklang mit den Grund- und Obertönen der anderen Stimmen. Und die Obertöne geben eine „reine“ Intonation vor. Wenn Chorsänger einen Dur-Akkord gänzlich unbeeinflusst (etwa durch ein Klavier) singen dürfen, wird die Terz etwas tiefer gesungen werden als die große Terz des Klaviers. Beim MollAkkord wird die Terz hingegen ein wenig höher liegen als auf dem Tasteninstrument. Da die Obertöne nun zueinander passen, singt der Chor einen wohlklingenden Akkord. Beispiel 1: Problematisch wird es jedoch, wenn sich die Funktion, die ein Ton in einem Akkord innehat, im Verhältnis zum nächsten Akkord verändert. In Beispiel 1 ist die Terz des Soprans gleichzeitig der Leitton, der zum Grundton des nächsten Akkords führt. Denken wir melodisch, so singen wir den Leitton stets ein wenig höher, damit die Melodie möglichst hell klingt. Wir erwarten, dass das Intervall zwischen Leit- und Grundton etwas enger gesungen wird. Wird das Fis unseres Beispiels jedoch „natürlich“ gesungen, also rein intoniert, und lassen wir sodann ein kleines Intervall zum G folgen, so fällt dieses G zwangsläufig zu tief aus. Der Chor hat also die Qual der Wahl: Er kann versuchen, a cappella in gleichschwebender Stimmung zu singen – eine ziemlich unmögliche Aufgabe; er kann eine „reine“ Terz anstreben – ... -3mit dem Risiko, den darauf folgenden Grundton zu tief zu singen; er kann die Terz etwas höher stimmen – wobei dann die Obertöne des Akkords nicht mehr zueinander passen; oder er kann das Intervall zwischen dem (tiefen) Leitton und dem Grundton absichtlich etwas vergrößern. In dieser harmonisch noch relativ einfachen Situation ist meines Erachtens die letztgenannte Option die beste. Beide Töne passen zu den Obertönen der anderen Stimmen: Man singt genau das, was die Natur vorgibt. Es ist die Aufgabe des Chorleiters, darauf hinzuweisen, dass der Sopran einen „großen“ Halbton singen muss. Dann wird er genau dorthin gelangen, wo er hinwollte. Beispiel 2: Ein anderes Beispiel aus dem englischen Repertoire: die ersten Takte von Henry Loosemores „O Lord, increase our faith“ (Beispiel 2). Als ich kürzlich die Tenorstimme dieser Motette in einem Chor sang, bemerkte ich, wie der Sopran gleich innerhalb der ersten beiden Takte merklich sank. Der Grund: In dieser vierstimmigen Wiedergabe intonierte der Sopran das Gis ganz natürlich, als Terz des Akkords – und eben nicht als Leitton, sodass der Sprung zurück zum A nicht mehr gelang. Die Chorleiterin bemerkte das Problem und ließ den Sopran die Stelle allein singen – die Intonation sank nicht mehr, da die Intervalle melodisch gesungen wurden, unbeeinflusst von Harmonie und Obertönen der anderen Stimmen. Doch sobald der Chor die Passage wieder vierstimmig sang, tauchte das Problem unverändert wieder auf. Die Lösung: Sobald der Sopran weiß, dass der Halbton nach oben „größer“ gesungen werden muss, ist das störende Phänomen beseitigt. Ich habe zwei Beispiele ausgewählt, in denen eine Spannung dadurch entsteht, dass derselbe Ton gleichzeitig als Terz und Septime fungiert. Es liegt auf der Hand, dass bei anderen Intervallen ähnliche Probleme bestehen. Dies sind freilich zwei einfache Beispiele; das Ganze wird recht schnell sehr komplex, da jeder Ton in einem Akkord eine bestimmte Funktion hat – und ein spezifisches Verhältnis zum ... -4folgenden Akkord. Das gilt umso mehr, wenn die Musik durch viele Tonarten läuft oder üppige Harmoniefolgen verwendet. Wie soll ein Chor mit solch komplexen Situationen zurechtkommen und dabei nicht an Intonationsgenauigkeit einbüßen? Ich glaube nicht, dass ein Chor in der Lage ist, jedes Intervall auf diese Weise zu berechnen oder berechnet zu bekommen. Glücklicherweise ist dies aber auch gar nicht nötig. Vielmehr ist es notwendig, dass der Chorleiter oder die Chorleiterin sich der Situationen bewusst ist, in denen derartige Probleme entstehen können. Er oder sie kann diese dann kurz erläutern und den Chor bitten, ein bestimmtes Intervall etwas größer oder kleiner zu intonieren. Manchmal kann es ausreichen, ein bestimmtes wiederkehrendes Intervall ins Visier zu nehmen: Als mein Chor neulich die schöne achtstimmige Fassung von „In dulci jubilo“ von Robert Pearsall aufführte, bestand ich darauf, dass die Sänger die Terz der bekannten Melodie stets etwas höher sangen – und wir blieben das gesamte Stück hindurch in sauberem F-Dur. Obwohl ich seit meiner Kindheit in vielen Chören gesungen habe, dauerte es 35 Jahre (15 davon als Chorleiter), bevor ich die reine Intonation bewusst kennen lernte. Die Frage, die ich mir selbst stelle, ist: Warum ist etwas so Grundsätzliches nicht allgemein besser bekannt? Warum wird es nicht unterrichtet? Ross Duffins interessantes Buch „How Equal Temperament Ruined Harmony (and Why You Should Care)“2 beginnt mit einer Episode aus dem Leben eines weltberühmten Orchesterdirigenten, der verzweifelt versucht, sein Orchester dazu zu bringen, zwei aufeinander folgende Akkorde „richtig“ zu spielen. Da er mit den Auswirkungen der gleichschwebenden Temperatur nicht vertraut ist, kann er nicht verstehen, warum dies nicht zu funktionieren scheint. Eigentlich hat mich diese Anekdote ein wenig getröstet. Zwar lernen Musiker, dass die gleichschwebende Temperatur existiert, und vielleicht auch, dass in der Vergangenheit auch andere Stimmungen Verwendung fanden. Doch anscheinend bleibt bei alldem unerwähnt, welche praktischen Auswirkungen diese Intervallverzerrungen haben. Offenbar befand ich mich in meiner Ahnungslosigkeit in durchaus guter Gesellschaft. Tatsächlich aber – wie so viele Sängerinnen und Sänger, die ein gutes Empfinden für Tonhöhen haben – wusste ich eigentlich schon die ganze Zeit hindurch über die Wirkung dieser ... -5Verzerrungen Bescheid. Ich spürte intuitiv, wann ich ein Intervall größer oder kleiner intonieren musste – ohne überhaupt zu merken, dass ich es tat. Ohne eigene Wahrnehmung des Phänomens und ohne die dazugehörige Theorie konnte ich es anderen aber unmöglich nahe bringen. Besagte Theorie (und mit ihr auch die eigene Wahrnehmung) kam mit der Entdeckung des Buches „Die reine Intonation im Chorgesang“3. Es enthielt und erläuterte alles, was ich bereits wusste, selbst jedoch nicht auszudrücken vermochte. Das Zahlenwerk erschien stellenweise etwas kompliziert, aber im Ergebnis verstand ich endlich, warum einige Intervalle „falsch“ intoniert werden und wie sich dies auf die gesamte Tonhöhe eines Chores auswirken kann. Seitdem bin ich in der Lage, meinem Chor4 die Intervalle zu vermitteln, die sicherstellen, dass die Intonation nicht absinken wird. Ich wage nicht zu behaupten, dass wir nie in der Tonhöhe absinken, und ich muss gestehen, dass wir einige harmonisch sehr komplexe Stücke (wie etwa Brittens „The Evening Primrose“) noch nicht vollends gemeistert haben. Doch sind wir mittlerweile in der Lage, ganze A-cappella-Programme ohne Intonationsprobleme aufzuführen, und sollte die Intonation irgendwo doch einmal absacken, so kann ich meistens das dafür verantwortliche Intervall ausmachen, das bei kurzem Konzentrationsmangel der Auslöser des Problems war. Diese Einsicht hat mich zu einem völlig neuen Probenansatz geführt: Ich spreche in der Probe nie davon, dass ein bestimmter Ton zu tief (oder zu hoch) gesungen wurde. Stattdessen bitte ich den Chor, das betreffende Intervall größer (oder kleiner) zu singen. Das Verhältnis zwischen der gleichschwebenden Stimmung und der reinen Intonation sollte zum Standardwissen eines jeden Chorleiters bzw. einer jeden Chorleiterin gehören. Wenn es gelingt, mit meinem Laienchor Intervalle einzustudieren, dürfte es bestimmt möglich sein, dies jedem interessierten Chor nahe zu bringen. Ich würde mir wünschen, dass andere meine Erfahrung langjähriger Ahnungslosigkeit nicht teilen oder nicht erst zufällig eine Doktorarbeit in der Staatsbibliothek entdecken müssten, um endlich ein Verständnis für das musikalisch Natürlichste 2 Duffin, Ross W.: How Equal Temperament Ruined Harmony (and Why You Should Care), New York 2007, 196 S. 3 Bevor Sie zur Buchhandlung oder Bibliothek laufen, sollten Sie wissen, dass ich diese Doktorarbeit in der Berliner Staatsbibliothek fand: Gratzki, Bettina: Die reine Intonation im Chorgesang, Bonn 1993, 300 S. 4 The Embassy Singers, Berlin: www.embassysingers.de ... -6der Welt zu entwickeln. Es fehlt ein leicht verständlicher Leitfaden über die Auswirkungen der gleichschwebenden Temperatur und der reinen Intonation im A-cappella-Chorgesang, der für normalsterbliche Chorleiter geschrieben wurde. Jetzt muss ich meinen Chor nur noch dazu bringen, gut zu stehen, richtig zu atmen, schöne Vokale zu singen – und dabei stets zu lächeln!