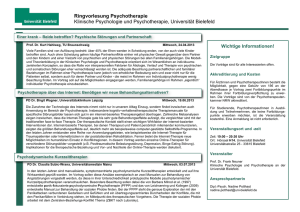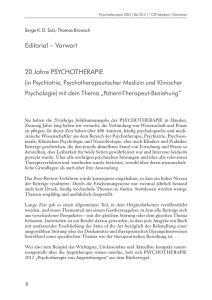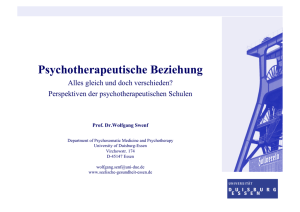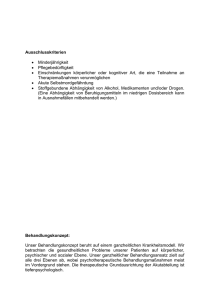Onlineartikel - Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft
Werbung
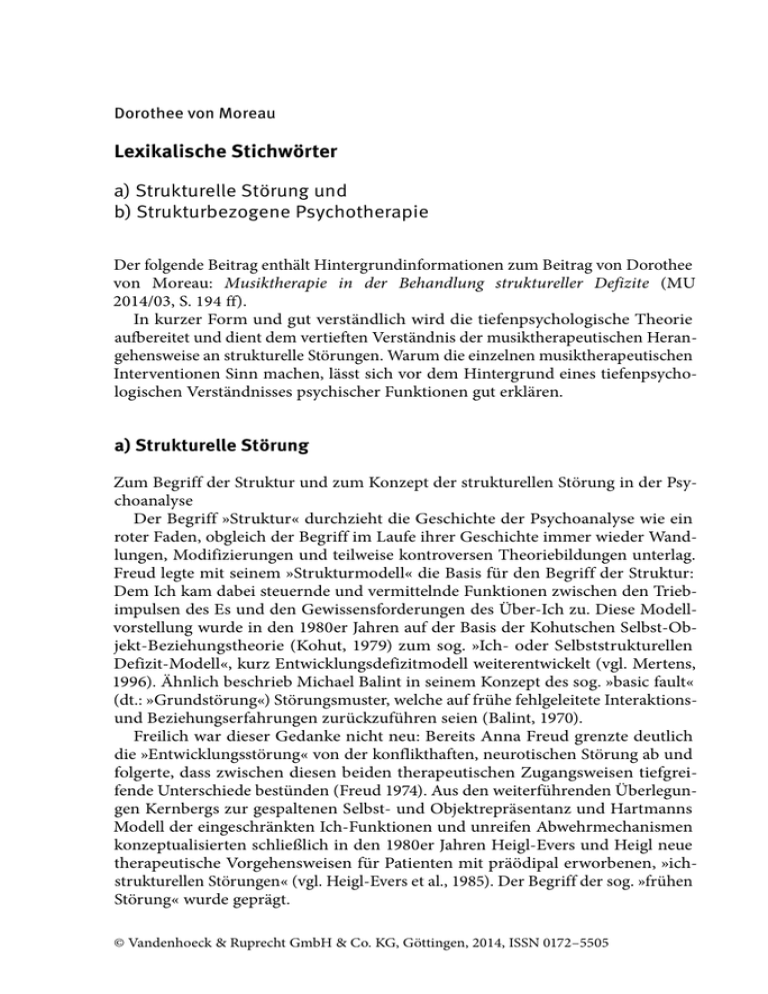
Dorothee von Moreau Lexikalische Stichwörter a) Strukturelle Störung und b) Strukturbezogene Psychotherapie Der folgende Beitrag enthält Hintergrundinformationen zum Beitrag von Dorothee von Moreau: Musiktherapie in der Behandlung struktureller Defizite (MU 2014/03, S. 194 ff). In kurzer Form und gut verständlich wird die tiefenpsychologische Theorie aufbereitet und dient dem vertieften Verständnis der musiktherapeutischen Herangehensweise an strukturelle Störungen. Warum die einzelnen musiktherapeutischen Interventionen Sinn machen, lässt sich vor dem Hintergrund eines tiefenpsychologischen Verständnisses psychischer Funktionen gut erklären. a) Strukturelle Störung Zum Begriff der Struktur und zum Konzept der strukturellen Störung in der Psychoanalyse Der Begriff »Struktur« durchzieht die Geschichte der Psychoanalyse wie ein roter Faden, obgleich der Begriff im Laufe ihrer Geschichte immer wieder Wandlungen, Modifizierungen und teilweise kontroversen Theoriebildungen unterlag. Freud legte mit seinem »Strukturmodell« die Basis für den Begriff der Struktur: Dem Ich kam dabei steuernde und vermittelnde Funktionen zwischen den Triebimpulsen des Es und den Gewissensforderungen des Über-Ich zu. Diese Modellvorstellung wurde in den 1980er Jahren auf der Basis der Kohutschen Selbst-Objekt-Beziehungstheorie (Kohut, 1979) zum sog. »Ich- oder Selbststrukturellen Defizit-Modell«, kurz Entwicklungsdefizitmodell weiterentwickelt (vgl. Mertens, 1996). Ähnlich beschrieb Michael Balint in seinem Konzept des sog. »basic fault« (dt.: »Grundstörung«) Störungsmuster, welche auf frühe fehlgeleitete Interaktionsund Beziehungserfahrungen zurückzuführen seien (Balint, 1970). Freilich war dieser Gedanke nicht neu: Bereits Anna Freud grenzte deutlich die »Entwicklungsstörung« von der konflikthaften, neurotischen Störung ab und folgerte, dass zwischen diesen beiden therapeutischen Zugangsweisen tiefgreifende Unterschiede bestünden (Freud 1974). Aus den weiterführenden Überlegungen Kernbergs zur gespaltenen Selbst- und Objektrepräsentanz und Hartmanns Modell der eingeschränkten Ich-Funktionen und unreifen Abwehrmechanismen konzeptualisierten schließlich in den 1980er Jahren Heigl-Evers und Heigl neue therapeutische Vorgehensweisen für Patienten mit präödipal erworbenen, »ichstrukturellen Störungen« (vgl. Heigl-Evers et al., 1985). Der Begriff der sog. »frühen Störung« wurde geprägt. © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014, ISSN 0172–5505 Lexikalische Stichwörter 195 Die Unterscheidung zwischen frühen konflikthaften und früh erworbenen strukturellen Störungen jedoch wird erst im Laufe der Entwicklung der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD) in der Arbeitsgruppe um Rudolf et al. (2002) explizit. Damit wurde der Begriff der »frühen Störung« endgültig abgelöst. Zur Bestimmung des (hohen, mäßigen, geringen oder desintegrierten) Strukturniveaus eines Patienten spielen nun Dimensionen wie Selbst- und Objektwahrnehmung, Regulierung/Steuerung der eigenen Affekte sowie des Objektbezugs, Kommunikation nach Innen und Außen und Bindung an innere und äußere Objekte eine Rolle. Im Weiteren wurde der Begriff »Struktur« in der »Struktur-Fokusliste« und der »Struktur-Checkliste« des OPD2 phänomenologisch klarer gefasst. Hier finden sich Elemente wie Selbstreflexion, Affektdifferenzierung, Affekterleben, Affektausdruck und -toleranz, Identität, Empathie, Nutzung von Phantasie, Bindungsfähigkeit, emotionaler Kontakt, Selbstwertregulation, Körperselbst, emotionaler Kontakt, Internalisierung guter Erfahrungen (vgl. Grande et al.2002). Struktur wird demnach verstanden als »Fundament für den Aufbau der Persönlichkeit« (Freud A. 1974), als »Niveau der kognitiv-mentalen Operationen des Patienten« (Krause 2009), sie dient der »Aufrechterhaltung einer inneren, psychischen Welt… im Wechselspiel zwischen individuellen Reaktionsdispositionen, körperlichen Bedürfnissen und Phantasien einerseits sowie Beziehungserfahrungen der Kindheit und Jugend andererseits « (Schneider und Seidler, 1995, S. 136). Struktur wird teilweise mit Mentalisierungs- und Symbolisierungsfähigkeit gleichgesetzt; jene Prozesse spielen auch bei strukturbildenden Prozessen eine wichtige Rolle, sind mit Struktur allerdings nicht identisch (vgl. Rudolf, 2011). Struktur beschreibt also die »psychischen Fähigkeiten und Werkzeuge« des Menschen, welche er braucht, um sich und die Welt zu verstehen (Mentalisierung und Selbstreflexion) und damit umgehen zu können. Dies zeigt sich, indem er z. B. Entwicklungsherausforderungen meistern, Konflikt austragen, Bedürfnisse und Wünsche aussprechen und regulieren und Neuanpassungen leisten kann. Die »strukturbedingte Störung«: Symptomatik, Ätiologie und Pathogenese Im Unterschied zu den konfliktbedingten Störungen imponieren strukturbedingte Störungen je nach Ausmaß in einer teilweise wenig greifbaren, teilweise sehr heftigen Symptomatik, geprägt durch Orientierungslosigkeit, vages Identitätsempfinden, fehlendes affektives Selbstverständnis, Kontrollverluste und ausgeprägte Beziehungsschwierigkeiten (vgl. Rudolf 2004). Neben der »lauten«, externalisierten, oft krisenhaft zugespitzten Symptomatik einer strukturellen Störung mit heftigen Gefühlsschwankungen, Affektdurchbrüchen, selbstverletzendem Verhalten und starken Beziehungsturbulenzen sollte die »leise« Symptomatik eines strukturellen Defizits nicht übersehen werden. Diese ist gekennzeichnet durch weitgehenden inneren Rückzug, einer Tendenz, sich »unsichtbar« zu machen, einer Vermeidung von Beziehungen, emotionaler Leere, Bezugslosigkeit zu sich selbst, Ausdruckskargheit, Hilflosigkeit, Überforderung und einem Erleben basaler Ängste von © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014, ISSN 0172–5505 196 Dorothee von Moreau Selbstverlust. Konfusion, Erregung oder Starre, Erlöschen, Leere stehen im Vordergrund des Erlebens; im Bezug zu sich selbst wird eine große Ratlosigkeit, fehlende Selbstreflexivität, fehlende Mentalisierung und die Unfähigkeit, sich selbst zu verstehen beschrieben. Die Betroffenen sind sich selbst fremd. Fehlende Empathie und Objektabgrenzung führen zu interpersonellen Verstrickungen, fehlende Selbstkompetenz und Affekttoleranz zu notfallmäßigen Impulsdurchbrüchen (affektive Durchbrüche, Essanfälle, Selbstverletzung). Dabei sind die Symptome nicht als Verdrängung, Abwehr oder Vermeidung zu interpretieren, sondern müssen als Ausdruck eines frühen grundlegenden Defizits verstanden werden: So geht man im Modell der strukturellen Störung davon aus, dass aufgrund einer belasteten frühkindliche Beziehungssituation die Entwicklung entscheidender struktureller Funktionen beeinträchtigt ist. Ob nun kindliche Merkmale, eine stressvoll erlebte Elternschaft oder eine schwierige soziale Lebenssituation der Familie insgesamt dafür ausschlaggebend sind, so führen im Zeitfenster der frühen Entwicklung anhaltende Interaktionsdefizite oder -missverständnisse zu einer defizitären oder vulnerablen Strukturentwicklung. Oft treten die Symptome erst später, im Rahmen von Entwicklungsanforderungen der Adoleszenz oder des frühen Erwachsenenalters auf, wenn kompensatorischer Bewältigungsmuster scheitern (vgl. Rudolf 2011). Dabei sei die aufbrechende Symptomatik wenig umschrieben und nicht eindeutig. Sie sei an meist soziale Situationen gebunden (berufliche Änderungen, Beziehungssituationen), in denen der Patient Schwierigkeiten oder Krisen erlebe, welche er nicht verstehe und welche er aufgrund mangelnder struktureller Voraussetzungen nicht meistern könne. Aus der neueren Entwicklungspsychologie, insbesondere der Säuglingsforschung der letzten Dekade ist uns bewusst geworden, wie sehr das Kind vom ersten Lebenstag an angewiesen ist, von bereitwillig verstehenden Eltern angemessen, d. h. instinktsicher, gelassen und wohlwollend aufmerksam und feinfühlig handelnd beantwortet zu werden: negative Affekte und Unlusterfahrungen müssen aufgefangen und beruhigt, Grundversorgung und Nähe sicher bereitgestellt werden. Es braucht aber auch die Erfahrung, spielerisch in zweckfreie Interaktion eintauchen zu können, entspanntes Miteinander-Sein zu erleben, dabei Affekte zu teilen, sich anstecken zu lassen, gespiegelt, (aus-)gehalten und erwidert zu werden, emotionale Ansteckung, geteilte Aufmerksamkeit und Imitation zu erleben und Möglichkeiten der sozialen Rückversicherung auf vielfältige und differenzierte Weise zu erhalten (vgl. Lenz und Moreau, 2012). Solche Erfahrungen sichern nicht nur die vitale Versorgung oder helfen dem Kind, zunehmend selbständiger Impulse zu steuern, Affekte zu regulieren oder Kommunikation einzuüben, solche Erfahrungen helfen dem Kind, sich selbst zu spüren und erlebend zu »verstehen«. Indem es sich im Anderen erwidert und gespiegelt erfährt, entwickelt das Kind ein erstes »implizites Wissen« für sich Selbst, seiner Affekte, seiner Selbstwirksamkeit und entwickelt ein sicheres Selbstempfinden sowie Selbstkompetenzen im Umgang mit sich und der Welt (vgl. Stern, 2000). Je kleiner das Kind, desto körpernaher und impliziter sind diese Erfahrungen gespeichert als Atmosphäre des In-der Welt-seins. Für die frühe Entwicklung des Selbst weit vor Prozessen der Mentalisierung wird deshalb der Begriff »Embodiment« verwendet. © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014, ISSN 0172–5505 Lexikalische Stichwörter 197 Affektwahrnehmung und -wiedererkennung, Affekttoleranz und -regulation, Empathie, Regulierung von Spannungszuständen und Unlusterfahrungen, Impulssteuerung, Internalisierung und Objektkonstanz, Bindung, (Körper-)Selbst, Identität, Unterscheidung zwischen Innen und Außen,… all dies wird in frühen Interaktionserfahrungen mit den nächsten wichtigen Bezugspersonen im Umkreis der Familie basal erlebt, wiederholt erfahren, dabei grundlegend entwickelt, modifiziert und gefestigt. All diese Erfahrungen bilden das psychische Grundrüstzeug oder Werkzeug oder psychodynamisch ausgedrückt das Strukturniveau eines Menschen. Findet diese strukturelle Entwicklung nur unzureichend oder bruchstückhaft statt oder kam es zu einschneidenden Defiziten, bleibt die Grundstruktur des Menschen verletzlich oder defizitär. Fehlende Bindung, irritierende Objekterfahrungen, Vernachlässigung oder inadäquate Beantwortung der kindlichen Grundbedürfnisse nach Nähe und emotionaler Antwort, seltener auch aggressiv-entwertende Haltungen oder Misshandlungen führen im Kind zu einem hilflosen Ausgeliefertsein an die eigene Verzweiflung und eine schwer erträgliche Welt. Die weitere psychische Entwicklung muss unter der Bedingung fehlender Verfügbarkeit über strukturelle Funktionen stattfinden und führt entweder zu kompensatorischen Bewältigungsmustern oder früher Symptombildung (z. B. frühe Regulationsstörungen, Unfallneigung). Ein Scheitern an Entwicklungsaufgaben oder anderen situativen Anforderungen kann aber auch im späteren Leben zum Zusammenbruch der Bewältigung, zu strukturellen Krisen mit Symptombildung oder Notfallreaktionen (z. B. antisoziales Verhalten, Suchtverhalten, selbstverletzendes Verhalten, Unfallneigung) führen (Rudolf 2011). Fonagy (2004) konzeptualisierte die Entstehung des »fremden Selbst (alien self)« durch »das Scheitern der kongruenten Spiegelung«. Dieser fremde Anteil entwickelte sich erstens »durch die Leere, die entsteht, wenn die die innere Verfassung des Kindes nicht adäquat gespiegelt wird«, und zweitens durch die Verinnerlichung der misslungenen Beziehungserfahrung. Teile des Selbst werden in der Folge als fremd und nicht wirklich zum Selbst gehörig erlebt (Strehlow 2013, S. 140). Unzureichende Strukturbildung kann aufgrund unterschiedlicher pathogenetischer Prozesse bei nahezu allen psychischen Störungen verborgen zugrundeliegen, angefangen von affektiven Störungen (z. B. Depression) über Persönlichkeitsstörungen bis hin zu Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis. Nach Rudolf schließen sich die »pathogenen Mechanismen der frühen Konflikte und der strukturellen Entwicklungsstörungen nicht aus, sie bestehen häufig nebeneinander, sind jedoch beide Folgen von nicht mentalisierten, implizit gespeicherten Vorgängen der frühen Entwicklung« (Rudolf, 2011, S. 57). Wichtig für das Verständnis sei es, »nicht einen seit jeher bestehenden Dauerzustand zu betonen, sondern die Aktualisierung in einer auslösenden Situation deutlich werden zu lassen« (Rudolf, 2011, S. 71). In der psychodynamischen Psychotherapie wird deshalb das Strukturniveau eines Patienten neben den anderen Achsen der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik immer erhoben und eingeschätzt. Denn dies hat entscheidende Implikationen für die Therapieplanung und die konkrete Umsetzung in der therapeutischen Vorgehensweise. © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014, ISSN 0172–5505 198 Dorothee von Moreau b) Strukturbezogene Psychotherapie Manual OPD In den verschiedenen Arbeitsgruppen zur OPD und den daraus abgeleiteten therapeutischen Implikationen für die »strukturbezogenen Psychotherapie« haben sich auf der Basis der therapeutischen Empfehlungen von Heigl-Evers und Heigl (1985), Grande et al. (1998; 2002), Oberbracht (2002; 2005) und Rudolf (2002; 2004) hervorgetan. Das »Manual der Strukturbezogenen Psychotherapie« von Rudolf (2004; 2006) soll im folgenden Abschnitt als Grundlage der ausgeführten Überlegungen herangezogen werden. Rudolf bringt es auf den Punkt, wenn er fordert: »Die … Dynamik struktureller Einschränkungen und die zugrunde gelegte Hypothese früher Beziehungsstörungen begründen insbesondere eine modifizierte therapeutische Haltung (weniger Distanziertheit und mehr therapeutische Aktivität im Sinne der Beelterung), eine modifizierte therapeutische Zielsetzung (aktive Förderung struktureller Fähigkeiten) und eine Reihe von therapeutischen Techniken, die geeignet sind, eine effektive therapeutische Zusammenarbeit auch unter der Voraussetzung erheblicher Beziehungs- und Kommunikationsprobleme zu ermöglichen« (Rudolf 2011, S. 69). Affektsteuerung, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Empathie und Bindung So gehe es auch in der psychodynamischen Therapie weniger um Bewusstmachung von Bedürfnishaftem, Dahinterliegendem, Unbewusstem, als vielmehr um die Förderung struktureller Funktionen wie Affektdifferenzierung, Impulssteuerung, Selbstreflexion, Fremdwahrnehmung, Empathie und Bindung. Therapie müsse den Patienten in seinen Fähigkeiten unterstützen, sich selbst zu beruhigen, sich selbst und seine interpersonelle Situation zu verstehen und diese anders als bisher regulieren zu können. Dies sei Voraussetzung dafür, dass der Patient lerne, sich ein Stück weit von sich selbst zu distanzieren und die Muster seines dysfunktionalen Verhaltens zu sehen. Abwehrdeutungen dagegen würden die Hilflosigkeit des Patienten ebenso verstärken wie ein abstinentes Nicht-Eingehen auf aktuelle Fragen und Nöte, Übertragungsdeutungen den Patienten eher belasten und verwirren, als die therapeutische Beziehung zu klären und zu fördern. Therapeutische Haltung Grundsätzlich empfiehlt Rudolf angesichts der basalen Beziehungsstörung eine wohlwollende, verstehen-wollende, zuversichtliche therapeutische Haltung, um dem »zwischen kindlicher Hilflosigkeit und Bedürftigkeit, erotisierender Attraktivität, aggressiver Entwertung und kalter Distanzierung« schillernden Beziehungsangebot des Patienten angemessen zu begegnen (Rudolf, 2011, S. 71f). Respekt und Anteilnahme für die Bewältigungs- und Überlebensstrategien des Patienten sollen helfen, diese Beziehungsangebote nicht persönlich zu nehmen, sondern als therapeutische © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014, ISSN 0172–5505 Lexikalische Stichwörter 199 Aufgabe zu verstehen. Die Rücksicht auf die eingeschränkten Beziehungskompetenzen, die Abgegrenztheit gegenüber dem interpersonellen Sog oder der interpersonellen Leere sowie das Ernstnehmen des pathogenen Gewichts der Störung und ihrer katastrophalen sozialen Auswirkungen bewahre den Therapeuten, therapeutisch vereinnahmt oder verstrickt zu werden oder der Verführung zu erliegen, dem Patienten eine Konfrontation mit biographische Belastungserfahrungen oder seiner inneren Destruktivität abzuverlangen. Ein aktiver Umgang mit dem Patienten trage im Spiegeln und Markieren von Affekten, Ermutigen, Anleiten, Regeln geben und Grenzen setzen Züge von Beelterung (vgl. Heigl-Evers, 1985). Der Therapeut müsse sich besonders zu Beginn der Therapie als Hilfs-Ich verstehen, denn aufgrund der strukturellen Defizite könnten viele Kompetenzen und Inhalte noch nicht aus dem Patienten selbst heraus entwickelt werden, sondern bedürften therapeutischer Anleitung im Hier und Jetzt. Der Therapeut dürfe keine Angst haben vor edukativen, coachenden und persönlich gefärbten Vorgehensweisen. Therapeutische Methoden Zu den im Vordergrund stehenden therapeutischen Methoden gehöre es, den Patienten −− zu Narrativen einzuladen und diese Ereignisepisoden im Sinne der Mentalization Based Psychotherapy (Batemann und Fonagy 2004; Fonagy, 2002) auszuleuchten und zu verstehen, −− dem Patienten die eigenen Wahrnehmungen zu spiegeln und somit »ein Bild von sich zurückzugeben«, −− aus diesen vielen Spiegelungen Muster abzuleiten, −− die affektiven Aspekte einer Situation herauszuarbeiten und zu verbalisieren, −− dabei gemeinsame Affektregulierung und »spiegelnde Verlebendigung des Selbst« zu ermöglichen (Rudolf, 2011, S. 139), −− die Ereignisepisoden in einen Beziehungskontext zu stellen und zu verstehen versuchen. Im Unterschied zur Übertragungsfokussierten Psychotherapie (Clarkin et al., 2001) werden dabei Beziehungssituationen nicht direkt aus der dyadischen Therapeut-Patient-Beziehung, sondern aus Alltagsbegebenheiten des Patienten gemeinsam quasi aus der Position des Dritten betrachtet, ausgeleuchtet und zu verstehen versucht. Dieses therapeutische aufwändige »Buchstabieren« von Affekten und Beziehungskontexten unterstütze den Patienten darin, eigene Affekte wahrzunehmen und zu benennen, Empathie für andere zu entwickeln, interaktionelle Muster zu verstehen und Handlungsspielräume dafür zu entwickeln. Entgegen evtl. regressiver Erwartungen soll angeregt werden, dass die Zeit zwischen den Behandlungsstunden intensiv genutzt wird, um interpersonelle Kompetenzen weiter zu entwickeln, auszuprobieren und einzuüben. Das therapeutische Vorgehen sei als »strukturfördernde Begleitung mit übenden Anteilen« zu verstehen (Rudolf, 2011, S. 137). Es fokussiere zunächst das Außen und © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014, ISSN 0172–5505 200 Dorothee von Moreau suche nach Stressoren, mit welchen der Patient sich konfrontiert sehe: Beziehungen, welche er nicht verstehe, Affekte, die er nicht ertrage oder soziale Situationen, die er nicht bewältigen könne. Im Laufe der Arbeit verschiebe sich der Fokus mehr und mehr zu den Bedürfnissen und Empfindungen, zu einem Selbst, welches sich mehr und mehr konstruiere, verstehe und schließlich verantworte. In seinem Manual zur strukturbezogenen Psychotherapie empfiehlt Rudolf (2004) als Interventionsabfolge 1. die Förderung der Wahrnehmung, 2. erklärende und verstehende Interventionen zur Erkennung von Verhaltens- und Erlebensmustern des Patienten, 3. Förderung der Verantwortungsübernahme und Selbstkompetenz. Therapeutische Angebote sollten zunächst vom Therapeuten initiiert werden, sie vom Patienten zu fordern, der weder Einsicht, noch Überblick in sein Inneres hat, sich von innen her fremd ist, mag eine Überforderung sein. Literatur Balint, M. (1970): Therapeutische Aspekte der Regression. Stuttgart: Klett. Bateman, A. und Fonagy, P. (2004): Psychotherapy for Borderline Personality Disorder. Mentalization Based Treatment. Oxford: University Press. Bateman, A.W. Fonagy, P. (2012): Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice. Arlington: American Psychiatric Publishing. Bowlby, J. (1951): Maternal Care and Mental Health. WHO Monograph Series. Genf (deutsch 1973) Brisch, K.H (2013, 12. Aufl.): Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie. Stuttgart: Klett-Cotta. Clarkin, J.F.; Yeomans, F.E.; Kernberg, O.F. (2001): Psychotherapie der Borderline-Persönlichkeit. Manual zur transference-focused-psy chotherapy (TFP). Stuttgart: Schattauer. Dammann, G.; Clarkin, J.F.; Yeomans, F.E.; Kernberg, O.F. (2007): Die übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP). Ein störungsspezifisches manualgeleitetes psychodynamisches Verfahren zur Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung. In: G. Dammann und P.L. Janssen (Hg): Psychotherapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Stuttgart: Thieme. Fonagy, P.; Target, M. (2003): Frühe Bindung und psychische Entwicklung. Gießen: Psychosozial-Verlag. Fonagy, P.; Gergley, G.; Jurist, E.L.; Target, M. (2004): Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst. Stuttgart: Klett-Cotta. Freud, A. (1974): Entwicklungspsychopathologie aus psychoanalytischer Sicht. In: Die Schriften der Anna Freud. Bd. 10. München. Kindler. Grande, T.; Rudolf, G.; Oberbracht, C. (1998): Die Strukturachse der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD). Forschungsergebnisse zum Konzept und zur klinischen Anwendung. PTT Persönlichkeitsstörungen Theorie und Therapie 2, S. 173–182. Grande, T.; Schauenburg, H.; Rudolf, G. (2002): zum Begriff der »Struktur« in verschiedenen Operationalisierungen. In: G. Rudolf, T. Grande, P. Henningsen (Hg.): Die Struktur der Persönlichkeit. Vom theoretischen Verständnis zur therapeutischen Anwendung des psychodynamischen Strukturkonzepts. Stuttgart: Schattauer. Heigl-Evers, A.; Henneberg-Mönch, U. (1985): Psychoanalytisch-interaktionelle Psychotherapie bei präödipal gestörten Patienten mit Borderline-Strukturen. Prax Psychother Psychosom 30, S. 227–235. © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014, ISSN 0172–5505 Lexikalische Stichwörter 201 Kohut, H. (1979): Die Heilung des Selbst. Frankfurt/M: Surkamp Krause, R. (2009): Psychotherapeutische Interventionen. In: M. Hauzinger, P. Pauli (Hg.). Psychotherapeutische Methoden. Göttingen. Hogrefe. Mertens, W. (1996): Grundalgen psychoanalytischer Psychotherapie. In: W. Senf und M. Broda (Hg.): Praxis der Psychotherapie. Stuttgart: Thieme Oberbracht, C. (2002): Hassen oder Verpassen? Prognostische Bedeutung der Struktureinschätzung nach OPD für die therapeutische Arbeitsbeziehung. In: G. Rudolf, T. Grande, P. Henningsen (Hg.): Die Struktur der Persönlichkeit. Vom theoretischen Verständnis zur therapeutischen Anwendung des psychodynamischen Strukturkonzepts. Stuttgart: Schattauer. Oberbracht, C. (2005): Psychische Struktur im Spiegel der Beziehung. Klinische Anwendung und empirische Prüfung der Strukturachse der OPD bei stationären psychosomatischen Patienten. Inauguraldissertation medizinische Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Rudolf, G. (2002): Konfliktaufdeckende und strukturfördernde Zielsetzungen in der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie. Z Psychosom Med Psychothe 48, S. 163–173 Rudolf, G. (2004): Strukturbezogene Psychotherapie. Leitfaden zur psychodynamischen Therapie struktureller Störungen. Stuttgart: Schattauer. Rudolf, G. (2011): Psychodynamische Psychotherapie. Die Arbeit an Konflikt, Struktur und Trauma. Stuttgart: Schattauer. Schneider G. und Seidler G. (1995): Internalisierung und Strukturbildung. Theoretische Perspektiven und klinische Anwendungen in Psychoanalyse und Psychotherapie. Wiesbaden: Springer. Stern, D.N.; Bruschweiler-Stern, N.; Harrison, A.M.; Lyons-Ruth, K.; Morgan, A.C.; Nahum, J.P., Sander, L.; Tronnick, E.Z. (1998): The process of the therapeutic change involving implicit knowledge: some implications of developmental observation for adult psychotherapy. Infant Mental Health, 19, S. 300–308. Stern, D. (1977/2000): Mutter und Kind. Die erste Beziehung. Stuttgart: Klett-Cotta. Strehlow, G. (2013): Mentalisierung und ihr Bezug zur Musiktherapie. Musiktherapeutische Umschau 34 (3), 135–143. Dorothee von Moreau, Prof. Dr. rer. medic., Musiktherapeutin DMtG, Dipl.-Psych., Psychologische Psychotherapeutin. Derzeit Leiterin der Musiktherapeutischen Lehrambulanz und Professorin an der Fakultät für Therapiewissenschaften der SRH Hochschule Heidelberg, Maria Probst Str. 3, 69123 Heidelberg. [email protected] © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014, ISSN 0172–5505