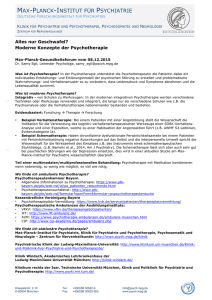Norbert Bowe
Werbung

1 %XQGHVYHUEDQGGHU9HUWUDJVSV\FKRWKHUDSHXWHQH9 =XP$UWLNHO Ä'LH9HUVRUJXQJSV\FKLVFK(UNUDQNWHULQ'HXWVFKODQG±XQWHU EHVRQGHUHU%HUFNVLFKWLJXQJGHV)DFKHVÃ3V\FKLDWULHXQG 3V\FKRWKHUDSLH¶ YRQ3URIHVVRU%HUJHULQÄ'HU1HUYHQDU]W³ Das Gesundheitssystem kann bereits jetzt die Früherkennung, Behandlung und Rehabilitation psychischer Erkrankungen nicht adäquat leisten - so die richtige Feststellung der ersten These des Artikels. Folgt man dann allerdings der sich anschießenden Analyse der Versorgungssituation und der die Versorgung tragenden Berufs- und Fachgruppen, so wird einem als Quintessenz nahegelegt, dass die Wurzel allen Übels im Mangel an Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie liege. Man gewinnt den Eindruck, die beiden anderen Fachgruppen im Feld psychischer Erkrankungen, die Fachärzte für Psychosomatik und Psychotherapie und die Psychologischen Psychotherapeuten, verbrauchten für wenige Leichtkranke zwar das meiste Geld, dabei sei aber die Effizienz und Qualität der Behandlungen (besonders der analytisch orientierten) ungesicherter. Zudem würde der Nachwuchs der Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie einerseits über stationäre psychosomatisch-psychotherapeutische Stellenangebote abgeworben und andererseits im ambulanten Bereich aufgrund besserer Honorierungen im Psychotherapiebereich dorthin gelockt. Da erscheint es nur folgerichtig, sich gegenüber der Konkurrenz zu behaupten und Veränderungen einzufordern: Es wird die „IDWDO GURKHQGH +|KHUKRQRULH UXQJ“ (wörtlich!) der Richtlinienpsychotherapie im EBM moniert zum Nachteil der Psychiatrieleistungen und im Zusammenhang mit der weltweiten „Entstigmatisierungskampagne“ die Zusammenführung der beiden Facharztgruppen in dem Gebiet Psychiatrie und Psychotherapie empfohlen. Die schließlich vorgeschlagene Ersatzlösung einer Umbenennung von „Psychiatrie und Psychotherapie in „Facharzt für Psychische Erkrankungen und Psychotherapie“ weist in die selbe Richtung, durch Einvernahme der Nachbardisziplinen den insgesamt vorgetragenen Anspruch zu unterstreichen, die eigentlichen und einzig relevant versorgenden Fachleute auf dem Gebiet psychischer Krankheiten und seelischer Störungen von Krankheitswert zu sein. Im Folgenden sei auf die vorgetragene Argumentation im Einzelnen eingegangen: %HGHXWXQJ GHU )DFKlU]WH IU 3V\FKLDWULH XQG 3V\FKRWKHUDSLH EHL GHU 9HUVRU JXQJSV\FKLVFK(UNUDQNWHU Bei der Analyse der Versorgungssituation und der Bedarfsermittlung wird angenommen, dass von den 30% der Bevölkerung, die in 12 Monatsfrist eine ICD-10-Diagnose psychischer Erkrankung aufweisen (Bundesgesundheitssurvey) bei ca. 25% eine Behandlungsindikation vorliege. Bei 80 Mio. Bundesbürger ergeben sich daraus rechnerisch 6 Mio. Behandlungsfälle pro Jahr. Bei dem dargelegten künftigen Bedarf an Psychiatern von 1 auf 6.000 Einwohner (derzeit 1 auf 17.000) würden ca. 13.000 Psychiater benötigt, die rund 460 Patienten pro Jahr behandeln würden. Diese Überlegungen gehen offensichtlich von einer Versorgung psychisch behandlungsbedürftiger Erkrankter allein durch die eigene Fachgruppe aus. 2 Die bisherige Versorgungsstruktur kennt eine gewachsene, u. E. sinnvolle Differenzierung: Psychiater und Nervenärzte haben ihren natürlichen Schwerpunkt in der Behandlung von Psychosen, schweren Charakterstörungen, schweren Depressionen ergänzt durch einen mehr oder minder großen Teil an Psychotherapie, Hausärzte führen einen nicht unerheblichen Anteil der Behandlungen psychisch Erkrankter wohnortnah durch, Fachärzte für Psychosomatik und Psychotherapie und Psychologische und KJ-Psychotherapeuten tragen im Wesentlichen die Versorgung mit Psychotherapie im engeren Sinne. Eine gefächerte und vernetzte Versorgungsstruktur wird in Zeiten eher begrenzter werdender Mittel eher in der Lage sein, den Bedarf der verschiedenen Versorgungssegmente zu decken, als eine nicht durchsetzbare knappe Verdreifachung der Zahl der niedergelassenen Psychiater. Dieser Alleinanspruch kann leider bewirken, die zunächst geäußerte Sorge um den %HVWDQG der Fachgruppe nur als Mittel zum Zweck der maximalen Ausweitung des eigenen Hoheitsgebietes aufzufassen. Es kann gar kein Zweifel sein, dass von den Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie ein ganz entscheidend wichtiges Segment der Behandlung psychisch Erkrankter geleistet wird. Es erscheint wichtig, dass hinreichend viele Kollegen sich auch künftig für diese Fachrichtung interessieren und diese ausüben. Auch besteht ein dringender Handlungsbedarf, die Bedarfszulassung für Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie so zu überarbeiten, dass eine moderate Erhöhung der Facharztsitze möglich wird. Insofern sind die vorgetragenen Bedenken ernst zu nehmen. Allerdings geht ein nicht unerheblicher Teil der Ursachenanalyse und der daraus gezogenen Folgerungen am Kern der Sache vorbei. %HKDQGOXQJVFKZHU(UNUDQNWHUYVOHLFKW (UNUDQNWHUXQG%HILQGOLFKNHLWVVW|UXQ JHQ" Indem die Darstellung die Differenziertheit der Versorgungslage nicht hinreichend wiedergibt, verleitet sie zu Fehlschlüssen. Zum einen lässt es sich gerade im Bereich psychischer Störungen nur schwerlich eine wissenschaftlich konsensfähige, objektivierbare Skala der Schwere der Erkrankungen erstellen (vor allem lässt sie sich nicht an ICD-10-Diagnosen sondern allenfalls an allg. Skalen wie z.B. BSS oder GAF erfassen). Zum anderen sind die in diesem Bereich tätigen Arzt- und Berufsgruppen doch in besonderem Maße dazu aufgefordert, nicht nur die „objektivierbare Seite“ der Krankheit zu beachten, sondern das Ausmaß des subjektiven Leidens als ethische Verpflichtung zur störungsadäquaten Behandlung aufzufassen. Im übrigen kann beispielsweise ein an Schizophrenie Erkrankter erheblich weniger leiden als ein Patient mit depressiven Symptomen auf neurotischer oder charakterneurotischer Basis oder eine Patientin mit krankhaften Störungen aufgrund von Missbrauch- oder Vergewaltigung in der Vorgeschichte oder ein Patient mit Somatisierungsstörung oder sog. Anpassungsstörung. Unter letzteren zwei Diagnosegruppen werden ohnehin zahlreiche schwere Leidenszustände subsummiert, angefangen von Verarbeitungsstörungen bei traumatisch erlebten Trennungserlebnissen, über schwere Beziehungsstörungen mit oft sich innerhalb der Beziehungsstrukturen multiplizierendem Leid, schweren Krisen bei Scheitern an psychosozialen Anforderungen, Folgen von Missbrauch etc. Auch ärztliche Psychotherapeuten und Psychologische Psychotherapeuten behandeln Menschen mit schweren Depressionen, mit Borderlinestörungen, schweren Persönlichkeitsstörungen (z.B. narzisstischen Störungen etc.), in kleinem Umfang auch mit Psychosekranken. Dabei ist für die Indikation zur Psychotherapie nicht das Kriterium der Leichte oder Schwere der Erkrankung ausschlaggebend, sondern ob eine mit 3 den Mitteln der Psychotherapie bearbeitbare krankhafte Störung sich aus der Konflikt/Lerngeschichte eruieren lässt. Es ist unkorrekt, hier den Eindruck entstehen zu lassen, Psychotherapeuten suchten sich die leichtesten Zustände heraus, während sie sich lediglich an allgemein-gültige medizinische Standards halten, nämlich eine spezifische Behandlung erst nach vorheriger Indikationsstellung durchzuführen. Selbst wenn Schwere-Unterschiede zwischen den Versorgungssegmenten von Psychotherapeuten und Psychiatern empirisch belegbar sind, so kann daraus nicht gefolgert werden, dass das eine medizinisch geboten sei und das andere weniger. Oder sind etwa Augenärzte nur deswegen weniger wichtig, weil die meisten Patienten ihrer Praxen nicht an ihren Augenkrankheiten sterben? 9HUEUDXFKYRQILQDQ]LHOOHQ5HVVRXUFHQLPDPEXODQWHQ%HUHLFK Auch beim Vergleich der aufgewandten Mittel (gemessen an den abgerechneten Punkten der EMB-Kapitel II-V) wird mit einer unzureichend differenzierenden Betrachtungsweise gearbeitet. Während im Bereich der Psychotherapie oft die Gesprächsleistungen den einzigen Behandlungs- und Kostenfaktor darstellen, die dazu noch meist nur über einen begrenzten Zeitraum angewandt werden, geht es in der Psychiatrie häufig um Kombinationsbehandlungen von Gesprächen und z.T. teuren Medikationen sowie sozialpsychiatrischen Maßnahmen, häufig auch über die gesamte Lebenszeit begleitend angewandt. Dazu ergibt sich – wie die Erfahrungen aus beiden Tätigkeitsbereichen zeigen – bei Psychosekranken i.d.R. nicht ein Gesprächsbedarf in derselben Frequenz. Mit anderen Worten: es hängt mit der Spezifität der psychotherapeutischen Behandlung zusammen, dass deren Erfolg i.d.R. an eine Behandlungskontinuität in spezifischer Sitzungsdichte über einen absehbaren Zeitraum geknüpft ist, während ein Großteil der psychiatrischen Behandlungen diskontinuierlicher und in gestreckten Zeiträumen oft ohne absehbares Ende der Behandlung, d.h. tendenziell lebenslang, vor sich geht. Damit korrespondiert die empirisch belegbare Tatsache, dass bei Querschnitts-Erhebungen zur Erkrankungshäufigkeit in der Bevölkerung die Zahl der Psychosen im engeren Sinne und der schweren Charakterstörungen deutlich unter der Zahl der psychotherapeutisch im engeren Sinn zu behandelnden Erkrankungen („Neurosen“) liegt. (LQVDW]YRQSHUVRQHOOHQ5HVVRXUFHQLPVWDWLRQlUHQ%HUHLFK Der Artikel vermittelt den Eindruck, als sei mit dem Aufbau psychosomatischpsychotherapeutischer Klinikplätze eine neue Situation geschaffen, die zur Abwerbung von Psychiater-Nachwuchs zwangsläufig führe und damit einen gefährlichen Aderlass an dringend gebrauchten Psychiatern provoziere. Bei genauerer Betrachtung muss festgestellt werden, dass der Großteil dieser Kliniken bereits als RehaKliniken bestand. Auch in der Vergangenheit existierte für psychiatrische Assistenzärzte der Anreiz und das Angebot, in solchen „psychosomatischen“ Kliniken tätig zu werden. Diese Situation ist also nicht so neu wie dargestellt. Die Orientierung der Assistenzärzte geschieht in der Praxis doch in hohem Maße entlang der Entwicklung eigener Interessen und Fähigkeiten, so dass viele sich für die Perspektive entscheiden, die zum eigenen Ansatz passt. Außerdem muss ein Wechsel zur psychosomatischen Klinik nicht zum Schaden für den künftigen niedergelassenen Psychiater sein, wie es umgekehrt für ärztliche Psychotherapeuten wichtig ist, hinreichend Erfahrungen in psychiatrischen Kliniken zu sammeln. Angesichts der Tatsache, dass der psychotherapeutische Ausbildungsanteil an der psychiatrischen Facharztausbildung in keiner Weise den Anforderungen an eine ausreichende Befähigung zur Psychotherapie neurotischer Erkrankungen genügt, muss eine solche ergänzende psychotherapeutische 4 Berufserfahrung sogar für das Anforderungsprofil als niedergelassener Psychiater und Psychotherapeut als besonders wünschenswert angesehen werden. In diesem Zusammenhang wirkt es nicht stimmig, an der im Text zitierten – absolut törichten und ärgerlichen – Anzeige (mit dem Versuch einer Abwerbung von Psychiatern) die Forderung aufzuhängen, zur Entstigmatisierung psychisch Kranker den psychiatrisch-psychotherapeutischen Einheitsfacharzt einzuführen, ohne dabei nur ansatzweise auf die dabei auftauchenden fachlichen Hindernisse einzugehen. Zwei kurze Bemerkungen noch zur Frage der Stigmatisierung. Die Betroffenen selber lehren uns ebenso wie die unausrottbaren Witzdarstellungen, dass Entstigmatisierungsbemühungen wie hier vorgeschlagen ins Leere gehen: wie häufig wird in Witzen dem Psychiater die Couch als Statussymbol zugeordnet, und wie häufig nennen die Patienten uns mal Psychiater, mal Psychotherapeut, mal Psychologe – ohne zu unterscheiden, offensichtlich weil sie unbewusst sich einstellen, dass all dem ununterscheidbar das Stigma „Psycho-...“ anhaftet. Des weiteren gibt es nicht zu beseitigende handfeste Gründe für das Stigma: zum einen die Scham und das Beschämende, angesichts des Betroffenseins, der Selbststeuerung durch eine krankhafte Störung im eigenen Selbst bei denen, die Einsicht in die Krankhaftigkeit ihrer Störung haben, zum anderen der öffentlich sichtbare Eingriff in die Autonomie bei denen, deren Schwere der Erkrankung eine Schutzmaßnahme gegen den Willen erforderlich macht, weil Krankheitseinsicht nicht besteht. Beide Situationen werden als existentiell ängstigend erlebt, solange unsere Kultur besteht. =XU (IIL]LHQ] XQG 4XDOLWlWVEHUSUIXQJ GHU %HKDQGOXQJVWlWLJNHLW LP VWDWLRQl UHQXQGLPDPEXODQWHQ6HNWRU Im Artikel wird ein deutlicher Unterschied festgestellt zwischen den Effektstärken stationärer psychiatrischer Behandlungen und stationärer psychosomatischpsychotherapeutischer Behandlungen (1,5 – 2 vs. 0,4 – 0,6). An diesen deutlichen Divergenzen lässt sich bereits ablesen, dass sich diese Bereiche nicht ohne weiteres mit den gleichen Überprüfungsmethoden auf Effizienz und Qualität untersuchen lassen. Das liegt nicht nur an der im Artikel dargelegten geringeren Schwere der Erkrankungen, sondern an den unterscheidbaren Anforderungsprofilen. In den psychiatrischen Kliniken werden dekompensierte Krankheitszustände, Depressionszustände die sich verselbständigt haben, schwere Krisen mit Suizidalität behandelt. Voraussetzung für Klinikaufnahme ist der zugespitzte Krankheitszustand, für den ambulante Behandlung nicht mehr ausreicht. Bei zugespitzten Zuständen bilden sich natürlich die Behandlungseffekte bei Rückbildung dieser Ausnahmesituation am deutlichsten ab. Dazu kommt im Falle schwerer Depressionen mit phasenhaftem Verlauf eine hochsignifikante spontane Besserungstendenz während der Klinikbehandlung im Laufe des Abklingens der Phase hinzu. Bei den Patienten psychosomatisch-psychotherapeutischer Kliniken spielen dem gegenüber oft zugespitzte psychosoziale Situationen eine wichtige Rolle, die eine erstmalig unausweichliche Konfrontation mit den Auswirkungen einer psychotherapeutisch zu behandelnden Störung bedeuten, die bis dahin kompensiert, verleugnet oder bagatellisiert worden war. Insofern wird häufig in der Klinik an der Fähigkeit zur „Krankheitseinsicht“ gearbeitet, das heißt eine erste Einsicht in die Störungsbedingungen vermittelt als (Motivations-) Voraussetzung für eine fort-führende mehr oder weniger kausal ansetzende ambulante Psychotherapie. Infolgedessen können 5 Effektstärken nicht im gleichen Maß nachweisbar sein; zum Teil müssen sogar aufgrund der Infragestellung bisher rigider Abwehrformationen bei nicht wenigen Patienten mit vorübergehenden Labilisierungen des psychischen Zustandes gerechnet werden. Bereits hier sind oberflächliche Vergleiche von Effektstärken irreführend, wenn sie nach dem Motto geführt werden: Höhere Effektstärken bei schwerer Kranken (psychiatrische Kliniken) vs. niedrige Effektstärken bei leichter Kranken (psychosomatische Kliniken) erweist doch, dass man nur noch psychiatrische Kliniken ausbauen sollte und die anderen zurückbauen. Schließlich ist auch noch der ambulante Sektor zu betrachten: hier sind alle chronisch persistierenden Zustände zu behandeln, darüber hinaus die depressiven Restzustände nach stationärer Behandlung oder das Wiederaufflackern von Symptomen unter Alltagsbelastung nach Entlassung etc. Es werden kranke Menschen behandelt, die unter den zusätzlichen psychosozialen Belastungssituationen des Alltagslebens wieder in Krankheitsphasen hineinrutschen. Daraus lassen sich keine einfachen Effizienznachweise gewinnen. Scheinbare Effizienzsteigerungen im ambulanten Sektor lassen sich am schnellsten durch Patientenselektion erreichen – dann auf Kosten der angemessenen Versorgung. Dem gegenüber ist die Behandlung chronisch persistierender schwerer Erkrankungen aufreibend und verdirbt die Effizienzstatistik. Diese Sachverhalte treffen sowohl auf Psychiater zu wie auf Psychotherapeuten. Anhand dieser Differenzen wird auch verstehbar, dass z.B. Qualitätsmonitoring im stationären Sektor verwertbare Hinweise zur Güte der Klinikbehandlung ergeben kann, eine Anwendung im ambulanten Bereich allenfalls in Zusammenhang mit der Erfassung einer großen Zahl weiterer Parameter Hinweise auf Behandlungs- und Versorgungsqualität erbringen kann. 'LHXQWHUVFKlW]WH%HGHXWXQJGHU%HVRQGHUKHLWHQGHU3V\FKRWKHUDSLH Darüber hinaus ist die Gegenüberstellung Behandlung schwerer Krankheitszustände durch Psychiater und Behandlung leichter Krankheitszustände durch Psychotherapeuten tendenziös und geht an den Realitäten differenzierender Behandlungsindikationsstellung völlig vorbei. Weder ist der Großteil neurotischer Erkrankungszustände mit dem Etikett „leicht“ zu beschreiben, noch ist die Anwendung störungsadäquater Behandlungskonzepte, die auf die therapeutische Bearbeitung von Fehlverarbeitungen mittels Gesprächen zielt, als weniger anspruchsvoll oder weniger beanspruchend zu bezeichnen. Hier kommt durch die Hintertür wieder die alte Fehlbewertung dieses wichtigen Versorgungssegmentes durch ein, eigentlich als überwunden angesehenes, Psychiatrieverständnis der Nachkriegszeit zum Vorschein: Damals belegte man die Behandlung neurotischer Störungen mit dem inzwischen veralteten Begriff „kleine Psychiatrie“. Nicht von ungefähr muss sich der niedergelassene Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie viel länger und intensiver psychotherapeutisch weiterbilden - bzw. die Psychologischen/KJ- Psychotherapeuten ausbilden - zur Erlangung der Befähigung, psychotherapeutisch zu behandeln, als dies im psychotherapeutischen Teil der psychiatrischen Facharztweiterbildung der Fall ist. Im Gegensatz zur Durchführung strukturierter Behandlungsprogramme nach Leitlinien, wie sie psychiatrisch-psychotherapeutisch gelehrt und angewandt werden, geht es in der Psychotherapie neurotischer Störungen um Hilfe zu Umstrukturierungen im Bereich der Selbststeuerung und der eigenen Persönlichkeit. Bei der üblichen psychiatrischen Konzeptualisierung eines Krankheitsprozesses ist die Krankheit als, quasi von außen, den Persönlichkeitskern „befallend“ gedacht, mit der umzugehen und auf 6 die sich einzustellen, Patient und Therapeut versuchen. Es geht um die Bewältigung primärer, sekundärer und tertiärer Krankheitsfolgen. Bei der Konzeptualisierung neurotischer Erkrankungen werden die krankhaften Vorgänge/Verarbeitungen als innerhalb des Hoheitssphäre (Selbst/Identitätskern) der Patientenpersönlichkeit gebildet aufgefasst, so dass Umgang mit den Vorstellungen, Einstellungen, Emotionen, Beziehungsmustern, Abwehrhaltungen, Wertvorstellungen und Selbstkonzepten der Betroffenen ganz im Vordergrund steht. Qualitäts- und Effizienzfragen sind dabei dem Gegenstand adäquat zu gestalten und anzuwenden. Schließlich hat auch der Gesetzgeber für die Erlangung psychotherapeutischer Qualifikationen im Psychotherapeutengesetz Maßstäbe gesetzt durch Bestimmung von Mindestvoraussetzungen der Ausbildungsgänge. Diese spezifisch-psychotherapeutischen Qualifikationen sind – auch wenn sie nicht unmittelbar auf die ärztliche Weiterbildung zu übertragen sind – dennoch qualitativinhaltlich normgebend auch für den ärztlichen Weiterbildungsbereich. Damit hat auch der Gesetzgeber verdeutlicht, dass Ausübung von Psychotherapie nicht im Nebenschluss erlernt werden kann, sondern einer ausführlichen, grundständigen, theoretischen und praktischen Qualifizierung bedarf. (LQ:RUW]XUÄ3V\FKRDQDO\VH³ Zunächst ist richtig zu stellen, dass im Rahmen der Richtlinienpsychotherapie analytische Psychotherapie zur Anwendung kommt und nicht Psychoanalyse nach engerer Definition. Dass bei den psychoanalytischen Richtlinienverfahren in den meisten Fällen modifiziert behandelt wird mit 1 (-2) Sitzungen/Woche, lässt sich allein schon damit belegen, dass – siehe das konkrete Beispiel Bayerns – die Psychotherapeuten im Schnitt nicht mehr als 6-5 Sitzungen pro Quartal abrechnen. Immerhin arbeiten ca. ¾ der bundesdeutschen Psychotherapeuten analytisch orientiert und 43% analytisch, so dass deren Behandlungsfrequenz-Durchschnitt sich auf die bayerischen Durchschnittszahlen hinreichend deutlich auswirken dürfte. Analytische Psychotherapie und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie als Richtlinienverfahren haben, im Gegensatz zur dargestellten Meinung des Autors, einen sehr weiten Indikationsbereich. Ihre Orientierung an der Strukturebene der Persönlichkeit und ihrer Regulationsmechanismen, sowie an den inneren Konflikten (das Pendant bei der VT heißt: kognitive und emotionale Folgen ungünstiger Lerngeschichten) ermöglicht auch Behandlungsansätze bei Patienten, bei denen eine reine Symptomorientierung eher ins Leere läuft. Entgegen diesem Sachverhalt wird im Artikel das Gegenteil nahegelegt. Zitat: „Insbesondere aufgrund des engen Indikationsbereiches dieses Verfahrens nach evidenzbasierter Medizin muss hier von einer deutlichen Fehlallokation von Mitteln ausgegangen werden.“ Diese Bemerkung vermittelt auch den irreführenden Eindruck, als ließe sich das weite Spektrum ambulant behandelter psychischer Störungen von Krankheitswert inzwischen schon mit Evidenzklassifizierungen, die sich in Bereichen der somatischen Medizin bewährt haben, hinreichend systematisch beurteilen und daraus solide Schlüsse ziehen über Indikationsweite und Nutzen in der ambulanten Versorgung. =XU.ULWLNDP)DFKDU]WIU3V\FKRVRPDWLNXQG3V\FKRWKHUDSLH Wenn die Facharztverbände für Psychosomatik und Psychotherapie in der Darstellung ihres Facharztspektrums den psychosomatischen Anteil allzu sehr in den Vordergrund stellen und dabei noch den Akzent auf somatische Erkrankungen mit psychischen Verarbeitungen setzen, erscheint der Versuch verständlich, dass Psychia- 7 terverbände den dabei in die 2. Reihe geratenen Anteil der Psychotherapie für den eigenen „großen“ Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie zu reklamieren versuchen, der die Behandlung aller psychischen Erkrankungen umfassen soll. Bei näherer Betrachtung allerdings stellt man fest, dass der Großteil der Weiterbildungsanforderungen zum Psychosomatik-Facharzt aus genuin psychotherapeutischen Weiterbildungsinhalten besteht. Auch in der Alltagspraxis der RehaKliniken wird schwerpunktmäßig an Patienten klinische Erfahrung gesammelt, die aufgrund psychischer und psychosozialer Belastungssituationen in eine in erster Linie psychotherapeutisch zu behandelnde Lebenskrise geraten sind, oft verbunden mit längerer Arbeitsunfähigkeit. Insofern qualifiziert sich de facto der PsychosomatikFacharzt hauptsächlich im psychotherapeutischen Bereich. Auch in Zukunft wird es bei dieser Schwerpunktsetzung bleiben. Denn bei den behandlungsbedürftigen psychosomatischen Störungen ist von einem viel höheren fachärztlichen Behandlungsbedarf für Patienten auszugehen, die somatische Begleitsymptome bei zugrundeliegenden seelischen Störungen von Krankheitswert haben, als für somatisch kranke Patienten mit psychischer Begleitsymptomatik. Insofern ist und bleibt die Psychotherapie – trotz gel. anderslautender Bekundungen von Facharztvertretern – Kernbereich des Psychosomatik-Facharztes. :DUXPGHU)DFKDU]WIU3V\FKLDWULHXQG3V\FKRWKHUDSLHVLFKQLFKWDOV'DFKIU GHQJHVDPWHQ9HUVRUJXQJVEHUHLFKSV\FKLVFK(UNUDQNWHUHLJQHW Spätestens die Auseinandersetzungen um die Neugestaltung der MusterWeiterbildungsordnung im (vor)letzten Jahr hat verdeutlicht, dass ein alles umfassender Facharzt für psychische Erkrankungen nicht zu realisieren ist. Bei der Diskussion des Kapitels des Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie kam es zu einer internen Kontroverse, ob der psychotherapeutische Kompetenzerwerb über eine Spezialisierung innerhalb des Fachgebietes erworben werden solle oder im Rahmen der grundständigen Facharzt-Weiterbildung. Für ersteres sprach, dass bei der Fülle der psychiatrisch zu vermittelnden Fachgebietsinhalte und bei den Erfordernissen einer hinreichenden Qualifikation in Psychotherapie die Weiterbildungszeit sonst überschritten würde, für das Letztere sprach, dass Psychiatrie ohne psycho-therapeutische Qualifikation ein Rückschritt für das Fachgebiet bedeutet hätte und einen Rückfall markiert hätte, hinter das inzwischen umfassendere Verständnis von Behandlungsnotwendigkeiten in der Psychiatrie. Der dann gefundene Kompromiss beinhaltet, dass eine psychotherapeutische Behandlungsberechtigung (zu Richtlinienpsychotherapie) zwar mit dem Facharzttitel grundsätzlich erworben wird, aber die Weiterbildungsinhalte im psychotherapeutischen Teil des Facharztkapitels quantitativ und qualitativ so eingeschränkt worden sind, dass die Anforderungen nur zur Ausübung einer begrenzt fachspezifischen Psychotherapie bei psychiatrisch behandlungsbedürftigen Patienten im engeren Sinne qualifizieren. Tatsächlich liegt der Weiterbildungsumfang des psychotherapeutischen Teils des Psychiatrie-Facharztes deutlich näher an dem Anforderungsprofil des fachgebundenen Zusatztitels Psychotherapie der übrigen Facharztgruppen, als an den Anforderungen des Facharztes für Psychosomatik und Psychotherapie oder den Ausbildungsanforderungen der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Anhand dieses Konfliktes und seiner Lösung ist noch einmal ganz deutlich geworden, dass der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sich nicht dazu eignet, als Superfacharzt den gesamten Psychobereich zu umspannen: die Fülle der erforderlichen 8 Weiterbildungsinhalte war nachgewiesenermaßen nicht in 5 Jahren Weiterbildungszeit unterzubringen. Vor diesem Hintergrund müssen die zum Ausdruck gebrachten Bestrebungen, den Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie, der im ärztlichen Weiterbildungsbereich einzig eine umfassende Befähigung zur Ausübung von Psychotherapie anzubieten hat, im eigenen Gebiet aufgehen zu lassen, implizit als Bestrebungen verstanden werden, das Rad der Geschichte in Deutschland zurück zu drehen und den psychotherapeutisch tätigen Ärzten die notwendigen Qualifikationsvoraussetzungen und die grundlegenden Versorgungsfelder zu beschneiden. In diesem Sinn sind leider auch die konkreten Bemerkungen zu interpretieren, welche die ambulante Psycho-therapie in den Verdacht bringen, überbezahlt, zu wenig effektiv, zu wenig versorgungsrelevant und dabei zu kostenintensiv zu sein (s.o.). 1RWZHQGLJNHLWGHU.RRSHUDWLRQHQXQGGHUHQ*UHQ]HQ Es wird im Artikel zuletzt angedacht, den Psycho-Bereich von dem alles umfassenden Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie aus und von der stationären Psychiatrie aus über integrierte Versorgungsformen zu strukturieren. Hier werden sehr „umfassende“ Überlegungen, möglicherweise auch ohne die betroffenen Patienten, gemacht. Diese wünschen sich nicht unbedingt eine nahtlose Vernetzung mit freiem Datenfluss über ihre Leiden und intimsten Vorstellungen, Ängsten, Erlebnissen, mit regelhaft per Testbatterien durchgeführter Erfassung ihrer Leiden und Behandlungen etc. Ohne Zweifel ist eine an den Interessen der Betroffenen orientierte Kooperation im Psycho-Bereich besonders wünschenswert. Dazu existieren bereits Ansätze in der ambulanten Versorgung. Beispielsweise arbeiten häufig Psychiater mit psychotherapeutisch Tätigen in Praxisgemeinschaften und Gemeinschaftspraxen zusammen. Gerade in dieser Zusammenarbeit er-schließt sich, wie sinnvoll und notwendig hier eine Arbeitsteilung und damit verbunden eine Eingrenzung des jeweils ausgeübten Versorgungsspektrums ist – als Schutz vor der Selbstüberforderung und vor Qualitätseinbußen eigener Behandlungstätigkeit. Bei der Zusammenarbeit zwischen ambulant und stationär ist im Interesse des Patienten i.d.R. vorrangig, dass ein vorurteilsfreier und offener Austausch möglich wird, im Respekt beider Seiten vor den unterschiedlich akzentuierten Beiträgen zum gemeinsam zu realisierenden Versorgungsauftrag. Ein solches Fundament der Kooperation und – wo nötig – auch Koordination, kann nur unter Kooperationsbereitschaft florieren, nicht aber unter Konkurrenz- und Verdrängungsgesichtspunkten, wie sie leider an vielen Stellen im Artikel zum Ausdruck gekommen sind. Norbert Bowe