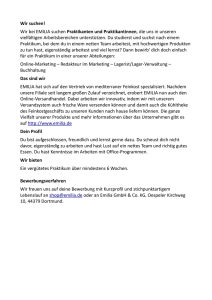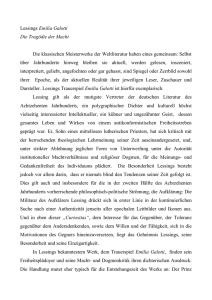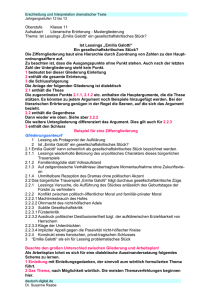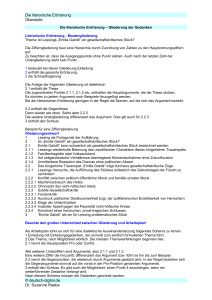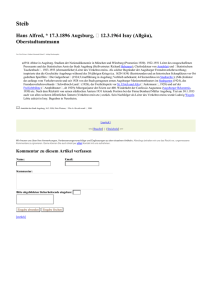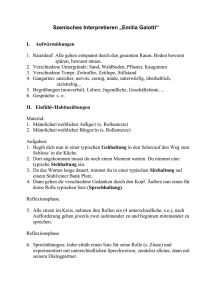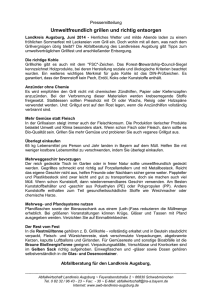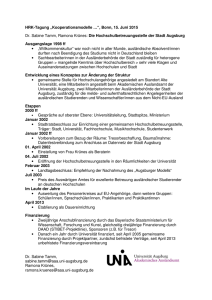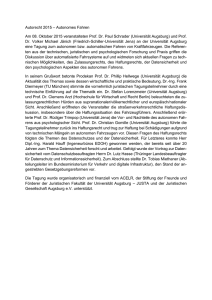lernt sein, uch - Theatergemeinde Augsburg
Werbung

Kultur 12 NUMMER 238 Jugend in Lebensgefahr Kultur kompakt HEILIGSPRECHUNG Mutter Bernarda war „stark, klug, mystisch“ Theater Augsburg Ein Drama von Ferdinand Bruckner Papst Benedikt XVI. hat am Sonntag vier Menschen zu Heiligen der römisch-katholischen Kirche gemacht. Darunter ist die Schweizer Ordensfrau Maria Bernarda Bütler (1848 –1924), die in Auw zwischen Zürich und Luzern geboren wurde und als Nonne in Kolumbien tätig war. „Mutter Bernarda bleibt ein leuchtendes Beispiel einer biblischen Frau: stark, klug, mystisch, spirituelle Meisterin und hervorragende Missionarin“, hieß es bei dem Gottesdienst über die erste Schweizer Heilige. Außerdem erhob Papst Benedikt XVI. die Nonne Anna Muttathupandathu, die 1946 starb, als erste Inderin in den Heiligenstand. Aus Ecuador gehört nun auch Narcisa de Jesus Martillo Moran zu den Auserwählten. Sie ist 1869 in Peru gestorben. Der in Neapel geborene Priester und Ordensgründer Gaetano Errico ist der einzige Mann unter den neuen Heiligen. (dpa) VON RÜDIGER HEINZE KUNSTMARKT Experte: Finanzkrise trifft auch die Kunst Die internationale Finanzkrise wird nach Auffassung des Frankfurter Museumsdirektors Max Hollein auch negative Auswirkungen auf den Kunstmarkt und das Kultursponsoring haben. Zwar gelte Kunst, ähnlich wie Gold, als stabile Ersatzanlage, aber „wenn die Rezession erst einmal tiefer greift, wird die Nachfrage nachlassen, und damit sinken dann auch die Preise“, sagte der 39-Jährige in einem Spiegel-Interview. „Vor allem wird fürs Erste die Zeit der richtig großen Deals vorbei sein“, meinte der Leiter der Kunsthalle Schirn und des Städel-Museums mit Blick auf die zuletzt in London mit Rekordpreisen für Werke von Damien Hirst boomende Gegenwartskunst.(dpa) „DER VORLESER“ Filmproduzent Scott Rudin springt ab Ärger in Hollywood um die Filmversion von Bernhard Schlinks Bestseller „Der Vorleser“. Produzent Scott Rudin ist von dem Projekt abgesprungen, weil er sich mit seinen Kollegen Harvey und Bob Weinstein überworfen hat. Rudin und Regisseur Stephen Daldry wollten mehr Zeit für die Nachbearbeitung des Filmmaterials, die Weinsteins streben eine Premiere am 12. Dezember an. (dpa) FOTOKÜNSTLER Andreas Gursky nimmt Kaiserring entgegen Der Fotokünstler Andreas Gursky hat den Kaiserring 2008 der Stadt Goslar (Niedersachsen) erhalten. Der Düsseldorfer gilt als einer der weltweit wichtigsten zeitgenössischen Fotografen. Er nahm die Auszeichnung am Samstag bei einer Feier in der historischen Kaiserpfalz entgegen. Gurskys Werke hätten sich „unauslöschbar dem kollektiven Bildgedächtnis eingeprägt“, so Laudatorin Marion Ackermann. (dpa) MONTAG, 13. OKTOBER 2008 Hier darf sich jeder sein eigenes Bild vom Objekt seiner Begierde machen – der entblößte Prinz ebenso wie die von seinem Kammerherrn gedungenen Schurken. Foto: A.T. Schaefer/Theater Augsburg Lieben will gelernt sein, Leiden auch Theater Augsburg Jan Philipp Gloger zeigt, dass Lessings „Emilia Galotti“ eine Schule der Empfindsamkeit ist VON ANGELA BACHMAIR Augsburg Es heißt, dass die Zuschauer laut geweint hätten, als Gotthold Ephraim Lessings „Emilia Galotti“ vor fast einem Vierteljahrhundert in Braunschweig uraufgeführt wurde. Dieses Trauerspiel wühlte die Menschen des Jahres 1772 gewaltig auf – und zwar nicht nur, weil der Aufklärer Lessing darin der absolutistischen Unmoral eine neue bürgerliche Moral des Respekts als politisches Ideal gegenüberstellte, sondern auch, weil es darin so überaus gefühlig zuging. Da wird geliebt und gelitten, geworben, geküsst und verraten, gebrüllt und gekost, intrigiert und gemordet. Keiner ist nur gut oder nur schlecht, jeder sehnt sich nach Glück und Liebe – und keiner gewinnt, was er wünscht. Diese emotionale Fülle musste der Mensch zu Lessings Zeiten erst zu empfinden lernen, wollte er sich als gleichwertig mit einem Fürsten begreifen. Eine Errungenschaft Zu lieben und leiden war vormals das Privileg der Aristokratie, alle anderen hatten das Recht nicht dazu. Lessing, mehr Theoretiker als Dichter, lieferte dem sich entwickelnden bürgerlichen Subjekt nun die Lernvorlage – mit Trauerspielen wie „Miss Sara Samson“ und der bekannteren „Emilia Galotti“. Der junge Regisseur Jan Philipp Gloger konzentriert sich auf diese kulturpolitische Errungenschaft der „Empfindsamkeit“, zu der Lessing seinen Beitrag leistete. Mit beherz- ten Strichen nahm er fast alle herrschaftskritischen Elemente aus dem Text, die das verlogene Leben bei Hofe schildern. Der Schurke Angelo ist gestrichen wie der fürstliche Rat. Der feudalistische Hintergrund der Tragödie fehlt – und damit verliert Emilias zündender Monolog „Ich will doch sehen, wer der Mensch ist, der einen Menschen zwingen kann“, viel von seinem egalitären Pathos. Der Regisseur nimmt den Text beim Wort Was bleibt, sind die Menschen, ihre Beziehungen, ihre Gefühle. Der Prinz (André Willmund so liebenswert wie kaltschnäuzig, eigentlich nicht wie ein Fürst, sondern eher wie ein Banker in glücklicheren Zeiten) hat sich in das Mädchen Emilia vergafft (bei Karoline Reinke lodert hinter der Sittsamkeit eine kaum gezügelte Kraft). Sein Kammerherr Marinelli (großartig Michael Stange – ein Machiavelli, der aber immer wieder in Selbstmitleid kippt) tut skrupellos alles, um seinem Chef das Objekt der Begierde zu besorgen. Gloger, der schon in der vergangenen Spielzeit mit Goethes „Clavigo“ eine viel beachtete KlassikerInterpretation geliefert hatte, macht aus der „Emilia“ nun aber keine Seifenoper von heute. Er nimmt Lessings Anliegen ernst und seinen Text beim Wort. Behutsam sprechen die Akteure ihre Sätze, so als müssten sie erst einmal testen, wie sich das anfühlt, wenn man sagt „Ich liebe sie.“ oder „Ich verachte ihn.“ Damit sich ihre Gefühle formen können, brauchen sie noch optische Hilfsmittel: Zunächst liefert sie der Maler Conti (Philipp von Mirbach). Dann kann auf die vier Seiten des großen Holzwürfels, den Bühnenbildnerin Bettina Kraus auf die leere Bühne gestellt hat, jeder das Bild werfen, das er sich von Emilia macht. Die Eltern (Ute Fiedler und Klaus Müller – zwei Rationalisten, deren Rechnung einer günstigen Heirat nicht aufgeht) sehen das süße Mädelchen, der Prinz und Emilias Verlobter Appiani, der gemeuchelt wird (sympathisch Oliver Bürgin) eine jeweils andere Frau. Nach den ersten emotionalen Fingerübungen kommt die Sache in Schwung: Die Drehtüren des Würfels wirbeln, Begehren kracht auf Ablehnung (wenn Emilia und der Prinz sich treffen), jeder agiert gegen jeden und sucht bei einem dritten Trost. Die vom Prinzen verlassene Gräfin Orsina (temperamentvoll Franziska Arndt) versucht, ihre Wut nach dem Vorbild antiker Furien auszutoben, und nach all der emotionalen Verwirrung kommt der Tod, den Emilia von ihrem Vater verlangt, geradezu beiläufig. Die Fallhöhe ist so beträchtlich wie erheiternd, wenn der Regisseur diese schlüssige, spannende Zweistundenaufführung (zu der Sebastian Jakob Musik von Kurt Weill, Astor Piazolla und Pink Floyd beisteuert) in einen Schlager von Udo Jürgens münden lässt. „Liebe ohne Leiden“ gibt es nicht – diese Erkenntnis ist für den gefühlserfahrenen Menschen des Jahres 2008 nur noch trivial. Starker Applaus! Wieder am 14., 17., 23. Oktober O Augsburg Einmal, die Premiere ist etwa eine halbe Stunde alt, wendet sich Freder kurz ans Publikum: „Was gibt’s denn da zu lachen?“ Man wusste nicht recht, ob die Frage, die nicht im Text zu finden ist, planvoll eingebaut oder improvisiert wurde. Ohne Berechtigung war sie jedenfalls nicht. Und hernach konnte man erfahren: Der Satz ist improvisiert worden – aus Unverständnis über anhaltendes Gekicher. 1925 schrieb der österreichischdeutsche Autor Ferdinand Bruckner, als Künstler ein späteres Opfer der Nazis, das Beziehungs- und Selbstfindungsdrama „Krankheit der Jugend“. Liest man das Stück heute, fallen einem als erstes die nahezu atemlosen Schlagabtausche der Dialoge auf, und als zweites die Aktualität des Stoffes, der sich wenig an Ort und Zeit der Handlung bindet: Wien, 1923. Sieben junge Menschen, zwischen 18 und etwa 30, sechs (angehende) Akademiker und ein Dienstmädchen, suchen ihre Zukunft – oder wenigstens einen Stellungsvorteil auf dem Weg dorthin. Dafür benötigen alle ausnahmslos eines: einen Partner. Gebeutelt von Illusion und Desillusion, von Erinnerung und Zuversicht, von den Wallungen der Gefühle und Hormone, von Wünschen und Ängsten, von Obsessionen und psychischen Auffälligkeiten, stolpern sie wild – und theatralisch stark komprimiert – von der einen Aussichtslosigkeit in die nächste. Die zynische und kaltschnäuzige Hölle, das sind die anderen bei diesen Szenen einer Wohngemeinschaft im Pensionshaus Schimmelbrot. Marie bettelt nach Liebe oder nach Schlägen Ferdinand Bruckner hat Sartre und in gewisser Weise Bergman vorweggenommen. Er lässt eine Jugend geballt zu Wort kommen, die in latenter Lebensgefahr schwebt, da sie ihren Platz noch nicht gefunden hat. So sagt es Irene (selbstbewusst: Christine Diensberg) im Stück selbst, der man als einziger Zukunfts-Chancen einräumen möchte, weil sie analytisch und hart gegen sich selbst ist – während das Glück aller anderen schlussendlich keinen Pfifferling wert zu sein scheint: zu träumerisch-weich der Dichter Petrell (Alexander Koll), zu verstört der Mediziner Alt (undurchsichtig: Daniel Breitfelder), zu konträr und gezwungen-exzessiv das letzte Paar des Abends, Marie und Freder (Philippine Pachl als nach Liebe oder Schlägen bettelnde, frischgebackene Doktorandin; Tjark Bernau als schnöselig-glatter Freder). Dazu kommen zum Finale: die bestürzend naive Lucy, schön gespielt von Anna Maria Sturm (schon auf dem Strich), die Männer- und Frauenfresserin Desiree – durchaus mit Charme gegeben von Ines Kurenbach (schon tot). In der Schwebe zwischen Gestern und Heute In die Augsburger Komödie müssten Schüler und Studenten nun strömen. Das Stück, leicht bearbeitet, geht vor allem sie etwas an. Auch weil Regisseurin Anne Lenk und Ausstatterin Halina Kratochwil, die hier der Spießigkeits-Bühnenbildnerin Anna Viebrock eindrucksvoll nacheifert, das Drama erstens in perfekter Schwebe zwischen Gestern und Heute halten (Blümchentapete und Schmierseifengeruch einerseits, elektrische Zahnbürste und Karaoke-Apparat andererseits) und zweitens sinnstiftend-hintergründige Musikeinlagen einbauen. Dieser Abend scharf zeichnender Frauen, in den der Zuschauer umstandslos geworfen wird, gewinnt erst peu à peu, dann schnell an Fahrt. Im zweiten Teil drängen sich Slapstick-Sekunden, Gekünsteltes, Exaltationen fast schon bis zur überzeichneten Groteske. Ineinander verschränkt spielt das Theater Augsburg beide Schlüsse, die Bruckner zu seinem Stück anbot. Hass- und liebestoll fallen Marie und Freder übereinander her – gleich neben der toten Desiree. Drei Menschen liegen aus drei Gründen nebeneinander. Sie heißen Liebessehnsucht, Sarkasmus, Depression. O Nächste Aufführungen am 17., 18., 25. Oktober Auch die charmante, lebenslustige Desiree (Ines Kurtenbach) gehört zu den jungen Menschen ohne Zukunft. Foto: A.T.Schaefer/Theater Augsburg Wirtshaus-Szenen Theater Ingolstadt „Mir san mir“ – Ein verfehltes Stück Bayern VON PETER SKODAWESSELY Der Stammtisch herrscht, und das ist nicht unbedingt witzig – auch im Auftragsstück für das Theater Ingolstadt. Foto: Christine Olma/Theater Ingolstadt Ingolstadt Das ging voll in die (Leder-)Hose: Der Ingolstädter Intendant Peter Rein hatte bei dem aus Mühldorf stammenden Münchner Kabarettisten und Liedermacher Werner Meier, wie es im Untertitel hieß, „Ein Stück Bayern“ in Auftrag gegeben. „Mir san mir“, das am Samstag seine Uraufführung hatte, sollte ein „musikalisch-satirischer Abend“ werden, erwies sich aber als weder witzig noch parodistisch. Ein bayerisches Wirtshaus, in das ein eben zum Dorf-Bürgermeister gewählter „Ossi“ eingeheiratet hat- te, musste als weißblauer Mikrokosmos herhalten. Bevölkert war die Gaststube mit sämtlichen vom TVKomödienstadl her bekannten Figuren – samt „Preiß’“ in Lederhose mit Gamsbarthut und umgehängtem Bergsteigerseil. Da durften natürlich auch ein Schuhplattler-Auftritt und eine „zünftige“ Rauferei mit splitternden Maßkrügen nicht fehlen. Dies alles unter Bierzeltgirlanden, mit Kruzifix an der holzvertäfelten Wand neben ausgestopftem Wolpertinger und Kachelofen. Doch eine Aneinanderreihung von Klischees und Vorurteilen reicht nicht aus. Solche Vorlagen müssen bearbeitet, zugespitzt und übersteigert werden. Dies aber ließen Autor Werner Meier und Regisseur Peter Rein nahezu total vermissen. Immer wieder eingebaute mehr oder weniger bekannte Lieder und Songs mit mehr oder weniger verfremdeten Texten konnten daran ebenso wenig ändern wie gelegentlich eingestreute tagesaktuelle kabarettistische Anspielungen. Und es half auch kaum, dass dann und wann der selige FJS von einer imaginären Wolke herunter seine Kommentare zum Geschehen gab. Dass das über dreistündige Stück dennoch einigermaßen unterhalt- sam war, lag an den Schauspielern. Sie gaben sich alle Mühe, trotz der ideenarmen Vorlage und der wenig einfallsreichen Regie gelegentlich kleine Glanzlichter zu setzen. Chris Nonnast als herrlich schmalziger Carolin-Reiber-Verschnitt, Matthias Winde als zwischen Idealismus und Realitätszwängen hin und her gerissenes Dorf-Oberhaupt und Peter Greif als schmierige Graue Eminenz ragten in diesem angestrengtbemühten Bauerntheater besonders heraus. O Wieder am 18. und 19. Oktober im Großen Haus des Theaters Ingolstadt.