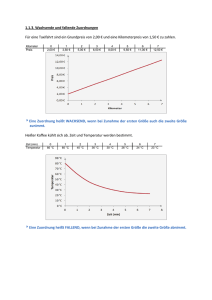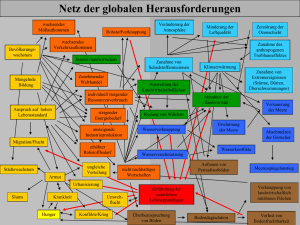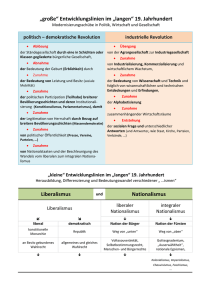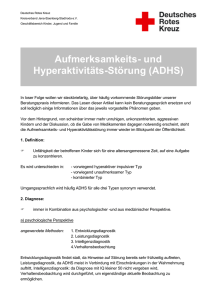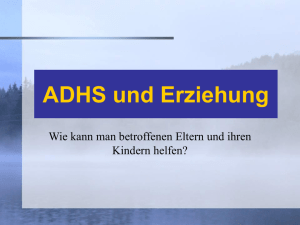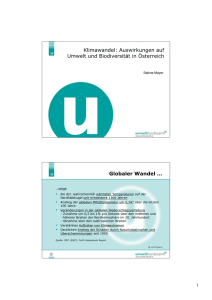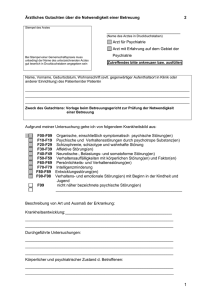Fachleute und Öffentlichkeit schauen heute mehr hin
Werbung

neue caritas Ausgabe 05/2012 Jugendhilfe Fachleute und Öffentlichkeit schauen heute mehr hin Psychische Erkrankungen junger Menschen werden bei Fachleuten und in der breiten Öffentlichkeit wesentlich differenzierter wahrgenommen als noch in den 1980er Jahren. Damit lässt sich die statistische Zunahme der Diagnosen teilweise erklären. Der folgende Aufsatz1 soll einen kurzen Überblick über die möglichen Gründe der Zunahme psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen geben. Insbesondere ist zu diskutieren, ob es eine reale Zunahme von psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter gibt und ob neue Störungen als eine Folge der Veränderungen in biologischen und/oder sozialen Systemen aufgefasst werden können oder als Ausdruck des wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritts anzusehen sind. In der Gesamtbevölkerung werden verschiedene Gruppen von "Patienten" unterschieden, die im engeren Sinne keine Patienten sind. Zum einen gibt es die Gruppe mit einer Lebenszeitdiagnose2, für die ein erhöhtes Risiko des Auftretens einer psychischen Störung besteht, zum Beispiel bedingt durch die Lebensumstände oder aufgrund eines genetischen Risikos. Innerhalb dieser Gruppe findet sich zum Zweiten eine sogenannte Hochrisikogruppe, deren Störung zwar für die Betroffenen bedeutsam ist. Die Störung wird aber nicht als so einschränkend erlebt, dass deswegen Fachpersonen zur Behandlung aufgesucht werden. Eine dritte, kleinere Untergruppe sind die Betroffenen, die eindeutig klinische Symptome aufweisen - denen eine Diagnose zugeordnet werden könnte -, die aber unerkannt beziehungsweise ohne Behandlung bleiben. Und schließlich gibt es die Gruppe der Patienten, die sich in ambulanter oder stationärer Behandlung befinden, aus der nur ein kleiner und spezifisch ausgewählter Teil in der (klinischen) Forschung erfasst werden kann. Es wird also deutlich, dass nicht alle potenziellen Patient(inn)en überhaupt in akuter Behandlung sind. Vielmehr ist eine Vielzahl von Faktoren notwendig, damit eine Behandlung überhaupt aufgenommen wird. Deshalb kann aus der Anzahl der Patienten, die in einer Bevölkerung in Behandlung vorgefunden werden können, nicht unbedingt auf die wirkliche Anzahl der Betroffenen und Erkrankten geschlossen werden. Im Folgenden sollen drei Modelle zur Veränderung der Häufigkeit psychischer Störungen kurz diskutiert werden. Veränderung der Häufigkeit psychischer Störungen Modell 1: Zunahme der Zahl psychischer Störungen durch psychosoziale Veränderungen in der Gesellschaft und der Lebensbedingungen, wie sie zum Beispiel durch Verarmung, soziale Ausgrenzung oder Veränderung von Familienstrukturen verursacht werden können. Ein Beispiel hierfür ist eine mögliche Zunahme frühkindlicher Entwicklungsstörungen. Modell 2: Zunahme der Auffälligkeiten durch die Veränderung der Versorgungsangebote der psychosozialen Dienste und Behandlungseinrichtungen. Vertiefte Forschung, bessere diagnostische Möglichkeiten, vermehrte Angebote durch Spezialambulanzen, die den Fokus auf spezielle Zielgruppen richten, können dazu führen, dass bestimmte Diagnosen häufiger gefunden werden. Ein Beispiel sind die Autismus-Spektrum-Störungen (ASS), die in den letzten Jahren häufiger beforscht und in der Folge heute häufiger beachtet und diagnostiziert werden. Modell 3: Das Schwellenmodell erklärt, warum durch die Erkenntnisse der Forschung die Auffassung über eine Störung sensitiver und breiter wird, wodurch definitorisch die Schwelle für die Feststellung einer Störung sinkt. Ein Beispiel sind die hyperkinetischen Störungen3. Durch Veränderungen im Diagnosemanual wurde dieses Störungsbild bekannter, in der Folge auch mehr beforscht, und durch die Benennung umfangreicher nachvollziehbarer Diagnosekriterien kam es zu einer Zunahme der diagnostizierten Fälle und damit auch zu einer Steigerung der Behandlungszahlen. Dies wird insbesondere durch die Zunahme von Methylphenidat4Verordnungen deutlich. Zum ersten Modell, also der Zunahme von psychischen Störungen im Kinder- und Jugendalter durch exogene Faktoren, ist auszuführen, dass erhöhte Ausgaben im Gesundheitswesen beobachtet wurden: Sie waren bedingt durch eine vermehrte Inanspruchnahme psychosozialer Dienste, eine kontinuierlich hohe Nachfrage bei kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanzen sowie in der Jugendhilfe durch eine Zunahme der Zahl der Platzierungen. In der Folge führt dies zu einem Mangel an ambulanten und stationären Unterbringungs-, Untersuchungs- und Therapieplätzen. Probleme bei der Bindung zwischen Eltern und Kind In der Kinder- und Jugendpsychiatrie nahmen statistischen Angaben zufolge alle Störungen zu, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Insbesondere das gehäufte Auftreten sozialer Verhaltensstörungen lässt sich durch das erste Modell erklären. Nicht nur die materiellen Lebensumstände, sondern auch Veränderungen der elterlichen Erziehungshaltung führen schon in frühen Jahren zu Problemen in der Bindungsentwicklung zwischen Eltern und Kind. Die Folge sind Schwierigkeiten in der Reaktion der Kinder auf die Erziehung. Viele Autor(inn)en gehen deshalb davon aus, dass Vernachlässigung, unangemessener Erziehungsstil, Ablehnung des Kindes, problematisches Verhalten der Eltern und negative Einflüsse durch psychisch kranke Eltern (zum Beispiel Suchterkrankung) zugenommen haben. Eine Mischung von Umweltfaktoren, familiären Einflüssen und Veränderungen in der Kultur sollen dazu geführt haben, dass schon Kleinkinder beeinträchtigt werden. Bei den betroffenen Kindern komme es zu Emotionsregulationsstörungen, negative Emotionalität trete häufiger auf und schließlich sei eine Zunahme aggressiven Verhaltens festzustellen. Daraus lassen sich Hochrisiko-Situationen für Kinder definieren. Einige Beispiele hierfür sind eine schwere psychische Erkrankung der Bindungsperson, sozioökonomische Belastungen durch Arbeitslosigkeit, ein häufiger Wechsel des Betreuungsrahmens für die Kinder sowie Belastungen durch Traumatisierung, Trennung der Eltern oder Behinderung, eine schwere Erkrankung eines Kindes in der Geschwisterreihe oder auch Stigmatisierung durch Migration. Dies führt zu einer Zunahme der Morbidität und Mortalität durch typische Vernachlässigungsund Misshandlungsformen im Säuglingsalter wie zum Beispiel Schütteltrauma, Gedeihstörungen, invasives Füttern, unterlassene Aufsicht und unterlassener Schutz für die Säuglinge. Der daraus entstandene erhöhte Bedarf an fachlichen Kinder- und Jugendhilfeleistungen im Sinne einer frühen Beziehungsförderung muss in Kooperation aller an Kinder- und Jugendhilfe beteiligten Fachinstanzen abgedeckt werden. Differenziertere Diagnostik Das zweite Modell - Zunahme der Auffälligkeiten durch Veränderungen bei den Versorgungsgegebenheiten - lässt sich am Beispiel ASS erläutern. In neueren epidemiologischen Untersuchungen zeigt sich ein enormer Anstieg der Prävalenz von ASS. Aus der wissenschaftlichen Literatur geht hervor, dass autistischen Störungen in den letzten Jahrzehnten zunehmend Aufmerksamkeit zuteil geworden ist, wodurch sich sowohl die diagnostischen als auch therapeutischen Möglichkeiten und Angebote deutlich verbessert haben. Während in früheren Studien noch davon ausgegangen wurde, dass drei Viertel aller Menschen mit Autismussymptomen geistig behindert seien, zeigen die neueren Untersuchungen, dass 30 Prozent über durchschnittliche bis überdurchschnittliche Intelligenz verfügen, weitere 30 Prozent eine nur milde bis moderate Intelligenzminderung aufweisen und statt drei Viertel nun nur noch circa 40 Prozent eine deutliche geistige Behinderung aufweisen. Diese Befunde hatten zur Folge, dass das Konzept des Autismus im Sinne eines dimensionalen5 Modells von engen Klassifikationen zu einem Modell einer Spektrumsstörung hin erweitert werden musste. Hierbei besteht heute die Auffassung, dass autistische Störungen nicht nur in ihrer Qualität, sondern auch quantitativ, das heißt also in Bezug auf den Schweregrad der Störung, unterschieden werden müssen. Dabei wird die Symptomatik der tiefgreifenden Entwicklungsstörung diagnostisch differenziert betrachtet, in Bezug auf die qualitativen Beeinträchtigungen von Interaktionen, der Kommunikation und Sprache sowie der eingeschränkten Interessen und stereotypen Verhaltensmuster. Zusammenspiel vieler Faktoren Das dritte Modell, das Schwellenmodell, erklärt am besten die Zunahme6 der ADHSDiagnosen in den letzten 25 Jahren. Bei Kindern wird häufiger ADHS diagnostiziert, gleichzeitig werden immer mehr Fälle außerhalb der bisher typischen Altersgrenzen beschrieben. Somit zeigt sich eine Zunahme der Diagnosen im Vorschulalter, bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Heute werden sogar Patient(inn)en in hohem Alter unter dem Aspekt einer ADHS-Diagnose untersucht. Als Grundvoraussetzung für diese Zunahme der Diagnose ADHS ist zunächst eine einheitliche und verständliche Diagnose mit breiter Akzeptanz unter den Fachpersonen anzunehmen. Hinzu kommt eine Vielzahl von Faktoren, die diesen Prozess förderten. Folgende Faktoren lassen sich hier als dominant beschreiben: 1. hochwirksame Behandlung mit Methylphenidat und anderen Medikamenten; 2. scheinbar einfache Diagnostik (neuere Befunde stellen dies infrage); 3. leicht zu kontrollierende Behandlung, da die Effekte bei richtiger Diagnose unmittelbar und sehr deutlich zu beobachten sind; 4. hohe Bereitschaft der Fachpersonen, die Behandlung durchzuführen, die sich zunehmend auch auf assoziierte Gruppen von Fachpersonen ausdehnte; 5. intensive Aktivität in der Forschung; vermutlich ist ADHS die am umfangreichsten in der kinder- und jugendpsychiatrischen Forschung repräsentierte Störung; 6. ausgeprägte Zunahme an zusätzlichen und ergänzenden Behandlungsangeboten (Aufmerksamkeitstraining, Verhaltenstraining etc.); 7. Zunahme der wirtschaftlichen Interessen und damit auch des Marketings der Behandlungsprodukte für diese Störung; dies gilt nicht nur für die Psychopharmakotherapie, sondern auch für die psychotherapeutischen und die übenden Behandlungsansätze; 8. zunehmende Bereitschaft der Kostenträger, die Behandlung dieser Störung zu finanzieren; 9. in der relevanten Öffentlichkeit ein zunehmendes Bewusstsein für das Vorhandensein der Auswirkungen und die Behandlungsmöglichkeiten der Störung, die sich durch eine Zunahme der Selbsthilfe- und Lobbyistengruppen manifestierte; 10. Entwicklung ergänzender Angebote zum Beispiel in der Jugendhilfe oder in der Ergotherapie, aber auch in der Schule und am Arbeitsplatz. Gestiegene gesellschaftliche Akzeptanz Alle diese Faktoren inklusive der Kritik, insbesondere an der ADHS-Behandlung mit Methylphenidat, führten dazu, dass das Störungsbild einen hohen Bekanntheitsgrad auch bei nicht davon betroffenen Personen gewann. ADHS ist heute in den meisten Ländern in der sozialen Gemeinschaft als psychische Störung weithin akzeptiert. Immer wieder auftretende kritische Beiträge führen dazu, dass umfangreiche Informationen über das Störungsbild von kompetenter Seite gegeben werden, wodurch die Aufmerksamkeit gegenüber ADHS und seine Akzeptanz letztendlich gerade durch die kritischen Beiträge gefördert wird. Heute ist ADHS nicht nur ein Störungsbild, sondern auch ein Markt, der nicht nur Fachleute aus Psychologie, Psychiatrie, Pädiatrie, Pädagogik und Jugendhilfe involviert: Inzwischen finden regelmäßig ADHS-Messen mit einem vielfältigen Angebot statt. Berufsübergreifende Zusammenarbeit tut not Mit Hilfe der drei erläuterten Modelle lässt sich voraussagen, dass auch in Zukunft eine Zunahme diagnostizierter psychischer Störungen zu erwarten ist. Es wird aber schwer nachzuweisen sein, ob es sich um eine wirkliche Zunahme handelt oder ob die Steigerung der Diagnosen die soziale Akzeptanz für das Vorhandensein und die Bedeutung von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen reflektiert. Hinzu kommen eine zunehmende Behandlungsbereitschaft bei Eltern und ihren Kindern und der wissenschaftliche Fortschritt sowie die Weiterentwicklung klinischer Methoden. Es ist zu vermuten, dass die oben genannten Faktoren in einem fördernden Zusammenspiel dazu führen werden, dass neue Störungsbilder definiert werden, bekannte eindeutiger und besser diagnostizierbar beziehungsweise behandelbar werden und dass neben der bestehenden Behandlung ein Schwerpunkt auf Prävention gelegt wird, um die Auswirkungen der zunehmend bekannter werdenden Störungen zu vermeiden. Jede methodisch ausgereifte Präventionsmaßnahme führt dazu, dass die Anzahl der Diagnosen zunimmt. Andererseits zeichnet sich eine angemessene Prävention dadurch aus, dass der Schweregrad der identifizierten Störung deutlich geringer ausfällt und dass bei geeigneter vorbeugender Behandlung auch die Folgen der Störung signifikant geringer sein werden. Dies setzt voraus, dass die an der Versorgung psychisch auffälliger und gestörter Kinder und Jugendlicher beteiligten Fachpersonen deutlich besser zusammenarbeiten als bisher. Notwendige erste Maßnahmen dafür sind: Entwicklung einer gemeinsamen Sprache über die Professionen und unterschiedlichen Fachbereiche hinweg; Kooperation auf Augenhöhe mit gegenseitiger Akzeptanz und Toleranz; fallübergreifende Zusammenarbeit aller relevanten Institutionen und Professionen; Verlässlichkeit und Sicherheit, insbesondere durch die unterschiedlichen Kostenträger unter Berücksichtigung neuer Kostenträgermodelle; Kooperation zwischen Kinder- und Jugendhilfe, Schule und Kinder- und Jugendpsychiatrie mit entsprechenden Kooperationsmodellen; gemeinsame anonymisierte Fallberatung mit Kooperationspartnern; Zielsetzung: Einschätzung anderer Professionen und Institutionen einholen, um Handlungsbedarfe im eigenen Zuständigkeitsbereich besser abschätzen zu können; überinstitutionelle Fallberatung, Supervision und Fort- beziehungsweise Weiterbildung. Anmerkungen 1. Basierend auf dem Vortrag des Autors bei der BVkE-Fachtagung am 20. September 2011 in Ludwigshafen. 2. Alle Diagnosen, die jemand zeit seines Lebens bekommen hat, werden rückblickend erfasst und gegebenenfalls gewichtet. 3. Auch bekannt als Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). 4. Ein als Betäubungsmittel verschreibungspflichtiger Arzneistoff zur Behandlung auch von ADHS; Handelsnamen sind Medikinet, Equasym, Concerta oder Ritalin. 5. "Dimensional" bedeutet, dass es fließende Grenzen gibt, wann von einer Störung gesprochen wird, s. weiter unten. 6. Diese Zunahme wird nicht nur durch die Diagnosen, sondern auch durch die Anzahl der behandelten Fälle bestimmt: Nicht jeder diagnostizierte Patient wird sofort behandelt, doch mit gewisser Verzögerung steigt die Zahl der behandelten Fälle, weil sich Einstellung und Wissen der Fachleute und Patienten ändern. Autor/in: Dr. Dr. Ulrich Preuß Quelle: Ausgabe 05/2012