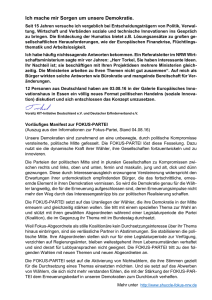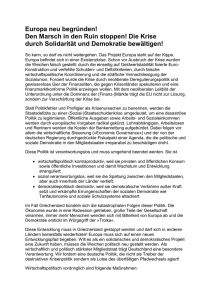Demokratie und Krise
Werbung
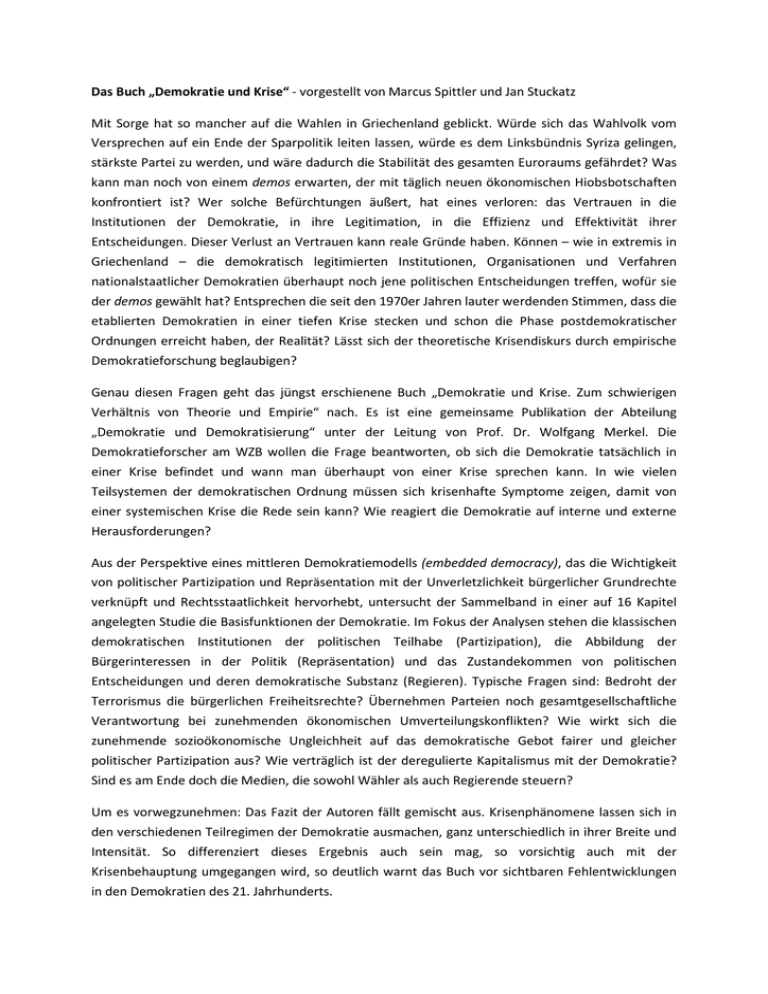
Das Buch „Demokratie und Krise“ - vorgestellt von Marcus Spittler und Jan Stuckatz Mit Sorge hat so mancher auf die Wahlen in Griechenland geblickt. Würde sich das Wahlvolk vom Versprechen auf ein Ende der Sparpolitik leiten lassen, würde es dem Linksbündnis Syriza gelingen, stärkste Partei zu werden, und wäre dadurch die Stabilität des gesamten Euroraums gefährdet? Was kann man noch von einem demos erwarten, der mit täglich neuen ökonomischen Hiobsbotschaften konfrontiert ist? Wer solche Befürchtungen äußert, hat eines verloren: das Vertrauen in die Institutionen der Demokratie, in ihre Legitimation, in die Effizienz und Effektivität ihrer Entscheidungen. Dieser Verlust an Vertrauen kann reale Gründe haben. Können – wie in extremis in Griechenland – die demokratisch legitimierten Institutionen, Organisationen und Verfahren nationalstaatlicher Demokratien überhaupt noch jene politischen Entscheidungen treffen, wofür sie der demos gewählt hat? Entsprechen die seit den 1970er Jahren lauter werdenden Stimmen, dass die etablierten Demokratien in einer tiefen Krise stecken und schon die Phase postdemokratischer Ordnungen erreicht haben, der Realität? Lässt sich der theoretische Krisendiskurs durch empirische Demokratieforschung beglaubigen? Genau diesen Fragen geht das jüngst erschienene Buch „Demokratie und Krise. Zum schwierigen Verhältnis von Theorie und Empirie“ nach. Es ist eine gemeinsame Publikation der Abteilung „Demokratie und Demokratisierung“ unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Merkel. Die Demokratieforscher am WZB wollen die Frage beantworten, ob sich die Demokratie tatsächlich in einer Krise befindet und wann man überhaupt von einer Krise sprechen kann. In wie vielen Teilsystemen der demokratischen Ordnung müssen sich krisenhafte Symptome zeigen, damit von einer systemischen Krise die Rede sein kann? Wie reagiert die Demokratie auf interne und externe Herausforderungen? Aus der Perspektive eines mittleren Demokratiemodells (embedded democracy), das die Wichtigkeit von politischer Partizipation und Repräsentation mit der Unverletzlichkeit bürgerlicher Grundrechte verknüpft und Rechtsstaatlichkeit hervorhebt, untersucht der Sammelband in einer auf 16 Kapitel angelegten Studie die Basisfunktionen der Demokratie. Im Fokus der Analysen stehen die klassischen demokratischen Institutionen der politischen Teilhabe (Partizipation), die Abbildung der Bürgerinteressen in der Politik (Repräsentation) und das Zustandekommen von politischen Entscheidungen und deren demokratische Substanz (Regieren). Typische Fragen sind: Bedroht der Terrorismus die bürgerlichen Freiheitsrechte? Übernehmen Parteien noch gesamtgesellschaftliche Verantwortung bei zunehmenden ökonomischen Umverteilungskonflikten? Wie wirkt sich die zunehmende sozioökonomische Ungleichheit auf das demokratische Gebot fairer und gleicher politischer Partizipation aus? Wie verträglich ist der deregulierte Kapitalismus mit der Demokratie? Sind es am Ende doch die Medien, die sowohl Wähler als auch Regierende steuern? Um es vorwegzunehmen: Das Fazit der Autoren fällt gemischt aus. Krisenphänomene lassen sich in den verschiedenen Teilregimen der Demokratie ausmachen, ganz unterschiedlich in ihrer Breite und Intensität. So differenziert dieses Ergebnis auch sein mag, so vorsichtig auch mit der Krisenbehauptung umgegangen wird, so deutlich warnt das Buch vor sichtbaren Fehlentwicklungen in den Demokratien des 21. Jahrhunderts. Demokratie in Zeiten deregulierter Märkte Im Zentrum einer Vielzahl von Beiträgen steht das Zusammenspiel von Ökonomie und Demokratie. Bernhard Weßels kann zeigen, dass Wählerwissen und “sincere voting”, also die Fähigkeit, eine Partei zu erkennen und zu wählen, die den eigenen Interessen entspricht, ungleich in der Gesellschaft verteilt ist und von individuellen sozioökonomischen Voraussetzungen abhängt. Ökonomische Ungleichheit setzt sich also auch in politischer Ungleichheit fort, wenn Wähler mit geringerer Bildung und Einkommen nicht die Parteien wählen können, die ihren Präferenzen entsprechen. Ob die unteren Schichten dadurch auch substanziell schlechter repräsentiert sind, fragen Pola Lehmann, Sven Regel und Sarah Schlote. Sie finden, dass die unterschiedlichen Schichten keineswegs homogenen Interessen folgen, das „untere Drittel“ in seinen politischen und sozialen Präferenzen sowohl von den einzelnen Abgeordneten als auch den Parteien jedoch schlechter repräsentiert wird. Eine Repräsentationslücke entsteht: Zwar reagieren die Parteien auf Ungleichheit (Petring) und bieten sozioökonomische Alternativen an (Volkens/Merz), aber gerade bei den großen Parteien in der Regierung ist dies deutlich seltener der Fall. Wolfgang Merkel und Jürgen Kocka nähern sich grundsätzlicher den systemimmanenten Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Kapitalismus und Demokratie. Während die Demokratie einer Logik der Kompromisse und Mehrheitsentscheidungen folgt, steht im Kapitalismus die Hierarchie und die Einzelentscheidung im Vordergrund. Eine „autonomieschonende Koexistenz von Kapitalismus und Demokratie gelingt am ehesten, wenn ein Verhältnis von gegenseitiger Machtbalance, Begrenzung und Verflechtung hergestellt werden kann“ (S. 334). Beide Autoren stellen fest, dass die gegenwärtige Form deregulierter Märkte und eines „neoliberalen“ Kapitalismus starke Unverträglichkeiten mit den Prinzipien der rechtsstaatlich „eingebetteten Demokratie“ hat. Welche Probleme gerade die wirtschaftliche Globalisierung für die nationalstaatlich organisierte Demokratie aufwirft, beschreibt Lea Heyne. Auf hoher Aggregatebene kann sie empirisch die Auswirkungen der Globalisierung auf die demokratische Qualität von 30 Staaten zwischen 1990 und 2012 zeigen. Soziokulturelle und politische Globalisierung haben sich in der Vergangenheit eher vorteilhaft mit Blick auf Deliberation und demokratische Kontrolle erwiesen, die ökonomische Globalisierung hat jedoch in der Summe einen sichtbar negativen Einfluss auf die Demokratiequalität in den einzelnen Staaten. Die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen zeigen: Wenn die Demokratie sich ernst nehmen will, dann muss sie selbst die Vorbedingungen für politische Gleichheit schaffen, die stets und gerade in den letzten drei Jahrzehnten durch die wachsende sozioökonomische Ungleichheit unterminiert wird. Der demokratische Staat als Garant von Bürgerrechten? Wie steht es um die Einhaltung und Kontrolle von Bürgerrechten in etablierten Demokratien? Dag Tanneberg beantwortet diese Frage im Hinblick auf eines der grundlegendsten Bürgerrechte, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Diesbezüglich werden in aller Regel autokratische Regime kritisiert. Was dabei oft unbeachtet bleibt: Auch etablierte Demokratien verletzen dieses basale Menschenrecht regelmäßig, insbesondere wenn sie selbst mit gewalttätigen terroristischen Bedrohungen konfrontiert sind. Bedrohungen wie die Anschläge vom 11. September 2001 in New York oder die Attentate in Madrid (2004) und London (2005) können dann zu erheblichen Verletzungen der Menschenrechte führen, wenn die demokratischen Regierungen über Gebühr die Freiheitsrechte der Bürger einschränken zugunsten eines vermeintlichen „Supergrundrechts“ auf Sicherheit. Religionsfreiheit, Unabhängigkeit der Gerichte, Gleichheit vor dem Gesetz und das Recht auf körperliche Unversehrtheit sind seit 9/11 in mehreren Demokratien zwischen 1990 und 2007 im Durchschnitt gesunken, stellen Aiko Wagner und Sascha Kneip fest. Während Einschränkungen in Ländern wie den USA, Italien, Frankreich und Spanien drastisch waren, haben die nordeuropäischen Länder und die Niederlande ein hohes Maß an Bürgerrechten erhalten können. Diese Schwankungen in der Einhaltung (de facto) von zivilen Rechten stehen im starken Kontrast zur ungebrochenen Gewährung dieser Rechte (de jure) in den nationalen Verfassungen. Ein genauerer Blick auf Verfassungsgerichte als Hüter der Grundrechte lohnt in diesem Zusammenhang. Bleiben Verfassungsgerichte inaktiv, wenn sie mit Grundrechtseinschränkungen durch andere Akteure konfrontiert werden, oder ‚überreagieren‘ sie gar und schränken die Regulierungsfähigkeit des Staates ein? Sascha Kneip untersucht dazu die als besonders unabhängig angesehenen vier Verfassungsgerichte in den USA, in Deutschland, Österreich und Kanada, um diese Frage zu beantworten. Insbesondere das deutsche und das österreichische Verfassungsgericht haben seit 1990 regelmäßig staatliche Einschränkungen von Bürgerrechten annulliert. Eine detaillierte Fallstudie des BVerfG zeigt zudem, dass das deutsche Verfassungsgericht effektiv in einer Reihe von Fällen interveniert hat, um grundlegende Rechte der Bürger zu sichern. Trotz dieser effektiven Stärkung der Demokratie, so schließt Kneip, sind die Gerichte aber weit davon entfernt, sich jenseits der verfassungsrechtlich gebotenen richterlichen Selbstbeschränkung als Ersatzgesetzgeber aufzuspielen. Neben Gerichten haben die Medien als „vierte Macht“ eine wichtige Funktion im Staat inne, um im Falle demokratischer Einschränkungen Alarm zu schlagen. Aber spielen sie auch faktisch diese ihr oft zugeschriebene Rolle? Kenneth Newton und Nicolas Merz untersuchen besonders spektakuläre Fälle wie den Watergate-Skandal und überprüfen, welchen Einfluss die Medien auf politische Entscheidungen hatten. Sie finden, dass dieser Einfluss retrospektiv oft massiv überschätzt wird und weisen weiterhin auf ein Paradoxon hin: Obwohl die Medien oft nicht die vielbeschworene „vierte Macht“ zu sein scheinen, werden sie von Politikern oft als diese angesehen und damit künstlich mächtiger gemacht, als sie tatsächlich sind. Unter der provozierenden Überschrift „Ist die Krise der Demokratie eine Erfindung?“ überträgt der Herausgeber Wolfgang Merkel die Ergebnisse der Einzelanalysen auf die konzeptionellen Überlegungen zu Krise und Demokratie in der Einleitung. Er kommt dabei zu differierenden Einschätzungen, die die Frage nach einer Krise der etablierten Demokratien nicht einfach bejahen lassen. Fragt man in Eurobarometer-Umfragen nach dem Zufriedenheitsgrad der europäischen Bürgerinnen und Bürger, liegt dieser – mit erheblichen nationalen Variationen – überraschend hoch. Im Jahr 2013 sogar höher als 1973. Der demos selbst glaubt also nicht an eine Krise der Demokratie. Prüft man die Krisenfrage durch das von Demokratieforschern entwickelte Demokratiebarometer mit seinen 100 Indikatoren, kommt man zum selben Schluss: Die Qualität der 30 besten Demokratien der Welt liegt 2012 leicht höher als im Jahr 1990. Auch hier stützen die empirischen Untersuchungsergebnisse die verbreitete These der Demokratie in der Krise nicht. Die dritte Perspektive auf der Ebene konkreter Teilanalysen unterhalb der Oberfläche von Bevölkerungsumfragen und aggregierten Demokratieindizes zeigt ein etwas anderes Bild. Die Krisenphänomene der reifen Demokratie sind vielschichtig und variieren von Institution zu Institution, von Politikbereich zu Politikbereich und von Land zu Land. Demokratiegewinnen bei Frauenrechten, Geschlechtergerechtigkeit, Minderheitsrechten oder der Rechenschaftspflicht der Regierungen und politischen Eliten stehen besorgniserregende Entwicklungen gegenüber. Das untere soziale Drittel der Gesellschaft ist weitgehend aus der Politik ausgestiegen. Wir nähern uns einer „Zweidritteldemokratie“ (Merkel). Dies allein widerspricht schon dem Gebot politischer Gleichheit, das zu den basalen Grundprinzipien der Demokratie gehört. Dass es zudem vom anderen Zweidrittel der demokratischen Gesellschaft nicht skandalisiert wird, ist der eigentliche Skandal. „Demokratie und Krise“ geht über den Großteil der in der Wissenschaft üblichen Sammelbände hinaus. Die Kapitel sind nicht Ergebnis eines Workshops, sondern Ergebnis langjähriger Forschung am und weisen damit eine für Sammelbände ungewöhnliche thematische und theoretische Kohärenz auf. Mit der Ausnahme des Historikers Jürgen Kocka waren oder sind alle Autoren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung „Demokratie und Demokratisierung“ am WZB. Die in anderen Sammelbänden üblichen generalisierenden – und wenig differenzierenden – Krisendiagnosen sucht man in diesem Buch vergebens.