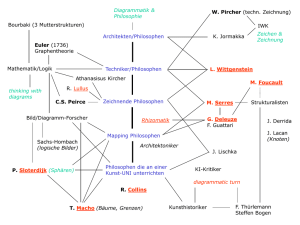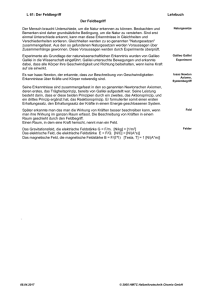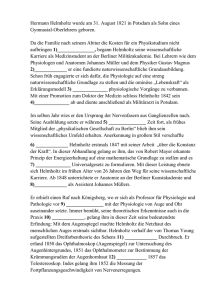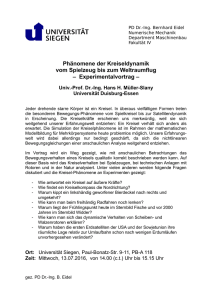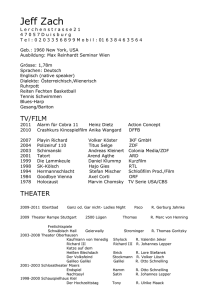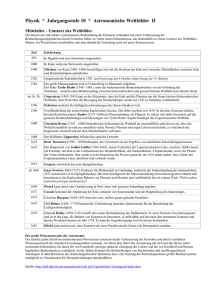Denken
Werbung

A. Kamlah ANSCHAULICHES UND SYMBOLISCHES DENKEN §1. Denkstile in der individuellen und historischen Entwicklung des Menschen Das menschliche Denken hat eine Entwicklung durchlaufen. Wer wollte das heute bestreiten? Ein Industriekaufmann unserer Tage denkt anders als die Helden Homers oder gar die Neandertaler. Sowohl im Individuum als auch in der Gattung Mensch findet eine solche Entwicklung statt. Für das Individuum hat Piaget mit seiner Schule einen Teil dieser Entwicklung untersucht. Niemand bezweifelt heute mehr, daß der einzelne Mensch in den frühen Phasen seiner Kindheit anders denkt als ein Erwachsener. Seine Schülerin B. Inhelder erforschte den mit dem Alter zunehmenden Besitz quantitativer Begriffe. Es gibt sehr überraschende Experimente, die zeigen, daß kleinere Kinder noch nicht die Fähigkeit besitzen, Quantitäten richtig abzuschätzen, auch wenn sie über alle dazu notwendigen Beobachtungen verfügen. Gießt man aus dem gleichen Meßbecher die gleiche Menge Saft vor den Augen fünfjähriger Kinder in ein breites, niedriges und ein schmales hohes Glas und läßt sie eines zum Trinken auswählen, dann nehmen sie in der Regel das hohe Glas, weil sie meinen, in diesem sei mehr enthalten, obwohl sie doch genau gesehen haben, wie man den Saft abgemessen hat. Ich habe den Versuch mit meinen eigenen Kindern ausgeführt, und diese haben sich zu meiner Verblüffung genauso benommen, wie B. Inhelder es erwartet hätte. Kinder denken eben fundamental anders als Erwachsene. Sie schätzen eine Stoffmenge nach dem unmittelbaren Augenschein und nicht, indem sie einen Erhaltungssatz der Stoffmenge dabei voraussetzen. Auch wenn Kinder älter werden, verfügen sie noch nicht über die Fähigkeit des abstrakten Denkens eines erwachsenen Wissenschaftlers. (Ich sage "eines Wissenschaftlers", da keineswegs alle unsere Mitbürger irgendwann in ihrem Leben die Fähigkeit erwerben, komplizierte naturwissenschaftliche oder sozialwissenschaftliche Gedankengänge nachzuvollziehen.) Dies sei an einem Beispiel erläutert: Ein etwa 16jähriger Jugendlicher glaubte, ein Perpetuum mobile entdeckt zu haben. Er wußte zwar, daß seine Überlegungen einen verborgenen Fehler enthalten müssen, weil es ja bekanntlich keine Perpetua mobilia gibt, konnte sich jedoch der Suggestion seiner eigenen Schlußfolgerungen nicht entziehen. Er dachte sich auf einem Rad eine Reihe von Stabmagneten tangential angeordnet und auf einem Ring um das Rad herum ebenso viele Magneten ihnen gegenüber im flachen Winkel zur Tangente. Die Magneten auf dem Ring, meinte er, zögen nun die Magneten des Rades an, dadurch fange das Rad an, sich zu drehen. Steht nun ein Magnet auf dem Rad einem solchen auf dem es umfassenden Ring gegenüber, dann wird er bereits vom nächsten dieser Magneten angezogen usw. Das Rad dreht sich so unaufhörlich. Natürlich stimmt etwas nicht an dieser Überlegung. Ein Magnet zieht einen anderen nicht nur von vorne an, so wie die rote Capa des Matadors den Kampfstier, sondern wenn der bewegliche Magnet an dem feststehenden vorbei gesaust ist, wird er von ihm zurückgehalten im Unterschied zu dem Stier, der am Stierkämpfer vorbei stürmt, wenn dieser kurz ausweicht. Der Effekt der beschleunigenden Kraft vor dem Magneten und der bremsenden Kraft nach Passieren des Magneten müssen sich ausgleichen. Aber so sehr mir der Sechzehnjährige bereit war, den Anteil beider Teilkräfte an der gesamten Bewegung zuzugestehen, so wenig nahm er mir ab, was ich ihm qualitativ nicht mehr erklären konnte, daß die eine Teilkraft das Rad um den gleichen Betrag beschleunigt, um den die andere es bremst. Ich konnte ihm keine Erklärung des Typs liefern, der für ihn maßgebend war, nämlich eine qualitative Erklärung. Qualitative Erklärungen versagen überall dort, wo verschiedene Einflüsse gegeneinander wirken und nur durch Rechnung zu entscheiden ist, in welcher Richtung der resultierende Einfluß wirkt. Wir sehen hier einen Fall eines für nicht geübte Naturwissenschaftler typischen Warum-Fragens, das nach Antworten von ganz bestimmter Art verlangt. Der Student der modernen Physik erhält während seines Studiums nicht nur Antworten auf vorhandene Fragen, er muß auch lernen, auf neue Art Fragen zu stellen und sich bisher gestellte Fragen abzugewöhnen. Das Wort "warum" ist sicherlich eines der schwierigsten der deutschen Sprache und ein guter Teil der intellektuellen Entwicklung besteht im Erlernen der angemessenen Warum-fragen und der angemessenen Typen von Antworten, die in Frage kommen können. Wir lachen darüber, wenn ein Kind fragt: "Warum heißt dieser Mann Herr Rehfuß?" Aber das zeigt doch nur, daß man lernen muß, wann man eine Erklärung erwarten darf und von welcher Art diese Erklärung sein darf. Genau wie der Erwerb quantitativer Begriffe gehört das Lernen angemessener Typen von Erklärungen zur geistigen Entwicklung. Die Physiklehrer kennen dieses Problem und die Physikdidaktik besteht zum Teil in der Kunst, den Schülern altersgemäße Erklärungen von Naturvorgängen anzubieten, ohne dabei die Wahrheit zu verfälschen. Eine wichtige Rolle in dieser Physikdidaktik spielen anschauliche Modelle für physikalische Geschehensabläufe, von denen der Physiker weiß, daß sie nur bestimmte Aspekte derselben richtig beschreiben. Schülern eines bestimmten Alters kann man aber etwas anderes als Erklärung noch nicht anbieten. Damit betreten wir bereits das Feld, auf dem wir uns in dieser Arbeit bewegen werden. Wir werden fragen: Wie stellen wir uns auf bestimmten Stufen unseres Denkens den physikalischen Vorgang eigentlich vor, in Bildern oder unbildlich und stellen die Bilder etwas dar, was man wahrnehmen kann oder etwas, was der Wahrnehmung unzugänglich ist, wie etwa Atome? Insofern haben wir es immer noch mit dem Typ der erwarteten Erklärungen zu tun, jedoch unter einem besonderen Gesichtspunkt, dem der Darstellung der Erklärung, damit, ob diese symbolisch oder bildlich ist, und wenn bildlich, von welcher Art diese Bilder dann sind. Offensichtlich wird man eine physikalische Erklärung ohne jedes anschauliche Modell erst Studenten oder Schülern anbieten können, die schon recht erwachsen sind. Jüngere Schüler müssen erst eine Entwicklung durchlaufen, die sie nicht umgehen können und in deren Endstadium sie erst den Typ von Erklärungen akzeptieren können, der in der modernen Wissenschaft üblich ist. Es wäre fast ein Wunder, wenn die Entwicklung, die jeder Mensch in seinem individuellen Leben durchläuft, der Gesellschaft als ganzer erspart geblieben wäre, wenn die Menschheit dem Haupte des Zeus, erwachsen wie Athene, entsprungen wäre. Natürlich war es nicht so. Irgendwann einmal haben wohl auch Erwachsene nicht gewußt, daß in zwei verschiedenen Gefäßen der Inhalt gleich ist, wenn eine Flüssigkeit aus dem gleichen dritten Gefäß, das jemals bis zur gleichen Marke gefüllt war, in beide hineingegossen wurde. Nur mag dies schon in ferner vorgeschichtlicher Vergangenheit liegen. Irgendwann hätten Menschen vielleicht keine quantitativen Erklärungen akzeptiert. Dies war wohl bereits in der historischen Zeit. Und irgendwann mußte eine gute Erklärung aus anschaulichen Modellen bestehen, das galt für manche Physiker noch vor hundert Jahren. So ist der Denktypus zu verschiedenen Zeiten wohl sehr unterschiedlich gewesen, was wohl grundsätzlich niemand bestreiten wird. Wenn z.B. T.S. Kuhn von verschiedenen "Paradigmen" oder "disziplinären Systemen" in der Physikgeschichte spricht, dann meint er auch schon so etwas wie Typen erwarteter Erklärungen. Damit ist das Stichwort "wissenschaftliche Revolution" bereits gefallen. Dieser Terminus wurde bekanntlich von T. S. Kuhn geprägt, um die Ablösung eines "Paradigmas" durch ein anderes zu bezeichnen (später spricht er von "disziplinären Systemen" statt von "Paradigmen"). Ein "Paradigma" bzw. "ein disziplinäres System" ist gekennzeichnet durch wissenschaftliche Axiome, Prinzipien, durch anerkannte Beispiele erfolgreicher Anwendung einer Wissenschaft und durch ihre methodologischen Regeln. Diese zusammen bestimmen eine Weise, die Welt zu begreifen, eine wissenschaftliche Weltanschauung. Das, was wir hier anvisieren wollen, hingegen, die begrifflichen Möglichkeiten, die Denkstile, fehlen allerdings in Kuhns Liste der Merkmale eines disziplinären Systems. Es ist viel über die "Inkommensurabilität" dieser Kuhnschen Paradigmen diskutiert worden, über die Unverstehbarkeit der Gedanken in einem Paradigma für den Vertreter eines anderen. Wie kann ich eine Physik eines mir fremden Paradigmas erkennen? Vielfach hat man dann geschlossen, daß die Kuhnschen Paradigmen entgegen Kuhns eigener Auffassung "kommensurabel" sein müssen, da wir ja offensichtlich zu begreifen in der Lage sind, was Physiker früherer Zeiten gesagt haben. Ich glaube, daß man es sich auf diese Weise zu leicht macht. Die verschiedenen Stile, in denen zu verschiedenen Zeiten gedacht worden ist, müssen, wenn sie mit Denkstilen verschiedener Lebensstadien des heranreifenden Menschen verglichen werden können, tatsächlich inkommensurabel sein, denn tatsächlich begreift derjenige, der auf qualitative Erklärungen fixiert ist, eine quantitative Erklärung nicht, und für wen eine Erklärung in anschaulichen Modellen erfolgen muß, sind unanschauliche physikalische Theorien, die nur aus mathematischen Formeln bestehen, eben einfach keine Erklärungen. Es bedarf schon einer kleinen Gehirnwäsche, ehe man bereit ist, so etwas zu akzeptieren. Vielleicht können wir nur vom reiferen Stadium der Entwicklung aus die früheren begreifen. Das heißt aber nicht, daß wir die Gedankengänge dieser früheren Denkstile dann in unserer Sprache ausdrücken können. Aber wir können vielleicht in einer Metasprache darüber reden und von dieser Warte aus die innere Konsequenz der Gedankengänge von Vertretern des anderen Denkstiles erkennen. Wie das möglich ist, brauchen wir hier vielleicht noch nicht zu verstehen. Aber irgendwie halten wir es doch für möglich, zu erfassen, was in Kindern vorgeht, die zwei Gläser mit der gleichen Flüssigkeitsmenge für verschieden stark gefüllt halten, auch wenn wir uns nicht mehr in die Lage dieser Kinder versetzen können. Diese Kinder haben eben einen anderen Begriff von "mehr Flüssigkeit" als wir. Für sie ist einfach in dem hohen Glas mehr Saft als in dem niedrigen. Und doch erfassen wir ihre Gedankengänge. In diesem Aufsatz wollen wir uns um einen speziellen Aspekt der Denkstile bemühen, um das Ausmaß, in dem gedanklichen Bilder, die unmittelbar etwas Wahrnehmbares darstellen, erst durch indirekt gedeutete Bilder und schließlich durch reine Zeichen (Symbole) ersetzt werden, und wie vor allem derartige Denkstile, die mit der Art der Vergegenwärtigung von Sachverhalten im Bewußtsein zu tun haben, zum Ideal des Denkens erhoben werden, zum "Denkideal". §2. Denkideale - Die Natur der Gedanken im Selbstverständnis der Philosophen und Wissenschaftler Die Philosophie versucht ihre Fragen mit Denken zu lösen. Dafür muß sie zunächst ihr Werkzeug, das Denken, untersuchen. Dasselbe gilt für die Mathematik und die theoretischen Naturwissenschaften. Aus diesem Grund war seit den Griechen das Denken stets eines der wichtigsten Themen philosophischer Reflexion. Ein Teil dieser Untersuchungen führt zur Aufstellung einer Logik mit Schlußregeln, Regeln für zulässige Definitionen usw. Das ist der harmlose Teil der Wissenschaft vom Denken; denn auf diese Regeln wird man sich leicht einigen können. Schwieriger zu beantworten ist die Frage, woraus denn eigentlich die Gedanken bestehen. Was sind eigentlich Begriffe, was sind Sätze oder Urteile? Diese Fragen führen unter anderem zum berühmten Universalienproblem (das Problem der Existenzweise der abstrakten Begriffe), das Plato als erster zu lösen versuchte, indem er den Begriffen ein objektives Sein als "eidoi" (Formen oder Typen von Dingen) zuschrieb, die uns dadurch zugänglich sind, daß wir sie - man weiß nicht, ob Plato das ganz so geglaubt hat, wie er es darstellt - vor der Geburt kennengelernt haben und uns daran erinnern. Bekanntlich haben andere Philosophen später Alternativen zu Platos sogenannter "Ideenlehre" vorgeschlagen, was zur über zweitausendjährigen Diskussion des Universalienproblems führte. Wir können nun wieder mit den Philosophen fragen: In welcher Gestalt sind Gedanken in unserem Kopf vorhanden? Diese Frage wird durch Platos Ideenlehre so direkt eigentlich nicht behandelt, spielte dann aber später bei der Diskussion des Universalienproblems eine große Rolle. Ihre Beantwortung ist aber äußerst wichtig, wenn man wissen will, welche Gedanken überhaupt zulässig sind. Kant versuchte, durch Untersuchung unserer Gedanken im "Gemüt" illegitime Begriffe der Metaphysik aus der Philosophie auszuscheiden. Begriffswörter, deren Begriffe nach einer fundierten Begriffstheorie gar nicht existieren können, stehen nur für bloße Scheinbegriffe; man verwendet dann Wörter ohne wirklichen Inhalt. In der philosophischen Tradition seit Descartes werden Begriffe als eine spezielle Art von "Vorstellungen" (engl. "ideas", franz. "idées") aufgefaßt. So redet wie die anderen Philosophen auch Kant. Ursprünglich hatte man bei den Vorstellungen (idées, ideas) an so etwas wie innere Bilder gedacht, mußte aber bald die Unzulänglichkeit dieser Theorie einsehen. Daher kann man nach Kant nicht erklären, was eine Vorstellung ist (Logik A 42), aber offenbar sind Vorstellungen etwas, was im Bewußtsein auftreten kann und zwar deutlich oder undeutlich (A 42). Das mag für den Augenblick genügen. Weiter unten gehe ich ausführlicher auf die Natur der Vorstellungen ein. Die moderne Auffassung davon, was ein Begriff und dementsprechend auch, was Wahrheit ist, ist davon radikal verschieden. So schreibt Carnap: "Die Einführung oder Legitimierung des Wortes 'Pferd' geschieht z. B. dadurch, das festgestellt wird, welche Bedingungen vorliegen müssen, damit wir ein Ding ein Pferd nennen, also durch Angabe der Kennzeichen des Pferdes (oder Definition des Wortes "Pferd"). Von einem Zeichen, das in solcher Weise eingeführt oder legitimiert ist ..., sagen wir, es bezeichne einen Begriff... Was ein Begriff ist, haben wir hiermit nicht gesagt, sondern nur, was es heißt, ein Zeichen bezeichne einen Begriff. Das ist auch das einzige, was genau gesagt werden kann. Und das genügt auch; denn wenn von Begriffen sinnvoll die Rede ist, so handelt es sich stets um durch Zeichen bezeichnete oder doch grundsätzlich bezeichenbare Begriffe; und im Grunde ist dann stets die Rede von diesen Zeichen und ihren Verwendungsgesetzen. Die Bildung eines Begriffs besteht in der Aufstellung eines Gesetzes über die Verwendung eines Zeichens (z.B. eines Wortes) bei der Darstellung von Sachverhalten" (R. Carnap 1926, S. 3 4). Damit sind nunmehr eigentlich die Zeichen das Wichtige. In welcher Weise der Begriff im Geiste existiert, wird nun zur Nebensache. Der Begriff ist dann die Bedeutung des Zeichens, die Art der Verwendung des Zeichens. Eng verknüpft mit der Frage nach den Begriffen ist die nach der Wahrheit. Denn wenn ich frage, was wahr ist, so muß ich zuerst mir darüber klar sein, wovon ich das eigentlich frage. Wovon kann sinnvollerweise gesagt werden, es sei wahr? Jahrhundertelang galt es als ausgemacht, daß Urteile oder "Verknüpfungen von Vorstellungen" wahr sein können, d.h. etwas, was im Bewußtsein, im Intellekt vorhanden ist: veritas est adaequatio rei et intellectus. Oder nach Kant: "Was ist Wahrheit? Die Namenserklärung der Wahrheit, daß sie nämlich die Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstande sei, wird hier geschenkt und vorausgesetzt"; (Kr. d. V. B 82)) Hier heißt Erkenntnis soviel wie "Urteil". In der heutigen analytischen Philosophie ist nun Wahrheit etwas ganz anderes. Tarski schreibt: "Wir wollen mit einem konkreten Beispiel beginnen und die Aussage 'Schnee ist weiß' betrachten. Wir stellen uns die Frage, unter welchen Umständen diese Aussage wahr oder falsch ist. ... Die Aussage 'Schnee ist weiß' ist wahr genau dann, wenn Schnee weiß ist." (Tarski 1977, S. 143) Tarski fragt gar nicht mehr nach der Wahrheit einer Vorstellung oder Erkenntnis, sondern von vornherein nach der Wahrheit einer Aussage. ("sentence" nach Tarski - "declarative sentence", 1949, S. 53, 1977, S. 142). Er sagt auch explizit: "Aus mehreren Gründen besteht wohl am meisten darin Übereinstimmung (it appears most convenient) , den Term 'wahr' auf Aussagen (sentences) anzuwenden". (1977, S. 142) und in einer Anmerkung sagt er dann, daß Aussagen Klassen von gleichartigen Inschriften, d. h. Zeichenreihen sind. Wir sehen hier deutlich einen fundamentalen Unterschied in der Auffassung von dem, was Wahrheit, gedankliche Vergegenwärtigung und Erkenntnis eigentlich sind. In der Philosophie heißt die Wende von der mehr psychologisch orientierten zur linguistisch orientierten Auffassung der linguistic turn, die sprachliche Wende. (Der Gegensatz zwischen der alten und der neuen Auffassung ist übrigens von allen analytischen Philosophen mehr oder weniger deutlich gesehen worden, so von Tarski S. 142; H. Reichenbach 1983, S. 19f.; F. Waismann 1976, S. 225) Damit ist klar, daß die Frage "Was ist Denken? Was ist Vergegenwärtigung in Gedanken?" sehr verschieden beantwortet werden kann. Wir wollen aber dabei nicht stehenbleiben, den Gegensatz zwischen der klassischen Auffassung der neuzeitlichen Philosophie und der modernen, der analytischen Philosophie zu beschreiben. Dieser Gegensatz ist nämlich nur der Ausdruck einer Revolution im Denkideal der Wissenschaftler überhaupt, die im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat und am deutlichsten in der Mathematik und der Physik faßbar wird. So spiegelt die Philosophie hier wie auch in vielen anderen Fällen nur die wissenschaftliche Denkweise ihrer Zeit wider. Man zeichnet ein völlig falsches Bild von der Philosophiegeschichte, wenn man sie nur als interne Geschichte des Faches darstellt, als Dialog der großen Denker unter sich. Alle entscheidenden Anstöße hat die Philosophie stets von außen erhalten, von der Wissenschaft und von den gesellschaftlichen Umwälzungen. Daher darf uns ein Phänomen wie der linguistic turn auch nicht nur als ein innerphilosophischer Vorgang interessieren. Wir wollen darin vielmehr eine Revolution des Denkideals der Wissenschaften sehen und haben dementsprechend die Frage: "Was ist Denken?" zu ersetzen durch die Frage "Was war gedankliche Vergegenwärtigung im Selbstverständnis der Wissenschaften im Zuge ihrer wechselvollen Geschichte?" Wir werden dann neben derjenigen Revolution, die innerhalb der Philosophie im linguistic turn ihren Ausdruck findet und die wir später die Einsteinsche Revolution nennen wollen, noch einen zweiten Umsturz des Denkideals auffinden, die Galileische Revolution. Dies beides sind die bedeutendsten Umwälzungen in der Geschichte der Physik und auch diejenigen, die immer wieder als Beispiele wissenschaftlicher Revolutionen aufgeführt werden. Oben hatten wir bereits vom Wandel der Denkstile geredet. Hier kommt der Wandel der Denkideale, der angestrebten Denkstile hinzu. Beide hängen miteinander zusammen, bei vollständiger Selbsterkenntnis gäbe es zwischen beiden auch keinen Unterschied. Aber da die Menschen sich nicht vollständig in der Reflexion durchschauen, hinkt das methodologische Sebstbewußtsein hinter den tatsächlichen Methoden hinterher. Man wird Denkideale und Denkstile voneinander unterscheiden müssen. Können wir nun wieder Kuhns Begriff der "wissenschaftlichen Revolution" auch auf die Denkideale anwenden? Wie oben schon gesagt, besteht für Kuhn ein disziplinäres System bzw. Paradigma aus Axiomen, Prinzipien, Beispielen und methodologischen Regeln. Eine "Revolution" ist dann die Ersetzung eines disziplinären Systems durch ein anderes. Aber über das, was wir hier "Denkideal" nennen wollen, sagt Kuhn nichts. Wir werden also die Änderungen, die sich in einer wissenschaftlichen Revolution vollziehen, als noch wesentlich fundamentaler anzusehen haben, als Kuhn dies tut. Es sind nicht nur wissenschaftliche Normen und methodologische Regeln davon betroffen, sondern bei den großen Revolutionen auch Denkideale. Was das ist, müssen wir uns noch klarmachen, was im nächsten Abschnitt geschehen soll. Haben wir uns die drei verschiedenen Denkideal der Neuzeit vor Augen geführt, werden wir versuchen, zu Anwendungen auf verschiedene Probleme zu kommen. Das kann nur sehr kurz und skizzenhaft geschehen. Ich werde nur einige Schlaglichter auf die Realismus-Idealismus-Debatte, auf die Aussage von Poincarés Konventionalismus und auf Diltheys Verstehenstheorie werfen können. Ich werde meine Thesen dazu auch noch nicht ausreichend belegen können. Die Anwendung der Theorie der Denkstile und Denkideale ist ein Forschungsprogramm, mehr einstweilen nicht. §3. Die verschiedenen Denkstile, Stile der gedanklichen Vergegenwärtigung Denken ist einmal als Probehandeln bezeichnet worden. Wer ein Problem durch Denken löst, muß es nicht durch Probieren lösen. Um ein solches Probehandeln zu ermöglichen, müssen die Dinge, die sonst Objekt des Handelns wären, durch irgend etwas repräsentiert werden, durch gedachte Bilder oder Zeichen (Symbole). (Wir reden jetzt so, als sei der Gesichtssinn die einzige Quelle der menschlichen Wahrnehmung. Das ist natürlich eine ungerechtfertigte Vereinfachung der Situation. Aber die Verallgemeinerung von dem einen auf die alle fünf Sinne dürfte keine prinzipiellen Schwierigkeiten aufwerfen.) Die Bilder können auch noch von verschiedener Art sein, sie können mehr oder weniger vom Original systematisch abweichen. Wir können daher nach Art der verwandten Vertreter oder Repräsentanten für Dinge und Sachverhalte verschiedene Denkstile unterscheiden, A) das direkt anschauliche Denken oder Denken in Bildern, B) das indirekt anschauliche Denken oder Denken in Modellen, C) das symbolische Denken. Diese drei Denkstile sollen nun beschreiben oder diskutiert werden. Danach werden wir sie zur Erklärung wissenschaftsgeschichtlicher und philosophiegeschichtlicher Ereignisse verwenden. A. Das direkt anschauliche Denken oder Denken in Bildern Ein Tierpsychologe (Verhaltensforscher) namens Tinklepaugh untersuchte 1928, wieweit Rhesus-Affen sich Sinneseindrücke merken können. Dazu machte er folgendes Experiment: Über eine Banane wird ein Becher gestülpt. Der Affe sieht das von seinem Käfig aus. Daraufhin wird der Becher durch ein Brett den Augen des Affen entzogen und die Banane heimlich durch ein Salatblatt ausgetauscht. Der Affe wird nun aus dem Käfig herausgelassen. Es geschah bei dem Versuch folgendes: Der Rhesusaffe wandte sich sofort dem Becher zu, hob ihn auf "und war einen Augenblick lang starr vor Staunen ... Dann untersuchte der Affe den Becher genau, schrie den Beobachter wütend an und ging davon" (Fischl 1949, S. 110). Was hat sich hier ereignet? Der Zoologe Fischl erklärt das Ereignis so: Der Affe glaubte, unter dem Becher sei eine Banane. Er mußte wohl irgendein Erinnerungsbild von der Banane zur Verfügung gehabt haben, mit dem er dann den Sinneseindruck der Banane verglich. Das ist natürlich eine Hypothese, die wir aber für die Zwecke unserer Erörterung annehmen wollen. Das Operieren mit geistigen Bildern, die unmittelbar mit Erlebnissen verglichen werden können, möchte ich die direkte Anschauung nennen. Hermann von Helmholtz sagt dazu: "Unter dem viel gemißbrauchten Ausdrucke 'sich vorstellen' oder 'sich denken können, wie etwas geschieht' verstehe ich - und sehe nicht, wie man etwas Anderes darunter verstehen kann, ohne allen Sinn des Ausdrucks aufzugeben -, daß man sich die Reihe der sinnlichen Ausdrücke ausmalen könne, die man haben würde, wenn so etwas im einzelnen Falle vor sich ginge." (Helmholtz, 1921, S. 5; Helmholtz, 1966, S. 44). Das ist zweifellos eine recht gute Charakterisierung der direkt anschaulichen Vorstellung, bzw. der gedanklichen Vergegenwärtigung durch Bilder. Tinklepaughs Affe malt sich also eine Banane aus, die er sehen wird, wenn er den Becher aufhebt. Dabei ist wichtig, daß zum "Sich-Vorstellen" im Sinne von Helmholtz zweierlei gehört, das gedachte naturalistische Bild und die Berücksichtigung der Situation, in der es auftritt oder auf die es zu beziehen ist. Der Rhesusaffe bezieht das vorgestellte Bild der Banane auf einen Teil seines Sehraumes, nämlich auf das Innere des Bechers. So läßt sich eine bildhafte Vorstellung in einer konkreten Situation verwenden. Es ist jedoch unmöglich, sich ohne Bezug auf die augenblickliche räumliche und zeitliche Situation einen Sachverhalt bildhaft als bestehend vorzustellen. Deshalb tragen ja Abbildungen, auch Photos, stets eine Unterschrift, z. B. "Blick auf den Louvre vom Place du Caroussel". Diese zusätzlichen Angaben des Beobachtungsstandpunkts und der Beobachtungsrichtung sind notwendig, damit man weiß, was mit dem Bild gemeint ist. Dies zu erwähnen ist wichtig, weil dadurch deutlich wird, daß ein bloßes Bild allein - ob real oder geistig, ist hier gleichgültig nichts darstellen kann. Ohne zusätzliche Angaben weiß niemand, worauf sich das Bild bezieht. Diese zusätzlichen Angaben sind entweder durch einen möglicherweise sprachfrei gedachten Bezug auf die Situation des Vorstellenden oder durch zusätzliche sprachliche Ausdrücke gegeben. Bilder mit einem derartigen sprachlichen Zusatz möchte ich etikettierte Bilder nennen. Man kann an Stelle einer direkt anschaulichen Vorstellung auch ein reales Bild zur Repräsentation eines Sachverhalts verwenden. Dieses ist dann ein Zeichen besonderer Art, das dem dargestellten Gegenstand ähnlich ist. Dann sind aber eine Reihe semantischer Regeln zu beachten. Ein Bild ist zunächst ein Ding, wie andere Dinge auch, z.B. ein Blatt Papier mit farbigen Flecken darauf. Es wird zum Bild, indem man es als ein solches versteht. Dazu muß man wissen, von wo aus man es betrachten muß, um einen mit der Wirklichkeit vergleichbaren Eindruck zu haben. Zusätzlich sind dann noch weitere semantische Regeln zu beachten, wie, daß das Bild etwas Dreidimensionales darstellt, obwohl es selbst zweidimensional ist oder daß der Rand des Bildes nicht mehr zum Blick gehört. Zwischendurch seien noch zwei wichtige Anmerkungen eingeschoben: 1. Helmholtz glaubte mit seiner Definition eine allgemeine Charakterisierung der Anschauung zu geben. Tatsächlich trifft sie aber nur auf das zu, was ich direkte Anschauung nennen möchte. Helmholtz hat hier die Möglichkeit der indirekten Anschauung, von der im nächsten Abschnitt die Rede sein soll, glatt übersehen. 2. Ich sage hier nochmals: Wenn in diesem Aufsatz von direkter Anschauung und von Bildern und später von indirekter Anschauung und von Modellen die Rede ist, möchte ich diese Termini nicht nur auf den Gesichtssinn beschränkt wissen. Ich will auch akustische, taktile oder olfaktorische "Anschauung" und "Bilder" zulassen. Der Gesichtssinn ist nur der wichtigste der fünf Sinne. Daher können wir pars pro toto zunächst einmal nur vom Sehen reden. Die Verallgemeinerung auf die anderen Sinne ist dann jederzeit möglich. das, was sie denkt, in einer Skizze auf einem Blatt Papier vorzuführen und ein sicheres Gefühl dafür hat, welche Figur auf der Skizze von ihr intendiert ist und welche nicht. Der wirkliche Denkvorgang ist sehr kompliziert und sogar teilweise der Selbstbeobachtung nicht zugänglich. Für unsere Überlegungen soll es nicht entscheidend sein, ob eine Person sich etwas an Hand einer Skizze überlegt oder sich das, was sie sonst zeichnen würde, nur vorstellt. Wir werden dann vom Denken in Bildern reden, wenn es mit dem gleichen Resultat erfolgt wie das Denken an Hand einer Skizze. Es liegt nahe, im direkt anschaulichen Denken den primitivsten Denkstil zu erblicken, der auch genetisch der ursprünglichste ist. Denn direkt anschauliches Denken haben wir ja bereits beim Rhesusaffen vermutet. Dazu wäre allerdings zu sagen, daß die alleinige Verwendung anschaulicher Bilder nur singuläre Sachverhalte ausdrücken kann. Man kann weder für Allquantoren noch für Existenzquantoren ein Äquivalent in der Bildersprache finden. Wie soll ich in einem Bild folgende Aussagen darstellen: 1. Fritz machte jeden dummen Streich begeistert mit. 2. Manchmal gab es sonntags Himbeereis. Ich kann ein Bild malen, auf dem Fritz einen dummen Streich begeistert mitmacht, und eines, auf dem eine Familie in Sonntagskleidung Himbeereis von der Mutter serviert bekommt. Aber diese Bilder sagen doch nur dann das Gewünschte, wenn das, was die Quantoren zum Ausdruck bringen, im Kommentar dazugesagt wird. Viele Philosophen haben versucht, das menschliche Denken nicht viel anders als das des Rhesusaffen zu verstehen: Die Menschen haben beim Denken Bilder vor ihrem geistigen Auge, die Dinge der Welt darstellen. Überlege ich mir, ob sich ein bestimmter Schrank durch eine von mir vorgestellte Tür tragen läßt, so projiziere ich mein geistiges Bild des Schrankes auf das geistige Bild der Tür und sehe dann, welches von beiden höher und breiter ist als das andere. So lassen sich in Gedanken Versuche ausführen. Denken ist Probehandeln, sagte ich bereits oben. Das Denken mit Bildern erspart mir einen unter Umständen riskanten und aufwendigen Versuch. Daß in speziellen Fällen Denken so ablaufen kann, soll auch nicht bezweifelt werden. Die Frage ist nur, ob ein jedes Problemlösen aus derartigen Gedankenversuchen oder Probehandlungen besteht. Indessen reicht die zusätzliche Einführung von Quantoren, die in der reinen Bildersprache fehlen, noch nicht aus, um selbst die Denkfähigkeiten von Menschen primitivster Kulturen wiederzugeben. Selbst diese sogenannten Primitiven sprechen nämlich eine Sprache mit einer komplizierten Grammatik, in der Konjunktionen wie "weil" und "damit", Zahlen, (oder etwas dazu Äquivalentes) und andere Ausdrücke vorkommen, für die es selbst in einer Bildersprache mit Quantoren nichts Entsprechendes gibt - wir setzen hier ohnedies voraus, daß Bildunterschriften zugelassen sind -, und sieht man sich die heutigen Sprachen genau an und analysiert deren Grammatik, so wird einem klar, daß vieles, was darin ausgedrückt werden kann, in Bildern nicht darstellbar ist, etwa Sätze im Konjunktiv, Finalsätze, Konditionalsätze, oder was an Formen fremder Sprachen diesen Arten von Sätzen entspricht. Man kann kein Bild malen, welches uns mitteilt: "Wenn es heute nicht mehr zu regnen aufhört, werden wir ganz durchnäßt zu Hause ankommen". Dieser Satz enthält die Konjunktion "wenn .. dann", ist also ein Konditional. Solche Sätze spielen bei zahllosen Problemen eine Rolle, womit zugleich klar ist, daß die Lösungen dieser Probleme nicht ausschließlich durch Denken mit Bildern vorgenommen werden können. Der Psychologe wird hier fragen, in welcher Weise sich eine Person der Bilder des Schrankes oder der Tür bewußt ist. Kann man wirklich sagen, daß sie vor ihrem geistigen Auge zwei Bilder "sieht", die sie versucht, zur Deckung zu bringen? Was spielt sich tatsächlich im Bewußtsein einer Person ab, die in Bildern denkt? Man kann wohl nur sagen, daß sie in der Lage ist - wenn man ein gewisses zeichnerisches Talent voraussetzt - Aber wir können uns für Tatsachenaussagen über die Welt eine Sprache denken, in der mindestens alle wahrheitsfunktionalen Aussagen der Prädikatenlogik erster Ordnung zu Wahrheitsfunktionen von etikettierten Bildern bestimmter Situationen äquivalent sind. Eine Konjunktion von etikettierten Bildern, die zusammen die Welt vollständig beschreiben, ist dann eine Zustandsbeschreibung der Welt. Alle Aussagen über die Welt sind aber (nicht notwendigerweise endliche) Disjunktionen von Zustandsbeschreibungen. Jemand, der eine solche Sprache benutzt, verwendet - so wollen wir es nennen den verallgemeinernden direkt anschaulichen Denkstil. Die Charakterisierung dieses Denkstiles sieht auf den ersten Blick ein wenig kompliziert aus. Aber das ist nicht mehr der Fall, wenn wir sie uns ein wenig näher ansehen und dafür eine andere Formulierung verwenden. Ich führe eine solche Formulierung hier vor, ohne nachzuweisen, daß sie mit der ersten Äquivalent ist: Im verallgemeinernden direkt anschaulichen Denkstil ist jede Aussage über die Welt eine logische Folgerung einer Konjunktion von Aussagen etikettierter Bilder. Eine zweite Formulierung mag für philosophische Ohren vertrauter klingen: Im verallgemeinernden direkt anschaulichen Denkstil sind alle Aussagen in einer Beobachtungssprache formulierbar. Denn eine Beobachtungssprache ist eine solche, deren Elementarsätze wahrnehmbare Situationen darstellen, was wir auch mit Bildern (nicht notwendigerweise mit optischen Bildern) machen können. B. Das indirekt anschauliche Denken Von der direkten Anschauung ist die indirekte zu unterscheiden. Für die direkt anschauliche Darstellung bzw. für Bilder sind die semantischen Regeln sehr einfach, obwohl - wie schon erwähnt - auch ein Bild niemals ganz ohne solche Regeln verstanden werden kann. Diese Regeln implizieren ja unter anderem, daß schon die Bilder der direkten Anschauung nur mit gewissen Zusatzangaben etwas aussagen. Für indirekt anschauliche Darstellungen bzw. Analogzeichen oder Modelle gelten viel kompliziertere semantische Regeln. Die realen oder geistigen Bilder der indirekten Anschauung haben - auch wenn geklärt ist, was sie darstellen sollen und wo ihr Rand ist - ihre Bildeigenschaft nicht allein auf Grund ihrer Ähnlichkeit zu ihrem Urbild, sondern ebenfalls auf Grund von semantischen Regeln, die Eigenschaften des Bildes Eigenschaften des Objekts zuordnen. Anmerkung: Eine weitere semantische Regel ist von N. Goodman behauptet worden (siehe N. Goodman, 1973, Kap. 1). Bei Photographien werden Bilder senkrecht verlaufender Parallelen so korrigiert, daß ihr Fluchtpunkt ins Unendliche rückt und so nicht mehr konvergierende Geraden (d.h. Parallelen) auf dem Bild entstehen. Konvergieren sie doch - beispielsweise die Kanten zweier Kirchtürme, wenn man sie vom Platz vor der Kirche fotografiert - empfinden wir das Bild als falsch; die Kirchtürme sehen dann schief aus, scheinen mit ihren Spitzen aufeinander zuzufallen. Für den Betrachter gelten also bereits unbewußt gewisse semantische Regeln, die Abweichungen von dem naturalistischen Eindruck vorschreiben. Goodman irrt, wenn er hier eine Abweichung vom naturalistischen Eindruck behauptet, wie K. Rehkämper überzeugend nachgewiesen hat (Rehkämper 1991, S. 110-117). Jedes zweidimensionale Bild ist in bestimmter Weise zu betrachten. Typischerweise hängen Bilder senkrecht an der Wand. Wenn auf einem solchen Bild zueinander parallele Kirchtürme dargestellt werden, weil ebenfalls senkrecht, zur Bildebene parallel sind, so liegt der Fluchtpunkt dieser parallelen Kirchtürme im Unendlichen, wie jedes Lehrbuch des perspektivischen Zeichnens uns lehrt. Das ist einfach die Bedingung für den richtigen optischen Eindruck. Die semantische Regel, die in einem solchen Falle Anwendung findet, enthält daher nicht eine Umdeutung des Bildes auf dem Papier in die adäquate bildliche Vorstellung, sondern sagt uns nur, wie wir auf das Bild draufschauen sollen. Etwa: Hänge das Bild in geeigneter Höhe an die Wand und betrachte es dann aus einer geeigneten Entfernung! Nun haben wir uns daran gewöhnt, Bilder auch in Büchern oder auf dem Tisch liegend anzuschauen. Aber auch wenn das vielleicht der häufigere Fall eines Umgangs mit einem Bild ist, bleibt das Hängen an der Wand die Standardsituation, die einen normativen Charakter bekommen hat. Natürlich gibt es Ausnahmen, wie Bilder aus der Vogelperspektive, bei denen aber vom dargestellten Gegenstand her bereits klar sein muß, wie man sie zu betrachten hat. Solche Bilder werden standardmäßig flach auf den Tisch oder den Fußboden zu legen sein. Der Übergang zwischen direkten und indirekten Darstellungen ist fließend. Bereits die meisten künstlerischen Bilder weichen deutlich vom naturalistischen Bild ab. Beansprucht nun ein Bild gar nicht mehr realistisch zu sein, so liegt die Notwendigkeit semantischer Regeln zu seinem Verständnis auf der Hand. Daß wir eine Strichzeichnung nicht als Drahtgebilde interpretieren, liegt an den beim Betrachter eingeübten Regeln zur Deutung solcher Zeichnungen. Ebenso weiß der Betrachter ägyptischer Reliefs, daß die Ägypter nicht in der eigentümlich abgeknickten Haltung herumgelaufen sind, in der sie dort dargestellt werden, oder der von mittelalterlichen Altarbildern, daß dort nicht mehrere gleich aussehende Heilige gleichzeitig auftreten, sondern einer in verschiedenen Phasen seines Lebens. Ist man sich erst über die Bedeutung der semantischen Regeln für nicht naturalistische Bilder im klaren, so wird man natürlich auch neue Regeln erfinden können. Dies tun wir besonders zum Zwecke graphischer Darstellungen. Abb. Die Bevölkerungspyramide für Baden-Württemberg 1978. Wirtschaftswissenschaftler stellen volkswirtschaftliche Tatsachen gerne in Diagrammen dar. Betrachten wir eine solches, z.B. eine "Bevölkerungspyramide"! Das Diagramm repräsentiert auf der linken Seite die weibliche und auf der rechten die männliche Bevölkerung. Ganz unten finden wir darin die Neugeborenen und in der Spitze der Pyramide die Greise. Der Graph sieht wie ein Weihnachtsbaum aus und seine verschiedenen Zweige und die Lücken dazwischen erzählen die Geschichte der letzten Jahrzehnte mit ihren Kriegen und ökonomischen Krisen. So steckt eine Menge Information über die deutsche Bevölkerung in diesem Diagramm, es ist in gewissem Sinne deren Portrait. Aber sieht das deutsche Volk wie ein Weihnachtsbaum aus? Wir benutzen gerne bildliche Ausdrücke, die sich auf die Bevölkerungspyramide beziehen, reden etwa vom Pillenknick. Aber das ist natürlich nur eine Analogie. Nichts im Aussehen der Deutschen rechtfertigt eine solche Bezeichnung. Der Knick ist nur ein Detail in der Figur, das die Abnahme der Geburtenrate seit etwa 1970 darstellt, nicht etwas, was wirklich geknickt ist. Somit ist das Diagramm ein Zeichen für das, was es darstellt, aber ein Zeichen besonderer Art, kein Bild - denn es ist dem dargestellten Sachverhalt nicht ähnlich -, aber eines, bei dem kleine Änderungen seiner Eigenschaften kleinen Änderungen von Charakteristika des Sachverhalts entsprechen. Man kann solche Zeichen Analogzeichen nennen in Anspielung auf die Repräsentation physikalischer Größen in Analogrechnern. Man kann auch sagen, das Zeichen sei ein visuelles Modell dessen, was es darstellt. Die Darstellung geschieht durch indirekte Veranschaulichung, bei der nicht ein Bild etwas zeigt, was in dieser Weise auch wahrgenommen werden könnte, so wie das Helmholtz in obiger Charakterisierung der direkten Anschauung zum Ausdruck bringt, sondern wo eine Graphik etwas darstellt, was in systematischer Weise von einem solchen Bild unterschieden ist. Kleinen Veränderungen eines Analogzeichens entsprechen kleine Veränderungen des dargestellten Gegenstandes und umgekehrt. D.h. Analogzeichen haben quantitative Merkmale, denen ebenfalls quantitative Merkmale der dargestellten Gegenstände entsprechen, und für diese gilt dann: Es gibt zum Analogzeichen a und seinen Gegenstand g eine Menge A von Analogzeichen mit a _ A und eine Menge G von Gegenständen mit g _ G, derart, daß eine stetige Abbildung F von G in A existiert, wobei g auf a abgebildet wird und außerdem gilt: sind a' _ A, g' _ G und a' = F(g'), dann ist a' ebenfalls das Analogzeichen für g'. Natürlich gilt das dann auch für Bilder, die somit eine spezielle Klasse von Analogzeichen darstellen. Ich ziehe es hier vor (obwohl das ein wenig unexakt ist), so zu reden, als seien Bilder keine Analogzeichen, sage also statt "sonstige Analogzeichen" einfach "Analogzeichen". Bei der Bevölkerungspyramide ist jedermann klar, daß er es mit einem Analogzeichen zu tun hat. Für die Wissenschafts- und Philosophiegeschichte hingegen sind Analogzeichen (Modelle) anderer Art noch interessanter, deren Natur als Analogzeichen nicht erkannt wurde. Betrachten wir daher ein gänzlich anderes Beispiel: Ein Modell eines Zuckermoleküls zu verstehen, heißt nicht, im Sinne von Helmholtz voraussehen zu können, was man an einem Zuckermolekül wahrnehmen könnte. Wir können nicht auf eine Größe von 10Å zusammenschrumpfen und nachsehen, ob die Kohlenstoffatome wirklich schwarz sind und die Sauerstoffatome wirklich blau wie bei dem Plastikmodell, das uns der Chemiker in seiner Vorlesung vorführt. Dennoch ist ein solches Modell - sei es nur vorgestellt oder als dreidimensionaler Gegenstand realisiert - nicht sinnlos. Bei geeigneter Interpretation kann es uns eine Menge über die Struktur von Molekülen lehren. Wir müssen nur sagen, was die weißen, blauen und schwarzen Kugeln bedeuten und die Stifte, mit denen sie verbunden sind. Entsprechendes gilt auch für andere Modelle oder indirekt anschaulichen Darstellungen. Wir können hier nicht mehr sagen, das Modell meine etwas, was so aussieht wie es selbst, so wie der Napoleon im Wachsfigurenkabinett so aussieht, wie einst Napoleon aussah, sondern die Bezüge der Eigenschaften des Modells zu denen der dargestellten wirklichen Sachverhalte müssen erklärt werden, so wie man bei der Bevölkerungspyramide erklären mußte, was die männliche und die weibliche Bevölkerung sein soll und welche Balken die einzelnen Jahrgänge darstellen. Man kann das auch alles ganz anders machen. Solche semantischen Regeln sind konventionell. In diesem Sinne sind die Vorstellungen der inneren Anschauung etwas anderes als antizipierte sinnliche Eindrücke im Sinne von Helmholtz. Wir können nun beim Denken in Modellen genau so wie beim Denken in Bildern verschieden differenzierte Sprachen konstruieren, die auf einem solchen Denken aufbauen, indem wir logische Junktoren und Quantoren einführen. C. Das symbolische Denken Durch die größere Bedeutung von semantischen Regeln zu ihrem Verständnis kommen die indirekt anschaulichen Vorstellungen sprachlichen Symbolen schon wesentlich näher als die direkt anschaulichen. Sprachliche Zeichen, Laute oder Buchstaben sind in ihrer Handhabung noch wesentlich variabler als die Bilder der indirekten Anschauung. Es soll hier nicht versucht werden, genau zu sagen, worin sie sich überhaupt von derartigen Bildern unterscheiden. Für unsere Zwecke war die Angabe von Beispielen ausreichend, um zu sagen, was wir meinen. Damit sind die drei Arten der Repräsentation vorgeführt und es bleibt nun unsere Aufgabe, die Rolle zu verstehen, die sie in der Geschichte der Wissenschaft und Philosophie gespielt haben. §4. Drei Epochen der Entwicklung des Denkens. A. Das Stadium des direkt anschaulichen Denkideals Denken in Bildern kann viele unserer Probleme lösen, welche von der gleichen Art sind wie die eines Schimpansen, der auf eine Kiste klettert, um eine an der Käfigdecke hängende Banane herunterzuschlagen, wie das von W. Köhler beobachtet worden ist (Köhler, 1963, S. 28-33). Aber selbst Menschen auf der primitivsten Kulturstufe sprechen eine Sprache mit einer komplizierten Grammatik, in der Konjunktionen, Pronomina, Zahlen, logische Quantoren (oder etwas dazu Äquivalentes) und andere Ausdrücke vorkommen, für die es in einer Bildersprache nichts Entsprechendes gibt. Wenn wir daher eine Epoche oder ein Stadium direkt anschaulichen Denkens konstruieren wollen, so kann es sich hier nicht mehr um das Denken der Affen handeln, sondern nur um ein Denken in der vollen Komplexität der natürlichen Sprachen der Menschheit. Wir können uns aber ein Denken vor Augen führen, bei dem singuläre Sachverhalte in Bildern darstellbar sind, so daß jeder Sachverhalt auf derartige Bilder bezogen bleibt. Wir können, wie bereits in §3C ausgeführt wurde, dieses verallgemeinernde direkt anschauliche Denken auch "Denken in der Beobachtungssprache" nennen, wenn wir einen modernen Ausdruck verwenden wollen. feststellbar. Dennoch ist bei Aristoteles eine starke Tendenz spürbar, Erklärungen durch beobachtbare Phänomene solchen durch verborgene Vorgänge vorzuziehen. Nun kann das Denkideal hinter dem Denkstil zurückbleiben, denn in der Selbstreflexion durchschaut sich der Mensch meist nur teilweise. So haben geistige Bilder stets eine gewisse Faszination auf die Philosophen ausgeübt und das Denken in Bildern bekam leicht einen paradigmatischen Charakter, konnte leicht zum Vorbild des Denkens überhaupt werden. Dennoch ist es eher unwahrscheinlich, daß jemals ernstzunehmende Philosophen nicht gesehen haben, daß das menschliche Denken viel komplexer ist als reines Bilddenken. Aber ob wir nun bei Aristoteles Denken in Bildern finden oder nicht, so argumentiert doch mindestens Galilei in seiner Auseinandersetzung mit den Aristotelikern gegen eine naive Auffassung, für die Geschwindigkeit etwas Beobachtbares sein muß. Er setzt sich mit dem verallgemeinernden direkt anschaulichen Denken im Begreifen der physikalischen Welt intensiv auseinander. Manches wird einfacher, wenn wir nicht den Menschen sondern die Natur betrachten. Viele unanschauliche Begriffe wie Wille, Seele, Staat, Gott, können wir beiseite lassen. Der Zustand der Welt läßt sich noch am ehesten anschaulich erfassen. Galilei befaßte sich besonders mit dem Geschwindigkeitsbegriff. Wenn singuläre Sachverhalte anschaulich erfaßbar sind, so muß auch wahrnehmbar sein, ob ein Körper sich bewegt oder ruht. Wir erlernen die Ausdrücke "sich bewegen" und "ruhen" anhand typischer Situationen. Eine sausende Schlittenfahrt oder ein schneller Galopp auf einem Pferd waren damals typische Situationen schneller Bewegung. Heute dürfen wir vielleicht das Pferd durch ein Motorrad ersetzen. Was sind die typischen Merkmale, die schnelle Bewegung auszeichnen, die also als Wesensmerkmale der Bewegung mit dem Wort erlernt werden? Ein sausender Wind, das Durchgeschüttelt-Werden, Lärm wie Pferdegetrappel und Motorradgeknatter. Charakteristisch für die natürliche Interpretation von "ruhend" und "bewegt" ist die Bemerkung eines preußischen Höflings, der, als er von Kopernikus' Theorie erfuhr, zu einem Diener sagte, der ihm den Falerner eingoß: "Paß auf, daß du die Flasche nicht verschüttest." Diese Geschichte wird von einem zeitgenössischen Gegner des Kopernikus durchaus zustimmend referiert. Bezeichnenderweise ist "Ruhe" sowohl das Wort für "Unbewegt-Sein" wie für "Stille". Unbewegt-Sein bedeutet also seinem Wesen nach auch Abwesenheit von Lärm. Mit diesen Begriffen von Bewegung und Ruhe gerät das kopernikanische Weltbild in Konflikt. Die Hartnäckigkeit, mit der im 16. Jahrhundert die Mehrzahl aller Gelehrten noch am ptolemäischen Weltbild festgehalten hat, erklärt sich unter anderem daraus, daß der Geschwindigkeitsbegriff des Kopernikus für das Ideal des verallgemeinernden direkt anschaulichen Denkens nicht zu fassen ist. Galilei verwendet daher auch in dem Dialog über die beiden Weltsysteme die ganze Kunstfertigkeit seiner Dialektik, um zu zeigen, daß man sich in Widersprüche verwickelt, wenn man am direkt anschaulichen Geschwindigkeitsbegriff festhält. Nur relative Geschwindigkeiten sind wahrnehmbar und in der direkten Anschauung vorstellbar. Galilei zeigt in einem Gedankenexperiment, daß in der geschlossenen Kajüte eines Man wird daher nun fragen, ob das Denken in Bildern bzw. in der Beobachtungssprache überhaupt jemals in der Wissenschaftsgeschichte eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, daß die naive Alltagsphysik zu allen Zeiten von dieser Art von Denken mindestens stark geprägt war. Selbst heutzutage neigen ja Schüler immer noch dazu, so zu denken. Aber es ist schwierig, von irgendeinem Wissenschaftler oder Philosophen der Vergangenheit zu sagen, er habe gemeint, der Mensch denke in Bildern. Wahrscheinlich hat der als nächster zu schildernde Denkstil der verallgemeinernden indirekten Anschauung bereits frühzeitig eine Rolle gespielt. Das Naturbild von Demokrit oder von Plato macht davon ausgiebigen Gebrauch. Man wird aber vielleicht Aristoteles einen besonderen Hang zum verallgemeinernden direkt anschaulichen Denkstil nachsagen können. Bei Aristoteles ist die Natur weitgehend so, wie sie uns erscheint. Was aus Erde ist, fällt nach unten, was aus Feuer ist, steigt nach oben, die Sterne umkreisen die Erdkugel. So sehen wir die Welt, und so ist sie auch. Unser Wissen gewinnen wir aus einer Verallgemeinerung unserer Wahrnehmungen. Die Versuchung liegt nahe, in Aristoteles den Wissenschaftler zu sehen, der alles in einer Beobachtungssprache formulieren wollte und damit ein Anhänger des Denkens in Bildern ist. Bei näherem Hinsehen entdeckt man aber auch bei Aristoteles Erklärungen von Naturphänomenen durch unbeobachtbare Vorgänge, was nach unserer Definition von direkter Anschauung kein direkt anschauliches Denken oder Denken in Bildern mehr sein kann. So erklärt er den Wurf eines Steines durch einen unsichtbaren Luftwirbel, der von dem Werfenden angestoßen wird und den Stein dann weitertreibt. Auch die Liebe der Planeten zum "ersten Beweger", der sie dazu treibt, auf ihren Bahnen immer weiterzulaufen, ist nicht direkt beobachtbar, und vielleicht niemals für menschliche Wesen Wie weit man damit kommt, wenn man die aristotelische Physik als ein Produkt des direkt anschaulichen Denkideals darstellen will, kann ich im Augenblick noch nicht sagen. Auch wenn das überhaupt grundsätzlich möglich ist, so hat er doch gegen dieses Ideal mehrfach verstoßen. Ganz sicherlich ist der methodologische Metadiskurs, die Rede von den vier Ursachen (causa efficiens, causa finalis, causa formalis und causa substantialis) noch nicht einmal im indirekt anschaulichen Denken, sondern nur im symbolischen Denken vollziehbar. sanft auf dem Wasser dahingleitenden Schiffes die Bewegung desselben an physikalischen Vorgängen innerhalb der Kajüte nicht feststellbar ist: "Schließt Euch in Gesellschaft eines Freundes in einen möglichst großen Raum unter dem Deck eines großen Schiffes ein. Verschafft Euch dort Mücken, Schmetterlinge und ähnliches fliegendes Getier; sorgt auch für ein Gefäß mit Wasser und kleinen Fischen darin; hängt ferner oben einen kleinen Eimer auf, welcher tropfenweise Wasser in ein zweites enghalsiges darunter gestelltes Gefäß träufeln läßt. Beobachtet nun sorgfältig, solange das Schiff stille steht, wie die fliegenden Tierchen mit der nämlichen Geschwindigkeit nach allen Seiten des Zimmers fliegen. Man wird sehen, wie die Fische ohne irgendwelchen Unterschied nach allen Richtungen schwimmen; die fallenden Tropfen werden alle in das untergestellte Gefäß fließen. Wenn Ihr Eurem Gefährten einen Gegenstand zuwerft, so braucht Ihr nicht kräftiger nach der einen als nach der anderen Richtung zu werfen, vorausgesetzt, daß es sich um gleiche Entfernungen handelt. Wenn Ihr, wie man sagt, mit gleichen Füßen einen Sprung macht, werdet Ihr nach jeder Richtung hin gleich weit gelangen. Die Ursache dieser Übereinstimmung aller Erscheinungen liegt darin, daß die Bewegung des Schiffes allen darin enthaltenen Dingen, auch der Luft, gemeinsam zukommt." (Galilei 1891, S. 197) Galilei weiß auch bereits, daß er als Kopernikaner die Grenzen des direkt anschaulich Faßbaren überschreiten muß, stellt die Vernunft den Sinnen gegenüber: er bewundert, "wie bei Aristarch und Kopernikus die Vernunft in dem Maße die Sinne hat überwinden können, daß ihnen zum Trotz die Vernunft über ihre Leichtgläubigkeit triumphiert hat." (Galilei 1891, S. 342) Hier besteht offenbar für Galilei ein Gegensatz zwischen dem Vernünftigen und der Erscheinung. Damit hat er in der Nachfolge Platos die Schranken des direkt anschaulichen Denkens durchbrochen. Bei Galilei vollzieht sich die Revolution der Ablösung des verallgemeinernden direkt anschaulichen Denkideals durch ein neues Denkideal, das verallgemeinernde indirekt anschauliche. Dieses müssen wir uns als nächsten vor Augen führen. ganen haben. Daher würden alle diese Eigenschaften beseitigt und vernichtet, wenn das Lebewesen ausgerottet würde. Töne werden somit in uns erzeugt und gehört - ohne daß es weiterer "tönender" oder "klangdurchlässiger" Eigenschaften bedürfte -, wenn ein schnelles Erzittern der Luft, die in kleinsten Wellen sich kräuselt, einen bestimmten Knorpel am Trommelfell in unserem Ohr bewegt." (Galilei 1966, S. 45, 47; Galilei, 1890-1909, Bd. 4, S. 333ff.)1 Galilei stellt sich offenbar die Welt ganz anders vor, als sie erscheint. Er denkt sich Atome im Raum vorhanden, welche Bewegungen ausführen, alle übrigen Erscheinungen der Materie, wie Gerüche, Klänge, Farben, lassen sich durch ihre Wirkung auf den menschlichen Organismus erklären, deuten aber nicht auf entsprechende Eigenschaften der Materie hin. Das Bild, welches er sich von der wahren Welt macht, ist eines der indirekten Anschauung, keine Antizipation möglicher Wahrnehmungen im Sinne von Helmholtz, sondern offenbar etwas, dessen Zusammenhang mit den möglichen Wahrnehmungen wesentlich komplizierter ist. Die heutigen Physiker würden sagen, Galilei denkt in anschaulichen Modellen. Ein anschauliches Modell - im Sinne des Physikers, nicht im Sinne des Mathematikers, der etwas ganz anderes unter "Modell" versteht -, muß durch semantische Regeln auf die Wirklichkeit bezogen werden. So besagt beim elektrischen Feldlinienmodell eine Regel, daß die Feldliniendichte der auf eine Probeladung wirkenden Kraft proportional ist und die Richtung der Feldlinien der Richtung dieser Kraft. Galileis Modell ist ein mechanisches; damit beginnt das Zeitalter der mechanischen Erklärungen, die bekanntlich bei vielen Phänomenen sehr erfolgreich waren, aber insbesondere in der Wärmelehre und schließlich in der Elektrodynamik gescheitert sind, als man nach Michelson und Einstein die Aussichtslosigkeit einer Theorie des Lichtäthers einsehen mußte. Die Eigenschaften der Materie, welche im Modell auftreten, nennt Locke etwas später als Galilei primäre Qualitäten und die Eigenschaften, welche als Wirkungen auf den Menschen erklärt werden, sekundäre Qualitäten. B Das Stadium des indirekt anschaulichen Denkideals Was setzt nun Galilei an die Stelle des direkt anschaulichen Denkens der physikalischen Welt, wenn er "mit der Vernunft die Sinne überwindet"? Er schreibt in il saggiatore (der Goldwäger): "Deshalb sage ich, daß ich mich, sobald ich mir einen Teil der Materie also eine körperliche Substanz - vorstelle, von der Notwendigkeit bedrängt fühle, mir zugleich vorzustellen, daß sie (räumlich) begrenzt und nach dieser oder jener Gestalt gebildet ist, daß sie im Vergleich zu anderen (Körpern) groß oder klein ist, daß sie an diesem oder jenem Ort, zu dieser oder jener Zeit existiert, daß sie sich bewegt oder stille steht, daß sie einen anderen Körper berührt oder nicht berührt, daß sie eine, wenig oder viel ist; und durch keine Vorstellung kann ich sie von diesen Bedingungen trennen. Aber ich fühle mich nicht im Geiste gezwungen, als ihre notwendigen Begleitumstände anzusehen, daß sie weiß oder rot, bitter oder süß, tönend oder stumm, von angenehmem oder unangenehmem Duft sein muß. ... Aus diesem Grund denke ich, daß diese Geschmäcke, Gerüche, Farben und so weiter nichts anderes als bloße Namen sind, soweit sie den Gegenstand betreffen, dem sie innezuwohnen scheinen, und daß sie ihren Sitz nur in den Sinnesor- Wäre sich Galilei der Tatsache bewußt gewesen, daß er nur mit einem anschaulichen mechanischen Modell operiert, so wäre die zitierte Stelle schlechthin als ein Fortschritt der Erkenntnis zu begrüßen. Man hatte gesehen, daß der direkt anschauliche Denkstil die Probleme der Physik nicht bewältigen kann; bereits in der Astronomie hatte er versagt, und in der irdischen Physik war man gezwungen, sozusagen hinter den Phänomenen eine unsichtbare mikroskopische Welt zur Erklärung von Wärme, Schall und Gerüchen zu postulieren. Das Fernrohr und später das Mikroskop zeigten dem Menschen ja auch, daß es vieles gibt, was dem unbewaffneten Auge unzugänglich ist. So war der Schritt vom verallgemeinernden direkt anschaulichen zum verallgemeinernden indirekt anschaulichen Denken unumgänglich geworden und das ganze mechanistische Zeitalter wird so die Epoche des indirekt anschaulichen Denkens. 1) Die Übersetzung ins Deutsche besorgte dankenswerterweise Herr Prof. W. Büttemeyer. Soweit wäre alles ein reiner Fortschritt gewesen; nur erkannten Galilei und seine Nachfolger nicht, daß sie es nur mit Modellen zu tun hatten. Für sie war ihr Bild der physikalischen Welt das einzig wahre Bild der objektiven Welt, für viele Philosophen die Welt, so wie sie dem Auge Gottes erscheint. Sie vertraten die Abbildtheorie der Erkenntnis, bzw. der Wahrheit, wonach wahre Erkenntnis über die Dinge der Welt so etwas wie ein wahres Bild derselben enthält. Veritas est adaequatio rei et intellectus (siehe auch obiges Kant-Zitat in § 2). Hätten sie erkannt, daß sie es mit Modellen bzw. Analogiezeichen zu tun hatten, bei denen es auch Synonyme geben kann, verschiedene Zeichen, die das Gleiche darstellen, wäre vielleicht manches einfacher gewesen. Aber mit der Abbildtheorie gerieten Wissenschaftler und Philosophen in ein Dickicht metaphysischer Probleme hinein, aus denen es kein Entrinnen gab, solange man nicht bereit war, zu sehen, was man eigentlich tat. Wir müssen, um die Situation der Wissenschaft nach Galilei zu begreifen, etwas allgemeiner werden und uns das Denkideal und die Theorie des Denkens von Descartes und Locke ansehen, die für die Philosophie zweier Jahrhunderte bestimmend waren. Bei Descartes erhält das Wort "idée", engl. "idea", deutsch meist mit "Vorstellung" übersetzt, seine bis Mitte des 19. Jahrhunderts maßgebliche Bedeutung. Eine Vorstellung ist jeglicher Inhalt des Bewußtseins, alles, was darin entweder real oder in der Phantasie auftreten kann. Ursprünglich ist mit "idée" an so etwas wie ein Bild gedacht, mit dem wir denken, so wie der Rhesusaffe vielleicht ein Bild einer Banane vor Augen hatte. Derartigen Bilder sind Prototypen von Vorstellungen (idées), aber keineswegs sind alle Vorstellungen (idées) solche geistigen Bilder. Das gilt z.B. für die Vorstellungen von Gott, einer menschlichen Seele, der abstrakten Begriffe wie der des Baumes, für die des Tausendecks, das wir von unserem geistigen Auge höchstens durchwandern können, das aber nie als Ganzes vorgestellt werden kann. Es gilt ferner für die Vorstellungen der Bejahung und Verneinung, des Zweckes, der Ursache usw. usw. Man sah sehr schnell, wie wir scheitern, wenn wir uns unter Vorstellungen nur geistige Bilder denken. Die von Descartes stark beeinflußte Logik von Port Royal, die in Frankreich und England sehr einflußreich war (Arnauld, 1972) nennt gleich im ersten Kapitel all die Vorstellungen (idées), die nicht Reproduktionen von etwas Wahrgenommenen sind. Nach Descartes, der Logik von Port Royal und Locke und fast allen anderen Philosophen der damaligen Zeit vollzog sich aber Denken in solchen Vorstellungen, die nicht mit Wörtern der Sprache verwechselt werden dürfen. Wörter und Sprache werden dann nur noch gebraucht, um anderen Personen die eigenen Gedanken mitzuteilen. Solange also noch Beobachtungs- und Modellsprachen als der Normaltyp der Sprache in der Naturwissenschaft galten, entstand so die Illusion, das Denken sei etwas von der Sprache Unabhängiges. Die "Vorstellung" wurde zwischen das Wort und die vom Wort bezeichnete Sache eingeschaltet. Das geschah bereits bei Aristoteles, wenn er sagte: "Es sind also die Laute, zu denen die Stimme gebildet wird, Zeichen der in der Seele hervorgerufenen Vorstellungen, und die Schriftzeichen sind wieder Zeichen der Laute" (de interpretatione 15b-16a). Begriffe galten dann als Vorstellungen besonderer Art. Die Vorstellungen von bestimmten Einzeldingen oder individuellen Situationen wurden direkt mit Bildern oder so etwas Ähnlichem identifiziert. Kant sprach hier von "Anschauungen". Die Allgemeinbegriffe dachte man sich durch einen besonderen psychischen Vorgang aus diesen Anschauungen gewonnen. Auch Kant vertrat diese damals orthodoxe Abstraktionstheorie, wonach beispielsweise der Allgemeinbegriff des Baumes als eine Art Zusammenfassung der Bilder einzelner Bäume, Buchen, Eichen, Birken, Tannen in verschiedensten Zuständen gebildet wird. So hat sich Kant die Entstehung eines Allgemeinbegriffs vorgestellt. (Kant 1800, S. 146): "Ich sehe z. B. eine Fichte, eine Weide und eine Linde. Indem ich diese Gegenstände zuvörderst unter einander vergleiche, bemerke ich, daß sie von einander verschieden sind in Ansehung des Stammes, der Äste, der Blätter u. dgl. m.; nun reflektiere ich aber hiernächst nur auf das, was sie unter sich gemein haben, den Stamm, die Äste, die Blätter selbst und abstrahiere von der Größe, der Figur derselben usw.; so bekomme ich einen Begriff vom Baume." Diese Begriffe dachte man sich also als unabhängig von den sprachlichen Zeichen in der menschlichen Seele vorhanden. Damit wird dann das Denken ein sprachfreies Operieren mit Vorstellungen. Es kommt zu einer Theorie der Sprache, wonach diese erst erforderlich ist, wenn Gedanken anderen Menschen mitgeteilt werden müssen, nicht jedoch, um sie überhaupt im Bewußtsein zu haben. Die Sprache ist damit das Telefon, mit dem die verschiedenen Seelen kommunizieren. Ich möchte diese Theorie die "Telefontheorie der Sprache" nennen. (In der Literatur gibt es bereits den Ausdruck "transmitter theory of language" den ich nicht so plastisch finde, wie den eben vor mir vorgeschlagenen.) Wir finden sie deutlich ausformuliert bei J. Locke: "Wenn jemand auch eine Fülle verschiedener Gedanken hegt, Gedanken, die anderen ebensogut Nutzen und Vergnügen bringen könnten wie ihm selbst, so sind sie doch alle in seiner Brust verschlossen, für andere unsichtbar verborgen; sie können auch nicht durch sich selbst kundgegeben werden. Da nun aber die Annehmlichkeiten und Vorteile der Gemeinschaft ohne eine Mitteilung der Gedanken nicht zu erreichen sind, so mußte der Mensch notwendig gewisse äußere, sinnlich wahrnehmbare Zeichen finden, mit deren Hilfe jene unsichtbaren Ideen, die seine Gedankenwelt ausmachen, andern mitgeteilt werden könnten." (Locke, 1981, Buch 3, Kap. 2, §1) Ähnlich hatte sich bereits Hobbes geäußert (siehe Hacking, 1984, S. 21f.). Die Telefontheoretiker, für die Begriffe etwas Mentales sind (etwas im "mind", wie die Engländer sagen, was mit "Geist" nur unvollkommen übersetzt wird, im "Gemüt" wie Kant dafür sagt), werden übrigens oft in der Literatur als Mentalisten bezeichnet. Der Mentalismus erscheint uns heute als fremd, nachdem wir uns so sehr an die analytische Philosophie gewöhnt haben. Wie soll sich ein Denken ohne Wörter abspielen, wenn es nicht eines in Bildern oder Modellen ist? Aber wir sagen vielleicht auch gelegentlich: "Ich habe nicht Kurt sondern Karl gemeint; ich habe mich versprochen." Was ist es dann, was man auch dann meinen kann, wenn man das falsche Wort verwendet? Nun, so hätten Descartes und viele nach ihm gesagt, ich hätte hier die Vorstellung von Karl vor Augen gehabt, aber "Kurt" gesagt. Irgendwie muß es deshalb ein Meinen geben, das ein psychischer Sachverhalt ist. Es gibt nicht nur Bedeutungsbeziehungen zwischen objektiv vorhandenen Zeichen und Dingen in der Welt. Die analytische Philosophie tendiert dazu, das zu übersehen. Wir können bei hinreichendem Wohlwollen auch folgendes nachvollziehen: Wörter sind etwas Zufälliges. Wörter zur selben Vorstellung sind meist bei unterschiedlichen Sprachen verschieden. Daher können Wörter nach Meinung der damaligen Philosophen für das Denken sogar störend sein. Durch Wörter können Menschen getäuscht oder verführt werden. Die Rhetorik lehrt uns, wie man das macht. Wir sollten daher besser beim Denken nur auf die Vorstellungen achten und die Wörter beiseite lassen. Noch Goethe läßt im Faust Mephisto einen "Schüler" auf den Arm nehmen: "Mephistopheles: Im ganzen - haltet Euch an Worte! Dann geht Ihr durch die sichre Pforte Zum Tempel der Gewißheit ein. Schüler: Doch ein Begriff muß bei dem Worte sein. Mephistopheles: Schon gut! Nur muß man sich nicht allzu ängstlich quälen; Denn eben wo Begriffe fehlen, Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten läßt sich trefflich streiten, Mit Worten ein System bereiten, An Worte läßt sich trefflich glauben, Von einem Wort kein Jota rauben." Sieht man nicht genau hin, so kann man diese Stelle auch im Sinne der analytischen Philosophie als ein Plädoyer für die ausschließliche Verwendung bedeutungsvoller Wörter ansehen. Dann wäre "Begriff" als "Bedeutung eines Worts" (in einem modernen Sinn) zu lesen. Aber das wäre eine der damaligen Zeit nicht angemessene Interpretation. Begriffe sind nach damaliger Auffassung Vorstellungen besonderer Art, und Goethe plädiert hier einfach dafür, daß Wörter mit entsprechenden Vorstellungen verbunden sind und sagt, daß es auf diese Vorstellungen ankommt. Die analytischen Philosophen halten das aber nicht für ausreichend. Vorstellungen können auch "begleitende Vorstellungen" sein, die zur eigentlichen Bedeutung eines Wortes nichts beitragen (Carnap 1928, §8). Vielleicht können wir an Goethes ironischer Empfehlung der Worte durch den Teufel den Appeal verspüren, den die Empfehlung, mit Begriffen statt mit Worten zu denken in der damaligen Zeit haben mußte. Worte hatten die Scholastiker des Mittelalters viele gemacht. Die Neuzeit war dazu aufgerufen, das im Auge zu behalten, was den Kern des Denkens ausmacht, die Vorstellungen, und darunter vor allem die Begriffe. Wir fragen bereits, wenn wir Descartes lesen, was er sich unter einer Vorstellung (idée, idea) vorgestellt haben mag, wenn es sich dabei nicht um etwas Bildhaftes handelte. Die Frage, wie die Vorstellungen vor unserem Bewußtsein erscheinen, spielte dann auch in den folgenden zwei Jahrhunderten eine zentrale Rolle in der Philosophie. Berühmt ist Berkeleys Kritik der Vorstellungen abstrakter Begriffe, z.B. des Dreiecks im allgemeinen. Berkeley leugnete die Existenz solcher abstrakter Vorstellungen. Aber auch Kants transzendentale Analytik ist weitgehend eine Theorie der Vorstellungen und speziell der Begriffe und ohne den cartesischen Hintergrund gar nicht zu verstehen. So sind die Probleme, in welche die Theorie vom sprachlosen Denken hineingerät, beträchtlich. Die Situation wird aber wesentlich einfacher, wenn nur von der Naturbeschreibung die Rede ist. Dazu reicht eine recht eingeschränkte Sprache aus. Zwecke, die menschliche Seele, Gott usw. spielen hier keine Rolle. Wir können sehr wohl an eine Naturbeschreibung denken, in der der Zustand der Natur völlig durch Bilder oder Modelle beschrieben wird, also im Geist durch Vorstellungen (idées) im ursprünglichen Sinne. Das war auch ganz die Auffassung der beiden Jahrhunderte nach Descartes. Dabei galt es als ausgemacht, daß Farben, Gerüche usw. in dieser Beschreibung nicht vorkommen. Descartes und seine Nachfolger pflichteten Galilei hierin bei. Es blieb die Beschreibung in geometrischen Termini, ja die ganze Welt wurde als Bewegungsvorgang vieler geometrisch in ihrer Form definierter Körper aufgefaßt. Die Grammatik dieser Modellbeschreibung ist die euklidische Geometrie, ohne die wir diese Welt nicht denken können. Aber, auch wenn es vor der Neuzeit solche Modelle gegeben hat, erhalten sie doch durch Descartes erst ihre erkenntnistheoretisch beherrschende Rolle in der Naturwissenschaft. Descartes hatte ein Programm für diese Wissenschaft formuliert, wonach alle Naturvorgänge durch indirekt anschauliche Modelle zu erklären sind. Gegen Ende seiner Prinzipien (Descartes, 1922, §IV, 203) sagt er: "Wenn ich den unsichtbaren Körperteilchen eine bestimmte Gestalt, Größe und Bewegung zuteile, als wenn ich sie gesehen hätte, und dennoch anerkenne, daß sie nicht wahrnehmbar sind, so wird man vielleicht die Frage erheben, woher ich denn diese Eigenschaften kenne. Ich antworte darauf, daß ich zunächst ganz allgemein alle die klaren und deutlichen Begriffe betrachtet habe, die in unserem Verstande betreffs der materiellen Dinge vorhanden sein können, und daß ich, da ich keine anderen gefunden habe, als die der Gestalten, der Größen und der Bewegungen und Regeln, gemäß denen diese drei Dinge durch einander verändert werden können, welche Regeln die Prinzipien der Geometrie und der Mechanik sind, den Schluß gezogen habe, daß notwendig alle Erkenntnis, die wir von der Natur haben können, allein daraus gezogen werden kann, weil alle anderen Begriffe, die wir von den sinnlichen Dingen haben, da sie verworren und dunkel sind, uns nicht dazu dienen können, uns die Erkenntnis irgend einer Sache außer uns zu geben, vielmehr eine solche nur zu hindern vermögen. ... So wie nun die, welche in der Betrachtung der Automaten geübt sind, aus dem Gebrauche einer Maschine und einzelner ihrer Teile, die sie kennen, leicht abnehmen, wie die anderen Teile, die sie nicht sehen, gemacht sind, so habe ich versucht, aus den sichtbaren Wirkungen und Teilen der Naturkörper zu ermitteln, wie ihre Ursachen und unsichtbaren Teilchen beschaffen sind." Die Unmöglichkeit der direkten Einlösung der indirekt anschaulichen Modelle durch Wahrnehmung hat zur Folge, daß wir nicht entscheiden können, welches von zwei empirisch äquivalenten Modellen das wahre ist. Descartes sagt dazu (Descartes, 1922, Teil IV, §204): "So wie man auch vielleicht auf diese Weise erkennt, wie alle Naturkörper haben entstehen können, so darf man daraus doch nicht folgern, daß sie wirklich so gemacht sind. Denn derselbe Künstler kann zwei Uhren fertigen, die beide die Stunden gleich gut anzeigen und äußerlich ganz sich gleichen, aber innerlich doch aus sehr verschiedenen Verbindungen der Räder bestehen, und so hat unzweifelhaft auch der höchste Werkmeister, Gott, alles Sichtbare auf mehrere verschiedene Arten hervorbringen können, ohne daß es dem menschlichen Geist möglich wäre, zu erkennen, welches der ihm zur Verfügung stehenden Mittel er hat anwenden wollen, um sie zu schaffen. Ich gebe diese Wahrheit bereitwilligst zu, und ich bin zufrieden, wenn die von mir erklärten Ursachen derart sind, daß alle Wirkungen, die sie hervorzubringen vermögen, denen gleich sind, die wir in den Erscheinungen bemerken, ohne daß ich mir deshalb den Kopf zerbreche, ob diese auf diese oder eine andere Weise hervorgerufen sind. Dies wird auch für die Zwecke des Lebens genügen, weil sowohl die Medizin und Mechanik, wie alle anderen Künste, welche der Hilfe der Physik bedürfen, nur das Sichtbare und deshalb zu den Naturerscheinungen Gehörige zu ihrem Ziele haben." Da Descartes noch in der Abbildtheorie der Erkenntnis verhaftet war, war für ihn eines von zwei äquivalenten Modellen stets das wahre, wiewohl es für praktische Zwecke gleichgültig ist, welches von beiden wir für wahr halten. Von hier führt erst der nächste Schritt im 19. Jahrhundert zu der Erkenntnis, daß es eigentlich keinen Sinn hat, ein Modell einem empirisch äquivalenten vorzuziehen. Descartes vollzieht diesen Schritt noch nicht. Im anschließenden Paragraphen äußert er sich wieder etwas optimistischer über die Erkennbarkeit des wahren unter den empirisch äquivalenten Modellen (§205). Auf Grund von Einfachheitsüberlegungen glaubt er zu einer "moralischen Gewißheit", d.h. in unserer Sprache wohl soviel wie "praktische Gewißheit", über die wahre Beschreibung der Welt zu gelangen. Von zwei empirisch äquivalenten Modellen reden beide über dieselbe Wirklichkeit, der wir - wie später H. v. Helmholtz erkannte - wo sie nicht mehr direkt wahrnehmbar ist, eigentlich überhaupt keine anschaulichen Eigenschaften zuschreiben dürfen. Wir dürfen uns so z. B. Atome nicht als bunte Kugeln vorstellen wie in einem Molekülmodell der Chemiker aus Holz oder Kunststoff. Aber gerade dies haben ja Galilei, Descartes und die Naturwissenschaftler der folgenden Jahrhunderte versucht. Sie ließen zwar Farben, Gerüche, Klänge in ihren Modellen fort, die geometrischen Gestalten der Dinge jedoch behielten sie bei. Wir können daher mit gutem Recht die Zeit von Galilei und Descartes bis ins 19. Jahrhundert als die Epoche der Denkens in Modellen ansehen, nicht weil es Analogzeichen, bzw. Modelle vorher nicht gegeben hätte, sondern weil diese in dieser Zeit eine methodisch bevorzugte Rolle spielen und das Ideal der Erklärung definieren, allerdings verbunden mit dem Anspruch, daß sie die wahre Wirklichkeit abbilden, so wie Gott sie sieht. Das Zeitalter von Galilei bis ins 19. Jahrhundert bevorzugt also die indirekt anschauliche Vergegenwärtigung durch Modelle. Dieser Vergegenwärtigungstyp definiert vor allem das damalige Ideal einer theoretischen Erklärung. Schwierigkeiten bereiteten dabei die Begriffe der Masse und der Kraft, und natürlich auch die aus den neuen Teilgebieten der Physik, wie Wärmelehre und Elektrizitätslehre. Werfen wir hier kurz einen Blick auf den Massenbegriff, um zu zeigen, von welcher Art diese Schwierigkeiten waren. Was unterscheidet (mit geistigem Auge gesehen) einen sehr dichten Körper (mit großem spezifischen Gewicht) von einem weniger dichten? Bezeichnenderweise nannte man die Masse "quantitas materiae". Man konnte sich den weniger dichten Körper vielleicht porös vorstellen oder aus Atomen mit großen Zwischenabständen bestehend, während beim dichteren Körper kleinere oder gar keine Poren auftreten oder die Atome dichter gepackt sind. Newton hat möglicherweise so gedacht: "Eine doppelt so dichte Luft im doppelten Raum ist von vierfacher Größe; dasselbe gilt von Schnee oder Staub, welche durch Flüssigwerden oder Druck verdichtet werden. Dasselbe findet auch bei allen Körpern statt, die durch irgendwelche Ursachen auf verschiedene Weise verdichtet werden. Auf das Mittel, welches die Zwischenräume der Teile frei durchdringen kann, nehme ich hier keine Rücksicht." (Newton 1872, S. 21) Noch Mach diskutierte kritisch die Schwierigkeit, die Newton beim Denken der Masse haben mußte: Wir "erkennen .. in der 'Menge der Materie' keine Vorstellung, welche geeignet wäre, den Begriff der Masse zu erklären und zu erläutern, da sie selbst keine genügende Klarheit hat. Dies gilt auch dann, wenn wir, wie es manche Autoren getan haben, bis auf die Zählung der hypothetischen Atome zurückgehen. Wir häufen hiermit nur Vorstellungen, welche selbst einer Rechtfertigung bedürfen." (Mach 1933, S. 210f.) Ich will diese Problematik hier nicht weiter verfolgen. Sie zeigt indessen, von welchen Voraussetzungen her man an die Sache heranging. Die Natur zu begreifen, hieß in gewissem Sinne, ein geistiges Modell von ihr zu haben, sie in Analogzeichen darzustellen. Mit der Telefontheorie verbindet sich auch eine andere Auffassung von Wahrheit, als sie heute gebräuchlich ist. Statt von Aussagen sprachen die Mentalisten lieber von Urteilen. Ein Urteil ist eine Verknüpfung von Vorstellungen, z.B. das Urteil, daß alle Menschen sterblich sind, eine Verknüpfung der Vorstellung vom Menschen mit der von der Sterblichkeit. Wahrheit ist dann keine Beziehung einer Aussage zu irgendwelchen Dingen, also zwischen einem sprachlichen Gebilde und der Wirklichkeit, sondern zwischen den Dingen und einem Urteil, einer Verknüpfung von Vorstellungen. Nicht, was einer sagt, sondern was er denkt, ist primär wahr oder falsch. Wahrheit ist Übereinstimmung des Urteils mit den Fakten, "adaequatio rei et intellectus" wie Thomas von Aquin sich bereits ausdrückt. Mit der Telefontheorie nicht notwendig aber de facto meist verbunden ist die Auffassung, daß das Urteil die Bedeutung bzw. der Inhalt der Aussage und die Vorstellung die Bedeutung der Bezeichnung ist. Oben war schon gesagt worden, daß alle physikalischen Sätze der Beobachtungssprache sich durch Mengen von Bildern darstellen lassen, von denjenigen Bildern, die mit ihnen verträglich sind. Also ist auch der Sinn einer solchen Aussage durch eine Menge von Bildern ausdrückbar. Dementsprechend ist auch die Bedeutung eines Prädikats durch eine Menge von Bildern gegeben. Diese Menge von Bildern wäre dann gerade die Menge der Anschauungen, die nach der traditionellen Abstraktionstheorie einer Vorstellung entspricht man denke an die oben zitierte Entstehung des Begriffs vom Baume. Übertrage ich den so gewonnenen Bedeutungsbegriff jedoch auf Modellsprachen, so begehe ich einen Fehler, genau jenen Fehler, der von den Vertretern der Telefontheorie, die ja meist in Modellsprachen das Instrument der Naturerkenntnis sahen, in der Regel begangen wurde. Danach sind verschiedene Bilder auch im Sinn verschieden. Verschiedene Modelle beschreiben auch verschiedene Sachverhalte. Der ganze sinnlose Streit zwischen Idealismus und Realismus in ihren verschiedenen Spielarten war die Folge (siehe unten § 5A). Diese Epoche, allgemein gepriesen als das Zeitalter der klassischen europäischen Philosophie, war eine Zeit der erkenntnislogischen Verirrung, einfach weil man die indirekten Vorstellungen mit der Abbildtheorie verband. Wir werden weiter unten sehen, wie als Bilder der an sich seienden Wirklichkeit mißverstandene Analogzeichen zu dieser Verirrung führen konnten und wie im kritischen Realismus von Helmholtz und dem Konventionalismus von Poincaré sich dieser Irrtum schrittweise aufklärte (siehe § 5B und D). C Das Stadium des symbolischen Denkideals Ich fasse zusammen: Die Epoche des indirekt anschaulichen Denkens ist in ihrer Blütezeit geprägt durch vier Grundannahmen: 1. durch den Mentalismus, 2. durch die Telefontheorie der Sprache, 3. durch die Abbildtheorie der Erkenntnis bzw. Wahrheit 4. durch das Denken in Modellen (Analogiezeichen), wobei der konventionelle Zeichencharakter nicht hinreichend verstanden wurde. Die Telefontheorie der Sprache impliziert den Mentalismus. Man kann Mentalist sein, ohne die Telefontheorie zu vertreten, wenn man glaubt, Denken sei mindestens in den komplizierteren Formen ohne Sprache nicht möglich, aber die Bedeutungen der Wörter seien dennoch etwas Mentales, Geistiges. Die Abbildtheorie setzt das Denken in Bildern oder Modellen voraus, aber nicht umgekehrt. Die genannten vier Grundannahmen führten zu unlösbaren erkenntnistheoretischen Problemen. Insbesondere die Abbildtheorie der Erkenntnis führte die Philosophen in eine Sackgasse. Wenn wahre Erkenntnis der Welt darin besteht, daß wir ein zutreffendes Bild von der Wirklichkeit haben, wer soll uns dann Wahrheit über die Welt garantieren, wo doch die Reizungen unserer Sinnesorgane im Körper erst durch Nervenleitungen ans Gehirn weitergeleitet werden. Die Nerven sind aber aller gleich, ob es nun Schmerznerven, die beiden Sehnerven oder Gehörnerven sind. Im Gehirn sollen dann die Impulse so entschlüsselt werden, daß die jeweils richtigen qualitativen Eindrücke im Bewußtsein auftreten, Farben für das Gesehene, Töne für das Gehörte usw. So etwas könnte nur Gott garantieren, der den Menschen geschaffen hat. Daher benötigen auch Descartes und Leibniz Gott als Garanten der Erkenntnis. Nur Gott allein wird uns sagen können, ob Galilei mit der These recht hat, daß nur Raum, Zeit, Bewegung und geometrische Gestalt der Körper objektiv sind, denn er sieht alles unmittelbar ohne Vermittlung von Sinnesorganen und Nervensträngen. Verständlicherweise wurde dieser Rückgriff auf Gott nicht mehr akzeptiert, als man den theistischen Gottesbegriff aufgab und durch einen deistischen oder pantheistischen ersetzte. Es bleiben dann nur zwei Auswege, entweder eine naive Argumentation, bei der das Problem einfach nicht ernstgenommen wurde, oder der Idealismus, wonach wir von den Dingen entweder nichts wissen oder diese gar nicht existieren und wir nur in einer dem Subjekt, dem menschlichen Geist (engl. mind) entstammenden Welt leben. Der heutigen Naturwissenschaft reichen auch anschauliche Modelle nicht mehr aus, sie denkt nur noch mit sprachlichen Zeichen. Jeder Physikstudent muß lernen, Formeln zu verwenden, bei denen er sich nichts Anschauliches mehr vorstellen kann. Er benutzt Zeichen, die durch semantische Regeln mit der Wirklichkeit verknüpft werden, so daß man weiß, was in solchen Zeichen formulierte Aussagen bedeuten. Anschauliche Vorstellungen mögen dabei manchmal eine Hilfe sein, sind aber für die Bedeutung der Zeichen unwesentlich. In gewissem Sinne ist dieses symbolische Denken, das jedem heutigen Naturwissenschaftler selbstverständlich ist, auch nicht mehr an das menschliche Bewußtsein gebunden. Gedankliche Operationen können auch von Computern ausgeführt werden. Das ist möglich, weil es bei sprachlichen Symbolen nur auf deren Syntax und Semantik ankommt. Die Syntax kann einem Computer und die Semantik mit diesem verkoppelten Meßgeräten einprogrammiert werden. So ist die Epoche des symbolischen Denkideals auch zugleich das Zeitalter der Computer. Das symbolische Denkideal hat sich mit voller Kraft seit Beginn unseres Jahrhunderts in der Naturwissenschaft, der Technik und dem öffentlichen Leben weitgehend durchgesetzt. Nachdem Hertz und Poincaré den wichtigen Schritt zum symbolischen Denken bereits in der Metadiskussion vollzogen hatten, machte Einstein damit ernst in der physikalischen Theorie. Wenn Einstein forderte, die Gleichzeitigkeit zu definieren, so brachte er damit zum Ausdruck, daß "gleichzeitig" ein Zeichen ist, dem natürlich eine Bedeutung zugewiesen werden muß. Diese ergibt sich nicht von selbst aus einer anschaulichen Vorstellung der Gleichzeitigkeit. In der Mathematik liegt der Durchbruch zum neuen Denken etwa in der gleichen Zeit, vielleicht noch ein wenig früher. Jedenfalls hatte Frege bereits klar den symbolischen Charakter der mathematischen Erkenntnis betont und versucht, die Arithmetik als symbolische Theorie zu begründen. Es folgten wenig später Russell und Hilbert mit der logizistischen und der formalistischen Auffassung von der Mathematik. Im neunzehnten Jahrhundert bahnte sich die neue Erkenntnis aber schon an. Damit ist eine Theorie der Entwicklung des Denkens in ihren Grundzügen skizziert. Natürlich haben wir das Denken nur unter einem einzigen Aspekt betrachtet, unter dem der Reprä- sentation von Sachverhalten durch Bilder, Modelle (Analogzeichen) oder Symbole. Diese Theorie taugt aber nur dann etwas, wenn sie einleuchtende Erklärungen für sonst unerklärliche geistesgeschichtliche oder wissenschaftsgeschichtliche Phänomene liefert. Einige solcher Anwendungen wollen wir hier kurz vorführen. Und ich glaube, daß unsere Theorie damit ihre Feuerprobe besteht. der Wirklichkeit enthält oder wenigstens einige Aussagen über eine solches Abbild macht. Gibt man die Abbildtheorie auf, so wird durchaus fraglich, ob obige beide Skizzen sich in ihrem Gehalt unterscheiden. Das müßte zumindest gezeigt werden. Damit verliert dann auch die Argumentation ihre Überzeugungskraft. C. Helmholtz' Neubestimmung des anschaulichen Denkens2 §5. Anwendungen A. Der Streit zwischen Idealismus und Realismus Bekanntlich führte die von Galilei und dann später von Descartes, Locke und anderen behauptete Kluft zwischen der realen und der scheinbaren Welt zu jahrhundertelangen Disputen über die "Dinge an sich" bzw. die "Außenwelt" und schließlich zu den Thesen des Idealismus und des Realismus. Carnap vertrat in seinem Büchlein Scheinprobleme in der Philosophie (1928) die Auffassung, der Streit zwischen Idealisten und Realisten sei sinnlos. Wenn er recht hatte, wird man sich fragen, woher die Suggestion dieser Thesen kam. Irgendwie mußten sich diese Thesen im Geist der Philosophen unterscheiden. Irgend etwas mußte in ihren Vorstellungen dabei verschieden sein, wenn sie das eine Mal von der Existenz und das andere Mal von der Nichtexistenz der Außenwelt sprachen. Ich habe einmal in einer Vorlesung erlebt, wie ein alter Professor diesen Unterschied an der Tafel durch folgende Skizzen darstellte: Betrachten wir die beiden Skizzen, so sollten wir uns fragen, ob sie Bilder oder Modelle sind. Offenbar stellen sie nichts dar, was in dieser Weise wahrgenommen werden kann. Also sind es keine Bilder. Sind es Modelle, so wäre nach den semantischen Regeln zu fragen, die für sie gelten sollen, und dann kann es sich ereignen, daß beide Modelle Zeichen für den gleichen Sachverhalt sind. Jedenfalls gilt für Modelle nicht mehr, daß verschiedene Modelle auch etwas Verschiedenes darstellen. Der alte Philosophieprofessor versuchte aber durch sein Tafelbild seinen Hörern zu suggerieren, der Idealismus müsse sich vom Realismus unterscheiden, wenn beide durch verschiedene Skizzen an der Tafel wiedergegeben werden. So kann ein philosophisches Scheinproblem dadurch entstehen, daß Modelle verwandt werden, ohne daß man sieht, daß es sich dabei um Modelle und nicht um Bilder handelt. Natürlich habe ich durch mein Argument nicht bewiesen, daß Realismus und Idealismus letztlich dasselbe behaupten. Aber ich habe - denke ich - zumindest plausibel gemacht, daß sie nicht allein deshalb, weil sie verschiedene anschauliche Vorstellungen verwenden, etwas Verschiedenes behaupten müssen. Der alte Professor vertrat also immer noch die Abbildtheorie der Erkenntnis, wonach wahre Erkenntnis so etwas wie ein Abbild Eine der größten Leistungen von Helmholtz war ein wichtiger Beitrag zur Klärung des Status der Geltung geometrischer Sätze. Für die Philosophen des 18. Jahrhunderts war die Geometrie die Theorie der räumlichen Gestalten. Wenn wir uns etwas im Raum anschaulich vorstellen, sind die so entstehenden Gedankenbilder den Gesetzen der euklidischen Geometrie unterworfen. So sind die Gesetze der Geometrie bei Hume relations of ideas (Hume 1951, book 1, section 4, part 1), denknotwendige Beziehungen zwischen den Vorstellungen. Bei Kant ist das im Prinzip auch so; nur ist bei ihm alles viel komplizierter. Nun ist eines klar: Wenn die Wissenschaft aus Urteilen und nicht aus Aussagen besteht, dann ist die euklidische Geometrie eine unverzichtbarer a priori gültiger Teil der Wissenschaft, gehört sozusagen zur Grammatik der Vorstellungen, in denen die Welt gedacht wird, dem Kodex der indirekten Anschauung, wie wir sie oben (in § 3B) genannt hatten. Das wird sehr schön von J. v. Kries formuliert, der noch 1916 sich nicht vom alten Weltbild einfach verabschieden konnte: "Auch ein Weltbild, wie es hier als höchstes Ziel wissenschaftlicher Entwicklung ins Auge gefaßt wird, muß sich nun selbstverständlich eines begrifflichen Materials bedienen, das uns irgendwie zugänglich, in unserem Seelenleben irgendwie gegeben ist. Hiermit kommen wir auf die Frage zurück, wie es kommt, daß für ein solches Weltbild der Inhalt der Mathematik bindende Gültigkeit besitzt. ...... Wir gelangen so dazu, das äußere Geschehen als eine Bewegung 'materieller Punkte' oder auch wohl als eines den Raum stetig erfüllenden Mittels zu denken, eine Vorstellung, die lange Zeit die Physik beherrschte und mindestens das Ziel eines wissenschaftlichen Denkens richtig anzugeben schien. Es versteht sich, daß, solange wir diesen Weg einhalten, also die Vorstellungen von Raum und Zeit dem wissenschaftlichen Wirklichkeitsdenken zugrunde legen, wir auch an die diesen Vorstellungen eigene Natur gebunden sind. ...... Auch [für] die zeit-räumlichen Bestimmungen ...... sind die inneren Beziehungen und Zusammenhänge zwingend festgelegt, die sich aus der Natur der Zeitund Raumvorstellung ergeben. In diesem Sinne kann der Inhalt der Mathematik, wiewohl er als die Summe von Reflexionsurteilen [d.h. von Humes 'relations of ideas'] eine von dem speziellen Inhalt der Erfahrung unabhängige Evidenz (eine Apriori-Geltung) besitzt, doch für die Erfahrung, d. h. für ein wissenschaftliches Weltbild bindend genannt werden. " (J. v. Kries 1916, S. 166f.) Helmholtz formulierte 1868 einen ganz neuen Begriff der geometrischen Anschauung. Nur die direkte Anschauung konnte für die Geometrie noch maßgebend sein. Er verwech- 2) Dieser Abschnitt ist teilweise ein Auszug aus Kamlah 1993. Dort werden die hier skizzierten Gedanken ausführlicher entwickelt. selte sie nicht mit der indirekten. Oben (In § 3B) hatte ich bereits seine Charakterisierung der direkten Anschauung zitiert: "Unter ...... Ausdrucke 'sich vorstellen' ...... verstehe ich ......, daß man sich die Reihe der sinnlichen Eindrücke ausmalen könne, die man haben würde, wenn so etwas im einzelnen Falle vor sich ginge." (Helmholtz 1921, S. 5) Danach bezieht sich das Anschauungsvermögen nur auf bloße Wahrnehmungen, nicht auf Modelle, in denen die Welt (dabei auch das, was den Sinnen unzugänglich bleibt, etwa Modelle von Atomen) gedacht wird. Helmholtz schilderte dann die Erlebnisse eines Beobachters in einer nichteuklidischen Welt, um zu zeigen, daß eine derartige Welt durch mögliche Erfahrungen nahegelegt werden könnte. "Er würde die entferntesten Gegenstände dieses Raumes in endlicher Entfernung rings um sich herum zu erblicken glauben, nehmen wir an, in hundert Fuß Abstand. Ginge er aber auf diese entfernten Gegenstände zu, so würden sie sich vor ihm dehnen, und zwar noch mehr nach der Tiefe, als nach der Fläche, hinter ihm aber würden sie sich zusammenziehen. Er würde erkennen, daß er nach dem Augenmaße falsch geurteilt hat. Sähe er zwei gerade Linien, die sich nach seiner Schätzung mit einander parallel bis auf diese Entfernung von 100 Fuß, wo ihm die Welt abgeschlossen erscheint, hinausziehen, so würde er, ihnen nachgehend erkennen, daß sie bei dieser Dehnung der Gegenstände, denen er sich nähert, aus einander rücken, je mehr er an ihnen vorschreitet, hinter ihm dagegen würde ihr Abstand zu schwinden scheinen, so daß sie ihm beim Vorschreiten immer divergent und immer entfernter von einander erscheinen würden. Zwei gerade Linien aber, die vom ersten Standpunkte aus nach einem und demselben Punkte des Hintergrundes in hundert Fuß Entfernung zu konvergieren scheinen, würden dies immer tun, so weit er ginge und er würde ihren Schnittpunkt nie erreichen." (Helmholtz 1921, S. 20) Interessant ist nun die Reaktion der Philosophen auf Helmholtz' Szenario. Ein großer Teil der Zeitgenossen hatte offenbar die Tragweite von Helmholtzens Gedankengängen überhaupt noch nicht begriffen. Viele Autoren, die sich mit Helmholtz auseinandersetzten, erwähnen seine Schilderung von Erlebnissen einer nichteuklidischen Welt überhaupt nicht, sondern nehmen nur Bezug auf sein anderes Beispiel, auf die zweidimensionalen Wesen (vielfach auch Beltramische Wanzen genannt), die auf einer krummen Fläche herumkriechen und bei ihren Messungen zu einer nicht-euklidischen Geometrie gelangen. Sie wenden dann mit Recht ein, daß der Analogieschluß von der zweidimensionalen im dreidimensionalen Raum gekrümmten Fläche auf die dreidimensionale im vierdimensionalen Raum gekrümmten Hyperfläche nicht zwingend ist.3 Die wenigen Philosophen, die die Bedeutung von Helmholtz' Schilderung begriffen hatten, reagierten mit dem Argument, er habe ja nur ein euklidisches Modell einer nicht-euklidischen Geometrie entworfen, in dem Körper beim Transport seltsame Verzerrungen und Größenänderungen erleiden und die Welt in einer Kugel endlicher Größe eingeschlossen bleibt. Die 3) Einzelheiten und Literaturangaben finden sich in Kamlah 1994. euklidische Geometrie bliebe dabei auch für Helmholtz die Grammatik des Denkens anschaulicher Modelle und damit a priori gültig. Die Philosophen reagierten damit auf Helmholtz bereits mit einer konventionalistischen Strategie, ganz im Sinne von W. v. O. Quine, der später sagen sollte: "Jede Aussage kann als wahr aufrechterhalten werden, was auch immer geschehen mag, wenn andernorts im System hinreichend radikale Anpassungen [an die Erfahrung] vorgenommen werden."4 Die Philosophen hatten damit selbst Kants Festung der reinen Anschauung unterminiert, und es war eine Situation geschaffen, in der nur noch ein kleiner Schritt notwendig war, um sie ganz zum Einsturz zu bringen. Diesen Schritt tat Poincaré. D. Poincarés Konventionalismus5 In den beiden Jahrzehnten vor und nach der Jahrhundertwende formulierte der Mathematiker Poincaré seine Philosophie des Konventionalismus. Der Grundgedanke war folgender: Die Aussagen der Wissenschaft folgen nicht logisch aus den unmittelbaren Erfahrungstatsachen, den "faits bruts", sondern wir brauchen zusätzliche Prinzipien, um die "faits scientifiques" aus ihnen zu gewinnen. Diese zusätzlichen Prinzipien sind aber nicht etwa wie bei Kant synthetische Grundsätze a priori, sondern Übereinkünfte, Konventionen. Poincaré richtete sich damit auf der einen Seite gegen die naiven Empiristen, die glaubten, die gesamte Wissenschaft aus empirischen Verallgemeinerungen gewinnen zu können und auf der anderen Seite gegen die Neukantianer, die glaubten, zusätzlich zu den empirischen Aussagen apriorische Prinzipien annehmen zu müssen. Bildhafte Modelle werden zur Darstellung der "faits scientifiques" nicht mehr benötigt. Die Darstellung ist rein sprachlich. Poincaré betrachtete die Wissenschaft selbst als Sprache, die wissenschaftlichen Tatsachen als Übersetzungen der rohen Tatsachen in diese Sprache (Poincaré 1905 u. 1921, Kap. 10, §3). Unter den für die Naturwissenschaft erforderlichen Konventionen sind vor allem die geometrischen Axiome zu nennen. Wir lesen diese in grober Näherung aus der unmittelbaren Erfahrung ab, indem wir die Glieder unseres Körpers als starre Köper oder Maßstäbe betrachten und Lichtstrahlen als geradlinig. Das reicht aber noch nicht, um die absolut genaue euklidische Geometrie zu gewinnen. Daher fordern wir diese als Konvention und gestalten unsere Physik so, daß sie immer dazu paßt. Wir könnten stattdessen auch eine nichteuklidische Geometrie nehmen, die sich im Bereich der unmittelbaren Erfahrung von der euklidischen nicht unterscheidet. Einen Zwang zur Bevorzugung der Geometrie Euklids gibt es nicht. Mit Poincarés Hauptthese verbindet sich eine zweite, die der Relativität der Bilder oder Modelle für wissenschaftliche Tatsachen. 4) "Any statement can be held true, come what may, if we make drastic enough adjustments elsewhere in the system." (Quine 1963, S. 43) 5) Dieser Abschnitt ist teilweise ein Auszug aus Kamlah 1994. Dort werden die hier skizzierten Gedanken ausführlicher entwickelt. In Poincarés Konventionalismus wird nämlich vollends deutlich, daß die Bilder der indirekten Anschauung einer Deutung bedürfen und es keinen Sinn hat, nach ihrer Wahrheit ohne Bezug auf eine solche Deutung zu fragen. Poincaré brachte in Wissenschaft und Methode sein berühmtes Gedankenexperiment einer sich über Nacht tausendfach vergrößernden Welt: "Nehmen wir an, daß in einer Nacht alle Dimensionen des Universums tausendmal größer werden: die Welt bleibt dann ähnlich zu sich selbst, wenn wir das Wort Ähnlichkeit in demselben Sinne gebrauchen, wie es im dritten Buche von Euklid angewendet wird. Was früher einen Meter lang war, mißt jetzt einen Kilometer, und was einen Millimeter lang war, hat jetzt die Länge eines Meters. Das Bett, in dem ich liege und mein eigener Körper vergrößern sich in demselben Verhältnisse." (Poincaré 1973, S. 81) Er sagt dann: auseinanderzusetzen. Aber Poincaré hat es bereits aufgelöst. Die Bilder, die hier verwendet werden (das für die Leute im Zug und das für die Streckenarbeiter), sind selbst so etwas wie sprachliche Zeichen, die in beiden Fällen verschieden interpretiert werden. Sie könnten sich nur widersprechen, wenn in beiden Fällen die Interpretation die gleiche wäre. Es ist naiv, anzunehmen, daß Bilder bereits für sich selbst sprechen. Aber genau das tun wir zunächst einmal, und damit entsteht für uns ein Paradoxon. Hans Reichenbach formulierte später sein "Relativitätsprinzip" der Geometrie, das im Grunde genommen nur eine Anwendung Poincaréscher Gedanken darstellt. Zunächst stellte er die Frage nach der Rolle der Geometrie des Anschauungsraums: "Da der Raum nur relativ ist, so hätte man besser sagen sollen: es hat sich überhaupt nichts ereignet, und deshalb konnten wir auch nichts bemerken." (S. 82) "Wir wollen zunächst annehmen, es sei richtig, daß ein besonderes Anschauungsvermögen existiert. Die euklidische Geometrie sei die vor allen anderen durch Anschaulichkeit ausgezeichnete. Wir fragen dann: was folgt daraus für den Raum der wirklichen Dinge?" (Reichenbach 1977, Bd. 2, S. 52) Zunächst ist uns ein Rätsel, was hier Relativität des Raumes heißen soll. Den Schlüssel zur Deutung finden wir wenig später: Reichenbach führt dann einen Satz, (den Satz __), als Resultat der Mathematik ohne eigenen Beweis ein: "Man ersieht hieraus, welch eine weitgehende Bedeutung der Relativität des Raumes zukommt; der Raum ist tatsächlich gestaltlos, und nur die Dinge in ihm geben ihm eine Gestalt. Was soll man von der direkten Anschauung denken, die wir von der geraden Linie oder von der Entfernung haben? Wir haben sowenig eine Anschauung von der Entfernung an sich, daß jede Entfernung, die wir gesehen haben, in einer Nacht tausendmal größer werden kann, ohne daß wir es bemerken, wenn nur gleichzeitig alle anderen Entfernungen dieselbe Änderung erleiden." (5. 86) "'Sei irgend eine Geometrie G' gegeben, welche die Meßkörper befolgen; dann können wir immer eine universelle Kraft K [d. h., grob gesagt, eine Kraft, die auf alle Körper gleich wirkt] so wirksam denken, daß die Geometrie eigentlich die Form einer beliebig zu wählenden Geometrie G hat und die Abweichung von G auf einer universellen Deformation der Meßkörper beruht.' Gegen die Richtigkeit von Satz __ gibt es keinen erkenntnistheoretischen Einwand. Läßt sich mit ihm das anschauliche Apriori vereinbaren? Zunächst ja. ...... Wir können der Anforderung der Anschauung immer nachgeben - das ist damit bewiesen. Aber mit dem Satz __ ist zugleich etwas anderes bewiesen, was in die Theorie des anschaulichen Apriori sehr wenig hineinpaßt. Es wird nämlich behauptet, daß der euklidischen Geometrie kein besonderer Erkenntniswert zukommt. Denn der Satz __ stellt ja alle Geometrien Poincaré kommt an dieser Stelle also selbst darauf zu sprechen, daß die Relativität des Raumes im Grunde genommen die Relativität unserer räumlichen Anschauung ist. Es ist letztlich die Erkenntnis der Notwendigkeit semantischer Regeln für die indirekte Anschauung. Denn ein Bild von der Welt als ganzer, einer Welt von außen betrachtet, ist niemals eine Antizipation einer möglichen Wahrnehmung, also kein direkt anschauliches Bild, sondern allenfalls ein indirekt anschauliches. So ist bei Poincaré letztlich die Selbstreflexion der Epoche des indirekt anschaulichen Denkens gelungen, in dem Augenblick, wo sie auch schon ihr Ende erreicht; denn Poincaré war bereits ein Vertreter des Denkens in Symbolen. Poincaré wandte den Gedanken der Relativität der räumlichen Anschauung dann auf die Relativitätstheorie an. Ein schnell bewegter Körper erscheint dem Beobachter im ruhenden System verkürzt. Für den mitbewegten Beobachter ist das umgekehrt. Die ruhenden Körper sind für ihn verkürzt. Wir können uns eine Eisenbahn denken - Poincarés Bild ist ein wenig anders-, die mit ein Zehntel Lichtgeschwindigkeit durch einen Tunnel fährt. Der Zug sei, wenn er steht, gerade so lang wie der Tunnel. Für die Fahrgäste gibt es dann einen Augenblick, in dem der Zug vorne und hinten (je etwa um ¼% seiner Länge) aus dem Tunnel herausragt. Für die Streckenarbeiter neben den Geleisen ist jedoch der Zug in einem bestimmten Augenblick vollkommen im Tunnel drin. Wir kennen dieses Paradox. Ein jeder, der Einsteins Relativitätstheorie verstehen will, hat sich damit gleichberechtigt nebeneinander; er formuliert das Relativitätsprinzip der Geometrie. Aus ihm folgt, daß es keinen Sinn hat, zu sagen, eine Geometrie sei die wahre. " (1977, Bd. 2, S. 52f.) Aus dem Zitat ist deutlich, daß das Relativitätsprinzip der Geometrie im Kontext einer Argumentation gegen Kants reine Anschauung entwickelt wurde. Durch die Einführung beliebig an die Erfahrung anpaßbarer formverändernder Kräfte verliert die euklidische Geometrie ihre Wirklichkeitsgeltung. Sie wird als Apriori-Disziplin überflüssig. Reichenbach versucht dann in den folgenden Paragraphen seines Buchs zu zeigen, daß auch der anschauliche Zwang, die Welt euklidisch zu denken, gar nicht besteht. Wir sehen ihn hier als einen Vertreter des Ideals des Denkens in Symbolen gegen die Anhänger des Ideals des Denkens in Modellen argumentieren. Damit hatte Reichenbach noch das Bewußtsein, an der Schwelle einer neuen Zeit zu stehen. Ganz anders war die Situation für A. Grünbaum eine Generation später und in den USA. Grünbaum interpretierte Poincarés und Reichenbachs Relativitätsthesen als ontologische Aussagen. Die Metrik sagte er, sei eine rein äußerliche "extrinsische Eigenschaft" des Raumes, keine "intrinsische", wesentliche. Der Raum, für sich betrachtet, sei "metrisch amorph". Grünbaum nannte diese These den "geochronometrischen Konventionalismus (GC)".6 Das paßt im Wortlaut zwar gut zu Poincarés Aussage, die ich oben zitiert habe. Aber was Poincaré dort sagt, darf nur in dem Kontext gelesen werden, in dem seine Sätze dort auftreten. Grünbaums GC ist von verschiedener Seite angegriffen worden, und manche Philosophen haben sich auch einfach nur gefragt, was Grünbaum denn gemeint haben könnte.7 Ich will den GC hier nicht diskutieren. Ich glaube nur, daß wir Poincaré und Reichenbach auch ganz gut verstehen können, ohne ihnen den GC zu unterstellen. Bemerkenswert finde ich dabei nur, daß ein Vertreter des neuen Paradigmas, der nicht mehr in der Auseinandersetzung mit den Anhängern des alten steht, die Diskussion zwischen den Paradigmen nicht mehr versteht. Wenn der gestalt switch (siehe Kuhn 1970, S. 150) endgültig stattgefunden hat, geht der Zugang zum alten Paradigma leicht verloren. Nur ein Historiker, der die Schriften der älteren Wissenschaftler sorgfältig liest, ist vielleicht in der Lage, für sich persönlich den gestalt switch nocheinmal rückwärts zu vollziehen. E. Diltheys Theorie des Verstehens8 Die dritte Anwendung ist von anderer Art. Bei Helmholtz und Poincaré hätte man noch denken können, wir redeten nur von Physik. Wenn nicht zwischendurch von Idealismus und Realismus die Rede gewesen wäre, könnte der Eindruck entstanden sein, als sei dieses Kapitel eigentlich nur für Naturwissenschaftler interessant. Sicherlich ist der Ausgangspunkt unserer Untersuchung die Form physikalischer und anderer naturwissenschaftlicher Theorien. Aber die gesamte Erkenntnistheorie der Neuzeit ist von der Form der zeitgenössischen naturwissenschaftlichen Theorien fundamental bestimmt, weshalb es auch fragwürdig ist, wenn Philosophiegeschichte oft von Leuten betrieben wird, die die Wissenschaftsgeschichte ihrer Bezugsepochen nicht kennen. Somit sollte es uns nicht verwundern, wenn wir auch in den Geisteswissenschaften auf Anwendungen unserer Theorie stoßen. Wir brauchen nicht lange danach zu suchen. In den Geisteswissenschaften wird auf einen Typ von Erkenntnis großen Wert gelegt, der teilweise noch dem Ideal des Denkens in Bildern entspricht, während in den Naturwissenschaften das Ideal des Denkens in Symbolen vorherrschend ist. Erkenntnis oder Wissen ist der methodisch gesicherte Glaube an etwas, das wahr ist. Oben (in § 2) wurde aber bereits ausgeführt, daß die Auffassung davon, was "wahr" heißt und worauf diese Bezeichnung angewendet wird, sich gewandelt hat. Für das 17. und 18. Jahrhundert waren vor allem Urteile wahr, 6) Grünbaum 1963, S. 10f. 7 ) Putnam 1975, Kap. 6; siehe auch das Diskussionsforum "Simultaneity by Slow Clock Transport" mit mehreren Beiträgen verschiedener Autoren in Philosophy of Science, 36 (1969), S. 1 - 81, 331 - 399. 8) Dieser Abschnitt ist teilweise ein Auszug aus Kamlah 1992. Dort werden die hier skizzierten Gedanken ausführlicher entwickelt. Kombinationen von Vorstellungen. Für die heutige Naturwissenschaft sind Aussagen Träger von Wahrheit. Nun behaupte ich keineswegs, daß die frühneuzeitliche Wahrheitstheorie völlig überholt ist und der alte Wahrheitsbegriff keinerlei Anwendungen hat. Es gibt im Alltagsleben viele Situationen, bei denen es nicht auf die Beziehung zwischen wahren Aussagen und der Wirklichkeit, sondern auf die zwischen richtigen Vorstellungen und der Realität ankommt. Wenn ich einen Kuchen backen will, reichen mir die Aussagen aus meinem Kochbuch nicht; ich muß den Teig auch richtig abschmecken können. Ich muß diejenige Geschmacksvorstellung von dem Teig haben, die mir den Kuchen so garantiert, wie er werden soll. Die Situationen, bei denen es im praktischen Leben auf die richtige Vorstellung von einer Sache ankommt, sind ohne Zahl, angefangen beim Pilze und Beerensammeln über die Kochkunst, den Sport, das Handwerk bis zur Musik und den schönen Künsten. Selbstverständlich muß aber auch der Chemiker wissen, wie der Inhalt des Reagenzglases aussehen muß, wenn ein Test auf Kalziumionen positiv ausfallen soll, und der Mediziner, wie die Hautflecken beim Scharlach aussehen. So etwas läßt sich nicht aus Büchern lernen, die nicht wenigstens Abbildungen enthalten. Es gibt also auf fast allen Gebieten anschauliches Wissen, das nicht angelesen werden kann. Bei den Geisteswissenschaften ist das anschauliche Wissen von psychischen Vorgängen anderer Personen das "Verstehen". An dem Ausdruck ist Kritik geäußert worden, weil wir das Wort "Verstehen" in der Umgangssprache viel umfassender verwenden, z. B. auch für das Durchschauen eines mathematischen Beweises, bei dem keinerlei Anschauung eine Rolle spielt. Ich denke, wir sollten einfach akzeptieren, daß das Wort "Verstehen" im methodologischen Kontext bei Dilthey in bestimmter Weise terminologisch fixiert worden ist. Dilthey hätte auch einem anderen Wort die Bedeutung geben können, die wir heute "Verstehen" zuschreiben. Er war frei in der Wahl des Wortes, das er für die Sache verwandte, die er beschreiben wollte. Vielleicht hätte Dilthey Mißverständnissen vorgebeugt, wenn er sich nicht in der deutschen Alltagssprache gebräuchlicher Wörter bedient hätte, sondern Fremdwörter geprägt hätte, wie es Windelband mit seiner Unterscheidung nomothetisch (Gesetze aufstellend) und idiographisch (Einzelnes beschreibend) getan hatte. Da er das nicht getan hat, können wir uns nur den hochterminologischen Gebrauch von "verstehen" und "erklären" bei Dilthey klarmachen und versuchen, herauszubekommen, was diese Wörter bei ihm bedeuten. Diltheys Erkenntnisziel ist das Nacherleben des Erlebnisses einer anderen Person, das sich aus ihren Äußerungen erschließen läßt. Das zeigt er sehr schön am Beispiel von Luther: Die Möglichkeit, in meiner eigenen Existenz religiöse Zustände zu erleben, ist für mich wie für die meisten heutigen Menschen eng begrenzt. Aber indem ich die Briefe und Schriften Luthers, ..., ... die Akten der Religionsgespräche und Konzilien ... durchlaufe, erlebe ich einen religiösen Vorgang von einer solchen eruptiven Gewalt, von einer solchen Energie, in der es um Leben und Tod geht, daß er jenseits jeder Erlebnismöglichkeit für einen Menschen unserer Tage liegt. Aber nacherleben kann ich ihn. (Dilthey 1970, S. 263ff.) So kommt Dilthey zu dem Tripel "Erleben - Äußerung - Verstehen". Ein Dichter, Künstler oder sonst eine Person von Interesse äußert sich in einem Kunstwerk oder Dokument, drückt ihr Erleben darin aus. Der Geisteswissenschaftler will wissen, welche Bewußtseinsinhalte darin zum Ausdruck kommen, d. h. er will verstehen. Dazu dienen ihm dann die Methoden der Hermeneutik. "Verstehen" ist keineswegs der Versuch, sich durch "Einfühlung" die erforderliche mühsame philologische Arbeit zu ersparen, wie manche Kritiker Diltheys gemeint haben. In den für die geisteswissenschaftliche Arbeit typischen Situationen versagt sogar meist das schlichte Sich-Einfühlen. Wir verstehen eben nicht spontan, was in einem mittelalterlichen Mönch vorgeht, der sich geißelt. Zu einem solchen Verständnis zu gelangen, ist mindestens äußerst schwierig, und man muß Diltheys Optimismus nicht teilen, wenn er ein solches Verständnis für möglich hält. Aber daß es für den Historiker ein erstrebenswertes Ziel sein kann, läßt sich doch wohl nicht bestreiten. Die logischen Empiristen des Wiener und Berliner Kreises haben immer wieder ihr Unverständnis gegenüber Diltheys Theorie des Verstehens artikuliert. So schrieb E. Zilsel, man könne vieles verstehen. Als die Türken im Jahre 1685 Wien belagerten, litt die Wiener Bevölkerung unter dem türkischen Bombardement, unter Hunger und Krankheiten. Wir hätten gut verstehen können, wenn das die Widerstandskraft der Wiener geschwächt hätte, aber ebenso, wenn ihre verzweifelte Situation zu heldenhaftem Durchhaltewillen geführt hätte. "Verstehen" wird hier als billiger Ersatz für wissenschaftliches Erklären verstanden. Das war es nach Dilthey natürlich nicht. Es ist einfach auch für Dilthey die Aufgabe des Historikers, auf Grund von Quellen herauszubekommen, welcher Fall wirklich vorlag. Ähnliche Äußerungen finden sich bei O. Neurath, C. G. Hempel, W. Stegmüller und anderen. Warum war es diesen Philosophen nicht möglich, zu sehen, was Dilthey wollte? Sie waren alle Anhänger des Ideals des Denkens in Symbolen. Wissenschaft besteht danach aus Aussagen, nach den Regeln einer Syntax verknüpften Ketten bedeutungstragender Zeichen. Sehr deutlich sagte das E. Dubislav, der immerhin besser als die anderen logischen Empiristen sah, was die Hermeneutiker wollten. Er bemerkte, daß für sie Verstehen ein Ziel und keine Methode war, billigte jedoch das Ziel nicht, da es seiner Vorstellung von Wissenschaft nicht entsprach. Er schreibt: Aber ist es nicht eine Hauptaufgabe einer Wirklichkeits- oder, wie man sie auch genannt hat, Realwissenschaft, neben den erwähnten Beschreibungen und geschilderten Erklärungen, die in Form der Beobachtung gleichsam vorauseilenden Berechnungen auftreten, auch noch zu einem sogenannten "Verstehen" zu gelangen? Und ist etwa gerade innerhalb der sogenannten Geisteswissenschaften alles bloße Beschreiben und Erklären, sofern dies dort überhaupt möglich ist, gleichsam "tot"? Und liefert etwa erst ein beseelendes, wertorientiertes Verstehen "lebendige" Erkenntnisse, so wie sie in den Geisteswissenschaften gesucht werden? ...... Man hat ...... versucht, das sogenannte "Verstehen" eines Gebildes, zu dem es eine Geisteswissenschaft bringen soll, objektiv zu charakterisieren. Man hat gesagt, daß das genannte Verstehen eines zu erforschenden Gebildes zu einem Erfassen desselben führt, das seinerseits beruhen soll auf einem nachfühlenden oder einfühlenden Erleben bei gleichzeitiger Einordnung des fraglichen Gebildes in ein Wertsystem. ...... [Doch] ...... alle Disziplinen, in denen es sich darum handelt, wirkliche Gebilde zu erforschen, sind grundsätzlich, weil dieselbe Forschungsmethode anwendend, von gleichem Charakter. ...... In allen derartigen Disziplinen nämlich, möge nun ihr Objekt ein lebendiger Organismus sein oder nicht, einmalig gegeben oder in Millionen von Exemplaren vorliegend, kann es sich nur darum handeln, die zu erforschenden Gebilde im Rahmen ansatzartig unterstellter Theorien ...... zu beschreiben und erklären, um sie auf Grund der Erklärung unseren jeweiligen Zwecken dienstbar zu machen. (Dubislav 1931, S. 144ff.) Der gestalt switch vom Ideal des Denkens in Bildern oder Modellen zum Ideal des Denkens in Symbolen hatte sich für die logischen Empiristen so gründlich vollzogen, daß nur noch in Symbolen (sprachlich) kodifiziertes Wissen als Wissenschaft akzeptiert wurde. Dubislav erscheint hier seltsam dogmatisch. Es fällt auf, daß er sein Wissenschaftsideal ohne Begründung wie eine Selbstverständlichkeit formuliert. Wir dürfen daher den Übergang vom Ideal des Denkens in Bildern und Modellen zu dem in Symbolen nicht schlechthin als Fortschritt verstehen. Wir haben oben gesehen, daß das bildhafte Denken durchaus sein eingeschränktes Recht behalten muß. Das gilt a fortiori für die Vergegenwärtigung geistiger Zustände. Dilthey steckte zwar mit seinem Erkenntnisbegriff noch tief im 19. Jahrhundert. Aber auf diese Weise bewahrte er auch den verstehenden Bezug zur geistigen Wirklichkeit, der für die Geisteswissenschaften unverzichtbar ist. Doch auch an Dilthey war die Naturwissenschaft seiner Zeit und ihre zeitgenössische Deutung der Natur nicht vorüber gegangen. Er sah indessen im Übergang zur symbolischen Darstellung der Natur einen Verlust an Erkenntnis. Sein Bestreben war, die Geisteswissenschaft in Kontrast zur Naturwissenschaft zu stellen und so die Eigenart der im 19. Jahrhundert erstarkten Geisteswissenschaft zur Geltung kommen zu lassen. So sagt Dilthey von der Natur: "Es gibt kein Verständnis dieser Welt, und wir können Wert, Bedeutung, Sinn in sie nur nach Analogie mit uns selbst übertragen,..." (Dilthey 1970, S. 106 - 107) Und von den naturwissenschaftlichen Theorien sagt er: "So ist die Natur uns fremd, dem auffassenden Subjekt transzendent, in Hilfskonstruktionen vermittels des phänomenal Gegebenen zu diesem hinzugedacht." (Dilthey 1970, S. 103, Dilthey, 1942, S. 90 ) Dilthey vertrat, wie bereits gesagt, noch das alte Erkenntnisideal des anschaulichen Erkennens der direkten Anschauung. Ich weiß, wie sich etwas zugetragen hat, wenn ich weiß, wie es ausgesehen hat und sich angehört hat und was die Menschen dabei gedacht und gefühlt haben. Und nun ist eines entscheidend: Von menschlichen Handlungen kann ich das anschaulich wissen, diese Handlungen kann ich im Geiste nachvollziehen. Physikalische Vorgänge hingegen sind in der direkten Anschauung nicht faßbar. Dadurch gewinnt die Geisteswissenschaft eine grundsätzliche Überlegenheit gegenüber der Naturwissenschaft. Menschliche Erlebnisse sind direkt anschaulich, sind nachvollziehbar. Hier lassen sich Bild und Urbild vergleichen, hier läßt sich etwas darüber aussagen, ob ein Bild zutrifft oder nicht. Die Dinge der Natur hingegen und die Bilder, die wir von ihnen haben, sind "offenbar zwei ganz verschiedenen Welten angehörig", wie Helmholtz sagt (1867, S. 443), die Naturdinge sind prinzipiell unvergleichbar mit den Bildern, die wir uns von ihnen machen. Wir haben oben bereits gesehen, wie Galilei im Goldwäger (il saggiatore) die physikalische Welt als die eigentlich wirkliche ansieht. Im obigen Zitat sagt Galilei, die Natur selbst schmecke nach nichts und rieche nach nichts, sei nicht farbig und töne nicht. In der Natur bewegen sich nur Atome im Raum auf mathematisch beschreibbaren Bahnen. Das ist zwar nach unserem heutigen Verständnis eine sinnlose Aussage, denn was soll "tönen" anders heißen als "tönen, wenn ein Lebewesen, z. B. ich, hinhört", nichtsdestoweniger war diese erkenntnistheoretische Scheinthese äußerst folgenreich, denn sie wurde von J. Locke und vielen anderen Philosophen der Neuzeit vertreten. Dilthey nimmt direkt auf diese These Bezug, wenn er sagt: "In der Natur sind Raum und Zahl als Bedingungen der qualitativen Bestimmungen und der Bewegungen gegeben und Bewegung ist dann die allgemeine Bedingung für die Umlagerung von Teilen oder Schwingungen der Luft oder des Äthers, welche Chemie und Physik den Veränderungen unterlegen. Der Gegenstand der Naturwissenschaft sind Körper, ihre am meisten fundamentale Eigenschaft sind die Beziehungen von Raum und Zahl, welche die Mathematik feststellt. Von ihnen ist die Mechanik abhängig, und indem Licht, Farbe, Ton, Wärme aus den Bewegungen der kleinsten Teile der Materie erklärt werden, entsteht die Physik." (1970, S. 104 - 105; 1942, S. 91.) Da für Dilthey wie für die meisten Denker des 19. Jahrhunderts die Welt dieser fast aller sinnlichen Eigenschaften beraubten physikalischen Körper nicht mehr wie noch für Kepler oder Leibniz eine Sphäre von höherer Wirklichkeit und Ausdruck der göttlichen Allmacht war, ist sie für ihn eine schemenhaft verblassende Welt ohne Leben: "Wir bemächtigen uns dieser physischen Welt durch das Studium ihrer Gesetze. Diese Gesetze können nur gefunden werden, indem der Erlebnischarakter unserer Eindrücke von der Natur, der Zusammenhang, in dem wir, sofern wir selber Natur sind, mit ihm stehen, das lebendige Gefühl, in dem wir sie genießen, immer mehr zurücktritt hinter das abstrakte Auffassen derselben nach den Relationen von Raum, Zeit, Masse, Bewegung." (1970, S. 93, 1942, S. 82-83.) Wir müssen Diltheys Aussage ernst nehmen. Er verwandte Helmholtz' kritischen Realismus zur Unterscheidung von Naturund Geisteswissenschaften mit dem Resultat, daß letztere dabei besser wegkommen als erstere. Nicht die Geisteswissenschaften, denen es an jeder mathematischen Methode mangelt, stehen als Bettler da, sondern die Naturwissenschaften, die statt das volle Leben in seiner Schönheit zu erfassen, sich mit einem Surrogat von Zahlen und Formeln begnügen müssen. Vielleicht tat Dilthey den Naturwissenschaften Unrecht. Aber er wies doch auf eine Seite der Erkenntnis hin, die schlechthin unverzichtbar ist, auf ihre Sinnlichkeit und auf die Sensibilität für die Befindlichkeiten des Menschen. §6. Rückblick Schauen wir auf die Gedanken zurück, die hier versuchsweise entwickelt worden sind! Wir haben in der Geschichte der Wissenschaft drei Denkideale zu unterscheiden versucht. Das Vorhandensein dieser Denkideale macht nun mit einem Male eine ganze Reihe wissenschaftshistorischer und philosophischer Erscheinungen verständlich. Hier konnte ich nur wenige Beispiele präsentieren. Die Zahl der Anwendungen ist in Wirklichkeit weit größer. Man sieht, wir können nur eine Geschichte des Denkens schreiben, wenn wir wissen, was Denken ist, nicht umgekehrt. Der Philosoph gewinnt die Philosophiegeschichte aus der Philosophie, nicht die Philosophie aus der Philosophiegeschichte. Hat er keine Philosophie, dann weiß er auch nicht, wovon er die Geschichte kennen lernen will. Dem Wissenschaftshistoriker geht es analog. Noch eine Bemerkung möchte ich hinzufügen. Nachdem ich Carnap und Wittgenstein gelesen hatte und mir klar wurde, wieviele Probleme der Philosophie sinnlos sind, fehlte mir so etwas wie ein Schlüssel zur Philosophiegeschichte. Denn offenbar hatten sich die Philosophen mit sehr vielen sinnlosen Problemen beschäftigt. Die Theorie des anschaulichen und symbolischen Denkens eröffnet mir wieder den Weg zur Deutung der erkenntnistheoretischen Tradition. Sie gibt sinnlosen Fragen zwar nicht nachträglich einen Sinn, zeigt aber doch, wie diese für die Menschen, die sie gestellt haben, subjektiv einen Sinn haben konnten. Literatur . Arnauld, A., 1972, Logik oder die Kunst des Denkens, Darmstadt Wiss. Buchges.. Carnap, R., 1926, Physikalische Begriffsbildung Karlsruhe Braun; Nachdruck Darmstadt 1966: Wiss. Buchges. ; Carnap, R., 1928, Scheinprobleme der Philosophie, Berlin-Schlachtensee Weltkreis Verl.; wieder abgedruckt in Der logische Aufbau der Welt. Scheinprobleme der Philosophie, Hamburg 1961: Meiner. Descartes, R., 1922, Prinzipien der Philosophie (4. Aufl.), Leipzig: Meiner. Dilthey, W., 1942, Gesammelte Schriften, Bd. 7, Leipzig: Teubner. Dilthey, W., 1970, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Frankfurt/M.: Suhrkamp. Dubislav, W., 1931, Die Definition, Leipzig: Meiner. Fischel, W., 1949, Leben und Erlebnis bei Tieren und Menschen, München Barth . Galilei, G., 1890-1909, Editione nationale delle opere di Galileo Galilei (hrsg. von A. Favoro) Florenz . Galilei, G., 1891, Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme, das ptolemäische und das kopernikanische (übers. u. erl. von E. Strauss), Leipzig Teubner . Galilei, G., 1966, Galileo Galilei, his Life and his Works (hrsg. von R. J. Seeger), Oxford/London/Edinburgh/New York/Toronto/Sidney/Paris/Braunschweig Pergamon . Galilei, G., 1980, Sidereus Nuntius. Nachricht von den neuen Sternen (hrsg. v. H. Blumenberg), Frankfurt/M. Suhrkamp . Goodman, N., 1973, Sprachen der Kunst. Ein Ansatz zu einer Symboltheorie, Frankfurt/M. Suhrkamp . Grünbaum, A., 1963, Philosophical Problems of Space and Time, New York: Knopf. Hacking, I., 1984, Die Bedeutung des Sprache für die Philosophie, Königstein/Ts. Hain . Helmholtz, H. v., 1867, Handbuch der physiologischen Optik Leipzig Voss. Helmholtz, H. v., 1868, Über die Tatsachen, die der Geometrie zugrunde liegen, in H. v. Helmholtz 1921; S. 38-55. Helmholtz, H. v., 1921, Schriften zur Erkenntnistheorie (hrsg. von P. Hertz u. M. Schlick), Berlin: Springer ;. Helmholtz, H. v., 1966, Abhandlungen zu Philosophie und Naturwissenschaft, Darmstadt Wiss. Buchges. Hertz, H., 1963, Die Prinzipien der Mechanik in neuem Zusammenhange dargestellt, Darmstadt: Wiss. Buchges. Hume, D., 1951, Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of Morals, Oxford: Clarendon Pr. Kamlah, A., 1992, Verstehen und Rekonstruieren, zur Theorie der Geisteswissenschaften, in L. Danneberg, F. Vollhardt (Hrsg.), Vom Umgang mit Literatur und Literaturgeschichte, Stuttgart: Metzler; S. 125-148. Kamlah, A., 1993, Die Böotier oder der zweifache Sinn der Begriffe in der Geometrie der Anschauung des 19. Jahrhunderts, in Drei Vorträge über Geometrie, Report No. 3/93 of the Research Group Semantical Aspects of Spacetime Theories: Universität Bielefeld, Zentrum für interdisziplinäre Forschung, D-33615 Bielefeld. Kamlah, A. 1994: "Poincaré's Philosophy of Relativity and Geometrical Intuition", in Greffe, J.-L., Heinzmann, G., Lorenz, K (Hrsg.): Henri Poincaré. Science and Philosophy, Berlin / Paris: Akademie Verl./ Blanchard; S. 145-167. Kant, I., 1781, Critik der reinen Vernunft (1. Aufl.), Riga; (Ausgabe A) ;;. Kant, I., 1800, Immanuel Kants Logik, ein Handbuch zu Vorlesungen, Königsberg; (Ausgabe A). Köhler, W., 1963, Intelligenzprüfungen an Menschenaffen, Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer. Kries, J. v., 1916, Logik, Tübingen: Mohr. Kuhn, T.S., 1970, The Structure of Scientific Revolutions (2. Aufl.), Chicago: Univ. of Chicago Pr. Kuhn, T.S., 1976, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (2. Aufl.), Frankfurt: Suhrkamp. Lenin, W. I., 1957, Materialismus und Empiriokritizismus, Berlin Dietz Verl. Locke, J., 1981, Versuch über den menschlichen Verstand, Hamburg: Meiner. Mach, E., 1933, Die Mechanik historisch kritisch dargestellt, Wiesbaden: Brockhaus; Nachdruck Darmstadt 1963: Wiss. Buchges. Newton, I., 1872, Mathematische Prinzipien der Naturlehre, Berlin; photomech. Nachdruck Darmstadt 1963: Wiss. Buchges.; Poincaré, H., 1973, Wissenschaft und Methode, Darmstadt Wiss. Buchges.; Nachdruck der Ausg. Leipzig/Berlin 1914. Poincaré, H., 1905, La valeur de la science, Paris 1905, Flammarion. Poincaré, H., 1921, Der Wert der Wissenschaft, Leipzig: Teubner. Putnam, H., 1975, Mathematics Matter and Method. Philosophical Papers, Vol. 1, Cambridge/London/New York/Melbourne: Cambridge Univ. Pr. Quine, 1963, From a Logical Point of View, New York: Harper & Row. Rehkämper, K., 1991, Sind mentale Bilder bildhaft? - eine Frage zwischen Philosophie und Wissenschaft, Hamburg Dissertationsdruck. Reichenbach, H., 1977, Gesammelte Werke, Bd. 1: Der Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie, Bd. 2: Philosophie der Raum-ZeitLehre, Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg. Reichenbach, H., 1983, Gesammelte Werke, Bd. 4: Erfahrung und Prognose, Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg. Tarski, A. 1949: "The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics", in H. Feigl, W. Sellars (Hrsg.) Readings in Philosophical Analysis, New York: Appleton-Century-Crofts; S. 52-84. Tarski, A. 1977: "Die semantische Konzeption der Wahrheit und die Grundlagen der Semantik", in G. Skirbekk (Hrsg.), Wahrheitstheorien, Frankfurt/M.: Suhrkamp; S. 140-188. Waismann, F., 1976, Logik, Sprache, Philosophie, Stuttgart Reclam.