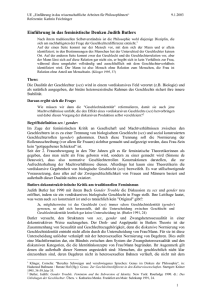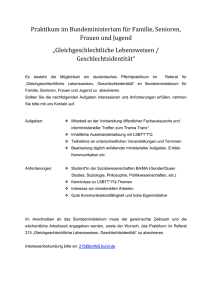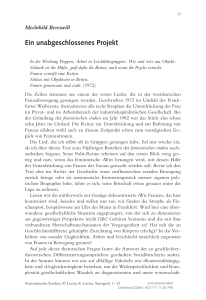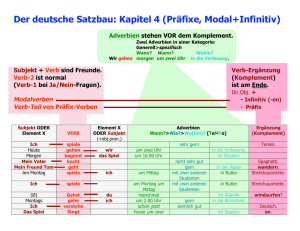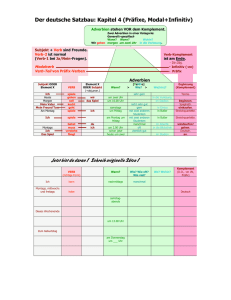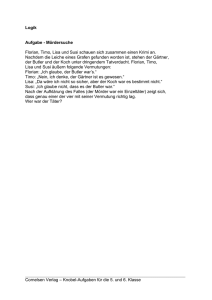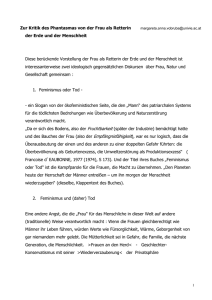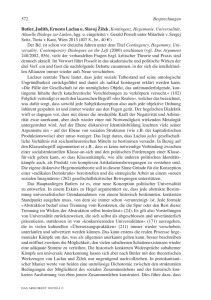13 Einführung in die feministische Philosophie
Werbung
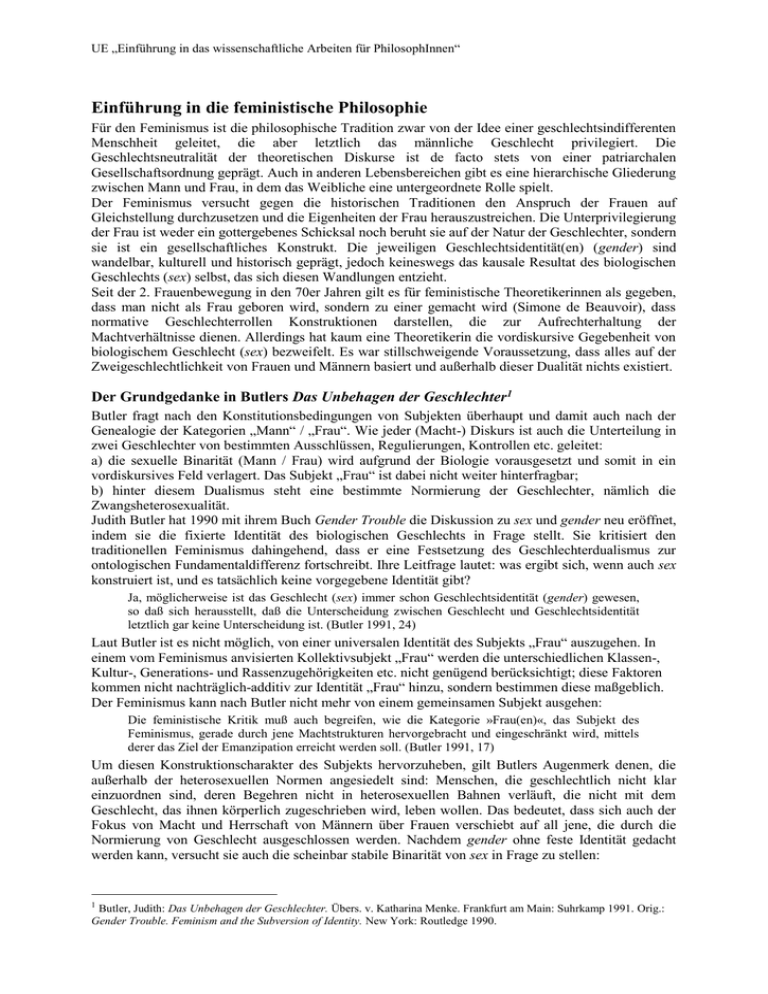
UE „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten für PhilosophInnen“ Einführung in die feministische Philosophie Für den Feminismus ist die philosophische Tradition zwar von der Idee einer geschlechtsindifferenten Menschheit geleitet, die aber letztlich das männliche Geschlecht privilegiert. Die Geschlechtsneutralität der theoretischen Diskurse ist de facto stets von einer patriarchalen Gesellschaftsordnung geprägt. Auch in anderen Lebensbereichen gibt es eine hierarchische Gliederung zwischen Mann und Frau, in dem das Weibliche eine untergeordnete Rolle spielt. Der Feminismus versucht gegen die historischen Traditionen den Anspruch der Frauen auf Gleichstellung durchzusetzen und die Eigenheiten der Frau herauszustreichen. Die Unterprivilegierung der Frau ist weder ein gottergebenes Schicksal noch beruht sie auf der Natur der Geschlechter, sondern sie ist ein gesellschaftliches Konstrukt. Die jeweiligen Geschlechtsidentität(en) (gender) sind wandelbar, kulturell und historisch geprägt, jedoch keineswegs das kausale Resultat des biologischen Geschlechts (sex) selbst, das sich diesen Wandlungen entzieht. Seit der 2. Frauenbewegung in den 70er Jahren gilt es für feministische Theoretikerinnen als gegeben, dass man nicht als Frau geboren wird, sondern zu einer gemacht wird (Simone de Beauvoir), dass normative Geschlechterrollen Konstruktionen darstellen, die zur Aufrechterhaltung der Machtverhältnisse dienen. Allerdings hat kaum eine Theoretikerin die vordiskursive Gegebenheit von biologischem Geschlecht (sex) bezweifelt. Es war stillschweigende Voraussetzung, dass alles auf der Zweigeschlechtlichkeit von Frauen und Männern basiert und außerhalb dieser Dualität nichts existiert. Der Grundgedanke in Butlers Das Unbehagen der Geschlechter1 Butler fragt nach den Konstitutionsbedingungen von Subjekten überhaupt und damit auch nach der Genealogie der Kategorien „Mann“ / „Frau“. Wie jeder (Macht-) Diskurs ist auch die Unterteilung in zwei Geschlechter von bestimmten Ausschlüssen, Regulierungen, Kontrollen etc. geleitet: a) die sexuelle Binarität (Mann / Frau) wird aufgrund der Biologie vorausgesetzt und somit in ein vordiskursives Feld verlagert. Das Subjekt „Frau“ ist dabei nicht weiter hinterfragbar; b) hinter diesem Dualismus steht eine bestimmte Normierung der Geschlechter, nämlich die Zwangsheterosexualität. Judith Butler hat 1990 mit ihrem Buch Gender Trouble die Diskussion zu sex und gender neu eröffnet, indem sie die fixierte Identität des biologischen Geschlechts in Frage stellt. Sie kritisiert den traditionellen Feminismus dahingehend, dass er eine Festsetzung des Geschlechterdualismus zur ontologischen Fundamentaldifferenz fortschreibt. Ihre Leitfrage lautet: was ergibt sich, wenn auch sex konstruiert ist, und es tatsächlich keine vorgegebene Identität gibt? Ja, möglicherweise ist das Geschlecht (sex) immer schon Geschlechtsidentität (gender) gewesen, so daß sich herausstellt, daß die Unterscheidung zwischen Geschlecht und Geschlechtsidentität letztlich gar keine Unterscheidung ist. (Butler 1991, 24) Laut Butler ist es nicht möglich, von einer universalen Identität des Subjekts „Frau“ auszugehen. In einem vom Feminismus anvisierten Kollektivsubjekt „Frau“ werden die unterschiedlichen Klassen-, Kultur-, Generations- und Rassenzugehörigkeiten etc. nicht genügend berücksichtigt; diese Faktoren kommen nicht nachträglich-additiv zur Identität „Frau“ hinzu, sondern bestimmen diese maßgeblich. Der Feminismus kann nach Butler nicht mehr von einem gemeinsamen Subjekt ausgehen: Die feministische Kritik muß auch begreifen, wie die Kategorie »Frau(en)«, das Subjekt des Feminismus, gerade durch jene Machtstrukturen hervorgebracht und eingeschränkt wird, mittels derer das Ziel der Emanzipation erreicht werden soll. (Butler 1991, 17) Um diesen Konstruktionscharakter des Subjekts hervorzuheben, gilt Butlers Augenmerk denen, die außerhalb der heterosexuellen Normen angesiedelt sind: Menschen, die geschlechtlich nicht klar einzuordnen sind, deren Begehren nicht in heterosexuellen Bahnen verläuft, die nicht mit dem Geschlecht, das ihnen körperlich zugeschrieben wird, leben wollen. Das bedeutet, dass sich auch der Fokus von Macht und Herrschaft von Männern über Frauen verschiebt auf all jene, die durch die Normierung von Geschlecht ausgeschlossen werden. Nachdem gender ohne feste Identität gedacht werden kann, versucht sie auch die scheinbar stabile Binarität von sex in Frage zu stellen: 1 Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. Übers. v. Katharina Menke. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991. Orig.: Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge 1990. UE „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten für PhilosophInnen“ Wenn wir jedoch den kulturell bedingten Status der Geschlechtsidentität als radikal unabhängig vom anatomischen Geschlecht denken, wird die Geschlechtsidentität selbst zu einem freischwebenden Artefakt. Die Begriffe Mann und männlich können dann ebenso einfach einen männlichen und einen weiblichen Körper bezeichnen wie umgekehrt die Kategorien Frau und weiblich. (Butler 1991, 23) Damit betont sie den grundsätzlich performativen Charakter von gender und gender identity. Die Wirklichkeit von Geschlecht wird im Zuge der performativen Wiederholung, im Zitieren dieser Normen erzeugt. Zu beachten gilt es bei der Performativität jedoch, dass Geschlecht zwar performativ ist, dieser Zustand aber nicht frei gewählt werden kann. Vielmehr entsteht der performative Charakter durch den Zwang regulierender Normen. Diese Normen stellen ein Ideal dar, das nie erreicht werden kann, daher gehören Variationen dieser Normen zum modus vivendi der Geschlechtsidentität. Der phantasmatische Charakter des Geschlechts kommt gerade durch die subversiven Wiederholungen und Verschiebungen der Konnotation von Weiblichkeit und Männlichkeit zum Vorschein. Darin wird ersichtlich, dass es keine vorgegebenen Identitäten gibt. Damit meint Butler Formen von Geschlechterparodie, Praktiken der Travestie, des Cross-Dressings und die Stilisierung sexueller Identitäten, wie sie in der schwul-lesbischen, queer und trans-gender Kultur entstehen. Es geht aber nicht um die Imitation „echter“ Männer und Frauen, sondern um die Parodie des Begriffs des Originals als solchem. (vgl. Butler 1991, 190-207) Das bedeutet, die Parodie braucht kein Original, die Imitation existiert ohne Original und durch die fortwährende Verschiebung wird der Mythos der Ursprünglichkeit aufgedeckt. So zeigt sich auch, dass Geschlechtsidentität eine Konstruktion ist, die ihren Ursprung immer wieder verschleiert. Dadurch dass Abweichungen von den Normen „bestraft“ werden, kann die Konstruktion aufrecht erhalten werden. Wenn Geschlechtsidentität performativ ist und nicht expressiv, dann gibt es keine vordiskursive Identität: Es gibt dann weder wahre noch falsche, weder wirkliche noch verzerrte Akte der Geschlechtsidentität, und das Postulat einer wahren geschlechtlich bestimmten Identität enthüllt sich als regulierende Fiktion. (Butler 1991, 208) Für eine feministische Politik bedeutet die Dekonstruktion der Identität nicht, dass alles was bisher gegolten hat, ad absurdum geführt wird (Vorwurf gegen Butler). Es bedeutet vielmehr, dass der Rahmen, in dem feministische Politik stattfindet, neu definiert werden soll. Jedes „wir“ (jedes Subjekt) ist eine Konstruktion, also auch die des Feminismus. Das Subjekt ist nicht, wie es die neuzeitliche Philosophie suggeriert, eine autonome ontologische Entität, sondern es konstituiert sich in Ausschließungsverfahren. Identität ist immer auch das, was man selbst nicht ist (Frau als Nicht-Mann, Schwarzer als Nicht-Weißer etc.). Bisher wurde das feministische „wir“ über die Identität Frau produziert, nach Butlers Analyse ist es jetzt an der Zeit, dieses „wir“ zu hinterfragen und andere Handlungsstrategien zu entwickeln. Ihre These besagt nämlich auch, dass nicht zuerst eine Identität existieren muss, um politisch Handeln zu können. Der Anspruch an den Feminismus besteht also darin, diesen Konstruktionscharakter offenzulegen und davon aus zu agieren, Verschiebungen zu initiieren, die Binarität der Geschlechter zu stören und aufzubrechen und immer wieder ihre „Unnatürlichkeit“ aufzuzeigen.