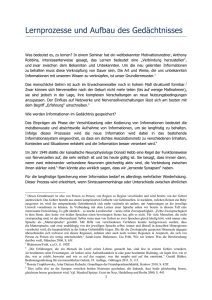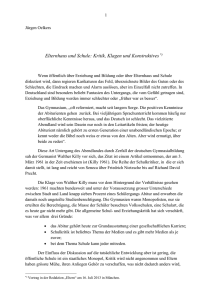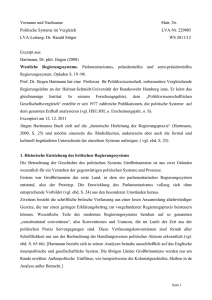Politische Steuerung sozialer Prozesse Über Steuerungsprobleme
Werbung

Politische Steuerung sozialer Prozesse
Über Steuerungsprobleme in modernen Gesellschaften
Von der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
der Universität Stuttgart zur Erlangung der Würde
eines Doktors der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Dr. rer. pol.)
genehmigte Abhandlung
Vorgelegt von
Tommy Scheeff
aus Karlsruhe
Hauptberichter:
Prof. Dr. Axel Görlitz
Mitberichter:
Prof. Dr. Ulrich Druwe
Tag der mündlichen Prüfung: 23. Mai 2014
Institut für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart
2014
1
Vorbemerkung
Das Erstellen einer Dissertation ist ein Projekt, das sich über mehrere Jahre erstreckt. Diese Jahre sind ausgefüllt mit einer kontinuierlichen und teils auch langwierigen Arbeit, die sich Seite um Seite, Abschnitt um Abschnitt, Gedanke um Gedanke
bemüht. Eine Arbeit, die erst am Ende nach langer Zeit ein gutes Gefühl für das Geleistete vermittelt.
Denn im grauen Alltag sind diese Jahre zugleich gespickt mit Tagen, an denen es
nur mühselig oder überhaupt nicht vorangeht. So frustrierten Texte, deren Inhalt sich
für mein Projekt erst nach der Lektüre als unbrauchbar erwiesen gleichermaßen wie
Ideen oder Einfälle, die ich über Tage und Wochen schriftlich ausgearbeitet hatte, um
sie dann am Ende doch zu verwerfen.
In solchen Situationen taten guter Rat, aufmunternde Worte und motivierende Zusprüche not. Von daher gilt es an dieser Stelle solchen Personen Dank zu sagen, die
auf je ihre Art und Weise einen Teil zu dieser Arbeit beigetragen haben:
Zunächst meiner Frau Katja für viele unterstützende Worte und Taten;
ferner meinen Eltern Christa und Heinz Scheeff, die mir zeitlebens Halt gaben;
der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) für die ideelle und finanzielle Unterstützung;
und nicht zuletzt Prof. Dr. Axel Görlitz, der mir nicht nur während meiner beruflichen Tätigkeit an der Universität ein angenehmer Vorgesetzter, sondern
auch als Betreuer meines Promotionsvorhabens der bedeutsamste Ratgeber
war.
Tommy Scheeff
2
Inhaltsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ...................................................................................12
Deutsche Zusammenfassung ...............................................................................................13
Abstract ................................................................................................................................18
1. Einleitung .........................................................................................................................22
Teil I Gängige politikwissenschaftliche Steuerungskonzepte
2. Rationalitätskonzepte .......................................................................................................34
3. Staats- und Gesellschaftstheorien ..................................................................................105
4. Systemtheoretische Ansätze - „offene“ Systemmodelle ..................................................140
5. Moderne Steuerungskonzepte - PaS als „einer unter vielen“ ..........................................154
Teil II: Ein autopoietisch fundiertes Steuerungsmodell
6. Warum gängige Steuerungskonzepte verwerfen? Autopoiese als Allheilmittel? .............213
7. Wissenschaftstheoretische Vorüberlegungen .................................................................220
8. Die Theorie der Autopoiese ............................................................................................283
9. Autopoietisch fundierte Steuerungskonzepte ..................................................................337
10. Darstellung des Steuerungsmodells .............................................................................420
11. Fazit & Ausblick ............................................................................................................523
Literaturverzeichnis ............................................................................................................526
3
Detailliertes Inhaltsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis .................................................................................................... 12
Deutsche Zusammenfassung ................................................................................................................ 13
Abstract.................................................................................................................................................. 18
1. Einleitung ........................................................................................................................................... 22
Teil I Gängige politikwissenschaftliche Steuerungskonzepte
2. Rationalitätskonzepte ........................................................................................................................ 34
2.1 Planungsbegriff ............................................................................................................................ 34
2.1.1 Begriffsannäherung .............................................................................................................. 34
2.1.2 Begriffsabgrenzungen .......................................................................................................... 35
2.1.3 Politische Planung ................................................................................................................ 37
2.1.4 Planungsfunktionen .............................................................................................................. 39
2.1.5 Plan- und Planungstypen ..................................................................................................... 41
2.1.6 Planungstheorie .................................................................................................................... 42
2.2 Entscheidungstheoretische Ansätze ........................................................................................... 45
2.2.1 Kennzeichen entscheidungstheoretischer Ansätze.............................................................. 45
2.2.2 Exemplarisch: Carl Böhrets Modell rationaler Entscheidung ............................................... 48
2.2.3 „Ideale“ Planung ................................................................................................................... 50
2.2.4 Zweck-Mittel-Schema ........................................................................................................... 56
2.2.5 Zwischenergebnis ................................................................................................................. 58
2.3 Gesellschaftspolitische Ansätze .................................................................................................. 59
2.3.1 Hinführung ............................................................................................................................ 59
2.3.2 Pluralistische Systempolitik oder: Planung in einer Welt von Systemen ............................. 60
2.3.2.1 Exemplarisch I: Renate Mayntz & Fritz W. Scharpf: Aktive Politik ............................... 61
2.3.2.2 Exemplarisch II: Niklas Luhmanns „Politische Planung“ .............................................. 62
2.3.4 Theorien des Staatsinterventionismus ................................................................................. 64
2.4 Kybernetische Ansätze ................................................................................................................ 66
2.4.1 Merkmale kybernetischer Planungskonzepte ....................................................................... 66
2.4.2 Exemplarisch I: Herbert Stachowiak: Politik als kybernetisches System ............................. 69
2.4.3 Exemplarisch II: Karl W. Deutsch: Politische Kybernetik ..................................................... 70
2.5 Planungsalternativen ................................................................................................................... 73
2.5.1 Entwicklungsbedarf alternativer Planungskonzepte ............................................................. 73
2.5.2 Herbert A. Simon: Bounded Rationality ................................................................................ 74
4
2.5.3 Michael D. Cohen: Garbage-Can-Modell ............................................................................. 74
2.5.4 Charles E. Lindblom: Muddling through ............................................................................... 75
2.6 Planung heute ............................................................................................................................. 81
2.6.1 Merkmale moderner Planungskonzepte ............................................................................... 81
2.6.2 Perspektivischer Inkrementalismus ...................................................................................... 83
2.6.3 Kommunikative und kooperative Planung ............................................................................ 86
2.6.4 Paradigmatische Steuerung ................................................................................................. 91
2.7 Planungskritik .............................................................................................................................. 96
2.7.1 Planung als generell problembeladenes Konzept ................................................................ 96
2.7.2 Varietätsproblematik ............................................................................................................. 97
2.7.3 Komplexitätsproblematik ...................................................................................................... 98
2.7.4 Informationsproblematik ..................................................................................................... 100
2.7.5 Kommunikationsproblematik .............................................................................................. 101
2.8 Fazit ........................................................................................................................................... 103
3. Staats- und Gesellschaftstheorien .................................................................................................. 105
3.1 Staatstheorien ........................................................................................................................... 106
3.1.1 Der „Staat“ - eine Begriffsannäherung ............................................................................... 106
3.1.2 Staat als „Zentrum der Herrschaft“? ................................................................................... 108
3.1.3 Das Steuerungskonzept des „Kooperativen Staats“ .......................................................... 109
3.1.4 „Aktivierender Staat“ ........................................................................................................... 118
3.1.5 Joachim Hirschs politökonomischer Ansatz ....................................................................... 119
3.1.6 Kritik .................................................................................................................................... 120
3.2 Gesellschaftstheorien ................................................................................................................ 123
3.2.1 Uwe Schimanks sozial- und steuerungstheoretische Konzeption...................................... 124
3.2.2 Schimanks Sozialtheorie .................................................................................................... 125
3.2.3 Subsystembildung .............................................................................................................. 128
3.2.4 Theorie sozialer Steuerung ................................................................................................ 131
4. Systemtheoretische Ansätze - „offene“ Systemmodelle ................................................................. 140
4.1 David Eastons politisches Systemmodell .................................................................................. 140
4.2 Werner Janns Policy-Making-Modell ......................................................................................... 144
4.3 Richard Münchs Interpenetrationskonzept ................................................................................ 148
5. Moderne Steuerungskonzepte - PaS als „einer unter vielen“ ......................................................... 154
5
5.1 Policy-Cycle ............................................................................................................................... 155
5.2 Renate Mayntz & Fritz W. Scharpf: Akteurzentrierter Institutionalismus .................................. 158
5.3 Steuerungskonzepte der Netzwerkanalyse bzw. -theorie ......................................................... 164
5.3.1 Bestandteile von Netzwerkansätzen .................................................................................. 167
5.3.2 Ronald Burts strukturalistische Handlungstheorie.............................................................. 169
5.3.3 Mark Granovetters Konzept des „Embeddedness“ ............................................................ 170
5.3.4 Ronald Burts Konzept des strukturellen Lochs .................................................................. 172
5.3.5 Sozialkapital........................................................................................................................ 173
5.3.6 Zwischenfazit ...................................................................................................................... 174
5.3.7 Policy-Netzwerke ................................................................................................................ 175
5.3.8 Fazit .................................................................................................................................... 178
5.4 Governance ............................................................................................................................... 180
5.4.1 Was meint „Governance“?.................................................................................................. 180
5.4.2 Governance-„Theorie“ und politische Steuerung ............................................................... 182
5.4.3 Funktionen von Governance .............................................................................................. 183
5.4.4 Eine Begriffsannäherung .................................................................................................... 184
5.4.4.1 Normativer vs. analytischer Governancebegriff ..................................................... 184
5.4.4.2 enger vs. weiter Governancebegriff ....................................................................... 185
5.4.4.3 prozess- vs. strukturorientierter Governancebegriff ............................................... 187
5.4.4.4 Governance auf lokaler, regionaler, nationaler oder internationaler Ebene .......... 189
5.4.4.4.1 Governance auf lokaler Ebene ....................................................................... 190
5.4.4.4.2 Governance auf nationaler Ebene .................................................................. 193
5.4.4.4.3 Governance in „Räumen begrenzter Staatlichkeit“ ........................................ 195
5.4.4.4.4 Governance „zwischen“ Staaten/ EU-Policy-Making ...................................... 197
5.4.4.4.5 „Global Governance“ ...................................................................................... 199
5.4.4.4.6. „Weiche Steuerung“ ....................................................................................... 202
5.4.5 Fazit .................................................................................................................................... 208
Teil II: Ein autopoietisch fundiertes Steuerungsmodell
6. Warum gängige Steuerungskonzepte verwerfen? Autopoiese als Allheilmittel? ............................ 213
7. Wissenschaftstheoretische Vorüberlegungen ................................................................................. 220
7.1 Theorien- bzw. Modelltransfers ................................................................................................. 221
7.1.1 Kritik der Naturwissenschaften an der Übernahme ihrer Modelle und Theorien in die
Sozialwissenschaften .................................................................................................................. 221
6
7.1.2 Prinzipielle Kompatibilität der Naturwissenschaften mit den Sozialwissenschaften .......... 225
7.1.3 Theorie? Modell? Eine erste Annäherung .......................................................................... 226
7.1.4 Theorienrekonstruktionsmethode ....................................................................................... 235
7.1.4.1 Rationale Rekonstruktion ........................................................................................... 235
7.1.4.2 Formalisierung und Axiomatisierung .......................................................................... 238
7.1.5 Wege eines Theorientransfers ........................................................................................... 241
7.1.5.1 Analogisierung ............................................................................................................ 241
7.1.5.2 Vereinheitlichung von Argumentmustern ................................................................... 243
7.1.5.3 Theorien-Netze im strukturalistischen Theorienverständnis ...................................... 246
7.1.5.3.1 Wissenschaftstheoretischer Strukturalismus ...................................................... 246
7.1.5.3.2 Theorien- und Modellverständnis des Strukturalismus ....................................... 248
7.1.5.3.3 T-Theoretizität ..................................................................................................... 255
7.1.5.3.4 Intertheoretische Links ........................................................................................ 259
7.1.6 Skizze des Theorientransfers ............................................................................................. 262
7.2 Erklärungsebenen ..................................................................................................................... 265
7.2.1 Individualistisches Erklärungsschema ................................................................................ 266
7.2.2 Kollektivistisches Erklärungsschema ................................................................................. 268
7.2.3 Zwischenfazit ...................................................................................................................... 270
7.2.4 Makro-Mikro-Makro-Erklärungsschema ............................................................................. 271
7.2.4.1 Logik der Situation ...................................................................................................... 276
7.2.4.2 Logik der Selektion ..................................................................................................... 277
7.2.4.3 Logik der Aggregation ................................................................................................ 277
7.2.4.4 Genetische Erklärung ................................................................................................. 279
8. Die Theorie der Autopoiese ............................................................................................................. 283
8.1 Der Ausgangspunkt: Autopoiese à la Maturana & Varela ......................................................... 283
8.1.1 Autopoiese als Theorie des Lebens ................................................................................... 286
8.1.1.1 Autopoietische Systeme erster und zweiter Ordnung ................................................ 286
8.1.1.2 Soziale Phänomene ................................................................................................... 289
8.1.2 Autopoiese als biologisch fundierte Kognitionstheorie ....................................................... 290
8.1.3 Autopoiesetheorie als Epistemologie ................................................................................. 293
8.1.4 Rationale Rekonstruktion und Axiomatik ............................................................................ 294
8.2 Sozialtheoretische Interpretation: Autopoietisches Gesellschaftsmodell .................................. 298
7
8.2.1 Darstellung des autopoietisch fundierten Gesellschaftsmodells ........................................ 298
8.2.2 Rationale Rekonstruktion und Axiomatik ............................................................................ 306
8.3 Sozialtheoretische Konsequenzen ............................................................................................ 309
8.4 Steuerungstheoretische Interpretation: Autopoietische „Steuerungstheorie“ ........................... 311
8.5 Steuerungstheoretische Konsequenzen ................................................................................... 316
8.5.1 Peter M. Hejl: Autopoietisch fundierte Makrosteuerung ..................................................... 316
8.5.1.1 Konstruktivistische Sozialtheorie ................................................................................ 316
8.5.1.2 Steuerungstheoretische Vorüberlegungen ................................................................. 322
8.5.1.3 Makrosteuerung I: Systeme 2. Ordnung .................................................................... 325
8.5.1.4 Makrosteuerung II: Kritische Inputs ............................................................................ 327
8.5.2 Mikrosteuerung I: Steuerung allonomer Sozialsysteme ..................................................... 330
8.5.3 Mikrosteuerung II: Steuerung durch Netzwerke ................................................................. 331
8.6 Fazit ........................................................................................................................................... 334
9. Autopoietisch fundierte Steuerungskonzepte .................................................................................. 337
9.1 Niklas Luhmann: Steuerung sozialer Systeme.......................................................................... 337
9.1.1 „Theorie“ sozialer Systeme................................................................................................. 337
9.1.2 Modellbausteine ................................................................................................................. 338
9.1.3 Steuerungstheoretische Folgerungen ................................................................................ 340
9.2 Gunther Teubner: Recht als autopoietisches System ............................................................... 344
9.2.1 Problemstellung .................................................................................................................. 344
9.2.2 Modellzweck ....................................................................................................................... 347
9.2.3 Ausgewiesener Modellgehalt.............................................................................................. 349
9.2.4 Steuerungstheoretischer Gehalt. ........................................................................................ 353
9.2.5 Kritik .................................................................................................................................... 360
9.3 Karl-Heinz Ladeur: Strategisches Recht ................................................................................... 362
9.3.1 Problemstellung .................................................................................................................. 362
9.3.2 Modellgehalt ....................................................................................................................... 363
9.3.3 Steuerungstheoretischer Gehalt ......................................................................................... 365
9.3.4 Kritik .................................................................................................................................... 371
9.4 Manfred Glagow: Selbststeuerungskonzepte............................................................................ 372
9.4.1 Problemstellung .................................................................................................................. 372
9.4.2 Systembildung .................................................................................................................... 373
8
9.4.3 Steuerungstheoretischer Gehalt ......................................................................................... 375
9.4.4 Kritik .................................................................................................................................... 378
9.5 Helmut Willke: Dezentrale Kontextsteuerung & Supervision .................................................... 378
9.5.1 Problemstellung .................................................................................................................. 378
9.5.2 Modellzweck ....................................................................................................................... 380
9.5.3 Ausgewiesener Modellgehalt.............................................................................................. 381
9.5.3.1 Systemgrenzen........................................................................................................... 381
9.5.3.2 Systemstruktur............................................................................................................ 382
9.5.3.3 Systemobjekte, -attribute, -relationen......................................................................... 383
9.5.3.4 Subsystembildung ...................................................................................................... 388
9.5.4 Steuerungstheoretischer Gehalt ......................................................................................... 389
9.5.4.1 Dezentrale Kontextsteuerung ..................................................................................... 393
9.5.4.2 Supervision ................................................................................................................. 395
9.5.5 Fazit .................................................................................................................................... 399
9.6 Axel Görlitz: Mediale Steuerung ................................................................................................ 400
9.6.1 Problemstellung .................................................................................................................. 400
9.6.2 Modellgehalt ....................................................................................................................... 401
9.6.3 Mediale Steuerung ............................................................................................................. 403
9.6.4 Kritik .................................................................................................................................... 406
9.7 Hans Peter Burth: Steuerung unter der Bedingung struktureller Kopplung .............................. 410
9.7.1 Problemstellung .................................................................................................................. 410
9.7.2 Modellkonzeption ................................................................................................................ 411
9.7.3 Modellgehalt ....................................................................................................................... 413
9.7.4 Steuerungstheoretischer Gehalt ......................................................................................... 415
9.7.5 Entwicklungen der Theorie struktureller Kopplung ............................................................. 417
9.7.6 Kritik .................................................................................................................................... 418
10. Das Steuerungsmodell „Kreative Policy-Netzwerke“ .................................................................... 420
10.1 Der Ansatz kreativer Netzwerke .............................................................................................. 420
10.1.1 Kreative Netzwerke: Eine erste Annäherung ................................................................... 422
10.1.2 Funktionen, Vor- und Nachteile, Untersuchungsebenen ................................................. 428
10.1.3 Zentrale Bausteine ........................................................................................................... 430
10.1.3.1 Kreativität .................................................................................................................. 430
9
10.1.3.2 Innovationen ............................................................................................................. 431
10.1.3.3 Begriff der „räumlichen Nähe“ .................................................................................. 432
10.1.4 Initiierung kreativer Netzwerke ......................................................................................... 434
10.1.5 Kritik .................................................................................................................................. 438
10.1.6 Zur empirischen Erfassbarkeit kreativer Netzwerke ......................................................... 439
10.1.7 Steuerung durch oder mit kreativen Netzwerken ............................................................. 442
10.1.8 Spezifikation des Ansatzes kreativer Milieus mit Hilfe der Autopoiesetheorie ................. 443
10.1.9 Kreative Milieus als Baustein des Gesamtmodells .......................................................... 445
10.2 Konstruktivistische Handlungstheorie: Ausfüllung der Mikroebene des Steuerungsmodells . 449
10.2.1 Hinführung ........................................................................................................................ 449
10.2.2 Ursprung des individualistischen Konstruktivismus:
George Kellys Konzept der
persönlichen Konstrukte .............................................................................................................. 454
10.2.3 Ursprung des sozialen Konstruktivismus: Peter L. Bergers & Thomas Luckmanns
„Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit .......................................................................... 456
10.2.4 Erving Goffman: „Wir alle spielen Theater“ ...................................................................... 460
10.2.4.1 „Wir alle spielen Theater“ ......................................................................................... 460
10.2.4.2 „Rollenspiel“ .............................................................................................................. 462
10.2.4.3 Rahmenanalyse........................................................................................................ 464
10.2.4.4 Fazit .......................................................................................................................... 467
10.2.5 Anthony Giddens: Theorie der Strukturation .................................................................... 468
10.2.5.1 Akteurshandeln......................................................................................................... 468
10.2.5.2 Handlungssequenzen ............................................................................................... 470
10.2.5.3 Strukturbegriff ........................................................................................................... 471
10.2.5.4 Fazit .......................................................................................................................... 474
10.2.6 Klaus Hurrelmann: Modell der produktiven Realitätsverarbeitung ................................... 475
10.2.6.1 Akteursbild ................................................................................................................ 476
10.2.6.2 Modellgehalt ............................................................................................................. 477
10.2.6.3 Fazit .......................................................................................................................... 479
10.2.7 Hans Lenk: Interpretationskonstrukte ............................................................................... 479
10.2.7.1 „Interpretieren“ und „Schemata“ ............................................................................... 480
10.2.7.2 Handlungstheoretische Überlegungen ..................................................................... 484
10.2.7.3 Fazit .......................................................................................................................... 488
10
10.2.8 Ernst von Glasersfeld: Handlungstheoretische Überlegungen aus dem Bereich des
Radikalen Konstruktivismus ........................................................................................................ 489
10.2.8.1 Ausgangspunkt: Jean Piagets Arbeiten über die Wissenserzeugung bei Kindern .. 490
10.2.8.2 Handlungskonzeption ............................................................................................... 492
10.2.8.3 „Viabilität“ .................................................................................................................. 495
10.2.8.4 Radikaler Konstruktivismus und „Soziales“ .............................................................. 497
10.2.8.5 Fazit .......................................................................................................................... 499
10.2.9 Hartmut Esser: Framing-Konzept ..................................................................................... 500
10.2.9.1 Vorab: Ein Exkurs zu „beschränkten“ RC-Theorien ................................................. 500
10.2.9.2 Frames und Skripte .................................................................................................. 502
10.2.9.3 Erklärung der Auswahl eines Frames oder Skripts .................................................. 505
10.2.9.4 Fazit .......................................................................................................................... 508
10.2.10 Zusammenfassung ......................................................................................................... 509
10.3 Darstellung des Steuerungsmodells ........................................................................................ 510
10.3.1 Realitätsausschnitt und Modellzweck ............................................................................... 510
10.3.2 Modellgehalt ..................................................................................................................... 512
10.3.2.1 Makroebene.............................................................................................................. 514
10.3.2.2 Mikroebene ............................................................................................................... 516
10.3.3 Steuerungsprozess ........................................................................................................... 518
10.3.4 Fachliche Verortung des Steuerungsmodells................................................................... 520
11. Fazit & Ausblick ............................................................................................................................. 523
Literaturverzeichnis ............................................................................................................................. 526
11
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildung 1: Ariadnefaden - Konzeption der Arbeit
Abbildung 2: Politisch-administratives System als rationales Planungssystem
Tabelle 1: Planungstheoretische Problemdimensionen
Abbildung 3: Systemanalyse und Planungsprozess
Abbildung 4: Linearer Planungsprozess
Abbildung 5: Schema des Zweck-Mittel-Handelns
Tabelle 2: Inkrementalismus - klassisch-analytisches Planungsmodell.
Abbildung 6: Staatsmodelle nach Dietmar Braun.
Abbildung 7: Uwe Schimanks Modell eines sozialen Subsystems
Abbildung 8: Soziale Steuerung nach Schimank
Abbildung 9: Eastons Systemmodell
Abbildung 10: Differenzierung von Outputs.
Abbildung 11: Werner Janns Politisch-administratives System
Abbildung 12: Policy-Cycle
Abbildung 13: Akteurzentrierter Institutionalismus
Tabelle 3: Koordinationsformen nach Scharpf
Abbildung 14: Burts strukturelle Handlungstheorie
Tabelle 4: Governance-Strukturen und -Prozesse.
Tabelle 5: Koordinationsmechanismen nach Benz
Abbildung 15: Mechanismen weicher Steuerung nach Göhler et. al..
Abbildung 16: Skizze des Modelltransfers
Abbildung 17: Erklärungsschema in Anlehnung an Coleman
Abbildung 18: Essers Makro-Mikro-Makro-Erklärungsschemas
Abbildung 19: Grundschema einer genetischen Erklärung
Tabelle 6: Dimensionen einer Steuerungstypologie der Autopoiesetheorie
Abbildung 20: Hejls Konzept der Steuerung durch Systeme 2. Ordnung
Abbildung 21: Hejls Konzept der Steuerung durch kritische Inputs
Tabelle 7: Steuerungstypologie mit den Varianten Peter M. Hejls
Tabelle 8: Bislang aus der Autopoiesetheorie deduzierte Steuerungsvarianten
Tabelle 9: Steuerung durch Netzwerke im Rahmen der Autopoiesetheorie
Tabelle 10: Steuerungsarten nach Gunther Teubner
Tabelle 11: Steuerungsmedien nach Willke
Abbildung 22: Milieugesteuerte Wirtschaftsentwicklung
Tabelle 12: Milieuorientierte Regionalpolitik
Abbildung 23: Giddens Handlungskonzeption
Abbildung 24: Giddens‘ Reproduktionskreislauf
Abbildung 25: Institutionentypen nach Giddens
Abbildung 26: Hans Lenks Interpretationsstufen
Abbildung 27: Ernst von Glasersfelds Wissens- und Handlungstheorie
Abbildung 28: Der Prozess des Framings nach Hartmut Esser
Tabelle 13: Handlungsmodi nach Hartmut Esser
Tabelle 14: Autopoietisch fundierte Steuerungsvarianten
Abbildung 29: Darstellung eines kreativen Policy-Netzwerks
Abbildung 30: Das kreative Policy-Netzwerk als Policy-Making-Modell
33
39
43
46
52
57
79
111
128
136
141
142
147
156
160
163
170
188
191
206
263
275
279
281
315
327
329
330
331
334
348
388
436
437
469
472
473
481
493
505
507
512
516
519
12
Deutsche Zusammenfassung
Ausgangspunkt der in dieser Arbeit angestellten Überlegungen war die Feststellung,
wonach politische Steuerung sozialer Prozesse in modernen Gesellschaften durch
eine Vielzahl an Gründen deutlich erschwert ist.
Politikwissenschaft ist nun jene Disziplin, deren Aufgabe es ist, sich mit diesem Problem zu beschäftigen, mögliche Lösungen auszuarbeiten und schließlich Beschreibungen oder sogar Erklärungen anzubieten. Solche Beschreibungen oder Erklärungen werden in der Wissenschaft von Ansätzen, Konzepten, Modellen oder Theorien
geliefert. Um das eingangs genannte Problem anzugehen, ist es also ratsam, im
Fundus der Disziplin nach bereits vorhandenen Vorschlägen zu suchen und sie auf
ihre Tauglichkeit hin zu überprüfen.
Zuerst wurden Rationalitätskonzepte, die in der Literatur meist unter dem Schlagwort
„Planung“ subsumiert werden, diskutiert. Solche Konzepte visieren eine rationale,
logisch stringente Entscheidungsvorbereitung an. Dieser Prozess wurde im Rahmen
solcher Konzepte zunehmend ausdifferenziert und verfeinert. Allerdings zeigte sich
bald, dass sie einige unüberwindbare Defizite besitzen. So vermögen sie es meist
nicht, gesellschaftliche Komplexität oder sämtliche Zusammenhänge eines Problembereichs zu reproduzieren. Ferner schien die Prämisse der Information unumsetzbar,
wonach rationale Planung die Kenntnis jeglicher Information voraussetze. Moderne
Planung verabschiedet sich nunmehr von allumfassender Kenntnis und setzt zunehmend auf kommunikative Verfahren, so z.B. Moderation oder Partizipation Betroffener. Was jedoch „Kommunikation“ meint, blieb theoretisch ungeklärt, sodass auch
hier von einer geeigneten Theorie oder einem Modell zur Erfassung moderner Steuerungsprozesse keine Rede sein konnte.
Im Anschluss wurde nach einem potentiellen Konzept im Rahmen der Staats- und
Gesellschaftstheorien gesucht. Moderne Staatstheorien befassen sich vorrangig mit
kooperativen Elementen. In ihrem Untersuchungsfokus steht jedoch nach wie vor
„der Staat“, wobei oft unklar blieb, was damit eigentlich gemeint ist. Gesellschaftstheorien befassen sich hingegen mit dem Wirkgeflecht z.B. zwischen Politik und anvisiertem Sozialsystem. Steuerungsleistungen rücken dabei jedoch eher in den Hintergrund; eine Präzision steuerungstheoretischer Arrangements blieb dabei aus.
In der Folge wurden systemtheoretische Steuerungskonzepte diskutiert. Mit David
Eastons bekanntem Systemmodell liegt eine sparsame, aber zu schlichte und empirisch widerlegte Konzeption vor, die politische Steuerung als Input-Output13
Mechanismus erfasst und sich in dieser Hinsicht auf kybernetische Grundlagen
stützt. Mit Werner Janns „Policy-Making-Modell“ existiert eine auf Eastons Systemmodell basierende Variante des politischen Systems. Diese differenziert die
Easton’sche „black box“ und die Outputs zwar weiter aus, äußert sich jedoch kaum
zu steuerungstheoretischen Wirkmechanismen. Diesen Anspruch zu erfüllen hat Richard Münch, der mit seinem „Interpenetrationskonzept ein systemtheoretisches, an
Steuerungsleistungen orientiertes Modell vorgelegt hat. Dabei hat sich jedoch gezeigt, dass hier im Grunde genommen lediglich eine marginale Erweiterung von
Talcott Parsons‘ AGIL-Schema vorliegt, die zudem Akteure ausspart und latent normativ ist.
Zur Überwindung dieser Defizite wurden daran anschließend Konzepte aus dem Bereich der Policy-Analyse vorgestellt. Eingangs wurde mit dem Policy-Cycle eine Konzeption vorgestellt, die Steuerungsprozesse zwar in verschiedene Phasen gliedern
kann, jedoch keine Erklärungsleistung anbietet. Der akteurzentrierte Institutionalismus von Fritz W. Scharpf und Renate Mayntz mutete zunächst als ausgefeilte Methode zur Untersuchung der Generierung von Policyleistungen an, entpuppte sich
aber lediglich als Heuristik von geringem theoretischem Wert. Anschließend wurden
Konzepte aus dem Gebiet der Netzwerkanalyse bzw. -theorie diskutiert. Hier liegt
nun u.a. die gesuchte Verbindung zwischen Makro- und Mikroebene vor, denn Netzwerkkonzepte nehmen Akteure und deren strukturelles Umfeld ins Visier. In den
Blickpunkt rücken dann Verhandlungsprozesse oder -positionen; als bedeutsam erweisen sich sogenannte „strukturelle Löcher“, die überbrückt werden müssen, zentrale Positionen oder die Anhäufung von Sozialkapital. Solche Konzeptionen ließen sich
dann beispielsweise in Policy-Netzwerk-Modelle integrieren; nur wurde auch dargelegt, dass steuerungstheoretische Überlegungen aus diesem Bereich allenfalls randständig vorliegen.
Zuletzt wurden zeitgemäße Konzepte in Betracht gezogen, die unter dem Schlagwort
„Governance“ subsumiert werden. Governance möchte neben klassischen hierarchischen oder marktförmigen Steuerungsversuchen alternative Varianten, etwa Verhandlungslösungen oder Kooperationen in den Blickpunkt rücken. Zunächst wurde
deutlich, dass diese Konzepte auf alle Ebenen der Gesellschaft - von der lokalen bis
zur internationalen - angewendet werden (können). Es zeigte sich jedoch auch, dass
Governance-Konzepte theoretisch meist defizitär konstruiert sind, sodass beispielsweise Wirkmechanismen kaum modelltheoretisch dargestellt werden.
14
Als ein alternatives Konzept zur Lösung der eingangs gestellten Forschungsfragen
wurde die Theorie der Autopoiese empfohlen. Da sie ursprünglich aus den Naturwissenschaften stammt, wurden zunächst Überlegungen angestellt, welche metatheoretischen Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um a) diese fachfremde Theorie in
angemessener Art und Weise in den Sozialwissenschaften zu verwenden und b) wie
sozialwissenschaftliche Erklärungen prinzipiell aussehen sollten.
Zu a): Gezeigt wurde zunächst, dass bislang erfolgte Übernahmen naturwissenschaftlicher Ideen durch die Sozialwissenschaften zuhauf kritisiert worden sind. Zur
Überwindung der genannten Defizite wurde ein methodisch angeleiteter Transfer
empfohlen. Als Transfermethode wurde der wissenschaftstheoretische Strukturalismus ausgewählt. Dieser befasst sich mit der Struktur von Theorien bzw. der
Verknüpfbarkeit bzw. Aussagenkompatibilität verschiedener Theorieelemente. Postuliert wurde, dass die biologische Autopoiesetheorie als Basis-Theorieelement, die
sozialwissenschaftliche Interpretation von Humberto Maturana und Francisco Varela
nebst steuerungstheoretischen Ableitungen und eine Verknüpfung des Ansatzes
kreativer Netzwerke mit dem Framing-Konzept Hartmut Essers als Modell der Theorie verwendet werden können.
Zu b): Die Autopoiesetheorie bot sich v.a. deswegen an, weil sie anders als viele andere sozialwissenschaftliche Theorien oder Modelle die soziale Makro- mit der individuellen Mikroebene verknüpfen kann. Hier konnte ein Argumentationszusammenhang entwickelt werden, in welchem sich Makro- und Mikroebene gegenseitig bedingen.
Im weiteren Fortgang wurde die Theorie der Autopoiese gemäß der Methode der Rationalen Rekonstruktion präzisiert und axiomatisiert. Im Anschluss daran wurde sie
sozialwissenschaftlich interpretiert, diese Variante ebenfalls axiomatisiert und daraus
insgesamt vier steuerungstheoretische Schlüsse gezogen. Die Steuerungskonzepte
wurden in einer zweidimensionalen Typologie verortet. Dimension eins unterschied
die Konzepte danach, ob sie sich ausschließlich auf der Makro- oder sich sowohl auf
der Makro- als auch der Mikroebene bewegten. Die zweite Dimension differenzierte
die zu steuernden Systeme danach, ob sie autonom oder allonom sind, wobei eingestanden wurde, dass die allermeisten modernen Sozialsysteme autonom sind.
Mit Hilfe „kritischer Inputs“ können erstens autonome Sozialsysteme unter Missachtung der Mikroebene gesteuert werden. Allonome Sozialsysteme können demnach
zweitens durch Systeme zweiter Ordnung reguliert werden, wenn man denn die Mik15
roebene nicht beachtet. Allonom müssen diese Systeme deshalb sein, weil andernfalls mit den Systemen zweiter Ordnung eine weitere Steuerungshürde zwischengeschaltet würde. Bei den ersten beiden Varianten handelt es sich um Konzepte, die
von Peter M. Hejl entwickelt worden sind. Beide wurden aufgrund ihrer Makrolastigkeit verworfen.
Handelt es sich drittens um allonome Systeme mit autopoietisch modellierten Akteuren, so könnte mittels Perturbationen hierarchisch gesteuert werden. Barrieren für
Steuerung ergeben sich demnach erst auf der Mikroebene; die Autopoiesen der Individuen lassen direkte Befehle nicht zu, sondern entscheiden ihr Handeln strukturdeterminiert. Als vierte Variante wurden kreative Policy-Netze ausgemacht: Diese respektieren die Autonomie sozialer Systeme und die Autopoiesen der Individuen.
Steuerung erfordert nun die Ausbildung gemeinsamer konsensueller Bereiche, in
welchen sich Akteure des politisch-administrativen Systems und aus den zu steuernden Teilsystemen zur Generierung von Policies zusammenfinden. Auf diese Art und
Weise kann die Binnenrationalität der anvisierten Sozialsysteme überwunden werden.
Im Folgekapitel wurden geläufige autopoietisch fundierte Steuerungskonzepte vorgestellt und kritisch diskutiert. Diese Konzepte stammen von Niklas Luhmann („Soziale
Systeme“), Gunther Teubner („Recht als autopoietisches System“), Karl-Heinz Ladeur („strategisches Recht“), Manfred Glagow („Selbststeuerungskonzepte“), Helmut
Willke („Kontextsteuerung“ und „Supervision“) und der Autorengruppe um Axel Görlitz, Ulrich Druwe und Hans-Peter Burth („mediales Recht“). Diese Konzepte wurden
allesamt als inadäquat verworfen; zumeist richtete sich die Kritik auf eine ausbleibende methodisch angeleitete Übernahme der ursprünglich aus den Naturwissenschaften stammenden Theorie und eine mit der Ursprungstheorie inkompatible Modellierung der Makroebene.
Zur Überwindung dieser Defizite wurde eine eigene Konzeption vorgeschlagen, die
die Autopoiesetheorie in ihrer sozialwissenschaftlichen Variante mit dem Ansatz kreativer Netzwerke und Hartmut Essers Framing-Konzept verknüpft, sodass am Ende gemäß dem wissenschaftstheoretischen Strukturalismus - ein (Steuerungs-) Modell
des Basis-Theorieelements „Autopoiesetheorie“ stand. Der Ansatz kreativer Netzwerke stammt ursprünglich aus der Wirtschaftsgeographie. Der Erfolg einer wirtschaftlich erfolgreichen Region hängt demnach davon ab, ob innovative und kreative
Lernprozesse durch eine Vernetzung von Unternehmen und Verwaltung zustande16
kommen. Hartmut Essers Framing-Konzept versteht Handeln erstens als das Einordnen einer aktuellen Situation in vorhandene Erkennungsmuster (Frames) und zweitens als ein Abrufen dazu passender und ebenfalls vorhandener Handlungsweisen
(Skripte). Sollte dieses Vorgehen keinen Erfolg zeitigen, würde eine Variation des
Handelns versucht und eine anschließende Einordnung in bzw. Umgestaltung existierender Frames angestrebt. Mit beiden Ansätzen wurde ein Steuerungsmodell
durch Verknüpfung entwickelt.
17
Abstract
The starting point of the considerations this work is based on was the diagnosis that
political steering of social processes in modern societies gets increasingly difficult
due to a multitude of reasons.
It is the business of political sciences to deal with this problem, to develop possible
solutions and finally to offer descriptions or even explanations. Science provides such
descriptions or explanations with the help of approaches, concepts, models or theories. In order to solve the problem mentioned above, it is advisable, to search for already existing proposals in the archive of the discipline and to test them regarding
their suitability.
At first rationality concepts, which are subsumed in the literature under the keyword
“planning”, have been discussed. Such concepts aim for a rational, logically stringent
preparation of decisions. This process has been differentiated and improved in the
framework of such concepts. However, it soon became obvious that they have some
insuperable deficits. For example, they are mostly not able, to reproduce the social
complexity or all the interrelations of a problem. Moreover the premise of information
seemed to be unrealistic, which means that rational planning requires every information appendant to the decision. Modern planning concepts do not require allembracing information, but increasingly focus on communicative processes, e.g.
moderation or the participation of the people that are concerned. But the question
what “communication” in a scientific or theoretical way means, remains unanswered,
so that we cannot speak of an adequate theory or model to cover modern steering
processes.
After that a potential concept has been searched for in the context of state- and social theories. Modern state theories primarily deal with cooperative elements. But still
“the state” stays in the focus of examination, even if it is often unclear, what “the
state” actually means. Social theory, in contrast, copes with the area in which the political system is confronted or connected with the focused social system. Steering
performances often take a back seat here; a theoretical precision of steering arrangements is frequently missing.
Then systems-theoretical steering concepts have been discussed. In David Easton’s
well-known systemic model an economical conception which models political steering
as an input-output-mechanism and thus bases it upon cybernetical principles is available. However, it is too simple and empirical disproved. Werner Jann’s “Policy18
Making-Modell” provides an alternative, which is predicated on Easton’s systemic
model. The “Policy-Making-Modell” differentiates Easton’s black box, but doesn’t
make offers for causal connections in reference to steering. Richard Münch wants to
meet this claim. He has developed a so-called “Interpenetrationskonzept”, a systemstheoretical concept focused on steering performances. However, it was shown that at
heart it was just a marginal expansion of Talcott Parsons’ AGIL-Scheme, which is
latently normative and even ignores actors.
In order to eliminate these deficits concepts from the domain of Policy-Analysis have
been presented. At first the policy-cycle-concept has been introduced. It can differentiate steering processes in several phases, but does not explain them. Fritz W.
Scharpf’s and Renate Mayntz’ “Akteurzentrierter Institutionalismus” seemed to be a
practical method to examine the production of policies in the first instance, but it finally turned out to be a heuristics without further theoretical content. Afterwards concepts of the network analysis and, respectively, network theory have been discussed.
These concepts are able to link the sociological macro- with the micro level because
they concentrate both on actors and their structural surroundings. Here bargainingprocesses or -positions are spotlighted; structural holes, which have to be bypassed,
central positions or the accumulation of social capital turn out to be especially important. Such concepts could be integrated in policy-networks; but it was also shown
that in this sphere steering-theoretical thoughts are very rare.
Last, contemporary concepts, which are usually subsumed to “governance”, have
been given consideration to. Governance wants - beside classic hierarchical or market-like arrangements - to focus on alternate steering variants, for example bargaining solutions or cooperation. First of all it became obvious that these concepts could
be applied to all social levels, e.g. local or international ones. However, it was also
shown that governance-concepts do not offer sophisticated theoretical constructions,
which means that causal connections are hardly presented.
As an alternative for solving the research questions the theory of autopoietic systems
has been recommended. As it originates from natural sciences, some reflections
have been made about which metatheoretical conditions have to be fulfilled, a) to use
this theory, which does not pertain to social sciences, in an adequately manner and
b) how socio-scientific explanations generally have to look like.
a) It was shown that up to now socio-scientific adoptions of natural scientific theories
have been criticized immensely. In order to resolve those deficits a methodical guid19
ed transfer has been recommended. As an appropriate method the structuralist theory-concept has been chosen. It deals with the structure of theories and, respectively,
with the connectivity or compatibility of statements of different theory elements. It was
postulated that it would be possible to use the biological theory of autopoiesis as a
basic theory element, Humberto Maturana’s and Francesco Varela’s socioscientific
interpretation along with steering-theoretical deductions and a connection of the approach of creative networks with Hartmut Esser’s framing-concept as a model of the
base-theory.
b) The theory of autopoiesis has been chosen because - in contrast to lots of other
sociological theories - it does connect the social macro- with the individual micro level. Here an argumentative relationship was developed, in which both levels accounted for another.
In the course of the work the theory of autopoiesis has been specified by a rational
reconstruction and axiomatized. After that it has been interpreted socio-scientifically
and again axiomatized; in addition to that four steering-theoretical conclusions have
been deducted. These steering concepts have been arranged in a two-dimensional
typology. Dimension one distinguished the concepts with regard to the socio-scientific
level which they covered - either just the macro-level or both the macro- and microlevel. Dimension two differentiated the systems which had to be steered between
autonomous and allonomous systems. It has been underlined that modern social systems are mostly autonomous.
First, with the help of „critical inputs” autonomous social systems can be steered by
ignoring the micro-level. Second, allonomous social systems can be regulated by
„second order systems”, also by ignoring the micro-level. These systems have to be
allonomous, because otherwise a new barrier for the steering processes would exist.
These two variants have been developed by Peter M. Hejl. As they examine only the
macro-level, both of them have been refused.
Third, regarding allonomous systems with autopoietic modelled actors, it could be
possible to steer them hierarchically by perturbating the actors. Steering barriers
would just exist on the micro-level. The autopoiesis of the individuals would prohibit
direct commands; their acting would be structure-determined. As a fourth variant creative policy-networks have been identified: They respect the autonomy of social systems and the autopoiesis of individuals. Steering requires the formation of common
consensual domains, in which the actors of the political systems and of those sys20
tems, which shall be steered, come together for the generation of policies. This way
the intern rationality of the social systems can be overcome.
In the following chapter autopoietic based steering concepts that are commonly used
have been presented and critically discussed. These concepts have been composed
by Niklas Luhmann („social systems“), Gunther Teubner („law as an autopoietic system“), Karl-Heinz Ladeur („strategic law“), Manfred Glagow („self-steering concepts“),
Helmut Willke („contextual steering“ and „supervision“) and Axel Görlitz, Ulrich Druwe
und Hans-Peter Burth („medial law“). They have all been refused; in most cases it
has been criticized that they used the theory of autopoiesis without a methodical correct transfer of this originally natural scientific theory and that the way they modelled
the macro-level was incompatible to the original theory.
In order to eliminate such deficits another conception has been proposed, which
combines the theory of autopoiesis and, respectively, its socio-scientific variant with
the approach of creative networks and Harmut Esser’s framing-concept. In the end
there was - in the words of structuralism - a (steering-) model of the base-theoryelement “theory of autopoiesis”. Originally, the approach of creative networks is an
approach of economical geography. The success of an economically successful region depends on the connection of companies and administration and subsequent
innovative and collective learning processes. Hartmut Esser’s framing-concept defines acting first as an integration of an actual situation into existing reconition patterns (frames) and second as a reactivation of fitting and also existing courses of actions (scripts). If this procedure did not succeed, a variation of action would be tried
and a following subsumption into respectively reformation of existing frames would be
pursued. A steering model has been developed by connecting these two approaches.
21
1. Einleitung
Wer morgens die Zeitung aufschlägt und aufmerksam den politischen Teil liest, dem
begegnen Darstellungen verschiedenster Sachverhalte, welche von der Gesellschaft
als problembelastet angesehen und der Politik zur Regelung angetragen werden.
Einige Themen erscheinen einmal und nie wieder auf der Agenda und sind von eher
kurzfristiger Haltbarkeit, andere hingegen tauchen in aller Regelmäßigkeit wieder auf
und provozieren den Eindruck eines Déjà-vus, das infolge seiner vermeintlichen Unlösbarkeit zunehmend Enttäuschung und Frustration bei politisch interessierten Bürgern hervorruft. Dies gilt gerade in modernen Gesellschaften, deren Agenden voll
von solchen Themen zu sein scheinen.
Drei Beispiele seien an dieser Stelle genannt: So kehren etwa Berichte über den
Missbrauch und die Opfer von Rauschgiften und den Kampf gegen den Drogenmarkt
alljährlich wieder. Dabei mutet die Lösung einfach an, gelte es doch v.a. die Dealer
dingfest zu machen, doch scheint dies das Problem offensichtlich nicht an der vielzitierten Wurzel zu packen. Ein Beispiel aus der Wissenschaft ist etwa die Förderung
von neuen Technologien. Diese wird Jahr für Jahr hauptsächlich mit dem Instrument
der Finanzierung durchgeführt. Dennoch fährt der Transrapid heute in Shanghai und
nicht in München wie auch das Silicon Valley nicht im Ruhrpott, sondern an der amerikanischen Westküste liegt. Ein letztes Beispiel ist der Arbeitsmarkt, dessen Lage
sich in den vergangenen Jahren statistisch zwar etwas entspannt hat, dem in der
Summe jedoch immer noch sehr viele Arbeitslose nebst einem neuen Reservoir an
verfügbaren, aber nicht dauerhaft unterzubekommenden Arbeitskräften wie etwa
Leiharbeitern oder langjährigen Hartz-IV-Empfängern gegenüberstehen.
Wer auf solche Regelungsproblematiken im Alltag stößt - sei es als aufmerksamer
Beobachter, sei es als politscher Entscheider - , stellt sich immer auch die Frage
nach der Lösung solcher Situationen. Während Alltagswissen eine Vielzahl an Patentrezepten oder oftmals ad hoc entwickelten Ideen zur Regelung sozialer Belange
anbietet, wie beispielsweise die viel zitierte „Basta-Politik“ oder „Runde Tische“, so
stellt sich Politikwissenschaft zunächst einmal die Frage, wie solche Regelungsversuche modelltheoretisch erfasst werden können. „Modelltheoretisch“ charakterisiert
das Ziel der Politikwissenschaft, mit rational begründeten Methoden und Instrumenten Erklärungen, Beschreibungen und idealerweise sozialtechnologische Anwendungen sozialer Regelungsprozesse zu generieren. Grundlage solcher Erklärungen und
Beschreibungen sind Ansätze, Konzepte, Modelle oder Theorien. In diesen werden
22
Begriffsdefinitionen und wissenschaftliche Aussagen über einen bestimmten Realitätsausschnitt zu einem Erklärungszusammenhang verdichtet (vgl. Görlitz 1998: 20).
Steuerungsbegriff. „Regelung“ wird in solchen politikwissenschaftlich formulierten
Konzeptionen nunmehr als „Steuerung“ bezeichnet und ist als Fachbegriff, der
gleichsam einen Kontext zu wissenschaftlichem Wissen eröffnet, zu verstehen. Steuerung bezeichnet „allgemein den säkularisierten, auf sachlich-technische Dimensionen reduzierten Prozeß politischer Herrschaftsausübung und tritt damit in Konkurrenz
zu dem üblicherweise umfassender verwandten Begriff ,Regieren‘. In einem spezifischeren Sinne bezieht […] sich [der Begriff, der Verf.] auf die positive, (Daseins-) Risiken vermeidende oder kompensierende und Wohlstand mehrende Gestaltungsaufgabe in modernen Demokratien“ (Schubert 1995: 454).
Den Begriff der „Gestaltungsaufgabe“ präzisierte Fritz W. Scharpf in einer bekannten
Definition des Steuerungsbegriffs, wonach Steuerung die „intentionale Handlungskoordination zur gemeinwohlorientierten Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse“
meint (Scharpf 1988: 64). Diese Definitionen verraten bereits, dass jeder Steuerungsprozess ein „Steuerungssubjekt“, welches Steuerung initiiert und durchführt, ein
anvisiertes „Steuerungsobjekt“, ein von der Gesellschaft als problembeladen wahrgenommenes Politikfeld, auf welchem sich der Steuerungsprozess abspielt, und nicht
zuletzt eine Steuerungsmethode, z.B. in Form bestimmter Instrumente, umfasst.
Steuerung wird im Rahmen dieser Arbeit als analytischer und nicht als normativer
Begriff aufgefasst. Genauer geht es darum, Steuerungsprozesse zu erklären oder zu
beschreiben, nicht jedoch „gute“ Steuerungskonzepte zu finden.
Bei den vorgestellten Definitionen handelt es sich um einen auf einer allgemeinen
Ebene formulierten Steuerungsbegriff. Etwas spezieller ließen sich beispielsweise
auch akteurstheoretische, soziale, funktionalistische, kybernetische oder etatistische
Steuerungsdefinitionen vorstellen, wie im Laufe dieser Arbeit noch zu zeigen sein
wird. In aller Kürze: Akteurstheoretisch meint Steuerung eine erfolgreiche Handlungskoordination; Angriffspunkt ist hier somit die Akteursebene. Soziale Steuerung
bezieht sich dagegen auf die Einführung und Anwendung bestimmter Programme,
während funktionalistische Steuerung eine Variation der Selbststeuerungskapazitäten eines sozialen Systems meint. Kybernetische Steuerung hingegen konzentriert
sich auf die Veränderung bestimmter Ist-Größen gemäß eines Soll-Werts. Nicht zuletzt postuliert etatistische Steuerung den Staat als den zentralen Steuerer schlechthin (vgl. Görlitz 1998: 79). Gleich welche Steuerungsdefinition präferiert wird - im
23
Rahmen all dieser Begriffsvorstellungen findet eine Suche nach einer Antwort auf die
Frage statt, „inwieweit Politik soziale Abläufe einleiten, umlenken oder abbrechen
kann“ (Görlitz 2002: 459). Politologische Steuerungskonzepte - also wissenschaftlich
fundierte Regelungsvorstellungen - setzen dabei immer auf rational begründete Methoden und Instrumente, oder pointiert formuliert: „Gewalt, Drohungen, Verführung,
List, Magie und Gebet rücken als Steuerungsinstrumente in den Hintergrund“ (Rohrberg 2003: 16).
Steuerungs-„theorie“. Bedenkt man die enorme Bandbreite an Subsystemen und
den damit einhergehenden Zuwachs an sozialen Problemen in modernen Gesellschaften, verwundert die Vielzahl an steuerungstheoretischen Zugängen nicht: „Differenzierungstheoretisch ergibt sich somit ein Bild politischer Gesellschaftssteuerung,
das durch ein Auseinanderklaffen von Steuerungsansprüchen und -erfordernissen
auf der einen und Steuerungsfähigkeit auf der anderen Seite gekennzeichnet ist“
(Lange/ Braun 2000: 13). So existieren in der Politikwissenschaft zahlreiche Steuerungskonzepte, die sich zwischen zwei Polen bewegen. Exemplarisch seien hier
autopoietisch fundierte Steuerungskonzepte genannt: Auf der einen Seite war es Niklas Luhmann, der die Ausdifferenzierung moderner Gesellschaften in vereinzelte
Subsysteme als Ursache für die Unmöglichkeit politischer Steuerung ausgemacht
hatte. Auf der anderen Seite bewegen sich Wissenschaftler, die meinen, Steuerung
sei vielmehr eine notwendige Folge dieser Ausdifferenzierung (so z.B. Axel Görlitz in
Anlehnung an Talcott Parsons, vgl. Görlitz 1998: 21). Dementsprechend gibt es „beinahe so viele Theorien politischer Steuerung, wie sich Wissenschaftler mit dem
Thema beschäftigen. Konträr zu dem immensen wissenschaftlichen Aufwand üb(t)en
diese Theorien selten einen großen Einfluss auf die Praxis politischer Steuerung aus.
Faktisch gibt es keine steuerungstheoretisch beratene politische Steuerung“
(Schweizer 2003: 19).
Erschwerend kommt hinzu, dass Steuerungstheorie in den vergangenen Jahrzehnten kein einheitliches Denkgebäude, sondern vielmehr ein aus ganz verschiedenen
Bausteinen zusammengesetztes Haus geschaffen hat. Es handelt sich hierbei um
„eine Abfolge von Thematisierungen verschiedener Aspekte eines komplexen Phänomens. Zuerst wurde die Schuld am diagnostizierten staatlichen Steuerungsversagen in organisatorischen und kognitiven Defiziten gesucht, und es entwickelte sich in
den 70er Jahren eine umfangreiche Planungsliteratur […]. Als die Planungseuphorie
zerstob, wandte sich das Interesse anderen Komponenten staatlicher Steuerungsfä24
higkeit zu: zum einen instrumentellen und institutionellen Aspekten der Politikentwicklung und zum anderen den Problemen beim Gesetzesvollzug. So entstand eher additiv als aus einem einheitlichen Konzept systematisch abgeleitet eine Theorie, die die
Voraussetzungen wirksamer politischer Steuerung thematisierte. Die einzelnen Komponenten dieser Theorie blieben allerdings in recht verschiedenartige Diskurse eingebettet“ (Mayntz 1996: 263).
Steuerungsanalyse. Methoden zur Untersuchung von Steuerungsprozessen bietet
die Steuerungsanalyse. Ihr geht es darum zu zeigen, „in welchem Umfang und in
welcher Tiefe die Politik gesellschaftliche Abläufe beeinflussen kann, welche politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für erfolgreiche politische Steuerung
gegeben sein müssen und welche Rolle den Steuerungssubjekten im Steuerungsprozeß zukommt“ (Braun 1995: 611). In diesem Sinne ist sie zuständig für die Produktion von Wissen zu Steuerungszwecken. Obzwar die Vielzahl steuerungstheoretischer Modelle oder Konzepte präzises Wissen suggeriert, meint etwa Volker Schneider, es sei „ein grundsätzliches Problem einer ,Praxeologie öffentlicher Politiken’ […],
dass in den Sozialwissenschaften - im Vergleich zu den Naturwissenschaften steuerungsrelevantes Wissen noch weitgehend fehlt oder zumindest unsicher ist.
Ingenieure, die technische Systeme reparieren, haben präzise und realistische Modelle von ihrem Interventionsobjekt, so dass ,Reality Checks‘ keine Überraschungen
bringen“ (Schneider 2008: 57).
In diesem Sinne könnten sich Steuerungstheorie und -analyse an den Naturwissenschaften orientieren, denn diese besäßen „eine ganze Reihe von Naturkonstanten
(z.B. Lichtgeschwindigkeit oder Newtons Gravitationskonstante), also Gesetze, die
universell, unabhängig von Ort und Zeit – also ewig gelten. In der Biologie und den
Gesellschaftswissenschaften ist es schwierig bis unmöglich, solche Konstanten und
Gesetze zu entdecken. Zwar gab es auch in den Sozialwissenschaften klassische
Versuche, eherne Gesetze zu finden (etwa Montesquieus Klimatheorie, Michels’
Oligarchiegesetz, und Duvergers Gesetz über den Zusammenhang zwischen Wahlrecht und Parteiensystem), doch keines konnte als ,universelles Gesetz‘ das Feuer
der Überprüfung passieren“ (ebd.: 60). Sozialwissenschaftliche Gesetze seien in ihrem Raum-Zeit-Bezug häufig stark begrenzt, was v.a. daran liegt, „dass biologische
und soziale Zusammenhänge ,eigendynamisch‘ sind und Prozesse erzeugen, die
häufig mit Anpassung, Koevolution und Emergenz beschrieben werden können. Ein
Auto oder ein Flugzeug verändert nicht seine Binnenstrukturen aufgrund endogener
25
Prozesse, aber Bio-Organismen und Sozialzusammenhänge beinhalten vielfältige
selbsttransformative und adaptive Prozesse“ (ebd.).
Die Theorie der Autopoiese. In den Politikwissenschaften gab es bereits den ein
oder anderen Versuch, bei der Modellierung von Gesellschaft oder Steuerungsprozessen auf naturwissenschaftliche Beihilfe zu setzen. Exemplarisch hierfür steht die
Theorie der Autopoiese, welche in den Sozialwissenschaften v.a. durch die Konzepte
Niklas Luhmanns oder der Autorengruppe um Axel Görlitz hohen Bekanntheitsgrad
erlangte. Diese Theorie soll auch in dieser Arbeit als Grundlage eines Steuerungskonzepts dienen. Ursprünglich sollte sie die Frage beantworten helfen, was eigentlich
„Leben“ sei bzw. wann ein Objekt als lebendig bezeichnet werden könnte.
Ohne in die Details zu gehen, können hier charakteristische Theoriezüge genannt
werden: Zunächst einmal versucht die ursprünglich aus der Biologie stammende
Theorie Objekte auf verschiedenen Ebenen zu erfassen. Ausgangspunkt der Überlegungen sind Zellmechanismen; darauf aufbauend werden Lebewesen - sowohl Menschen als auch Tiere - bedacht und letztlich das Soziale als emergenter Phänomenbereich einbezogen. Die Grundannahme lautet, dass es sich jeweils um energetisch
offene, aber informationell geschlossene Systeme handelt. Systeminterne Prozesse
verlaufen rekursiv; Informationen sind damit selbst erzeugt und keine extern geschaffenen „Inputs“. Wie in dieser Arbeit gezeigt werden wird, weisen die bisher vorliegenden, autopoietisch fundierten Steuerungskonzepte Defizite gelegentlich inhaltlicher
Art, v.a. aber im Hinblick auf die Art und Weise der Übertragung der Theorie in die
Sozialwissenschaften auf. Von daher wird eines der zentralen Anliegen dieser Arbeit
sein, zu zeigen, wie bzw. mit welcher Methode die Autopoiesetheorie wissenschaftstheoretisch korrekt in die Politikwissenschaft übertragen werden kann. Hierzu werden
Exkursionen in die Wissenschaftstheorie und Modelltheorie unumgänglich sein.
Vorzüge der Theorie. In den Augen des Verfassers bietet diese Theorie mehrere
Vorteile, die eine Verwendung in den Politikwissenschaften als sinnvoll erscheinen
lassen:
Zunächst einmal bietet die Theorie der Autopoiese ein geeignetes Fundament
für die Modellierung moderner, überaus komplexer sozialer Systeme und
(Steuerungs-) Prozesse. Dies hat auch Renate Mayntz bestätigt, die die Theorieübernahme begründet sah in einer „Abkehr vom Weltbild der Newtonschen
Mechanik und dem wachsenden Interesse für die Erforschung nichtlinearer
Prozesse in Systemen fern vom Gleichgewicht, die zunehmend nicht mehr als
26
störende Ausnahme, sondern als Regelfall wirklichen Geschehens erkannt
werden“ (Mayntz 1991: 313).
Weiterhin bieten autopoietisch fundierte Sozialtheorien Möglichkeiten, die soziale Makro- mit der individuellen Mikroebene zu verbinden und auf diese Art
und Weise ein traditionelles Problem der Sozialwissenschaften zu lösen.
Darüber hinaus birgt die Theorie der Autopoiese genügend Potential, eine
wissenschaftstheoretisch konsequent formulierte Steuerungstheorie zu generieren. Wie zu zeigen sein wird, bewegt sie sich auf einer analytisch verfassten
Ebene, was eine empirische Überprüfbarkeit erschwert. Von daher wird es als
Basiselement dienen; empirische Forschung wird eine Verknüpfung mit weite-
ren Teilkonzepten erforderlich machen.
Ferner ist der Verfasser der Überzeugung, dass die Autopoiesetheorie - anders als in bisherigen sozialwissenschaftlichen Varianten angenommen Steuerung nicht ausschließlich auf sogenannte Perturbationen zurückführt,
sondern auch komplexere Steuerungsvarianten anbietet. Während Perturbationen als externe Reize zu verstehen sind, die Systemverhalten lediglich provozieren, nicht jedoch regulieren, so lassen sich mit der Autopoiesetheorie in
den Augen des Verfassers komplexere, netzwerkartige Steuerungsarrangements, die die Steuerungsbarriere „Perturbation“ ein wenig abschwächen,
durchaus vorstellen.
Nicht zuletzt lassen sich nach Ansicht des Verfassers all die sprachlichen Verirrungen, die im Rahmen der Übernahme der Autopoiesetheorie aufgetreten
sind, beheben. Vielmehr noch scheint die Autopoiesetheorie in Bezug auf wissenschaftstheoretische Forderungen geradezu prädestiniert dazu, nach gewissen Spielregeln transferiert zu werden und auf dieser Grundlage eine
sprachlich präzise Sozial- und Steuerungstheorie anleiten zu können.
Ziel der Arbeit. Die Autopoiesetheorie soll in dieser Arbeit als Grundlage eines politikwissenschaftlichen Steuerungsmodells dienen. Autopoietische Begriffe sind - wie
gezeigt werden wird - analytische Begriffe und deshalb nur bedingt für sozialwissenschaftliche empirische Forschungsarbeit geeignet, obzwar auch solche Begriffe Erkenntnisse bieten können (vgl. Friedrich 1980: 205). Aus diesem Grund wird das anvisierte Steuerungsmodell auf Grundlage einer geeigneten Transfermethode entwickelt werden. Für die Spezifikation des Steuerungsmodells werden der Ansatz kreati27
ver Netzwerke und eine konstruktivistische Handlungstheorie herangezogen werden,
sodass beide sozialwissenschaftlichen Ebenen - Makro- und Mikroebene - ausgefüllt
werden. Der Ansatz kreativer Netzwerke geht in seinen Ursprüngen der Frage nach,
ob es bestimmte Faktoren gibt, die eine Region wirtschaftlich erfolgreich werden lassen, und nimmt hierbei insbesondere informelle Vernetzungen und das Kreativitätspotential der Akteure ins Visier. Konstruktivistische Handlungstheorien erkennen als
Ursache von Handlungen intern erzeugte Modelle, Ideen oder Weltbilder an, präzisieren diese jedoch nur bedingt als beispielsweise vorrangig ökonomische, ökologische
oder religiöse Handlungsursachen.
Forschungsfragen. Im Rahmen dieser Arbeit sollen folgende Forschungsfragen beantwortet werden:
Zunächst werden gängige politikwissenschaftliche Steuerungskonzepte, die nicht
autopoietisch fundiert sind, als Möglichkeiten zur Beschreibung und Erklärung politischer Steuerungsprozesse diskutiert werden. Hier stellen sich vorrangig zwei Fragen:
Wie werden Steuerungsprozesse im jeweils vorliegenden Ansatz theoretisch
erfasst?
Warum werden diese Ansätze zur Erklärung und Beschreibung von Steuerungsprozessen verworfen?
Der anschließende zweite Teil befasst sich dann mit der Autopoiesetheorie und dem
anvisierten Steuerungsmodell. Hier gilt es vorrangig zu fragen:
Wie lassen sich moderne Steuerungsprozesse mit Hilfe der Autopoiesetheorie
adäquat beschreiben und erklären?
Ferner müssen hier folgende Teilfragen beantwortet werden:
Wie bzw. mit welcher Methode kann die Autopoiesetheorie wissenschaftstheoretischen Kriterien gerecht werdend von den Naturwissenschaften in die Sozi-
alwissenschaften übertragen werden?
Wie sieht eine sozialwissenschaftliche Interpretation der rational rekonstruierten Autopoiesetheorie aus und lassen sich daraus steuerungstheoretische
Konzepte ableiten?
Wie kann der Ansatz kreativer Netzwerke mit der rational rekonstruierten und
sozialwissenschaftlich interpretierten Autopoiesetheorie verknüpft und auf dieser Grundlage ein Steuerungsmodell bilden?
28
Wie lässt sich das anvisierte Steuerungsmodell mit einer konstruktivistischen
Handlungstheorie spezifizieren?
Verlauf der Arbeit. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Im Teil I werden gängige
Steuerungskonzepte, -ansätze oder -modelle etc. diskutiert, kritisiert und letztlich
verworfen. Die Steuerungskonzepte sollen - neben der inhaltlichen Kritik - abschließend nach den Kriterien „empirische Adäquatheit“, „logische Konsistenz“, „theoretisches Innovationspotential“ und „steuerungstheoretische Effektivität“ bewertet werden. Im Teil II wird es um die Alternative, namentlich die Autopoiesetheorie, gehen,
auf deren Grundlage mit Hilfe des Ansatzes kreativer Netzwerke und einer konstruktivistischen Handlungstheorie ein alternatives Steuerungsmodell komponiert werden
soll.
Ausgangspunkt des ersten Teils sind Steuerungskonzepte, die i.d.R. unter dem
Schlagwort „Planung“ subsumiert werden. Mit den Planungskonzepten sollte ein rationalisierter, analytisch präzise vorgegebener und umfassender Regelungsdurchgriff
der Politik auf die Gesellschaft gewährleistet werden. Das politisch-administrative
System nimmt hier - abgesehen von modernen Planungsansätzen - eine zentrale
Stellung ein; der Staat wird ganz im Sinne Platons als der Steuermann schlechthin
verstanden. In diesem Abschnitt wird es darum gehen, den allgemein gehaltenen
Planungsbegriff aufzuschlüsseln, verschiedene Planungskonzepte darzustellen und
zu kritisieren. Hier soll v.a. deutlich gemacht werden, dass zwar im politischen Alltag
allenthalben geplant wird, in der politikwissenschaftlichen Theorie diese Konzepte
aus gewissen Gründen faktisch keine Rolle mehr spielen.
Mit den Staatstheorien sollen im folgenden Kapitel die mutmaßlich traditionsreichsten
politikwissenschaftlichen Steuerungskonzepte untersucht werden; der Fokus richtet
sich hier auf eine erlesene Auswahl moderner Konzepte. Zwar wird von den Staatstheoretikern eingestanden, dass das politisch-administrative System anders als von
den traditionellen Planungskonzepten angenommen seine zentrale Stellung verloren
habe; dessen Bedeutsamkeit wird jedoch nicht geleugnet, denn gesteuert würde ja
nach wie vor wie auch Steuerungsansprüche vorrangig an den Staat gestellt würden.
Vorgestellt wird Dietmar Brauns Typologie von Staatsmodellen unter Berücksichtigung steuerungstheoretischer Gesichtspunkte; das daraus hervorgehende Destillat
des „Kooperierenden Staates“ wird im Anschluss näher betrachtet. Hernach wird das
Konzept des „aktivierenden Staates“ als eine moderne Weiterentwicklung präsentiert
und in der Folge mit Joachim Hirschs politökonomischem Ansatz eine aktuelle „linke“
29
Staatstheorie angesprochen. Gesellschaftstheorien hingegen nehmen anders als
Staatstheorien eher das steuerungstheoretisch interessante Wirkungsgeflecht zwischen Staat und Gesellschaft ins Visier. Hier soll der in der Literatur wohl geläufigste
Vertreter Uwe Schimank mit der „Theorie sozialer Steuerung“ vorgestellt werden, die
als eine im Laufe der Zeit sehr weit entwickelte Gesellschaftstheorie gesehen werden
kann.
Im anschließenden Kapitel über systemtheoretische Steuerungskonzepte werden
steuerungstheoretisch fokussierte Modelle offener Systeme vorgestellt. Mit der systemtheoretischen Begrifflichkeit sollte u.a. auf die Kritik an Staatstheorien reagiert
werden, wonach nie präzisiert worden ist, wer oder was der Staat eigentlich sei und
wie Steuerungsversuche als Verknüpfung staatlicher und gesellschaftlicher Bereiche
modelliert werden können. Ausgangspunkt ist das politische Systemmodell David
Eastons, der mit dem Input-Output-Konzept in der Politikwissenschaft eine breite Resonanz erfahren hat. Es folgt das Policy-Making-Modell Werner Janns, in dem das
politisch-administrative System zum ersten Mal präzise ausdifferenziert wurde. Abschließend wird Richard Münchs Systemmodell vorgestellt, mit welchem er eine umfassende Konzeption zur Steuerung sozialer Systeme aufgelegt hat.
Planungskonzepte, Staatstheorien und systemtheoretische Modelle wurden mit dem
empirisch festgestellten Sachverhalt konfrontiert, wonach politische Steuerung in
Form von „Durchregieren“ sehr häufig scheitert. In dem nunmehr folgenden Kapitel
sollen Steuerungskonzepte vorgestellt werden, die das politisch-administrative System nicht mehr als zentralen Lenker, sondern lediglich als „einen unter vielen“ begreifen. Zu Beginn wird der Policy-Cycle dargestellt, mit welchem zum ersten Mal der
Steuerungsprozess analytisch ausdifferenziert wurde. Mit dem Akteurzentrierten Institutionalismus folgt ein prominenter Ansatz, der sowohl hierarchische als auch
durch Netzwerke oder Verhandlungen hergestellte politische Entscheidungen als
Grundlage von Steuerung untersuchen möchte. Danach sollen Ansätze aus dem Bereich der Netzwerktheorie bzw. -analyse vorgestellt werden, die das PaS im Rahmen
politischer Steuerung in netzwerkartigen Konglomeraten verorten und ihm somit jedwede übergeordnete Stellung absprechen. Der letzte Abschnitt befasst sich mit Ansätzen und Konzepten, die unter dem Schlagwort „Governance“ firmieren und in der
aktuellen Debatte einen breiten Raum einnehmen.
Im zweiten Teil werden zunächst überblicksartig die wesentlichen Kritikpunkte an den
gängigen Steuerungskonzepten dargelegt. Bevor die Autopoiesetheorie als Grundla30
ge des hier zu entwickelnden politikwissenschaftlichen Steuerungsmodells verwendet
werden kann, gilt es, generelle Voraussetzungen zum Transfer eines Modells oder
einer Theorie von der einen in eine andere Disziplin zu reflektieren. Zunächst einmal
werden generelle Problempunkte ursprünglich naturwissenschaftlicher Modelle, die
Eingang in die Sozialwissenschaften gefunden haben, angesprochen und allgemeine
Überlegungen zu einem Theorientransfer angestellt. Anschließend werden verschiedene Übertragungsmethoden diskutiert werden, von welchen der „Wissenschaftstheoretische Strukturalismus“ als die brauchbarste Variante ausgewiesen wird. Nicht
zuletzt soll in diesem wissenschaftstheoretischen Kapitel die Makro-Mikro-MakroProblematik in den Sozialwissenschaften angesprochen und auf das anvisierte
Steuerungsmodell bezogen werden.
Im Anschluss wird die Alternative „Autopoiese“ näher betrachtet. Hier wird zunächst
die biologische Ursprungstheorie rational rekonstruiert und axiomatisiert. Danach
wird sie sozialtheoretisch interpretiert und auf ihre steuerungstheoretische Tauglichkeit hin überprüft. Aus steuerungstheoretischer Sicht werden vier Steuerungsvarianten abgeleitet, von denen eine - grob beschrieben als „netzwerkartige Steuerung“ im weiteren Verlauf dieser Arbeit zu einem Steuerungsmodell „kreativer PolicyNetzwerke“ ausgebaut werden soll. Die vier Steuerungsvarianten werden entlang der
beiden Dimensionen „Makroebene vs. Ebenenverschränkung“ und „autonome vs.
allonome Systeme“ differenziert.
Hernach werden ausführlich in der Literatur vorliegende autopoietisch fundierte
Steuerungskonzepte diskutiert und kritisiert, v.a. im Hinblick auf die jeweils verwendete Transfermethode und die Konsistenz der Konzepte im Vergleich zur Ursprungstheorie. Weitere Kriterien sind etwa empirische Adäquatheit, theoretisches Innovationspotential und steuerungstheoretische Effektivität. Unterschieden werden kann
zwischen Konzepten, die Kommunikationen oder aber Akteure als Elemente sozialer
Systeme ausweisen.
Nachdem die vorliegenden autopoietisch fundierten Steuerungskonzepte verworfen
worden sind, gilt es, ein eigenes autopoietisch begründetes Steuerungsmodell zu
konzipieren. Zur Spezifikation wird der Ansatz kreativer Netzwerke gewählt und mit
der Autopoiesetheorie wissenschaftstheoretisch adäquat verknüpft. Dabei wird deutlich werden, dass dieser Ansatz mit den meisten der grundlegenden Aussagen und
Begriffen (Axiome) der Autopoiesetheorie kompatibel ist. Als defizitär wird er sich
jedoch in handlungstheoretischer Hinsicht erweisen: Während sich die Autopoiese31
theorie, wie gezeigt werden wird, handlungstheoretisch eher vage äußert und allenfalls eine konstruktivistische Vorgehensweise präferiert, finden sich in dieser Hinsicht
beim Ansatz kreativer Netzwerke keine Hinweise.
Das zu konzipierende Steuerungsmodell muss ergo handlungstheoretisch spezifiziert
werden und zeitgleich mit der Autopoiesetheorie kompatibel bleiben. Hierzu gilt es,
aus dem Fundus konstruktivistischer sozialwissenschaftlicher Handlungstheorien
eine geeignete, d.h. mit der Theorie der Autopoiese kompatible, zu finden. Diskutiert
und auf ihre Kompatibilität hin untersucht werden nun verschiedene solcher Handlungstheorien, genauer Erving Goffmans Handlungskonzeption, Anthony Giddens‘
Theorie der Strukturation, Klaus Hurrelmanns Modell der produktiven Realitätsverarbeitung, Hans Lenks Interpretationskonstrukte, Ernst von Glasersfelds handlungstheoretische Überlegungen aus dem Bereich des Radikalen Konstruktivismus und
nicht zuletzt Hartmut Essers Framing-Konzept.
Im letzten Abschnitt soll das anvisierte Steuerungsmodell dargestellt werden. Dies
geschieht durch eine Kombination mit dem Ansatz kreativer Netzwerke auf der Makroebene und mit der präferierten konstruktivistischen Handlungstheorie auf der Mikroebene. Steuerung erfolgt hier im Rahmen eines „kreativen Policy-Netzwerkes“.
32
Abbildung 1: Ariadnefaden - Konzeption der Arbeit
33
Teil I Gängige politikwissenschaftliche Steuerungskonzepte
2. Rationalitätskonzepte
2.1 Planungsbegriff
2.1.1 Begriffsannäherung
Mit seiner bekannten Aussage „If planning is everything, maybe it's nothing” hat Aaron Wildavsky zu zeigen versucht (1973), dass der Begriff „Planung“ schwer zu fassen ist und sowohl im Alltag als auch in wissenschaftlichen Diskursen eine Unmenge
an möglichen Bedeutungen und Sachverhalten enthalten kann. Dietrich Fürst meint
diesbezüglich, „daß es keine für alle Planungsformen gleichermaßen verbindliche
Definition von Planung gibt“ (Fürst 1993: 105). So lässt sich in der Literatur eine Vielzahl teils verschiedener, teils sehr ähnlicher Definitionen von Planung finden (vgl.
dazu Bechmann 1983: 183 ff.). Einige dieser Definitionen weisen durch Beliebigkeit
erhebliche Mängel auf, sodass nach Lau eine Fülle an „teilweise widersprüchlichen,
teilweise semantisch unbefriedigenden Planungsbegriffe[n]“ gefunden werden könne
(Lau 1975: 59). Andere Autoren behaupten sogar, Planung in einer Definition zu erfassen sei unmöglich (Lenk 1972: 81). Im Folgenden soll es von daher darum gehen,
dem Planungsbegriff ein Stück näher zu kommen und zu verdeutlichen, was Politologen unter Planung verstehen und vor welchem zeitgeschichtlichen Hintergrund sich
der Begriff zunächst bewegt hat. Danach werden in den folgenden Kapiteln entscheidungstheoretische, kybernetische und gesellschaftspolitische Ansätze vorgestellt,
und abschließend werden Kritiken an und Alternativen zu Planung aufgezeigt.
Planung meint vereinfacht „die gedankliche Vorwegnahme des Handelns und geht
jeder einigermaßen rationalen Entscheidung voraus“ (Fürst 2004b: 9). Rational sind
Planungen im Sinne dieser Definition dann, wenn sie effizient und effektiv zugleich
sind. Effizienz bemisst sich über das Verhältnis zwischen Mitteleinsatz und Ertrag,
lässt sich durch Kosten-Nutzen-Kalküle berechnen und ist damit ein ökonomisches
Maß. Effektivität beschreibt den Zielerreichungsgrad. Ihr geht es um die Feststellung,
inwieweit die anvisierten Ziele mit den eingesetzten Mitteln erreicht worden sind. Planung unterscheidet sich somit von anderen, im Alltag geläufigeren Entscheidungsverfahren, z.B. vermeintlich plausiblen ad-hoc-Entscheidungen oder instinktivem Verhalten, durch rationale Verfahrensweisen und damit eine vermeintlich verbesserte
Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung (vgl. Dose 2003: 374).
34
Rationalität ist im Übrigen dasjenige Kriterium, welches in allen Definitionen von Planung vorkommt, aber auch ganz unterschiedlich definiert werden kann. Max Weber
bestimmt rationale Entscheidungen beispielsweise als nachvollziehbare Entscheidungen. Alternativ lässt sich Rationalität in Planungskonzepten auch materiell betrachten; dann geht es um die Planung einer Policy, die gesellschaftlichen Erwartungen entspricht, d.h. legitim und konsensual sein soll (vgl. Fürst 2004b: 9). Allerdings
darf nicht übersehen werden, dass die Nennung konkreter Ziele in diesem Verständnis häufig scheitern kann, etwa dann, wenn es um die Frage geht, was denn ein
Stadtviertel tatsächlich „wohnlicher“ mache - mehr Grün oder mehr Einkaufsmöglichkeiten (vgl. Dörner 2010: 68).
Ein generelles Ziel jeder Planung liegt darin, jedwede „drohende, nicht gewünschte
künftige Zustände (Gefahren, Katastrophen) zu vermeiden“ (Hanisch 1999: 43).
Grundidee von Planung ist damit „die Idee der Gestaltbarkeit der Gesellschaft und
damit der Machbarkeit von Geschichte gemäß bestimmter Prinzipien“ (Jann 1995:
472). Dieser Gedanke ist fest verbunden mit der wissenschaftlichen Beschäftigung
mit Rationalität während der Aufklärung, denn die damaligen Philosophen „glaubten
an eine rationale Gestaltbarkeit der sozialen Umwelt. Diese Einsicht, daß die soziale
Ordnung nicht einer göttlichen Ordnung entspricht, sondern von Menschen gemacht
und damit veränderbar ist, führte rasch zu Versuchen, diese Veränderungen planhaft
vorzustrukturieren“ (Lau 1975: 11 f.). Moderner Planung geht es darum, „die Möglichkeiten kollektiven Handelns zu steigern und den Bereich der durch kollektive Entscheidungen wählbaren Ziele zu erweitern“ (Hesse 1987: 381).
2.1.2 Begriffsabgrenzungen
Bei „Planung“ handelt es sich um einen in der Alltagssprache weit verbreiteten Begriff. Es sollte auch nicht übersehen werden, dass es kaum eine einzige von der
scientific community akzeptierte Definition gibt, sondern dass zahlreiche Autoren eigene Definitionen präsentieren (vgl. Selle 2004b: 144). Deshalb gilt es, den Planungsbegriff von anderen Begriffen zu unterscheiden, die auf den ersten Blick eine
ähnliche Bedeutung suggerieren. Diese Problematik ist hinlänglich bekannt, soll an
dieser Stelle aber auch nicht exegetisch diskutiert werden (vgl. Fürst 2004c: 239).
Planung meint zunächst etwas anderes als Plan: „Planung ist die auf den Erlaß eines
Planes zielende Tätigkeit; der Plan ist das Produkt dieser Tätigkeit“ (Maurer 2006:
429). Planungssystem bezeichnet „die auf eine bestimmte Aufgabe (z.B. Raumpla35
nung) bezogene Institutionalisierung der Planung (rechtliche Grundlagen, Aufbauund Ablauforganisation der Planung), die für das Planungssystem relevanten Planarten und deren Arbeitsteilung, die Instrumente und systemspezifischen Methoden der
Planung sowie die ‚Planungsinfrastruktur‘ (Ausbildungsgänge, Publikationsorgane,
Professionellen-Vereinigungen)“ (Fürst 1995: 709). Darüber hinaus weist Dietrich
Fürst auf die Ähnlichkeit der Begriffe „Planung“ und „verwaltungsmäßige Entscheidungsvorbereitung“ hin und stellt in diesem Zusammenhang berechtigte Fragen:
„Wenn Planung Entscheidungsvorbereitung ist, ist dann nicht jedes Verwaltungshandeln Planung, sofern es Entscheidungsentwürfe hervorbringt wie z. B. Gesetzentwürfe, Entwürfe für Verordnungen und Verwaltungsvorschriften? […] Was meint man,
wenn man von Landschaftsplanung oder Raumplanung oder Stadtplanung spricht?
Meint man damit nicht alle Aktivitäten, die zum Ergebnis haben, Pläne oder Programme zu entwickeln und fortzuschreiben, nach denen sich Behörden und/oder Private zu richten haben?“ (vgl. Fürst 2004b: 10). Eine Unterscheidung könne von daher nur graduell stattfinden.
Fürst nennt in diesem Zusammenhang drei Unterscheidungskriterien, die einen Prozess als Planung ausweisen: Erstens müsse der Verlauf der Entscheidungsvorbereitung einen so hohen politischen Stellenwert gewinnen, damit der Prozess eine eigene Qualität gewinne. Zweitens müssten verschiedene betroffene Interessen systematisch abgewogen und nicht nur in für Verwaltungsverfahren typischen Routinen behandelt werden. Drittens müsse das Ergebnis des Prozesses ein eigenständiger Plan
mit verbindlichen Planzielen oder einer hohen Selbstbindung der Behörde sein, und
nicht nur Entscheidungsgrundlage für weitergehende Diskussionen (vgl. ebd.). In
diesem Verständnis habe Planung allerdings nicht mehr die Aufgabe, mögliche Alternativen neutral für die Entscheidenden aufzubereiten, sondern vielmehr eine Vorentscheidung zu treffen, die dann lediglich durch die rechtlich legitimierten Personen
bestätigt werden muss. Von daher sei es aus dieser Perspektive nur bedingt sinnvoll,
Planung und Entscheidung als disjunkte Sphären zu betrachten.
All diese Begriffsklärungen drehen sich um den Begriff „Planung“. Andere Begriffskombinationen, die diesen Begriff enthalten, werden im Rahmen dieser Arbeit nicht
diskutiert werden. Im Rahmen einer umfassenderen Planungsdiskussion müsste
dann geklärt werden, wer z.B. Planer ist und wer nicht, was alles als Fachplanung
bezeichnet werden kann oder inwieweit Planung(-stheorie) normativ sein darf (vgl.
Selle 2004b: 146 ff.).
36
2.1.3 Politische Planung
Hier geht es nun nicht um Urlaubs- oder Familienplanung, sondern um politische
Planung; Planung ist damit im politisch-administrativen System angesiedelt. Alle politikwissenschaftlichen Planungsverständnisse teilen die Ansicht, wonach das Steuerungssubjekt „Staat“ das Steuerungsobjekt „Gesellschaft“ prinzipiell regulieren kann;
politische Steuerungskrisen mahnten lediglich eine Verbesserung der politischen
Steuerungskapazitäten an. Ob denn das politische System überhaupt steuerungsfähig bzw. die Steuerungsobjekte steuerbar seien, wurde während der Jahre der Planungseuphorie kaum hinterfragt. Hauptaufgabe sei deswegen eine „,Rationalisierung
der Politik‘ […], wobei Politischer Planung und damit der entsprechenden verwaltungswissenschaftlichen und politikwissenschaftlichen Theorie eine zentrale Bedeutung zukommt“ (Görlitz/ Burth 1998: 83). Planung soll damit ganz allgemein den
Handlungsspielraum von Politik durch rationale Verfahren erhöhen und somit Grundlage allen Handelns der öffentlichen Verwaltung sein (vgl. Dose 2003: 374).
Insbesondere während der Hochzeit von Planung wurde davon ausgegangen, dass
Planung „die am weitesten fortgeschrittene Problemlösungsstrategie gegenüber den
anstehenden Problemlagen“ in einer immer komplexer werdenden Welt sei
(Naschold 1973: 59). Planungskonzeptionen wurden im Rahmen der Diskussion um
Gesellschaftsreformen forciert, von daher ging es um eine „Verknüpfung rein planungstechnischer Fragestellungen mit Problemen der effektiven Steuerung gesellschaftlicher Teilsektoren sowie normativen Diskussionen über die inhaltlichen Zielsetzungen und die demokratische Legitimation einer derart weitreichenden Politischen Planung“ (Görlitz/ Burth 1998: 85). Gedankliches Fundament solcher klassischen Planungskonzepte ist die ontologische Annahme, dass das Sein real existiere,
erkennbar, kausal determiniert und in dieser Hinsicht veränderbar sei (vgl. Warzecha
2004: 39 f.).
Analytisch lässt sich Planung im politisch-administrativen System exemplarisch wie
folgt aufschlüsseln: Zentraler Planer politischer Planung ist das politischadministrative System. Innerhalb des politisch-administrativen Systems kann vertikal
zwischen einem Aufgabenplanungs-, einem Ressourcenplanungs- und einem Entscheidungsstrukturplanungssystem unterschieden werden. Im Aufgabenplanungssystem werden wünschenswerte Zustände der Systemumwelt bzw. politische Ziele
wie Bedürfnisse und Werte, und entsprechende Programme entwickelt. Der Ressourcenplanung geht es sowohl um die Erhaltung und die Erweiterung gesamtgesell37
schaftlicher Ressourcen, z.B. durch die Beförderung eines hohen Wirtschaftswachstums, als auch um die Aneignung von Ressourcen für das politische System. Die
Entscheidungsstrukturplanung bezieht sich schließlich auf die formelle und informelle
Organisation des Ablaufs (vgl. Schatz 1973: 12).
In allen drei Bereichen kann zwischen unterschiedlichen Rationalitäts-, Informations-,
Motivations und Organisationskriterien unterschieden werden (vgl. Naschold 1973:
64). So behandelt die Ressourcenplanung Zielprobleme in Form von Knappheitsrelationen; die Programmplanung hingegen versteht solche Probleme instrumentalistisch
(vgl. ebd.: 77).
Auf horizontaler Ebene werden eine strategische, eine taktische und eine operative
Planungsebene unterschieden. Strategische Planung bedeutet eine längerfristige
Aufgabenplanung, bei der antizipierte Zustandskonstellationen in ihren Auswirkungen
und Vernetzungen durchdacht werden. Eine entsprechende Planungstechnik ist beispielsweise die kausale Modellierung. Darauf fußt taktische Planung, die mittelfristige
Programme mit Hilfe von z.B. Kosten-Nutzen-Analysen konzipiert. Diese Planungsebene fundiert wiederum operative Planungen, denen es um die Realisierung einzelner Projekte geht, z.B. durch empirische Sozialforschung (vgl. ebd.: 64).
38
Abbildung 2: Politisch-administratives System als rationales Planungssystem nach
Görlitz/ Burth 1998: 87.
2.1.4 Planungsfunktionen
Fritz W. Scharpf bestimmte Politik schon 1973 als "die Möglichkeit kollektiven Handelns bei nicht vorauszusetzendem Konsens" (Scharpf 1973b: 33). Hier schloss die
neuere Planungsforschung an und übernahm die Definition von Planung als Koordinations- und Konsensfindungsprozess, die verstanden wurde „als eine Technik der
vorwegnehmenden Koordination einzelner Handlungsbeiträge und ihrer Steuerung
über längere Zeit. Planung steigert so die Möglichkeiten kollektiven Handelns und
erweitert den Bereich der durch kollektive Entscheidungen wählbaren Ziele“ (ebd.:
38). In diesem Sinne ist Planung nicht das vielzitierte zielorientierte Handeln, denn
Umsetzung und Evaluation sind nicht Bestandteil von Planung; es lassen sich jedoch
auch andere Ansichten in der Literatur finden (z.B. bei Fürst 1993: 105).
Scharpf differenzierte Planung im Politischen System auf der Grundlage von Eastons
Systemmodell weiter aus. Die Black Box unterteilte er in Strukturen, womit politische
Institutionen gemeint sind, und Prozesse, in denen politische Entscheidungen präformiert werden (vgl. Scharpf 1973b: 41). In diesem Rahmen existieren in Planungsprozessen zwei grundlegende Aufgabenbereiche: Dabei handelt es sich erstens um
39
wissenschaftlich angeleitete Informationsverarbeitung zur Lösung der gestellten Planungsaufgaben. Zweitens nennt er Konsensbildung als weitere Funktion von Planung. (vgl. ebd.: 43 f.). Beide Prozesse können zwar analytisch getrennt gedacht
werden; in der Wirklichkeit verlaufen sie jedoch nie losgelöst von einander. Planung
ist damit auf der Informationsseite zu verorten und kann laut Scharpf „als Verstärkung und Systematisierung der Informationsverarbeitung im Auswahlprozeß definiert
werden“ (ebd.: 45).
Nach Dietrich Fürst hat Planung vier fundamentale Funktionen, genauer
dass sie anstrebt, „frühzeitig auf Probleme Einfluß zu nehmen, indem sie die
Problemwahrnehmung, Problemdefinition und den möglichen Problemlö-
sungsraum vorzustrukturieren versucht (Frühwarnfunktion),
die Zeitachse des Handelns in die Zukunft verlängert (Orientierungsfunktion),
durch Berücksichtigung von sachlichen Interdependenzen und deren interessenabhängigen Bewertung Ziel- und Maßnahmekonflikte frühzeitig ausräumt
(Koordinationsfunktion) und
(in Einzelfällen) die Verhärtung von Verteilungs- und Interessenkonflikten zugunsten gemeinwohlorientierter, kooperativer Lernprozesse aufzulösen versucht (Moderationsfunktion)." (Fürst 1995: 709).
Planung meint somit nicht nur Entscheidungsvorbereitung, sondern weist auch wertende und damit (vor-)entscheidende Aspekte auf. Laut Fürst sei das wesentliche
Kriterium zur Unterscheidung von Planung und Entscheiden das „Mehr“ an Rationalität. Allerdings würde nur so viel Rationalität Eingang in den Plan finden, wie es die
Entscheider zuließen bzw. inwieweit diese ihre Entscheidungen auf Planung fundierten. Von daher könne die Funktion des Entscheidens nur schwerlich von der der Planung getrennt werden (vgl. Fürst 2004b: 11). Jochen Hanisch weist darauf hin, dass
im Zuge einer Planung eine Vielzahl an Entscheidungen getroffen werden müssten:
„Investoren entscheiden über Bauvorhaben, […] Behörden, die Genehmigungen
aussprechen oder Planfeststellungsverfahren durchführen, entscheiden über die Zulässigkeit von Infrastrukturmaßnahmen [unter Berücksichtigung der, der Verf.] Ergebnisse einer Umweltverträglichkeitsprüfung, […] Städte und Gemeinden entscheiden über ihre Flächennutzungsstruktur, […] Planer und Planerinnen […] über ästhetische Formen und Materialien, […] Gerichte müssen entscheiden, ob die verschiedenen Akteure am Entscheidungsprozeß bestehende Vorschriften richtig angewendet
40
haben“ (Hanisch 1999: 87). Andere Autoren bestehen wiederum auf die analytische
Trennung von Planung und Entscheidung. So spricht Carl Böhret etwa davon, dass
ein guter Plan sich durch Alternativen und nicht nur Varianten einer Alternative auszeichne. Die Entscheidungsmöglichkeit des Politikers dürfe nicht reduziert werden
(Böhret 1975: 15).
Es darf nicht übersehen werden, dass gerade die Zukunftsorientierung der Planung
zur Antizipation kommender Probleme einige gravierende Schwierigkeiten mit sich
bringt. Erstens würden Betroffene eines potentiellen Plans während der Planungsphase noch gar nicht zu ermitteln sein. Dies gilt beispielsweise für die Bewohner eines neuen Wohngebiets. Selbst wenn sie identifiziert wären, könnten sie womöglich
keine Bedürfnisse konkret benennen. Zweitens sei es üblich, die eigenen Interessen
erst dann forciert zu vertreten, wenn sie unmittelbar berührt seien (vgl. Scharpf
1973b: 47). Dies zeigt sich etwa im Hinblick auf ökologische Gefahren, die seit langem bekannt, aber erst seit kurzem mit adäquaten umweltpolitischen Maßnahmen
bekämpft werden. Je weiter ein bestimmtes Interesse in der Zukunft liege, desto
schwächer würde dafür gekämpft bzw. geplant.
2.1.5 Plan- und Planungstypen
Hartmut Maurer nennt in der Summe acht verschiedene Plantypen: Haushaltspläne
sämtlicher Gebietskörperschaften, Raumordnungspläne, den Bedarfsplan für die
Bundesfernstraßen, Pläne im umweltrechtlichen Bereich, soziale Bedarfspläne, Pläne im Bildungs- und Hochschulbereich, behördeninterne Dienstpläne (Verwaltungsvorschriften) und nicht zuletzt personenbezogene Pläne, etwa zur Resozialisierung
eines Strafgefangenen (vgl. Maurer 2006: 424 ff.).
Bei den Raumordnungsplänen unterscheidet er ferner zwischen raumordnender Gesamtplanung und raumbezogener Fachplanung. Bei ersterer handelt es sich um
räumliche Entwicklungsplanungen. Dabei geht es um eine umfassende Koordination
von Projekten zum Zweck einer nachhaltigen Entwicklung von Gemeinden und Regionen. Diese Planungsvorhaben werden von Behörden, Gemeinden, Ministerien, Regierungspräsidien etc., aber auch privaten Organisationen durchgeführt. Die Fachplanungen hingegen umfassen lediglich die Planung einzelner Projekte, also beispielsweise den Bau einer Umgehungsstraße oder die Erschließung eines Neubaugebietes (vgl. Fürst 2004b: 9). Laut Dietrich Fürst unterscheiden sich die beiden Planungsbereiche folgendermaßen: „Räumliche Entwicklungsplanungen koordinieren
41
mehrere Fachplanungen räumlich und werden deshalb ‚querschnittsorientiert‘ genannt, während die Fachplanungen als ‚Sektorplanungen‘ bezeichnet werden, weil
sie nur den Ausschnitt der Wirklichkeit berücksichtigen, der für das Ressort/die Behörde qua ihrer Kompetenzzuweisung wichtig ist“ (ebd.). Oder kurz gefasst:
Querschnittsplanung macht Vorgaben für Sektorplanung. Raumplanung weist laut
Fürst für bürokratisch organisierte Staaten insofern Schwierigkeiten auf, als dass sie
auf die Kooperation verschiedener Einheiten setzt. Hierarchien und formale Regelsysteme würden dadurch gestört, es entstünden Konflikte zwischen den Kommunen,
einzelnen Fachressorts oder unterschiedlichen föderalen Ebenen (Fürst 1998: 53).
Daneben existieren noch weitere Differenzierungsmöglichkeiten für Planung, etwa in
Bezug auf den Zeithorizont (kurz-, mittel- und langfristige Planung) oder im Hinblick
auf den Planungsgegenstand; Inputplanung meint z.B. die Organisation und Verteilung von Ressourcen wie Finanzen und Personal, Outputplanung konzentriert sich
auf die Formulierung von Lösungswegen, Aufgaben oder bestimmten Zielen (vgl.
Dose 2003: 374). Nach dem Zeithorizont differenzierte Planungstypen lassen sich
beispielsweise auch nach dem zeitlichen Planungshorizont, dem Realisierungshorizont und dem Wirkungshorizont differenzieren (vgl. Bechmann 1981: 114). Andere
Unterscheidungskriterien in Bezug auf Planung sind etwa die Steuerungsqualität
(Negativ- vs. Positivplanung) oder die institutionelle Einbindung, z.B. fachübergreifende, integrierte Planung und Sektorplanungen (vgl. Fürst 1995: 708). Fazit dieser
knappen Übersicht: Während in der Politikwissenschaft Planung aus noch zu zeigenden theorieimmanenten Gründen kaum noch eine Rolle spielt, ist sie wesentlicher
Bestandteil des politischen Alltags.
2.1.6 Planungstheorie
Wie Planung aussehen soll, besagt die Planungstheorie, der es darum geht, „ein
Kompendium an Instrumenten und Methoden, wie für den jeweiligen Gegenstandsbereich künftige Zustände erreicht werden können“, bereitzustellen (Hanisch 1999:
68). Planungstheorie geht es folglich um eine „wissenschaftstheoretisch und sozialwissenschaftlich fundierte kritische Reflexion und Explikation realer Planungsphänomene, Planungskonzepte und planerischer Handlungsmodelle, der spezifischen gesellschaftlichen Funktionen, Implikationen, Leistungen, geplanten wie ungeplanten
Wirkungen von Planung sowie der widersprüchlichen und konflikthaften gesellschaftlichen Rahmenbedingungen“ (Konter 1998: 109 f.). Dazu können auch Überlegungen
42
bezüglich normativer Konzeptionen gehören, wenn es etwa um einen Plan umrahmende Leitbilder geht (vgl. Bechmann 1981: 49).
Planungstheorie ist nicht einer bestimmten Wissenschaftsdisziplin zugehörig; sie
zeichnet sich durch eine gewisse Multidisziplinarität aus (vgl. Konter 1998: 107). Außerdem ist sie selbst nur geringfügig empirisch fundiert. Es existieren kaum umfassende Untersuchungen, sondern zumeist Einzelfallstudien, die sich etwa mit einzelnen Instrumenten oder innovativen Beispielen, gerade im Bereich der Stadtplanung,
befassen. Nur selten werden kursorische Gesamtüberblicke geboten (vgl. Selle
2004b: 154). Zur genaueren Verortung planungstheoretischer Arbeiten und Ausweisung von Untersuchungsbereichen hat Christoph Lau aufbauend auf einem Konzept
Frieder Nascholds eine genetische (prozessuale), eine strukturelle und eine funktionale Dimension von Planungstheorie jeweils nach theoretischer und praktischer Kontingenz unterschieden (vgl. Lau 1975: 69 f.):
Kontingenzaspekt
Praktische Kontingenz
Theoretische Kontingenz
Genetische Dimension
Entstehungszusammenhang
von Planungssystemen
Entwicklung von
Rationalitätsbegriff und
Planungsdenken
Strukturelle Dimension
Organisationsstruktur von
Planungssystemen
Logische Struktur von
Planungskonzepten
Funktionale Dimension
Planungsfunktionen, Restriktionen und Chancen gesellschaftlicher Planung
Funktionen von Planungskonzepten und
Planungsideologien
Tabelle 1: Planungstheoretische Problemdimensionen nach Lau 1975: 70.
Dietrich Fürst stützt sich in seiner kritischen Betrachtung der Planungstheorie auf das
bekannte Politikmodell David Eastons (vgl. Fürst 2004c: 242). Demnach seien Planungsphasen auf der Input- und Outputseite des Modells recht gut erforscht. Schwächen weise die Planungstheorie hingegen in Bezug auf die Throughput- und
Outcome-Phase auf.
43
Die Schwächen der Throughput-Phase sind insbesondere dem Umstand geschuldet,
dass Easton das Innenleben des Politischen nicht weiter ausdifferenziert und stattdessen als „Black Box“ bezeichnet hat. Stattdessen würden zur Beschreibung und
Erklärung v.a. der Throughput-Planungsprozesse Theorien aus anderen Disziplinen
importiert, etwa die Spieltheorie. Dieser Import sei v.a. dem starken Praxisbezug des
deutschen Planungssystems als auch der geringen Zahl an Lehrstühlen geschuldet
(vgl. ebd.: 245). So verwundern die diesbezüglichen Schwachstellen der Planungstheorie umso weniger; zunehmend informelle Planungsprozesse ließen sich laut
Fürst empirisch kaum erfassen. Dies gelte noch viel mehr für die darin ablaufenden
Planungs- und Informationsverarbeitungsprozesse, Maßnahmen- oder Interessenkoordinationen. Unklar bleibe auch das Verhältnis von Institutionen zu Planungsprozessen und -stilen.
Auf der Outcome-Seite macht Fürst folgende Schwachstellen aus: Erstens müsste
anstelle einer ausbleibenden Evaluation das Verhältnis bzw. Vermittlungsprozesse
zwischen Planern und Adressaten verstärkt in den Fokus gerückt werden, damit Pläne wirklichkeitsnäher geschmiedet würden. Zweitens müssten dann die Reaktionen
der Adressaten auf Planungseffekte untersucht werden, um negative Auswirkungen
zukünftig vermeiden zu können. Drittens sollten Rückwirkungen von Planungsergebnissen auf kommende Inputs untersucht werden; Planung müsste somit als „kontinuierlicher Lernprozess“ verstanden werden (vgl. ebd.: 243 f.).
Planungstheorie hat sich während der Hochzeit der Planung in eine systemische
bzw. handlungstheoretische und eine politökonomische Variante ausdifferenziert
(vgl. Lau 1975: 27 ff.). Der handlungs- bzw. systemtheoretische Ansatz unterscheidet
zwischen
entscheidungstheoretischen,
kybernetisch-systemtheoretischen
und
inkremental-pragmatischen Ansätzen (vgl. Fürst 1995: 710, zu den Details siehe die
folgenden Kapitel). Politökonomische Konzepte analysieren „die Funktion staatlicher
Planung in einem kapitalistischen System (mit dessen eigentümlichen strukturellen
Konfliktlagen) sowie die Restriktionen der Planung in marktwirtschaftlichen Steuerungsstrukturen“ (Lau 1975: 27). Ähnlich nehmen gesellschaftspolitische Ansätze
Auswirkungen und Interaktionen der planenden Politik mit ihrer gesellschaftlichen
Umwelt allgemeiner ins Visier (vgl. Görlitz/ Burth 1998: 101); von daher werden politökonomische Planungskonzepte hier den gesellschaftspolitischen zugeordnet. All
diese Ansätze außer den politökonomischen haben die weitere Planungsdiskussion
entscheidend geprägt, obwohl allgemein anerkannt war, dass letztere „beträchtlich
44
höhere theoretische Erklärungskraft, empirische Bewährung sowie strategische
Fruchtbarkeit […] besitzen“ (Naschold, zit. nach Lau 1975: 66). Im Folgenden werden
entscheidungstheoretische, gesellschaftspolitische, kybernetische und inkrementelle
bzw. alternative Planungskonzepte diskutiert werden (zur Gliederung vgl. Görlitz/
Burth 1998: 90 ff.).
2.2 Entscheidungstheoretische Ansätze
2.2.1 Kennzeichen entscheidungstheoretischer Ansätze
Die entscheidungstheoretischen Ansätze bezwecken eine Optimierung von Entscheidungsverläufen in Planungsprozessen. Ursprünglich aus dem militärischen Bereich stammend, gelangten sie im Rahmen der US-amerikanischen Mondfahrtmissionen als „Systemanalyse“ zu einem glanzvollen Höhepunkt. Der Erfolg der Systemanalyse im technischen Bereich bestand in der offensichtlich richtigen Beantwortung
tausender im Rahmen von Entwicklungsprozessen gestellter Einzelfragen, sodass
sie auch auf andere Bereiche übertragbar erschien: „Die Sanierung der Slums, die
Reinhaltung von Luft und Wasser, die gerechte Verteilung des von unserem Volk in
einem Jahr erarbeiteten Vermögens und die Beteiligung der Bürger an den ihr
Schicksal bestimmenden Zielbildungsprozessen muß mit dem gleichen Methodensatz in Angriff genommen werden, welcher der Weltraumforschung eine ,zweite kopernikanische Wende‘ ermöglichte: der Systemanalyse“ (Nagel 1971: 3 f.).
In der Bundesrepublik wurde die Systemanalyse vornehmlich zur Verbesserung von
verwaltungstechnischen Abläufen verwendet. Voraus gingen leistungskritische Überlegungen, die Alfred Nagel in folgender Frage nebst Antwort zuspitzte: „Besitzen die
praktische sowie wissenschaftliche Politik und Verwaltung der Bundesrepublik […]
bereits ein leistungsfähiges Entscheidungshilfemittel, das es ihnen gestattet, zu jedem unerwartet auftauchenden Problem in gesetzter Zeit und bei begrenztem Informationsstand systematisch, rational und nachvollziehbar eine tragfähige Entscheidung zu erarbeiten, welche die Ziele der betroffenen Bürger nachweisbar ihrer Verwirklichung näher bringt? Das ist die Schlüsselfrage […]. Wir können Sie getrost verneinen“ (ebd.: 1). All diesen Ansätzen geht es somit darum, „das politischadministrative System als zentralen Planungs- bzw. Steuerungsakteuer zu einem in
diesem Sinn rational handelnden Entscheidungssystem umzustrukturieren“ (Görlitz/
Burth 1998: 90). In diesem Sinne handelt es sich um normative Ansätze.
45
Die Systemanalyse konzentriert sich besonders auf die Zweck-Mittel-Rationalität und
ein lineares Entscheidungsverhalten, welches auf den Einbau von Rückkopplungsmechanismen verzichtet. Ganz allgemein geht es darum, das potentielle Entscheidungsfeld zu ordnen und Entscheidungsprozesse zu systematisieren. Systemanalyse
kann definiert werden als „ein Entscheidungshilfsmittel, das ein Problem definiert und
seine Lösung in der Form von fünf Grundelementen in Angriff nimmt: einem Ziel oder
einer Anzahl von Zielen; Maßnahmen, mit denen die Ziele verwirklicht werden können; Kosten oder Ressourcen, die für jedes Handlungssystem aufzubringen sind;
einem logischen oder mathematischen Modell, in dem die denkbaren Maßnahmen
systematisch angesichts gewichteter Ziele hinsichtlich des Nutzens, der Kosten und
anderer Konsequenzen verglichen werden können; einer Entscheidungsregel zur
Auswahl der geeignetsten Alternativen“ (Nagel 1971: 25). Damit sind auch schon
wesentliche Begriffe der Systemanalyse genannt, allerdings gibt es „nur wenige gelungene Versuche, Systemanalyse knapp und auch für den Außenstehenden prägnant zu definieren“ (ebd.: 16). Diese fünf Schritte lassen sich nun nicht nur in einem
linearen Ablauf vorstellen, sondern auch im Hinblick auf ihre Verschränkungen untereinander, sodass sich folgende Grafik ergibt:
Abbildung 3: Systemanalyse und Planungsprozess nach Rudwick 1973: 337.
Darüber hinaus sollen diese Verfahren auf quantifizierbaren Daten beruhen, ohne
jedoch auf qualitative Ergänzungen zu verzichten (vgl. Nagel 1971: 22). Denn trotz
46
quantitativer Daten kann Systemanalyse keine eindeutigen Entscheidungen garantieren und gleicht dementsprechend eher einem iterativen Vorgehen.
Nicht übersehen werden darf, dass zumindest analytisch ein Unterschied zwischen
„Systemanalyse“ und „Entscheidungsprozess“ besteht. Rudwick besteht darauf, „daß
Systemanalyse eine Hilfe für den Entscheidungsträger ist“ (Rudwick 1973: 338);
Schweizer hingegen erkennt eine synonyme Verwendung der Begriffe Systemanalyse und „entscheidungstheoretische Ansätze“ (vgl. Schweizer 203: 36).
Schwerpunktmäßig fundieren entscheidungstheoretische Ansätze auf einem geschlossenen Modell, das aus drei Prämissen besteht (Naschold 1972a: 33):
1. Geringe Umweltkomplexität. „Geschlossen“ meint hier, dass der Entscheidende oder das Planungssystem die Umwelt prinzipiell vernachlässigt, sei es, weil
sie für Systementscheidungen keine Rolle spielt, oder sei es, weil sie nur wenig komplex bzw. stark strukturiert ist und somit vom Planungssystem kontrolliert werden kann. Allerdings gestehen manche Vertreter der Systemanalyse
auch eine andere Betrachtungsweise ein: „Die Umwelt des Systems kann
nicht als fest strukturiert und überschaubar angenommen werden, sondern ist
als komplex, unübersichtlich und sich wandelnd anzusehen. Das Ausmaß der
Umweltkontrolle des Systems […] ist abhängig vom Grad der Information und
Rationalität des Systems und der Komplexität der Umwelt. Je weniger komplex die Umwelt ist, um so einfacher ist die Entscheidungssituation des Systems und um so größer die Möglichkeit der Umweltkontrolle. Je größer der Informationsgehalt und Rationalitätsgrad der Systementscheidungen, um so
größer auch seine Umweltkontrolle“ (ebd.: 32).
2. Hohes Rationalitätsniveau. Weiterhin wird der Entscheider als homo oeconomicus modelliert. Diesem wird ein hohes Rationalitätsniveau unterstellt, wonach er „alle Werturteile in konsistenter und transitiver Weise zu einer einheitlichen Werteskala“ zusammenfassen kann (ebd.: 33).
3. Hohes Informationsniveau. Dem Entscheidenden seien demnach alle Handlungsmöglichkeiten und -folgen bewusst. Es kann jedoch zwischen gewissen
oder wahrscheinlichen Handlungsfolgen unterschieden werden; man spricht
dann von Handeln bei Gewissheit, Risiko oder Ungewissheit. Entscheiden unter Risiko heißt, dass der Akteur den Ausgangszustand nicht kennt, aber sein
Eintreten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angeben und damit die Konsequenzen einer Handlungsalternative berechnen kann. Entscheiden unter
47
Ungewissheit bedeutet hingegen, nicht einmal die Wahrscheinlichkeiten des
Eintretens einer Ausgangssituation zu kennen (vgl. Bechmann 1981: 100).
In Bezug auf politische Planung muss folgendes ergänzt werden: Staatliches Handeln und gesellschaftliche Effekte werden in Modellen über einfache kausale Wirkungsketten verbunden. Ob hierarchische Steuerung überhaupt möglich ist, wird
nicht thematisiert. Aus diesem Grund werden die Umweltverhältnisse zudem als konstant betrachtet. Darüber hinaus wird gesellschaftliche Teilhabe oder gar Selbststeuerung nicht thematisiert (vgl. Ritter 1987: 339).
2.2.2 Exemplarisch: Carl Böhrets Modell rationaler Entscheidung
In der Literatur werden zahlreiche Modelle dem entscheidungstheoretischen Ansatz
zugeordnet. Klassisch ist die Einteilung in Fixzielmodelle, Optimierungsmodelle und
Alternativenauswahlmodelle. Diese sollen hier nur kurz angeschnitten werden; näher
erläutert werden sie ausführlich in der Literatur (vgl. dazu Lau 1975: 73 ff. oder Görlitz/ Burth 1998: 91 ff.). Fixzielmodelle setzen bekannte Informationen über Umwelt
und Ziele voraus, letztere gelten zudem als unveränderbar. Hier gilt es adäquate Instrumente zur Erreichung der Ziele zu finden. Ausgeblendet wird dabei, dass Ziele
nicht miteinander kompatibel sein können. Aus diesem Grund wurden Optimierungsmodelle entwickelt: Grundlage ist hier eine auf ökonomischen Kriterien basierte
soziale Nutzenfunktion, die maximiert werden soll. Ziele sollen dann gegeneinander
und im Hinblick auf gegebene Mittel abgewogen und ggf. variiert werden. Beide Modelle gehen von der unrealistischen Annahme aus, dass „vollständige Informationen
über den Kausalzusammenhang zwischen Mitteleinsatz und Zielerreichung vorausgesetzt und die eindeutige Trennbarkeit von Zwecken und Mitteln“ haltbar sei (Görlitz/ Burth 1998: 93). Das Alternativenauswahl verzichtet auf eine soziale Nutzenfunktion. Es bewertet stattdessen Handlungsalternativen nach ihren Konsequenzen und
bringt sie dann in eine Rangfolge.
Es darf nicht übersehen werden, dass diese entscheidungstheoretischen Ansätze zu
generell und damit auch für die Politik bzw. die Politikwissenschaft nur bedingt tauglich sind, was z.B. auch Carl Böhret feststellte: „Ein unmittelbar auf die Entscheidungsproblematik der Regierung in den westlichen demokratischen Systemen bezogenes Modell, das als spezifischer Orientierungsrahmen für die Entwicklung und den
Einsatz von Entscheidungsinstrumenten dienen könnte, ist jedoch noch zu entwickeln“ (Böhret 1970: 40). Zur Behebung dieses Mangels entwickelte er ein politologi48
sches Modell rationaler Entscheidung, mit welchem heuristisch die wichtigsten Faktoren einer politischen Entscheidungsfindung aufgezeigt werden sollten. Böhret formulierte das Modell verbal und verzichtete damit auf eine schematische oder formallogische Darstellung: „Der Grund dafür ist in der Komplexität des politischen Entscheidungsfeldes, aber auch in Schwierigkeiten einer allgemein anerkannten Begriffsbildung zu suchen, so daß sich vor allem Probleme bei der Formulierung und Operationalisierung politischer Beziehungsgeflechte ergeben“ (ebd.: 41). Der Modellgehalt
besteht aus folgenden Komponenten:
Zunächst einmal führt er den homo politicus anstelle des homo oeconomicus
ein: „Ihn zeichnet aus, daß er die Rationalisierung der Entscheidung als
,technisch-instrumentellen Vorgang‘ mit Zielsetzungen (politischem Programm) und mit von der Entscheidungsstruktur auferlegten Verhaltensweisen
wie ,Überredung‘ und Verhandlung (,bargaining‘) dergestalt verknüpft, daß er
seinen politischen Nutzen maximiert. Die Nettosanktionen aus der von der
Entscheidungsstruktur verweigerten Zustimmung zu den persönlich konkretisierten Zielen soll niedrig bleiben, d.h. die Zustimmung der Entscheidungsadressaten und/oder ihrer Repräsentanten zu den aus den übergeordneten Werten bzw. Normen der Gesellschaft ,abgeleiteten‘ politischen Zielen muß mit
möglichst geringen Kosten (z.B. für ,Überredung‘ oder ,Zugeständnisse‘) erreicht werden. […] Indem der homo politicus in seiner Rolle als Entscheidungsträger seinen individuellen politischen Nutzen zu maximieren versucht,
fördert er auch in bestimmter Weise den ,kollektiven‘ Nutzen der Entscheidungsadressaten“ (ebd.: 42). Rational werden seine Entscheidungen durch
die Beachtung zweier sich gegenseitig bedingender Maximen, der Machterhaltungs- und der Gestaltungsmaxime. Erstere umschreibt den Drang des homo
politicus, seine Position durch adäquates Handeln zu wahren; dies spielt insbesondere im Hinblick auf bevorstehende Wahlen eine Rolle. Zweitere besagt,
dass er zudem die Gesellschaft nach bestimmten Zielen zu verändern trach-
tet, d.h. er handelt zielbezogen (vgl. ebd.: 44).
Weiterhin nimmt Böhret an, dass Persönlichkeitsmerkmale wie Motivation oder
Charisma in modernen politischen Systemen eine untergeordnete, aber nicht
zu vernachlässigende Rolle spielen, v.a. in peripheren Entscheidungsbereichen oder bei besonders wegweisenden Entscheidungen, wo dann der soziale
Hintergrund eines Politikers Einfluss hat.
49
Darüber hinaus muss sich der Politiker Ziele setzen, gewichten und ordnen.
Diese Ziele sollen aus dem gesellschaftlichen Wertesystem abgeleitet werden
und damit mehrheitsfähig sein. Die Setzung von Zielen sei nur dann adäquat,
wenn sie mit den beiden Maximen kompatibel seien (vgl. ebd.: 48).
Der
Entscheidung
liegen
verschiedene
Programme
(Ziel-Mittel-
Kombinationen) zugrunde. Mithilfe bestimmter Instrumente sollen die Alternativen bewertet werden. Am Ende steht die Auswahl einer Handlungsalternative
aufgrund einer Entscheidungsregel. An dieser Stelle wird somit der klassische
entscheidungstheoretische Ansatz integriert (vgl. ebd.: 53 f.). Welche Instrumente Böhret genau meint, soll hier nicht diskutiert werden (vgl. dazu ebd.: 65
ff.).
Zuletzt gilt es, Hindernisse aus der internen und externen Entscheidungsstruktur einzukalkulieren, was sich hauptsächlich auf die Organisation des politischen Systems bezieht. So können etwa Gewaltenteilung, die Verwaltung einer Regierung nebst Ministerien oder Stäben, aber auch externe Experten
Entscheidungen deutlich hemmen oder zumindest beeinflussen.
All diese Faktoren strukturieren den Handlungsspielraum des Entscheidungsträgers.
Die Grundkonzeption des Modells lässt sich wie folgt zusammenfassen: „Der Entscheidungsträger als besondere Erscheinungsform des homo politicus handelt rational, wenn er konkrete politische Ziele aus dem gesellschaftlichen Wertsystem so ableitet, nach Prioritäten ordnet und verfolgt, daß er innerhalb der gegebenen Entscheidungsstruktur seinen politischen Nutzen maximiert. […] Das Maximum des politischen Nutzens ergibt sich, wenn langfristig ein veränderliches Gleichgewicht zwischen Machterhaltungs- und Gestaltungsmaxime erreicht wird“ (ebd.: 61). Dabei sei
je nach Situation der ein oder andere Faktor wichtiger. Böhret ist zu Gute zu halten,
dass er die rein ökonomische Rationalität durch eine politische (im Sinne von machterhaltende) ergänzt hat. Allerdings weist dieses Modell wegen seiner entscheidungstheoretischen Basis selbstverständlich die gleichen Mängel auf wie viele andere dieser Ansätze (s. folgender Abschnitt).
2.2.3 „Ideale“ Planung
Wenn im folgenden von einem idealen Planungsprozess die Rede sein wird, so nur
mit dem Ziel, „dass man tatsächlich über Planung sprechen kann und eben nicht
über Landschaftsplanung, Raumplanung, Wirtschaftsplanung, Unternehmenspla50
nung“ etc. (Bechmann 1981: 52) - es geht damit um eine allgemeine Struktur, die
jedem Planungsprozess zu Grunde liegt. Es darf nicht übersehen werden, dass solche Muster eine sehr grobe Phaseneinteilung meist ohne Rückkopplungsschleifen
und explizierte Zusammenhänge aufweisen (vgl. Bechmann 1981: 61). Solche Muster oder Schablonen liegen jedoch jedem entscheidungstheoretischen Ansatz zu
Grunde.
Soll ein bestimmtes gesellschaftliches Problem von Politik durch Planung gelöst werden, stehen in der Regel zunächst mehrere Lösungsvorschläge im Raum, aus denen
es eine auszuwählen gilt. Im Rahmen planerischer Rationalität wird dabei ein ganz
bestimmtes Entscheidungsverhalten suggeriert. Grundlage einer jeden planerischen
Entscheidung seien „die subjektiv-normative Ausgangssituation des Entscheidenden, die zur Auswahl stehenden Handlungsalternativen oder Ziele, das Wertsystem
des Aktors […], die Entscheidungsregel des Aktors“, die aus dem Wertesystem abgeleitet wird (ebd.: 96). Die Entscheidung reife wie gezeigt idealiter in fünf Schritten:
Erstens würde der Akteur die situationsrelevanten Umweltinformationen verarbeiten
und einen Zielzustand formulieren. Zweitens würden Entscheidungsalternativen abgegrenzt. Drittens projiziere der Entscheider zu jeder Alternative sämtliche Konsequenzen. Diese würde er viertens auf Grundlage seines Wertesystems bewerten und
ordnen. Fünftens würde nun auf Basis einer Entscheidungsregel die am stärksten
präferierte Alternative ausgewählt und umgesetzt (vgl. ebd.: 97).
51
Abbildung 4: Idealer Planungsprozess nach Fürst 2004a: 26. Diese Abbildung zeigt eine
etwas ausdifferenziertere Form eines linearen Planungsprozesses. In der Literatur lassen
sich auch noch detailliertere Varianten finden, etwa bei Alfred Nagel (1971: 44), der einen
28teiligen Entscheidungsansatz vorstellt, oder bei Gotthard Bechmann (1981: 58 ff.).
Jochen Hanisch weist darauf hin, dass solche Konzeptionen einige Mängel aufweisen. Zunächst sei es unrealistisch, dass der Entscheidende Handlungsalternativen
und Prognosen bewerten könne und sein eigenes Wertesystem dabei unverändert
bleibe (vgl. Hanisch 1999: 90). Daneben darf nicht übersehen werden, dass Ent52
scheidungsverfahren wie Kosten-Nutzen-Analysen oder Nutzwertanalysen jeweils
auf bestimmten Grundlagen und Zielen basieren. Bei ersterem sind das beispielsweise ökonomische Überlegungen mit dem Ziel, eine maximale Rentabilität zu erzielen.
Die als „beste“ postulierte Entscheidung basiert damit immer auf einer bestimmten
Werteskala, andere Faktoren bleiben somit bei der Entscheidungswahl ausgeschlossen (Albers 2004: 107). Zudem könne kein Planer jegliche Situationen und Handlungsalternativen vollständig erfassen; Entscheidungen erfolgten dabei immer zu einem gewissen Grad unter Ungewissheit. Außerdem würde sich Planung immer auf
den anvisierten Zustand auswirken; dies würde jedoch nur selten berücksichtigt (vgl.
Hanisch 1999: 90). Nicht zuletzt sei es aus logischer Perspektive unmöglich zu behaupten, man habe den besten Plan entworfen bzw. die beste Lösung gefunden, da
es immer bessere, bislang unbekannte Lösungen geben kann (vgl. Albers 2004:
107).
Dabei birgt die Festsetzung von Zielen eine Menge an Gefahren. Ziele können eindeutig oder diffus sein; ggf. kann es darum gehen, Zustände zu erreichen oder zu
vermeiden. Desweiteren kann es vorkommen, dass Ziele miteinander positiv direkt
oder über Drittvariablen verknüpft sind. Wird das eine Ziel erreicht, gilt das auch für
das andere. Es wäre aber auch umgekehrt - sprich: negativ - denkbar: Ist ein Ergebnis, das einem Ziel entspricht, geschafft, wird das andere Ziel unerreichbar. Drittens
besteht auch die Möglichkeit, dass Ziele vollkommen unverbunden sind (vgl. Dörner
2010:77). Noch nicht beantwortet sind dann Fragen etwa nach der Relevanz oder
Zentralität der unterschiedlichen Ziele. Dies ist vor allem dann bedeutsam, wenn eine
zeitgleiche und effektive Zielerreichung unmöglich ist und es darum geht, nur einen
Teil der Ziele zu verwirklichen.
Nicht vergessen werden darf dabei, dass politische Planungsprozesse dynamische
Prozesse sind. In der Regel verläuft Planung gerade nicht streng nach dem dargestellten Schema, sondern unterliegt häufig Sprüngen zwischen den einzelnen Phasen. Bechmann weist in diesem Rahmen auch darauf hin, dass es in jedem Planungsprozess Wissenslücken hinsichtlich der konkreten Ausgangssituation, der prozessbegleitenden Außen- und Rückwirkungen und der Mittel aufgrund der komplexen Wirklichkeit geben kann. Zudem verlaufe menschliches Denken nicht immer so
linear wie in einem Plan suggeriert (vgl. ebd.: 83). Es würde zu selten berücksichtigt,
dass sich die zu regulierenden Objekte nach einer Planung weiterentwickeln und
verändern können, durchaus auch durch den Plan selbst. Planungsobjekte werden
53
nicht „auf die Reaktion des Handelnden einfach nur warten. Sie entwickeln sich weiter, ob der Akteur das nun schätzt oder nicht. Die Realitätsausschnitte sind nicht
passiv, sondern - in gewissem Maße - aktiv“ (Dörner 2010: 62).
In der Regel würde von einem Zustand ausgehend geplant, sinnvoller sei es jedoch,
in Schritten oder Prozessen zu denken. Daneben müsste berücksichtigt werden,
dass die Dynamik solcher Systeme Zeitdruck verursache und eine genaue Kenntnis
des Gegenstandes damit verunmöglicht würde (vgl. ebd.: 63). Ferner müssten Entwicklungstendenzen bedacht, also (Re-)Aktionen des Planungsgegenstandes einkalkuliert werden: „Man muss nicht nur wissen, was der Fall ist, sondern auch, was in
Zukunft der Fall sein wird oder sein könnte, und man muss wissen, wie sich die Situation in Abhängigkeit von bestimmten Eingriffen voraussichtlich verändern wird“
(ebd.: 64). Hier geht es dann um bestimmte Hypothesen oder Modelle, die Planer
von ihren Objekten haben.
Auf keinen Fall darf deswegen die Diskrepanz realer Planungsprozesse im Vergleich
mit dem lehrbuchartigen Ideal übersehen werden. Dies ist v.a. dem Umstand geschuldet, dass es sich bei Planungsprozessen immer auch um politische Prozesse
handelt. Politik gehe es laut Fürst eher um die Befriedigung von Interessen; Problemlösungen seien von daher nur für dieses Ziel adäquate Mittel (vgl. Fürst 2004a: 25).
Zur Folge habe dies konsens- bzw. mehrheitsfähige anstelle „bester“ Lösungen, eine
stete Reproblematisierung durch ständige Wechsel des politischen Personals und
ausgehandelte statt rational konzipierte Pläne (vgl. ebd.: 26). Gerade der demokratisch erzwungene Austausch des Führungspersonals führe zu einer eher kurzfristig
orientierten Planung und zu bestandserhaltenden Policies; auf einen längeren Zeitraum hin fixierte Innovationen würden dadurch erschwert oder seien zumindest von
Konsensbildungsprozessen der Politik abhängig (vgl. Scharpf 1973b: 109 ff.).
Es existieren verschiedene Versuche, den Konsensbedarf einer Policy im Vorab zu
bestimmen. Der wohl bekannteste ist dem Arenenkonzept Theodor Lowis entnommen. Lowi unterscheidet zwischen einem distributiven, einem redistributiven und einem regulativem Policy-Typ. Am leichtesten lässt sich Konsens laut Lowi in Bezug
auf eine distributive Politik herstellen, etwa eine allgemeine Steuersenkung. Ganz
anders sehe dies bei redistributiven Policies aus: Streit sei hier unvermeidbar, da es
etwa bei der Sozialpolitik jeweils Gewinner und Verlierer gebe (vgl. Heinelt 2003:
241).
54
Den entscheidungstheoretischen Ansätzen mangelt es nach Ansicht einiger Autoren
außerdem an einem geeigneten Bewusstsein für ethische Grundlagen. So unterließen es Planer generell, vorab die allgemeine philosophische Frage zu stellen „Was
sollen wir tun?“ und würden stattdessen jeweils auftragsabhängig und damit ökonomisch planen (vgl. Lendi 2004: 22). Der Hinweis auf ethische, moralische bzw. generell normative Fragestellungen im Rahmen der Planungsdiskussion soll an dieser
Stelle genügen, dieser Arbeit geht es ja gerade nicht um einen normativen Steuerungsbegriff.
Nicht zuletzt ist die Problemwahrnehmung bzw. das Agenda-Setting meist interessen- oder mediengefiltert. Es kommen also nur solche Probleme in den Blickwinkel,
die von bestimmten Gruppierungen wahrgenommen und lautstark inszeniert werden,
also gerade nicht solche Probleme, die von Planern als relevant erachtet werden.
Aber auch solche Probleme würden dann gelegentlich in Gremien oder externe Beratungsgruppen wie Runde Tische ausgelagert. Die Alternativensuche würde häufig
durch zeitliche, sachliche und finanzielle Begrenzungen eingeschränkt, auf Routineverhalten reduziert, auf Abwehrhaltungen seitens der Verwaltung stoßen oder gar die
Neudefinition des Problems provozieren. Meist würde es weniger um bestimmte Ziele
als vielmehr die Verteilung von Mitteln gehen. Nicht zuletzt könne durch falsche Planinterpretationen, verzögerndes Arbeiten oder Verweigerungsstrategien die Implementation eines Planes verhindert werden (vgl. Fürst 2004a: 31 ff.).
Ob Planung tatsächlich in solchen idealen Schemata verortet werden kann, ist also
äußerst umstritten. Noch überzeugender wirkt diese Kritik, wenn man all jene Aspekte benennt, die alle Teile von Planung sein können, und dabei bedenkt, wie diese
miteinander vernetzt sein können. Dietrich Fürst weist darauf hin, welche Faktoren
z.B. in Bezug auf die Raumplanung in einem Planungsprozess Relevanz besitzen:
„Ein Planungsobjekt (Gebiet/ Raum), ein Informationen und Werte verarbeitendes
Planungssubjekt […], ein Feld von Interessen, welche auf die Inhalte der Planung
Einfluss nehmen wollen, eine institutionalisierte Arena, über die Planung verbindlich
wird und in der letzte Interessenkonflikte bereinigt werden, ein hierarchisches administratives Kontrollsystem, das die Stimmigkeit der Pläne im Kaskadensystem der
deutschen Planungslandschaft prüft und sicherstellt, dass relevante Rechtsregelungen eingehalten wurden“ (Fürst 2004c: 241). Mit Hilfe seiner Arbeitsmittel ist es Aufgabe des Planers, einen Plan bezüglich des Planungsobjektes zu erstellen. Arbeitsmittel können finanzieller oder häufig auch ideeller Art, etwa Informationen oder Wis55
sen, sein (vgl. Bechmann 1981: 43 f.). Wissen kann sich z.B. auf den Planungsgegenstand, instrumentelle Möglichkeiten oder gesellschaftliche Rahmenbedingungen
beziehen (vgl. Bechmann 1981: 50). Es mutet schier unmöglich an, all jene Faktoren
in ein Schema gleichsam zwingen zu können.
2.2.4 Zweck-Mittel-Schema
Ausgewählten Plänen, die zur Behebung eines Problems am besten geeignet scheinen, wird eine ganz bestimmte Rationalität unterstellt, welche in der Literatur als
„Zweck-Mittel-Schema“ bezeichnet wird. Demnach ist es mit Hilfe von Planung möglich, die Entwicklung einer bestimmten Situation mit Hilfe bestimmter Mittel auf die
Realisierung eines anvisierten Endergebnisses hin zu beeinflussen (Bechmann
1981: 81 ff.). Es werden zwei allgemeine rationale Handlungsmöglichkeiten unterschieden:
1. Ein gegebenes Ziel soll mit dem geringstmöglichen Aufwand erreicht werden.
Hier geht es um den ökonomischen Umgang mit den einzusetzenden Mitteln.
2. Mit gegebenen Mitteln soll der möglichst größte Nutzen erlangt werden (vgl.
ebd. 82).
Laut Bechmann habe ein optimaler auf Planung fundierter Handlungsprozess folgende drei Bedingungen zu erfüllen: Erstens müsse das handelnde Subjekt die Ausgangslage richtig erfassen. Zweitens solle der anvisierte Zweck eindeutig festgelegt
sein. Drittens müsse die Wirkungsweise der Mittel hinlänglich bekannt sein (vgl.
ebd.).
56
Abbildung 5: Schema des Zweck-Mittel-Handelns nach Bechmann 1981: 83.
Dieses Schema weist jedoch zahllose Mängel auf. So sei bei den beiden vorgestellten Handlungsmöglichkeiten entweder der Zweck oder die Mittel jeweils invariabel.
Dies würde jedoch kaum realen Planungsprozessen entsprechen, wo sich die Faktoren durch planerischen Ermessensspielraum oder politische Opportunität verändern
ließen. Ziele ließen sich zudem nicht immer der gegebenen Ausgangssituation zuweisen. So könnte etwa die Erstellung von Grünflächen einerseits dem Naturschutz,
andererseits als Ausgleichmaßnahme einer Erweiterung eines Industriegebiets dienen. Ziele müssten somit klar definiert im Sinne von „geschlossen“ sein (vgl.
Warzecha 2004: 45).
Daneben sei die Zuordnung bestimmter Mittel zu bestimmten Zielen nicht immer so
eindeutig wie auf den ersten Blick angenommen (vgl. ebd.: 43 f.). In diesem Rahmen
wird in der Literatur häufig diskutiert, inwieweit Nebenfolgen Bestandteil des ZweckMittel-Handeln sind (vgl. Grundwald 2000: 32). Zudem seien Zwecke niemals wertfrei, häufig gelte dies auch für Mittel (vgl. Bechmann 1981: 83 f.). Ferner könnten
Zwecke nicht immer in einem Präferenzsystem angeordnet werden, ganz davon abgesehen, dass niemals alle Zwecke gekannt werden könnten (Tenbruck 1971: 96).
57
Überdies würden Planer den Realitätsausschnitt ihres Planungsgegenstandes nicht
immer nach rationalen Gründen, sondern auch nach Zeit- und Finanzierungsaspekten wählen. Auch könnten wichtige Aspekte eines Bereichs übersehen werden, denn
Planungsprozesse seien immer „zwangsläufig durch Selektivität, Akzentuierung und
Komplexitätsreduktion charakterisiert“ (Konter 1998: 112). Dabei könnten etwa bestimmte Daten gar nicht erst erhoben oder vielschichtige Kausalzusammenhänge
nicht erfasst werden; eine vollständige Informationsgewinnung ist damit ausgeschlossen (vgl. Albers 2004: 107). In diesem Sinne ist Kaisers Definition von Planung
„als systematischen Entwurf einer rationalen Ordnung auf der Grundlage allen verfügbaren Wissens“ nicht angemessen, da dieses verfügbare Wissen nicht unbedingt
in vollem Umfang eingefangen werden kann (Kaiser, zit. nach Hesse 1987: 381).
Nicht übersehen werden darf die Tatsache, dass „eine widerspruchsfreie Zielverfolgung und kontrollierte Planungsdurchführung angesichts einer unabweisbaren Interessengebundenheit von Entscheidungs- und Implementationsprozessen“ unmöglich
sei (Heinelt 2004: 170). Dazu gehört auch das Faktum, dass der Erfolg eines Planes
meist nicht vom Planer ausgemacht wird. Außerdem lässt sich laut Albers nicht immer präzise urteilen, ob ein beobachteter Effekt aus der Maßnahme resultiert, die der
Plan vorgegeben hat (vgl. Albers 2004: 107). Häufig würde auch ignoriert, dass Planung selbst ungeahnte Entwicklungen und Nebenwirkungen anstoßen könne und
dadurch Planungsunsicherheit produzieren würde (vgl. Konter 1998: 114). Nicht zuletzt hänge ein qualitativer Planungsprozess von den Kompetenzen des Planers ab.
Die unhinterfragte Übernahme des Zweck-Mittel-Schemas wurde aus den genannten
Gründen schon bald in Frage gestellt: „Zweifellos ist die Erkenntnis, daß Zweck und
Mittel sowie Subjekt und Objekt jeweils gegenseitig durcheinander bedingt sind, nicht
besonders neu. […] Planungswissenschaft […] wußte mit dieser Erkenntnis nicht viel
anzufangen“ (Musto 1975: 298). Planung verschwand somit nicht aus dem wissenschaftlichen Fokus. So kamen erste Forderungen auf, die Mängel des Zweck-MittelSchemas wie beispielsweise ungewollte Nebenbedingungen oder alternative gleichwertige Zwecke bei künftigen Planungsprozessen zu berücksichtigen (z.B. Tenbruck
1971: S. 94).
2.2.5 Zwischenergebnis
Die entscheidungstheoretischen Ansätze haben wie gezeigt zuhauf Kritik hervorgerufen, und Systemanalytiker sahen durchaus die Schwächen ihrer eigenen Erfindung.
58
Nagel beispielsweise weist darauf hin, dass in solchen Analysen quantitative Elemente überproportional Eingang finden und qualitative Elemente meist gar nicht berücksichtigt würden. Zudem würde das Beharren auf festgelegte Regeln Manipulationsmöglichkeiten eröffnet werden: „Unter Mißachtung dieser Bedingungen können
Ergebnisse beeinflusst werden, falls tendenziös gegebene und nicht verifizierte Informationen in die Studie eingehen oder Werturteile aus einer politischen Haltung
heraus absichtlich manipulativ verschoben werden. Da die Verwaltung auf der unteren Stufe jene Daten heraussucht, die ihre eigene Position verbessern und der bestehende Wettbewerb die Behörden zu beträchtlich optimistischen Schätzungen verführt, wird die Errechnung von Kosten-Nutzen-Kriterien […] diesen Trend nur noch
verstärken“ (Nagel 1971: 121). Görlitz weist auf die Werteproblematik in den entscheidungstheoretischen Ansätzen hin, wonach Werte als unhinterfragter Ausgangspunkt von Entscheidungen genommen und in das Handlungskalkül der Entscheidungsträger einbezogen werden. Dabei werden solche Fragen wie etwa nach dem
Zustandekommen bzw. der Herkunft der Werte oder ihrer Gewichtung vernachlässigt. Daran habe auch die Einführung von Wertaggregationen nichts geändert, die
lediglich einen konstruierten Ersatzkonsens darstellten (vgl. Görlitz/ Burth 1998: 95).
Daneben scheinen solche Ansätze aufgrund der Vernachlässigung der Umwelt und
weiterer Faktoren für moderne, äußerst komplexe Gesellschaften und deren Probleme ungeeignet: „Planungstechnisch gesehen schränken die geschilderten unrealistischen Prämissen der entscheidungstheoretischen Konzepte (volle Information, hohe
Rationalität, transitive Werteordnung, stabile Umwelt, Trennung von Werten und Mitteln) die Anwendbarkeit dieser Konzepte auf relativ überschaubare Planungssituationen ein, wie sie gerade im Falle politischer Gesellschaftsplanung nicht gegeben sind“
(Görlitz/ Burth 1998: 95). Um diesen Mangel zu umgehen, wurden gesellschaftspolitische und kybernetische Planungsmodelle entwickelt, die im Folgenden vorgestellt
werden sollen.
2.3 Gesellschaftspolitische Ansätze
2.3.1 Hinführung
Die gesellschaftspolitischen Ansätze politischer Planung können in Konzepte der pluralistischen Systempolitik, also solche, die Planung systemtheoretisch zu erfassen
suchen, und politökonomisch fundierte Ansätze des Staatsinterventionismus differenziert werden. Ihre Urheber bezweckten eine bislang vernachlässigte Integration
59
der Systemumwelten in den Planungsprozess. Als Beispiele für pluralistische Systempolitik werden das akteurstheoretische Konzept der „Aktiven Politik“ von Renate
Mayntz und Fritz W. Scharpf und das Planungskonzept des „frühen“ Luhmanns vorgestellt. Abschließend werden in aller Kürze die Grundzüge der politökonomischen
Theorien angeschnitten. Im Unterschied zu den entscheidungstheoretischen und kybernetischen Ansätzen rücken hier politische Prozesse, Restriktionen und Verhaltensweisen stärker in den Mittelpunkt. Planung ist damit nicht mehr lediglich mit der
Binnenrationalisierung des politischen Systems gleichgesetzt. Diese Ansätze betonen vielmehr „das ,politische‘ Element staatlicher Planung, das aus ihrer Perspektive
bei den ‚technokratisch‘ ausgerichteten, entscheidungstheoretischen Planungskonzepten zu kurz kommt“ (Görlitz/ Burth 1998: 101).
2.3.2 Pluralistische Systempolitik oder: Planung in einer Welt von Systemen
Ausgangspunkt ist die Akzeptanz der Tatsache, dass moderne Gesellschaften pluralistisch organisiert sind und dementsprechend unter Berücksichtigung bestimmter
Interessen die Verteilung von Ressourcen ausgehandelt werden. Innerhalb der Gesellschaft haben sich demnach verschiedene Subsysteme ausdifferenziert, von denen lediglich dem politischen System eine Steuerungsfähigkeit zugesprochen wird,
die es zur Integration des Gesamtsystems verwendet (vgl. ebd.: 102). Im Gegensatz
zu einem ungezügelten Pluralismus geht es Systempolitik darum, „die fragmentierte
Struktur und den vielfältig gebrochenen Prozeß politisch-administrativer Entscheidungen - den administrativen Inkrementalismus - in die Form einer umfassend angelegten, systematischen Rationalität garantierenden, konzeptionellen Planung zu
transformieren“ (Naschold/ Väth 1973: 22).
Politische Planung kann dann verstanden werden „als Instrument, den Prozeß gesellschaftlicher Ausdifferenzierung aufrechtzuerhalten und (mehr oder weniger konfliktfrei) zu stabilisieren“ (Görlitz/ Burth 1998: 102). Dies kann zum Einen durch den
Ausbau der Informations- und Koordinierungsprozesse seitens des politischadministrativen Systems geschehen. Zum Anderen visiert pluralistische Systempolitik
die Determinanten des politischen Prozesses eher als bislang an. Zentral hierbei ist
die Berücksichtigung verschiedener Gruppen auf der Input-Seite und eine stärkere
Steuerung von Technologieentwicklungen (vgl. Naschold/ Väth: 23 f.). Dem politi-
60
schen System obliegt dann meist nur noch die Rolle des Moderators, so dass von
eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten gesprochen werden kann.
2.3.2.1 Exemplarisch I: Renate Mayntz & Fritz W. Scharpf: Aktive Politik
In diesem Verständnis sollte eine „Aktive Politik“ vermehrt und besser vorbereitet in
pluralistische Auseinandersetzungen eingreifen, diese Prozesse steuern und damit
gestalterisch wirken: „Gestaltung ist aktives (statt reaktives) Handeln, Gestaltung ist
zukunftsbezogen und sie ist komplex, das heißt, es geht nicht nur um punktuelle Einzelmaßnahmen, sondern um die Verwirklichung umfassender und koordinierter politischer Programme“ (Mayntz 1973: 99). Die aktive Entwicklung, d.h. Planung, von
Programmen sollte fünf Merkmale aufweisen. Erstens sollte im Sinne des Primats der
Politik Planung autonom erfolgen. Sie sollte zweitens leitungsbestimmt sein und nicht
in verwinkelten bürokratischen Gängen entstehen. Drittens habe sich aktive Politik an
einer längerfristigen Perspektive auszurichten. Viertens sollten nicht nur organisierte
Interessen behandelt, sondern auch nicht organisierte Interessen respektiert werden.
Fünftens sollte aktive Politik umweltverändernd sein, d.h. verändernd in die gesellschaftliche Umwelt eingreifen (vgl. Mayntz/ Scharpf 1973: 123).
Voraussetzungen aktiver Politik sind entsprechende Ressourcen, eine erhöhte Informationsverarbeitungskapazität, eine verbesserte Koordination der Bürokratie und der
Interessengruppen und nicht zuletzt eine entwickelte Fähigkeit zur Lösung von Konflikten (vgl. ebd.: 125). Politik wird dann als „aktive Politik“ zur Verarbeitung von Problemen (policy-making) verstanden (vgl. Jann 1995: 473). Aktive Politik ist laut Renate
Mayntz und Fritz W. Scharpf die „vorausschauende, aktive Regelung und Steuerung
jener gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozesse, deren ungesteuerte Dynamik
die für das Gesamtsystem relevanten Probleme und Krisen hervorbringt“ (Mayntz/
Scharpf 1973: 116). Sie unterliegt gewissen Beschränkungen wie etwa dem rechtlichen Rahmen, politischen Mehrheiten oder ökonomischen Sachzwängen (vgl. ebd.
118 ff.).
Bei Scharpf und Mayntz meint Steuerung „ein System von einem Ort oder Zustand
zu einem bestimmten anderen zu bringen“ (Mayntz 1987: 190) und setzt damit
Steuerungssubjekt, Steuerungsobjekt, Steuerungsziel und Steuerungsinstrumente
voraus. Politik sei demnach in der Lage, im Sinne einer hierarchischen Steuerung auf
die Steuerungsobjekte einzuwirken. Ob die Steuerungswirkung dann erfolgreich sei
oder nicht, sei jedoch eine ganz andere Frage.
61
Das Konzept der aktiven Politik war eine Kritik „an der bloß reaktiven, kompensatorischen und kurzfristig orientierten, herkömmlichen Politik“ und der „Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen Erzeugung von vorrangig sozioökonomischen und sozio-kulturellen Schwierigkeiten einerseits und der unzulänglichen wie unpassenden
Problemverarbeitungskapazität andererseits“ - man könnte in diesem Sinne auch von
einem ungezügelten Pluralismus sprechen (Böhret 1990: 207). Allerdings weist Görlitz darauf hin, dass diese Vorstellung von politischer Steuerung nicht mehr angemessen sei, denn „der Steuerungspessimismus ist […] empirisch und theoretisch
sehr wohl begründet; die traditionelle Steuerungsdefinition - wie sie von Mayntz und
Scharpf verwendet wird - ist empirisch in den Sozialwissenschaften widerlegt“ (Görlitz 1994: 67).
2.3.2.2 Exemplarisch II: Niklas Luhmanns „Politische Planung“
Wenn an dieser Stelle von Luhmann die Rede ist, muss darauf hingewiesen werden,
dass man gewissermaßen zwischen zwei „Luhmännern“ unterscheiden kann. Hier
geht es nun um den frühen Luhmann, der seine Arbeiten noch auf den systemtheoretischen Klassikern wie etwa denen von Talcott Parsons oder David Easton fundierte.
Systeme waren in deren Verständnis prinzipiell offen und über Input-OutputBeziehungen mit ihrer Umwelt verbunden. Auf dieser Grundlage ist Planen für Luhmann systemisch und prozessual zu verstehen und nicht mit idealen Schematas oder
Vergleichbarem gleichzusetzen, wie sie im Abschnitt über entscheidungstheoretische
Ansätze dargelegt wurden.
Das politische System hat laut Luhmann zwei Funktionen inne: Erstens sei es Aufgabe der Verwaltung, bindende Entscheidungen nach Maßgabe von Plänen und Programmen zu treffen. Der Politik obliege es zweitens, eine fraglose Akzeptanz dieser
Entscheidungen herzustellen. Das politische System bestehe damit bei Luhmann aus
der Verwaltung und der Politik (vgl. Luhmann 1971: 57). Das sei laut Luhmann ein
struktureller Sonderfall, denn damit existierten „im politischen System zwei unterschiedliche Kommunikationssphären mit je verschiedenen Organisationen und Verhaltensstilen, Sprachen, Relevanzgesichtspunkten und Rationalitätskriterien“ (ebd.:
58). Statt von einem „Sonderfall“ könnte man auch etwas nüchterner von zwei Subsystemen innerhalb des politischen Systems sprechen.
Verwaltung und Politik stünden sich einerseits in ihren Handlungsschwerpunkten,
andererseits hierarchisch gegenüber. Was die Handlungsschwerpunkte betrifft, gilt:
62
„Die Politik setze die Zwecke fest, die Verwaltung sucht die geeigneten Mittel zur
Verwirklichung dieser Zwecke und wende sie an“ (ebd.: 60). Hierarchisch herrsche
eine gewisse Asymmetrie, denn der Politik stünden die alternativen Handlungsmöglichkeiten der Verwaltung offen, umgekehrt gelte das jedoch nicht. Zusammen obliege diesen beiden Systemen die Aufgabe der Komplexitätsreduktion „durch Prozesse
der Herstellung kollektiv-bindender Entscheidungen“ (ebd.: 69). In Anlehnung an
Ashbys Prinzip der requisite variety gilt bei Luhmann: „Je höher die Komplexität des
Systems, desto größer die Komplexität der Welt, die vom System erfaßt werden
kann“ (Görlitz/ Burth 1998: 107) und damit desto größer die Chancen seine SystemUmwelt-Differenz aufrecht zu erhalten. Rational sei dann diejenige Handlung, die zur
Systempersistenz beiträgt (vgl. Luhmann 1971: 68).
Luhmann geht es nun um eine Leistungssteigerung des politischen Systems durch
eine Vergrößerung der Binnenkomplexität. Die hierarchische Ordnung könne dies
durch den Einbau von Konditionalprogrammen mit der Form „Wenn A, dann B“ erreichen. Diese gelteten unabhängig davon, ob das betreffende Ereignis gerade vorliegt
oder nicht, und sollten immer dann angewendet werden, wenn das Ereignis tatsächlich vorkommt. Laut Luhmann würde damit „der vertikale Kommunikationsfluß entlastet und zugleich werden abgeleitete nichthierarchische Autoritäten geschaffen“ (ebd.:
63).
Solche Programme werden im Luhmannschen Verständnis als Planung par excellence betrachtet, denn „konditionale Programmierung ist Entscheidung über Entscheiden“ (ebd.). Ob für ein Ereignis nun eine Regel vorliegt oder nicht bzw. ob eine Regel
mit einem entsprechenden Tatbestand existiert, sei damit Aufgabe der jeweils betroffenen Behörde, Abteilung etc. In Bezug auf das Zweck-Mittel-Schema könnten lediglich ökonomische Verbesserungen erreicht werden, und selbst das gelinge nur
schwerlich. Denn entweder müsse es darum gehen, mit gegebenen Mitteln ein maximales Ziel oder ein gegebenes Ziel unter sparsamstem Mitteleinsatz zu erreichen.
Optimale Ziele seien jedoch in verflochtenen Organisationen kaum zu verwirklichen
(vgl. ebd.: 64). Eine reflexive Planungstheorie müsste sich besonders um Entscheidungsprämissen, allgemeine Organisation der Stellen, die Einsetzung individueller
Persönlichkeiten und die Pläne selbst kümmern (vgl. ebd.: 71 ff.). In diesem Sinne
empfiehlt Luhmann eine Konkretisierung der Differenzierung zwischen Politik und
Verwaltung, etwa durch „hinreichende Rollentrennungen und Kommunikationsschranken“ und eine Stärkung der „Lern- und Innovationsfähigkeit“ (ebd.: 72 f.).
63
Planen ist nach Niklas Luhmann ein reflexiver Prozess, d.h. ein Prozess, der auf sich
selbst angewandt wird: „Planen ist Festlegung von Entscheidungsprämissen für künftige Entscheidungen, oder kürzer formuliert: Planen heißt über Entscheidungen entscheiden“ (ebd.: 59) oder nochmals anders ausgedrückt: Planen meint die Vorstrukturierung potentieller Entscheidungen. Grunwald weist darauf hin, dass Luhmann
recht habe, wenn er den Zusammenhang von Planen und Entscheiden erkennt.
Dennoch sei diese Definition defizitär: „Denn erstens verschwinden darin völlig die
kognitiven und normativen Probleme des Aufbaus von Plänen, welcher der Entscheidung darüber methodisch vorausgehen muß. […] Und zweitens hebt die
Luhmannsche Definition ausschließlich auf bestimmte Folgen des Planens ab, nämlich zukünftige Entscheidungen zu prägen. Weder ihre Zwecke noch ihr Zustandekommen sind darin enthalten“ (Grunwald 2000: 234). Luhmann lege somit den
Schwerpunkt auf das Beobachten von Planungsfolgen. Görlitz und Burth weisen zudem darauf hin, dass Luhmann das Problem der Wert- und Interessenaggregation
nicht gelöst, sondern durch eine neue Terminologie umformuliert habe. Dieser Umstand habe eine weitere Folge: „Ohne empirische Operationalisierung erweist sich
der Begriff ,Systemrationalität‘ als zu vage, um die Formulierung konkreter, handlungsanleitender Entscheidungshilfen für politische Planungsprobleme ermöglichen
zu können“ (Görlitz/ Burth 1998: 109 f.). Aus empirischer Perspektive ist das Konzept
somit unterbestimmt.
2.3.4 Theorien des Staatsinterventionismus
Planung wird in den Theorien des Staatsinterventionismus bzw. politökonomischen
Ansätzen ein anderer Stellenwert zugeschrieben als in den Ansätzen der pluralistischen Systempolitik. Kern all jener Ansätze ist, „daß der Staatsapparat selber mit der
kapitalistischen Produktion und der Aufrecherhaltung ihrer Bedingungen in einer
Weise verfilzt ist, daß die Fiktion seiner ,Selbständigkeit‘, d.h. seiner nur
negatorischen Bezogenheit auf die Dynamik der Einzelkapitale nicht mehr aufrechterhalten werden kann“ (Offe, zit. nach Ronge 1971: 139). Planung ist dann eine Methode zur Aufrechterhaltung dieser Verfilzung und des kapitalistischen Prozesses mit
der Aufgabe „die Vermeidung von Krisen im Interesse eines dynamischen Wachstums bei optimaler Auslastung der Produktionselemente“ sicherzustellen (Ronge
1971: 146).
64
Ausgangspunkt der Überlegungen ist damit keine Modellierung der Gestaltungsfähigkeit des politisch-administrativen Systems, sondern vielmehr eine politökonomische Konzeption der kapitalistischen Gesellschaft (vgl. Ronge/ Schmieg 1973: 14 ff.,
Ronge 1971: 137 ff.). In diesem Sinne „gehen politökonomische Theorien - sei es in
den Varianten des Staatsinterventionismus, des staatsmonopolistischen Kapitalismus, oder der ökonomischen Reproduktion - sämtlich in irgendeiner Form von der
Ableitung der Funktion des politisch-administrativen Systems aus der ökonomischgesellschaftlichen Entwicklung aus“ (Naschold/ Väth 1973: 26). Jeder Ansatz fordert
also zunächst eine Konzeption ökonomisch-gesellschaftlicher Zusammenhänge und
damit, dass „von den Bedingungen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses
ausgehend das sich auch politisch ausdrückende Klassenverhältnis in der bürgerlichen Gesellschaft untersucht und darin die Funktion des Staates bestimmt werden“
(ebd.: 31f.).
Die kapitalistische Ökonomie verlange auf der einen Seite politische Steuerung, allerdings nur in einem von ihr bestimmten Ausmaß: „Planung wird von denselben Faktoren erzwungen, die sie gleichzeitig aber auch schon wieder restringieren“ (ebd.:
33). Oder an anderer Stelle etwas ausführlicher: Den politökonomischen „Theorietypen ist gemeinsam, daß die immanenten Gesetzmäßigkeiten kapitalistischer Kapitalverwertungsprozesse das organisierende Zentrum auch der sozialen und politischen
Bereiche bilden und daß aus dem Kapitalverwertungsprozeß selbst heraus permanent dysfunktionale Folgeprobleme entstehen, die in der gegenwärtigen Gesellschaftsformation notwendigerweise auf kollektive staatliche Planung zur Sicherstellung partieller Verwertungsinteressen und genereller Systemstabilisierungsinteressen
angewiesen sind. […] Beim politökonomischen Paradigma stellt Planung vielmehr
den exogen bedingten Versuch der politischen Zentralagenturen dar, die selbstzerstörerischen Wirkungen des Kapitalverwertungsprozesses und seiner Nebenfolgen
im sozialen System aufzufangen und zu kompensieren“ (Naschold 1972b: 80 f.).
Vermeintliche Erfolgsaussichten von politischer Planung fallen gemäß den einzelnen
Ansätzen recht unterschiedlich aus. Eine Variante geht von der grundsätzlichen
Steuerungsfähigkeit des Staates aus, dessen Aufgabe es sei, durch die Schaffung
einer Massenloyalität mithilfe entsprechender Planungssysteme das Gesamtsystem
zu sichern. Hauptvertreter dieser Variante sind beispielsweise Jürgen Habermas und
Claus Offe. Eine weitere Variante geht von einer strukturell zwangsläufigen Krisenanfälligkeit des politischen Systems aus, die durch überbordende finanzielle Inputs, ei65
ne kaum zu gewährleistende Massenloyalität und eine durch Dezentralisierung und
Privatisierung geschwächte Administration verursacht würde (vgl. Naschold/ Väth
1973: 25 ff.).
Wie bereits angedeutet, verschwanden die politökonomischen Ansätze alsbald im
Archiv der Politikwissenschaft, was möglicherweise auch dem Zeitgeist geschuldet
war. Kurios mutet dieser Umstand deswegen an, weil der ein oder andere Autor die
Ergebnisse dieser Ansätze für sehr plausibel hielt, so z.B. Frieder Naschold: „Die
Planungstheorien des polit-ökonomischen Paradigmas erfassen, wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung, alle relevanten Problemdimensionen einer Planungstheorie. Konfrontiert mit dem empirisch-theoretischen Befund von Planungen innerhalb
der BRD und Frankreich scheint das polit-ökonomische Paradigma beträchtlich höhere theoretische Erklärungskraft, empirische Bewährung sowie strategische Fruchtbarkeit zu besitzen“ (Naschold 1973: 104). Allerdings haben all jene Ansätze teils
sehr unterschiedliche Ergebnisse gezeitigt und dabei die Möglichkeiten des politischen Systems im Hinblick auf Planung als Krisenmanagement stellenweise zu sehr
unterschätzt (vgl. ebd.).
2.4 Kybernetische Ansätze
2.4.1 Merkmale kybernetischer Planungskonzepte
Der Modellzweck der aus der aus der Kybernetik stammenden Steuerungskonzepte
bestand in der Behebung der bekannten Defizite der klassischen, v.a. entscheidungslogischen Planungstheorie: „Insbesondere die nicht einlösbaren Voraussetzungen eines hohen Informationsniveaus, einer starren oder vom Planungssystem
dominierten Umwelt sowie die problematische Trennung der Zielbestimmung von der
Mittelauswahl, stellen jene Defizite dar“ (Görlitz/ Burth 1998: 96). Fundamental unterscheiden sich diese Konzepte zu den bisherigen Planungstheorien in ihrer grundsätzlichen Konzeption: „Die wichtigste Antwort war, dass man eine Planungsprozessreaktion auf den Planungsgegenstand implizieren musste“ (Schweizer 2003: 38). Im
Gegensatz zu den entscheidungslogischen Planungsansätzen endete Planung hier
nicht mehr mit der Wirkung bzw. der Adressatenreaktion, sondern wurde konzipiert
als ein fortwährender Kreislauf. Denn es „sollte einerseits möglich sein, während des
Planungsprozesses durch Rückkopplung Informationen über Abweichungen vom
Sollwert und über zielrelevante Umweltfaktoren in die Planung einfließen zu lassen
66
und andererseits das überforderte Planungssubjekt durch Mehrfachregelung und
Dezentralisierung der Entscheidungseinheiten zu entlasten“ (Lau 1975: 98).
Erste Anwendung fand die Kybernetik im Bereich der Maschinentechnik und der Biologie, wobei häufig Strukturverwandtschaften zwischen den einzelnen Disziplinen
auftraten. So setzt Schmidt exemplarisch das Funktionieren eines technischen Heizkreislaufs mit der menschlichen Fähigkeit, die eigene Körpertemperatur regulieren zu
können, gleich (vgl. Schmidt 1970: 203). Kybernetische Maschinensteuerung war in
ihren Grundzügen wie folgt konzipiert: „Ein determiniertes System reagiert, von Zufallsschwankungen abgesehen, in einer einzigen, stets vorhersagbaren und genau
reproduzierbaren Weise. Sein Verhalten entspricht einer geschlossenen einwertigen
Transformation, die vollkommen definiert werden kann. Es ist demzufolge unelastisch
und setzt eine eindeutig ihm angepaßte, nicht jedoch indifferente oder gar bedrohliche Umwelt voraus. Verhaltensweisen wie irreversibler Wandel, Wachstum, Innovation sind ausgeschlossen. Solche Struktur- und Verhaltensannahmen ermöglichen
eine präzise Außensteuerung des Systems, die auf dem Zweck-Mittel-Schema und
dem Befehlsmodell beruht“ (Naschold 1972a: 14). Auf komplexe Sozialsysteme lässt
sich diese Definition nur schwerlich übertragen, „da alle sozialen Systeme komplexer
und stochastischer Natur sind und ihr Verhalten im Gegensatz z.B. zu mechanischen
Systemen zielgerichtet und absichtsvoll ist“ (ebd.: 23).
Offensichtlich ist, dass eine Zielveränderung eben nur bei besonders störenden Umwelteinflüssen vorgenommen wird und solche Systeme insofern eine konservative
Neigung besitzen, als „daß diese bei marginalen Veränderungen von Zielen und
Struktur eben doch die grundlegende Rationalisierung von Systemzielen nur als
,Notlösung‘ vorsehen. Immerhin besteht in der bloßen Möglichkeit der Zielvariabilität
ein bedeutender Rationalisierungsfortschritt gegenüber Fixzielmodellen“ (Lau 1975:
102).
Obwohl nur selten gefragt wurde, ob die Übernahme dieser Konzepte in die Sozialwissenschaften wissenschaftstheoretisch zulässig ist, gelten all jene Ansätze als
Grundlage der politischen Kybernetik (vgl. Lau 1975: 108). Dementsprechend teilt
diese die folgenden Grundannahmen: Das gesamte System wird als ein Regelkreis
verstanden. Als Regelstrecke wird dabei der ganze Raum bezeichnet, welche durch
die Veränderungen des Regelkreises beeinflusst, besser determiniert wird. Der Regelkreis besitzt nun eine Regeleinrichtung. Diese muss zunächst in den Lage sein,
über bestimmte Messfühler einen Ist-Wert der Regelgröße (d.i. die zu variierende
67
Einheit der Regelstrecke) zu ermitteln. Dieser Wert wird nun mit dem anvisierten SollWert verglichen. Anschließend reguliert die Regeleinrichtung den realen Ist-Wert so,
dass er mit dem Soll-Wert übereinstimmt. Der Prozess ist damit nicht abgeschlossen:
Über eine Rückkopplungsschleife wird der neue Wert wieder an die Regeleinrichtung
übermittelt, sodass von einem Kreislauf des permanenten Messens und Stellens gesprochen werden kann (vgl. Schmidt 1970: 203). Die Übermittlung der Messwerte
erfolgt dabei in Form von Signalen, d.h. codierten Informationen (vgl. Lau 1975: 97).
Vorgeworfen wurde diesen Modellen hauptsächlich, sie seien nach wie vor von Herrschaftsgedanken durchsetzt und entsprächen in diesem Sinne der top-downPerspektive klassischer Planungsmodelle. Dies gelte v.a. für die Prozessierung von
Informationen, denn „der gegenseitige Informationsaustausch zwischen System und
Umwelt wird zwar immer gegenseitig postuliert, beschränkt sich aber im wesentlichen
doch auf die Rezeption von Information über Umwelt durch das System. Diese einbahnige Kommunikationsbeziehung läßt das System mit Umwelt nur als möglicher
Störvariablen rechnen und den Aspekt der Informationsübertragung vom System auf
die Umwelt, die ja nach systemtheoretischer Konzeption auch aus Systemen besteht,
außer acht“ (ebd.: 112).
Insgesamt unterscheidet sich das kybernetische Planungsverständnis vom entscheidungslogischen in folgenden Punkten: „Anstatt eine einmalige irreversible Zielsetzung vorzunehmen, werden die Ziele selbst bis zu einem gewissen Grade variabel
und in den Planungsprozeß einbezogen. Statt einer Informations- und Programmierungsphase findet ständige Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung
während des gesamten Planungsprozesses statt. Die Durchführung wird nicht mehr
wie bei den Zweckmodellen allein durch die technischen Realisierungsbedingungen,
sondern auch durch interne Systembedingungen determiniert“ (ebd.: 99). Eine höhere Autonomie erreichen solche Systeme etwa dadurch, indem sie die Sollwerte selbst
festlegen können (vgl. Naschold 1972a: 25). Dahinter steckt eine Annahme, die Bekanntheit durch W. Ross Ashbys Postulat der „requisite variety“ erlangte (vgl. Ashby
1974: 298 f.). Planung soll demnach in kybernetischen Systemen in die Lage versetzt
werden, für möglichst jedes Problem eine Lösung zu finden. Er postuliert, dass nur
solche Systeme eine realistische Überlebenschance besitzen, die für jedes bestehende Problem Handlungsmöglichkeiten besitzen, d.h. die Systemkomplexität muss
den kontingenten Umweltbedingungen weitestgehend entsprechen.
68
2.4.2 Exemplarisch I: Herbert Stachowiak: Politik als kybernetisches System
Eine erste Variante eines kybernetischen politischen Systems bietet Hebert
Stachowiak an. Stachowiaks Modellzweck besteht in der Modellierung der Grundstruktur von Planung in einer Gesellschaft. Sein Modellgehalt besteht im Kern aus
drei Bausteinen: Erstens einem Aktionssubjekt. Subjekte können Individuen oder
Gruppen sein. Diese sind in der Lage, ihre Umwelt zu verändern und entwickeln
dementsprechend bestimmte Ziele. Sie entscheiden über die Handlungswahl und
überwachen deren Ausführung. Die Planung einer Handlung obliegt zweitens bestimmten Planungssubjekten. Mithilfe deren Pläne sollen drittens die Aktionsobjekte
anvisiert und variiert werden (vgl. Stachowiak 1989: 263 ff.).
Aktionssubjekt, Planungssubjekt und Aktionsobjekt sind in Stachowiaks Planungssystem durch Rückkopplungsschleifen informationell miteinander verbunden und bilden damit ein kybernetisches System: „Die Kopplungsbeziehungen sollen die realen
gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Planern, Auftraggebern und Betroffenen
abstrahierend wiedergeben“ (Bechmann 1981: 73). Dem Planungssubjekt komme
dabei eine Art Mittlerrolle zu: Seine Aufgabe sei es, Ziel- und Aktionsplanungen in
Bezug auf das Aktionsobjekt für das Aktionssubjekt zu entwickeln. Die Umsetzung
dieser Pläne ist Aufgabe des Aktionssubjektes. Haben diese Pläne eine Wirkung entfaltet, erhält das Aktionssubjekt neue Informationen über das Aktionsobjekt und entwickelt ggf. neue Pläne.
Laut Grunwald lege Stachowiak den Schwerpunkt zu sehr auf den kreiskausalen Ablauf statt auf die Frage danach, wie eigentlich geplant wird: „Die in einer Planungstheorie zu klärende Frage, wie dies erfolgt, wird aber nicht beantwortet. […] Diesem
Rückkopplungsprozess gilt das Interesse Stachowiaks sehr viel stärker als dem Planen selbst“ (Grunwald 2000: 231). Überdies meint Grunwald, die kybernetische Planungstheorie sei einerseits zu allgemein und andererseits zu eng gefasst: „Wenn
nämlich jegliche mit einer Rückkopplungsschleife operierende Einwirkung eines Systems auf seine Umwelt als Planung verstanden wird, lassen sich z.B. auch das Verhalten von Mikroorganismen in Bezug auf ihre Wechselwirkung mit der Umwelt durch
Stoffaustausch, ja sogar die programmierte Annäherung eines robotischen, durch
Sensoren gesteuerten Greifarmsystems an ein zu bergendes Objekt als ,PlanungsRegelkreise‘ auffassen. Andererseits greift die kybernetische Planungstheorie zu
kurz, weil sie auf adaptive (selbstkorrigierende) Dauerplanung ausgelegt ist und sin69
gulär geplante Handlungskomplexe wie z.B. die Apollo-Mondlandungen nicht rekonstruieren kann“ (ebd.: 232).
Nicht zuletzt weist Grunwald darauf hin, dass sowohl Herbert Stachowiak als auch
George Chadwick, dessen Konzeption hier nicht behandelt werden soll1, mit ihren
Definitionen von Planung jeweils die Umsetzung des Planes in die Planungsphase
einbezogen haben. Chadwick definiert Planung z.B. als „a process of human thought
and action based upon that thought - in point of fact, forethought, thought for the future” (Chadwick 1978: 24, zit. nach Grunwald 2000: 233). Stachowiak hingegen
meint, Planung sei die „gedankliche Vorwegnahme zukünftigen Handelns“ und ein
„Verfahren zur Erlangung geeigneter Handlungsantizipationen“ (Stachowiak 1970: 1).
2.4.3 Exemplarisch II: Karl W. Deutsch: Politische Kybernetik
Einer der bekanntesten Autoren, der sich das kybernetische Grundgerüst für seine
politikwissenschaftlichen Arbeiten aneignete, war Karl W. Deutsch. Im Gegensatz zu
früheren Autoren der politikwissenschaftlichen Kybernetik fundierte Deutsch seine
Überlegungen auf der Tatsache, dass moderne Gesellschaften äußerst komplex
strukturiert seien und Probleme in zeitlich immer kürzeren Abständen auftauchten
und dementsprechend rascher gehandhabt werden müssten. Kybernetische Systemmodelle müssten demnach zum Zwecke der Steuerung von Gesellschaft mehr
als eine lediglich kompensierende Rückkopplung bieten.
Kybernetik bedeutet laut Deutsch „die systematische wissenschaftliche Beschäftigung mit Kommunikations- und Steuerungsvorgängen in Organisationen aller Art“ sei
(Deutsch 1969: 126). Kommunikation sei dann der Kitt, der alle sozialen Organisationen zusammenhalte. Steuerungsanalytischer Kern der folgenden Überlegungen ist,
„daß die Aufbewahrung und Verarbeitung von Informationen in Maschinen und ihre
Verwendung zur Steuerung der Maschinen sich unter Bedingungen vollziehen, die es
erlauben, jeden einzelnen Schritt zu verfolgen und jedes System zu analysieren und
wieder zusammenzusetzen“ (ebd.: 131).
Politische Systeme sind laut Deutsch rückgekoppelte Systeme: „Anders ausgedrückt
bezeichnet Rückkopplung […] ein Kommunikationsnetzwerk, das auf eine Informationseingabe mit einer Tätigkeit reagiert, deren Ergebnis als Teil einer neuen Information auf das weitere Verhalten des Systems selbst zurückwirkt. Ein einfaches Rückkopplungsnetzwerk ist so gebaut, daß es auf ein von außen stehendes Ereignis […]
1
Chadwicks klassisches Werk zur Planung stammt aus dem Jahr 1978 und trägt den Titel „A systems view of
planning.
70
in einer bestimmten Weise reagiert […], bis eine bestimmte Sachlage hergestellt ist
[…]. Solange die gesuchte Einstellung nicht vollständig erreicht ist, wird die Tätigkeit
des Netzwerks fortgesetzt“ (ebd.: 142). Demnach könnten politische Systeme sowohl
fixierte Ziele besitzen als auch ihre Ziele unter dem Einfluss einer sich wandelnden
Umwelt variieren und das System auf diese Weise stabilisieren.
Deutsch fordert hierfür innovative Problemlösungen (vgl. ebd.: 233); das System
müsste folglich in die Lage gesetzt werden zu lernen - darin besteht der Zweck seiner
Modellierung des politischen Systems. Deutsch nennt zunächst einfaches Lernen,
was bedeutet, dass Ziele invariant bleiben und lediglich die Wege und Mittel zur Erreichung dieses Ziels durch Lernen verändert werden. Durch komplexes Lernen hingegen könnten auch die Ziele und die Verarbeitungsmechanismen der Regeleinrichtung und damit des Staates gewandelt werden. Verändert sich überdies die Leistungsfähigkeit des Systems im Hinblick auf die Zielerreichung, muss von pathologischem Lernen gesprochen werden (vgl. ebd.: 147). Pathologisches Lernen liegt etwa
dann vor, „wenn Informationen aus dem Gedächtnis anderen Informationsquellen
vorgezogen werden. Dieser Umstand führt zur starren Fixierung von Verhaltensweisen ohne Rücksicht auf Umweltänderungen und zum Abbau der Informationsaufnahme- und Verarbeitungskapazität“ (Naschold 1972a: 28); exemplarisch für dieses
Verhalten können etwa Diktaturen gesehen werden.
Zusammengefasst lässt sich somit sagen: „Lernprozesse werden als Kommunikationsprozesse verstanden, die von der Struktur des Informationsflusses, von der Leistungskapazität der Informationskanäle und von dem Wirkungsgrad der Steuerungsund Kontrollmechanismen abhängig sind. Der Grad der ,Lernfähigkeit‘ eines Entscheidungssystems bestimmt seine eigene Lebensfähigkeit und Pathologie“ (Schmidt
1970: 204). Das Überleben eines kybernetisch verstandenen politischen Systems
hängt damit von seiner Lernfähigkeit, dem Umgang und der Verarbeitung von Informationen und damit von der Einleitung innovativer Handlungen bzw. Prozesse ab.
Politik muss demnach auf externe Störeinwirkungen nicht nur reagieren, sondern ggf.
den Störfluss mit Innovationen dauerhaft unterbinden, weshalb jeder Staatsmann
„deshalb eine Kunst beherrschen [muss], die der Kunstfertigkeit des Autofahrers auf
vereister Straße gleicht, der jede Schleuderbewegung so zeitig voraussieht, daß er
sie noch mit kleinen Korrekturbewegungen am Steuerrad unter Kontrolle halten kann,
wo langsames oder allzu hastiges Eingreifen den Wagen erst richtig ins Schleudern
brächte und vielleicht sogar zugrunde richten müßte“ (ebd.: 258).
71
Ob ein politisches System sein Ziel erreichen kann, hängt dabei von vier Positionen
ab: Erstens von der Belastung durch neue Informationen, zweitens von der Verzögerung infolge der Reaktion des Systems, drittens vom möglichen Gewinn, d.h. vom
Ausmaß der Verhaltensänderung des Systems, und viertens von der Führung, welche die Differenz zwischen exakter und faktischer Position des anvisierten Ziels
meint (vgl. ebd.: 261 f.). Erfolgreiche politische Systeme sind dann „sich selbst entwickelnde und erweiternde Systeme, die fähig sind, ihre Überlebenschancen zu verbessern und ihren Aktionsbereich auf eine wachsende Vielfalt von Umweltbedingungen auszudehnen“ (ebd.: 330). Zu diesem Zwecke müssten politische Systeme
Wachstum ermöglichen. Wachstum ist somit die positive Alternative zu pathologischem Lernen. Wachstum kann sich dann z.B. auf das Menschenpotential, auf die
Ökonomie, auf die eigene Autonomie, Selbstbestimmung und eigene Ressourcen,
auf die Informationskanäle oder auf die Zieländerung beziehen. Diese Dimensionen
hängen zudem alle miteinander zusammen, von daher gilt laut Deutsch: „Gleichzeitiges Wachstum in allen diesen Dimensionen ist wohl am besten geeignet, das Überleben eines Systems in der internationalen Politik zu gewährleisten“ (ebd.: 336).
Für Deutschs Modell gilt, dass es „einen äußerst originellen und fruchtbaren Bezugsrahmen zur Analyse zentraler und bisher oft übersehener Prozesse im politischen
System“ darstellt (Naschold 1972a: 29). Allerdings habe dessen Konzept erhebliche
Schwierigkeiten in Bezug auf Reliabilität, Validität und Operationalisierbarkeit. V.a.
dessen Konzepte der Informationsverarbeitung seien unpräzise; von daher bedarf es
weiterer, das Grundkonzept ergänzender Modelle. Zudem seien dessen Konzepte
kaum operationalisierbar (vgl. ebd.: 162 ff.).
Kybernetische Modelle fanden trotz dieser Schwächen in der Politikwissenschaft und
in verwandten Disziplinen weiter Verwendung. Auf Grundlage der kybernetischen
Planungstheorie basieren heute etwa der planerische Zweig der KI-Forschung, der
Robotik und der kognitionswissenschaftlichen Forschung. Planung wird hier jeweils
verstanden als ein Prozess der Informationsverarbeitung, in dessen Folge Verhaltensänderungen angestrebt werden, um mit der Umwelt in Einklang zu bleiben. Reaktionen der Umwelt werden erneut sensorisch erfasst und ebenfalls in Verhaltensänderungen übersetzt (vgl. Grunwald 2000: 231).
72
2.5 Planungsalternativen
2.5.1 Entwicklungsbedarf alternativer Planungskonzepte
Im Folgenden geht es um Entwicklungen innerhalb der Planungstheorie zur Behebung genannter Defizite. Dass überhaupt Alternativen existieren und Planungstheorie nicht im Nirwana verschwand, zeigt, dass Planungstheoretiker generell an Planung und Planbarkeit (wenn auch in veränderter Form) festhielten und einen Ratschlag Scharpfs nur selten berücksichtigten: „Wir brauchen darum neben Planungstheorie und Planungstechnologie auch die wissenschaftliche und politische Diskussion über die Kriterien der Planungsbedürftigkeit. Nicht alles, was mit dem verfügbaren
Instrumentarium planbar erscheint, braucht auch langfristig geplant zu werden, und
nicht alles, was koordinierbar erscheint, braucht auch koordiniert zu werden“ (Scharpf
1973b: 56, Hervorhebung im Original, der Verf.).
Nach der Planungseuphorie wurden viele Ursachen für das Scheitern geplanter regulativer Politik diskutiert. Renate Mayntz hat im Zuge der Debatte vier Problemdimensionen
ausgemacht.
Erstens
könne
es
geschehen,
dass
Policies
nicht
implementierbar seien bzw. von der Verwaltung aus welchen Gründen auch immer
nicht umgesetzt würden (Implementationsproblem). Zweitens sei es durchaus möglich, dass Adressaten das Programm nicht befolgten (Motivationsproblem). Drittens
könnten Programme zwar wirkungsvoll, aber nicht effektiv, d.h. zielführend sein. Der
Politik würde es dann an Wissen über mögliche Problemlösungszusammenhänge
mangeln (Wissensproblem). Nicht zuletzt könne Politik auch an der Unzulänglichkeit
der
eigenen
Instrumente
und
damit
am
Steuerungsobjekt
scheitern
(Steuerbarkeitsproblem) (vgl. Mayntz 1987: 194).
Jännicke nennt allgemeiner Entwicklungen „des erhöhten Steuerungsbedarfs der
Industriegesellschaft einerseits […] und der sinkenden Steuerungsfähigkeit von Staat
und Politik andererseits“ als Gründe für Planungs- und damit Steuerungsversagen
(Jännicke 1986: 11). Auch in sozialistischen Gesellschaften sei Planung häufig an
ihre Grenzen gestoßen, weil „ein gut definiertes Problem, eine volle Bandbreite von
Alternativen, die zu erwägen sind, vollständige Grundlageninformationen, komplette
Informationen über die Folgen jeder Alternative, vollständige Informationen über die
Werte und Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger und vollständig adäquate Zeit,
Fachkenntnis und Ressourcen“ nur selten vorlägen (Peters 2004: 8).
73
Moderne Planungsverständnisse basieren in weiten Teilen auf den Arbeiten Herbert
A. Simons („bounded rationality“), Michael D. Cohens („Garbage-Can-Modell“) und
Charles E. Lindbloms („Muddling through“); von daher werden diese Konzepte zunächst vorgestellt, bevor zeitgemäße Planungsansätze dargelegt werden.
2.5.2 Herbert A. Simon: Bounded Rationality
Aufgrund der offensichtlichen Planungsdefizite und der Kritik an Planungskonzepten
konzentrierten sich verschiedene Autoren auf alternative Handlungsmodelle mit eingeschränkter Rationalität. Der Pionier solcher Konzepte ist Herbert A. Simon, der
schon in den fünfziger Jahren Überlegungen zu „bounded rationality“ anstellte. Handelnde gehen demnach nur von den ihnen bekannten Handlungsalternativen und
den ihnen zugeordneten Folgezuständen aus. Risiko und Unsicherheit könnten mögliche Ziele, Handlungsalternativen und Kosten entscheidend prägen oder gar ausschließen (Simon 1972: 163). Überdies könnte der Handelnde komplexe Umweltbeschränkungen kaum überschauen und müsste demnach akzeptieren, „daß die Welt,
die er wahrnimmt, ein drastisch vereinfachtes Modell des summenden, blühenden
Durcheinanders ist, das die reale Welt darstellt“ (Simon 1981: 31). Ziele seien überdies nicht in eine Rangordnung einordbar; es könne lediglich zwischen akzeptablen
und inakzeptablen Lösungen unterschieden werden, wobei meist die erstbeste Lösung gewählt würde (vgl. Simon 1978: 358). Demnach könne es laut Simon nie um
optimale, sondern eher um befriedigende Lösungen gehen (vgl. Simon 1972: 170).
Tenbruck weist jedoch auf eine gewisse Diskrepanz hin: Einerseits möchte Simon
aufzeigen, wie Planung besser gemacht werden kann - in diesem Sinne handelt es
sich um ein normatives Modell. Andererseits orientiert sich die Modellkonzeption
stark am Handeln „in der Realität“, von daher scheint fraglich, woher denn Verbesserungen kommen sollen (vgl. Tenbruck 1971: 103).
2.5.3 Michael D. Cohen: Garbage-Can-Modell
Das Garbage-Can-Modell von Michael D. Cohen, James G. March und Johan P. Olsen stellt das bekannteste Beispiel einer Weiterentwicklung des Ansatzes der begrenzten Rationalität dar. Mit ihm sollten Entscheidungen in Organisationen realitätsnäher beschrieben werden können. Ausgangspunkt sind drei Annahmen über Organisationen: In ihnen herrschten erstens problematische, d.h. unklare Präferenzen,
zweitens würden die Akteure Entscheidungsstrukturen nicht kennen und stattdessen
auf trial-and-error-Verfahren setzen („unclear technology“) und drittens würden je
74
nach Entscheidungssituation gänzlich andere Akteure beteiligt sein und sich dann je
nach Lust, Zeit und ihrem Engagement einbringen („fluid participation“) (vgl. Cohen/
March/ Olsen 1972: 2). Demnach sei die Vorstellung, in Organisationen würden rationale Entscheidungen auf Grundlage rationaler Planung getroffen, verwegen.
Stattdessen müssten vier Aspekte - die Autoren sprechen von „Strömen“ - bei der
Beschreibung von Entscheidungssituationen beachtet werden: Erstens Probleme, die
aus jeder sozialen Perspektive ganz anders ausfallen könnten. Zweitens Lösungen,
die meist schon vor dem Auftauchen einer Frage oder eines Problems entwickelt
worden wären. Drittens Teilnehmer, deren Zahl je nach Entscheidung stark variieren
könnte. Viertens und letztens Entscheidungsgelegenheiten, also Situationen, in welchen eine Organisation in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen (vgl. ebd.: 3).
Diese vier Ströme fließen jeweils unabhängig vor sich hin. Entscheidungen setzen
eine Art Kopplung der Ströme voraus, wobei dann zu einem wesentlichen Teil der
Zufall bestimmt, welche Lösungen, Teilnehmer, Entscheidungen oder Probleme aufeinanderträfen und so zu einer ganz bestimmten, aber mitnichten rationalen Entscheidung führten.
Eine weitere Gruppe von Autoren können laut Bettina Warzecha in der Nachfolge
Herbert A. Simons gesehen werden. Diese versammeln sich unter der Bezeichnung
„konstruktivistisch-systemische Planungstheoretiker“ (vgl. Warzecha 2004: 94 ff.).
Grundlage all dieser Ansätze ist die Annahme, dass das Sein und jedwede Erkenntnis darüber ein Konstrukt ist. Zu diesen Ansätzen gehört etwa Karl E. Weicks Ansatz
der offenen Evolution. Pläne versteht er als eine Art Reklame einer Organisation, um
zu überzeugen und andere zu einer Interaktion zu locken. Planen bedeutet für Weik,
dass begrenzt rationale Akteure in örtlich begrenzter Perspektive basierend auf verkürzten Analysen Entscheidungen treffen oder Empfehlungen geben. Rationalität gilt
generell als beschränkt und grundsätzlich individuell konstruiert. Planung müsse sich
somit auf austauschbare Einstellungen, Kompromisse und ggf. Unwissenheit einstellen - dieses Konzept stellt somit eine Absage an den klassisch-analytischen Planungsprozess dar. Organisationen würden sich in diesem Sinne evolutionär entwickeln (vgl. Weik 1985, zit. nach Warzecha 2004: 94).
2.5.4 Charles E. Lindblom: Muddling through
Für Wirbel in der deutschen Planungstheorie sorgte der Sammelband von Fehl, Fester und Kuhnert (1972), in welchem ein Kapitel aus einem Werk von Charles E.
75
Lindblom und David Braybrook abgedruckt war, welches sich gegen umfassende
Ansätze aus der Systemtheorie und der Kybernetik wandte. Fortan richtete sich der
Blick auch auf prozessuale Aspekte der Planung. Uneingeschränkt rationale Entscheidungen wurden Planung hier nicht mehr unterstellt, sodass vom Anfang des
Endes des uneingeschränkten Planungsglaubens in der BRD gesprochen werden
kann: „So viel gesunder Menschenverstand und so viel erbarmungsloser Realitätssinn im gesellschaftlich und demokratisch möglichen Umgang mit Missständen einer
Nachkriegsgesellschaft […] wirkte im deutschen Planungsdiskurs damals skandalös.
Sie wirkten aber auch außerordentlich befreiend und öffneten entscheidend den
Raum für eine Demokratisierung der Planung (ebd.: 125). Charles E. Lindblom war
der bekannteste Autor, der nicht nur auf Planungsprobleme hinwies, sondern auch
eine gänzlich andere Planungsalternative entwickelte.
Lindblom bezeichnete seine planungstheoretischen Überlegungen als „Strategie der
unkoordinierten kleinen Schritte“ (Braybrooke/ Lindblom 1972: 140), in der Literatur
meist als „Inkrementalismus“ oder - auf Englisch - als „Muddling through“ (Durchwursteln) bezeichnet. Er behauptet, dass Politiker in der Regel keine großangelegten
gesellschaftlichen Veränderungen anvisierten, sondern lediglich „sich auf jene kleinen Verbesserungen (increments) konzentrierten, durch die sich die aus alternativen
politischen Strategien resultierenden gesellschaftlichen Zustände (social states) jeweils vom Status quo abheben“ und „sich auf Zuwachsspannen in einem Grenzbereich“ fokussierten, „in dem eine Veränderung gesellschaftlicher Zustände gegenüber
dem Bestehenden gerade noch in Betracht gezogen werden kann“ (ebd.: 143).
Es würden nur solche politische Strategien ausgewählt, die sich erstens in ihren Folgen untereinander glichen und zweitens den Status quo nur geringfügig variierten,
deswegen würde drittens keine umfassende, sondern lediglich eine folgenfokussierte
Analyse angestrebt (vgl. ebd. f.). Aus diesen Gründen würden Politiker - interessanterweise nennt Lindblom hier nicht die Planer - bei der Suche nach einer passenden
Strategie nur wenige Alternativen in Betracht ziehen und auch hier nur bestimmte
und niemals alle Folgen überdenken (vgl. ebd.: 148 f.). Ursächlich hierfür sei auch
die Tatsache, dass niemals vollständige Informationen über eine problembehaftete
Situation, Ziele und Mittel erlangt werden könnten (vgl. Kade/ Hujer 1972: 171). In
diesem Sinne würden Ziele nur dann ausgewählt, wenn hierfür Mittel vorhanden seien und dann auch nur jene Ziele, die mit den günstigeren Mitteln zu erreichen wären.
Nicht zuletzt könnten Ziele und Mittel im Anschluss daran diskutiert werden - ein rati76
onaler Diskurs fände also nicht vor, sondern höchstens noch in Grenzen nach einer
Vorauswahl statt (vgl. Braybrooke/ Lindblom 1972: 152 f.).
Inkrementalismus unterscheidet sich aufgrund folgender Merkmale deutlich von
klassischen Planungsverständnissen: „It assumes intellectual capacities and sources
of information that men simply do not possess, and it is even more absurd as an approach to policy when the time and money that can be allocated to a policy problem
is limited, as is always the case” (Lindblom 1959: 80). Zum einen geht es um Planung unter der Bedingung unvollständiger Information; war doch wie gezeigt die Informationsproblematik ein Hauptkritikpunkt an den klassischen analytischen Planungsansätzen: „In inkrementalistischen Planungstheorien wird versucht, das Anspruchsniveau an das Wissen organisationaler Entscheidungsträger mit Hilfe eines
besonderen Umganges mit der Komplexität des Seins zu senken“ (Warzecha 2004:
69). Zum anderen möchte der Inkrementalismus einen angemessen Umgang mit
wertgeschätzten Zuständen oder Bewegungen (Evolution) nahelegen. Planung soll
dann eher zum Begleiter eines gesellschaftlichen Entwicklungsganges werden und
im Sinne der Stückwerkstechnik kleine, aber erfolgreiche Ergebnisse zeitigen.
Evolution findet im Rahmen des inkrementalistischen Ansatzes als eine Form gesellschaftlicher Entwicklung Anerkennung, die nach dem Versuch-Irrtum-Prinzip langsam
vonstattengeht. Konkrete Ziele können dadurch erst im Planungsprozess entwickelt
werden, sie sind damit kaum von den gewählten Mitteln getrennt zu denken. Vorab
postulierte übergeordnete Ziele dienen lediglich als Bewertungsmaßstab für die gewählten Mittel oder als grobe Wegrichtung. Durch die Vorgehensweise in kleinen
Schritten sei es sogar möglich, dass einzelne Planungsphasen voneinander kaum zu
trennen seien. Inkrementalismus ist deswegen jedoch nicht konservativ; auch kleine
Schritte könnten große Veränderungen zeitigen (vgl. Lindblom 1979: 520).
Es ist offensichtlich, dass Lindbloms Konzept eine Simon’sche Färbung aufweist.
Unübersehbar ist auch die Nähe des Lindblomschen Konzeptes zu Karl Poppers
Peacemeal-Engineering. Dies verdeutlicht folgendes Zitat, wonach der Planer laut
Popper „will make his way, step by step, carefully comparing the results achieved
and always on the look-out for the unavoidable unwanted consequences of any reform; and he will avoid undertaking reforms of a complexity and scope which make it
impossible for him to disentangle causes and effects“ (Popper 1969: 67). Anders als
Popper meint Lindblom jedoch, dass an politischen Planungsprozessen eine Vielzahl
dezentraler Akteure beteiligt seien (vgl. Kade/ Hujer 1972: 172).
77
Lindbloms Überlegungen wurden v.a. deshalb kritisiert, „weil seine Empfehlungen zu
konservativ,
relativ
ziellos
und
ohne
Alternativen-Diskussion
seien“
(Fürst/Scholles/Sinning 2004a: 18). Seine Strategie verteidigte er schon früh mit dem
Argument, „daß sie für eine sich permanent ändernde Welt entworfen ist“ (vgl.
Braybrooke/ Lindblom 1972: 164). Dieses Postulat wurde jedoch von Kade und Hujer
scharf angegriffen: In einer Zeit, in der die tiefe Kluft zwischen technologischem Entwicklungsstand und der Lösung menschlich-sozialer Probleme sichtbar geworden ist,
erscheint eine ,Planung der kleinen Schitte‘ geradezu selbstmörderisch“ (Kade/ Hujer
1972: 174). Auch Armin Grunwald kritisiert den inkrementalistischen Planungsbegriff
- allerdings in Bezug auf Popper - ganz allgemein: „Diese Auffassung von Planung ist
jedoch handlungstheoretisch unzulänglich und genügt in keiner Weise den Anforderungen an einen Planungsbegriff in der Komplexität der Moderne“ (Grunwald 2000:
226).
Das letzte Zitat zeigt exemplarisch, dass der Lindblom‘sche Inkrementalismus-Ansatz
in der Literatur eher als kritische Gegenposition zur klassischen Planungstheorie
denn als eigenständige Alternative aufgenommen worden ist, da sich deren theoretische Grundkonstellationen im Prinzip gleichen (vgl. Warzecha 2008: 69). Treibt man
den Lindblom‘schen Ansatz auf eine gedachte Spitze, würde das eine deutliche Reduktion der Relevanz von Planung bedeuten. Diese Absicht verfolgen beispielsweise
evolutionäre Planungstheorien. Diese akzeptieren „vielmehr die Dominanz sich selbst
ergebender Entwicklungen gegenüber den Möglichkeiten gezielte menschlicher Eingriffsversuche“ (Warzecha 2004: 73).
78
Inkrementalismus
Notwendige Anzahl der
Klassisch-analytisches
Planungsmodell
wenige
viele
langsam
schnell
Dimension der „Entfer-
kurze Entfernung zwi-
große Entfernung zwi-
nung“ von Planungszie-
schen Status Quo und
schen Status quo und
Planungsziel
Planung
Informationseinheiten
Dimension der „Geschwindigkeit“ angestrebter Veränderungen
len und Status quo
Politische Bewertung
aus theoretischem
Konzept wird oft eine
„zwangsläufig“ konservative Ausrichtung abgeleitet
Verhältnis von Planung
und Evolution
Planung verhält sich zur
Evolution behutsam
eingreifend
theoretisches Konzept
orientiert sich am klassisch-analytischen Wissenschaftsmodell
Planungseingriffe in
großem und kleinem
Umfang sind gleichermaßen denkbar
Tabelle 2: Gegenüberstellung Inkrementalismus - klassisch-analytisches Planungsmodell; Tabelle nach Warzecha (2008: 72).
Einen der ersten auf Lindbloms Konzeption basierenden Vorschlägen für die Praxis
hat Paul Davidoff vorgelegt. Er wollte neben den Planern und Planungsbehörden betroffene Gruppen und Individuen in den Planungsprozess einbeziehen, wodurch der
klassische rationale Planungsprozess durch den Einbau weiterer, v.a. anderer Planungsschritte ganz im Sinne Lindbloms aufgebrochen und zergliedert würde. Er forderte nicht mehr einen Plan nach einem vorgegebenen Ziel, sondern einen Planungsprozess unter Berücksichtigung weiterer Ziele. Denn starre Pläne hätten dazu
geführt, „daß viele Empfehlungen der Stadtplaner dazu tendierten, die bestehenden
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu verfestigen“ anstelle sie zu verändern
(Davidoff 1972: 168). Laut Davidoff sei es sehr wohl Aufgabe der Planer, sich in den
Streit um eine politisch richtige Strategie einzumischen und die Empfehlungen be-
79
stimmter Interessen - sei es von Individuen oder Gruppen, sei es von privaten oder
öffentlichen Akteuren - berücksichtigen.
Darin spiegelt sich selbstverständlich eine Forderung der damaligen Zeit nach „mehr
Demokratie“, der sich die damalige Planung, die sich noch vornehmlich in der Bürokratie konzentrierte, zwangsläufig stellen musste. Davidoff forderte eine pluralistische
Konzeption von Planung, an der sich auch die Planer mit dem Ziel beteiligen sollten,
„daß der Planer mehr tun sollte, als nur die Wertvorstellungen, die seinen Lösungsvorschlägen zugrunde liegen, offen darzustellen; er sollte sie bekräftigen; er sollte
sich zum Anwalt dessen machen, was er für richtig hält“ (ebd.: 151). Dazu gehört
auch, die Erstellung alternativer Lösungswege anderen Gruppen zuzugestehen und
diese im Rahmen eines Planungsprozesses mit einzubeziehen und zu beurteilen;
Planung wird dann zur „Anwaltsplanung“ (vgl. ebd.: 156).
Ebenfalls auf Lindblom aufbauend hat Brunhilde Seidel-Kwem 1983 den Versuch
unternommen, das aus der Betriebswirtschaft stammende Konzept der „strategischen Planung“ auf Übertragbarkeit in die öffentliche Verwaltung zu überprüfen. Strategische Planung ist laut Seidel-Kwem „ein Instrument, das die Zielerreichung durch
eine Anpassung der Unternehmungsaktivitäten an den Wandel in der sie umgebenden Unternehmungsumwelt sichern soll. Dabei umfaßt sie ,(1) die vorausschauende
Formulierung der konzeptionellen Gesamtansicht der Unternehmenspolitik sowie (2)
die Bestimmung der jeweils nächsten strategischen Schritte in Richtung auf diesen
gewünschten Zustand‘“ (Seidel-Kwem 1983: 20). Es geht nicht um die Festsetzung
von Zielen; diese würden vielmehr als gegeben vorausgesetzt. Unterschieden wird
nun zwischen strategischer, taktischer und operativer Planung. Strategische Planung
meint hier „eine langfristige Maßnahmenkombination […], die (1) der Zielerreichung
dient, (2) das Gesamtsystem der Einzelwirtschaft betrifft, (3) umweltbezogen ist und
(4) eine Steuerungsfunktion gegenüber nachgeordneten Planungsstufen ausübt“
(ebd.: 29). Sie bietet damit Entscheidungsstrukturen oder -regeln für die ihr untergeordnete taktische und operative Planung. Taktische Planung bedeutet die inhaltliche
Konkretisierung und soll sich um die Verfügbarkeit von Ressourcen und der Koordination von Aktivitäten kümmern. Operative Planung hingegen soll sich um die Feinheiten der taktischen Planung kümmern (vgl. ebd.: 31).
80
2.6 Planung heute
2.6.1 Merkmale moderner Planungskonzepte
Analog zu vielen anderen Bereichen wie Kirchen oder Krankenhäusern würde auch
die Raumplanung ökonomisiert. Am Beispiel der Stadtplanung zeigt sich etwa, dass
es im Zuge eines sich globalisierenden Marktes, des daraus resultierenden Kampfes
um Arbeitsplätze und günstige Standorte und der Verschuldung der Kommunen Planung heute vornehmlich um die Stärkung der Wettbewerbsposition einer Stadt oder
Gemeinde und nicht mehr um die Gleichwertigkeit von Lebensbedingungen geht (vgl.
Danielzyk 2004: 13). Dies geschieht beispielsweise durch die Bereitstellung hervorragender Infrastruktur, Bauflächen und Kultureinrichtungen; „Raumplanung wird zum
Produktmanagement“ (Wegener 2004: 162). In der Planungstheorie steht hierfür etwa Karl Gansers „perspektivischer Inkrementalismus“, über den noch zu reden sein
wird. In der Summe führt dies zu einer Übertragung neoliberaler Prinzipien in die
Planung. Daneben gibt es aber auch kooperative oder zivilgesellschaftliche Alternativen, denen es darum geht, staatliche Planung und damit Steuerung in Grenzen
staatlicher Steuerungsfähigkeit auf Basis freiwilliger Kooperation oder basisdemokratischer Beteiligungsformen zu ermöglichen (vgl. ebd.: 163 f.). Planer müssen dann
zunehmend Moderations-, Mediations- und Organisationfunktionen übernehmen.
Die moderne Planungsdiskussion gründet auf verschiedenen Erfahrungen, die mit
den beginnenden 90er Jahren gesammelt wurden. Dazu gehört etwa die Globalisierung, v.a. der Ökonomie, und eine vermeintlich damit einhergehende reduzierte
Steuerungsfähigkeit des Staates, pluralisierte Lebensformen, die europäische Integration und die wachsende Bedeutung von Großinvestitionen auf kommunaler Ebene
(vgl. Fürst 2004b: 20). Planung musste sich v.a. dem sich wandelnden Staat zum
nunmehr „kooperativen Staat“ anpassen (vgl. Fürst 1998: 54). Der kooperative Staat
zeichne sich z.B. durch Aufgabendelegation bzw. Dezentralisierung, eine in Bezug
auf Flexibilität und informale Verfahren erweiterte Verwaltung, die Einführung des
Neuen Steuerungsmodells (New Public Management) und die Akzeptanz der auf einer pluralen Werteordnung basierenden Gesellschaft aus (vgl. ebd.: 55 f.).
Dadurch würde Planungstheorie folgende Entwicklungen zeitigen: Erstens würden
Prognosen durch kurzfristige Szenarien ersetzt, zweitens müssten Pläne äußerst
flexibel gestaltet werden, drittens müssten Netzwerke berücksichtigt und dadurch
komplexere Wirklichkeitsannahmen konzipiert werden, viertens müssten Planer zu81
nehmend moderierend eingreifen und ggf. fünftens gesellschaftliche Lernprozesse
promovieren (vgl. Fürst 2004b: 21). Die vollziehende Verwaltung erfordere von Planung in zunehmendem Maße den Einbau von Zielvorgaben und Verfahrensnormen
anstelle konditionaler Programme, die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe und
die Integration von Experimentier- und Öffnungsklauseln (vgl. Fürst 2000b: 12). Dabei darf nicht übersehen werden, dass Planungstheorie spätestens seit dem Ende
der Planungseuphorie lediglich als Reflex auf empirische Planungserfahrungen zu
verstehen ist und nicht mehr Planung vorausgeht (vgl. ebd.: 17).
Ein zentrales Schlagwort der modernen Planungstheorie lautet „Nachhaltigkeit“. Es
geht nun nicht mehr um die Erarbeitung großräumiger Pläne, sondern vielmehr sollen
die geplanten Handlungen Lösungen bieten, die auch in ferner Zukunft noch tragbar
sein würden und sich meist auf die regionale Ebene konzentrieren. Aber auch Nachhaltigkeit ist ein nur bedingt neutraler Begriff, denn es darf nicht übersehen werden,
„dass über allgemeine Grundsätze hinaus die konkrete Planung nur aus der örtlichen
Situation - ökologisch, ökonomisch, politisch - ableitbar ist“ (Albers 2004: 108 f.). Es
muss darum gehen, „dass sich deren Grundsätze [der Planung, der Verf.] nicht aus
einem abstrakten Modell ableiten lassen, sondern aus der jeweiligen konkreten Situation und der in ihr maßgebenden Sicht der Zukunft zu gewinnen sind“ (ebd.:110).
Andere Autoren wie Bernhard Müller weisen dagegen auf deduktive Ansätze nachhaltiger Raumplanung hin. Dazu gehören etwa Konzepte der Enquete-Kommission
des Deutschen Bundestags zum „Schutz des Menschen und der Umwelt“ (vgl. Müller
2004: 162). Bereiche nachhaltiger Planung seien etwa Umweltpläne mit bestimmten
Zielvorgaben, sanierte Haushalte oder ein nachhaltiger Wettbewerb. Nachhaltige
Raumplanung wird sich zukünftig vermehrt um die Folgen des demografischen
Rückgangs zu kümmern haben (vgl. ebd.: 170). Die Ziele nachhaltiger Planung sollen z.B. über Kontextsteuerung und gesellschaftliche Diskurse konsensual durchgesetzt werden (vgl. Fürst 1998: 57). Moderne Planung zeichnet sich damit sachlich
durch Nachhaltigkeit und prozessual durch Kommunikation aus. Allerdings lässt sich
der Begriff „Nachhaltigkeit“ in der Wirklichkeit nur schwer konkretisieren und besitzt
damit einen breiten Interpretationsspielraum. So genießt wirtschaftliches Wachstum
meist Vorrang vor Ressourcenschonung, und der Flächenverbrauch wird zu Gunsten
der Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete nur selten begrenzt, damit Boden- und Mietpreise erträglich bleiben (vgl. Priebs 2000: 48 f.).
82
Nicht zuletzt zeichnen sich moderne Planungsprozesse v.a. durch die Herstellung
gesellschaftlichen Konsenses aus: „Ihr zentrales Instrument ist die Überredung/
Überzeugung im Prozeß einer multilateralen Koordinationsarbeit“ (Fürst 1998: 60).
Umso schwieriger sei es nun für Planer, ihre Eigenständigkeit bzw. Unverwechselbarkeit z.B. im Vergleich mit Verwaltungsbeamten zu wahren. Dies gelte auch für
Pläne, die flexibel im Hinblick auf marktförmige Steuerung sein und häufig kurzfristig
erstellt werden sollen (vgl. ebd.: 61). Planung verändert sich, wird aber nicht ersetzt:
„Dieser Wandel zur gesellschaftlichen Selbststeuerung bringt eine regulativ ausgerichtete Planung in die Defensive, auch wenn sie dadurch nicht ersetzt werden kann“
(Fürst 2000a: 5).
2.6.2 Perspektivischer Inkrementalismus
Eine zeitgemäße, auf Lindbloms Konzepten basierende und in der Praxis ausgeübte
Variante ist der perspektivische Inkrementalismus Karl Gansers. Zwar ist das technokratische Entscheidungsmodell in Planungsprozessen grundlegend erhalten geblieben. Allerdings hat ein Wandel des Planungsverständnisses insofern stattgefunden, als das dem Staat keine umfassende Steuerung durch Planung mehr zugestanden wird: „Dem Übergang von der Entwicklungsplanung zum (‚perspektivischen‘) Inkrementalismus folgten die Abkehr von der Flächennutzungsplanung (mit ihrem postulierten Anspruch auf Gemeinnützigkeit und sozialen Ausgleich) und die Hinwendung zur Planung und Umsetzung von Projekten (Partikularinteressen), die Privatisierung von öffentlichen Planungsaufgaben (teils auch von Hoheitsrechten) und der
wachsende Bedeutungsverlust der öffentlichen Planung“ (Konter 1998: 107). Vielmehr existiere eine neue Perspektive, die „Ziele lediglich als Grundwerte vorgibt,
aber nicht fertig ausdifferenziert und vordefiniert“, in der Literatur als „perspektivischer
Inkrementalismus“
bezeichnet
wird
und
die
„Bedeutung
von
nicht-
verrechtlichten, nicht-regulativen, informellen und kooperativen Planungsmechanismen“ betont (Peters 2004: 9).
Ganser geht es um eine transparente und kontrollierbare Planung: „Der
,Inkrementalismus‘ ist in der Planungstheorie der gescholtene oder auch gelobte Gegenpart einer ,comprehensive policy‘. Mit dem vorgestellten Adjektiv ist die Vielzahl
von kleinen Schritten gemeint, die sich auf einen perspektivischen Weg machen. Im
theoretischen Anspruch ist dies sicher der ,kleinere Bruder‘ der integrierten Entwicklungsplanung, in der praktischen Politik könnte man darin durchaus auch den
83
,erfolgreicheren‘ Nachkommen sehen“ (Ganser 1991: 59). Laut Ganser basiert der
perspektivische Inkrementalismus auf sieben Konstruktionsprinzipien:
1. Ziele werden nicht operationalisiert, d.h. konkret benannt, sondern als gesellschaftliche Grundwerte ausgewiesen.
2. Symbolische Einzelfallentscheidungen sollen die Zieltreue der Planer verdeutlichen. Dies ist etwa dann gegeben, wenn mit jedem Straßenausbau oder der
Erweiterung von Wohngebieten zugleich Ausgleichmaßnahmen in Form von
Baumneupflanzungen verfolgt und öffentlich zelebriert werden.
3. Anstelle abstrakter Programme werden einzelne Projekte und mit Ihnen der
jeweilige Bedarf an Instrumenten entwickelt.
4. Der Handlungszeitraum wird auf überschaubare Etappen reduziert.
5. Es wird auf eine flächendeckende Realisierung zu Gunsten einer regionalen
oder lokalen Betrachtungsweise verzichtet.
6. Anstelle großangelegter Programme sollen lediglich die Instrumente integriert
werden.
7. Anstelle von rechtlichen Interventionen sollen ökonomische Anreize geschaffen werden (vgl. ebd.: 59 ff.).
Nicht übersehen werden darf dabei, dass die aufgezeigten Punkte rechtlich bereits
angelegt sind. Der perspektivische Inkrementalismus kann somit verstanden werden
als Antwort auf die Frage: „Kann man mit den Planungs- und Finanzierungsinstrumenten von gestern die Probleme der Stadt von morgen bewältigen?“ (ebd.: 63).
Sein Programm lässt sich wie folgt zusammenfassen: „Demnach bleiben Zielvorgaben auf dem Niveau gesellschaftlicher Grundwerte (Leitvorstellungen), es wird stärker auf ökonomische Anreize statt auf rechtliche Interventionen (Ge- und Verbote)
gesetzt, und es wird von Programmen, die ‚flächendeckend‘ angelegt sind, Abschied
genommen; stattdessen wird Multiplikatoreffekten von Projekten eine entscheidende
Bedeutung beigemessen“ (Heinelt 2004: 170).
Zusätzlich müsse es um die Integration von Betroffenen gehen, denn „die gesellschaftliche Komplexität hat offensichtlich einen Grad erreicht, in dem wesentliche
Veränderungen nicht mehr abstrakt durch Pläne befohlen und durch einfache Infrastrukturinvestitionen durchgesetzt werden können, sondern sich nur noch dann verwirklichen, wenn alle Beteiligten ein aktives Interesse und persönliche Motivation in
die gemeinsame Arbeit einbringen“ (Ganser/ Sieverts 1993: 35). Zur Verbesserung
von Planungsperspektiven fordert Ganser u.a. ein ausgeweitetes fallbezogenes Prü84
fungsverfahren anstelle schwerfälliger und großräumiger Planungsprozesse, wofür
beispielhaft die Umweltverträglichkeitsprüfung stünde, eine Neuordnung der Finanzierungsbasis der planenden Behörden und eine umfassende Anreizstruktur für umweltschonendes Verhalten (vgl. Ganser 1991: 64 f.).
Klassisches Beispiel für den perspektivischen Inkrementalismus ist die IBA EmscherPark. Hier geht es um die soziale und ökologische Entwicklung des industrialisierten
Gebiets entlang der Emscher im nördlichen Ruhrgebiet. Ziel war die Entwicklung eines regionalen Leitbildes, „das zum einen die unterschiedlichen Interessengruppen
in der Region, die einzelnen städtebaulichen und sonstigen Projekte sowie die Projektbeteiligten zusammenführen und zum anderen die Region als Einheit - Leitbild
,Ökometropole‘ […] - stärken soll“ (ebd.: 96). Als Oberziel wurde der ökologische,
wirtschaftliche und soziale Umbau des Emschergebiets, einem Schwerpunkt der alten Montanindustrie, durch technologische und organisatorische Innovationen ausgegeben, etwa „die verbesserte Lebensqualität der alltäglichen Lebensbedingungen
für die Bewohner und der Standortbedingungen für die Wirtschaft, die verbesserte
Qualität der natürlichen Lebensgrundlagen sowie der städtebaulichen und stadträumlichen Qualität vor allem des öffentlichen Raumes, ,die Wiederentdeckung und Weiterentwicklung der Kraft sozialer Bewegungen, sozial-kultureller Milieus und sozialräumlicher Identität‘ sowie die ,Öffnung der Region für neue Produktions- und Kommunikationstechnologien, für neue soziale Kulturen, für neue kreative Ideen, für neue
Formen dezentraler, anpassungsfähiger und der Selbstverwaltung zugänglicher Daseinsvorsorge‘“ (ebd.: 97).
Methodische Konstruktionsprinzipien waren u.a. eine am Einzelfall symbolisch verdeutlichte Prinzipientreue, Zielvorgaben in Form gesellschaftlicher Grundwerte und
einzelne Projekte anstelle umfassender Programme, überschaubare Etappen, integrierte anstelle gegenläufiger Instrumente (vgl. Ganser/ Siebel/ Sieverts 1993: 114
f.). Mit Hilfe von Werkstätten, Workshops und Organisationshilfen sollten innovative
Ideen gefördert werden. In der Summe geht es um die Verknüpfung der „,SachKreativität‘ des Entwerfens […] [mit der] ‚Verfahrens-Kreativität‘ des intelligenten
Kombinierens von Förderungsprogrammen und Verfahrenswegen, des Zusammenbringens von engagierten Persönlichkeiten und der Mobilisierung der Öffentlichkeiten
als komplexe Innovationsstrategie“ (ebd.). Effekte seien auf einer symbolischen, einer persönlichen und einer sachlichen Ebene auszumachen. Kritisch anzumerken ist,
85
dass Planung gemäß dem perspektivischen Inkrementalismus nur dann eingesetzt
werden sollte, wenn ein Konsens im Bereich des Möglichen liegt (vgl. ebd.: 37).
Eine ähnliche Vorgehensweise verfolgt die IBA Stadtumbau Sachsen-Anhalt 2010. In
Zusammenarbeit mit der Stiftung Bauhaus Dessau, der Landesentwicklungsgesellschaft SALEG und dem IBA-Büro möchte die Landesregierung Sachsen-Anhalts die
Problematik der schrumpfenden Städte angehen. 18 Städte beteiligen sich an der
IBA, wobei deren Projekte im Gegensatz zu nicht beteiligten Städten bevorzugt finanziell gefördert werden. Stadtumbau soll hier nicht flächendeckend, also landesweit einheitlich, geplant werden, sondern den einzelnen Städten auf Basis eines gemeinsamen Bezugs-, Unterstützungs- und Kooperationspunktes (der IBA) überlassen
werden. Jede Stadt soll dabei ein eigenes Profil auf dem Weg zur Verschlankung
entwickeln (vgl. Sonnabend 2010: 108). Dabei sollen „begrenzte Kräfte und knappe
Mittel auf einen zukunftsträchtigen städtischen Entwicklungspfad“ gelenkt werden
und das Profil „mittelfristig alle Ressortentscheidungen orientieren“ (ebd.: 109). Damit
könnten in jeder Stadt im Rahmen des jeweiligen Profils einzelne Projekte geplant
und verwirklicht werden, ohne auf einen landesübergreifenden Plan bezogen werden
zu müssen.
2.6.3 Kommunikative und kooperative Planung
Dass politische Planung viele Ziele verfehlt hat, stand Ende der 80er Jahre außer
Frage: „The dilemma is that the technical and administrative machineries advocated
and created to pursue these goals in the past have been based on what we now see
as a narrow scientific rationalism. These machineries have further compromised the
development of a democratic attitude, and have failed to achieve the goals promoted”
(Healey 1992: 143). Deswegen gerieten neue Planungs- und damit Steuerungsformen in den Blickpunkt: „Man begann, in Planungs- und Entwicklungsprozessen kooperative Steuerungs-Elemente zu entdecken, vor und neben gesetzlich definierten
(hoheitlichen) Verfahrensschritten traten Aushandlungen und Vereinbarungen, hierarchische Strukturen wurden durch (heterarchische) Netzwerke ergänzt, öffentliche
Akteure reihten sich ein in Partnerschaften unterschiedlicher Art“ (Selle 2004a: 229).
Diese Konzeption widerspricht jedoch traditionellen Planungsverständnissen. Frieder
Naschold wies schon 1973 darauf hin, dass das technokratische Selbstverständnis
der Planer und der Politik zu einer Verhinderung von Reformen der Planungsprozesse führen könnte: „Die Form technokratischer Steuerungsplanung steht einer Demo86
kratisierung der politischen Willensbildung entgegen, und der Inhalt dieser Planung
bewirkt eher eine Fortschreibung zumindest derjenigen Gesellschaftsstrukturen, die
zur Systemstabilisierung erforderlich sind, als deren Reform“ (Naschold 1973: 85).
Die Kooperationsforderungen von Planern mit neuen Akteuren ließ Planungstheoretiker außerdem zunehmend Formen und Wirkungen von Kommunikation untersuchen. Es ging nicht nur um Kommunikation zwischen den Planern, sondern z.B. auch
zwischen Planern und Politikern oder Planern und Betroffenen. Die Relevanz von
Kommunikation hat dazu geführt, dass dieses neue Planungsparadigma als eine
„kommunikative Wende“ charakterisiert wird (vgl. ebd.: 230). Schlagworte moderner
Planungstheorie sind also Kooperation und Kommunikation (dass sich hier bis heute
keine sonderlichen Neuerungen ergeben haben, zeigt etwa Spiegel 2010: 111).
Kooperative Planung bedeutet einen Abschied vom Modell des vorgeordneten, rationalen Planens: „Die Zeiten aber der allgemeinen öffentlichen Planung von oben
sind vorbei. Nahezu jeder öffentliche Gestaltungsanspruch ist inzwischen auf die
Einbeziehung anderer als der öffentlichen Akteure angewiesen“ (Boll 2010: 541).
Laut Selle meint kooperatives Planen die Akzeptanz und Beteiligung einer Vielzahl
von z.T. betroffenen öffentlichen und privaten Akteuren und Organisationen an der
Planung in einem intermediären Bereich, d.h. nicht nur innerhalb staatlicher Institutionen, und ein neuartiges Verständnis von Planung als Prozess, in welchem Ziele
und Lösungen veränder- bzw. verhandelbar sind (vgl. Selle 1994: 61 ff.). Planung ist
dann in vielfältigen Formen denkbar und kann ggf. ganzheitlichere Problemsichten
erzeugen (vgl. ebd.: 78 f.) und am Ende ggf. Ziele verfolgen, die anfangs nicht anvisiert waren (vgl. Selle 1999: 218).
Die Verwaltung müsse in der Lage sein, kooperativ zu lernen und sich selbst zu kontrollieren. Gesellschaftliche Entwicklungen sollen durch kooperative Einbindung in
Planungsprozesse abgebremst werden. Dies sei gerade in Zeiten extremer sozialer
Pluralisierung, die eine Subjektivierung der Werte mit sich bringe, und der ökologischen und ökonomischen Globalisierung, die die Welt schneller und komplexer mache, zwingend (vgl. Fürst 1993: 112 f.). Notwendig sei zudem vernetzt zu denken, in
Netzwerken zu handeln, gesellschaftliche Diskurse zu akzeptieren und den Faktor
Zeit in der Planung verstärkt zu berücksichtigen (vgl. ebd.: 114 f.). In diesem Verständnis ähnelt kooperative Planung generell den Merkmalen moderner Staatsverständnisse, v.a. denen des kooperativen Staates (vgl. Fürst 2010: 183).
87
In der Zwischenzeit hat die Planungstheorie als auch die Planungspraxis eine ganze
Reihe an Instrumenten entwickelt, die eine vereinzelte bürgerschaftliche Partizipation
an Planungsprozessen ermöglichen sollen. Dabei kann etwa im Rahmen der Stadtplanung zwischen einfachen und komplexeren Partizipationsformen unterschieden
werden (vgl. Scholles 2004: 362 f.). Einfache Formen sind z.B. Bürgerversammlungen, Ortsbegehungen, die Bearbeitung von Einsprüchen und informative Veranstaltungen wie etwa Ausstellungen oder Ortsbegehungen. Als komplexere Partizipationsformen gelten beispielsweise kommunale Foren, Planungszellen und Betroffenenausschüsse. In kommunalen Foren sollen interessierte Gruppen, Verbände oder Einzelpersonen Planungsprozesse mit Hinweisen unterstützen oder bei Bedarf als Ansprechpartner für die Planer fungieren.
Häufig werden solche Foren für ihre mangelnde Legitimation und ihre nichtrepräsentative Auswahl ihrer Mitglieder kritisiert. Etwas kompakter sind dagegen Planungszellen organisiert. Hier wir eine vorübergehende Kooperation von Planern und
Betroffenen ermöglicht; die Ergebnisse ihrer Arbeit werden in Bürgergutachten veröffentlicht. Das Ziel dabei lautet, planerischen Sachverstand mit dem Erfahrungswissen
der Betroffenen zu kombinieren. In Betroffenenausschüssen sind hingegen gewählte
Vertreter lediglich der Betroffenen versammelt. Ihre Aufgabe besteht darin, die Interessen der Bürger gegenüber Planern bzw. der Politik durch die besondere Legitimation der Wahl zu vertreten. Statt Ausschüssen können sich auf dieser Grundlage
auch Vereine oder ähnliche Zusammenschlüsse bilden (vgl. ebd.: 363 ff.).
Weitere Formen der kooperativen Planung sind Moderation und Mediation. Moderation soll Diskussionen oder Verhandlungen mit dem Ziel, ein bestimmtes Ergebnis
durchzusetzen, unterstützen. Gewinner soll es dabei auf beiden Seiten geben. Mediation hingegen kommt meist bei bereits gescheiterten Verhandlungen zum Einsatz,
also bei solchen Auseinandersetzungen, in dem die Beteiligten vermeintlich in Gewinner und Verlierer eingeteilt werden können. Der Mediator soll dabei die Situation
entschärfen und auf eine auf allen Seiten anerkannte Lösung hinwirken (vgl. Kostka
2004: 345 f.).
Allgemeine Grenzen dieser Partizipationsformen sind etwa die verwendete Fachsprache („Planerchinesisch“), die als Hemmnis wirkende Schriftform, vorgeschriebene (zumeist öffentliche) Gebäude oder Bekanntmachungen in Amtsblättern und v.a.
ein gewisser Grad an Bildung und Artikulationsfähigkeit, Zeit und Geld (vgl. Fürst/
Scholles/ Sinning 2004b: 371). Nicht zuletzt handelt es sich bei den vorgestellten
88
Partizipationsformen um einzelne Instrumente, die den klassischen Planungsprozess
ergänzen sollen, ohne jedoch an dessen Grundfesten zu rütteln. Denn es darf nicht
übersehen werden, dass Planer sich in der Regel als ausgewiesene Experten sehen.
Bürgerschaftliche Partizipation wird aus diesem Selbstverständnis heraus kritisch
beäugt. So würden Betroffene kaum über gesicherte Verfahrenskenntnisse verfügen,
zu Debatten über Nebensächlichkeiten neigen oder kaum in der Lage sein, zwischen
Umwelt- und Wirtschaftsbelangen adäquat abwägen zu können. Nicht zuletzt müssten auch die politischen Institutionen empfänglich für außerinstitutionelle Initiativen
sein (vgl. Fürst/ Scholles/ Sinning 2004a: 357).
Hubert Heinelt merkt an, dass kooperative Planungskonzepte sehr ähnliche Demokratiedefizite wie die Europäische Union aufweisen. Demnach würden sie aufgrund
der Kooperation mit privaten Akteuren wesentlich schwächer mit einem politischen
Legitimationszentrum, z.B. einem Parlament, verbunden sein. Daneben würde eine
im Planungsprozess erzeugte Legitimation einem modernen Demokratieverständnis
widersprechen. Heinelt fordert stattdessen eine wesentlich komplexere Form der Legitimation, nämlich „nach ‚oben‘ im Sinne einer Rückkopplung an demokratisch legitimierte Entscheidungsinstanzen, nach ‚unten‘ im Sinne einer Öffnung für zivilgesellschaftliche Öffentlichkeiten und horizontal gegenüber ressourcenstarken Organisationen verschiedener sozialer Sektoren“ (Heinelt 2004: 166). In diesem Verständnis
kann auch von einer Legitimation über mehrere Ebenen hinweg gesprochen werden.
Dass aber auch eine Planung, die lediglich im Hinterzimmer der Politik stattfindet und
auf Kooperation gänzlich verzichtet, ebenfalls einen Mangel an Legitimation aufweist,
hat etwa Scharpf schon früh herausgearbeitet (vgl. Scharpf 1973b: 35).
Allerdings befürchtet Heinelt zugleich, dass diese moderne Art der Planung bzw. der
Entscheidungsfindung zur Parzellierung von Entscheidungsarenen und Undurchschaubarkeit politischer Verantwortung beiträgt. Entscheidungsfindungen könnten
etwa am Widerstand einzelner Gruppen scheitern. Alternativ könnten lediglich Lösungen mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden werden, da nur diese
konsensfähig seien. In diesem Sinne gelte es, eine neue Form der politischen Führung zu etablieren (vgl. Heinelt 2004: 169). Es darf auch nicht übersehen werden,
„dass durch Verhandlungslösungen oftmals nur Kompromisse ‚auf halbem Wege‘
gefunden werden, und dass Verhandlungen teilweise als Ausdruck von Schwäche
der Raumplanung begriffen werden, die ihre Ziele offenbar anderweitig nicht in der
Lage ist umzusetzen“ (Priebs 2000: 48). Darüber hinaus sind nicht alle Probleme
89
verhandelbar (vgl. Selle 1994: 92). Die Akzeptanz der aufgegebenen Zielorientierung
klassischer Planung zugunsten der Integration von Betroffenen charakterisiert Dietrich Fürst metaphorisch: „Planung soll in gesellschaftlichen Prozessen der Problembearbeitung eher ‚Schmieröl‘ als Hemmnis sein“ (Fürst 1993: 115).
Kommunikative Planung. Patsy Healey schlug beispielsweise vor, die Theorie des
kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas in moderne Planungsprozesse zu
integrieren. Es käme dementsprechend darauf an, vor einem Planbeschluss einen
Diskurs zu führen, bei welchem ausschließlich rationale Argumente angenommen
werden, denen qua Vernunft jeder zustimmen kann. Anschließend dürfe erst eine
Handlungswahl getroffen werden (vgl. Healey 1992: 150 f.). Kommunikative Planung
wird von Healey dann wie folgt verstanden: „A communicative approach to
knowledge production - knowledge of conditions, of cause and effect, moral values
and aesthetic worlds - maintains that knowledge is not pre-formulated but is specifically created anew in our communication through exchanging perceptions and understanding and through drawing on the stock of life experience and previously consolidated cultural and moral knowledge available to participants” (ebd.: 153).
Planung ist damit ein interaktiver Prozess, der die Existenz autonomer Individuen
und Gemeinschaften, die in gemeinsam hergestellten Arenen freie und kritische Diskurse führen, voraussetzt und diesen Diskursen Handlungsmacht zugesteht (vgl.
ebd.: 154 ff.). Diese Individuen seien aber nicht wie im liberalen Verständnis egoistische Interessenverfolger; vielmehr seien ihre Einstellungen dialogisch gebildet, d.h.
sozial konstruiert (vgl. Patsey 1996: 219). In diesem Sinne liege eine Übereinstimmung in bestimmten Themen durchaus im Bereich des Möglichen. Solche Diskurse
würden durch gewisse Regeln angeleitet, sodass ein strategischer Konsens ermöglicht würde (vgl. ebd.: 219). Wichtige Fragen in diesem Zusammenhang beziehen
sich dann beispielsweise auf die Initiierung eines Diskurses außerhalb der üblichen
Planungsarrangements, die Mitgliedschaft in einer Arena (wer gehört dazu und wer
nicht?), welche Themen warum auf die Agenda gesetzt werden können und wie sie
diskutiert werden sollen, und nicht zuletzt wie Argumente bewertet und kritisiert werden dürfen (vgl. ebd.: 223 ff.). Laut Patsey ist kommunikative Planung besonders für
Umweltbelange geeignet, denn in diesem Politikfeld habe die klassische Planung am
deutlichsten versagt (vgl. ebd.: 218).
Nach Peters sollten Argumente in Planungsprozessen gelegentlich diskursiv abgewogen werden: „Letztendlich konnte Planung dem synoptischen Anspruch einer all90
umfassend-objektiven Abwägung aller Aspekte sowohl aus empiristischer Sicht (Unmöglichkeit einer ‚objektiven‘ Sichtweise) als auch aus praktischen Gründen (unvollständige Informationen) nie gerecht werden“. Es geht kommunikativer Planung damit
v.a. um die Überwindung traditioneller Planungsverständnisse und -abläufe. Oder
anders ausgedrückt: „Weiche, auf Kommunikation und Kooperation angelegte Formen der Planung sind gefragt, nicht harte, verbindliche Pläne“, denn die „Integration
von Handlungsträgern über eine dialogartige Planung ist wichtiger als der Plan. Das
neue Planungsverständnis begreift Planung als Diskurs und Lernprozeß“ (Peters
2004: 7). Planung scheint in diesem Verständnis ein Stück weit von einer reinen Zielorientierung abzurücken, d.h. „Planung wird in unserer Gesellschaft deshalb vor allem als Querschnittsplanung immer wichtiger, als System der Vernetzung von Themen und Handlungsträgern“ (Fürst 1993: 116).
2.6.4 Paradigmatische Steuerung
Als eine besondere Variante moderner kommunikativer Planungsmethoden hat sich
paradigmatische Steuerung etabliert. Konkret geht es dabei um die „Veränderungen
von Einstellungen und Wertungen in den Köpfen der Akteure mit dem Ziel, ihr Handeln entsprechend zu verändern. Dazu gehören organisierte Diskurse, aber auch alle
Formen der organisierten Lernprozesse, die vermehrt in der Planung und Politik verwendet werden“ (Fürst 2004a: 23). Paradigmatische Steuerung beschäftigt sich mit
der „Steuerung über Ideen, Normen und ethische Grundhaltungen, oder […] Planungsdoktrinen“ (Fürst 2000b: 110) und setzt „auf die Veränderung von Deutungsmustern und Einschätzungen von Situationen, Problemen und Lösungen“ (Fürst
2003a: 125). Ihr Unterfangen besteht somit in der Steuerung von Paradigmata der
Betroffenen, seien es Behörden oder Akteure aus der Öffentlichkeit; Falludi spricht
beispielsweise von einer „planning doctrine“ (Faludi 1997: 83).
Politikwissenschaftliche Planungstheorie beschäftigt sich hier mit Steuerungsbereichen, die kein Steuerungszentrum aufweisen oder sich nicht mit direkten Steuerungsinstrumenten regulieren lassen. In dieser Hinsicht ähnelt dieser Planungstyp
Konzepten aus der Governancediskussion oder Netzwerkforschung (vgl. Altrock/
Güntner/ Kennel 2004: 189 ff., Rudolph 2003: 73 ff.). Genauer geht es darum, Planung als kommunikationsbezogenen Lernprozess aufzufassen und auszurichten und
damit modernen Anforderungen an Planungsprozessen zu entsprechen (vgl. Fürst
91
2000b: 111). Dies kann beispielsweise durch Runde Tische oder andere partizipative
Formen geschehen, um Betroffene möglichst früh an Planungen zu beteiligen.
Alternativ kann während eines Planungsprozesses mit Hilfe von Gutachten oder
Fachveranstaltungen der Plan regelmäßig ins Bewusstsein der Betroffenen gerufen
werden (vgl. ebd.). In diesem Sinne gehört paradigmatische Steuerung zur kommunikativen Planungstheorie, die insgesamt darauf abzielt, durch die Integration von
Bürgern bessere Planungsprozesse zu erreichen (vgl. Altrock/ Güntner/ Kennel 2004:
195).
Anders als der kommunikativen oder auch persuasiven Planungstheorie geht es paradigmatischer Steuerung nicht einfach um die Überzeugung der Betroffenen im Hinblick auf einzelne Aspekte eines Planungsprozesses wie etwa die Einschätzung einer Problemdefinition oder mögliche Planungsfolgen, sondern grundsätzlich um die
Änderung von Einstellungen, Interpretationsschemata und Werthaltungen. In modernen Planungsprozessen sollte Zwang demnach nur noch als ultima ratio eingesetzt
werden (vgl. Fürst 2003a: 125). Fürst macht zwei Punkte paradigmatischer Steuerung als Hauptunterschied zu kommunikativer Steuerung aus:
„Zum einen spielen Lernprozesse eine große Rolle: Einstellungsveränderungen und Veränderungen von Deutungsmustern lassen sich nicht durch wenige
Gespräche erzielen. Vielmehr verlangen sie eine Umorientierung im
,Systembezug‘: ob sich die Akteure nur an ihren eigenen Interessen orientieren oder auch an den Interessen eines Kollektivs, dem sie sich zugehörig füh-
len.
Zum anderen ist paradigmatische Steuerung auf Einbindung der Adressaten in
eine kollektive Verantwortlichkeit ausgerichtet: Paradigmatische Steuerung
macht den ,Adressaten der Steuerung‘ zum ,Partner der Steuerung‘. Steuernder und Gesteuerter gehen eine ,Steuerungsgemeinschaft‘ ein, die dazu führen soll, dass sie gemeinsam neue Problemlösungen suchen oder anwenden“
(ebd.: 126).
Instrumentelles Wissen ist dabei einfacher zu modifizieren als übergreifende Deutungsmuster oder Weltbilder. Relevant ist hier v.a. die Art der Interaktion, wobei die
breite Öffentlichkeit laut Fürst nur über Massenmedien und damit eher schwerlich
paradigmatisch gesteuert werden könne. Bei den Interaktionen könne es zu vielfältigen Kommunikationsproblemen kommen, etwa hinsichtlich unverständlicher Semiotik
(„Planerchinesisch“), subjektiver Interpretationen und der Ressonanzbereitschaft der
92
Adressaten (vgl. ebd.: 129). Es kommt also darauf an, das zu erreichende Deutungsmuster etc. überzeugend darzustellen und in Kommunikationsprozessen den
Schwerpunkt auf die Sach- und Beziehungsebene zu legen: „Auf der Sachebene
müssen die Inhalte der Pläne insofern überzeugen, als sie Fragen beantworten, die
aus Sicht der Adressaten wichtig sind; auf der Beziehungsebene müssen Planer/innen und Adressaten zu gleichgerichteten Werthaltungen und Einstellungen gelangen, die auf einem Gefühl für ,Gemeinsamkeit‘ gegründet sind (ebd.: 132).
Ganz davon abgesehen kann paradigmatische Steuerung nie gegen aktuelle Trends
angehen, sondern sich nur von diesen unterstützen lassen. Solche „gleichgerichteten
Einstellungsänderungen“
sind
z.B.
Grundlage
zahlreicher
ökologischer
Renaturierungs- oder Ausgleichsmaßnahmen, die ohne einen vorhergehenden Wertewandel in Bezug auf die Umwelt meist kaum durchsetzbar wären (vgl. ebd.: 131).
Nicht übersehen werden darf dabei, dass paradigmatische Steuerung in der Praxis
schwer zu handhaben ist. Einerseits sind Planer von ihrem Selbstverständnis her
eher keine Moderatoren. Andererseits stößt sie an ihre Grenzen, wenn es um sehr
gegensätzliche Interessen oder Emotionen geht (vgl. ebd.: 138). Ebenfalls sollte klar
sein, dass es sich dabei um kein ganz neues Planungsverständnis, sondern eher um
Planung auf einer anderen Ebene handelt. So unterscheidet Kooiman drei Governance-Ebenen: Meta-governing bezieht sich dabei auf Leitbilder oder Ethik - oder
eben Paradigmata - und basiert auf Diskursen. Second-order-governing betrifft die
Ausgestaltung von Institutionen und Politikinhalten und wird sowohl durch Diskurse
als auch Verhandlungen (arguing & bargaining) bestimmt. First-order-governing bezieht sich auf die konkrete Umsetzung eines Plans, was laut Kooiman durch Hierarchie, Diskurse und Verhandlungen erreicht werden kann (vgl. Kooiman 2002, 2003,
zit. nach Heinelt 2010 240 ff.).
Hauptsächlich in der Stadtentwicklungsplanung traf die Leitbildsteuerung auf reges
Interesse, v.a. im Rahmen einer ökologischen Stadt(um-)gestaltung, die kleinräumige
und dezentrale Entwicklungen, eine Übernahme neuer, v.a. ökologischer Ambitionen
wie etwa Energieeinsparungen und die Mitarbeit der Betroffenen umfasste (vgl.
Betker 1992: 85). Nur dem politisch-administrativen System nebst seinen Planungsmethoden wurde zugetraut, Umweltprobleme umfassend und nicht nur fallspezifisch
in den Griff zu bekommen. Weitere Bausteine sind etwa die Konzentration auf die
Erneuerung gewachsener historischer Stadtviertel und den Ausbau kultureller Zentren wie etwa Museen (vgl. ebd.: 91 f.). Umfassend meint hier eine tendenzielle
93
Rückbesinnung auf größere Raumplanungen unter Berücksichtigung zahlreicher
Faktoren wie etwa Umwelt, Wirtschaft oder Kultur - Mediziner würden von einer
ganzheitlichen Behandlung sprechen.
Jüngeren Datums, aber in ihren Grundzügen auf paradigmatischer Planung basierend, sind die Konzepte des „Regional Governance“ und des „Place-Makings“. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass im Zuge der Globalisierung regionale oder lokale
Wurzeln wieder stärker zu Buche schlagen und dadurch ein verstärkter sozialer und
emotionaler Zusammenhalt auf dieser Ebene provoziert würde (vgl. Fürst/ Lahner/
Pollermann 2008: 71). Unter Place-Making versteht man „einen kollektiven Prozess
der Raumgestaltung mit dem Ziel, die Raumnutzungs- und Lebensqualität zu verbessern und sich den Raum sozioemotional ,anzueignen‘“ (ebd.: 73). Hauptbausteine
dieses Konzepts sind eine emotionale („Heimat“), eine im Sinne des Putnam’schen
Sozialkapitals sozialintegrative Bindung an einen Raum, und eine Governance-Form,
die Möglichkeiten der selbstverantwortenden Mitgestaltung eröffnet. Unterstellt wird
dabei, dass über Identitätsbildungs- und Interaktionsprozesse Einstellungen, Motivation, das Gemeinschaftsgefühl positiv beeinflusst werden und es sogar zur Konstituierung von engen Netzwerken kommen kann.
Empirisch lassen sich jedoch hohe Hürden solcher Entwicklungen nachweisen. So
muss die Landschaft besonders ästhetisch, der Bezug der Menschen zur Region historisch vorgeprägt und das räumliche Potential auch wirtschaftlich nutzbar sein, z.B.
durch Tourismus (vgl. ebd.: 74). Je stärker die Bindungen zu einem „place“ ausfallen,
desto größer ist die Bereitschaft, Kosten für eine gruppenspezifisch nutzvolle Gestaltung zu akzeptieren. Es geht somit um den Gemeinschaftsgutcharakter einer Kulturlandschaft.
Regionales Governance in Bezug auf place-making meint hier eine netzwerkartige
Kooperation staatlicher, privater und ökonomischer Akteure zur Regelung regionaler
Probleme. Gemeinsame Betroffenheit oder das Erscheinen einer bestimmten Chance am Horizont, systematische Kommunikation mit einem Mindestmaß an Führung,
eine regelmäßige Mitgliedschaft und eine gemeinsame ideelle Klammer können dann
regionale Governanceformen promovieren, allerdings nur dort, wo weder öffentliche
Institutionen die Aufgabe alleine lösen könnten noch das Problem zu komplex sei
und es auf „Professionelle“ übertragen werden müsste (vgl. ebd.: 78 ff.). Es kommt
dann zunächst darauf an, die beteiligten Individuen und Gruppen als auch den Prozess an sich gut zu managen, z.B. durch eine motivierende Inszenierung des Pro94
zesses oder des Problemdrucks, durch eine Vertiefung der Gemeinschaft oder durch
das Feiern schneller Erfolge. Desweiteren ist es wichtig, Kontextbedingungen abzustimmen, beispielsweise durch eine Betonung soziokultureller Gemeinsamkeiten
oder durch das Ausschalten ökonomischer Zwänge. Darüber hinaus gilt es das anvisierte Governance-Arrangement straff zu organisieren und nicht zuletzt den Kooperationsprozess über die Initiierungsphase hinaus zu erhalten (vgl. ebd.: 84 f.).
Ist Planung durch die vorgestellten Entwicklungen „gerettet“? Ritter formulierte bereits 1987 einige Merkmale, die moderne Planung aufweisen müsste. Laut Fürst sei
dies durchaus gelungen: Gängige Planungsverständnisse zeichne in etwa aus, dass
sie „prozessual und auf aktive Konsensbildung ausgerichtet sei, strategisch über leitbildhafte Vorstellungen wirke, mit verkraftbaren Zielsetzungen […] (statt allumfassender Gesamtplanung) arbeite, […] mit institutioneller Sicherung für die Gesamtorientierung operiere, auf einen Prozeß der Verwirklichung von Zielen statt eines Vollzugs von Plänen orientiert sei und angereichert werde durch ein funktionsfähiges
Rückkopplungssystem im Wege der Evaluierung und daraus abgeleiteten Lernprozesse“ (Ritter 1987, zit. nach Fürst 1998: 64).
Diese Eigenschaften zeitigten jedoch gewisse Paradoxien innerhalb der Planung, wie
etwa langfristige Strukturplanung vs. kurzfristige Problemlösungen, Verbindlichkeit
von Plänen vs. flexibles Verwaltungshandeln, zunehmende sachliche und soziale
Inklusion vs. Eingeständnis der Unmöglichkeit, in einer komplexer werdenden Welt
allwissend sein zu können etc. (vgl. ebd.: 65) - neue Planungskonzepte haben somit
neue Schwächen.
Trotz dieser Paradoxien finden sich solche Forderungen auch noch in modernen
Texten, wo davon die Rede ist, „dass Planung ‚kommunikativ‘ und ‚kooperativ‘ sein
solle, dass Planer als Moderatoren agieren sollten, dass vom reinen ‚Plänemachen‘
Abschied zu nehmen sei und der Plan lediglich als Zwischenergebnis eines in die
Planumsetzung zu verlängernden Interaktionsprozesses aufzufassen sei, dass Planung stärker strategisch ausgerichtet werden müsse […], dass die Vielfalt der Belange konstruktiv-kreativ integriert werden müsse, wobei von der in Verwaltungen typischen ‚negativen‘ zur ‚positiven‘ Koordination überzugehen sei“ (Fürst 2000b: 17). Es
zeigt sich somit, dass Planer weiterhin für die Berücksichtigung ihres Fachgebiets
durch die Entwicklung von Planungsalternativen eintreten; Planungsbedürftigkeit im
Rahmen von politischer Steuerung wird nicht bestritten: „Polit. Planung hat in D mittlerweile eine beachtliche Tradition. Infolge weiter wachsender und sich qualitativ ver95
ändernder Problemlösungsanforderungen an das polit.-administrative System sind
auch weiterhin umfangreiche Steuerungs- und Regulierungsleistungen zu erbringen“
(Dose 2003: 378).
2.7 Planungskritik
2.7.1 Planung als generell problembeladenes Konzept
In den vorigen Abschnitten wurden bereits spezifische Mängel bestimmter Planungskonzepte aufgezeigt. In diesem Abschnitt sollen nun abschließend bekannte Hauptprobleme von Planung diskutiert werden.
Auf generell defizitäres Planungsverhalten wies Dietrich Dörner mit dem Spiel
„Tanaland“ hin. In diesem Spiel hatten Studenten die Aufgabe, ein Tal in Afrika, das
von Bauern und Hirten bewohnt war, sich in einer vorindustriellen Phase befand und
- für diesen Entwicklungsstand - problemlos funktionierte, mit Hilfe der Segnungen
der modernen Wissenschaften innerhalb von sechs Spielrunden mit diktatorischer
Vollmacht zu entwickeln. Nach der Hälfte der Spielzeit waren die Einwohner u.a. mit
Düngemitteln, einer besseren medizinischen Versorgung und Elektrizität versorgt,
dadurch stieg die Bevölkerung an.
Was zunächst den Eindruck eines grandiosen Erfolgs vermittelte, entpuppte sich in
der Folgezeit als tickende Zeitbombe: Es kam zu einer Bevölkerungsexplosion und in
deren Folge zu katastrophalen Hungersnöten. Die Planer hatten die Folgeprobleme
ihrer Eingriffe nicht bedacht und Dörner einige interessamte Einsichten gewonnen,
ging es ihm doch nicht um die Entwicklung afrikanischer Täler, sondern um das Verhalten von Planern in konkreten Planungssituationen (vgl. Dörner 2010: 22 ff.).
Dörner meinte, dass diese Simulationen sehr wohl der Realität entsprächen. Planungssituationen würden sich in beiden Fällen durch bestimmte Merkmale auszeichnen, nämlich Komplexität, Vernetztheit, Intransparenz und Dynamik. Genauer bestünden solche Systeme „jeweils aus sehr vielen Variablen, die ,vernetzt‘ sind, da sie
sich untereinander mehr oder minder stark beeinflussen; dies macht ihre Komplexität
aus. Weiterhin sind die Systeme intransparent, zumindest teilweise; man sieht nicht
alles, was man sehen will. Und schließlich entwickeln sich die Systeme von selbst
weiter; sie weisen Eigendynamik auf. Hinzu kommt, dass die Akteure […] keine vollständigen Kenntnisse aller Systemeigenschaften“ besitzen (ebd.: 58 f.).
Wenn - wie Scharpf meint - Planung und politische Entscheidung tatsächlich zwei
disjunkte Sphären seien, dann könnten sich schier unüberwindbare Schwierigkeiten
96
schon vor dem Planungsprozess ergeben und diesen damit deutlich einschränken.
Die Kombination von rationaler, informationsverarbeitender Planung und konsensorientierter Politik hat demnach bereits Auswirkungen auf die Definition eines Problems.
Politische Probleme werden in diesem Rahmen oft als „schlecht strukturierte Probleme“ bezeichnet. Sie zeichnen sich etwa dadurch aus, „dass sich der Zustand seit
einiger Zeit verschlechtert hat (z.B. Infrastruktur verfällt), dass sich Rahmenbedingungen verändert haben, die den Zustand als nicht mehr haltbar einschätzen lassen
(z.B. wachsende Arbeitslosigkeit als Folge der zunehmenden Globalisierung […],
dass sich Werte geändert haben (z.B. zunehmende Unzufriedenheit mit der schlechten Umweltsituation […]), dass sich bei gleichbleibenden Wertesystem die Ansprüche
gewandelt haben, die an eine ‚befriedigende Situation‘ gerichtet werden (z.B. als
Folge zunehmend internationaler Vergleiche oder neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse“ (Fürst 2004a: 28f.).
Es kämen nur solche Probleme auf die politische Agenda, die von einer großen Zahl
politischer Akteure wahrgenommen werden, in vorhandene Problemlösungsstrukturen eingepasst werden könnten und zudem schnell erfassbar seien (vgl. ebd.: 26).
Dabei ist schon die Problemerkennung innerhalb des Planungsprozesses von
Schwierigkeiten durchsetzt. So stellen sich etwa Fragen danach, ob denn die Beschäftigung mit dem richtigen Problem erfolgt, ob es adäquat analysiert wird und ob
ausreichend relevante Informationen zur Problembestimmung vorliegen (vgl. Böhret
1975: 19). Jedwede politische Planung ist in der Summe schon deshalb störungsanfällig, weil nur bestimmte Probleme Eingang in die Agenda finden oder sich die Problemstruktur ändert. Im Planungsprozess lassen sich dann die vier folgenden generellen Planungsprobleme ausmachen.
2.7.2 Varietätsproblematik
Grundlage ist die bereits angesprochene „requisite variety“ von Ashby. Diese Problematik bezieht sich auf die Unmöglichkeit eines jeden Planungssystems, für jeden
Fall eine Lösung auf Lager zu haben. Ein Beispiel hierfür ist das Planungssystem der
gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsfaktoren, welches auf die Abbildung möglichst aller gesellschaftlichen Prozesse in der administrativen Organisation
abzielt (vgl. Naschold/ Väth 1973: 15). Allerdings weist Frieder Naschold darauf hin,
dass auch dieses Planungssystem bezüglich seiner requsite variety an Grenzen sto-
97
ßen könne; dieser Umstand könne nur durch eine Einbeziehung gesellschaftlicher
Gruppierungen in Planungsprozesse aufgelöst werden (vgl. Naschold 1973: 79).
Dörner weist darauf hin, dass auch Planer in vielen Situationen auf tradierte oder ritualisierte Handlungsmöglichkeiten zurückgriffen. Ihr Handlungsspielraum würde dadurch eingeengt bzw. zu einem gewissen Konservativismus neigen (vgl. Dörner
2010: 68). Das andere Extrem besteht in der übergenauen Planung und Einkalkulierung jedweder möglichen Situation. Berücksichtigte Störfälle ließen Planer immer
weiter in die Untiefen ihres Gegenstandes eintauchen und ihre Pläne weiter ausdifferenzieren, sodass am Ende eine zu komplexe Lösungsstrategie stünde, die die Unsicherheit vergrößerte anstatt sie zu verringern (vgl. ebd.: 248). Dieser Weg würde etwa dann beschritten, wenn der Staat versucht, den Erwerb notwendiger Informationen auf breitere Basis zu stellen, etwa durch Statistiken, die weitere Ausdifferenzierung der eigenen Binnenstruktur, den Kontakt zu Interessengruppen oder der Wissenschaft (Ronge/ Schmieg 1973: 54 ff.).
Gelegentlich würden Planer auch dazu neigen, Probleme zu ungenau zu erfassen
und Lösungen zu unpräzise zu beschreiben. Umso problematischer erscheint dieser
Sachverhalt, wenn man die Starrheit bzw. die lange Dauer einer Korrektur von Plänen bedenkt (vgl. Ganser 1991: 57). Zu dieser Problematik zählen aber auch Defizite
bei der Übernahme von Planungsergebnissen durch die Verwaltung. So sei es laut
Naschold in den USA während der Planungseuphorie nie gelungen, Ergebnisse des
Planungssystems PPBS adäquat in politische Entscheidungen einzubauen, da Planung einer ökonomischen, Politik hingegen einer konsenssuchenden Rationalität
folgt (vgl. Naschold/ Väth 1973: 10).
2.7.3 Komplexitätsproblematik
Das zweite Hauptproblem wurde von Fritz W. Scharpf ausformuliert. Scharpf attestiert zunächst dem politischen System eine mangelnde Steuerungsfähigkeit in modernen Gesellschaften. Dieses Problem ließe sich weder durch einen Ausbau der
Entscheidungs- und Informationsverarbeitungsprozesse noch durch eine sozialistische Revolution lösen (vgl. Scharpf 1973a: 73 f.); letzteres war zu jener Zeit eine in
der kritisch-dialektisch verfahrenden Politikwissenschaft durchaus diskutierte Möglichkeit. Der Ausbau des politisch-administrativen Systems könne „durch eine Verbesserung der personellen (Aus- und Fortbildung), finanziellen (mittelfristige Finanzplanung), organisatorischen (Reorganisation, Planungsstäbe) und informellen Res98
sourcen (moderne Entscheidungs- und Planungsmethoden) sowie der Prozesse der
Konfliktaustragung und Konsensbildung“ erreicht werden (Jann 1995: 473). Würde
es in diesem Sinne seine eigene Binnenstruktur ausdifferenzieren, könnte man in
Anlehnung an Ashby auch von einer verbesserten „requisite variety“ sprechen. Dies
sei vielen modernen politischen Systemen gelungen.
Scharpf kritisiert aber, „daß es jedoch bisher nur mit außerordentlichen Schwierigkeiten und in relativ geringem Maße möglich war, auch die realen Interdependenzen der
Problemzusammenhänge in der sozioökonomischen Umwelt durch entsprechende
Verknüpfungsmuster der politisch-administrativen Problemverarbeitung zu reproduzieren“ (Scharpf 1973a: 77) und spricht damit die Vielzahl von Merkmalen in Planungssystemen an, die zudem alle auf irgendeine Art und Weise miteinander vernetzt sein können. Er meint, die Missachtung der Relationen führe unweigerlich zu
einer punktuellen Politik, die aufgrund ihrer mangelnden Komplexität automatisch
schlechte Lösungen zeitige. Die mangelnde Erfassung der Komplexität sei Folge der
Dezentralisierung moderner Regierungen. Zwar sei gerade in den Ressorts, Abteilungen und Referaten sachliche und finanzielle Kompetenz angesiedelt, dadurch
würde aber zugleich der Blick auf einzelne dem eigenen Zuständigkeitsbereich entsprechenden Problemausschnitte verengt und weniger auf umfassende Zusammenhänge gerichtet (selektive Perzeption). Desgleichen würde die Aufteilung in Ressorts
und Abteilungen in Bezug auf die Koordinationsplanung Kompetenzen beschränken
und eine umfassende Problemlösung mangels Handlungsspielraum verunmöglichen.
Desweiteren würden genauso Kompetenzüberschneidungen existieren (vgl. Scharpf
1973b: 107 f.).
Helmut Willke meint dazu, Planung sei „absurd, weil Planung unter Bedingungen hoher interner wie externer Dynamik und Komplexität in sich widersprüchlich und irreführend ist. […] Man muss sich zunächst der erschreckenden Einsicht stellen, dass
Planung in einem strengen Sinne für komplexe dynamische Systeme nicht möglich
ist. Planung ist ein viel zu einfach und linear gedachtes Instrument für die Steuerung
dynamischer Zusammenhänge“ (Willke 2003: 293). Andere Ursachen für die mangelnde Abschätzung oder Erfassung von Zusammenhängen sind etwa Zeitdruck,
geringes Wissen über den Gegenstand, verzögertes Eintreten anvisierter Wirkungen
oder das Auftreten anvisierter Effekte, die tatsächlich auf anderen Wirkungszusammenhängen basieren (vgl. Schönwandt 1986: 42). Daneben könne auch die Existenz
bestimmter Theorien Mutmaßungen über bestimmte empirische Zusammenhänge
99
verstärken, obwohl diese so gar nicht vorlägen (vgl. ebd.: 52). Nicht zuletzt wurden
auch überkomplexe Pläne entwickelt, die den politischen Entscheidern kaum noch
vermittelt werden konnten (vgl. Ganser 1991: 57).
Klaus von Beyme wies auf die Komplexitätsproblematik aus systemtheoretischer
Sicht hin: „Beim Verlassen von einfachen negativen Rückkopplungsschleifen […] und
beim Versuch, den Wandel komplexer Systeme zu planen, wird es immer schwieriger, die Zusammenhänge zu überblicken. Ursachen und Wirkungen sind in komplexen Systemen nicht mehr unmittelbar einsichtig miteinander verknüpft, die dysfunktionalen Folgen von Planungen lassen sich oft erst mit starker zeitlicher und örtlicher
Verschiebung erkennen. […] Noch schwieriger erscheint die Ermittlung der entscheidenden Systemparameter, auf deren Veränderung das System reagiert, da sich immer wieder zeigt, daß komplexe politische Systeme selbst auf Änderung mehrerer
Parameter kaum reagieren“ (Beyme 2006: 217).
Das Komplexitätsproblem trat im Übrigen auch im Rahmen des oben angesprochenen Planspiels Tanaland auf, wo z.B. ersichtlich wurde, dass eine Reduzierung von
Kleinsäugern durch Jagd etc. nicht nur eine verbesserte Ernte, sondern auch eine
Vergrößerung des Insektenbestands und der Zahl der Raubtiere verursachte; letztere
wendeten sich nun dem Viehbestand der Ackerbauern zu (vgl. Dörner 2010: 27 f.).
Zur Lösung jener Probleme politischer Systeme fordert Scharpf eine Form der positiven Koordination, wonach alle betroffenen Abteilungen und Referate zusammen den
gesamten Problemzusammenhang analysieren und gemeinsame Handlungsalternativen entwickeln sollten. Dies wäre jedoch mit einer enormen Steigerung der Koordinationskosten verbunden (vgl. Scharpf 1973b: 85 f.).
2.7.4 Informationsproblematik
Die dritte chronische Krankheit von Planung firmiert unter dem Begriff „Informationsproblem“ (vgl. Bechmann 1981: 87). Generell werden Informationen in jeder Phase
eines Planungsprozesses benötigt, und zwar jeweils über ganz verschiedene Dinge
wie Eigenschaften des Planungsobjektes, Erwartungen seitens des Auftragsgebers,
Werte und Interessen der an der Planung Beteiligten und der von der Planung Betroffenen und nicht zuletzt über Handlungsmöglichkeiten des Planers (vgl. ebd.: 89).
An dieser Stelle ist schon zu sehen, dass es kaum möglich ist, in einem Planungsprozess jegliche Informationen über jede Phase zu jedem Aspekt zu sammeln. Überdies ist jede Information an die Art und Weise des Informationsempfangs seitens des
100
Planers und dessen Vorwissen nebst Interpretationsvermögen gebunden (vgl. ebd.:
93). Frieder Naschold weist darauf hin, dass jegliches Informationsverarbeitungssystem defizitär sei, denn generell stehe ihnen „eine weitreichende Unfähigkeit gegenüber, diese informationelle Komplexität adäquat zu verarbeiten und valide zu reproduzieren“, von daher spricht er auch von „information pollution“ und „Datenfriedhöfen“
(Naschold 1973: 86). Carl Böhret ist sich darin mit Naschold einig: „Planungsfehler
entstehen hauptsächlich aus der unzureichenden Existenz oder der mangelhaften
Verarbeitung relevanter Information“ (Böhret 1975: 20).
Daneben weist Böhret darauf hin, dass nur vorhandene Informationen erhoben und
verarbeitet werden könnten, dass sie gleichzeitig aber auch erst im Nachhinein als
relevant eingestuft werden können (vgl. ebd.). Andererseits werden solche verspäteten Informationen manchmal auch bewusst ignoriert: „Neue Informationen stören das
Bild. Wenn man einmal zu einer Entscheidung gekommen ist, so ist man froh, der
ganzen Unbestimmtheit und Unentschiedenheit der Vorentscheidungsphase entronnen zu sein“ (Dörner 2010: 147). Informationen müssen daneben über potentielle
Planungsfolgen eingeholt werden (vgl. Böhret 1990: 97 f.). Darüber hinaus kann es
auch biologische Gründe geben, warum nur bestimmte Informationen wahrgenommen werden. Dann kommt es auch darauf an, wie diese in vorhandenes Wissen eingepasst werden (vgl. Schönwandt 1986 21). Informationen werden vorzugsweise
dann in Planungen verarbeitet, wenn sie die eigene Meinung bestätigen, im Gedächtnis leicht verfügbar, darüber hinaus leicht anschaulich und erwünscht sind (vgl.
ebd.: 23 ff.).
2.7.5 Kommunikationsproblematik
Ein jüngeres Problem der Planung(stheorie) taucht in der Literatur in der Regel nicht
in dieser Liste auf. Es geht um die Schwierigkeiten und Widersprüche von „Kommunikation“ im Rahmen eines „Kooperativen Handelns“ als eine neuere Form des Planens. Klaus Selle weist beispielsweise darauf hin, dass solche auf Kommunikation
mit den Betroffenen basierenden Planungsprozesse meist mit Hilfe zahlreicher Leerformeln eine konsensuale anstelle einer besten Lösung zeitige, die zudem nicht bei
allen Betroffenen Rückhalt finde oder die wahren, d.h. politischen Zentren der Macht
ignoriere (vgl. Selle 2004: 231 f.) - nicht jede Kommunikation zeitigt somit Kooperation.
101
Die kommunikative Wende habe überdies eine ganze Palette an Handlungsmöglichkeiten geschaffen, die eine gezielte Verhinderung einer Lösung gestatteten: „Das
Verlagern der Problembearbeitung in andere Bereiche (der Regierung), das Gründen
neuer Komitees für weitere Untersuchungen, das Zerlegen des Entscheidungsgegenstandes in viele Einzelteile, das Hineinstellen des Themas in einen anderen Kontext oder die Neuformulierung der Fragestellung oder gar die Übereinstimmung darin,
dass man nicht übereinstimmte. In der Summe führe dies alles das dazu, das wirklich
drängende Probleme nicht bearbeitet, notwendige Entscheidungen nicht getroffen
und lediglich fadenscheinige Beschlüsse gefasst und nichts sagende Papiere verfasst werden“ (ebd.: 232). Nicht zuletzt würde die Kommunikation zwischen Planern
und Betroffenen meist zu vermehrten Widerstand auf Seiten der Letzteren führen, da
in der Regel Eigeninteressen und nicht das Gemeinwohl verfolgt würden. Diese neuartigen Konstellationen hat Planer zunehmend dazu gezwungen, „ihr Berufs- und
Handlungsfeld gegenüber konkurrierenden Handlungsträgern politisch zu verteidigen“ (Fürst 2000c: 15).
Es gebe aber auch eine ganze Reihe an hausgemachten Planungsfehlern, die jedwede Kommunikation a priori pervertiere. Dazu gehörten etwa Bürgertreffen, die
nach der Entscheidungsfindung anberaumt wurden, ein auf Seiten der Politik überschätztes Interesse der Betroffenen an einer gemeinwohlorientierten Diskussion, die
Teilnahme irrelevanter und damit nur vermeintlich Betroffener (vgl. Selle 2004: 237
f.). In diesem Sinne hat Throgmorton wohl nicht unrecht mit seiner Behauptung: „the
communicative turn […] has ignored the ‚dark side‘ of planning, which can produce
social oppression, domination, and control” (Throgmorton 2000: 367). Dies liegt laut
Selle auch an planungstheoretischen Beiträgen zum kommunikativen Planen, in denen zwar häufig Kommunikationsformen beschrieben würden, jedoch nur selten Inhalte, Aufgaben, beteiligte Personen etc. exakt benannt würden (vgl. Selle 2004: 247
f.).
Zwar ist auf der einen Seite positiv zu vermerken, dass moderne Planungsansätze
Phänomene wie „Kommunikation“ etc. zunehmend in den Blick nehmen. Auf der anderen Seite wirkt die Beschäftigung hiermit jedoch äußerst defizitär. Dies mag mutmaßlich an der geringen Zahl an Instituten und Lehrstühlen in der BRD liegen, die
sich mit Planung beschäftigen - hier mangelt es wohl schlicht an Ressourcen zur tiefergehenden Beschäftigung mit „Kommunikation“. Moderne Planungstheorie muss
sich dann aber die Frage gefallen lassen, warum sie an dieser Stelle nicht auf die
102
zahllosen Vorarbeiten und Untersuchungen z.B. der Sozial- oder der Kommunikationswissenschaften zurückgreift. Letztlich hantieren die Vertreter der Planungstheorie
mit einem theoretisch nicht bestimmten Begriff von Kommunikation, der somit lediglich als Schlagwort verwendet wird.
2.8 Fazit
Planungstheorien spielen heute in der Politikwissenschaft so gut wie keine Rolle
mehr. Die vorgestellten Innovationen wie kommunikative, kooperative oder perspektiv-inkrementalistische Innovationen stammen eher aus spezialisierten Planungslehrstühlen oder wurden im Bereich der Stadtplanung entwickelt. Wie keine andere an
Planung interessierte Disziplin hat Politikwissenschaft Planungsdefizite herausgearbeitet und Planung aus den genannten Gründen aus ihrem Curriculum ausgeschlossen. Wie gezeigt wurde, besitzen sämtliche Planungskonzepte einige teils schwerwiegende Defizite.
Abschließend soll versucht werden, die vorgestellten Rationalitätskonzepte auf die
eingangs genannten Kriterien hin zu überprüfen und zu bewerten. Hinlänglich empirischer Adäquatheit wurden für die klassischen Planungsansätze zahllose Defizite
aufgezeigt, wobei sich die Kritik v.a. an der Diskrepanz zwischen theoretischer Sparsamkeit und empirischer Komplexität erzürnte. Inkrementalistische Ansätze erschienen in diesem Hinblick geeigneter, allerdings stellte sich dann die Frage, woher denn
innovative Verbesserungen kommen sollten, wenn sie zur Beschreibung der Realität
und nicht zur Verbesserung der Planungsprozesse entwickelt wurden. Nicht ganz zu
Unrecht haftet an diesen Ansätzen ein konservativer Ruf.
Dank der zahlreichen Kritik hat sich die Planungstheorie in all ihren Verästelungen
wie gezeigt entwickelt, sodass ihr ein gewisses Innovationspotential attestiert werden
kann - man denke nur an die entscheidungstheoretischen Ansätze als Ausgangspunkt der Entwicklung und die kommunikativen oder kooperativen Ansätze, die diese
Struktur vollkommen aufgebrochen haben.
In Bezug auf logische Konsistenz kann kaum eine Aussage getroffen werden, da es
sich bei der Mehrheit der Planungsansätze eher um Heuristiken, Ansätze oder Empfehlungen denn stringente Modelle oder Theorien handelt. Vernachlässigt man diesen Umstand, so konnte den Ansätzen zumindest kein logischer Bruch nachgewiesen werden.
103
Die steuerungstheoretische Effektivität von Planungskonzepten ist nur schwierig einzuschätzen. Wie gezeigt erregte sich ein Teil der Kritik an der Tatsache, dass geplante Politik häufig Fehlschläge produzierte, woraufhin Politikwissenschaft die theoretische Beschäftigung mit Planung im Gegensatz zu deren regelmäßiger Verwendung im Alltag verworfen hat. Möchte man aus politikwissenschaftlicher Perspektive
die Bewertung in Bezug auf dieses Kriterium auf einen Nenner bringen, so könnte
man formulieren: Je geringer die Komplexität eines Problembereichs, desto eher
kann mit Planung effektiv gesteuert werden. Steuerung nach dieser Hypothese setzt
dann jedoch voraus zu wissen, wie komplex ein Problem tatsächlich ist - diese Hypothese zeitigt somit neue Schwierigkeiten. Ein Beispiel: So zeigt etwa der Bau von
ausführlich geplanten Umgehungsstraßen, dass anvisierte Effekte wie etwa die Verdrängung des Verkehrs aus der Innenstadt häufig verfehlt oder gar neue Folgeprobleme wie etwa das Absterben eines Stadtkerns herbeigeführt werden. Und das, obwohl es doch „nur“ Verkehrsströme in Bezug auf die Problemkomplexität zu untersuchen gilt. Ob Planung für die Steuerung moderner sozialer Prozesse geeignet ist,
scheint damit mehr als fraglich.
104
3. Staats- und Gesellschaftstheorien
Unter dem Oberbegriff „Staats- und Gesellschaftstheorien“ firmiert in der Politikwissenschaft ein buntes Sammelsurium an Steuerungskonzepten. An dieser Stelle soll
und kann diese Ansammlung nicht in voller Breite dargestellt werden. Es soll genügen, exemplarisch einzelne aktuelle Theorien oder Konzepte vorzustellen, um zu
verstehen, wie die Vertreter dieser Richtung vorgehen. Staatstheorien beschäftigen
sich schlicht formuliert mit der Gestaltungsfähigkeit des Staates gegenüber der Gesellschaft, Gesellschaftstheorie hingegen mit der gesellschaftlichen Auswirkung sowie den Grenzen staatlicher Eingriffsversuche (vgl. Schweizer 2003: 41). Präziser
formuliert: „So reflektiert Steuerungstheorie als Staatstheorie die Konsequenzen politischer Steuerung für die institutionelle Struktur, das normative Selbstverständnis und
die demokratische Legitimation des Staates. Steuerungstheorie als Gesellschaftstheorie wiederum fragt komplementär nach den Möglichkeiten und Grenzen von politischer Steuerung im Sinn einer gesamtgesellschaftlich erforderlichen Integrationsleistung, die insbesondere angesichts der funktionalen Differenzierung sozialer Teilsysteme als zunehmend problematisch begriffen wird“ (Görlitz 2001: 11).
Allen diesen Ansätzen gemein ist die Idee eines Staates, der im Bereich des Politischen entweder das alleinige oder zumindest das zentrale Steuerungssubjekt ist.
Ronge verweist in diesem Rahmen auf Hegels Rechtsphilosophie, in der erstmals
analytisch zwischen „Staat“ und „Gesellschaft“ getrennt wurde (vgl. Ronge 1989:
973). Dabei wurde der Gegensatz oder - nüchterner ausgedrückt - die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft wie folgt dargestellt: „Man gelangt dann leicht zu
der Vorstellung einer einfachen Kräftemechanik, in der Staat und Gesellschaft in Relationen von stark/ schwach, schwach/ stark oder als ausgeglichenes Kräfteverhältnis
erscheinen […]. Dieser Kombinatorik liegt die Überlegung zu Grunde, daß Autonomiegewinne der einen Seite notwendig mit Autonomieverlusten […] der anderen verknüpft sind. […] Diese Sichtweise findet sich oft dort, wo die Sphärentrennung von
Staat und Gesellschaft besonders hervorgehoben wird“ (Czada 1991: 152).
Exemplarisch hierfür kann folgende Differenzierung von Staatstheorien betrachtet
werden: „(1) Theorien, die vom Primat des Staates gegenüber der Gesellschaft ausgehen, von solchen, in denen der Staat vice versa in der Gesellschaft aufgeht; (2)
Theorien struktureller Abhängigkeit des Staates von gesellschaftl. Interessen, etwa
die verschiedenen Varianten marxistischer Staatstheorien, die den Staat in Abhängigkeit von den Klassenverhältnissen und als Instrument der jeweils dominanten
105
Klasse begreifen […] (3) Theorien, die von der Interdependenz von Staat und Gesellschaft und einem mehr oder minder hohen Maß an Autonomie des Staates ausgehen […] Theorien, die […] von der Autopoiesis der einzelnen Systeme der Gesellschaft ausgehen, welche voneinander abgeschottet sind […] und von anderen Systemen nicht direkt gesteuert werden können“ (Schultze 2003b: 495). Während
Staatstheorien häufig auf einer juristischen Terminologie basieren und eine streng
hierarchische Steuerung postulieren, rekurrieren Gesellschaftstheorien zwecks Berücksichtigung von Differenzierungsprozessen meist auf systemtheoretischer Begrifflichkeit.
3.1 Staatstheorien
3.1.1 Der „Staat“ - eine Begriffsannäherung
Ein Großteil der Staatstheorien greift auf die geläufige Staatsdefinition von Georg
Jellinek zurück, der als konstituierende Elemente drei Punkte ausgemacht hat: „1. ein
Staatsgebiet als ausschließlicher Herrschaftsbereich, 2. ein Staatsvolk als sesshafter
Personenverband mit dauerhafter Mitgliedschaft, 3. eine souveräne Staatsgewalt,
was (a) nach innen das Monopol der legitimen Anwendung physischer Gewalt bedeutet, (b) nach außen die rechtliche Unabhängigkeit von anderen Instanzen“ (Reinhard 1999: 16, zit. nach Nullmeier 2009: 35). Diese Definition wirft jedoch einige Unklarheiten auf, denn wer letztendlich zum Volk gehört, welches Gebiet Teil wessen
Staates ist und wie weit staatliche Gewalt reichen darf, ist damit nicht gesagt. In der
Summe führt diese Staatsdefinition zu vielen begrifflichen Unklarheiten, sodass nicht
klar wird, wer oder was der „Staat“ eigentlich ist. Fraglich bleibt auch, ob diese und
andere Staatsdefinitionen überhaupt noch zur zeitgemäßen Erscheinungsform passen: „So sind die heutigen Staatsdefinitionen […] in hohem Maße Begriffsbildungen
verbunden, die sich vor knapp hundert Jahren ergeben haben“ (Nullmeier 2009: 37).
In der Politikwissenschaft wurde von daher die staatstheoretische von der systemtheoretischen Perspektive abgelöst und erstere zu einem Schattendasein verurteilt.
Neu ist nun die Verwendung des Begriffs „Politisch-administratives System“. Es
„handelt sich dabei um alle am politischen Entscheidungsprozess beteiligten und
durch die Verfassung legitimierten Organe“ (Pöllmann 2006: 15). Darüber hinaus
wird der Staat als „politisches System“ konzipiert: „Das politische System eines Gemeinwesens ist in diesem Verständnis die Gesamtheit der Elemente, die in ihrem
Zusammenhang die Einheit der politischen Funktionen des Gemeinwesens stiften.
106
Daher umfasst es mehr als nur die Institutionen des politisch-administrativen Systems“ (ebd.). Vegleichbar mit dieser Definition ist die alternative Konzeption von
Arthur Benz, der den Staat im Schema des akteurszentrierten Institutionalismus verortet. Der Staat wird als Institution verstanden, die einen Handlungsrahmen für Akteure „im“ Staat bietet, wobei Akteure solche sind, die an der Herstellung von Politik
beteiligt sind. Eine innovative Theorie bietet dieses Vorgehen zwar nicht, aber die
einzelnen Analysekategorien lassen spezifische Fragestellungen zu (vgl. Benz 2008:
102). Trotz allem: Der klassische Staatsbegriff wurde im Laufe der Zeit gleichsam
weichgespült und aufgelöst. Im Rahmen dieser Arbeit soll jedoch zur Veranschaulichung an dieser Stelle beim klassischen Staatsbegriff der Staatstheorie innegehalten
werden.
Frank Nullmeier schlägt beispielsweise vor, auf die Jellinek’schen Begriffsklassen
Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt zu verzichten. Stattdessen sollten eine
funktionale, aufgabenbezogene Dimension von Politik, eine unterschiedlich ausgeprägte Monopolisierung dieser Aufgaben und der Verbandscharakter von Staaten in
den Blickpunkt rücken (vgl. Nullmeier 2009: 40 ff.). Andere Autoren wie Jörg Klawitter
meinen, auf jegliche Staatsdefinitionen verzichten zu können und setzen stattdessen
auf Deskriptionen, ohne jedoch zu verdeutlichen, worin denn der Mehrwert dieses
Vorgehens läge. Laut Klawitter könne das Phänomen „Staat“ wie folgt beschrieben
werden: „Der moderne Staat kann als ein historisch stets vorformiertes und sich aktual gesellschaftlich formierendes Akteursystem bezeichnet werden. Dieses erzielt
eine Bindungswirkung für die Herstellung möglichst gesamtgesellschaftlich erarbeiteter und akzeptierter Entscheidungen, die durch die prinzipielle Fähigkeit und Bereitschaft zu gemeinwohlorientiertem Handeln erreicht wird. Sie verfügt über eine institutionalisierte Gewalt/ Gewaltenteilung mit einem fungibelen, ausreichenden stabilen
Apparat, weist eine räumliche wie zeitliche Ausdehnung auf und gibt trotz der Vielgestaltigkeit und Vielschichtigkeit der am Staat direkt oder indirekt partizipierenden Akteure eine öffentlich bewußte, öffentlich getragene und koordinierte Richtungsorientierung für die Ausgestaltung nach Innen wie das Wirken nach Außen vor, - ohne den
Alleingültigkeitsanspruch des einmal Entschiedenen auf (relative) Dauer vertreten,
durchsetzen oder für sich beanspruchen zu können bzw. zu dürfen“ (Klawitter 2001:
195). Ob mit solchen sprachlichen Ungetümen ein Untersuchungsgegenstand besser
als mit Definitionen eingegrenzt werden kann, ist wohl eher fraglich. Die Staatsbegrifflichkeit weist also einige Unzulänglichkeiten auf, und „fast schien es so, als ob in
107
den siebziger Jahren mit dem Siegeszug des systemtheoretischen Denkens der Begriff ,Staat‘ aus der politikwissenschaftlichen Diskussion ganz verschwinden würde“
(Voigt 2000: 10).
Bei aller begrifflichen Unschärfe bleibt jedoch die Idee erhalten, dass es „der Staat“
ist, der die Gesellschaft in wesentlichen Gebieten steuert. Verzichtet man auf Hobbes
und dergleichen und sucht stattdessen nach einer modernen Begriffsbestimmung, so
könnte man formulieren, der Staat sei „das Subsystem der Gesellschaft, in dem (1)
die gesamtgesellschaftlich verbindlichen Entscheidungen gefällt werden, das (2) als
Öffentliche Verwaltung die Entscheidungen implementiert und administriert und (3)
als Rechtssystem die Konflikte reguliert, die aus den getroffenen Entscheidungen
folgen“ (Schultze 2003a: 485). Auch nach dieser jüngeren Definition bleibt der Staat
als Herrschaftszentrum wie auch das klassische Steuerungsverständnis vom Steuerungssubjekt und Steuerungsobjekt erhalten.
3.1.2 Staat als „Zentrum der Herrschaft“?
Staatstheoretiker verfolgen seit jeher die Aufgabe, Eigenschaften und Wesen des
Staates jeweils ihrer Zeit gerecht zu bestimmen: „Der Glaube an den Staat war stets
dem Auf und Ab der geschichtlichen Ereignisse unterworfen. Waren die Verhältnisse
vom Krieg bestimmt, so führten Denker wie Hobbes und Machiavelli den Staat gegen
Bürgerkrieg oder unselige Kleinstaaterei ins Feld. Riefen die Verhältnisse nach Reform oder gar Revolution, so sollte der Staat der Gesellschaft dienen oder sogar abgeschafft werden, wie bei Marx oder Laski […]. So wurde der Staat bald bewundert,
bald gehaßt; […] Heute hat der Staat viel von seiner einstigen Bedeutung für das politische Denken verloren“ (Beyerle 1994: 1).
Moderne Staatstheorie hat akzeptiert, dass der Staat nicht mehr als unumstrittenes
Herrschaftszentrum agieren kann, sondern gesellschaftliche Akteure berücksichtigen
muss: „Staat und Gesellschaft sind heute weder klar voneinander abgegrenzt (sondern von vielfach komplexen Interdependenzen charakterisiert und durch Netzwerke
und Verhandlungssysteme miteinander vermittelt), noch ist der Staat im Innern homogen und allein von hierarchischen Entscheiden bestimmt (sondern entsprechend
der Aufgabenfülle stark spezialisiert und horizontal wie vertikal fragmentiert) […]. An
die Stelle politischer Steuerung durch autoritatives Entscheiden treten zunehmend
Aufgaben der Koordination, Moderation und Integration durch indirekte und dezentrale Steuerung“ (Schultze 2003a: 485 f.).
108
Claus Offe benennt ein Ursachentrio für den Verlust von Steuerungsfähigkeit: „Es
handelt sich erstens um die - sei es institutionell geschützten ,materiellen‘, sei es
,lebensweltlichen‘ - Restriktionen regulierender Staatstätigkeit, die sich im gesellschaftlichen Umfeld dieser Tätigkeit geltend machen. Zweitens handelt es sich […]
um die paralysierende Binnenkomplexität hochentwickelter Staatsapparate, in deren
Struktur Partikularismen, symbiotische Beziehungen zu Umweltausschnitten, Rivalitäten, verkürzende Manipulationen des Informationshaushaltes usw. mit dem Effekt
einsickern, daß in irgendeinem strikten und anspruchsvollen Sinne von einer inneren
,Wirkungseinheit‘ kaum her die Rede sein kann. Ein dritter Aspekt […] sind die offensichtlichen Souveränitätsverluste, die der Staat durch Abtretung seiner strategischen
Dispositionsfähigkeit einerseits an die Vergangenheit [z.B. durch Kredite, der Verf.],
andererseits an andere Staaten oder supranationale Organisationen erleidet“ (Offe
1987: 312 f.). Dabei handelt es sich um Überlegungen, die in sehr ähnlicher Form im
Rahmen der Governance-Konzepte erneut auftauchen werden.
Moderne Staatstheoretiker haben trotz der genannten Umstände an ihrem klassischen Realitätsausschnitt - dem „Staat“ - festgehalten. Denn entgegen mutmaßlich
sinkender Steuerungsfähigkeit wurden dem Staat immer mehr Aufgaben zur Lösung
angetragen (vgl. Ulrich 1994: 22). Aus ordnungspolitischer Sicht ist es z.B. Aufgabe
des Staates das Recht auf Eigentum zu gewährleisten oder Gewalt zu vermeiden.
Aus wohlfahrtspolitischer Perspektive soll er eine größere Verteilungsgerechtigkeit
herstellen, sich um Arme und Benachteiligte kümmern. In jüngster Zeit würde darüber hinaus dem Staat die Aufgabe der kollektiven Risikovermeidung zugeschrieben,
d.h. „daß er für eine problemadäquate und steuerungspolitisch angemessene
,Risikoabsorption‘ sorgt. Staatliche Interventionen sind nicht erst dann gefordert,
wenn es um die nachträgliche Beseitigung von Schäden geht; vielmehr sollte der
Staat bei besonders sensiblen gesellschaftlichen Entwicklungen präventiv und gestaltend tätig werden“ (ebd.: 26). Die folgenden Autoren haben Ihre Konzepte allein
zu dem Zweck entwickelt, dem Staat alternative Steuerungsformen, die ein Mindestmaß an Effektivität und Effizienz aufweisen, aufzuzeigen.
3.1.3 Das Steuerungskonzept des „Kooperativen Staats“
Dietmar Braun hat zur Lösung der angedeuteten mutmaßlichen gesellschaftlichen
Fragmentierung und damit einhergehenden Parzellierung politischer Macht eine Typologie entwickelt, die für vier Konstellationen ideale Steuerungsmodelle darlegt. Auf
109
Basis dieser Typologie arbeitet Braun im Anschluss ähnliche Komponenten der vier
Modelle heraus und versucht abschließend ein idealtypisches Steuerungsmodell zu
entwickeln. Zwar handelt es sich eher um Staats- bzw. Steuerungskonzepte und weniger um Modelle; dennoch wird Brauns Terminologie, der von „Modellen“ spricht,
beibehalten.
Die Typologie dieser Steuerungsmodelle fundiert Braun auf einem zweigeteilten
Steuerungsverständnis. Erstens meint Steuern in Anlehnung an Easton gesellschaftliche Ressourcen bzw. materielle und immaterielle Werte autoritativ zu verteilen.
Sucht man nach einem effizienten Verteilungsmodus, so gelange man in der Regel
an die Extrema „Plan“ und „Markt“. Diese beiden Modi gehen auf Überlegungen Walter Euckens zurück, der sich die Frage gestellt hat, wie der ökonomische Markt am
besten gelenkt werden solle, damit möglichst jeder Teilnehmer sich selbst versorgen
könne (vgl. Ulrich 1994: 117 f.) Daneben bezieht sich „Steuern“ auf gesellschaftliche
Koordination, was entweder durch horizontale, gesellschaftliche Selbstorganisation
oder durch vertikale, staatliche Organisation erfolgen kann (vgl. Braun 2001: 102).
Diese beiden Dimensionen erlauben es Braun, vier Staats- bzw. Steuerungsmodelle
zu konzipieren:
Interventionsstaat. Vertreter dieses Staatstyps gehen von der prinzipiellen Gestaltbarkeit gesellschaftlicher Entwicklungen durch den Staat aus, sofern ausreichend Ressourcen, Personal und technisch-instrumentelles Vermögen vorhanden sind. Der Staat wird hier als ein einheitlicher Handlungsakteur verstanden. Untersuchungsschwerpunkt ist von daher die Steuerungsfähigkeit
des Staates, nie jedoch die Steuerbarkeit von Gesellschaft. In diesem Sinne
ist er kompatibel mit den Planungsverständnissen der Planungseuphorie. In
Anlehnung an die Typologie wird diesem Staatstyp sowohl die Verteilung von
Ressourcen wie auch die Koordination gesellschaftlichen Handelns zugetraut
(vgl. ebd.: 105).
Minimaler Staat. Die Staatsaufgaben beschränken sich gemäß dieses Steuerungstypus auf die Sicherstellung marktwirtschaftlicher Tätigkeiten in der Gesellschaft, etwa durch die Bereitstellung eines gesetzlichen Regelwerks. Die
Verteilung von Ressourcen soll dem Markt überlassen werden. Die Koordination gesellschaftlichen Handelns reduziert sich auf eine formal-legalprozedurale Rationalität; die Wahrung einer Marktwirtschaft konformen Ordnung verbleibt jedoch beim Staat (vgl. ebd.: 106 f.).
110
Moderierender Staat. Analog zu den Vertretern des minimalen Staates wird
auch hier die marktförmige Verteilung von Ressourcen propagiert. Zusätzlich
wird hier die Auffassung vertreten, gesellschaftliche Koordination solle der
Gesellschaft überlassen werden; der Ordnungspolitik des Staates und der
Ausübung des Gewaltmonopols werden nur geringe Erfolge zugetraut. Zentrale Schlagwörter sind hier etwa „Zivilgesellschaft“ oder „Gemeinschaft“. Steuerung reduziert sich hier auf Selbststeuerung, staatliche Reform meint v.a. Ent-
staatlichung (vgl. ebd.: 108).
Steuerungsstaat. Auch dieser Staatstyp bevorzugt gesellschaftliche Selbststeuerung. Allerdings sollen Eingriffe des Staates sich nicht auf die prozedural-rationale Bereitstellung eines Rahmens beschränken, sondern durch Interventionen in Form von Delegationen Selbstorganisationsstrukturen befördert
werden, um die staatliche Handlungsfähigkeit zu bewahren. Wie im minimalen
und moderierenden Staat wird für eine Reduktion der Bürokratie plädiert. Zudem setzt er Ziele, die als globaler Rahmen gelten; bei deren Verfehlung greift
er notfalls ein. Die Steuerungsfähigkeit des Staates soll durch Delegation und
Partizipation der Adressaten gesteigert werden. Eine praktische Variante dieses Konzepts ist etwa das New Public Management (vgl. ebd.: 111 f.). Verteilungsfragen können zwar laut Braun dem Steuerungsstaat zugeschrieben
werden (so erklärt sich dann auch die Zuordnung dieses Typs in der folgenden
Grafik), allerdings würden diese nur selten diskutiert (vgl. ebd.: 114).
Grafisch lassen sich die Modelle wie folgt verorten:
Abbildung 6: Staatsmodelle nach Dietmar Braun (2001: 115).
Braun meint, es gelte für alle vier Idealtypen, dass staatliche Steuerung ohne eine
Beteiligung von gesellschaftlichen Akteuren oder dem Selbstorganisationspotential
111
gesellschaftlicher Organisationen prinzipiell nicht mehr möglich sei (vgl. ebd.: 115).
Aus diesem Grund macht Braun den Typus des kooperativen Staates als eine fünfte,
aber nur bedingt eigenständige Variante aus. Diesen Staatstyp siedelt er gleichsam
in der Mitte der obigen Grafik an und unterstellt, „dass jedes der bisher besprochenen Steuerungsmodelle den kooperativen Staat zur Kenntnis nimmt, ihn aber auf
andere Art und Weise interpretiert“ (ebd.: 116). Anknüpfungspunkte böten im Rahmen des Steuerungsstaats und des moderierenden Staats beispielsweise netzwerkartige Arrangements zur Modellierung der Interdependenz von Staat und Gesellschaft. Dieser Interaktionsprozess wird als prinzipiell ungerichtet betrachtet. Steuerungssubjekt und -objekt können kaum unterschieden werden, da klare Autoritäten
nicht ausgemacht werden könnten - alle Teilnehmer seien gleichberechtigt (vgl. ebd.:
120). Kooperation tauche im Interventionsstaat in Form von korporatistischen Arrangements auf, es gehe hier um eine gelegentliche Einbindung relevanter Interessengruppen in Steuerungsprozesse (vgl. ebd.: 118). Im minimalen Staat äußere sich ein
Misstrauen gegenüber korporatistischen Aushandlungen, da diese ggf. zur Durchsetzung partikularer Sonderinteressen und damit zur Verminderung des Gemeinwohls
benutzt würden; stattdessen würde hier auf Verteilungskoalitionen gesetzt (vgl. ebd.:
119). Die Typen „Interventionsstaat“ und „Minimaler Staat“ entwickelten somit ein
gegensätzliches Verständnis vom kooperativen Staat.
Unabhängig davon, ob man staatliche Kooperation mit der Gesellschaft als Stärkung
oder Schwächung des Staates aufgreift, besteht doch Einigkeit über ein grundlegendes Defizit, wonach „Netzwerke zwar günstige Opportunitätsstrukturen zur politischen Abstimmung darstellen, dass damit aber eine umfassende Problemlösung
noch keineswegs garantiert ist“ (ebd.: 121). Dieser Mangel könnte durch Appelle,
Moderation, ggf. eine Rückkehr zu hierarchischer Steuerung oder ein geeignetes Interdependenzmanagement gelöst werden (vgl. ebd.: 122 ff.).
Ausgangspunkt des Konzepts des kooperativen Staates ist die Überlegung, dass
nach wie vor ein politisches Nervenzentrum existiert, welches die Entwicklung von
Programmen, Zielen und Strategien vorantreibt. Die grobe Zielsetzung wird zusätzlich durch die netzwerkartige Beteiligung gesellschaftlicher Gruppierungen ergänzt
(Regelungsstruktur). Die Umsetzung erfolgt nicht mehr ausschließlich über die Bürokratie, sondern auch über quasi- oder nicht-staatliche Organisationen (Leistungsstruktur) (vgl. ebd.: 125). Politische Steuerung vollzieht sich demnach über ein „doppelt indirektes zielorientiertes Handeln“: Politik kann zunächst in der Regelungsstruk112
tur Verfahren, Prozeduren, Teilnehmer oder grobe Zielrichtungen bestimmen, die
Grundlage eines Netzwerks sein sollen. Anschließend kann über das Netzwerk Gesellschaft im Einklang mit den politisch formulierten Zielen gesteuert werden. „Doppelt indirektes Handeln“ bezieht sich somit erstens auf die Ausgestaltung der Netzwerke und zweitens auf adäquate Verhandlungsergebnisse zur Erreichung anvisierter Zustände. In der Leistungsstruktur werden ebenfalls Anreizstrukturen geschaffen,
die eine der Politik positiv gesinnte Ausrichtung der nicht-staatlichen Organisationen
erhoffen lässt (vgl. ebd.: 125 f.). Hans-Peter Burth weist darauf hin, dass das Konzept des kooperativen Staates mit der Argumentation des Policy-Netzwerkes konvergiert. Allerdings würden sich beide Konzepte im Hinblick auf ihre jeweils spezifische
Fragestellung unterscheiden (vgl. Burth 1999: 226).
Rüdiger Voigt hat das Konzept des kooperativen Staates weiter ausdifferenziert. Die
Ursachen für dessen Bedarf seien vielfältig: „Einerseits verflüchtigt sich die Souveränität des Nationalstaates im Dickicht supra- und internationaler Verflechtungen, wenn
auch zugleich in einer Gegenbewegung der nationale Egoismus - gerade auch auf
dem Gebiet der Handels-, Wirtschafts- und Währungspolitik - zuzunehmen scheint.
Andererseits werden im Innern neben politischen Parteien und den großen Interessenverbänden zunehmend auch andere gesellschaftliche Gruppen mit Vetopositionen zu Teilhabern an der staatlichen Macht. […] Es kommt hinzu, daß Deutschland
als Bundesstaat - anders als z.B. Frankreich - keine Regierungszentrale hat, in der
alle Kompetenzen zusammenlaufen, der Bund muß vielmehr die staatlichen Kompetenzen mit den Ländern teilen. […] Die Vielzahl der Instanzen, Behörden und administrativen Akteure führt mit ihrer Pluralisierung von Ressortperspektiven und Verschärfung der Rivalitäten zu kaum lösbaren verwaltungsinternen Koordinationsproblemen“ (Voigt 1995: 33 f.). Wegen dieser Ursachen attestiert Voigt der traditionellen
etatistischen Steuerung, die geprägt sei durch Hierarchie, Routinisierung der Problemlösungen und Verrechtlichung, Ineffizienz und Ineffektivität (vgl. ebd.: 40). Im
Hinblick auf die zunehmende Komplexität moderner Gesellschaften ließen sich vier
Situationstypen unterscheiden (vgl. ebd.: 41):
1. Kodifizierung: Hier geht es um die schriftliche Fixierung von Normen auf
Grundlage ausreichenden Wissens über Wirkungszusammenhänge.
2. Konfliktregulierung: Diese bezieht sich auf die Regelung von Konflikten, für
die noch keine Ziele vorgegeben wurden.
113
3. Informationsverarbeitung: In diesem Fall sind die Ziele klar, nicht jedoch die
Wirkungsmechanismen.
4. Zielkonkretisierung und -realisierung: Die Ziele sind nur grob umrissen; in den
Blickpunkt rücken nun Zielkonkretisierung und das Verständnis von Wirkungszusammenhängen.
In jeder dieser vier Situationen sei der Staat auf kooperative Steuerung angewiesen.
Voigt macht nun verschiedene kooperative Steuerungsarrangements aus:
Pluralismus. Das Gemeinwohl wird mit dieser Koordinationsform durch einen
geregelten Wettbewerb verschiedener Interessen erzielt. Der Staat soll dabei
einen Interessenausgleich herbeiführen. Wettbewerbspartner sind neben dem
Staat die Verbände. Problematisiert würde dieses Konzept etwa durch Interessenungleichgewichte, etwa schlecht vs. gut organisierte oder mächtige vs.
machtlose Interessen, oder gar durch eine Dominanz von Partikularinteressen,
die den Staat als Selbstbedienungsladen verstünden (vgl. ebd.: 43 f.).
Korporatismus. Hier geht es um eine gegenseitige Instrumentalisierung von
Staat und Interessenverbänden zur Erreichung eigener Ziele. In der Summe
geht es um eine abgestimmte Politik: „Es handelt sich um eine Form gesellschaftlicher
Konfliktregulierung,
bei
der
-
auf
freiwilliger
Basis
-
,parlamentarische Interessenvermittlung und bürokratische Steuerung ergänzt
werden durch etablierte Verhandlungssysteme aus Staat und Verbänden sowie (durch) Elemente der Kollegial- und Selbstverwaltung‘“ (ebd.: 45). Partner
des Staates seien erstens die Verbände. Diese zeichneten sich durch Spezialisierung, Standardisierung von Regeln und Arbeitsweisen, Formalisierung,
Zentralisation von Entscheidungswegen und eine gewisse Organisationsstruktur aus. Partner seien zweitens auch Kammern, etwa die Ärzte- oder Handelskammern. Auch dieser Steuerungsvariante wird eine Neigung zu Interessenungleichgewichten und zu kurzfristigen Lösungen vorgeworfen (vgl. ebd.: 46
f.).
Parteien als Teilhaber staatlicher Macht. Über Parteien würden Verbindungen
zu anderen politischen Ebenen hergestellt, da sie ein Monopol auf Politik hätten und quasi unersetzlich seien. Gefördert würde dieser Umstand hauptsächlich durch ihre verfassungsrechtliche Absicherung. Kritik erfährt dieser Umstand z.B. in Bezug auf die scheinbar zementierte Machtverteilung der etab114
lierten Parteien und eine gewisse Ohnmacht der Wähler; gesellschaftliche
Selbststeuerung würde dadurch geradewegs verunmöglicht (vgl. ebd.: 49 ff.).
Kooperative Interaktionssysteme im Bundesstaat. Damit sind dauerhafte Kooperationen zwischen Bund und Ländern gemeint. Diese basierten meist auf
Einstimmigkeit und minimalen Lösungen, wodurch dauerhafte Kompetenzverschränkungen entstünden. Beispielhaft hierfür stehe die regionale Wirtschaftsförderung, die kaum noch von nur einer Ebene durchgeführt werden könne.
Für diesen Umstand, wonach gewisse Aufgaben nur noch durch eine verstetigte Kooperation zwischen den politischen Ebenen erfüllt werden könnten,
fand laut Voigt der Begriff „Politikverflechtung“ Eingang in die Politikwissenschaft. Sichtbar würde dies in vertikalen und horizontalen Beziehungsgeflech-
ten, so z.B. in Planungs- und Finanzierungsangelegenheiten (vgl. ebd. 52 f.).
Kooperation in der Grauzone zwischen Bund und Ländern. Vergleichbare
Kooperationsformen existierten zwischen den Ländern, allerdings seien diese
nicht rechtlich fixiert und bewegten sich von daher in einer Grauzone. Ursache
hierfür sei, dass der Bundesrat zur Mitwirkung der Länder an der Bundespolitik, nicht jedoch zur gemeinsamen Koordinierung ihrer Politiken entwickelt
worden sei. Beispiele hierfür seien die Konferenzen zwischen Ministern, etwa
die Kultusministerkonferenz, oder Landtagspräsidenten. (vgl. ebd.: 55 f.).
Policy-Netzwerke. Hierbei handelt es sich um verstetigte korporative Arrangements: „Einigt sich eine begrenzte Zahl korporativer Akteure in einem Politikfeld auf ein bestimmtes Muster organisatorischer Identitäten, Kompetenzen
und Interessensphären, dann kann es zur Etablierung netzwerkartiger institutioneller Arrangements kommen“ (ebd.: 57). Voraussetzung sei die Existenz
korporativer Akteure, „die strategische Entscheidungen fällen, mit anderen
korporativen Akteuren verhandeln und Kompromisse schließen können“
(ebd.). Diese Akteure können privater oder staatlicher Natur sein. Handlungslogik ist hier der politische, gelegentlich indirekte Tausch, z.B. in Form von
Aufgabe von Widerstand oder Unterstützungsangeboten.
All diese Varianten basieren auf Verhandlung. Dass es aber ganz unterschiedliche
Formen von Verhandlung geben kann, darauf weist etwa Jörg Klawitter hin. Kompetitiv zu verhandeln meint demnach, seinem Gegenüber zwar einen Gewinn zuzugestehen, sich selbst möchte man jedoch einen noch größeren Gewinn erheischen.
115
Kooperativ verhandeln bedeutet, einen möglichst hohen Gewinn für beide Seiten erzielen zu wollen. Altruistische Verhandlungen dürften wohl eher selten vorkommen,
da sie auf die Gewinnmaximierung des Gegenübers zielen, ohne auf eigene Verluste
zu achten. Verhandelt man hingegen egalitär, sollen Gewinnunterschiede möglichst
niedrig ausfallen. Anders hingegen punitive Verhandlungsstrategien, wo es darum
geht, dem Verhandlungspartner einen Verlust beizufügen. Nicht zuletzt können Staaten gemäß Klawitter eine Selbstvernichtungsstrategie verfolgen, um ehemalige und
leidgewordene Partner mit in den Abgrund zu ziehen (vgl. Klawitter 2001: 201 f.).
Gunnar Folke Schuppert hat eine ähnliche Typologie von Staatskonzepten vorgelegt,
die sich mit dem kooperativen Staat befasst. Diese konzipiert er jedoch prozessual,
d.h. er möchte Staatstypen aus verschiedenen Zeiten betrachten. Insgesamt nennt
Schuppert fünf verschiedene Typen: Erstens den demokratischen Rechts- und Interventionsstaat (DRIS), der mit Beginn der Industrialisierung mit Hilfe des öffentlichen
Rechts Regelungsbedarf erfüllte. Zweitens den Wohlfahrtsstaat, dessen Aufgabe in
der Abmilderung kapitalistischer Folgeprobleme in der Gesellschaft durch Umverteilung bestand. Drittens den kooperativen Staat, der zunehmend auf Verhandlungen
und Übereinkommen setzte. Viertens den Präventionsstaat, dessen Aufgaben v.a.
die Sicherheitsvorsorge oder Gefahrenabwehr betrafen. Fünftens und letztens den
Gewährleistungsstaat, der Public-Private-Partnerships nutzt und im Rahmen der
Gewährleistungsverwaltung die gesellschaftliche Daseinsvorsorge und Selbstregelungsmöglichkeiten sichert (vgl. Schuppert 2010: 140 ff.).
Ganz neu ist die Idee des kooperativen Staates nicht: Schon 1979 meinte ErnstHasso Ritter kooperative Arrangements in der Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft ausgemacht zu haben: „Die instrumentelle Verwendung von Informationen,
der Einsatz öffentlicher Überredungsstrategien und der Gebrauch indirekt wirkender
Lenkungsmittel kennzeichnen jedoch eine Entwicklung, die sich immer weiter von
den traditionellen Formen hoheitlichen Handelns entfernt. […] Diese Entwicklung ist
in einem auf Zusammenarbeit gerichteten Verhältnis von Staat und Wirtschaft folgerichtig. […] Der Staat steigt vom hoheitlich-hoheitsvollen Podest des einseitig Anweisenden herab, er tritt auf die Ebene des Austausches von Informationen und Leistungen und der Verbindung zu abgestimmten Handeln“ (Ritter 1979: 393).
Möglichkeiten für Kooperation sieht Ritter v.a. zwischen dem Staat und Unternehmen. Beispielsweise über Verträge könnte ein Leistungsaustausch oder eine Vereinigung von Leistungen zur gemeinsamen Zielerreichung vereinbart werden (vgl.
116
ebd.: 395). In den Untersuchungsfokus rücken dann solche Fragen wie die nach der
Legitimation solcher Kooperationen oder dem Ausmaß an Gemeinwohlorientierung
seitens der beteiligten Unternehmen (vgl. ebd.: 407). Die Gesellschaft des kooperativen Staates soll „sich ihrer Idee nach vom egoistisch-utilitaristischen Konkurrenzprinzip lösen und zu einer auf das gemeine Wohl verpflichtenden Zusammenarbeit finden“; der kooperative Staat „ist ein Staat, der sich mit den Gruppen in Zusammenarbeit verbindet, der Großunternehmen, Oligopolen und organisierten Gruppen Zugang
zu seinen Entscheidungsvorgängen gewährt und der demgemäß die Gruppenmeinungen und Gruppeninteressen als bewegende Kraft der Gemeinwohlprozesse in
der pluralistischen Demokratie anerkennt […], der sich der Träger sozialer und ökonomischer Macht zur Umsetzung seiner Ziele bedient und der öffentlichen Aufgaben
zur kooperativen Erledigung mit eben diesen Machtträgern ,vergesellschaftet‘“ (ebd.:
408 f.).
Ferner erscheint ein auf Verhandlung setzender Staat im Gegensatz zu klassischen
Staatsverständnissen geschwächt. Pöllmann formuliert diese Kritik in Form eines
Fazits deutlich positiver: „Der kooperative Staat agiert zwar deutlich hoheitsreduziert,
doch wird deutlich, dass er durch die Einbeziehung gesellschaftlicher Interessen in
seine verschiedenen Verhandlungsarenen eine erhöhte Sensibilität für die Komplexität politischen Handelns in einer zunehmend durch Verunsicherung geprägten postmodernen Gesellschaft aufbringt. Seinen Steuerungsanspruch kann er dabei allerdings nicht […] direkt gegen den Willen seiner Steuerungsadressaten durchsetzen.
Er hat sich mit Ergebnissen zufrieden zu geben, die im Konsens mit den beteiligten
Akteuren gefunden werden“ (Pöllmann 2006:96).
Insgesamt darf jedoch nicht übersehen werden, dass Typologien keinen Erklärungsgehalt aufweisen. So darf in diesem Rahmen entgegen der Terminologie der Autoren
auch nicht von Staatstheorie gesprochen werden. In der Regel finden sich wie gezeigt unter dieser Überschrift lediglich Typen oder gar begriffliche Versatzstücke, ohne eine Theorie oder ein Modell, sondern allenfalls ein Konzept oder ein Ansatz zu
bilden. Dies zeigt sich auch bei Schupperts jüngerem Werk, in welchem er lediglich
auf
bestimmte
Schlüsselbegriffe
wie
„Europäisierung“,
„Pluralisierung“
und
„Ökonomisierung von Staat und Verwaltung“ eingeht (vgl. Schuppert 2010: 146 ff.).
Das entspricht zugegebenermaßen seiner Intention, lediglich „einige kleine Bausteine zu einer zu entwickelnden Theorie des Wandels von Staatlichkeit beizusteuern“
117
(ebd.: 11). Ob diese Bausteine die Politikwissenschaft und allen voran die Staatstheorie voranbringen, ist jedoch fraglich.
3.1.4 „Aktivierender Staat“
Als jüngstes verwaltungspolitisches Leitbild gilt der „aktivierende Staat“ mit folgender
zentraler Überlegung: „Nicht allein der Staat ist für die Lösung gesellschaftlicher
Probleme zuständig, sondern diese sollen, wo immer möglich, an die Zivil- oder Bürgergesellschaft zurückgegeben werden“ (Jann 2002: 291). Die Neuausrichtung der
Verwaltungspolitik soll dabei mit Hilfe von Governance-Konzepten geschehen, die ihr
Augenmerk „zum einem (wieder) auf die institutionellen Grundlagen von Organisationen, insbes. Regierung und Verwaltung (formale und informelle Regeln und Werte),
zum anderen auf deren Umweltbeziehungen, also auf die Verbindungslinien zu Bürger- und Zivilgesellschaft, zu Unternehmen und Marktwirtschaft, zu Politik und Demokratie,“ richten (ebd.).
Damit einher geht eine Abkehr vom Leitbild des Verwaltungsmanagements bzw. der
Verwaltung als Unternehmen. Probleme politischer Steuerung werden nun auch dem
Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft und nicht mehr nur dem politischen System allein zugewiesen (vgl. ebd.: 293). Dabei werden Erfolgsrezepte des New Public
Management durchaus übernommen: „Die neuen Ziele lauten also - neben Effizienz
und Dienstleistungsorientierung, die durchaus weiter gelten sollen - Stärkung von
sozialer, politischer und administrativer Kohäsion, von politischer und gesellschaftlicher Beteiligung, von bürgerschaftlichem und politischem Engagement“ (ebd.: 294).
Zentral sei damit, „gesellschaftliche Akteure in die Problembewältigung einzubinden,
sie zu motivieren und aktivieren, um sie nicht länger von oben herab, top down, zu
steuern oder zu versorgen“ (Jann 2005: 33). Die Hauptforschungsfrage lautet dann:
„Wie könnten und sollten institutionelle Arrangements ausgestaltet sein, die zivilgesellschaftliches Engagement, gesellschaftliche Selbstregelung und Selbstorganisation stärken und anregen und nicht verhindern und dämpfen?“ (ebd.) - es handelt sich
somit um eine normative Fragestellung.
Wolfram Lamping et. al. erkennen vier Leitlinien, die den Ansatz des aktivierenden
Staates und damit die Beziehungen zwischen dem Staat und der Gesellschaft charakterisieren: „Dialog statt Dekret […]; zielklare Kooperation statt gegenseitiger
Schuldzuweisung und Domänedenken; Produkt- und Prozessoptimierung, z. B.
Purchaser-provider-split, One stop shop, dezentrale Fach- und Ressourcenverant118
wortung, Quasi-Märkte, Leistungsvergleiche etc.; Ko-Produktion – Zusammenwirken
von öffentlichen Leistungserbringern und aktiven und selbstverantwortlichen Bürgern/Klienten“ (Lamping et. al. 2002: 34).
3.1.5 Joachim Hirschs politökonomischer Ansatz
Unzerstörbar scheinen darüber hinaus politökonomische Ansätze mit dem Schwerpunkt „Staatstheorie“ zu sein. Obwohl diese Ansätze in der Politikwissenschaft allenfalls in ideengeschichtlichen Büchern diskutiert werden, hat Joachim Hirsch 2005 ein
Buch aufgelegt, das sich aus dieser Perspektive heraus mit modernen Staaten beschäftigt. Materialistische Staatstheorien würden sich „auf je spezifische Weise auf
den von Marx entwickelten historischen Materialismus und dessen Kritik der politischen Ökonomie beziehen. […] In ihrem Zentrum steht das Bemühen, den im Alltagsverständnis und in der etablierten Wissenschaft verwendeten Begriff ,Staat‘ als
Ausdruck von gesellschaftlichen Strukturen zu entschlüsseln, die durch besondere
Formen von Ausbeutung und Unterdrückung gekennzeichnet sind und damit einen
widersprüchlichen Charakter tragen“ (Hirsch 2005: 15). Und weiter: „Der Staat wird
also nicht einfach als gegebener Organisations- und Funktionszusammenhang, sondern als Ausdruck eines antagonistischen und widersprüchlichen Vergesellschaftungsverhältnisses begriffen“ (ebd.: 16).
Am Ende seiner Untersuchungen kommt Hirschzu einem ähnlichen Ergebnis wie die
Vertreter des kooperativen Staates, wonach Kooperation i.w.S. als Steuerungsvariante zu präferieren sei. Allerdings macht er andere Ursachen für diese Lösung aus:
„Als nach wie vor wichtiger Vermittler sozialer Beziehungen und Klassenverhältnissen sowie als Träger der militärischen Gewaltpotentiale wird die gesellschaftliche
Entwicklung immer noch entscheidend von den in Staaten und institutionalisierten
Machtverhältnissen bestimmt. Den Staat als Auslaufmodell oder als eine Art passive
Transmissionsinstanz ökonomischer Prozesse aufzufassen, trägt die Gefahr in sich,
den kapitalistischen Macht-, Herrschafts- und Gewaltzusammenhang zu übersehen.
Staaten reproduzieren die Dynamik des kapitalistischen Akkumulationsprozesses
und die Klassenbeziehungen nicht nur, sondern prägen diese auf Grund der in ihnen
institutionalisierten Kräfteverhältnisse und der damit verbundenen politischen Dynamiken wesentlich“ (ebd.: 197).
Die von Hirsch formulierten Konsequenzen der Globalisierung sind im übrigen nicht
besonders innovativ, wie z.B. eine zunehmende Privatisierung staatlicher Aufgaben,
119
eine Ausdifferenzierung des staatlichen Gewaltmonopols auf verschiedenen Ebenen
und eine damit einhergehende Verunmöglichung konsistenter Politik, eine zunehmende Abkopplung des internationalen Kapitals von nationalen Volksökonomien und
eine Erschwerung wohlfahrtsstaatlicher Kompromisse auf nationaler und internationaler Ebene (vgl. ebd.: 198 ff.). Damit würde das Ende des liberaldemokratischen
Zeitalters eingeläutet; der Staat und die Zivilgesellschaft würden ökonomisiert.
Wie der Staat sein Steuerungspotential erhalten bzw. anpassen könne, sei laut
Hirsch nicht Bestandteil von Wissenschaft: „Es ist nicht Aufgabe von kritischer Wissenschaft, konkrete gesellschaftliche und politische Alternativen zu entwerfen. Diese
entstünden vielmehr aus sozialen Bewegungen und Kämpfen und den damit verbundenen Erkenntnis- und Lernprozessen. Wissenschaftliche Analyse kann jedoch dazu
beitragen, historische Erfahrungen zu vergegenwärtigen, die existierenden Verhältnisse zu verstehen und Möglichkeiten zu skizzieren“ (ebd.: 215). Und weiter: „Es gibt
keine Pläne dafür, wie eine andere Gesellschaft auszusehen hätte. Veränderte Formen von Gesellschaft und Politik müssen in Kämpfen durchgesetzt werden, deren
Ausgang und Ergebnis offen ist“ (ebd.: 233). Dass Hirsch offensichtlich das Verschwinden der materialistischen Theorie nicht verwunden hat, beweist folgendes Zitat, mit dem er sich auf die Ignoranz des politikwissenschaftlichen Establishments in
Bezug auf das politökonomische Theoriengebäude bezieht, wonach sich „ihre Überlegungen für eine Wissenschaft eher störend erweisen, die sich in ihrem Mainstream
auf konstruktive Politikberatung und die Legitimation der bestehenden Verhältnisse
konzentriert“ (ebd.: 14) - kein Wort von fachlicher Kritik an diesem Theoriestrang.
3.1.6 Kritik
Hans-Peter Burth kritisiert an den Autoren der staatstheoretischen Ansätze deren
Neigung, die empirische mit der normativen Argumentationsebene häufig zu verwechseln. In diesen Ansätzen würde „politische Steuerung mit ,staatlicher Steuerung‘
interpretiert und das politikwissenschaftliche Forschungsinteresse an den empirischen Bedingungen soziopolitischer Steuerung sozusagen ,automatisch‘ mit dem
normativen Interesse des Staates an gemeinwohlorientierter Politik parallel geführt“
(Burth 1999: 224). Burth verlangt stattdessen eine strikte Trennung dieser Ebenen:
„Die Optimierung staatlicher Steuerungsfähigkeit ist sicherlich ein zentrales Ziel politikwissenschaftlicher Steuerungstheorie, dies sollte jedoch nicht dazu führen, daß
120
Steuerungsfähigkeit und Steuerbarkeit, wider besseres empirisches Wissen, aus
normativen Gründen postuliert werden“ (ebd.).
Martin Jänicke hingegen fordert von den Staatstheoretikern einen deutlicheren Bezug auf empirische Ergebnisse, die es zu verallgemeinern gelte, da sie Wandlungsprozesse besser als die reine Theorie wahrnähmen. Stattdessen „herrscht ein verbreitetes top-down-sizing vor […] mit einer übergroßen Neigung zur ideengeschichtlichen Betrachtung“ (Jänicke 2005: 956). Möglicherweise mag sowohl die Verwechselung von empirischer und normativer Argumentationsgrundlage als auch der Verzicht
auf empirische Untersuchungen mit dem Umstand zusammenhängen, dass staatstheoretische Ansätze aus den unterschiedlichsten Disziplinen stammen, denn „eine
in sich geschlossene, widerspruchsfreie moderne Staatstheorie ist noch nicht erarbeitet worden“ (Klawitter 1992: 193); daran hat sich auch im Folgejahrzehnt nichts
geändert (vgl. Voigt 2001: 143).
Daneben übersehen die Autoren, die für den kooperativen Staat oder eine sich selbst
steuernde Gesellschaft votieren, dass allenthalben hierarchisch gesteuert wird. Dies
gelte v.a. für Notfallmaßnahmen oder besonders große gesellschaftliche Risiken. So
ließe sich z.B. das Verkaufsverbot gesundheitsschädigender Lebensmittel nur hierarchisch durchsetzen (vgl. Nahamowitz 1995: 125). In diesem Rahmen weist Nahamowitz zusätzlich daraufhin, dass der Doyen der Verwaltungsrechtslehre, Ernst
Forsthoff, schon um 1950 über kooperatives Staatshandeln schrieb. Darüber hinaus
würden die Autoren des kooperativen Staats nie das Scheitern dieser Steuerungsform aufzeigen, wie z.B. das unrühmliche Ende der konzertierten Aktion oder das
Scheitern einer Verpackungsverordnung (vgl. ebd.: 127). Schließlich darf nicht übersehen werden, dass kooperative Steuerung nicht nur Vorteile mit sich bringt: „Die
Kontrollierbarkeit und Steuerbarkeit solcher vernetzten Systeme wird schwieriger,
gleichzeitig steigen aber auch die Zweifel an der Führungs- resp. Steuerungsfähigkeit
dieser vernetzten Systeme“ (Fürst 1987: 266).
Dass der Staat nach wie vor existiert bzw. immer noch gebraucht wird, meint auch
Gunnar Folke Schuppert. Er meint, der moderne Staat entspreche nicht mehr dem
westfälischen Modell, sondern sei eher ein Mitgliedsstaat und nicht mehr der klassische demokratische Rechts- und Interventionsstaat: „Die Zerfaserung von Staatlichkeit bedeutet also nicht das Ende des Staates. Sie bedeutet aber, daß die Organisation von Staatlichkeit komplexer und womöglich prekärer geworden ist, als sie es im
121
goldenen Zeitalter des DRIS war“ (Genschel/ Leibfried/ Zangl 2006, zit. nach Schuppert 2010: 10).
Gewisse Ähnlichkeiten weist der Governance-Ansatz mit der Idee des kooperativen
Staates auf. In diesem Sinne tendiert die moderne Staatstheorie vermehrt in die
Bahnen der Governance-Ansätze: „Da ein Staat ohne die Fähigkeit zur Steuerung
seine Existenzberechtigung aufs Spiel setzt, sollte die Staatswissenschaft den Governance-Ansatz aufgreifen und weiterentwickeln“ (Voigt 2010: 1). Denn obwohl verschiedene Theorien, Konzepte und Ansätze in den vergangenen Jahrzehnten die
Steuerungsfähigkeit des Staates bestritten, meint Voigt nach wie vor einen enormen
Bedarf an Steuerung in der Gesellschaft ausmachen zu können. Diese Steuerungsleistung könne zudem nur der Staat erbringen (vgl. ebd.: 11). Leider verzichtet Voigt
in diesem Rahmen darauf, eine mögliche Perspektive der Verknüpfung von Staatstheorie und Governance-Ansatz zu skizzieren.
Ebenfalls Anschluss an eine andere Teildisziplin der Politikwissenschaft, genauer die
Politikfeldanalyse, möchten Everhard Holtmann und Sebastian Putz suchen (vgl.
Holtmann/ Putz 2004: 10 f.). Analog dazu wurde überprüft, inwieweit die klassischen
Ansätze der Policy-Analysis sich auf die als Staat verstandene EU anwenden lassen
und ob die Konzeptualisierung eines integrierten steuerungstheoretischen Gesamtmodells möglich ist (vgl. Sturm 2004: 117 ff.).
Solch einen einheitlichen staatstheoretischen Analyserahmen (hier für den Nationalstaat) haben z.B. Achim Hurrelmann, Stephan Leibfried, Kerstin Martens und Peter
Mayer entwickelt. Die Autoren haben vier Dimensionen ausgemacht, mit welchen
Staaten sowohl in ihrer historischen Entwicklung als auch in ihrer aktuellen Tätigkeit
bewertet werden können. Diese Dimensionen seien ihrer Ansicht gemäß auch außerhalb der Wissenschaft als Wertmaßstäbe für einen Staat verbreitet. Im Einzelnen
handelt es sich dabei um Frieden und physische Sicherheit (Territorialstaat), Freiheit
und Rechtsstaatlichkeit (Verfassungsstaat), demokratische Selbstbestimmung (demokratischer Nationalstaat), wirtschaftliches Wachstum und soziale Wohlfahrt (Interventionsstaat) (vgl. Hurrelmann et. al. 2008: 25). Tatsächlich seien alle vier Staatsbereiche durch moderne Entwicklungen wie wirtschaftliche, ökologische oder technische Globalisierungstendenzen bedroht. In ihrem Sammelband gehen die Autoren
nun der Frage nach, ob der klassische Nationalstaat vor verkraftbaren Veränderungen oder gar einer „Zerfaserung“ steht. Dazu stellen sie für die folgenden Untersuchungen einen analytischen Rahmen bereit. Dabei wird der Schwerpunkt jedoch auf
122
die Untersuchung von Aufgabenverlagerungen gelegt. Nur marginal wird die Frage
danach gestellt, inwieweit Staaten noch steuern können (vgl. ebd.: 303 ff.).
Die Staatstheorie sollte in den kommenden Jahren weiter beobachtet werden. Spätestens mit dem Aufflammen der Wirtschafts- und Finanzkrise wurde in der Öffentlichkeit eine Rückkehr des Staates diskutiert. Es bleibt abzuwarten, wie Politikwissenschaft auf diese Auseinandersetzung reagieren wird. So schreibt etwa Rolf G.
Heinze: „Das Pendel schwingt zurück: Von der Marktdominanz zur Renaissance des
Staates“ (Heinze 2009: 11) und stellt die prophetische Frage: „Wird das Jahr 2009
nun ein Wendejahr hinsichtlich steuerungspolitischer Paradigmen, wird die Marktdominanz zugunsten einer Renaissance des Staates abgelöst?“ (ebd.: 33). In diesem
Sinne habe „der Verlust der ökonomischen Deutungshoheit in zentralen gesellschaftlichen Steuerungsfragen […] aber Raum geschaffen für sozialwissenschaftliche Analysen, die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht in dem engen Korsett einer auf Nutzenmaximierung beruhenden Kapitallogik beschreiben, sondern auf die Wechselwirkungen zwischen der Ökonomie, sozialen und politischen Strukturen eingehen“ (ebd.:
13) - der Steuerungspessimismus scheint damit überwunden.
In der Summe handelt es sich bei den Staatstheorien eher um Konzepte und Ansätze; von Steuerungsmodellen oder -theorien kann keine Rede sein. Diese versuchen
in der empirischen „Wirklichkeit“ vorkommende Staatstypen zu beschreiben, sodass
von einer gesicherten empirischen Adäquatheit gesprochen werden kann. Allerdings
taugen diese Konzepte nur bedingt für empirische Forschungsarbeiten. Im Hinblick
auf logische Konsistenz konnten diesen Konzepten und Ansätzen keine Brüche attestiert werden. Deren theoretisches Innovationspotential scheint vermehrt zu versiegen, da zum einen das Konzept des kooperierenden Staates große Ähnlichkeit mit
Konzepten aus dem Governance-Spektrum aufweist und zum anderen dem kooperativen Staat keine herausragenden Neuentwicklungen gefolgt sind. Zeitgleich mutet
die steuerungstheoretische Effektivität dieser Ansätze einigermaßen plausibel an.
Defizite ergeben sich v.a. aufgrund einer ausbleibenden steuerungstheoretischen
Modellierung; kausale Wirkmechanismen werden keine vorgestellt.
3.2 Gesellschaftstheorien
Gesellschaftstheorien rücken nun Möglichkeiten, Effekte und Grenzen von Steuerung
in der Gesellschaft in den Mittelpunkt. Zeitgemäße Varianten haben den Baukasten
und das Vokabular der Systemtheorie übernommen und modellieren dementspre123
chend ihren Gegenstand, diese Theorien „sind heute durchweg systemtheoretisch
inspiriert und zumeist als Teil- bzw. Bereichstheorien konzipiert“ (Schultze 2003b:
494).
In der Literatur lassen sich mehrere gesellschaftstheoretische Konzeptionen finden.
Ein etwas älteres Konzept stammt von Wilfried Gotsch. Er befasst sich umfassender
mit sozialer und damit nicht nur politischer Steuerung. Nach Gotsch handelt es sich
immer dann um soziale Steuerung, „wenn Akteure in einer Weise miteinander integriert werden, daß Handlungs- und Wirkungsketten entstehen, die eine aktive Gestaltung von Adressatensystemen ermöglichen“ (Gotsch 1987: 27). Allerdings reduziert
Gotsch sein Konzept auf korporative Akteure (also eine Art „Mesoebene“), wodurch
die Makroebene und individuelle Akteure unberücksichtigt bleiben.
Im Folgenden soll nun aus drei Gründen die soziale Steuerungstheorie Uwe
Schimanks vorgestellt werden: Erstens handelt es sich dabei um eine sehr komplexe
und damit fortentwickelte Gesellschaftstheorie. Zweitens kann dargestellt werden,
wie Schimank sein Denkgebäude im Laufe der Jahre fortentwickelt hat. Und drittens
kann gezeigt werden, warum sich Gesellschaftstheorie als Steuerungstheorie für politikwissenschaftliche Steuerungsdebatten nur wenig eignet.
3.2.1 Uwe Schimanks sozial- und steuerungstheoretische Konzeption
Uwe Schimank hat eine soziale Steuerungstheorie entwickelt, die sich der problematisierten Auseinandersetzung zwischen systemischen und am Akteur orientierten
Konzepten annahm. Nach Ansicht Schimanks sollte dieser Dualismus überwunden
werden, denn es sei deutlich, „daß System- und Akteurtheorien zueinander in einem
wechselseitigen Schrittmacherverhältnis stehen“ (Schimank 1988: 620) oder etwas
präziser formuliert: „Handeln ist also keineswegs nur Ergebnis struktureller Determination, sondern immer zugleich Produktion und Reproduktion von Struktur, strukturiert und strukturierend in einem“ (Schimank 2005: 104). Aus diesem Grund gelte es,
„akteurtheoretische Erklärungen gesellschaftlichen Handelns durch Einbau des systemtheoretischen Konzepts des gesellschaftlichen Teilsystems zu verbessern“
(Schimank 1988: 620). Schimanks Theorie wählt somit einen umfassenden Realitätsausschnitt und nicht nur einen bestimmten Bereich der Gesellschaft. Der Modellzweck liegt in der Konzeption einer Sozialtheorie, die die beiden genannten Ebenen
verknüpft und sich damit auf viele gesellschaftliche Problemfelder anwenden lässt.
Neben Steuerungsprozessen geht es Schimank auch um die Beschreibung und Er124
klärung von Differenzierungsprozessen, die nicht durch Systeme, sondern durch Akteurshandeln verursacht werden - klassischer Systemtheorie attestiert er ein erhebliches Defizit an sozialintegrativer Perspektive (vgl. Schimank 2005: 102).
3.2.2 Schimanks Sozialtheorie
Akteurskonzepte basierten laut Schimank auf der Leitdifferenz Akteur/ Akteurskonstellation. Die Konstruktion von Akteuren müsse laut Schimank drei Merkmale aufweisen: Erstens besäßen sie gewisse positiv oder negativ konnotierte Ziele und Interessen. Zweitens würden diese Akteure über Potentiale zur Veränderung von Situationen wie etwa Geld, Zeit oder Wissen verfügen. Drittens würden sie entlang bestimmter individueller Strategien, z.B. absolute Maximierung des eigenen Nutzens
oder Relative Minimierung der eigenen Verluste, handeln (vgl. Schimank 1988: 620).
Alternativ zu dieser Heuristik läge laut Schimank zur Erklärung von Handlungsantrieben in der Soziologie eine ganze Reihe von Akteursmodellen vor, von denen die
prominentesten wohl der Homo Sociologicus und der Homo Oeconomicus seien (vgl.
Schimank 2005: 30).
Akteurskonstellationen entstünden, sobald sich die Ziele, Interessen oder Potentiale mindestens zweier Akteure begegneten, etwa in Form gegenseitiger Inkompatibilität, Konkurrenz oder Win-Win-Situationen (vgl. Schimank 1988: 620). Unterschieden
werden drei mögliche Akteurskonstellationen: Erstens Beobachtungskonstellationen,
welche sich auf solches Handeln bezieht, dass sich durch die Beobachtung von anderen beeinflussen lässt, z.B. die weit verbreitete Anpassung an Modetrends. Zweitens Beeinflussungskonstellationen, welche einer Beobachtung durch einen anderen
gewissermaßen Nachdruck verleiht, etwa durch Loben oder Androhung von Strafen.
Drittens Verhandlungskonstellationen, die die ersten beiden Konstellationen um
Handlungsabstimmungen und die Möglichkeit verbindlicher Vereinbarungen ergänzen (vgl. Schimank 2005: 32 f.).
Akteurskonstellationen zeichnen sich ferner durch zwei Dimensionen aus, das „Wollen“ und das „Können“. Zum Wollen zählen u.a. Interessen und reflexive Interessen,
etwa der Drang nach Ausweitung der eigenen Macht oder das Verlangen nach einem
breiteren Ressourcengrundstock bzw. mehr Kontrollmöglichkeiten. Das Können bezieht sich hingegen auf den institutionellen Kontext, verschiedene Ressourcen der
wechselseitigen Beeinflussung, den situationsbezogenen Wissensstand und in der
Summe den Opportunitätskontext mit seinen jeweiligen Handlungsmöglichkeiten.
125
Schimank weist in diesem Rahmen darauf hin, dass Akteure in Konstellationen nur
selten durch ihr Handeln eine anvisierte Strukturdynamik exakt erreichen (vgl. ebd.:
153 ff.).
Im Fokus von Akteurstheorien stehe laut Schimank das Problem der Interdependenzoder Kontingenzbewältigung und Fragen nach daraus resultierenden Folgen, Handlungsverkettungen oder Sozialstrukturen, denn wie gesagt erzeuge Akteurshandeln
eine Sozialstruktur wie umgekehrt die Sozialstruktur das Verhalten der Akteure präge
(vgl. Schimank 1988: 621). Allerdings würde nur selten erklärt, wie denn Akteursinteressen zustande kämen; eine Theorie o. Ä. existiere bislang nicht. So unterstelle man
Interessen und Ziele in der Regel nach Plausibilitätskriterien oder glaube etwa Dokumenten oder ähnlichen empirisch erfassbaren Quellen - das Zustandekommen sei
damit jedoch nicht erklärt (vgl. ebd.:622). Während z.B. Rational-Choice-Theoretiker
auf die Wahlmöglichkeiten eines Individuums in jeder kontingenten Situation hinweisen, möchte Schimank stattdessen die situationsübergreifenden, generalisierten
Handlungsorientierungen in den Vordergrund einer solchen Erklärung gerückt sehen,
da sie bislang eher vernachlässigt worden seien und in den Augen Schimanks jede
Handlungswahl vorstrukturieren würden. Es handelt sich dabei um „normative, kognitive und evaluative constraints“ (ebd.: 623).
Schimank bedient sich zu diesem Zweck der Systemtheorie. Systeme bilden sich
nach einer Leitdifferenz System/ Umwelt aus; innerhalb des Systems wird dadurch
Komplexität eingeschränkt und damit auch Handlungsmöglichkeiten. Schimank formuliert das etwas pointiert: „Wenn ich mich beispielsweise im Wirtschaftssystem etwa in einem Kaufhaus - bewege, weiß ich, daß von mir als Kunden eine Kaufofferte
erwartet wird und keine sportliche Höchstleistung, keine Predigt und keine Verführung einer Verkäuferin. Umgekehrt erwarte ich von der Verkäuferin, daß sie auf meine Kaufofferte eingeht und mir keine politischen Ratschläge erteilt oder mich medizinisch untersucht“ (ebd.: 626). Und etwas ernster: „Daß Sozialsysteme Sinnsysteme
sind, bedeutet somit, daß sie sinnhafte Verweisungshorizonte von Handeln eingrenzen“ (ebd.). Mit der Einführung von Handlungsmöglichkeiten und damit von Zwecken
wendet er sich deutlich etwa von Luhmanns systemtheoretischer Variante ab (vgl.
Lange 2001: 119).
Schimank unterscheidet nun drei Typen generalisierter Handlungsorientierungen:
Erstens stecken kognitive Orientierungen gesellschaftliche Sinnhorizonte wie z.B.
Wahrnehmungsmuster oder Deutungsschemata ab. Zweitens besagen normative
126
Orientierungen, was gesellschaftlich gewünscht ist bzw. sein soll, etwa in Form von
Normen oder Rollenerwartungen. Drittens grenzen evaluative Orientierungen als
Bewertungen von Handlungseffekten Sinnhorizonte in Bezug auf das Wollen der Akteure ab, etwa durch generalisierte Motive, Zwecke oder Rationalitätsprinzipien (vgl.
Schimank 1988: 627).
Damit kommt Schimanks Postulat von der Zusammengehörigkeit von Akteur- und
Systemtheorien ins Spiel, denn wenn Systeme Kontingenz beschränken, dann stelle
sich doch immer die Frage, für wen dies geschehe: „Gesellschaftliche Teilsysteme
sind als handlungsprägende Sozialsysteme somit Konstitutionsbedingungen der
Handlungsfähigkeit gesellschaftlicher Akteure“ (ebd.: 630). Akzeptiert man dies, könne man die Entstehung sozialer Subsysteme auf die Relation zwischen gesellschaftlichen Akteuren und sozialen Situationen zurückführen. Schimanks zentrale These
lautet von daher: „Die gesellschaftlichen Teilsysteme als sinnhafte Zusammenhänge
evaluativer, normativer und kognitiver Orientierungen sind vielmehr […] Fiktionen
konkreter sozialer Situationen und fungieren damit als kontingenzbestimmende selffulfilling-prophecies“ (ebd. f.). Soziale Situationen fallen in sachlicher, sozialer und
zeitlicher Hinsicht in diesem Sinne „äußerst konkret“ aus. Würden diese Kriterien
auch für Sozialsysteme gelten, dann wäre die Komplexität schier unendlich. Zur Begrenzung derselben postuliert Schimank die drei genannten Orientierungen, die damit zu einer „extrem simplifizierende[n] Abstraktion“ der Kontingenzen einer jeden
Situation beitragen (ebd.: 633).
Schimanks ursprüngliches Gesellschaftsmodell sieht damit wie folgt aus: „Als sinnhafte Zusammenhänge generalisierter evaluativer, normativer und kognitiver Orientierungen sind gesellschaftliche Teilsysteme simplifizierende Abstraktionen der Kontingenz konkreter sozialer Situationen. Diese simplifizierenden Abstraktionen werden
von den gesellschaftlichen Akteuren als kontingenzbestimmende Funktion genutzt,
wobei die Kontingenzbestimmung nicht erst in der distanzierten Beobachtung, sondern projektiv bereits in der Situationsgestaltung selbst stattfindet. Die Antizipation
der Fiktion des jeweiligen gesellschaftlichen Teilsystems durch die in eine konkrete
soziale Situation involvierten Akteure führt zu einer Fiktionalisierung der Situation im
Sinne einer Annäherung an die abstrakte Handlungslogik des gesellschaftlichen Teilsystems. Dies wiederum bestätigt die Adäquanz der Fiktion, wodurch die Fiktionalisierung entsprechender sozialer Situationen beibehalten werden kann“ (ebd.: 636).
127
Abbildung 7: Uwe Schimanks Modell eines sozialen Subsystems
3.2.3 Subsystembildung
Schimank geht bei seinen systemtheoretischen Überlegungen von einer funktional
differenzierten Gesellschaft aus: „Sie gliedert sich primär in ungleichartige, aber
gleichrangige Teilsysteme. Jedes Teilsystem ist auf eine bestimmte Funktion gesellschaftlicher Reproduktion spezialisiert. Entsprechend dieser Funktion bildet es eine
eigene Semantik, einen eigenen binären Code, der in einigen Fällen auch zu einem
symbolisch generalisierten Kommunikationsmedium ausgebaut ist, sowie den Code
spezifizierende Handlungsprogramme aus. Bei den meisten funktionalen Teilsystemen der modernen Gesellschaft ist die Ausdifferenzierung soweit vorangeschritten,
daß Semantik und Code selbstreferentiellen Charakter gewonnen haben“ (Rosewitz/
Schimank 1988: 298). Selbstreferentialität meint hier, dass alle internen und externen
Ereignisse nach dem eigenen Code - und nicht anders - interpretiert werden; darüber
hinaus kann nichts zum Ereignis für das jeweilige System werden. Auch die Betrachtung der Gesellschaft wird aus dieser Perspektive partikularistisch.
128
Schimank bezweifelt nun, dass teilsystemische Verselbstständigung allein mit Differenzierung, Spezialisierung und Selbstreferentialität begründet oder gar erklärt werden kann. In den Fokus sollte vielmehr ein Ursachenbündel an Bedingungsfaktoren
rücken (vgl. ebd.: 304). Zunächst zu den innersystemischen Faktoren:
Ausmaß der gesellschaftlichen Folgenträchtigkeit von Teilsystemoperationen:
„Je bedeutsamer und je weniger substituierbar die Leistungen eines gesellschaftlichen Teilsystems für dessen Umwelt sind, desto stärker ist diese Folgenträchtigkeit gegeben“ (ebd.: 305). Die Folgenträchtigkeit könne etwa in einem unzureichenden Ausmaß erbrachter Leistungen oder in risikobeladenen
Nebenfolgen dieser Leistungen bestehen. Betrachtet man das Wissenschaftssystem, seien Beispiele für ersteres nicht erbrachte Innovationen und für den
zweiten Punkt etwa ökologische Folgen bestimmter Erfindungen.
Ausmaß der Esoterik teilsystemischer Verselbständigungstendenzen: „Die
Größe der Differenz [in Bezug auf die normativen, kognitiven und evaluativen]
Handlungsorientierungen, der Verf.] kann allerdings variieren. Insbesondere
kann ein gesellschaftliches Teilsystem in seinem ,Eigen-Sinn‘ von den Akteuren in der gesellschaftlichen Umwelt mehr oder weniger akzeptiert werden“
(ebd.: 307). Ein Beispiel hierfür seien die fundamentalen Interessenunterschiede zwischen an Grundlagenforschung ausgerichteten Kernphysikern und
am Profit orientierten Energieunternehmen.
Möglichkeitsspielraum von Akteuren des betreffenden Teilsystems zu einer individuellen oder organisatorischen ökonomischen Interessenverfolgung: „Je
größer der Spielraum ökonomischer Interessenverfolgung innerhalb eines gesellschaftlichen Teilsystems ist, desto stärker können sich Verselbständigungstendenzen insbesondere im Hinblick auf die Akqusition finanzieller Ressourcen aus der gesellschaftlichen Umwelt ausprägen“ (ebd.: 310). Als Beispiel hierfür nennt Schimank das Gesundheitssystem, in welchem Ärzte die
dort vorherrschenden Handlungsorientierungen zugunsten ökonomischer Kri-
terien unterlaufen könnten.
Ausmaß an teilsystemischen Selbststeuerungskapazitäten: Dieses „bemißt
sich daran, inwieweit spezialisierte Organisationen und Verhandlungsgremien
vorhanden sind, die die mehr oder weniger ausgeprägte Pluralität von Interessen innerhalb des Teilsystems so synthetisieren können, daß Potentiale kollektiver Handlungsfähigkeit gebildet werden“ (ebd.: 314). Politischer Steuerung
129
könne dadurch erheblicher Widerstand geleistet werden. Exemplarisch hierfür
nennt Schimank wiederum das Gesundheitssystem, welches eine Vielzahl an
Gremien oder Organisationen wie etwa Verbände der Ärzte und Krankenkassen, Vertreter der Pharmaindustrie und parametrischer Berufe aufweise. Interessanterweise würde laut Schimank eine sehr hohe oder sehr niedrige
Selbststeuerungsfähigkeit Verselbständigungstendenzen promovieren, eine
mittlere hingegen dieser eher entgegenwirken.
Daneben seien noch politische, d.h. durch das politische System bedingte Faktoren
verantwortlich:
Politische Steuerungsansprüche: Diese würden dann von politischen Akteuren
artikuliert, „wenn sie ein ,Interesse des Staates an sich selbst‘ […] unmittelbar
oder mittelbar tangiert sehen“ (ebd.: 319). Unmittelbare Interessen seien etwa
ein Bedarf des Staates an Forschungsleistungen des Wissenschaftssystems.
Mittelbar sei etwa der Versuch Kosten im Gesundheitssystem zu dämmen, um
Auswirkungen auf die Lohnnebenkosten zu vermeiden. Bestehe weniger Interesse, dann könne sich politische Steuerung auf die Vorgabe von Rahmen-
richtlinien reduzieren und Selbststeuerung einen Vorschub geben.
Existenz effektiver politischer Steuerungsinstrumente: Dazu gehören laut
Schimank „Ge- und Verbote […] Überzeugungsmaßnahmen […] Anreize und
Infrastrukturvorgaben […] prozedurale Steuerungsmaßnahmen […] Delegation
als ,verordnete Selbststeuerung‘“ (ebd.: 322). Schimank meint, dass Selbststeuerung nur durch effektive Instrumente induziert würde, denn nur diese
könnten teilsystemischen Widerstand und damit den Drang nach Selbststeuerung hervorrufen. Dabei sei aber auch die andere Richtung denkbar, wenn also Steuerungsinstrumente subsystemische Probleme nicht lösten und die
Subsysteme dadurch auf Eigenhilfe angewiesen seien.
Ausmaß des politischen Steuerungswissens: Schimank meint, daß mit zunehmender Esoterik eines Sozialsystems das Unwissen aufseiten des politischen Systems steige (vgl. ebd.: 325).
Schimank macht drei Indikatoren aus, mit denen eine Verselbständigung eines Subsystems identifiziert werden könne. Erstens handle es sich dabei um nicht oder nur
geringfügig erfüllte Leistungserwartungen, etwa wenn die Wissenschaft die an sie
herangetragenen Probleme nicht löst. Zweitens gehe es um gesellschaftliche Risi130
ken, die mit dem Output eines bestimmten Systems verbunden seien und die Integrität der Gesamtgesellschaft störten. Und drittens bezieht sich Schimank auf den extensiven Verbrauch von Ressourcen, v.a. finanzieller Art (vgl. ebd.: 296 f.). Bei einer
Verselbständigung handelt es sich um eine Zuschreibung seitens eines oder mehrerer Akteure aus anderen Subsystemen, die aufgrund einer Verletzung der genannten
Kriterien und auf Basis ihrer systemspezifischen kognitiven, normativen und evaluativen Orientierungen zu Stande kommen. Hinzukommen müsse ferner eine dauerhafte
Persistenz seitens des sich verselbständigenden Systems gegen externe Steuerungsanstrengungen, v.a. durch das politische System, existieren.
Politische Steuerung wird in der Summe geradezu verunmöglicht, denn „an dieser
Barriere [der Selbstreferentialität, der Verf.] muß jede externe Steuerung, sobald sie
Vorgänge innerhalb des betreffenden Teilsystems deterministisch festlegen will,
scheitern […] Eine politische Forschungssteuerung, die diese Intransparenz ihres
Steuerungsgegenstandes ignoriert, muß zwangsläufig nicht intendierte und nicht
prognostizierte Effekte zeitigen - und sei es, daß der Steuerungsgegenstand in seiner immanenten Dynamik überhaupt nicht beeinflußt wird“ (ebd.: 301). Steuerungsmöglichkeiten böten sich wenn überhaupt erstens durch die Konkurrenz aller Teilsysteme um die Ressource Geld. Allerdings würde mit Geld eher die Quantität als die
Qualität von Systemverhalten variiert, zudem könnten mit der Verknappung dieser
Ressource auch umweltkompatible Handlungsweisen gestört werden. Zweitens
könnten Teilsysteme auf Reflexivität in Bezug auf die Wahrung der gesamtgesellschaftlichen Einheit setzen und dementsprechend ihre Selektionen ausrichten. Nach
Schimank würden solche Fähigkeiten in der Literatur eher selten diskutiert. Drittens
nennt er in Anlehnung an Teubner und Willke das Konzept der Kontextsteuerung. So
könnte z.B. mit Hilfe des reflexiven Rechts das Intersystemgefüge unter Berücksichtigung der teilsystemischen Autonomie gestaltet werden; hier geht es dann etwa um
autonome Regelungen durch Verhandlungssysteme. Machtasymmetrien würden jedoch nicht berücksichtigt, deshalb müssten Alternativen gesucht werden (vgl. ebd.:
302 f.).
3.2.4 Theorie sozialer Steuerung
Seine später entwickelte Theorie sozialer Steuerung setzt nun am Akteur und nicht
am System an; Steuerungshandeln versteht er dementsprechend als Akteurshandeln
(vgl. Schimank 1992: 165). Alle Formen von Handeln werden laut Schimank vom
131
systemischen Bezugsrahmen geprägt. Dieser strukturelle Kontext umfasst nunmehr
die drei Ebenen „gesellschaftliche Teilsysteme“, „institutionelle Regelungen“ und
„Akteurkonstellationen“.
Soziale
Steuerung
versteht
Schimank
„in
einem
akteurtheoretischen Verständnis [als] eine bestimmte Art zielorientierten Handelns“
(ebd.: 166). Steuerndes Handeln kann erstens direkt sein, etwa wenn ein Akteur zur
Reduzierung der Zahl der Krebstoten ein Krebsmedikament selbst entwickelt. Er
kann zweitens andere Akteure z.B. durch Bereitstellung von Finanzmitteln für eine
Forschungseinrichtung zur Entwicklung einer Krebstherapie überzeugen. Drittens
wäre es möglich, indirekt über die Gestaltung des strukturellen Kontextes, etwa über
die Bereitstellung eines Forschungsprogramms auf die Entwicklung von Heilungsmaßnahmen hinzuwirken. Im Gegensatz zur zweiten Maßnahme ist dieser Weg zeitlich, sachlich und sozial nicht nur punktuell. Nur die letztgenannte Möglichkeit bezeichnet Schimank als Typ sozialer Steuerung, um den Begriff nicht inflationär zu
verwenden. Schimank versteht soziale Steuerung somit als ein doppelt indirektes
zielorientiertes Handeln: „Ein Steuerungsakteur führt den von ihm angestrebten
Weltzustand dadurch herbei, daß er den strukturellen Kontext anderer Akteure so
gestaltet, daß sie diesen Zustand herbeiführen“ (ebd.: 167).
Die steuerungstheoretische Leitfrage lautet dann gemäß Schimank: „Unter welchen
Umständen und auf welche Weisen kann ein Akteur, der steuernd bestimmte Zustände herbeiführen will, dies tun?“ (ebd.). Zu diesem Zweck müsse ein Akteur zunächst Akteure identifizieren, die in der Lage seien, den anvisierten Zustand herbeizuführen, denn eine direkte Steuerung der Systeme ist ja ausgeschlossen. Anschließend muss die Richtung der relevanten Handlungsintentionen dieser Akteure geklärt
werden, um die notwendige Richtungsänderung zur Sicherstellung des Steuerungsziels herausfinden zu können. Abschließend müssten Steuerungsmöglichkeiten vermittelt über den strukturellen Kontext - gesucht werden, die den Akteur veranlassen, im Sinne des Steuerungsziels zu handeln (vgl. ebd.). Schimank ist somit anders
als Luhmann der Ansicht, dass Akteure in und auch zwischen Systemen strategisch
handeln können. Allerdings könne nie der Code des anvisierten Systems geändert
werden, denn dies würde das Ende des Systems bzw. dessen Autopoiesis‘ bedeuten.
Als Beispiel für eine soziale Steuerung nennt er die Steuerung des Wissenschaftssystems durch das politische System: „Die intersystemischen Tauschbezüge - Ressourcen gegen nützliche Erkenntnisse - stimulieren und ermöglichen anwendungs132
bezogene Forschung. […] Die Tauschbezüge greifen nicht in den Wahrheitscode ein,
,beugen‘ die Wahrheit nicht. Sehr wohl bestimmen sie aber darüber mit, welche potentiell auffindbaren Wahrheiten gesucht und auch gefunden werden“, beispielsweise
über die Bereitstellung von Fördermitteln, Laborausstattungen, etc. (Schimank 2005:
161 f.). An dieser Stelle zeigt sich, dass Schimank die Grenzen des AutopoieseBegriffs, den er wie Luhmann unhinterfragt aus der Biologie übernommen hat und
zugleich noch stärker metaphorisch verwendet, sehr weit dehnt. Ob denn die Bereitstellung solcher Ressourcen noch als Perturbationen oder nicht eher als Eingriff in
das System gelten muss, darüber kann gestritten werden (vgl. Maturana 1998: 104).
Im Hinblick auf Steuerungshandeln weist Schimank darauf hin, dass die drei genannten Handlungsorientierungen - normativ, kognitiv und evaluativ - zunächst jede Wahl
einer steuernden Handlung einschränkten. Erst nach dieser Vorauswahl könne ein
Akteur sich für eine bestimmte Handlung entscheiden. Diese drei Handlungsorientierungen seien nun in den sozialen Strukturebenen mit unterschiedlicher Gewichtung
verankert:
1. Erstens in gesellschaftlichen Teilsystemen, die jedem Akteur eine jeweilige
Fiktion zur Definition einer Situation bieten. Hier dominiert v.a. eine evaluative
Orientierung, denn diese „schließt zahlreiche Richtungen des ,Wollens‘ als irrelevant aus und fixiert gleichsam den Blick des Akteurs in eine und nur eine
Richtung. Die weitere Spezifikation des Wollens erfolgt dann auf den beiden
darunterliegenden sozialen Strukturebenen“ (Schimank 1992: 170). Teilsystemisch-evaluative Orientierungen vereinfachen damit die Wahl einer Handlung.
Steuerungsprobleme ergeben sich etwa dann, wenn der steuernde und der zu
steuernde Akteur unterschiedlichen Systemen und damit Handlungslogiken
angehört oder wenn sich das politische System um die Koordination zwischen
zwei anderen Systemen kümmern möchte (vgl. ebd.:173). Dieses Problem
könne z.B. durch das Ansprechen der eingangs erwähnten reflexiven Interessen gelöst werden, etwa über Zuteilung von Ressourcen oder Machtbefugnissen. Reflexive Interessen werden anderen Akteuren meist unterstellt, wirken in
diesem Sinne als Fiktion und prägen sowohl die Fremd- als auch die Selbstbeobachtung. Schimank versteht die reflexiven Interessen demnach als „Generalschlüssel“ bzw. als gemeinsame Sprache, unabhängig vom teilsystemischen Orientierungshorizont. Steuerung sei nur dann möglich, wenn reflexive
133
Interessen des steuernden und des anvisierten Akteurs kompatibel wären. Allerdings sei diese Steuerungsvariante nicht durch die Systemtheorie
identifizert worden, „weil eben nur Akteure, aber nicht gesellschaftliche Teilsysteme mit Interessen ausgestattet sind“ (ebd.: 14).
2. Die zweite Ebene besteht aus den Institutionenkomplexen, genauer „aus normativen, evaluativen und kognitiven Orientierungen - allerdings auf einem viel
geringeren Generalisierungsniveau. Bei Institutionen handelt es sich um operationale Vorgaben dazu, wie Akteure bestimmte Situationen wahrnehmen
und beurteilen und wie sie demzufolge dann handeln sollen“ (ebd.: 170). Dazu
gehören beispielsweise Sitten, formalisierte Verfahren, Rechtsnormen, Rollen
oder Mitgliedschaftserwartungen formaler Organisationen; vorrangig sind hier
normative Orientierungen. Auf dieser Ebene würden laut Schimank deutlich
mehr Steuerungsvarianten als auf der ersten Ebene existieren.
Exemplarisch stünden hierfür zum Einen korporative Akteure, die entweder
durch Eigeninitiative zu einem bestimmten nützlichen Zweck oder durch politischen Druck entstanden seien. Der Grad an Organisation dieser Akteure und
deren Steuerbarkeit stünden in keinem gerichteten Verhältnis. Solche Akteure
könnten dem Steuernden Informationen oder aggregierte Interessen mitteilen,
gegenüber ihren Mitgliedern verpflichtende Maßnahmen erlassen oder als deren handlungsleitender struktureller Kontext wirken. Dabei lassen sie sich
durch Entscheidungen verändern und mittels Hierarchie kontrollieren. Zum
Anderen lässt sich über Kompetenzzuweisungen und Entscheidungsverfahren
ebenfalls steuernd eingreifen. Erstere teilen Steuerungsakteuren Steuerungsmöglichkeiten zu. Entscheidungsverfahren seien der Weg zur Variation von
Steuerungskompetenzen. So könnten Steuerungsmonopole, plurale Steuerungsarrangements oder Blockademonopole entstehen (vgl. ebd.: 178 f.).
3. Die dritte Ebene bilden Akteurkonstellationen; hier geht es um die Kooperation
mit anderen Akteuren. Von besonderer Bedeutung ist hier die kognitive Orientierung, der es hier vorrangig um Informationen über den Kooperationspartner
geht, etwa im Hinblick auf Beeinflussbarkeit, Handlungsabsichten oder Handlungseffekte. Beispielhaft können hier Verhandlungsstrukturen, Beziehungsdefinitionen und wechselseitige Erwartungsmuster genannt werden. Bei den
Verhandlungsstrukturen komme es laut Schimank auf institutionelle Kompetenzzuweisungen und Entscheidungsverfahren bei der Bestimmung des Cha134
rakters der Verhandlung an. Daneben spielen Beziehungsdefinitionen eine
wichtige Rolle. Diese besagen, nach welchen Handlungsstrategien die beteiligten Akteure vorgehen, wobei es sich eben nicht immer um eine Nutzenmaximierung im Sinne der RC-Theorien handeln muss. Nicht zuletzt sind wechselseitige Erwartungsmuster von Bedeutung. Hier geht es darum, wie Steuerungsakteure den Steuerungsadressaten ein bestimmtes Handeln unterstellen
können, etwa Profitorientierung oder das Unterstellen von Entscheidungsschwäche (vgl. ebd.: 183 ff.).
Zusammengefasst sieht das Modell so aus, „daß evaluative, normative und kognitive
Orientierungen von der Ebene der gesellschaftlichen Teilsysteme über die Ebene der
Institutionenkomplexe zur Ebene der Akteurkonstellationen immer weiter spezifiziert
werden, wobei zugleich die Modalität der Orientierungszusammenhänge von Ebene
zu Ebene wechselt. Eine evaluative Modalität auf der Ebene der gesellschaftlichen
Teilsysteme
geht
in
eine
normative
Modalität
auf
der
Ebene
der
Institutionenkomplexe und diese wiederum in eine kognitive Modalität auf der Ebene
der Akteurkonstellationen über. So geht das teilsystemisch geprägte ,Wollen‘ in das
institutionell
geprägte
,Sollen‘
und
dieses
schließlich
in
das
durch
die
Akteurkonstellation geprägte ,Können‘ der Akteure ein“ (ebd.: 172). Der in dieser Arbeit interessierende Sachverhalt der Steuerung eines bestimmten sozialen Systems
durch ein anderes (v.a. das politische) System ließe sich dann folgendermaßen illustrieren:
135
Abbildung 8: Soziale Steuerung nach Schimank 1992.
Anders als staatstheoretische Zugänge hat Schimank sein Steuerungskonzept von
der Gesellschaft her konzipiert. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist damit immer
sein Modell von Gesellschaft. In einer späteren Arbeit hat Schimank auf dieses Spezifikum gesellschaftstheoretischer Steuerungstheorie hingewiesen und sich deswegen auf die Suche nach weiteren, in der Soziologie verbreiteten Gesellschaftsleitbildern gemacht, um diese für eine folgende Steuerungstheorie auf Gemeinsamkeiten
hin zu überprüfen, teilweise zu verknüpfen und fruchtbar zu machen. In der Summe
handelt es sich dann jedoch eher um „ein facettenreiches Bild moderner Gesellschaft“ (Schweizer 2003: 44). Den Konzepten der gesteuerten Gesellschaft, der
staatlich verfassten Gesellschaft und der polykontexturalen Gesellschaft liegt demnach ein Staatsbild zugrunde, wonach der Staat eine in Subsysteme ausdifferenzierte Gesellschaft immer dann steuert, wenn deren Selbststeuerungskompetenzen ausgereizt wären. In der Öffentlichkeit würde ja auch immer nach dem Staat und nicht
der Wirtschaft, der Religion etc. gerufen, wenn die Gesamtgesellschaft bedrohende
Probleme auftreten.
Schimank hält nach wie vor an der selbstreferentiellen Geschlossenheit der Subsysteme fest. Fraglich ist dann allerdings, wie Politik diese Systeme steuern kann. Er
nennt nun diesbezüglich drei steuerungstheoretische Konsequenzen: „Erstens stellt
funktionale Differenzierung eine politisch zu respektierende Steuerungsbegrenzung
dar. […] Zweitens erwachsen aus der nicht zur Disposition stehenden funktionalen
Differenzierung zwei Arten von Problemen gesellschaftlicher Systemintegration: die
eklatante Leistungsverweigerung eines Teilsystems gegenüber einem anderen und
136
die Überlastung eines Teilsystems durch negative Externalitäten eines anderen. […]
Drittens schließlich bedeutet der intersystemische Orientierungsdissens auch eine
hochgradige kognitive Intransparenz der Teilsysteme füreinander“ (ebd.: 227). Beispielsweise könne im Rahmen der Organisationsgesellschaft ein Teil der Steuerungsaufgaben getrost den Organisationen überlassen werden, da diese sich selbst
um integrative Steuerungsprobleme kümmern könnten. Andernfalls könne der Staat
nach wie vor über Verhandlungsnetzwerke moderierend eingreifen oder Organisationen unterstützen bzw. selbst gründen (vgl. ebd.: 229).
Schimank beschreibt nun verschiedene Gesellschaftsbilder nebst steuerungstheoretischen Konsequenzen. Sozusagen auf der Mikroebene identifiziert Schimank eine
individualisierte Gesellschaft, die sich durch fortschreitende Ansprüche seitens der
Bürger und Anspruchserfüllung durch die Politik („Wohlfahrtsstaat“) spiralförmig entwickelte. Die Folgen seien Verteilungskonflikte, eine Überlastung des Wohlfahrtsstaates und ökologische Probleme. Dem gegenüber stellt Schimank die Bürger- und
Verantwortungsgesellschaft und die durch Ulrich Beck bekannt gewordene Risikogesellschaft, die Politik jeweils dazu brächte, mit ihren kognitiven und moralischen Vorstellungen im Einklang zu steuern oder ggf. auf die Selbststeuerungspotentiale von
Vereinen etc. zu setzen. Abschließend erwähnt Schimank die Medien- und Inszenierungsgesellschaft, wonach die Beschäftigung mit Steuerungsproblemen in der Regel
durch die Inszenierung in den Massenmedien vorgeformt würde. Medien könnten
ebenfalls Steuerungsversuche unterstützen, indem sie vermeintliche Adressaten einschüchterten. Politik könne aber auch die Medien nutzen, um sich selbst darzustellen. Vergleichbar damit sei die Weltgesellschaft, die Politik nicht nur im Zusammenhang mit Medien, sondern in einem weltweiten Netzwerk von Unternehmen, wissenschaftlichen Einrichtungen, kulturellen Arrangements verheddert und damit in ihrer
Steuerungsfähigkeit eingeschränkt sieht.
Das Destillat dieser Reise Schimanks durch verschiedene Gesellschaftstheorien im
Hinblick auf Steuerung lautet nun folgendermaßen: „In der Moderne bestehen große
und nicht beliebig herunter schraubbare kulturelle Steuerungsambitionen und erwartungen, die in erster Linie an den Staat adressiert werden. […] Der wichtigste
Steuerungszugriff erfolgt heute primär auf formale Organisationen, künftig vielleicht
auch zunehmend auf Wertegemeinschaften. Die moderne Gesellschaft setzt hierfür
vor allem drei wichtige Steuerungsbedingungen: Polykontexturalität, Medienpräsenz
und Globalisierung. […] Steuerungsprobleme schließlich erwachsen zum einen aus
137
der Abstimmung zwischen den verschiedenen Teilsystemen. Diese Art von Problemen haben allerdings die heutigen Verhandlungsdemokratien, auch im supranationalen Maßstab ganz gut im Griff. Die größten Herausforderungen politischer Gesellschaftssteuerung erwachsen hingegen zukünftig aus dem Anspruchsindividualismus,
den ökologischen Problemen und den ,unteilbaren Konflikten‘, die zwischen
antangonistischen religiösen und ethnischen Gemeinschaften in multikulturellen Gesellschaften erwachsen können“ (ebd.: 240). Damit ist allerdings noch überhaupt
nichts darüber gesagt, wie gesteuert werden kann; in steuerungstheoretischer Hinsicht bietet Schimank somit keine Innovation bzw. keine präzisen Lösungsangebote.
Schimank hat sein über viele Jahre entwickeltes Grundgerüst in einem jüngeren
Werk zusammengefasst (Schimank 2010). Bei seiner steuerungstheoretischen Konzeption handelt es sich eher um einen Bezugsrahmen oder eine Heuristik, da alle
Ebenen nur angedeutet, aber nicht ausformuliert werden. Dies unterbleibt laut Schimank aus guten Gründen, denn „insgesamt zeigt sich, daß Steuerungssituationen
aufgrund dieser vielfältigen, hier nur illustrativ erläuterbaren strukturellen Prägungen
hochgradig komplex sind und sowohl die systemtheoretische Perspektive als auch
bisherige akteurtheoretische Betrachtungen immer nur einen geringen Teil dieser
Komplexität erfassen“ (Schimank 1988: 165). Systemtheoretische Konzepte könnten
nur für die teilsystemische Ebene angewendet werden, akteurtheoretische hingegen
für die Ebene der Institutionenkomplexe und Akteurkonstellationen - Erklärungsdefizite seien damit vorprogrammiert. Selbst wenn Konzepte für alle drei Ebenen vorlägen,
wäre deren Interdependenz noch nicht beachtet.
Im Gegensatz zu den staatstheoretischen Konzepten ist Schimanks Ansatz jedoch
wesentlich differenzierter, und „gerade hinsichtlich dieser Aspekte erscheint die von
Schimank vorgeschlagene steuerungstheoretische Heuristik als äußerst vielversprechend“ (Görlitz/ Burth 1998: 139). Allerdings gibt Schimank selbst steuerungstheoretische Defizite seiner Arbeiten zu bedenken. Als Soziologe setze er den Schwerpunkt
auf die Konzeption von Gesellschaft und nicht auf die Untersuchung von Steuerung:
Politikwissenschaft „bemüht sich vorrangig um ein sozusagen ,technisches‘ und auf
die Ablaufdynamiken und deren institutionelle Kanäle gerichtetes Verständnis politischer Gesellschaftssteuerung. Es geht um Steuerungsinstrumente, GovernanceKonstellationen und das Wechselspiel von Steuerung und ungesteuerten sozialen
Dynamiken. Diese Themenfacetten sind bei der Policy-Forschung gut aufgehoben.
Worüber diese allerdings bisher nicht verfügt, ist ein theoretisch gehaltvoller Begriff
138
der Gesellschaft in ihrer heutigen und für die nächste Zukunft erwartbaren Gestalt“
(Schimank/ Lange 2001: 221).
Das Konzept Schimanks ist in der Summe nur insofern brauchbar, als damit Steuerungssituationen und -konstellationen aufgezeigt werden können. Wie jedoch mit
welcher Effektivität gesteuert oder wie Steuerung erklärt werden kann, wird von dieser Konzeption nicht dargestellt. Somit kann in steuerungstheoretischer Hinsicht nur
bedingt empirische Angemessenheit attestiert werden; selbst aus sozialtheoretischer
Sicht bleibt es eher abstrakt. Allerdings kann es im Vergleich mit den Staatstheorien
als äußerst innovativ angesehen werden, da es versucht, Gesellschaft und partiell
Steuerungsprozesse theoriegeleitet zu beschreiben, nicht jedoch zu erklären.
139
4. Systemtheoretische Ansätze - „offene“ Systemmodelle
4.1 David Eastons politisches Systemmodell
Das mutmaßlich bekannteste Politikmodell stammt von David Easton, der Politik systemtheoretisch interpretiert und dementsprechend ein politisches Systemmodell entwickelt hat. Dieses Systemmodell wurde zur Grundlage zahlreicher Untersuchungsansätze, es „ist die theoretische Basis für den überwiegenden Teil der Politikfeldforschung. Vor allem die Modellbildung ist hiervon stark geprägt“ (Schubert 1991: 28).
Mit dem Systemmodell sollte der klassische Staatsbegriff überwunden und aus der
Disziplin gleichsam getilgt werden. Easton führt drei Gründe auf, warum das Systemkonzept dem Staatsbegriff vorzuziehen sei: „Erstens schließe der Staatsbegriff als
politikwissenschaftlicher Grundbegriff staatenlose Gesellschaften aus dem Objektbereich der Disziplin aus. Zweitens fungiere der Staatsbegriff eher als Mythos einer
Einheitsbildung denn als analytischer Begriff und drittens lasse sich auf der Suche
nach einem allgemeinen Staatsbegriff bestenfalls eine sehr formale Definition gewinnen“ (Nullmeier 2009: 38). Darüber hinaus war sein Systemmodell zugleich eine Kritik an der zu seiner Zeit üblichen Politikwissenschaft. Diese stützte sich erstens in
großem Ausmaß auf die Ideengeschichte, was dazu führte, dass für aktuelle Probleme nur unzeitgemäße Lösungen angeboten werden konnten. Zweitens wurde die
Disziplin in diesen Jahren zunehmend empirisch ausgerichtet. Easton bemängelte
daran das sture Ansammeln von Daten, ohne noch Bezug auf Probleme zu nehmen
(vgl. Fuchs 2006: 347).
Nach Easton besitzen politische Systeme folgende zentrale Aufgabe, die sie von
anderen gesellschaftlichen Teilsystemen unterscheidet: „A political system, therefore,
will be identified as a set of interactions, abstracted from the totality of social behavior, through which values are authoritatively allocated for a society” (Easton 1965:
57). Politische Systeme haben somit die Funktion, in einer differenzierten Gesellschaft allgemeinverbindliche Regeln zu setzen.
Dem Modell liegen eingängliche Begriffe zu Grunde. Zunächst einmal geht Easton
davon aus, dass an das politische System Inputs aus dessen Umwelt herangetragen
werden. Diese Inputs können analytisch in Forderungen (demands) und Unterstützung (support) differenziert werden. Forderungen bestehen z.B. in einer erhöhten
Nachfrage nach strengeren Sicherheitsgesetzen; Unterstützung meint etwa das Zahlen von Steuern oder das Wählen systemkonformer Parteien. Sie werden innerhalb
140
des politischen Systems verarbeitet (conversion). Easton lässt die Ausdifferenzierung
des politischen Systems jedoch offen; er spricht lediglich von einer „black box“. Elemente des politischen Systems sind all diejenigen Interaktionen, die an der autoritativen Verteilung von Werten teilhaben. Das Ergebnis dieses Umwandlungsprozesses
sind Outputs, genauer Entscheidungen (decisions) und Handlungen (actions) in Form
von z.B. Gesetzen oder Programmen. Die gesellschaftlichen Folgen dieser Outputs
wirken über Inputs wieder zurück auf das politische System (feedback). Hauptaufgabe des politischen Systems ist die Sicherung des eigenen Überlebens im Sinne der
Grenzerhaltung bzw. eines dynamischen Anpassungsprozesses (vgl. Easton 1990:
49 ff.).
Insgesamt handelt es sich bei Eastons Systemmodell um ein kybernetisches Systemmodell. Der Kerngedanke des Modells besteht darin, dass „die Verarbeitung von
inputs zu outputs als zentrale Leistung des poltischen Systems herausgestellt wird“
(Schubert 1991: 28) - man könnte auch von einem „Problemlöseapparat“ sprechen
(Gellner/ Hammer 2010: 57). Die rein analytische Begrifflichkeit ist der Grund dafür,
warum es sich im Grunde genommen um ein Systemmodell von Politik und eben
keine politische Systemtheorie handelt.
Abbildung 9: Eastons Systemmodell nach Jann/ Wegrich 2009: 82.
Anders als beispielsweise die Rationalitätskonzepte nimmt das Systemmodell
Eastons die Outputs stärker ins Visier. In der Literatur hat sich diesbezüglich eine
141
bestimmte Differenzierung durchgesetzt. Das Ergebnis der Politikformulierung besteht aus „Policies i.e.S.“. Diese Policies sind beispielsweise Gesetze, Programme,
Pläne oder Willenserklärungen. Werden diese Policies dann auch durchgeführt,
spricht man von „Outputs“, was die Überführung der Policies in reale Leistungen oder
Interventionen meint. Die Wirkung der Outputs auf die Adressaten wird als „Impact“
bezeichnet. Nur selten jedoch lässt sich die Wirkung einer Policy auf den jeweiligen
Adressatenkreis begrenzen. Effekte dieser Policy im gesellschaftlichen Umfeld werden von daher als „Outcome“ tituliert (vgl. Jann/ Wegrich 2009: 82).
Abbildung 10: Differenzierung von Outputs nach Jann/ Wegrich 2009: 82.
Für die Konzeption des Politisch-administrativen Systems als black-box ist Easton
zeitlebens kritisiert worden. So sei der zentrale Schwächepunkt des Modells, „dass
es keine genaue Auskunft gibt über die beteiligten Verarbeitungseinheiten innerhalb
des Systems (z.B. individuelle oder korporative Akteure) und auch nicht über die Beziehungsstruktur, die die beteiligten Einheiten verbindet“ (Schneider/ Janning 2006:
21). Und ganz ähnlich dazu: „Die lapidare Darstellung des politischen Verarbeitungsvorganges als Black-Box-Prozess hinterlässt bei Policyforschern natürlich ein
Höchstmaß an Unzufriedenheit. […] Die öffentliche Verwaltung ist für sie kein automatisierter Apparat, auf dessen verlässliche Arbeitsweise blind vertraut werden kann“
(Gellner/ Hammer 2010: 58). Diese Aussage erinnert sehr an die Kritik der frühen
Planungskonzepte, wonach das Politisch-administrative System eben kein rationalmechanistisch verfahrender Apparat, sondern durch Komplexität und menschliche
Schwächen geprägt sei.
Gabriel Almond hat wegen dieser Kritik das Systemmodell bzw. die black box ausdifferenziert. Die black box unterteilte er in Input-Funktionen und Output-Funktionen.
Input-Funktionen sind für ihn politische Sozialisation und Rekrutierung, politische
Kommunikation, Interessenartikulation und -aggregation. Als Output-Funktionen
nennt er das Setzen, das Anwenden und das Interpretieren von Regeln (vgl. Almond
1960: 3 ff.). Allerdings ist es auch Allmond nicht gelungen, eine konsistente Theorie
142
zu entwickeln, „sondern blieb in einer Typologie stecken, da die Funktionen nebeneinandergestellt blieben, ohne daß klar wurde, in welchem Verhältnis sie zueinander
stehen und wie sie aufeinander einwirken“ (von Beyme 2006: 210 f.). Zudem weist
von Beyme auf die Problematik solcher enggefassten Typologien hin. So lasse sich
etwa die Kommunikationsfunktion kaum ausschließlich im System verorten; sie sei
doch eher eine Output-Funktion (vgl. ebd.).
Daneben weist die Easton’sche Abstraktion des politischen Systemmodells große
Ähnlichkeiten mit Staatstheorien auf: „Letztlich entkomme das Konzept des
,politischen Systems‘ nicht dem Alltagsverständnis nationalstaatlich geprägter Politik.
Schon die Rede von ,politischen Systemen‘ lege deren Mehrzahl und Gleichrangigkeit nahe und stehe bereits sprachlich in gewisser Nähe zum Westfälischen System
nebengeordneter, formal gleichrangiger Nationalstaaten. In den Abstraktionen der
Systemterminologie setzen sich implizit Bezüge zu recht konkreten Erscheinungsformen heutiger politischer Systeme durch“ (Nullmeier 2009: 39). Fuchs weist darauf
hin, dass der hohe Abstraktionsgrad von Eastons Systemmodell für demokratietheoretische Forschungen nur bedingt tauglich ist. Solchen Untersuchungen gehe es um
(günstige) Entstehungsbedingungen von Demokratien bzw. „bessere“ und „schlechtere“ Varianten demokratischer Systeme. Easton hingegen gehe es lediglich um die
Persistenz der politischen Strukturen. So könne beispielsweise das politische System
Deutschlands nach dem Wechsel von der Weimarer Republik in die nationalsozialistische Herrschaft als persistent bezeichnet werden, da es als eigenständiges System
weiter existierte (vgl. Fuchs 2006: 364).
Darüber hinaus wurde die politische Systemtheorie nach ihrer Hochphase v.a. von
Vertretern des Rational-Choice-Paradigmas angegriffen. Während Easton Politik
noch systemisch erklärte, meinten Rational-Choice-Theoretiker, dass Politik individuell erklärt werden müsse. Um dies zu gewährleisten, bedürfe es somit keiner System, sondern einer Handlungstheorie. Die Folge dieser grundlegenden Kritik war der Paradigmenstreit zwischen Anhängern von Systemtheorien und von Handlungstheorien
(vgl. ebd.: 362 f.). Fuchs weist jedoch darauf hin, dass die Handlungstheoretiker spätestens in den achtziger Jahren Institutionen als handlungsleitende Strukturen in ihre
Konzepte aufnahmen und dabei respektierten, dass nicht jede Struktur durch individuelles Handeln erklärt werden kann. Hier bestünden Anknüpfungspunkte an die
Systemtheorie Eastons; bislang stehe eine diesbezügliche Verknüpfung noch aus
(vgl. ebd.: 363).
143
In der Summe hat sich das Easton’sche Systemmodell für die steuerungstheoretische Diskussion nur in der Hinsicht als nützlich erwiesen, als dass es eine differenziertere Vorstellung vom „Steuermann“ geben konnte. Letztlich bleibt es sowohl auf
der Makroebene als auch durch Input-Output-Konzeptionen der klassischen hierarchischen Steuerungsvorstellung verhaften und bietet keinerlei Hinweise auf die Beteiligung weiterer Steuerungsakteure. Im Folgenden sollen zwei jüngere Varianten
politischer Systemmodelle betrachtet werden, als deren „Ahne“ Easton gelten kann.
4.2 Werner Janns Policy-Making-Modell
Die bekannteste Erweiterung des Easton’schen Systemmodells stammt von Werner
Jann. Jann behält die Gliederung in Inputs, Conversion und Outputs grundsätzlich
bei. Sein Policy-Making-Modell ist jedoch im Conversion- und Output-Bereich deutlich differenzierter. Das ist der Tatsache geschuldet, wonach die Policy-Forschung
schwerpunktmäßig Politikformulierung und -implementation in den Untersuchungsfokus rückt. Dass Inputs und damit Partizipationsbemühungen eher vernachlässigt
werden, wurde der Policy-Forschung des Öfteren vorgeworfen. Allerdings handelt es
sich dabei eher um Gegenstände der politischen Soziologie bzw. der Verbände und
Interessengruppenforschung (vgl. Schubert 1991: 28).
Jann unterscheidet zunächst das von ihm modellierte Policy-Making-System (PMS)
vom Politisch-administrativen System bzw. dem Politischen System. Die beiden letzteren seien Begriffe und Konzepte, die der Überwindung des klassischen Staatsbegriffes dienten und dessen juristische, theoretische, gewohnheitsmäßige etc. Begrenzungen sprengen sollten. Zum PaS könnten damit auch Gerichte und Parteien,
aber auch informelle Strukturen und damit etwa Verbände je nach Forschungsinteresse gezählt werden. Unter dem Policy-Making-System werden hingegen „sämtliche
öffentliche Institutionen und Akteure subsumiert, die mit der Entwicklung oder Durchführung staatlicher Politiken beschäftigt sind (ganz grob: Regierung und Verwaltung)“
(Jann 1981: 19). Eine präzisere Definition ist folgendem Umstand geschuldet: „Die
inhaltliche Bestimmung dessen, was mit policy-making-system oder politischadministrativem System jeweils bezeichnet werden soll, ist vielmehr weitgehend abhängig von den jeweiligen Forschungsinteressen, dem zu analysierenden Politikfeld
und dem tatsächlich vorgefundenen politischen Prozeß. Ganz allgemein kann daher
nur festgehalten werden, daß das policy-making-system alle diejenigen binnenstruk-
144
turellen Faktoren umfaßt, die auf den politischen Problemverarbeitungsprozeß Einfluß ausüben“ (Schubert 1991: 31).
Innerhalb des Policy-Making-Systems unterscheidet Jann zwischen Prozessen und
Strukturen der Politikformulierung und der Politikdurchsetzung: „Mit dieser Trennung
wird - neben der Trennung von input und output - auch in der ,black box‘ selbst der
Erkenntnis Rechnung getragen, daß die tatsächlichen politischen Problemlösungen
unter den Handlungsbedingungen moderner westlicher Demokratien in der Regel
von den Partei- und Regierungsprogrammen, politischen Forderungen etc. abweichen“ (Schubert 1991: 31).
Politikformulierung meint die Überführung von Inputs in staatliche Handlungsprogramme oder rechtliche Regelungen mit dem Anspruch der Verbindlichkeit. Ergebnisse dieses Prozesses bezeichnet Jann als Policies i.e.S. Analytisch unterscheidet
er bei der Politikformulierung zwischen Phasen der Informationsgewinnung bzw. verarbeitung, der Konfliktregelung und Konsensbildung. Beteiligte Akteure sind zumeist Politiker, Interessenvertreter und in weiten Bereichen die Verwaltung.
Politikdurchsetzung meint die Implementation der Programme. An dieser Stelle können die Policies i.e.S. nochmals deutliche Veränderungen erfahren. Analytisch differenziert Jann zwischen Programmkonkretisierung (etwa der Aufstellung von Plänen),
Bereitstellung von Ressourcen (Personal, Organisation, Finanzen) und der eigentlichen Ausführung (rechtswirksame Einzelfallentscheidung und unmittelbare Leistungserbringung). Relevante Akteure sind die jeweiligen Adressaten und die vollziehenden Behörden. Allerdings sei es oftmals schwierig, Bereiche der Politikformulierung und -durchsetzung empirisch auseinanderzuhalten; es handle sich dabei eben
um eine analytische Festsetzung (vgl. Jann 1981: 21).
Desweiteren gliedert Jann das Policy-Making-System in Strukturen und Prozesse. Zu
den wichtigsten Strukturen gehört die Personalstruktur (etwa in Bezug auf Einstellungen, Erfahrungen, Qualifikationen), die Organisationsstruktur (formaler Aufbau oder
Zuständigkeitsverteilung) und die Prozessstruktur (Verfahrensregeln, festgelegte
Prozeduren, etc.) Prozesse sollen zunächst einmal die dynamischen Komponenten
der Strukturen heißen (vgl. ebd.: 22).
Jann unterscheidet Inputs nicht wie Easton nach Forderungen und Unterstützung,
sondern nach System-, Problem- und Politikcharakteristika. Systemcharakteristika
sind allgemeine Merkmale des jeweiligen gesamtgesellschaftlichen Systems, die
mutmaßlich auf das Policy-Making-System wirken, etwa der Industrialisierungsgrad,
145
der Bildungsgrad oder die Einkommensverteilung. Problemcharakteristika bezeichnen Eigenschaften der Probleme, mit welchen das Policy-Making-System konfrontiert
wird. Eine mögliche Variante wäre nach Jann die Unterscheidung in Niveauprobleme,
Niveaufixierungsprobleme, Verteilungsprobleme und Interaktionsprobleme. Politikcharakteristika beziehen sich auf traditionelle Elemente der Politik, die gemeinhin
zum Politisch-administrativen System gezählt werden. Dazu gehören z.B. Institutionen wie Parteien, Verbände oder die Massenmedien, desweiteren Meinungen, Einstellungen & Normen und nicht zuletzt Instrumente der politischen Willensbildung
(vgl. ebd.: 24 f.).
Darüber hinaus behält Jann die Weiterentwicklung des Output-Begriffes bei. Den
Output der Politikformulierung bezeichnet er wie gesagt als Programme bzw. Policies
i.e.S.
(als
Gesetze),
den
Output
der
Politikdurchsetzung
nennt
er
Implementationsoutput. Beide zusammen sollen als Policies (i.w.S.) bezeichnet werden. Wirkungen des Outputs unterscheidet er nach der Reaktion der Adressaten
(Impact) und der Reaktion des Gesamtsystems (Outcome) (vgl. ebd.: 26).
146
Abbildung 11: Politisch-administratives System nach Jann (1981: 17).
Jann ist es mit seinem Modell des Policy-Making-Systems gelungen, eine differenziertere, logisch konsistente Variante des Easton’schen politischen Systemmodells
vorzulegen. Dies gilt für die Outputs, aber noch viel mehr für die Betrachtung der
147
„black box“. Insgesamt ist es „ein kategoriales Zusammenhangsschema, in dessen
Rahmen politische Wirkungszusammenhänge erfaßt, beschrieben und analysiert
werden können“ (Schubert 1991: 32) - für empirische Arbeiten bietet es somit bestimmte Indikatoren an. Über die ebenfalls alternativ modellierten Inputs gelingt es
Jann, sachliche oder institutionelle Zwänge in das Modell zu integrieren. Das herkömmliche Systemmodell verliert damit deutlich an Sparsamkeit.
Daneben darf nicht übersehen werden, dass auch Janns Konzeption des politischen
Systems Ähnlichkeiten zu Staatstheorien aufweist. So gibt auch Jann die klassische
top-down-Perspektive von Politik nicht auf. In der Summe bietet Jann eine verfeinerte, systemtheoretisch fundierte Modellierung des klassischen Steuerungssubjekts
und eine Verfeinerung der Vorstellung von Steuerungsprodukten und -wirkungen.
Über eine Beschreibung dieses Subjekts und der Outputs gelangt er jedoch kaum
hinaus, d.h. er kann kein ausgefeiltes Erklärungsmodell politischer Steuerung anbieten. Zur Modellierung steuerungstheoretischer Effekte wäre es angemessen, auch
das „Gegenüber“ von Steuerung - das klassische Steuerungsobjekt - systemtheoretisch ins Visier zu nehmen und das entsprechende Wirkgeflecht zu betrachten. Diese
Aufgabe hat sich beispielsweise Richard Münch zur Lösung gestellt.
4.3 Richard Münchs Interpenetrationskonzept
Richard Münch hat eine Variante eines „offenen“ Systemmodells entwickelt, dass auf
der Differenzierungstheorie von Talcott Parsons fundiert (vgl. Münch 1996: 19 ff. und
225 ff.). Nach Münch und analog zu Parsons lassen sich Gesellschaften mit dem
AGIL-Schema analytisch betrachten und in Subsysteme differenzieren. So bestünden moderne Gesellschaften aus dem ökonomischen, dem politischen, dem Gemeinschafts- und dem soziokulturellen System. Jedes dieser Systeme habe eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen; die Wirtschaft müsse durch Versorgung mit Gütern bestimmte Anpassungsleistungen (Adaption) und die Politik gesamtgesellschaftlich verbindliche Entscheidungen treffen (Goal attainment) (vgl. ebd.: 20 f.). Diese Subsysteme ließen sich nun mit dem AGIL-Schema weiter ausdifferenzieren; im politischen
System würde z.B. Goal Attainment (G) durch politische Macht verbürgt, Strukturerhaltung (Latent pattern Maintenance, L) durch Einbettung in den kulturellen Wertehorizont gewahrt, Integration (I) durch Unterstützung seitens der Bürger geschaffen und
Anpassung (A) durch die Nutzung von Ressourcen gesichert werden (vgl. ebd.: 22).
148
Kommunikationsmedium des politischen Systems sei Macht, die orts- und zeitungebunden sei (vgl. ebd.: 26).
Nach Münch sei es jedem System möglich, seine Outputs in Form eines Faktors oder
Produkts in andere Subsysteme zu transferieren: „Faktoren werden im Medium des
Sendersystems auf die Adressatensysteme zur dortigen Verarbeitung übertragen,
Produkte im Medium der Adressatensysteme zum dortigen Verbrauch“ (ebd.: 23).
Beide Vorgänge würden jeweils soziale Rollen und Verfahren des einen Systems im
anderen als „Stellvertretung“ erfordern; an diesen Stellen würden Interpenetrationszonen entstehen. Auf diese Art und Weise würden moderne, hochdifferenzierte Gesellschaften einen umfangreichen Leistungsaustausch sicherstellen und sich nicht
wie bei Luhmann in einzelne Subsysteme auflösen. Exemplarisch nennt Münch die
Interpenetration von Wirtschaft und Politik: Faktoren der Wirtschaft seien Produktivität in Form von Geldzahlungen; das politische System würde diese in Programme
investieren. Die Stellvertretung sei hier die Haushaltspolitik. Ein Produkt der Wirtschaft für die Politik seien Leistungen der Unternehmen und Behörden im öffentlichen Auftrag (vgl. ebd. f.).
Steuerungsprozesse müssten nun auf diesem Konzept gründen; Münch widerspricht
damit v.a. Luhmanns Vorstellung autopoietischer Sozialsysteme und befürwortet die
klassische Input-Output-Konzeption sozialer Systeme: „Politische Steuerung endet
nicht in der Steuerung des politischen Systems, sondern greift durch die Transformation von politischer Macht in Einfluß, Wahrheit und Geld in die Systeme der gesellschaftlichen Gemeinschaft, der Kommunikation und Wissenschaft und der Wirtschaft
ein“ (ebd.: 228). Das politische System müsse vielmehr „symbitiosche“ Beziehungen
mit Prozessen anderer Teilsysteme eingehen und nicht nur nach dem eigenen Code
„mächtig“/ „machtlos“ verfahren, um steuern zu können (vgl. ebd.: 46 f.). Die Berücksichtigung solcher Beziehungen zeitige längere Entscheidungsprozesse, stärkere
Bindungskraft der Entscheidungen und v.a. eine stärkere Verkoppelung mit wirtschaftlichen Abhängigkeiten (vgl. ebd.: 47).
Politische Steuerung erfordere zu berücksichtigen, „daß die Institutionalisierung der
politischen Steuerung stets die Balance zwischen politischer Selbstreferenz und
Fremdreferenz zu halten hat, um Effektivität zu erzielen. Institutionenbildung in der
Interpenetrationszone zwischen Politik, Kultur, Gemeinschaftsleben und Wirtschaft
muß die gleichwertige Symbiose der politischen und nichtpolitischen Elemente erlauben und Übergewichte einzelner Elemente im Entscheidungsprozeß verhindern“
149
(ebd.). Auf diese Art und Weise ist politische Steuerung „so in einen Leistungsaustausch von gesellschaftlichen Teilsystemen eingefügt, der allein die systematische
Integration der Gesellschaft garantieren kann“ (ebd.: 72). Politische Steuerung erfolgt
somit nicht nur nach dem Code „mächtig/ machtlos“, sondern muss via Interpenetration auch die anderen Kommunikationsmedien wie Geld, Einfluss und Wertbindungen in Dienst nehmen (vgl. ebd.: 78); andernfalls würden Policies kaum verwirklicht
werden, denn „politische Steuerung ist ein Akt, der nur dann zum Erfolg gelangt,
wenn die Politik imstande ist, sowohl politische Macht als auch Geld, Einfluß und
Wertbindungen (Wahrheit) in ausreichendem Maß zu mobilisieren und einzusetzen“
(ebd.: 80). Ein politischer Faktorinput in andere Teilsysteme soll mittels politischer
Macht ökonomisches, solidarisches und kulturelles (wertebezogenes) Handeln bezüglich der anvisierten Policy ausrichten; ein politischer Produktoutput hingegen setzt
auf die Verwendung der Medien Geld, Einfluss und Wertbindungen, um in andere
Systeme einzugreifen und Steuerungsprozesse zu initiieren (vgl. ebd.: 82).
Je nach politischem Problem nähmen laut Münch unterschiedliche Akteure, die zudem verschieden organisiert seien und diverse Interessen ausbilden würden, an einem Steuerungsprozess teil. Zu analytischen Zwecken unterscheidet Münch nun
synthetisch-kooperative, kompetitive, etatistische und kompromissförmige Steuerungsarrangements und generiert hierzu jeweils ein „Steuerungsmodell“. Diese Modelle führt er mit Hilfe der vier Subsysteme „Politik“ (Macht), „gesellschaftliche Gemeinschaft“ (Enfluss), „Ökonomie“ (Geld) und „Kommunikationssystem/ Wissenschaft“ (Wahrheit) zusammen (vgl. ebd.: 181):
1. Synthesemodell: Dieses zeichnet sich durch stark gebündelte Interessen in
wenigen Großverbänden und deren engen Verknüpfung mit dem Staat aus
(vgl. ebd.: 182). Je nachdem, welche Seite „dominiert“, handelt es sich in der
Empirie um Korporatismus oder Staatskorporatismus. Münch sieht dieses Modell in der BRD verwirklicht. Verbände hätten hier einen großen Einfluss auf
politische Prozesse, Parteien oder Medien, der zumeist aus der Gewohnheit
resultiere. Dadurch werden jedoch spontane oder unorganisierte Interessen
vom politischen Geschehen ausgeschlossen; gleichsam kann das politische
System zum Spielball der Verbände mutieren. Politische Steuerung müsse
somit zwischen den beiden Extrempunkten „Herrschaft der Verbände“ oder
„Starker Staat ohne Berücksichtigung gesellschaftlicher Interessen“ lavieren;
es gilt, alle Interessen in einer Synthese zusammenzuführen. Zu diesem
150
Zweck stütze sich Politik vornehmlich auf die Wissenschaft als Vermittlungsinstanz und deren Leitwert „Wahrheit“. Allerdings gilt es zu berücksichtigen,
dass v.a. Umweltgruppen und Bürgerinitiativen erhebliche Zweifel an der Objektivität von Wissenschaft hegten (vgl. ebd.: 192).
2. Wettbewerbsmodell: Dieses Modell geht von einer Vielzahl partikularer, konkurrierender Verbände und einer entsprechenden Aufsplitterung des politischen Systems aus, wodurch viele Gesetzgebungsinitiativen verunmöglicht
würden. Exemplarisch nennt Münch die USA, in der Politik „im öffentlich ausgetragenen Kampf zwischen präsidialer Verwaltung, Kongreß, Regulierungsbehörden, Gerichten, Industrie, Wissenschaft, Umwelt- und Verbraucherorganisationen“ vollzogen wird (ebd.: 200). Einflussmöglichkeiten oder politische
Macht seien hier fragmentiert und unterliegen Schwankungen, sie müssten
deswegen unter Inkaufnahme von Kosten erworben werden. Parallel dazu
würde eine heterogene Zahl an wissenschaftlichen Instituten eine Vielzahl unverträglicher „Wahrheiten“ unter Berücksichtigung verschiedener Interessen
produzieren; die Instanzen des politischen Systems könnten sich je nach Interessenlage kompatible Wahrheiten herausnehmen (vgl. ebd.: 205 f.). Wissenschaft produziere damit keine dauerhafte Politik; die Übernahme ihrer Wahrheiten sorge vielmehr für neue Streitigkeiten. Vergleichbares gilt für die Wechselwirkung zwischen Geld und politischer Macht (vgl. ebd.: 208 f.).
3. Etatistisches Modell: Hier wird von einer heterogenen Gesellschaft mit sehr
verschiedenen Interessenlagen, die teils selbst heterogen seien, und einem
politischen System mit zersplittertem Parteiensystem, schwachem Parlament,
aber einem starken Präsidenten bzw. einer hervorgehobenen Zentrale und einer straffen Verwaltung ausgegangen (vgl. ebd.: 209). Exemplarisch hierfür
stehe laut Münch das politische System Frankreichs. Politische Steuerung ist
alleinige Aufgabe ebenjener Zentrale, wobei nur solche Projekte berücksichtigt
würden, die das Interesse der Regierung weckten. Der Einfluss der Verbände
würde von der Zentrale mehr oder minder zugestanden; sie würden gleichsam
instrumentalisiert (vgl. ebd.: 211). Wissenschaftliche Wahrheit wie auch Geld
würden hier i.d.R. in den Dienst der Technokratie gestellt; eine andere Rolle
nehme erstere gelegentlich als Kritikerin an der Politik ein (vgl. ebd.: 215 f.).
4. Kompromissmodell: In diesem Modell sind gesellschaftliche Interessen verhältnismäßig fragmentiert und uneinheitlich organisiert, etwa nach Berufs151
gruppen oder Spezialfunktionen; Verbände versammeln nur wenige Mitglieder
und haben demnach einen nur geringen Einfluss auf das politische System.
Dieses bestehe selbst aus diversen Instanzen und könne deswegen nicht „im
großen Stil“ mit den Verbänden kooperieren. Nach Münch würde etwa Großbritannien auf diese Art und Weise regiert. Gesellschaftliche Steuerung vollziehe sich hier in kleinteiligen, netzwerkartigen Arrangements zwischen Verbänden und politischem System. Konflikte würden in informellen Austauschbeziehungen durch Kompromisse beigelegt; meist handle es sich um die Befriedigung partikularer Interessen und nicht um die Lösung gesamtgesellschaftlicher Probleme. Einfluss und politische Macht verblieben in ihren jeweiligen Subsystemen (vgl. ebd.: 217 f.). Wissenschaftliche Wahrheiten würden
konservativ behandelt, u.a. um bereits existierende Kompromisse zu schonen
(vgl. ebd.: 221). Die Transformation von Geld und politischer Macht verlaufe
meist in zähen Auseinandersetzungen und vorsichtigem Vorgehen (vgl. ebd.:
224).
Hans-Peter Burth weist etwa darauf hin, dass dieses Konzept „mit dem staatstheoretischen Leitbild des ,Kooperativen Staates‘“ korrespondiere und dementsprechend
empirisch angemessen sei (Burth 1999: 118). Burth bewertet auch die ProduktFaktor-Theorie als eine angemessene Modellierung von Leistungsaustauschen zwischen Sozialsystemen. Auf den ersten Blick hat Münch mit dem Konzept der Interpenetration einen mittleren Weg zwischen dem Input-Output-Konzept und autopoietischer Abgeschlossenheit gefunden.
Dennoch hat sein Konzept zuhauf Kritik hervorgerufen. Münchs Modell sei latent
normativ, denn das poltische System würde nach wie vor als auf der Spitze einer
Steuerungshierarchie thronend betrachtet werden anstelle es den anderen Systemen
gleichzustellen (vgl. ebd.). Übersehen werden darf zudem nicht, dass Münch analytische und empirische Begriffe in seinem Modell parallel verwendet, so z.B. auf der
einen Seite „System“, „Faktor“ oder „Output“ und auf der anderen Seite „Verbände“
oder „Verwaltung“ - die analytische und empirische Ebene verschwimmen damit ineinander. Ferner „läßt sich die Tendenz zu einer mehr oder weniger harmonischen Interpenetration der sozialen Teilsysteme (ohne eine gewisse Dogmatik) nicht stringent
begründen; zum anderen verführt sie in empirischer Hinsicht dazu, das aus den Interessengegensätzen möglicherweise resultierende Konfliktpotential und die damit verbundene Steuerungsproblematik zu beschönigen“ (ebd.: 129).
152
Noch deutlicher wird Schweizer bei seiner Kritik an Münch: „Wer Neues erwartet,
wird in der üblichen münchschen Jargonhaftigkeit gleich zu Anfang unumstößlich
eines
Besseren
belehrt.
[…]
Was
folgt
ist
Altbekanntes:
Parsonsche
Vierfeldertabellen, abgewandelte AGIL-Schemen, Modelle politischer Steuerung und
last but not least Medienverwendungen und -banken“ (Schweizer 2003: 55 f.). In diesem Sinne habe Münch keine steuerungstheoretische Innovation, sondern allenfalls
eine marginale Erweiterung Parson’scher Grundüberlegungen geleistet (vgl. Schweizer 2008: 69). Desweiteren weist Schweizer darauf hin, dass Münch zwar die Bedeutsamkeit von Akteuren betont, aber ein ausgefeiltes Akteurskonzept aber in seinem Modell überhaupt nicht verwendet: „Um wissenschaftstheoretisch hoffähig zu
werden, müsste eine handlungstheoretische Fundierung der Konzepte erfolgen.
Durch ein Verharren auf der Makro-Ebene wird jeder steuerungstheoretische Gehalt
unweigerlich reduziert“ (Schweizer 2003: 57). Nicht zuletzt bietet Münch keine Erklärung, sondern vielmehr eine Beschreibung von Leistungsaustäuschen (vgl. Bergmann 2001: 46).
153
5. Moderne Steuerungskonzepte - PaS als „einer unter vielen“
Im Folgenden sollen Steuerungskonzepte vorgestellt werden, die in der Literatur häufig der Policy-Analyse zugeordnet werden. All diese Konzepte leugnen das Postulat
der Rationalitätskonzepte und der Staatstheorien, wonach der „Staat“ oder das „Politisch-administrative System“ als Steuerungszentrale fungieren und Steuerungsprozesse unter Missachtung des zu steuernden Gegenübers erfolgreich sein können.
Stattdessen wird das politisch-administrative System als „eines unter vielen“ betrachtet, das bezüglich seiner Ambitionen sehr wohl das Wirkgeflecht von Steuerungsprozessen beachten muss. Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist der PolicyCycle, mit dem als einem der ersten Ansätze das Policy-Making prozessual aufgeschlüsselt hat. Mit dem akteurzentrierten Institutionalismus folgt ein Ansatz, mit welchem Steuerungsprozesse durch Fokussierung auf eine jeweils besondere
Akteurkonstellation und einen spezifischen institutionellen Hintergrund untersucht
werden können. Im Anschluss werden Konzepte aus dem Bereich der Netzwerkanalyse bzw. -theorie vorgestellt, die das politisch-administrative System im Rahmen von
Steuerungsprozessen in einem netzwerkartigen Arrangement verorten. Zum Abschluss werden aktuelle Konzepte diskutiert, die i.d.R. unter dem Schlagwort „Governance“ subsumiert werden.
Während v.a. Rationalitätskonzepte und Staatstheorien teils einen expliziten normativen Charakter aufweisen, möchten Konzepte aus dem Bereich der Policy-Analyse
verstärkt analytisch, d.h. beschreibend und erklärend, verfahren (vgl. Héritier 1987: 8,
Howlett/ Ramesh 2003: 4). Nach Thomas Dye beschäfitgen sich solche Konzepte
damit, „what governments do, why they do it, and what difference it makes” (Dye
1976, zit. nach Schubert/ Bandelow 2009: 3). Eine grundlegende Neuausrichtung
erfuhr sie im Rahmen der Implementations- und Evaluationsforschung, die sich mit
der Frage befasste, ob Politik überhaupt einen Unterschied mache. An der PolicyAnalyse wurde zu dieser Zeit ihr vermeintlicher Charakter als ein Werkzeug der
Technokratie, die mangelnde empirische Bewährung ihrer steuerungstheoretischen
Hypothesen und die Unangemessenheit ihrer empfohlenen Instrumente kritisiert (vgl.
Héritier 1993: 10).
Zwar möchte Policy-Analyse heute v.a. Problemlösungen anbieten (vgl. Schneider/
Janning 2006: 216); allerdings finden ihre Ergebnisse anders als die Planungskonzepte zu Beginn der siebziger Jahre nur selten Niederschlag in der praktischen Politik (vgl. Schneider 2008: 55). Der Grund dafür läge auf der Hand: „In the real world of
154
public policy, technical superiority of analysis was often subordinated to political necessity“ (Howlett/ Ramesh 2003: 4). So darf es insgesamt nicht verwundern, wenn
von den folgenden Konzepten im politischen Alltag i.d.R. keines begegnet, was zu
bedauern ist, denn in der Summe „hat die Policy-Analyse bei der Untersuchung konkreter Politikfelder eine Vielzahl von Variablen aufgedeckt, die den Erfolg bzw. Mißerfolg politischer Programme bestimmen“ (Ulrich 1994: 41).
5.1 Policy-Cycle
Der Policy-Cycle stellt Politik als Policy-Making-Prozess dar. Dieser Prozess lässt
sich in verschiedene hintereinander geschaltete Phasen differenzieren. Vorausgegangen war eine doppelte Kritik an vorhergehenden Politikprozessvorstellungen:
Zum Einen lag der Schwerpunkt bislang eher auf der input-Seite, also auf Anforderungen und Unterstützungsleistungen. Nun sollte auch - in Easton’schen Worten - die
Black Box und die Output-Seite wie etwa Gesetze oder Programme in den Blickwinkel gerückt werden. Zum Anderen wurde die Verwaltung bis zu dieser Zeit aus formaler Perspektive betrachtet. Sie galt als ein rationales Instrument und arbeitete demnach nur gemäß rechtlichen Vorgaben. Dass aber auch Verwaltung Politik mitgestalten kann, wurde dabei übersehen (vgl. Jann/ Wegrich 2009: 77 f.).
Die theoretische Ausgangslage des Policy-Cycles kann eine geistige Nähe zu den
Rationalitätskonzepten kaum leugnen: „So wurde davon ausgegangen, daß klare
und
konsistente
Ziele
existieren,
adäquate
Kausaltheorien
über
Ursache-
Wirkungszusammenhänge vorliegen, ausreichende rechtliche Ressourcen und klare
Durchführungsstrukturen mit angemessener Ressourcenausstattung und motivierten
Beteiligten gegeben sind, die Unterstützung durch Interessengruppen verläßlich ist
und keine größeren Veränderungen in der sozioökonomischen Umgebung zu erwarten sind, also von Voraussetzungen ausgegangen, die nur in seltenen Fällen existieren“ (Héritier 1993: 11). Und an anderer Stelle: „The operative principle behind the
notion of the policy cycle is the logic of applied problem-solving“ (Howlett/ Ramesh
2003: 13). Der Policy-Cycle soll hier nur in aller Kürze vorgestellt werden (ausführlich
z.B. bei Gellner/ Hammer 2010: 56 ff., Jann/ Wegrich 2009: 75 ff., Schneider 2006:
48 ff., Schubert 1991: 69 ff.). In der Regel umfasst er sechs bestimmte Phasen:
1. Problemdefinition: Hier geht es um die Wahrnehmung und Bestimmung eines
Problems.
155
2. Agenda Setting: Diese Phase befasst sich mit Fragen danach, wann und wie
gesellschaftliche Probleme auf die politische Tagesordnung gelangen.
3. Politikformulierung: In diesem Abschnitt werden politische Vorschläge zur Lösung des Problems in konkrete Programme, Gesetze etc. gegossen.
4. Politikimplementierung: Anschließend werden die Policies umgesetzt bzw.
durchgeführt. Hier rückt dann auch die Verwaltung in den Blickpunkt.
5. Politikevauierung: Ob eine Policy effektiv und effizient gewirkt hat, wird in dieser Phase untersucht.
6. Politiktermination: Meint den Abschluss eines Policy-Making-Prozesses. Dieser kann, wenn das Problem gelöst ist, eine Beendigung bedeuten oder aber
auch als Misserfolg eine Aufgabe der Policy (vgl. Jann/ Wegrich 2009: 85 ff.).
Grafisch lassen sich diese Phasen so darstellen:
Abbildung 12: Policy-Cycle in Anlehnung an Jann/ Wegrich 2009: 86.
Zwar hat der Policy-Cycle das Wissen über komplexe Politikprozesse vermehrt und
systematisiert (vgl. ebd.: 104). Desweiteren hat er den Dualismus von System und
Akteur scheinbar überwunden: „Eine Stärke des Phasenmodells ist sicherlich seine
Abkehr vom strikten Institutionen- oder Akteursbezug“ (Blum 2009: 131). Er hat aber
dennoch zuhauf Kritik hervorgerufen. Beispielsweise entspreche die Konzeption des
Phasenmodells nur selten der Realität: Dem Policy-Cycle „liege ein schematisches
,Fließband-Produktionsmodell‘ zugrunde sowie eine zu starre Vorstellung von der
Abfolge der Phasen ,Problemdefinition, Agendagestaltung, Politikformulierung, Implementation und Feedback-Loop/ Evaluation‘, die sich in Wirklichkeit nicht funktional
156
getrennt und logisch aneinanderreihen, sich vielmehr überschneiden, wiederholen
und simultan verlaufen“ (Héritier 1993: 11). Offensichtlich ist, „dass es sich bei der
Zyklus-Metapher um nicht viel mehr als eine Utopie, eine Wunschvorstellung handelt,
die von der Realität selten bestätigt wird“ (Gellner/ Hammer 2010: 69). Daneben habe die Implementationsforschung das „Durcheinander“ realer Politikprozesse aufgedeckt, sei es in Bezug auf die Vernetzung der beteiligten Akteure oder auf die Zusammenhänge verschiedener politischer Maßnahmen. Ein auf dem Phasenmodell
gründender Instrumenteneinsatz müsse geradezu zwangsläufig ineffektiv sein (vgl.
ebd.: 12).
Aus demokratietheoretischer Perspektive wurde dem Phasenmodell und der PolicyAnalyse insgesamt vorgeworfen, eine technokratisch-instrumentelle Blickrichtung
einzunehmen, ohne demokratisch erarbeitete Alternativen oder den Makroeffekt von
Policies zu bedenken (vgl. ebd.: 14 f.). Zudem würde der Policy-Cycle eine hierarchische Top-Down-Perspektive vermitteln, die empirisch so nicht vorfindbar sei (vgl.
Jann/ Wegrich 2009: 103). Vernachlässigt würde zudem etwa symbolische oder rituelle Politik; Jann und Wegrich hierzu: „Insgesamt führt die Orientierung am Phasenmodell damit zu einem ,oversimplified‘, unrealistischen Weltbild. Policy-Making erscheint zu einfach, weil es nur darauf anzukommen scheint, Programme zu entwickeln und am Laufen zu halten. Verkannt wird, dass Policy-Making in aller Regel die
Modifikation bestehender Policies bedeutet und nicht die Entwicklung neuer Lösungen“ (ebd.). Analog dazu Howlett: „The principal disadvantage of this model is that it
can be misinterpreted as suggesting that policy-makers go about solving public problems in a very systematic and more or less linear fassion“ (Howlett/ Ramesh 2003:
14).
Daneben weisen Howlett und Ramesh darauf hin, dass es letztlich unklar sei, ob der
Policy-Cycle lediglich Regierungen oder auch weitere individuelle oder kollektive Akteure wie Organisationen in den Blick nimmt (vgl. ebd.). Sabatier weist zudem darauf
hin, dass es sich beim Phasenmodell um gar kein „Kausalmodell“ handelt: „Es mangelt an identifizierbaren Faktoren, die den Politikprozeß von einer Phase zur anderen
vorantreiben und die Aktivitäten innerhalb einer spezifischen Phase bedingen“ (Sabatier 1993a: 118). In diesem Sinne sei es eher als Heuristik zu gebrauchen, die einzelne Phasen postuliert, zu welchen dann phasenspezifische Untersuchungen basierend auf phasenspezifischen Teilmodellen durchgeführt werden sollten. So ließe sich
beispielsweise Robert W. Kingdons Policy-Window-Modell zur Untersuchung der
157
Agenda-Setting-Phase verweden. Schwierigkeiten bereitet dann, „dass die mehr oder
minder scharfe Trennung der einzelnen Phasen auch dazu geführt hat, dass die theoretischen Ansätze zu distinkt voneinander bleiben. […] Das übergeordnete Ziel,
nämlich Politikwandel bzw. die Frage zu beantworten, warum politische Akteure tun,
was sie tun, kann ein auf eine Phase beschränkter Ansatz daher auch immer nur partiell erreichen“ (Blum 2009: 131 f.).
In der Summe bietet der Policy-Cycle somit kein Modell, sondern allenfalls eine Heuristik, mit der politische Steuerungsprozesse in verschiedene Phasen differenziert
werden können - in diesem Sinne bietet er tatsächlich ein gewisses Innovationspotential. Allerdings sollte von steuerungstheoretischen Erklärungsleistungen hier nicht
gesprochen werden. Empirische Forschungsarbeiten können schließlich nur auf dessen Phaseneinteilung gründen; der Kreislauf an sich bietet keine empirischen Überprüfungsmöglichkeiten.
5.2 Renate Mayntz & Fritz W. Scharpf: Akteurzentrierter Institutionalismus
In den neunziger Jahren entwickelten Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf den
akteurzentrierten Institutionalismus (AzI). Mit dem AzI verfolgten die beiden Wissenschaftler das Ziel, einen Ausgleich zwischen ökonomischen und soziologischen Theorien herbeizuführen. Sowohl in der Betriebs- als auch in der Volkswirtschaftslehre
gehen die „klassischen“ Modelle davon aus, dass ökonomische Ergebnisse Folgen
individuellen Handelns seien; genauer: Folgen ökonomischen Handelns, wonach ein
„homo oeconomicus“ versucht, seine Interessen rational (Kosten-Nutzen-Kalkül) zu
erreichen. Die traditionellen soziologischen Erklärungsmodelle führten gesellschaftliche Veränderungen hingegen meist auf andere Makrophänomene zurück. Das geradezu klassische Beispiel hierfür ist der Versuch Max Webers, das Aufkommen des
Kapitalismus auf die Verbreitung des Protestantismus zurückzuführen.
Es geht somit um eine Verbindung von strukturellen und handlungstheoretischen Ansätzen. Im Kern besagt er, dass bei der Erklärung politischer Phänomene sowohl
Institutionen als auch Akteure zu betrachten seien. Zeitgleich verliert das Modell dadurch an Sparsamkeit, da es beide potentiellen Quellen von Veränderungen ins Visier nimmt (vgl. Scharpf 2000: 73 f.). Der Modellzweck besteht in der „Erklärung vergangener politischer Entscheidungen, um so systematisches Wissen zu gewinnen,
das der Praxis helfen könnte, realisierbare Problemlösungen zu entwickeln oder Insti158
tutionen zu entwerfen, die im allgemeinen die Formulierung und Implementation gemeinwohlorientierter Politik begünstigen“ (ebd.: 85). Berücksichtigt werden sollten
z.B. „Prozesse der Ausdifferenzierung der staatlichen Organisationsform, die Ausweitung der Staatsaufgaben, die ,Eigendynamik sozialer Prozesse‘ […], die Erhöhung
gesellschaftlicher Differenzierung als auch extern induzierte transnationale Herausforderungen […], die sich noch so ,guten‘ Steuerungsprogrammen entzogen, […] die
verschiedentlich übersehenen ,eigenen Interessen‘ staatlicher Institutionen, die aus
dem Postulat ,politischer Gesamtsteuerung‘ resultierenden Koordinationsprobleme
und ,Transaktionskosten‘ […] und die Kosten der Beschaffung und Bearbeitung von
Informationen, welche die Vorstellung einer Gesamtsteuerung zusätzlich verunmöglichten“ (Luthardt 1999: 158).
Beim AzI handelt es sich um einen Ansatz und eben kein Modell, d.h. er bietet keine
Kausalzusammenhänge und kann daher lediglich als Heuristik, also als Suchanleitung zur Erschließung der wichtigsten Erklärungsfaktoren, dienen: „Ansätze dagegen
liefern nur Hinweise für die Suche nach Erklärungen“ (ebd.: 75). Zu diesem Zweck
rückt der AzI die vier Größen „Institutionen“, „Akteure“, „Akteurskonstellationen“ und
„Interaktionsformen“ in den Untersuchungsmittelpunkt, was sich grafisch folgendermaßen verorten lässt:
159
Abbildung 13: Akteurzentrierter Institutionalismus nach Scharpf 2000: 85
In den Sozialwissenschaften existieren ganz verschiedene Definitionen des Begriffs
„Institution“. Dabei wird in allen gängigen Begriffsbestimmungen der Einfluss von
Institutionen auf das Verhalten der Akteure bejaht; das Ausmaß hingegen recht unterschiedlich bemessen (vgl. Holke 2005: 9). Demnach wird ein Spektrum mit den
beiden folgenden Extrema abgedeckt: Zum Einen ein enger Institutionenbegriff, wonach Akteurshandeln ausschließlich durch die Institutionen vorgegeben wird („rules
of the game“). Nach Fuchs sind Institutionen dann „auf Dauer gestellte Regelkomplexe, die das Handeln von Akteuren so steuern, dass regelmäßige Interaktionsmuster
entstehen und eine soziale Ordnung konstituieren“ (Fuchs 1999: 162). Zum anderen
ein weiter Institutionenbegriff: Hier treten kulturelle, normative und symbolische Elemente hinzu (Mayntz/ Scharpf 2000: 42), wodurch die Ursachen für das Handeln der
Akteure vielschichtiger werden. Institutionen sind laut Mayntz und Scharpf „Regelsysteme […], die einer Gruppe von Akteuren offenstehende Handlungsverläufe strukturieren […] [und] nicht nur formale rechtliche Regeln umfassen, […] sondern auch soziale Normen, die von den Akteuren im allgemeinen beachtet werden und deren Verletzung durch Reputationsverlust, soziale Mißbilligung, Entzug von Kooperation und
Belohnung oder sogar durch soziale Ächtung sanktioniert wird“ (ebd.: 77). Relevante
Institutionen sind dann diejenigen, die je nach Forschungsgebiet folgendermaßen
160
nicht-deterministischen Einfluss auf das Handeln der Akteure ausüben: „Institutionen
erleichtern oder beschränken daher nicht nur eine bestimmte Menge von Entscheidungen, sondern sie legen auch weitgehend fest, wie die Ergebnisse, die durch solche Entscheidungen erreicht werden, von den beteiligten Akteuren bewertet werden und sie bestimmen daher die Präferenzen der Akteure im Hinblick auf die möglichen
Optionen. Darüber hinaus üben institutionalisierte Verpflichtungen auch Einfluß auf
die Wahrnehmungen aus“ (ebd.: 79).
Mit dem akteurzentrierten Institutionalismus können daneben sowohl komplexe als
auch individuelle Akteure in die Untersuchung einbezogen werden. Komplexe Akteure sind etwa Koalitionen, Clubs, soziale Bewegungen und Verbände (vgl. ebd.:
102). Akteure zeichnen sich laut Scharpf durch ganz bestimmte Eigenschaften aus.
Erstens durch Fähigkeiten in Form persönlicher Handlungsressourcen: Dazu gehören persönliche Merkmale, etwa Stärke, Intelligenz oder Sozialkapital, materielle
Ressourcen wie Geld oder Land, technologische Ressourcen, privilegierter Informationszugang und v.a. institutionellen Regeln. Wahrnehmungen und Präferenzen sind
zweitens Handlungsorientierungen, die sowohl stabil als auch veränderbar sein können. Wahrnehmungen sind kognitive Orientierungen; hier geht es um die Wahrnehmung der gegebenen Situation und ihrer kausalen Struktur, potentieller Handlungsoptionen und erwartbarer Ergebnisse. Motivationale Orientierungen bzw. Präferenzen können analytisch in Interessen, Normen, Identitäten und Interaktionsorientierungen gegliedert werden (vgl. Mayntz/ Scharpf 1995: 53 f.). Interessen meinen v.a.
Eigeninteressen in Bezug auf die eigene Autonomie oder gar das Überleben. Normen können sowohl Bedingungen als auch Zwecke von Handlungen entscheidend
beeinflussen. Die Identität eines Akteures erleichtert eigene Entscheidungen und
macht den Akteur für Außenstehende durchsichtiger (vgl. Scharpf 2000: 117 ff.). Beide - kognitive und motivationale Handlungsorientierungen - werden von der jeweiligen sozialen Rolle abgeleitet, die ein Akteur einnimmt. Problematisch dabei ist, dass
Akteure erstens zwei und mehr Rollen einnehmen können und damit Rollenkonflikte
provozieren und zweitens individuelle Eigeninteressen nicht gänzlich übersehen
werden dürfen (vgl. ebd.: 112 f.). Die Beschreibung der Akteure mit Hilfe dieser Charakteristika hat für die weitere Modellierung insofern Folgen, als dass sich das Handeln der Akteure modelltheoretisch eben nicht nur an institutionellen Vorgaben ausrichtet. Vielmehr haben auch ihre persönlichen Eigenschaften Einfluss auf ihr Verhal-
161
ten. Der AzI liefert mit diesen Eigenschaften Hinweise, auf was bei der Beschreibung
der Akteure geachtet werden kann bzw. soll.
Akteure bewegen sich zudem in Konstellationen. Der Begriff der Akteurskonstellation „beschreibt die beteiligten Spieler, ihre Strategieoptionen, die mit den verschiedenen Strategieoptionen verbundenen Ergebnisse und die Präferenzen der Spieler in
Bezug auf diese Ergebnisse“ (ebd.: 87). Scharpf empfiehlt zur Rekonstruktion der
Akteurskonstellationen wie auch zur daran anschließenden Modellierung des Entscheidungsprozesses die Spieltheorie. Die Beschreibung der realen Akteurskonstellationen ermöglicht einen Vergleich verschiedener Akteursbeziehungen auf hohem
Abstraktionsniveau, und setzt in die Lage, das jeweilige Konfliktniveau zu ermitteln
und unterschiedliche Konfliktarten gegenüberzustellen.
Policies gehen jedoch nicht aus den Akteurskonstellationen, sondern aus den Interaktionen hervor. Sie sind „das Produkt strategischer Interaktionen zwischen mehreren oder einer Vielzahl politischer Akteure […], von denen jeder ein eigenes Verständnis von der Natur des Problems und der Realisierbarkeit bestimmter Lösungen
hat, und die weiter mit je eigenen individuellen und institutionellen Eigeninteressen
sowie normativen Präferenzen und eigenen Handlungsressourcen ausgestattet sind“
(ebd.: 34).
Welche Interaktionsvariante vorrangig Verwendung findet, wird durch den institutionellen Kontext beeinflusst. Zur Beschreibung des institutionellen Kontextes verwendet Scharpf die Begriffe „Anarchisches Feld“, „Netzwerk“, „Verband“, und „Organisation“. Soll eine Entscheidung z.B. in einem anarchischem Feld getroffen werden, ist
einseitiges Handeln in Form eines nichtkooperativen Spiels die mutmaßlichste Variante. In einem Netzwerk hingegen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Policies in
Form von Verhandlungen produziert werden. Im jeweiligen Kontext können folgende
Interaktionsformen angewendet werden:
162
Institutioneller Kontext
Einseitiges
Handeln
Verhandlung
Mehrheitsentscheidung
Hierarchische
Steuerung
Anarchisches
Feld
Netzwerk
Verband
Organisation
X
X
X
X
(X)
X
X
X
-
-
X
X
-
-
-
X
Tabelle 3: Koordinationsformen nach Scharpf 2000: 91.
Mayntz und Scharpf gelingt es mit dem akteurzentrierten Institutionalismus, die institutionelle Ebene mit der Akteursebene zu versöhnen. Es gilt, dass „der institutionelle
Rahmen das Handeln von Organisationen prägt, während diese ihrerseits für das
Handeln der Mitglieder den institutionellen Rahmen bilden“ (ebd.: 42). Akteure werden i.d.R. zur Vereinfachung der Analyse als kollektive Akteure modelliert. Bei Bedarf
ist eine Rückkehr auf die individuelle Ebene jedoch durchaus möglich (vgl. ebd.: 35).
Keiner der Ebenen kommt dabei ein Übergewicht zu.
Dennoch: Der AzI besitzt keine Erklärungskraft, sondern ist vielmehr eine Heuristik,
die auf steuerungstheoretisch relevante Faktoren - Institutionen, Akteure, Konstellationen und Interaktionen - hinweist. Insofern kann er höchstens als Ausgangspunkt
der Konzeption eines Steuerungsmodells dienen oder Beschreibungen in einigermaßen gesicherte Bahnen lenken. Zur Erklärung bedarf es jedoch weiterer Teilmodelle,
die modulartig in diese Heuristik eingesetzt werden. Eine solche Weiterentwicklung
hat z.B. Dirk Koob vorgenommen, der meint, dass „der akteurzentrierte Institutionalismus von Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf als geeignete, die komplexe Realität
ordnend strukturierende Heuristik hinsichtlich einer steuerungstheoretischen PolicyAnalyse klassifiziert werden“ könne (Koob 1999: 177). Koob substituiert erstens den
von Mayntz und Scharpf favorisierten Kooperationsansatz durch Überlegungen aus
dem Rational-Choice-Komplex, wobei er unterstellt, Mayntz und Scharpf hätten diesen zugunsten eines homo sociologicus falsch interpretiert (vgl. ebd.: 178). So meint
er, dass das „Koordinationsbedürfnis moderner Gesellschaften […] also auch im Verständnis des akteurzentrierten Institutionalismus durchaus über die Nutzenmaximierung kollektiver Akteure herstellbar“ sei (ebd.: 179). Nutzenmaximierende Überlegungen können jedoch laut Koob in Anlehnung an Uwe Schimank durch Interessen
163
der Erwartungs- und Orientierungssicherheit, der Vertrauensbeziehungen und der
Autonomie und Wahrung des Besitzstandes beeinflusst bzw. beschränkt werden (vgl.
ebd.). Zweitens möchte Koob die Wahrnehmungen des betrachteten Akteurs im Politikfeld und damit die Umweltwirkungen der Selbststeuerungsmechanismen dieses
Akteurs in den Vordergrund rücken.
Stefan Schweizer kritisiert an Koobs Modell zunächst dessen Begründung für die
Wahl des RC-Ansatzes. Laut Koob würde in modernen Gesellschaften Kooperation
hauptsächlich durch Eigeninteresse und somit Nutzenmaximierung gefördert.
Schweizer hierzu: „Diese Begründung ist wenig wissenschaftstheoretisch und eher
pragmatisch“ (Schweizer 2003: 70). Desweiteren wundert sich Schweizer darüber,
dass auch Koob die Mikroebene eher stiefmütterlich behandelt. Zwar würde der Kooperationsantrieb der Individuen bei Koob mit dem RC-Ansatz erklärt, allerdings verzichte er dann auf die Wahl einer geeigneten Handlungstheorie: „Wissenschaftstheoretisch merk- und fragwürdig bleibt, dass auch in der modifizierten Modellvariante
das Individuum als eigentlicher Entscheidungs- und Handlungsträger ausgeblendet
bleibt“ (ebd.). Nicht zuletzt bemängelt Schweizer, „dass keine wissenschaftstheoretisch plausible Modellierung sozialer Prozesse, wie sie zum Beispiel durch das Modell der soziologischen Erklärung nach Coleman bzw. Esser vorgenommen werden
kann, stattfindet. Dieser Schritt sei unabdingbar, wenn man ein theoretisch anspruchsvolles, operationalisierbares sowie auch empirisch gehaltvolles Erklärungsmodell soziopolitischer Steuerung erhalten möchte“ (ebd.: 71). Wie also soziale Prozesse und damit Steuerungsvorgänge vonstattengehen, bleibt auch bei Koob relativ
vage angedeutet. Nicht zuletzt bietet der AzI in seinen Varianten kein kausal modelliertes Erklärungsmodell, nach welchem in dieser Arbeit gesucht wird.
5.3 Steuerungskonzepte der Netzwerkanalyse bzw. -theorie
Die Netzwerkanalyse bzw. Netzwerktheorie zählt zu den jüngeren Konzepten der
Policy-Forschung. Zunächst ein paar begriffliche Präzisierungen: In Deutschland findet der Begriff „Netzwerkforschung“ anstelle von „social network analysis“ breite
Verwendung, um klarzustellen, dass nicht nur soziale Netze untersucht werden können. Konzepte aus diesem ereich finden z.B. auch in der Kommunikationsforschung,
der Informatik, der Soziologie, den Wirtschaftswissenschaften, der Ethnologie, den
Geschichtswissenschaften und nicht zuletzt in der Politikwissenschaft Verwendung
(vgl. Schnegg 2010: 55). So würden etwa Ingenieure bei der Untersuchung von
164
Stromnetzen auf die Methoden der Netzwerkforschung zurückgreifen (vgl. Stegbauer
2008a: 12). Diese multidisziplinäre Ausrichtung weist auf die vielschichtigen Wurzeln
des Konzepts hin, die etwa in der Soziologie, der Mathematik, der Physik und der
Psychologie zu finden sind. Zu unterscheiden sind ferner die Begriffe „Netzwerkanalyse“ und „Netzwerktheorie“ mit sich jeweils ergänzenden Forschungsinteressen: „Bei
der Analyse sozialer Netzwerke […] handelt es sich sowohl um eine Reihe von formalen Verfahren zur Analyse von Beziehungen zwischen Akteuren und deren Mustern als auch um eine Theorieperspektive auf eben solche Beziehungen“ (Haas/
Mützel 2008: 49). Netzwerkanalyse bezeichnet also den methodischen Baukasten,
während Netzwerktheorie als eine Perspektive auf bestimmte soziale Sachverhalte
bezeichnet werden kann. Diese Unterscheidung gilt es v.a. in Deutschland zu wahren: „Während in den USA viel stärker die Analysetechniken im Vordergrund stehen,
kommt im deutschsprachigen Gebiet, stärker als dies im internationalen Bereich üblich, eine Theoriedebatte hinzu“ (Stegbauer 2008a: 13).
In Deutschland werden Netzwerkkonzepte seit ca. 25 Jahren entwickelt und angewendet. Anfangs noch stark strukturalistisch ausgerichtet, wurden in der Zwischenzeit weitere Konzepte wie etwa das Sozialkapital oder die Idee der strukturellen Löcher in die Diskussion aufgenommen (vgl. Haas/ Mützel 2008: 57 f.). Christian Stegbauer weist darauf hin, dass die Netzwerktheorie gerade in Deutschland eine große
Diskussionsfreude ausgelöst habe, weil sich hier strukturalistisch und individualistisch orientierte Sozialwissenschaftler nicht ganz so verbissen gegenüber stünden
(vgl. Stegbauer 2008a: 14). So sieht er deren Besonderheit darin belegt, „dass der
Beziehungskontext, die Beziehungsstruktur in die Analysen miteinbezogen wird.
Meist werden in der klassischen Umfrageforschung die Menschen dekontextualisiert“
(ebd.: 11). In diesem Sinne kann die Netzwerkforschung als eine Weiterentwicklung
des oder sogar als eine Kritik am Behaviouralismus gesehen werden, der sehr anfällig für Fehler sei, wie die zahlreichen Beispiele misslungener Wahlprognosen zeigten
(vgl. Liepelt 2008: 24). Gerade die Umfrageforschung sei etwa im Hinblick auf die
Fixierung auf einzelne Personen, das Festhalten am Zufallsprinzip und die Unterstellung, Individuen handelten grundsätzlich rational, besonders störanfällig (vgl. ebd.:
27 f.).
Netzwerkansätze gründen auf einer Vielzahl an unterschiedlichen Methoden, die
heute in der Regel computergestützt sind. Dazu zählen erstens graphische Darstellungen, die auf der Verbundenheit (operationalisiert als mathematisch transformierte
165
Distanzen) der Akteure fußt. Zweitens können Netzwerke in Matrizen erfasst werden.
Daten zu Netzwerken können durch Beobachtung oder Befragung ermittelt werden
(vgl. Holzer 2006: 39 ff.).
Laut Klaus Liepelt lägen dem Emporkommen der sozialen Netzwerkforschung fünf
Aspekte zugrunde. Das sei erstens die Feststellung, dass Individuen durch Kommunikation und Interaktion ihre Einstellungen änderten oder anders handelten. Besonderes Gewicht erhalte diese Erkenntnis dadurch, dass Individuen i.d.R. in mehrere
soziale Netzwerke teils sehr eng eingebunden seien. Zweitens gerieten zunehmend
sogenannte „Relevanzsprünge“ in den Blickpunkt der Forschung. Damit werden all
diejenigen zufälligen Ereignisse, spontanen Prozesse, Gegebenheiten und Gelegenheiten bezeichnet, die soziale Konstellationen eben nicht intentional variierten. Drittens gehörten all jene neuen Instrumente und Theorien dazu, die von den ersten
Netzwerkforschern entwickelt und angewandt worden waren und gleichsam soziale
Biotope in den Blickpunkt rückten. Viertens nennt Liepelt die Erkenntnis, wonach jede Person eben kein einheitliches Individuum sei, sondern aus einer Vielzahl an
Identitäten bestehe, die je nach sozialer Umgebung zum Vorschein komme. Fünftens
und letztens handle es sich um die Anerkennung des Umstands, wonach moderne
Gesellschaften aus einer schier unendlichen Vielzahl sozialer Netzwerke bestünden
und selbst wiederum miteinander vernetzt seien (vgl. Liepelt 2008: 29 ff.).
Diesen innovativen Gedanken würde die Netzwerkforschung gerecht werden, denn
sie „bietet theoretisch wie methodisch andere Möglichkeiten, jene Identitäten, die das
Geschehen in den untersuchten Bereichen tatsächlich bestimmen, empirisch aufzuspüren und äquivalent zusammenzuführen. Schon weil die Person als Komponente
in mehreren Identitäten auftritt, die ihrerseits mit benachbarten Einheiten interagieren
und die zusammen in größere Verbünde eingebettet sind, werden nicht Personen
oder Personengruppen, sondern die jeweils relevanten Segmente der sozialen Organisation durch entsprechende Kombinationsverfahren ermittelt. Daher ist es zunächst irrelevant, ob eine Person in diesen Segmenten einmal oder mehrmals – in
verschiedenen Rollen – oder auch gar nicht auftritt“ (Liepelt 2008: 40). Allerdings
würde der Informationsbedarf dadurch enorm gesteigert, sodass erst mit dem Aufkommen moderner Computerprogramme größere Netzwerke ins Visier genommen
wurden (vgl. Krempel 2008: 217).
In der Summe geht es der Netzwerkforschung um „die Beziehungen zwischen Akteuren, seien es Menschen oder Organisationen, konkret die Strukturen und Inhalte die166
ser Beziehungen sowie die Konsequenzen, die sich aus diesen Struktureigenschaften für die Akteure ergeben“ (Kropp 2008: 145). Der Modellzweck sämtlicher Netzwerkansätze liegt damit in der Erforschung der Beziehungsmuster in modernen Gesellschaften.
Um zu verstehen, wie Netzwerkkonzepte als Steuerungskonzepte verwendet werden
können, sollen zunächst begriffliche Grundlagen geklärt werden, bevor dann drei
spezifische Ansätze bzw. Konzepte aus diesem Bereich - Ronald Burts strukturelle
Handlungstheorie, Mark Granovetters Embeddedness-Konzept und der SozialkapitalAnsatz - vorgestellt werden. Abschließend geht es um Policy-Netzwerke, also die
Integration von Netzwerkansätzen in die politikwissenschaftliche Steuerungsdebatte.
Diese ausführliche Diskussion wird sich spätestens dann als sinnvoll erweisen, wenn
Governance-Konzepte diskutiert werden - auch hier taucht der Netzwerk-Begriff wieder auf.
5.3.1 Bestandteile von Netzwerkansätzen
Ein Netzwerk wird definiert „als eine abgegrenzte Menge von Knoten oder Elementen
und der Menge der zwischen ihnen verlaufenden sogenannten Kanten“ (Jansen
2006: 58). Jansen weist an dieser Stelle darauf hin, dass Netzwerke „relationsspezifisch“ seien. Von daher könne ein Netzwerk auch so verstanden werden, „dass es
eine spezifische Relation ist, die über eine Menge von Elementen definiert ist“ (ebd.).
Abgesehen von dem Begriff der „Funktion“ weist diese Definition Ähnlichkeiten mit
der allgemeinen Definition (sozialer) System auf, die ja bekanntlich aus Elementen
bestünden, welche über Strukturen relational und prozessual verbunden seien. Mit
Hilfe von Netzwerkansätzen soll die Struktur- mit der Akteursebene verbunden werden: „Ziel ist es, sie [die Struktur, der Verf.] für die Erklärung individuellen Handelns
heranzuziehen und die Entstehung bzw. Veränderung von Strukturen über individuelles Handeln zu erklären“ (ebd.: 13). Wie etwa beim akteurzentrierten Institutionalismus wird hier davon ausgegangen, dass sich Akteure und Strukturen gegenseitig
bedingen.
Zunächst sollen ein paar begriffliche Grundlagen gelegt werden. Prinzipiell untersucht die Netzwerkforschung unterschiedliche Merkmalsträger und damit unterschiedliche Merkmalstypen, von denen Jansen zunächst individuell begründete von
kollektiven Merkmalen unterscheidet (vgl. Jansen 2006: 53 ff.):
167
Zu den individuell begründeten Merkmalen: Absolute Merkmale als kontextunabhängige Konstanten sind beispielsweise das Alter oder das Geschlecht. Relationale
Merkmale hingegen bezeichnen eine Beziehung zwischen mindestens zwei Elementen eines Netzwerks, etwa eine Handelsbeziehung oder eine Freundschaft, sind damit kontextabhängig und können beispielsweise durch Transaktionen, Kommunikation, macht- oder gefühlsorientierte Einstellungen entstehen und nach ihrer Gerichtetheit oder ihrer Intensität hin untersucht werden (vgl. ebd.: 59). Komparative Merkmale können dann erhoben werden, wenn vergleichbare Merkmale sowohl auf individueller als auch kollektiver Ebene vorliegen. Bekanntestes Beispiel ist etwa der Vergleich des Einkommens einer Person mit dem Durchschnittseinkommen einer Gruppe. Kontextuelle Merkmale sind solche, die zwar für Individuen gelten, jedoch aus
deren Kontext hervorgehen (vgl. ebd.: 56 ff.). So können z.B. Bürger der westlichen
Industriestaaten jeweils als reich angesehen werden, da ihre Länder in der Summe
ein hohes durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen aufweisen.
Kollektive Merkmale hingegen können auf drei verschiedene Merkmalstypen hin untersucht werden. Analytische Merkmale ergeben sich aus statistischen Umformungen
von Individualdaten, etwa Mittelwerte oder Streuungsmaße. Strukturelle Merkmale
ergeben sich aus den Relationen der Individuen wie z.B. die Freundschaftsdichte.
Globale Merkmale hingegen sind nicht auf individuelle Ebene zurückführbar; Jansen
nennt hierfür exemplarisch die Nutzung von Geld als Tauschmedium. Damit wird
deutlich, dass in der Netzwerkanalyse sowohl quantitative als auch qualitative Merkmale untersucht werden können (vgl. Hollstein 2006.: ff.).
In der Netzwerkforschung können abgesehen vom einzelnen Element fünf verschiedene Analyseebenen betrachtet werden (vgl. Jansen 2006: 60 ff.). Eine Dyade besteht aus nur zwei verschiedenen Einheiten und bildet damit die kleinstmögliche Einheit. Hier geht es v.a. um die Gerichtetheit von Beziehungen. Triaden hingegen bestehen aus drei Knoten und rücken somit Fragen nach der Transitivität und Hierarchie in Netzwerken in den Vordergrund. Richtet man nun den Blick auf größere Zusammenhänge in einem Netzwerk, kann das zum Einen mit Ego-zentrierten Netzwerken geschehen. Ausgehend von einem „Ego“ (also einem einzigen Akteur) werden andere Akteure („Alteri“) ermittelt, die in Beziehung zu eben diesem Akteur stehen. Das Netzwerk setzt sich dann aus Beziehungen zwischen Ego und Alteri und
zwischen den verschiedenen Alteri zusammen. Die bekannteste auf egozentrierten
Netzwerken basierende Arbeit stammt von Rainer Diaz-Bone, der mit diesem Kon168
zept die Modernisierung familialer Netzwerkbeziehungen untersucht hat (Diaz-Bone
1997). Alternativ dazu können ausschnittsweise Gruppen bestimmter Netzwerke betrachtet werden; ein Beispiel hierfür ist das Cliquenkonzept. Letztens können Netzwerke in ihrer Gesamtheit untersucht werden (Gesamtnetzwerke), was etwa im
Hinlick auf die Dichte eines Netzwerkes oder auf komplexere Strukturen sinnvoll ist.
Besonders in Bezug auf Gesamtnetzwerke wird dann die Frage relevant, wie solche
Netzwerke abgegrenzt werden können bzw. welche Akteure und Beziehungstypen
dazu gehören und welche nicht (vgl. ebd.: 72).
Mit den positiv verbundenen Einflussnetzwerken und den negativ verbundenen
Tauschnetzwerken können grundsätzlich zwei Typen an Netzwerken unterschieden
werden. Einflussnetzwerke sind typischerweise zentralitätsfixiert und verwenden die
hierfür entwickelten Maße (s.u.). Demnach sei „der Status und die Macht eines Akteurs um so größer, je größer die Zahl seiner Außenbeziehungen ist und je mächtiger
seine Kontaktakteure ihrerseits sind“ (ebd.: 163). Komplementarität und Additivität
sind die Hauptmerkmale dieses Typs. Ein ressourcenbasiertes Tauschnetzwerk geht
hingegen der Frage nach, „welchen Abhängigkeiten und Zwängen er [der Akteur, der
Verf.] unterliegt bzw. welche Abhängigkeiten anderer er ausbeuten kann. […] [Es, der
Verf.] macht das Fehlen von strukturellen Zwängen und die Ausbeutbarkeit struktureller Löcher zu einem Indikator für Macht (ebd.)“. Hier geht es somit um Konkurrenz
und strukturelle Autonomie - Akteure sind dann umso mächtiger, je machtloser bzw.
beziehungsärmer ihre Bezugspersonen sind bzw. je größer ihre Kontrolle über knappe Ressourcen ist (vgl. ebd.: 164). Einfluss- und Tauschnetzwerke differenzieren
damit v.a. in ihrer Vorstellung von der Macht eines Akteurs.
5.3.2 Ronald Burts strukturalistische Handlungstheorie
Ronald Burt entwickelte eine strukturelle Handlungstheorie, wonach sich Akteure und
Strukturen gegenseitig beeinflussen. Sein Modell lässt sich mit den folgenden vier
Grundannahmen zusammenfassen:
1. Auf der Makroebene modelliert Burt die Gesellschaft als eine stratifizierte Sozialstruktur zur Bewertung der Position eines Akteurs.
2. Die Interessen eines Akteurs werden durch die Sozialstruktur in ihrer Entwicklung beeinflusst.
3. Die Constraints einer Handlung entstehen durch die Position in der Sozialstruktur und den daraus abgeleiteten Interessen.
169
4. Mit ihren Handlungen beeinflussen die Akteure die Sozialstruktur und verändern sie ggf. (vgl. Burt 1982: 10).
Insgesamt ergibt sich damit folgende graphische Darstellung:
Abbildung 13: Burts strukturelle Handlungstheorie (nach Burt 1982: 9).
Burts Ansatz kann als „instrumenteller Relationalismus“ bezeichnet werden, da er
„Rational Choice als Handlungstheorie und relational begründete Constraints und
Optionen im Sinne einer Situationslogik“ verbindet (Jansen 2006: 25). Damit lehnt er
es ab, soziales Handeln sowohl aus Eigeninteressen heraus als auch durch Normen
(wie z.B. bei Parsons) zu erklären. Handeln wird vielmehr durch ein Zusammenspiel
der eigenen Position, die als Status- bzw. Rollenset verstanden werden kann, mit der
relationalen Sozialstruktur erklärbar (vgl. Beckert 2005: 295). Zugleich behält er Bausteine der Rational-Chocie-Theorie bei, u.a. die Ansicht, dass Akteure ihren Nutzen
maximieren möchten.
5.3.3 Mark Granovetters Konzept des „Embeddedness“
Mark Granovetters Ansatz nimmt die „Embeddedness“ (Eingebundenheit) von Akteuren ins Visier. Ausgehend von Thomas Hobbes‘ Ordnungsproblematik stellt er zwei
Akteursmodelle gegenüber. Erstens den homo sociologicus, der sich aufgrund erfolgreicher Sozialisation und Normenverinnerlichung adäquat verhalte. Zweitens den
homo oeconomicus, der sein Handeln auf Eigeninteressen und eben nicht sozialen
Beschränkungen gründe (vgl. Granovetter 1985: 483 ff.). Dorothea Jansen weist darauf hin, dass in beiden Modellen der Akteur isoliert dargestellt sei: „Das untersozialisierte Akteurkonzept tut dies, indem es ein eng am Selbstinteresse orientiertes Handeln unterstellt. Das übersozialisierte Modell des Strukturfunktionalismus muss sich
diesen Vorwurf gefallen lassen, weil Verhalten als durch einmal internalisierte Nor170
men determiniert gedacht wird, relativ unabhängig vom aktuellen sozialen Kontext“
(Jansen 2006: 20). Granovetters Konzept der Eingebettetheit betont stattdessen die
sozialen Kontexte, welche Eigeninteressen und Normen relativieren würden, d.h.
Handlungen würden immer aus sozialen Relationen hervorgehen (vgl. Granovetter
1985: 487 ff.).
Plausibel scheint zunächst die Annahme, dass diejenigen Akteure in Netzwerken
besonders machtvoll sind, die eine zentrale Position einnehmen. Zur Untersuchung
solcher Positionen wurde eine ganze Reihe an Maßen entwickelt, die hier nur angedeutet werden können. Auf der Mikroebene kann etwa der „Degree“ ermittelt werden,
welcher über die Eingebundenheit dieses Akteurs Auskunft gibt. Gezählt werden hier
die direkten Beziehungen eines Akteurs. Unterschieden werden je nach Gerichtetheit
der Beziehung Indegrees und Outdegrees (vgl. ebd.: 95 f.). In Gesamtnetzwerken
kann z.B. die Kohäsion untersucht werden: Je mehr Akteure miteinander verbunden
sind, desto stärker ist die Kohäsion in diesem Netzwerk (vgl. ebd.: 105 ff.).
Angewandt hat Granovetter diesen Ansatz in einer Untersuchung darüber, wie Arbeitnehmer an Informationen über zukünftige Stellen gelangen. Das Resultat lautete,
dass die meisten Arbeitsstellen über persönliche Kontakte oder Mund-zu-MundPropaganda besetzt und eben nicht durch Stellenanzeigen bzw. gezielte Suche vermittelt würden (vgl. Granovetter 1995: 3 ff.). Dies läge erstens an der begrenzten Informationsverarbeitungskapazität von Unternehmen, die daher lieber auf Kontakte
anstatt formale und langwierige Bewerbungsverfahren zurückgriffen. Zweitens würde
die Verarbeitung von Unmengen an Informationen zu viel Geld kosten. Drittens und
letztens seien viele Informationen seitens der potentiellen Arbeitnehmer schlicht unglaubwürdig (vgl. ebd.: 97 ff.).
Jobs würden stattdessen v.a. durch lockere Sozialstrukturen vermittelt; Granovetter
postuliert damit die Stärke schwacher Beziehungen, denn nur über sie würden neue
und interessante Informationen bzw. Stellen mitgeteilt. Seiner Studie gemäß waren
es gerade nicht die persönlichen Kontakte zu Freunden, Familienangehörigen oder
anderen über „strong ties“ Bekannten, sondern die durch „weak ties“ hergestellten
Kontakte, die gutbezahlte Jobs vermittelten. Es existieren jedoch auch Studien, die
postulieren, dass strong ties aus Gründen der Solidarität eher zur Vermittlung eines
Arbeitsplatzes hergezogen würden (vgl. Beckert 2005: 293).
Granovetters Konzept hat demnach trotz seiner mutmaßlich bahnbrechenden Erkenntnisse auch Kritik erfahren: „So wichtig Granovetters Konzeption für die Erklä171
rung von Informationsflüssen auch sein mag, gerade die Einfachheit, die einerseits
eine unkomplizierte Operationalisierung der Betrachtungen zulässt, begrenzt die Anwendung des Konzeptes andererseits“ (Stegbauer 2008b: 107). Daneben meint
Stegbauer, dass „Granovetters Unterscheidung zwischen ,strong‘ und ,weak‘ verkennt, […] dass man zwischen einer Reihe ,enger‘ Beziehungen mit ganz verschiedenem Beziehungscharakter unterscheiden kann“ (Stegbauer 2008b: 110). So ließen
sich strong ties zwischen Familienangehörigen, Lebenspartnern oder Freunden vollkommen unterschiedlich operationalisieren. Fragen diesbezüglich könnten etwa sein,
ob und inwieweit man sich gegenseitig hilft, über welche Themen - Arbeit, Hobbies
oder Privatleben - Gespräche geführt werden oder sich sogar gegenseitig Geld leiht.
Allein von der „Stärke“ einer Beziehung zu reden, ist diesbezüglich mit Sicherheit zu
wenig differenzierend. Diese Kritik wurde v.a. von Harrison White aufgenommen, der
nicht nur verschiedene Beziehungstypen herausstellte, sondern auch die Asymmetrie
einer Beziehung zwischen zwei Personen betonte. Beziehungen seien nach White
mehrdimensional, flexibel und dynamisch, jedoch nicht beliebig. Nur selten könne
man von Dyaden ausgehen; der Regelfall sei vielmehr eine ausgeprägte Vernetzung.
Handlungseinheit ist bei White nicht der Akteur, sondern ein kleines soziales Aggregat wie etwa eine Kleinstgruppe oder eine Partnerschaft (vgl. ebd.: 113 ff.). Whites
Ansatz kann als “relationaler Konstruktivismus” bezeichnet werden, denn er „betont
die Konstruktion und Wirkung von Identitäten und Institutionen in sozialen Einbettungen“ (Jansen 2006: 25).
5.3.4 Ronald Burts Konzept des strukturellen Lochs
Ronald Burt knüpfte an die Überlegungen Mark Granovetters an und entwickelte
hierzu den Begriff des „strukturellen Lochs“, der neben dem bekannten Informationsaspekt folgendermaßen verwendet wird: Zunächst geht es um die Frage nach Kontrollvorteilen durch bestimmte Strukturarrangements in Netzwerken, den daraus verbundenen Handlungsvor- und nachteilen und um die Gestaltbarkeit dieser Strukturen
zur Erlangung eines breiten Potentials an Ressourcen. Desweiteren bezeichnet Burt
die Struktur der Netzwerke als Ursache für eine Ungleichverteilung von Handlungsressourcen, die insbesondere durch die Unerreichbarkeit einzelner Akteure untereinander entsteht. Dabei geht es nicht mehr um starke Beziehungen, sondern um das
Überbrücken strukturellen Löcher, z.B. zwischen zwei autonomen Abteilungen, um
172
Handlungsmöglichkeiten zu gewinnen, etwa in Form von Kontrollmöglichkeiten, Informationen oder einer zunehmenden Sichtbarkeit (vgl. Beckert 2005: 299).
Burt stellt nun eine zentrale Hypothese auf, wie diese Form des Sozialkapitals optimiert werden könne: Dies könne demnach dadurch geschehen, dass „Akteure möglichst viele strukturelle Löcher überbrücken und zugleich nicht selbst auf Makler zwischen Netzwerkclustern angewiesen sind. Im Idealfall erreichen sie eine Position der
strukturellen Autonomie“, indem sie maklerfrei eine Vielzahl an Netzwerkclustern
durch jeweils eine Kontaktperson erreichen (Burt 1992: 8 ff.).
Burts grundlegendes Konzept sieht dann so aus, „dass ein Akteur um so mehr strukturelle Autonomie genießt, je diversifizierter seine eigenen Außenbeziehungen zu
Akteuren mit anderen Netzwerkpositionen sind, je schlechter die Chancen dieser
Akteurgruppen ihrerseits zu Absprache und kollektiver Aktion sind, und je besser die
Chancen für die eigene Akteurgruppe ist, die Zwänge von Austauschbarkeit und
Konkurrenz untereinander in den Griff zu bekommen“ (vgl. Jansen 2006: 187). Burt
sieht strukturelle Autonomie gerade dann gefährdet, je stärker der Akteur in direkte
und indirekte Beziehungen investiert, die ihrerseits stark miteinander verbunden sind
- solche Netzwerke seien redundant (vgl. Jansen 2006: 255). Deshalb setzt er an die
Ergebnisse Granovetters an und behauptet, dass sich soziales Kapital bei einem Akteur genau dann in hohem Maße bildet, wenn er über weak ties strukturelle Löcher
zwischen mehreren Clustern engerer Beziehungen miteinander verbindet (vgl. Burt
1982: 44). Die Überbrückung struktureller Löcher zeitigt für den Akteur einen hohen
Informationsgrad in Form von Zugangsmöglichkeiten, Timing und Empfehlungen und
Kontrollmöglichkeiten über bestimmte Handlungen.
5.3.5 Sozialkapital
Eine besondere Entwicklung innerhalb der Netzwerkansätze stellt das Konzept des
Sozialkapitals dar. Dieses soll den individuellen Akteuren einen breiteren Handlungsrahmen eröffnen; „Netzwerke sind damit ein Wettbewerbsfaktor auf der Ebene von
Einzelakteuren, von Akteursgruppen oder ganzen Gesellschaften“ (Jansen 2006:
26). Sozialkapital kann laut Jansen nur bedingt intentional hergestellt werden; meist
entstünde es „nebenbei“. Daneben habe es eine positive Konnotation; negatives Sozialkapital könnten bestimmte Handlungsbarrieren oder Zwänge sein. Anders als
ökonomisches oder humanes Kapital ist Sozialkapital von den Beziehungen eines
Akteurs abhängig, somit relational konstituiert und äußerst dynamisch. Jansen meint
173
sogar, mit dem Sozialkapitalkonzept könne die Lücke zwischen Makro- und Mikroebene geschlossen werden (vgl. ebd.: 27) - ein Anspruch, den ja Netzwerkansätze
generell für sich reklamieren.
Die Diskussion rund um das Thema Sozialkapital richtet sich „auf die unterschiedlichen Grundlagen sozialen Kapitals, das Ausmaß des in einer Gesellschaft zirkulierenden sozialen Kapitals, seine differentielle Verteilung und die Brauchbarkeit der
verschiedenen Kapitalformen in unterschiedlichen Kontexten und für unterschiedliche
Probleme“ (ebd.). Jansen unterscheidet in der Summe sechs Faktoren, die das Sozialkapital eines Akteurs ausmachen können: Erstens Familien- und Gruppensolidarität, die auf starken und engen Beziehungen beruht, zugleich aber die Gefahr einer
Polarisation verschiedener Gruppen birgt. Zweitens Vertrauen in die Geltung universalistischer Normen, etwa gute Sitten oder eine bestimmte Handelsmoral, was Handlungssicherheit verschaffen soll. Drittens Information, wobei sich dieser Faktor v.a.
auf die Untersuchungen Granovetters stützt. Viertens Macht durch strukturelle Autonomie, die etwa dann entsteht, wenn ein Akteur im Sinne Burts strukturelle Löcher
verbinden kann. Fünftens Selbstorganisationsfähigkeit von Kollektiven (Hierarchisierung und Stratifizierung), z.B. zur Bekämpfung eines Dritten oder zur Abschottung
gegenüber einem potentiellen Konkurrenten. Sechstens und letztens Macht durch
sozialen Einfluss, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn es um die Sicherung
von Loyalität und den Aufbau kollektiver Identitäten geht (vgl. ebd.: 28 ff.). Bei dieser
Aufzählung handelt es sich laut Jansen um das Ergebnis einer Literaturrecherche;
einzelne Forschungsarbeiten formulieren ihre Vorstellung von Sozialkapital meist in
Anlehnung an einen oder zwei dieser Faktoren. Insbesondere ist noch unterbelichtet,
ob diese Faktoren evtl. miteinander kausal zusammenhängen (vgl. Marx 2010: 99).
5.3.6 Zwischenfazit
Die exemplarisch vorgestellten Konzepte oder Ansätze dienen der Untersuchung
netzwerkartiger Arrangements. Möchte Steuerungstheorie Regelungsprozesse als
Netzwerke betrachten, dann muss sie sich dieses Methodenrepertoires bedienen.
Eine „Steuerungstheorie“ entsteht dann nicht ohne jeglichen theoretischen Hintergrund, sondern bedarf einer angemessenen Indienstnahme oder Verknüpfung solcher Teilkonzepte im Rahmen von Policy-Netzwerken. Exemplarisch hierfür kann
etwa Stefan Schweizers Werk zur Verknüpfung der Autopoiesetheorie mit Konzepten
aus dem Bereich der Netzwerktheorie genannt werden (Schweizer 2003). Politische
174
Steuerung erfolgt dann etwa über in Netzwerken vonstattengehende Tauschprozesse oder durch die Vermittlung prominenter Akteure. Abschließend werden noch Policy-Netzwerke als genuin politikwissenschaftliche Netzwerkansätze vorgestellt.
5.3.7 Policy-Netzwerke
Der Zuwachs an Interdependenzen und eine zunehmende Akkumulation von Ressourcen bei gesellschaftlichen Organisationen zwingt Politik zunehmend zu einem
Handeln in netzwerkartigen Arrangements: „Weil staatliche Ressourcen und Organisationskapazitäten mit diesen Auswirkungen sozialer Differenzierung nicht Schritt
halten und staatliche Akteure zunehmend unfähig werden, die notwendigen Ressourcen für die Produktion von Politiken (Formulierung und Durchsetzung) selbständig zu garantieren, wird der traditionelle Parlaments- und Regierungskomplex in zunehmendem Maße abhängig von der Kooperation und der kollektiven Ressourcenmobilisierung nichtstaatlicher, privater Akteure. Kooperation ist jedoch nicht zu erzwingen, was staatliche Akteure zu Verhandlungen mit solchen gesellschaftlichen
Machtgruppen zwingt“ (Schneider 2004: 7). Weitere Gründe für die Entwicklung dieses Konzepts seien Defizite hierarchischer Steuerung, die Ausweitung der Staatstätigkeit und die damit einhergehende Ausdifferenzierung des PaS, ein enormer Zuwachs und eine Bedeutungszunahme nichtstaatlicher korporativer Akteure, die Globalisierung und eine durch das Internet beschleunigte Diffusion des Denkens (vgl.
ebd.: 14 f.).
U.a. aus diesen Gründen findet der Policy-Netzwerk-Ansatz „auf allen Ebenen der
Politikformulierungund -implementation: von der kommunal-regionalen […], der nationalen […], der europäischen […] bis hin zur internationalen Ebene“ (Kenis/ Raab
2008: 132) Verwendung, etwa „1. als Instrument zur Klassifizierung der Beziehungsmuster zwischen staatlichen und gesellschaftlichen Akteuren sowie 2. als neue Erscheinungsform politischer Steuerung“ (Knill 2000: 113). Policy-Netzwerke würden
einem besonderen Umstand gerecht: „Anstatt von einer zentralen Autorität hervorgebracht zu werden, sei dies die Regierung oder die gesetzgebende Gewalt, entsteht
Politik heute oft in einem Prozeß, in den eine Vielzahl von sowohl öffentlichen als
auch privaten Organisationen eingebunden ist“ (Mayntz 1993: 241).
Arthur Benz versteht Policy-Netzwerke „als relativ dauerhafte, nicht formal organisierte, durch wechselseitige Abhängigkeiten, gemeinsame Verhaltenserwartungen und
Orientierungen sowie Vertrauensbeziehungen stabilisierte Kommunikationsstrukturen
175
zwischen Individuen oder Organisationen, die dem Informationsaustausch, der kooperativen Produktion eines Kollektivgutes oder der gemeinsamen Interessenformulierung dienen“ (Benz 1995: 195). Er unterstellt generell drei Motive, die zur Entstehung von Policy-Netzwerken führen. Akteure „versuchen zum einen, ihre eigene
Macht angesichts von Tendenzen einer Hierarchisierung von Entscheidungsstrukturen zu sichern; zum zweiten bemühen sie sich um den Abbau von Unsicherheit in
Mehrebenenstrukturen; zum dritten suchen sie nach konsensfähigen Lösungsalternativen bzw. Verständigungmöglichkeiten, die in formalisierten Verhandlungskontexten nicht erkennbar oder formulierbar sind“ (Benz 1995: 195).
Laut Franz Urban Pappi können Policy-Netzwerke erstens „relativ neutral als durch
Beziehungen eines bestimmten Typs verbundene Akteure verstanden werden“
(Pappi 1993: 84). Inhaltlich können sie zweitens konkretisiert werden „als besondere
Erscheinungsform der Interessenvertretung oder der Politiksteuerung“ (ebd.). Drittens und letztens ist Pappi der Ansicht, man könne „Politikfelder als Sozialsysteme
mit einer als Netzwerk beschreibbaren Struktur“ erfassen (ebd.: 85).
Zum ersten Punkt: Pappi weist auf die Vorzüge hin, die eine relationale Betrachtung
von Politikfeldern mit sich brächte. Entscheidend seien Interaktionen wie Kommunikation oder Tauschprozesse. Einheiten solcher Netzwerke können Organisationen
oder Individuen sein, die laut Pappi prinzipiell voneinander unabhängig seien (vgl.
ebd.: 87).
Zum zweiten Punkt: Pappi „geht davon aus, daß wir es hier mit einer besonderen
Erscheinungsform von Interessengruppeneinfluß auf die Politik oder von politischer
Steuerung zu tun haben, die nur in politischen Systemen auftritt“ (ebd.: 88). Dahinter
steckt die Vorstellung, dass in modernen Gesellschaften Organisationen einen gewichtigen Platz bei der Herstellung und Durchsetzung von Policies einnehmen: „Politische Steuerung ist, vor allem im Bereich der Implementation von Politiken, nur noch
in netzwerkartigen Gebilden durchsetzbar, in die die mächtigen privaten Akteure mit
eingebunden sind“ (ebd.). Spätestens mit netzwerktheoretischen Ansätzen hat sich
die Steuerungsdebatte vom viel zitierten Steuermann, der das Staatsschiff allein auf
Kurs hält, somit verabschiedet. Laut Pappi könne der Begriff des Policy-Netzwerks
auch allgemeiner verstanden werden, indem man schlicht die Beziehungen zwischen
Organisationen und Netzwerken ins Visier nimmt und nicht nur die steuerungstheoretische Komponente. Interessant sei dann die Frage, was für Typen an Policy-Netzen
identifiziert werden könnten.
176
Zum dritten Punkt: Pappi fordert, zunächst zu untersuchende Systeme auszuwählen
und sich erst dann für eine Beschreibungsmethode festzulegen (vgl. ebd.: 90). Politikfelder können laut Pappi „als soziale Einheiten oder Sozialsysteme konstruiert
werden, deren Struktur dann mit Hilfe der Netzwerkanalyse analysierbar ist“ (ebd.:
91). In dieser Hinsicht orientiert sich Pappi an Burstein, der Politikfelder als Teilbereiche des politischen Systems modelliert, die sich mit inhaltlichen Themen beschäftigen: „Die Abgrenzung eines Systems kann zum einen nach inhaltlichen Kriterien aus
der Sicht des jeweiligen Forschers vorgenommen werden, die Abgrenzung kann als
Konstrukt der beteiligten Akteure zustandekommen oder sie kann kulturell erfolgen“
(ebd.). Die Folge dieser Ausdifferenzierung autonomer Teilsysteme sei eine Ausweitung von Staatstätigkeit und eine Spezialisierung teilgebietsspezifischer Politikformulierung. Politikfelder können somit zunächst analytisch postuliert oder als soziale
bzw. kulturelle Konstrukte abgegrenzt werden.
Z.B. im Fall kultureller Konstrukte ließe sich bei der Modellierung auf Parsons Systemtheorie zurückgreifen. In dessen Systemtheorie würden Akteursmengen auf
Grundlage eines geteilten Symbolsystems interagieren; „dieses gemeinsame Symbolsystem ist in Politikfeldern häufig ein bestimmtes für das Politikfeld herausragendes Gesetzeswerk wie z.B. das Sozialgesetzbuch für die deutsche Sozialpolitik. Solche Symbolsysteme garantieren Gemeinsamkeiten der Problemsicht, die die Interaktionen der Beteiligten erleichtern, ohne daß sie Interessenkonflikte hinsichtlich der
konkreten Policies verhinderten“ (ebd.). Die Folge seien nun Interaktionen, „die für
das Politikfeld als Ganzes Sinn machen, weil sie z.B. Investitionen in soziale Beziehungen darstellen, die nicht eng auf bestimmte Policies bezogen sind. Andererseits
können zwei Akteure eine Koalition zur Durchsetzung einer bestimmten Policy eingehen“ (Ebd.). Allgemeine Interaktionen zeitigen nach Pappi Politikfeld-Netze; Interaktionen zur Durchsetzung einer bestimmten Policy hingegen Policy-Netze. Die
Auswahl der Akteure muss je nach der entsprechenden Phase im Policy-Zyklus erfolgen. Es geht somit um die Systemabgrenzung und die Art der institutionellen Arena.
Kenis plädiert zusammengefasst dafür, „immer dann von einem Netzwerk zu sprechen, wenn mehrere interdependente Organisationen oder deren Teile als Kollektiv
bewusst oder unbewusst ihre Handlungen aufeinander abstimmen und damit Effekte
auf der kollektiven Ebene erzeugen. Im Falle von Politiknetzwerken sind die kollektiven Sachverhalte dabei öffentliche Politiken, die über das eigentliche Netzwerk hin177
aus auf der gesellschaftlichen Ebene ebenfalls Effekte erzeugen. Dabei sind die Akteure nicht lediglich formell innerhalb eines größeren hierarchischen Arrangements
einander über- oder untergeordnet“ (Kenis 2008: 134). Netzwerke werden somit als
unabhängige Variable bei der Beschreibung oder Erklärung des Zustandekommens
einer Policy betrachtet. All jenen Netzwerkansätzen „ist dabei eine relationale Perspektive gemeinsam, d. h. ein Fokus auf die im Politikprozess relevanten Akteure,
deren Interessen und insbesondere deren Beziehungen untereinander als zentrale
Erklärungsfaktoren für den Verlauf sowie den Output bzw. Outcome politischer Prozesse. Der Politiknetzwerkansatz nimmt daher eine Mittelposition zwischen
,undersocialized approaches‘ wie etwa Rational Choice und ,oversocialized approaches‘ wie etwa marxistischen Ansätzen oder der Systemtheorie ein“ (ebd.: 132). Policy-Netzwerke gründen also nicht auf formalen Institutionen, sondern „werden danach
als in einzelnen Politiksektoren bestehende Verhandlungssysteme zwischen staatlichen und privaten Akteuren verstanden, welche durch Institutionen sowie eingeschliffene Verhaltensmuster und Tauschprozesse zwischen den Akteuren einen gewissen
Grad an interaktiver und struktureller Stabilität erlangen. […] Ein Policy-Netzwerk ist
also ein analytisches Konstrukt, das unter der Perspektive definiert wird, wie für einen
begrenzten
Regelungsgegenstand
(z.B.
Telekommunikations-
oder
Luftreinhaltepolitik) kollektiv verbindliche politische Entscheidungen hergestellt werden können“ (Knill 2000: 112).
5.3.8 Fazit
Netzwerkansätze haben sich in den Augen einiger Autoren als kompatibel mit einer
großen Zahl anderer soziologischer Theorien erwiesen. Dies läge hauptsächlich an
ihrer Fähigkeit, Makro- und Mikroebene verknüpfen zu können. Per Kropp weist darauf hin, dass der Netzwerkansatz kompatibel mit dem Makro-Mikro-MakroErklärungsschema James Colemans sei, genauer mit einer Variation des Schemas
von Lars Udehn (vgl. Kropp 2008: 148). Auf der Makroebene würden demnach nicht
nur Institutionen, sondern strukturelle bzw. relationale Arrangements von Individuen
verortet. Auf der Mikroebene würde ein entsprechendes Akteursmodell zu wählen
sein, um das Handeln der Akteure erklären zu können. In dieser Hinsicht bedarf der
Netzwerkansatz dann weiterer Spezifikationen. Zumindest kann man dem Netzwerkansatz nach diesem Kompatibilitätstest zu Gute halten, dass er modernen methodologischen Standards gerecht werden kann, denn „das Potential des Paradigmas be178
steht darin, die Kluft zwischen Mikro- und Makroperspektiven der Sozialwissenschaften zu füllen“ (Krempel 2008: 224).
Zeitgleich könne ihm diese Stärke auch als eine Schwäche ausgelegt werden, denn
„wer nach allen Seiten offen ist, kann bekanntlich nicht ganz dicht sein. Demnach
hätte es die Netzwerkanalyse bis heute versäumt, eine eigene Theoriebasis zu entwickeln“ (Holzer 2006: 73). Ähnlich dazu Patrick Kenis: „Der Fokus auf die
Governanceebene führte weiter dazu, dass wir bisher kaum Fortschritte im Hinblick
auf eine Netzwerktheorie von Politik gemacht haben (Netzwerk als Explanans), […]
in der Netzwerkeigenschaften die unabhängige und Effektivität, Legitimität, Innovation, etc. von öffentlicher Politik die abhängige Variable darstellen“ (Kenis 2008: 139).
Zu klären sei v.a., welche verschiedenen Ergebnisse unterschiedliche Formen von
Netzwerken zeitigen könnten - eine Netzwerktypologie müsse demnach erst noch
entwickelt werden. Und Boris Holzer zum gleichen Sachverhalt: „Mehr Programm
denn Theorie scheint die SNA [soziale Netzwerkanalyse, der Verf.] eine eher lose
Ansammlung von Forschungsinteressen und Erklärungsprämissen zu sein. […] Nach
wie vor spielen in der SNA formale und forschungspragmatische Fragen eine größere Rolle als die Entwicklung und Präzisierung von Theorien und Konzepten“ (Holzer
2010: 79).
Laut Boris Holzer gebe es in dieser Hinsicht zwei vielversprechende Ansätze. Der
erste Ansatz versuche, aus dem empirischen Forschungsprogramm der Netzwerkanalyse heraus eine Netzwerktheorie zu entwickeln. Die Wissenschaftler dieses Ansatzes vertreten die Ansicht, dass es die Position der Akteure in einem Netzwerk sei,
die ihr Handeln bestimme oder zumindest entscheidend präge. Der zweite Ansatz
möchte mit Hilfe bestehender Theorien soziale Netzwerke beschreiben. So wurden
und werden Netzwerke beispielsweise als Nachfolger der Systemtheorien bzw. von
Systemen, als eigenständiger Systemtyp oder als Bindeglied zwischen Systemen
betrachtet (vgl. Holzer 2006: 93 ff.).
Laut Jens Beckert hätten Burt und Granovetter wichtige Einsichten zur Erklärung individueller Handlungsmöglichkeiten und von Diffusionsprozessen geliefert. Gleichzeitig müssten ihre Konzepte jedoch in mehreren Punkten kritisiert werden. Erstens
würden individuelle Einstellungen und Eigenschaften der Akteure bei der Erklärung
von Handeln unterbelichtet bleiben. Zweitens würde nach wie vor eine handlungstheoretische Engführung auf RC-Theorien vorherrschen und damit Kultur und Moral
als handlungsleitende Faktoren ausblenden. Drittens würde die Netzwerkanalyse mit
179
ihrer Vorstellung von Relation eine tiefengründige Struktur a la Claude Lévi-Strauss
übersehen. So seien etwa Mythen individuell unabhängig und dennoch strukturell
manifest (vgl. Beckert 2005: 301 ff.). In eine ähnliche Richtung stößt die Kritik, wonach netzwerkanalytische Ansätze i.d.R. auf die Berücksichtigung von Ideen, Symbolen etc. verzichteten. Dabei könnten diese Faktoren in den Augen einiger Wissenschaftler die Erklärungskraft von Netzwerken deutlich steigern: „Damit dies gelingt,
muss sich die netzwerkanalytische Forschungstradition öffnen und neben den relationalen Faktoren, die Handlungsorientierungen und Handlungschancen von Akteuren
prägen, auch symbolische und kulturelle Faktoren und deren Institutionalisierung
einbeziehen“ (Jansen 2006: 15).
Schließlich ist es netzwerkanalytischen bzw. -theoretischen Ansätzen aus steuerungstheoretischer Perspektive nicht gelungen, ein komplexes Erklärungsmodell politischer Steuerung zu entwickeln. Wenn immer davon die Rede ist, Policies würden in
modernen Gesellschaften in netzwerkartigen Arrangements ausgehandelt oder durch
Einflusspotentiale erwirkt, dann ist damit letztlich nur gesagt, wie eine Policy generiert wird. Bestenfalls ließe sich noch zeigen, dass auch die Umsetzung einer Policy
Netzwerke benötigt bzw. dass traditionelle hierarchisch angelegte Verwaltungen nicht
einmal mehr die Implementation von Policies gewährleisten können. Gesucht wird
jedoch ein Erklärungsmodell, das auf einer eindeutigen theoretischen Grundlage basiert und auf diesem Fundament komplexe Steuerungsarrangements in den Untersuchungsfokus rückt. Denn die Annahme, Policies würden durch Netzwerke generiert,
bietet selbstverständlich keinerlei Aussagen darüber, wie solche Policies letztlich wirken. Dabei sollten sich moderne Steuerungstheorien auch Gedanken über Steuerungswirkungen oder -effekte machen, wie dies etwa systemtheoretische Varianten
vornehmen.
5.4 Governance
5.4.1 Was meint „Governance“?
Wohl kaum ein Begriff hat die Debatte in der Politikwissenschaft in den vergangenen
beiden Jahrzehnten so geprägt wie „Governance“, dessen Wurzeln in der wirtschaftswissenschaftlichen Institutionenökonomik und in den politikwissenschaftlichen
Gebieten „Internationale Beziehungen“ und „Policy-Forschung“ liegen (vgl. Benz et.
al. 2007: 11). Was „Governance” meint, lässt sich nur näherungsweise beschreiben,
denn in der Literatur findet sich keine allgemein akzeptierte Begriffsbestimmung:
180
„Auch nach mehr als 15 Jahren Konjunktur hat sich bis heute weder eine präzise Definition von Governance noch eine einheitliche Verwendung normativer oder empirischer Ausrichtung entwickelt“ (von Blumenthal 2005: 1149). Dabei beschränkten
„sich die Antworten häufig auf ein begriffliches Tasten, ein Probieren und Abwägen
und auf den schließlichen Hinweis, dass inzwischen zwar schon einige der drängenden Probleme einer Governancetheorie angegangen worden seien und dass sich ein
gemeinsames Verständnis fachübergreifend herauskristallisiere, dass das Proprium
der Governanceforschung aber endgültig erst noch gefunden werden müsse“ ( De La
Rosa/ Kötter 2008: 12). Das ist umso erstaunlicher, weil es sich dabei um einen in
der Politikwissenschaft geradezu dominierenden Begriff handelt. Nicht zu Unrecht hat
von daher Arthur Benz die Vermutung angestellt, „dass es sich hierbei um einen Modeausdruck handelt, der Altes lediglich in ein Neues Gewand kleidet? […] Neuen Bezeichnungen sollte man mit Skepsis begegnen, vor allem dann, wenn sie plötzlich in
aller Munde sind und in vielen Bereichen Verwendung finden, keiner aber so genau
definieren kann, was eigentlich damit gemeint ist“ (Benz/ Dose 2010: 13).
Governance umfasst recht grob sämtliche moderne Regierungsformen, die sich vom
klassischen Regieren unterscheiden lassen: „Während Government auf den Bereich
des formalen Entscheidens innerhalb der Verfassungsinstitutionen zielt und in erster
Linie die einseitige staatliche Steuerung vorrangig durch Setzung verbindlichen
Rechts impliziert, weist Governance auf ein Zusammenspiel verschiedener staatlicher wie nichtstaatlicher Akteure hin, das in unterschiedlicher Ausprägung auftritt, in
der Regel jedoch eine Komponente der Verständigung oder des Verhandelns aufweist. Der zentrale Unterschied liegt dabei weniger in den Ergebnissen als vielmehr
in der Ausgestaltung des Prozesses“ (von Blumenthal 2005: 1151). Eine ähnlich vage Definition bieten De La Rosa und Kötter, wonach es der Governanceforschung
„um die (Re-)Konstruktion komplexer Gesellschaftsstrukturen mit Blick auf (1) bestimmte kollektive Leistungen, die (2) von bestimmten Akteuren (3) in einer bestimmten Weise erbracht werden“, gehe (De La Rosa/ Kötter 2008: 13). Präzisiert würde
diese Definition auf folgende Art und Weise: „Wer als Governance-Akteur und was
als Governance-Leistung gilt, ist jeweils eine Frage der Empirie“ (ebd.). In der Summe geht es darum, „die Interdependenzen zwischen Akteuren und die verschiedenen
Formen der Interdependenzbewältigung im Kontext von Institutionen und gesellschaftlichen Teilsystemen in den Mittelpunkt“ zu rücken“ (Benz et. al. 2007: 16). Und
an anderer Stelle heißt es, es „gewinnt die Einsicht mehr und mehr an Boden, dass
181
die Ordnung des Zusammenwirkens öffentlicher und privater Handlungskompetenz
eines der Zentralprobleme des modernen Verwaltungsstaates sein dürfte“ (Schuppert
2008: 20).
5.4.2 Governance-„Theorie“ und politische Steuerung
In der Literatur ist es üblich, Governance von politischer Steuerung zu unterscheiden.
Von Blumenthal weist darauf hin, dass die klassische Steuerungsdebatte trotz aller
gesellschaftlichen Umbrüche den Staat bzw. das politische System nach wie vor als
zentralen Lenker verstehe. Governance hingegen rücke verschiedene Formen der
Kooperation in den Blickwinkel: Es gehe nunmehr darum, „nicht-hierarchische Formen von Problemlösungen bis hin zu gesellschaftlicher Selbstregelung stärker in den
Blick zu nehmen“ (von Blumenthal 2005: 1171). Genschel und Zangl stellen fest, der
Staat wandle „sich vom ,Herrschaftsmonopolisten‘, der alles Herrschaftshandeln exklusiv für sich beansprucht, zu einem ,Herrschaftsmanager‘, der die Herrschaftsakte
nicht-staatlicher Akteure aktiviert, komplementiert und synchronisiert, ohne sie freilich
bis in die Einzelheiten kontrollieren oder steuern zu können“ (Genschel/ Zangl 2008:
431). Ob „Governance“ tatsächlich als erstes politikwissenschaftliches Konzept das
politisch-administrative System aus dem Zentrum von Steuerungsprozessen herausnimmt, bleibt jedoch fraglich, wenn man etwa an Netzwerkansätze oder den
akteurzentrierten Institutionalismus denkt.
Renate Mayntz meint, Governance-Theorie [sic!] sei „keine einfache Fortentwicklung
im Rahmen des steuerungstheoretischen Paradigmas; sie befaßt sich mit einem eigenen Satz von Fragen und lenkt dabei das Augenmerk auf andere Aspekte der
Wirklichkeit als die Steuerungstheorie“ (Mayntz 2005: 11); Schuppert bezeichnet dies
als „Perspektivenerweiterung“, die nun zu den staatlichen Akteuren Regelungsstrukturen gesellt (Schuppert 2011: 19). Darüber hinaus seien beide Konzepte auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt: Steuerungskonzepte, -modelle oder -theorien seien zumeist für nationalstaatliche Zwecke entwickelt worden, Governance-Konzepte
eher für supranationale Ebenen (vgl. Mayntz 2005: 13 f.). Ferner sei im Rahmen von
Governance kaum noch eine Unterscheidung zwischen Steuerungssubjekt und
Steuerungsobjekt möglich, was Begriffe wie „staatliche Akteure“ anstelle von „der
Staat“ demonstrierten (vgl. ebd.: 15). Dabei übersieht Mayntz gerade mit dem letzten
Punkt die gesamte Steuerungsdebatte über autopoietische Systemtheorien, die eine
solche kausaldeterministische Verbindung von Subjekt und Objekt ebenfalls vernein182
ten. Schließlich sei das Governance-Konzept eher institutionalistisch, Steuerungstheorie hingegen akteursorientiert ausgerichtet. (vgl.ebd.: 16). Allerdings muss auch
diese Feststellung in Frage gestellt werden, wenn man sich einmal die in dieser Arbeit vorgestellten Steuerungskonzepte in Erinnerung ruft. In der Summe „sind die
Unterschiede zwischen der Steuerungs- und der Governance-Perspektive doch so
deutlich, dass es sich zwar nicht um einen Paradigmenwechsel, sondern um eine
Verschiebung der Perspektive handelt, die jedoch mehr umfasst als einen bloßen
Wechsel des Etiketts“ (von Blumenthal 2005: 1173).
5.4.3 Funktionen von Governance
Gunnar Folke Schuppert bestimmt sieben Funktionen, die von GovernanceKonzepten erfüllt würden. Erstens hätten sie eine Brückenfunktion inne, die eine
Verbindung unterschiedlicher politikwissenschaftlicher Subdisziplinen ermöglichten.
Zweitens fungierten Governance-Konzepte als Reformstrategie, wenn es beispielsweise um die Veränderung von Strukturen und inhaltlichen Vorstellungen in der Verwaltung gehe. Allerdings möchte Schuppert den Schwerpunkt von Governance eher
auf dessen analytische Möglichkeiten setzen (vgl. Schuppert 2011: 16). Drittens sei
Governance nach Schuppert ein Schlüsselbegriff, mit dem man „neue Denkbahnen
aufschließen und Assoziationsräume eröffnen […] [und] neuartige Entwicklungen
oder auch Brüche markieren“ könne (ebd.: 17). „Aufschließen“ und „Markieren“ beziehen sich laut Schuppert auf den Wandel der Staatlichkeit, der v.a. mit dem Governance-Konzept erstmals sprachlich präzise erfasst werden könne. Viertens könne
Governance als Meta-Ebene verstanden werden, mit deren Hilfe es gelinge, z.B. verschiedene Governance-Modi (auch Mischtypen), verschiedene Politikfelder, unterschiedliche Strukturen bis hin zu Mehrebenensystemen zu betrachten (vgl. ebd.: 26).
Fünftens bezeichnet Schuppert Governance als Entstaatlichungsstrategie, wobei mit
zunehmender Enge der Begriffsdefinition der Staatsgehalt des GovernanceKonzepts zunehmend reduziert würde. Sechstens sieht Schuppert GovernanceKonzepte als geeignet, transnationale Rechtsprozesse zu flankieren und zu steuern.
Damit meint er, dass Governance auf globaler Ebene zunehmend verrechtlicht und
damit dessen rechtsfreier Raum aufgelöst würde (vgl. ebd.: 37 f.). Siebtens und letztens sieht Schuppert in der Literatur Hinweise, wonach Governance ein Regierungskonzept ist, dass ursprünglich aus den OECD-Staaten stamme und auf Entwicklungsländer übertragen werden sollte. Analog zu Governance als Reformstrategie
183
betont Schuppert auch hier, dass Governance eher als analytische denn als normative Perspektive zu verstehen sei (vgl. ebd.: 42).
5.4.4 Eine Begriffsannäherung
Zur näheren Bestimmung des Begriffs Governance bestehen verschiedene Vorgehensweisen. Im Folgenden werden verschiedene Konzeptionen des GovernanceBegriffs dargestellt, die meist entlang eines binären Begriffsschemas verortet werden.
5.4.4.1 Normativer vs. analytischer Governancebegriff
Zunächst einmal kann zwischen einer analytischen und einer normativen Variante
unterschieden werden. Governance als analytische Forschungsperspektive versucht,
„die impliziten Annahmen eines Großteils der Forschung zu Governance möglichst
gering zu halten, um so ein auf verschiedenste Konstellationen anwendbares Instrumentarium zu erhalten“ (vgl. ebd. 1166). Governance als analytische Perspektive
kann demnach zwischen verschiedenen Governance-Mechanismen und -strukturen
differenzieren und dabei über Beobachtungsmöglichkeiten entscheiden. Dabei darf
jedoch keine Vermengung der analytischen mit der empirischen Ebene vorgenommen werden, denn „die Vermischung einer strikt analytischen Perspektive von Governance mit der Hypothese eines fundamentalen Wandels von Staatlichkeit und mit
Aussagen über den generellen Niedergang staatlicher Steuerungsfähigkeit stellt die
größte Hypothek dar, mit der Governance als Analyseperspektive belastet ist“ (ebd.:
1168). Die analytische Forschungsperspektive hat in der Summe eine Vielzahl von
Typologien von Governance-Modi entwickelt.
Die normative Variante empfiehlt eine grundlegende Umgestaltung politischer Regelungsprozesse hin zu Formen der Kooperation und der Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure: „Dem normativen Gebrauch von Governance liegt die Annahme zugrunde, dass durch den vermehrten Einsatz neuer Steuerungsformen Effizienz und
Effektivität erhöht und generell staatliche Handlungsfähigkeit wiedergewonnen werden kann“ (ebd.: 1163). Solche Konzepte firmieren dann unter dem Oberbegriff
„Good Governance“. Ursprünglich stammen sie aus dem Bereich der Entwicklungshilfe und postulierten dort staatliche und verwaltungstechnische Ideale (vgl. Hill 2005:
220). In diesem Rahmen wurde eine ganze Reihe an Kriterien entwickelt, die aus
Governance eben Good Governance machen, so z.B. Partizipation, Transparenz und
Fairness (vgl. ebd.: 224). Dabei fällt auf, dass Good Governance kein politikwissen184
schaftliches, sondern ein politisches Konzept ist, das etwa von der Europäischen
Kommission vertreten wird (vgl. Benz et. al. 2997: 15). So könnte Governance prinzipiell nochmals in eine normative (politikwissenschaftliche) und eine praktische (politische) Variante differenziert werden.
Gerade auf der lokalen Ebene sieht sich Good Governance mit einer gewissen Problematik konfrontiert, denn auch Partizipation erfordert eine Auswahl der Beteiligten
nach bestimmten Kriterien und schließt damit andere mutmaßlich Betroffene von der
Entscheidungsfindung aus. Ob sich mit solchen Formen auch die Effizienz erhöhen
lässt, scheint von Blumenthal - mit Ausnahme der internationalen Ebene - eher fragwürdig (vgl. von Blumenthal 2005: 1164). Ganz zu schweigen von der Legitimationsproblematik, wonach die Beteiligung privater Akteure an der Politik eben nicht durch
z.B. eine Wahl legitimiert sei. Von Blumenthal weist zudem darauf hin, dass das
normativ verstandene Governance-Konzept zugleich eine analytische Komponente
aufweist: „Governance aus normativer Perspektive umfasst aber nicht nur das positive Propagieren neuer Steuerungsformen, sondern zugleich die Analyse von Governance im engeren Sinne unter normativen demokratietheoretischen Gesichtspunkten“ (ebd.: 1165). Gelegentlich sei diese Vermengung metatheoretischer Ebenen
auch schlicht eine Folge mangelnder Stringenz (vgl. Blatter 2006: 51).
5.4.4.2 enger vs. weiter Governancebegriff
Daneben kann ein enger von einem weiten Governancebegriff unterscheiden werden
(vgl. Schuppert 2008: 24, dazu auch Benz/ Dose 2010: 20 ff.). Der weite Governance-Begriff erfasst nicht ausschließlich neue politische Regelungsphänomene, sondern möchte auch eine Analyseperspektive für hierarchische oder selbstregelnde
Steuerungsmechanismen bieten; Arthur Benz weist in diesem Zusammenhang auf
die Untersuchungen zum Thema „Politikverflechtungsfalle“ hin. Im Gegensatz dazu
schließt der enge Governance-Begriff hierarchische Herrschaft aus und setzt stattdessen auf netzwerkartige Arrangements.
Dabei ist gar nicht gewiss, dass Regieren im Verständnis des „engen“ Governance
immer erfolgreich sein muss: „Empirische Arbeiten haben jedoch gezeigt, dass nichthierarchische Formen des Regierens unter Einbeziehung nicht-staatlicher Akteure
keineswegs immer effektiv sind. Sie produzieren vor allem dann problemadäquate(re) Politiken, wenn die Möglichkeit besteht, politische Entscheidungen auch hierarchisch zu verabschieden und gegen Widerstand durchzusetzen. Der ,Schatten der
Hierarchie‘ hat eine ausschlaggebende Wirkung auf die Kooperationsbereitschaft
185
staatlicher bzw. nicht-staatlicher Akteure“ (Börzel 2007: 41). Einerseits wächst der
Druck auf die beteiligten Akteure, da bei fortwährendem Dissens eine einseitige
staatliche Entscheidung droht. Andererseits muss eine konsensuale Entscheidung
den Vorgaben des politisch-administrativen Systems entsprechen, um überhaupt Einigung erzielen zu können.
Verhandlungserfolge hängen damit gleichermaßen vom Schatten der Hierarchie ab
wie einseitig-hierarchische Entscheidungen. Dies gelte insbesondere für jegliche
Formen gesellschaftlicher Selbstkoordination, bei welchen z.B. das Problem der
Trittbrettfahrer ohne eine hierarchische Drohkulisse außer Kontrolle zu geraten drohe. Wenn jedoch effektive Verhandlungslösungen als Alternative zu hierarchischen
Entscheidungen von Hierarchie abhängen, könne man von einem Paradoxon sprechen (vgl. ebd.: 46). Interessanterweise gelte dann auch folgende Hypothese: Je
größer der Schatten der Hierarchie, desto größer die Bereitschaft privater Akteure zu
kooperieren und desto geringer das Interesse politischer Akteure an Verhandlungslösungen (vgl. ebd.: 48).
Beispielhaft sei das (enge) Governance-Konzept von Jan Kooiman genannt.
Kooiman bezeichnet den engen Governance-Begriff als soziopolitisches bzw. interaktives Governance, da es „auf umfassenden und systematischen Interaktionen zwischen den Steuernden und den Gesteuerten basiert und sich sowohl auf öffentlichöffentliche als auch auf öffentlich-private Interaktionen erstreckt“ (Kooiman 2005:
153). Und an anderer Stelle: „The ,why‘ of modern governance can be best explained
by an awareness that governments are not the only actors adressing major societal
issues; that besides the traditional ones, new modes of governance are needed to
tackle these issues; that governing arrangements will differ from global to local and
will vary sector by sector“ (Kooiman 2003: 3). Eine Interaktion versteht er als Beziehung zwischen zwei oder mehr sich gegenseitig beeinflussenden Einheiten, worin
eine Handlungs- (Prozess-) und eine Strukturebene unterschieden werden kann. Die
Eigenschaften der Einheiten und deren Ambitionen, existente Beziehungen zu erhalten oder zu variieren, prägen die soziopolitische Realität (vgl. Kooiman: 155).
Der Modellzweck besteht somit in der Erfassung verschiedener Steuerungsinteraktionen, d.h. genauer im Angebot einer Typologie an Governance-Modi. In dieser Hinsicht gleicht Kooimans Unterfangen vielen anderen Governance-Konzepten, von denen im Folgenden eine erlesene Auswahl vorgestellt wird. Kooiman unterscheidet
nun drei Modi: Mit „Self-Governance“ bezeichnet er den etwa für autopoietisch mo186
dellierte Sozialsysteme charakteristischen Modus der Selbststeuerung. In aller Kürze:
Solche Systeme könnten nur sich selbst steuern, externe Steuerung sei im Prinzip
nur auf Umwegen möglich und nur dann erfolgreich, wenn das mit dem Steuerungsimpuls anvisierte Ziel mit dem Steuerungseffekt, der sich aus einer systemrelativen
Verarbeitung ergibt, deckt (vgl. ebd.: 157 f.). Als zweiten Modus nennt Kooiman „CoGovernance“. Diese bezeichnet „den Gebrauch organisatorisch ausgeformter Interaktionsformen für Steuerungszwecke. […] Akteure kooperieren miteinander, koordinieren ihre Handlungen und kommunizieren miteinander ohne eine zentrale oder
dominierende Steuerungsinstanz“ (ebd.: 159). Drittens bezieht sich Kooiman auf hierarchische Governance bzw. Intervention als klassischen Regelungstyp, wobei es
nicht nur um eine top-down-Perspektive geht, sondern vielmehr um deren Einbettung
„in a broader category of societal interactions“ (Kooiman 2003: 116).
Kooiman bildet nun neben den Governance-Modi eine weitere Dimension, die verschiedene Governance-Ordnungen umfasst. Mit dem Fernziel, eine „Problemlösungs- und Chancenerzeuungstheorie“ zu generieren, nennt er zunächst Governance erster Ordnung. Dabei geht es um die direkte Problemlösung. Governance zweiter
Ordnung kümmert sich hingegen um den Rahmen, die Bedingungen und institutionelle Strukturen von Problemlösungsprozessen. Drittens führt Kooiman MetaGovernance als Governance dritter Ordnung an. Dabei handelt es sich um einen Meta-Rahmen, der Theorie und Praxis von Governance erster und zweiter Ordnung aus
einem normativen Blickwinkel heraus betrachtet. (vgl. Kooiman 2005: 163 ff.). In der
Summe bietet Kooiman ein Konzept zur Erfassung „von Problemen und Chancen auf
der Grenze des Sozialen und des Politischen,[…] deren Steuerung erfordert, die Bedeutungsgehalte, Instrumente und das Handlungspotential aller drei Funktionsbereiche in Betracht zu ziehen, um die gestellten Probleme zu lösen oder sie wenigstens
[…] nicht außer Kontrolle geraten zu lassen“ (ebd.: 169).
5.4.4.3 prozess- vs. strukturorientierter Governancebegriff
Daneben kann Governance auch in eine prozess- oder strukturorientierte Variante
differenziert werden. Governance kann zum Einen als Struktur bzw. als Form sozialer
Ordnung gesehen werden. Soziale Ordnung kann etwa durch Hierarchie, einen
Markt, Gemeinschaften, Verbände oder Netzwerke koordiniert werden (vgl. Börzel
2005: 75). Diese sozialen Muster bzw. „Governance-Struktur ergibt sich aus den Akteuren und den Beziehungsmustern zwischen ihnen“ (ebd.: 76). Man könnte auch
von Akteurskonstellationen sprechen und diese danach unterscheiden, ob lediglich
187
öffentliche oder private Akteure oder beide Gruppen beteiligt sind. Während sich in
Märkten gleichberechtigte Akteure gegenüberstünden und ihre Handlungen autonom
koordinierten, seien in Hierarchien (hier v.a. auf den Staat bezogen) Akteure an Weisungen gebunden. Jedoch könne der Staat nach innen und außen intentional handeln. In Netzwerken treten sich dagegen öffentliche und private Akteure gleichberechtigt gegenüber. Dabei lassen sich Netzwerke danach unterscheiden, ob an ihnen
nur öffentliche (gouvernementale Netzwerke), private (gesellschaftliche Netzwerke)
oder Akteure aus beiden Sphären (öffentlich-private Netzwerke) teilnehmen (vgl.
ebd.: 76). Governance als Prozess hingegen ergibt sich aus der Unterscheidung zwischen hierarchischen und nicht-hierarchischen Steuerungsformen. Bürokratien würden zumeist durch Hierarchien gelenkt; aber auch Mehrheitsentscheide seien hierarchisch geprägt, da sich die Minderheit einer Mehrheit beugen müsse. Alternativ dazu
stehen Prozesse des Aushandelns oder der Argumentation bzw. Überzeugung. Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild:
Akteurskonstellationen (strukturell)
Steuerungsmodi (prozessual)
Hierarchisch
Mehrheitsentscheidung
Hierarchische Weisung
Nicht-hierarchisch
Verhandeln
Argumentieren
Öffentliche Akteure
Hierarchische Setzung
Staat
Unabhängige Regulierungsbehörden
Supranationale Institutionen
Zwischenstaatliche Kooperation
Internationale Organisationen
Zwischenstaatliche
Verhandlungen
Intergouvernementale
Verhandlungen
im
Bundesstaat
Öffentlich-Private
teure
Ak-
Private Akteure
Kooperation zwischen Gesellschaftliche
öffentlichen und priva- Selbstregulierung
ten Akteuren
private Regime
Tripartistische Ver freiwillige
handlungssysteme
Selbstverpflich Öffentlich-private
tung
Partnerschaften
Regulierte Selbstregulierung
Tarifautonomie
Berufsverbände, Kammern
Technische Normierung
Tabelle 4: Governance-Strukturen und -Prozesse, Tabelle nach Börzel 2005: 77.
Sebastian Botzem et. al. weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Feststellung eines
Wandels von Staatlichkeit die Prozessperspektive geradezu aufzwinge: „Die besondere ,Kompetenz‘ des Governance-Ansatzes, ja sein spezifischer Mehrwert liegt
eben unseres Erachtens in der Prozesshaftigkeit und Dynamik der in ihm angelegten
Perspektive“ (Botzem et. al. 2009: 13 f.). Es geht damit nicht um GovernanceEbenen (etwa europäische vs. nationale Ebene) oder Governance-Bereiche wie z.B.
Governance des Internets, sondern um eine Betrachtung der Veränderung von Governance-Strukturen. Die Autoren bestimmen hierzu vier Dimensionen, genauer: sich
188
wandelnde und neue Akteurskonstellationen, sich wandelnde und neue institutionelle
Arrangements
und
Regelungsstrukturen
mit
dem
Schwerpunkt
auf
eine
institutionenkulturelle Perspektive, sich auflösende bzw. verwischende bisherige
Grenzziehungen und sich wandelnde oder neu zu entwickelnde Legitimationskonzepte (vgl. ebd.: 12). Mit Hilfe dieser vier Dimensionen entwickeln sie Fragestellungen in Bezug auf die Themenfelder Politik, Wirtschaft, Wissen und Recht und bieten
damit eine Schablone für einen von ebenjenen Autoren herausgegebenen Sammelband über Governance als Prozess. Dabei zeigt sich gerade in diesem Band, dass
Governance ein Konzept zur Beschreibung politischer Regelungsprozesse ist, zur
Erklärung jedoch wegen eines Mangels an modelltheoretischer Fundierung nur wenig beiträgt.
5.4.4.4 Governance auf lokaler, regionaler, nationaler oder internationaler Ebene
Julia von Blumenthal schlägt beispielsweise vor, Governance-Formen auf lokaler
bzw. regionaler, nationaler und europäischer Ebene zu betrachten (vgl. von Blumenthal 2005: 1154). Auf der lokalen Ebene haben sich demnach schon frühzeitig Formen von Governance gezeigt und es wurde bald „sichtbar, dass die räumliche Deckung von Problemzuordnung und Zuständigkeit lokaler Entscheidungsgremien nur
begrenzt gegeben ist, dass die kommunalpolitischen Akteure nur einen Teil der relevanten Akteure darstellen“ (ebd.: 1155). Gerade in diesem Bereich haben sich demnach Politiknetzwerkmodelle sinnvoll entwickeln lassen. Daneben sei das New Public
Management eine erste anwendungsorientierte Governance-Variante. Dies sei zugleich Ausdruck der in Deutschland vorherrschenden Bemühungen, Regierungsaufgaben auf private Akteure zu übertragen, während in anderen Ländern eher die Verlagerung von der nationalen auf die lokale oder regionale Ebene im Mittelpunkt stehe.
Schwieriger sei die Installation von Governance-Formen auf regionaler Ebene, da
hier meist noch keine anderweitigen Regierungsstrukturen existieren und die Initiative somit „von unten“ ausgehen müsse (vgl. ebd.: 1158). Auf europäischer Ebene habe sich wie auf keiner anderen Ebene Governance etabliert: „Regieren oder eben
Governance in der EU zeichnet sich in besonderer Weise durch das Zusammenwirken unterschiedlicher, konfligierender Regelsysteme und durch das Auftreten unterschiedlicher Governance-Modi aus: Während die Europäische Kommission als
,Prozessmanager‘ und ohne Rücksicht auf Wähler relativ unabhängig agieren kann,
unterliegen die nationalen Regierungen der Logik des nationalen Parteienwettbe189
werbs“ (ebd.: 1159 f.). Somit würden Policies erstens zwischen der EU und den Nationalstaaten und zweitens zwischen den Nationalstaaten untereinander in Netzwerken auf freiwilliger Basis ausgehandelt; dies sei das zentrale Merkmal von „European
Governance“.
Auf
Governanceforschung
nationalstaatlicher
hauptsächlich
mit
Ebene
der
beschäftigt
Generierung
von
sich
Politik
die
in
Mehrebenensystemen (strukturelle Perspektive), v.a. in föderalen Systemen, und mit
der Einbeziehung privater Akteure (prozessuale Perspektive), z.B. in der Umweltpolitik.
5.4.4.4.1 Governance auf lokaler Ebene
Unabhängig davon, auf welcher Ebene man den Governance-Begriff nun verortet,
bietet er in allen Überlegungen eine auffallende Breite an Möglichkeiten zur Charakterisierung politischer (Regelungs-)Prozesse. Dies gilt beispielsweise für die Verwaltungsforschung und damit für die lokale oder regionale Ebene. Arthur Benz hat darauf hingewiesen, dass die Verwaltungswissenschaft eine Vielzahl an empirisch ermittelnden Ergebnissen durch einzelne Studien mit einem jeweils gesonderten theoretischen Rahmen hervorbringen und dadurch Verwaltungsmängel belegen konnte:
„Eine empirische Verwaltungsforschung ist in der Tat auf eine solche Spezialisierung
angewiesen“ (Benz 2006: 29). So hat etwa die Bürokratieforschung die Entstehung
informaler Beziehungen in formalen Organisationen nachweisen können. Daneben
wies die Demokratieforschung in den siebziger Jahren auf die Starrköpfigkeit und
Verselbständigung einzelner Behörden gegenüber der politischen Führung hin. Mit
dem Governance-Konzept könnte es jedoch gelingen, einen abstrakten, generalisierenden und dennoch operationalisierbaren Rahmen zu entwickeln: „Wenn Verwaltungswissenschaft aber über Einzelanalysen hinaus gelangen will, bedarf sie eines
analytischen Werkzeugs, mit welchem Funktionsmechanismen kategorisiert und auf
den Begriff gebracht werden können“ (ebd.: 30).
Benz bestimmt zunächst relevante Formen kollektiven Handelns zwischen Akteuren
in institutionellen Kontexten. Er geht davon aus, dass Akteure ihre Handlungen entweder mit Hilfe von Anpassung durch Beobachtungen oder von Einfluss durch Kommunikation koordinieren; beide Formen können einseitig oder wechselseitig angewendet werden. Anpassungsprozesse werden durch Restriktionen (Zwang) oder Optionen (Chancen) ausgelöst, Einfluss hingegen durch Überzeugung (Information)
oder Anreize (Ressourcentausch) (vgl. ebd.: 31).
190
Benz unterscheidet ferner vier komplexere Interaktionsformen. In Verwaltungen dominiere erstens Hierarchie, die Berechenbarkeit und Machtbegrenzung mit sich bringe und die Bewältigung komplexer Aufgaben ermögliche. Interessanterweise stehe
eine asymmetrische Machtverteilung in Hierarchien einer umgekehrt asymmetrischen
Informationsverfügung entgegen, oder anders formuliert: Je höher man die Verwaltungsleiter emporsteigt, desto umfassendere Machtkompetenzen und größere Informationsdefizite lassen sich finden. Von daher sei Hierarchie immer auf wechselseitige Anpassungsprozesse angewiesen (vgl. ebd.: 31). Die zweite Interaktionsform bezeichnet Benz als „Netzwerke“. Netzwerke basieren auf gegenseitigem Einfluss
durch Ressourcen oder Informationen und sind meistens informal und einigermaßen
dauerhaft. Der dritte Governancemodus ist die Verhandlung. Diese basiert ebenfalls
auf wechselseitigem Einfluss, ist jedoch meist formal geregelt und kann entweder
durch Kompromisse bzw. Konzessionen (bargaining) oder durch wechselseitige
Überzeugungen (arguing) erfolgen. Viertens und letztens nennt Benz den Wettbewerb. Dieser basiert auf wechselseitiger Anpassung aufgrund individueller Interessen
und einem gemeinsam akzeptierten Regelkatalog. Bei diesen vier Formen handelt es
sich um analytisch postulierte Typen; in der Wirklichkeit ließen sich komplexere, teils
vermengte Varianten nachweisen (vgl. ebd.: 35).
HIERARCHIE
NETZWERK
VERHANDLUNG
WETTBEWERB
Koordinationsmechanismus
Struktur
wechselseitige
Anpassung
asymmetrische
Verteilung von
Macht und Information
wechselseitiger
Einfluss
variable Verteilung
von Einflussbeziehungen
wechselseitiger
Einfluss
gleiche Vetomacht, variable
Verteilung von
Informationen und
Tauschpotentialen
wechselseitige Anpassung
formale Gleichheit,
variable Wettbewerbsfähigkeit
Stabilisierung
formale Regeln
Interdependenz,
Vertrauen
individuelle und
gemeinsame
Interessen
komparative Orientierung, individuelle
Interessen
Austrittskosten
sehr hoch
relativ hoch
relativ gering
gering
Tabelle 5: Koordinationsmechanismen nach Benz 2006: 35.
Benz arbeitet mit Hilfe dieser analytischen Unterscheidung nun fünf in der modernen
Verwaltung vorherrschende Governanceregime heraus. Dazu gehört erstens Verhandeln im Schatten der Hierarchie. Die Bezeichnung „Schatten der Hierarchie“
„deutet an, dass ein übergeordneter Koordinationsmechanismus existiert, der aber
nur dann zur Wirkung kommt, wenn Koordination in Verhandlungen scheitert: „die
möglichen Folgen des Scheiterns werden aber von den Verhandlungspartnern einkalkuliert“ (ebd.: 36). Verhandlungen bezwecken dabei die Überwindung begrenzter
191
Kapazitäten von Hierarchien. Zweitens nennt Benz Verhandlungen oder hierarchische Koordination in Netzwerken. Hier bilden nun Netzwerke anstelle der Hierarchie
den Rahmen. Solche Netzwerke existieren in Verwaltungen meist auf einer gleichrangigen Ebene feststellen; Verhandlungen erleichtern sie hingegen durch die Förderung reziproken Verhaltes seitens der Akteure (vgl. ebd.: 37). Drittens lassen sich
laut Benz Hierarchien, Netzwerke und Verhandlungen im Schatten des Wettbewerbs
nachweisen. So könnten Hierarchien durch Institutionen-, Leistung- und Ressourcenwettbewerbe ergänzt werden. Auf regionaler Ebene würden besonders solche
Netzwerke gefördert, die die Region voranbringen, d.h. in einem Wettbewerb bestehen könnten. Auf kommunaler Ebene ließen sich Verhandlungen etwa um Infrastrukturprojekte zwischen Gemeinden beobachten; der Wettbewerb würde dabei um Bewohner oder Firmenansiedlungen geführt (vgl. ebd.: 38).
Während es sich bei den ersten drei Varianten um eingebettete GovernanceMechanismen handelt, dominiert in den beiden folgenden, von Benz als „verbunden“
charakterisierte Formen kein bestimmter Mechanismus. Die kooperative Verwaltung
zielt viertens in ihrem Kern auf Verhandlungslösungen, ohne jedoch die durch Hierarchie gegebene „Kompetenz zur autoritativen Entscheidung über Rechtsanwendung oder Leistungsvergabe“ gänzlich zu vergessen (ebd.: 40). Die Beteiligung verschiedener Akteure würde eine Kombination unterschiedlicher Governance-Formen
befördern. So seien Beamte vornehmlich in Hierarchien gebunden, während etwa
Interessengruppenvertreter v.a. durch Netzwerke geprägt seien. Fünftens und letztens nennt Benz das Konzept des New Public Managements, welches „die Effizienz
der Verwaltung vor allem durch Trennung zwischen politischer Zielsetzung und ausführender Tätigkeit, durch Leistungswettbewerbe, durch Zielvereinbarungen sowie
durch ein systematisches Controlling“ verbessern soll (ebd.: 43). Hierarchien würden
hier nur selten genutzt, stattdessen würde eher auf Anreize in Form von Leistungsvereinbarungen gesetzt.
Daneben würde jedoch gerade das New Public Management viele real existierende
Governance-Formen übersehen, so z.B. das „Politische“ an der Verwaltung, wenn
etwa Ziele vorab in parteidemokratischen Verfahren ausgehandelt würden, oder etwa
im Hinblick auf Zielvereinbarungen, da Erwartungen in oberen Ebenen etwa durch
Experten, auf der Leistungserbringungsebene hingegen von den Leistungsempfängern gestellt würden. Es geht damit um die Frage, wie Qualitätsstandards gefunden
werden können (vgl. ebd.: 45).
192
Nicht übersehen werden darf dabei, dass das Governance-Konzept im Rahmen der
Verwaltungswissenschaft starken Einfluss auf die Entwicklung des Leitbildes des aktivierenden Staates gehabt hat. Von daher kann eine inhaltliche oder semantische
Kongruenz dieser Konzepte kaum geleugnet werden (vgl. Jann 2002: 291). So heißt
es etwa in einem Text zum aktivierenden Staat: „Im Zentrum des Interesses stehen
nicht mehr nur die Steuerungsmedien Markt/ Geld/ Wettbewerb, sondern es interessiert die Kombination unterschiedlicher Steuerungsformen - bis hin zur Problematisierung von Solidarität, Vertrauen und ähnlichen ,weichen‘ Steuerungsmodi“ (ebd.:
297). Arthur Benz gibt zudem zu, dass es kaum möglich sei, sämtliche GovernanceFormen innerhalb der Verwaltung analytisch zu fassen. Dies zeigen allein schon die
Kombinationsmöglichkeiten, die prinzipiell ins Unendliche gesteigert werden könnten.
Von daher verfestigt sich der Eindruck, solche Governance-Typologien seien a priori
defizitär.
Ein ähnliches Vorgehen verfolgt Joachim Blatter, der eine achtgliedrige Typologie
moderner Governance-Formen entwickelt hat, die Ökonomie und Soziologie durch
diesen „transdisziplinären Brückenschlag“ einander näher bringen sollen. Da es in
dieser Arbeit um Politikwissenschaft und nicht um Ökonomie geht, soll Blatters Gedankengang nur knapp angedeutet werden. Blatter wählt zunächst die Dimensionen
„Weltbilder“ (holistisch oder partikularistisch), „Gesellschaftsbilder“ (segmentär oder
funktional) und „Handlungstheorien“ (homo oeconomicus/instrumentell und homo
sociologicus/ konstitutionell), wobei die Handlungstheorien jeweils in vier Varianten
differenziert werden (vgl. Blatter 2006: 62). Diese kombiniert er anschließend miteinander, sodass insgesamt acht verschiedene Governance-Formen entstehen. Blatters Typologie wirkt theoretisch wesentlich stringenter als die von Benz‘, „da zu jedem Typus ein handlungstheoretisches Konzept und die entsprechenden institutionellen Strukturen präsentiert werden“ (ebd.: 72), d.h. Blatter berücksichtigt auch die
Mikroebene und arbeitet hier mit bekannten soziologischen Handlungstheorien.
5.4.4.4.2 Governance auf nationaler Ebene
Auf gesamtstaatliche bzw. nationalstaatliche Ebene wurde das Governance-Konzept
ebenfalls bezogen. Während sich „Staat“ noch auf ein bestimmtes institutionelles
Setting richtet, geht es Governance nicht nur auf dieser Ebene um Interaktionsstrukturen und -prozesse im Rahmen der Transformation moderner Staaten (vgl. Benz
2007b: 339). Nationalstaaten zeichnen sich laut Benz durch sieben Merkmale aus:
ein bestimmtes Staatsgebiet, eine gewisse Staatsbürgernation, besondere Leistun193
gen und Interventionsansprüche, rechtsstaatliche Mäßigung, demokratische Verfahren und Strukturen, Bürokratie und eine Verfassung (vgl. ebd.: 340 f.). Damit lassen
sich verschiedene Staaten voneinander oder ein Staat von der Gesellschaft unterscheiden; „in der Governance-Perspektive kommt hingegen die Vielfalt der kollektiven Akteure und ihrer Interaktionen in den Blick“ - man könnte auch von netzwerkartigen Verflechtungen sprechen (ebd.: 342).
Nationalstaaten haben nun laut Benz mit drei „Grenzproblemen“ zu schaffen: Erstens
seien klassische Grenzen einerseits Hindernis für den freien Güter-, Personen- und
Warenverkehr, andererseits jedoch keine Barriere für ökologische und ökonomische
Schwierigkeiten. Zweitens würden v.a. innerhalb der westlich geprägten Nationalstaaten zunehmend Menschen leben, die nicht mehr klassisches Mitglied der Staatsbürgernation seien und deren Integration deswegen anders gelöst werden müsste.
Drittens würden nationalstaatliche Funktionsleistungen vermehrt an ihre Grenzen
stoßen, was besonders an der Überforderung der Sozialkassen oder an der Privatisierung staatlicher Aufgaben erkennbar sei (vgl. ebd.: 343). Veränderungen im Hinblick auf Regieren seien von daher unvermeidlich: „Da der Staat im Verhältnis zu anderen Staaten, zu Angehörigen anderer Nationen oder zur Gesellschaft und zu privaten Akteuren nicht übergeordnet ist, können diese Koordinationsaufgaben nicht mit
den klassischen Modi der autonomen Staatsgewalt erfüllt werden, sondern erforderten eine interaktive Politik zwischen Staaten, zwischen Gebietskörperschaften und
zwischen privaten und staatlichen Akteuren. Grenzen werden meistens durch Verhandlungen oder durch Netzwerke überbrückt, teilweise aber auch durch wechselseitige Anpassung in Konkurrenzbeziehungen. Das alles schließt nicht aus, dass sie
weiterhin durch eine hierarchische Ordnung gesichert werden, das heißt durch Gesetze und ihren bürokratischen Vollzug. Aber in den institutionellen Strukturen des
demokratischen Verfassungs- und Verwaltungsstaates entwickeln sich komplexere
Governance-Formen im Schatten oder jenseits der Hierarchie“ (ebd.: 343 f.).
Governance sprengt damit in wachsendem Ausmaß das klassische nationalstaatliche
Demokratieprinzip, wonach Wähler Parlamente durch Wahl legitimieren und Parlamente dann Regierungen einsetzen. Verhandlungslösungen, etwa zwischen verschiedenen Kammern oder Parteien oder zwischen dem Staat und Privaten, ersetzen
immer häufiger die klassische demokratisch arrangierte hierarchische Herstellung
von Gesetzen. Diese Veränderung bzw. teilweise Abkehr vom hierarchischen Denken erstreckt sich wie gezeigt auch auf die Ebene der Verwaltung. Folge sei eine zu194
nehmende Politikverflechtung, die Benz mit dem Begriff „Multilevel Governance“ etikettiert (vgl. ebd.: 346). Dieses Konzept bezieht sich auf „die Tatsache, dass in einem
institutionell differenzierten politischen System Akteure unterschiedlicher Ebenen
aufeinander angewiesen sind und ihre Entscheidungen koordinieren müssen. Die
institutionellen Strukturen eines Mehrebenensystems können allerdings ebenso variieren wie die Modi der Politikkoordination, die durch wechselseitige Anpassung, Verhandlungen, Netzwerke, Wettbewerb oder hierarchische Steuerung erfolgen kann“
(Scharpf 2007a: 297).
Mehrebenengovernance zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: „Erstens sind
mit Ebenen politische Einheiten gemeint, die primär nach territorialen Aspekten organisiert sind. Zweitens gilt das Interesse politischen Strukturen und Prozessen, die die
Ebenen miteinander verbinden, sowie der Koordination und Steuerung zwischen
Ebenen. Drittens bestehen Zusammenhänge zwischen den die Ebenen verbindenden Prozessen und Regeln sowie den institutionellen Bedingungen und politischen
Prozessen innerhalb der Ebenen“ (Benz 2010: 116). Auf nationaler Ebene sei es besonders für Bundesstaaten geeignet, hierfür habe etwa Fritz W. Scharpf die Theorie
der Politikverflechtung entwickelt (vgl. ebd.: 303). Dieses Konzept ergänzte z.B. Gerhard Lehmbruch um Interaktionen zwischen Parteien, sodass Parteienwettbewerb
und Bund-Länder-Verhandlungssysteme in der BRD als dominante GovernanceFormen gesehen werden können (vgl. ebd.: 305). Interessant, dass Benz gerade
diese Theorie als bereichsspezifische Theorie für Governance erwähnt, da Scharpf
seine diesbezüglichen Überlegungen in den siebziger Jahren des 20. Jhdt. angestellt
hat und Governance doch ein Konzept jüngeren Datums sein möchte.
5.4.4.4.3 Governance in „Räumen begrenzter Staatlichkeit“
Nun kann das Konzept laut einigen Autoren nicht nur für westliche industrialisierte
Staaten angewendet werden, sondern auch in Räumen begrenzter Staatlichkeit. Mit
der Übertragbarkeit des Governance-Konzepts auf solche Staaten befassen sich z.B.
die Autoren eines Sammelbandes (Risse/ Lehmkuhl 2007), die von folgender zentralen Feststellung ausgehen: „Sowohl der Blick auf die zwei Drittel der Staaten außerhalb der entwickelten OECD-Welt als auch die Betrachtung historischer Räume begrenzter Staatlichkeit - z.B. koloniale Räume - zeigen jedoch, dass GovernanceLeistungen sehr viel häufiger unter Bedingungen erbracht werden, in denen effektive
Gebietsherrschaft, staatliches Gewaltmonopol und autoritative Entscheidungskompetenz des Staates nicht oder nur teilweise gegeben sind“ (Risse/ Lehmkuhl 2007: 14).
195
Es geht letztlich um Räume, „in denen staatliche Institutionen zu schwach sind, um
einerseits politische Entscheidungen herstellen und durchsetzen zu können und andererseits politische Herrschaft wirksam begrenzen zu können“ (ebd.: 15).
Möchte das Governance-Konzept eine große Reichweite für sich in Anspruch nehmen, dann muss es sich diesem empirischen Befund stellen und seine Anwendbarkeit in diesen Bereichen nachweisen. In diesen Räumen geht es darum, für Nationalstaaten typische Leistungen wie Sicherheit, die Bereitstellung öffentlicher Güter oder
einer Herrschaftsordnung zu erbringen, ohne das strukturelle nationalstaatliche Arrangements vorhanden wären - Governance soll den Nationalstaat gleichsam substituieren (vgl. ebd.: 22 f.). Risse und Lehmkuhl nennen als typische Merkmale den
Einbezug privater individueller oder kollektiver Akteure, neue Steuerungsformen wie
das Setzen von Anreizen, Benchmarking, Überzeugungs- und Lernprozesse, Steuerung durch symbolische Orientierung und nicht zuletzt sämtliche Formen von Kooperation, insbesondere mit internationalen Akteuren (vgl. ebd. 23 f.).
Ulrich Schneckener geht ein wenig anders vor: Er fragt nicht nach Substitutionsmöglichkeiten für nationalstaatliche Arrangements, sondern danach, was fragile Staaten
stabil hält (vgl. Schneckener 2007: 113). Exemplarisch nennt er den bewussten Einsatz von Patronage- und Klientelpolitik und die Kooptation bestimmter Gruppen oder
Stämme (man könnte dies als „Netzwerk“ bezeichnen), vorsichtige Reformen und
zeitgleich ein repressiver Umgang mit der Opposition, oder sogar eine optimale Ausbeutung extern abgeleiteter Finanzen oder landeseigener Ressourcen. In dieser Hinsicht erinnert dieses Governance-Konzept ein wenig an die Leitfrage David Eastons,
was die Persistenz politischer Systeme (und eben nicht nur westlicher industrialisierter Demokratien) aufrecht erhält. Nachhaltiger wäre es jedoch, einige dieser Stabilisatoren zu überwinden und gezielt einen state-building-Prozess zu initiieren (vgl.
ebd. 117 f.).
Nicht übersehen werden darf dabei, dass das Governance-Konzept immer dann,
wenn es um die Beteiligung privater Akteure bzw. das Fehlen staatlicher Strukturen
geht, einen deutlichen Mangel an Legitimation aufweist. Dies zeigt sich insbesondere
bei Konzepten des Global Governance oder bei Governance in fragilen Staaten. Risse und Lehmkuhl nennen drei Möglichkeiten zur Überwindung dieses Dilemmas. Erstens könnte in solchen Konstellationen in Anlehnung an Scharpf auf eine OutputLegitimation gesetzt werden. Policies sind demnach immer dann legitim, wenn sie die
gestellten Probleme möglichst gut lösen, wobei sich dann die Frage stellt, was „gut“
196
meint. Diese Art der Legitimation würde immer dann greifen, wenn kein legitimierender Demos existiere. Zweitens könnte die externe Input-Legitimation erhöht werden,
was meint, dass die für eine Policy Verantwortlichen an die Adressaten
legitimatorisch zurückgebunden werden. Dies könnte etwa durch eine größere
Transparenz, verstärkte Öffentlichkeit oder eine direkte Einbeziehung der Repräsentanten in die Governance-Form erreicht werden. Drittens könnten zur Erhöhung der
Legitimation deliberative Governance-Formen verwirklicht werden, wodurch sich
bessere Argumente durchsetzen würden. Mit dieser Art würde sowohl die Input- als
auch die Output-Legitimation erhöht werden; nicht vergessen werden darf jedoch,
dass deliberative Verfahren generell sehr voraussetzungsvoll sind.
In der Summe handelt es sich bei den drei angeschnittenen Lösungsmöglichkeiten
um sehr vage Ansätze (vgl. Risse/ Lehmkuhl 2007: 147 ff.). Partizipation, Transparenz, Deliberation und Assoziation von z.B. NGOs als alternative Legitimationsmechanismen werden auch von Matthias Ruffert genannt, allerdings erkennt er deren
Defizite an: „Diese Kompensation von Legitimation [durch die genannten Alternativen, der Verf.] sollte ernst genommen werden, anstatt die Leistungserwartungen an
die repräsentative Demokratie zu überdehnen […]. Andererseits liegen die Schwächen von Partizipation, Assoziation und Deliberation klar auf der Hand. Vor allem die
Grundsätze demokratischer Freiheit und Gleichheit sind in Gefahr, wenn sich durch
(diskursive) Beteiligung (bestimmter Interessengruppen) eine ,demokratische Elitenherrschaft‘ zu verfestigen droht“ (Ruffert 2009: 66).
5.4.4.4.4 Governance „zwischen“ Staaten/ EU-Policy-Making
Governance-Konzepte lassen sich nicht nur auf Steuerungsprobleme in, sondern
auch zwischen Staaten anwenden. Exemplarisch soll dies hier am Beispiel der Europäischen Union verdeutlicht werden, ohne jedoch an dieser Stelle auf die Besonderheiten des EU-Policy-Makings einzugehen (vgl. dazu Tömmel 2007: 22 ff.). Zunächst
steht die Annahme im Raum, dass die EU hauptsächlich durch kooperative Steuerungsmechanismen regiert, denn sie könne ja „bei der Durchsetzung verbindlicher
Regeln nur begrenzt auf hierarchische Koordinationsformen zurückgreifen, da es an
einer sanktionsbewehrten Zentralgewalt fehlt“ (Börzel 2005: 79). Laut Tanja Börzel
können Steuerungsprozesse der EU dann folgendermaßen charakterisiert werden:
Erstens seien die Zuständigkeiten auf mehrere Ebenen - von der europäischen bis
zur lokalen - verteilt. Zweitens seien an diesen Prozessen öffentliche und private Akteure beteiligt, die wegen des Verfügungspotentials über Ressourcen voneinander
197
abhängig sind. Drittens setze die EU hauptsächlich auf regulative Politik; es gehe um
sachgerechte anstelle individuell nützlicher Politik bzw. um die technische Regulierung statt um die Umverteilung von Mitteln (vgl. ebd.: 80).
Diese Merkmale führten auf EU-Ebene zu einem eigenständigen Koordinationsmechanismus, der dadurch gekennzeichnet ist, „dass erstens Politik vorwiegend an
Problemlösung orientiert ist und zweitens der Politikprozess durch hoch organisierte
gesellschaftliche Subsysteme bestimmt wird. Drittens weicht die hierarchische Überbzw. Unterordnung zwischen öffentlichen und privaten Akteuren einem stärker
gleichberechtigten Austausch, der die Grenzen zwischen öffentlicher und privater
Sphäre verwischt“ (ebd.). Network Governance sei der bevorzugte Koordinationsmechanismus auf horizontaler EU-Ebene, allerdings nur, wenn es um die Einbeziehung
von privaten Akteuren gehe. Das sei auf EU-Ebene nur selten der Fall, etwa in Bezug
auf die Sozialpolitik oder bei der Vorbereitung von Entscheidungen (vgl. ebd.: 85).
Dies läge zum Einen an den Ressourcen der privaten Akteure, an denen die EU außer an Informationen kaum Interesse habe. Zum Anderen sei die EU eher pluralistisch organisiert und für Partikularinteressen wenig empfänglich (vgl. ebd.: 88). Auf
vertikaler Ebene würde hingegen der hierarchische Modus dominieren, v.a. durch die
Gemeinschaftsmethode, wonach Kommission, Rat und Parlament gemeinsam Verordnungen und Richtlinien erlassen. Zwar würden oft transgouvernementale Verhandlungen vorgeschaltet, diese würden jedoch im Schatten der Hierarchie stattfinden. Daneben gebe es noch Politikfelder, die rein inter- oder transgouvernemental
ausgehandelt würden, z.B. die gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik.
Fazit dieses kursorischen Überblicks: Die Europäische Union besitzt ein umfangreiches Repertoire an Steuerungsarrangements; von einer zunehmenden Regulierung
durch Netzwerke oder gar einem Verschwinden hierarchischer Steuerung kann jedoch keine Rede sein (ausführliche Darstellung der EU-Steuerungsmechanismen bei
Börzel 2007: 75 ff.). Markus Jachtenfuchs und Beate Kohler-Koch sprechen in dieser
Hinsicht zurecht von einem „breite[n] Fächer der Mechanismen gemeinschaftlicher
Politik“ (Jachtenfuchs/ Kohler-Koch: 2010: 72). In der Summe hat sich die Anwendung von Governance-Konzepten auf die Europäische Union jedoch bewährt und zu
neuen Erkenntnissen geführt, da auf Teilmodelle, die für nationale Staaten entwickelt
worden sind, nun verzichtet werden könne (vgl. Tömmel 2007: 20).
198
5.4.4.4.5 „Global Governance“
Auch für die globale Ebene bietet das Governance-Gebäude verschiedene Konzepte
an, die unter dem Begriff „Global Governance“ firmieren und sich schwerpunktmäßig
auf politische Steuerungsprobleme beziehen, die sich aus Globalisierungsprozessen
ergeben. Der Grund für diese Probleme sei, dass „effektive Governance von der
räumlichen Übereinstimmung der politischen Regelungen mit den gesellschaftlich
integrierten Räumen bzw. dem Fehlen signifikanter Externalitäten abhängt und im
Zuge der Globalisierung die gesellschaftliche Verflechtung über Grenzen hinweg zunimmt“ (Zürn 2005: 121). In Bezug auf globale Probleme eine recht ähnliche Feststellung: „Immer deutlicher wird, dass herkömmliche Formen nationalstaatlicher Steuerung und internationaler Verregelung diesen globalen Herausforderungen nicht gerecht werden“ (Risse/ Lehmkuhl 2007: 13).
Global Governance bedient sich nun des Instrumentariums des GovernanceBaukastens. Globale Probleme sollen mit Hilfe weicher und harter Steuerungsinstrumente gelöst werden, einer globalen Regelungsinstanz bedarf es dabei nicht unbedingt: „vielmehr kann es auch das aggregierte Resultat der Tätigkeiten verschiedenster Akteure sein“ (ebd.: 126). Aus dieser Blickrichtung weist Governance zum Einen
eine normative Konnotation auf, wonach globale Probleme durch (Good) Global Governance gelöst werden könnten. In dieser Hinsicht findet das Konzept auch in der
Politik rege Verwendung. Zum Anderen bietet es eine analytisch-deskriptive Perspektive und beschäftigt sich dann mit sämtlichen Steuerungsarrangements auf globaler
Ebene.
Letztere Blickrichtung lässt sich nochmals in die Bausteine Governance „by“, „with“
und „without“ Government zerlegen. Der erste Punkt meint solche Steuerungsprozesse, die allein von nationalstaatlichen Regierungen durchgeführt werden und die
dann grenzüberschreitende Auswirkungen haben, z.B. der Ausstieg aus der Atomenergie. Governance with Governnemt bezieht sich auf solche Steuerungsversuche,
die durch mehrere nationale Regierungen gemeinsam koordiniert werden. Governance without Government umfasst all jene Regelungen, die durch private Akteure
getroffen werden. U.U. können Staaten daran beteiligt sein; allerdings gilt das in diesem Fall nur, wenn sie keinen privilegierten Status innehaben und als ein Akteur unter vielen gelten (vgl. ebd.: 127 f.).
Insbesondere die internationale Kooperation zwischen Regierungen stelle nichts
Neues dar: „Das Neue an Global Governance ist nun, dass sich das internationale
199
Regieren zunehmend mit Formen des transnationalen Regierens, aber auch mit nationalstaatlichen Formen des Regierens verbindet und dabei selbst eine neue Gestalt
annimmt“ (ebd.: 128). Zwei Faktoren seien besonders bedeutsam für Global Governance: Erstens eine Vergesellschaftung des Regierens, die vermehrt gesellschaftliche Gruppen mit einbezieht. Zweitens eine Verrechtlichung des Regierens jenseits
des Nationalstaates, der die Interpretation von Regeln auf institutionell vorgegebene
Verfahren gründet (sekundäre Regeln).
Maria Behrens nennt für die drei Governance-Formen konkrete Beispiele. Die „International Standardization Organization“ (ISO) stehe exemplarisch für Governance
without Governments. Hier vereinbaren die Mitglieder - Wissenschaftler, Unternehmensvertreter etc. - technische Normen zur Qualitätssicherung. Mitglieder der ISO
sind nicht die Regierungen, sondern nationale Normungsinstitute. Als Beispiel für
Governance with Government kann laut Behrens der Global Compact genannt werden. Global Compact strebe eine nachhaltigere Globalisierung durch eine Einbindung multinationaler Konzerne in partnerschaftliche Problemlösungen an. Dazu gehören große Unternehmen, NGOs und Staaten. Sie thematisieren u.a. Arbeits- und
Sozialstandards, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Ein Beispiel für Governance with Governments ist laut Behrens der UN-Sicherheitsrat, in welchem ausschließlich Staaten für die internationale Sicherheit oder die Einhaltung der UNCharta sorgen wollen (vgl. Behrens 2010: 98 ff.).
Zürn weist nun auf vier Entwicklungen hin, die die Existenz bzw. zunehmende
Durchsetzung von Global Governance bestätigen. Erstens nehme die Quantität gemeinsamen internationalen Regierens deutlich zu. Elemente hiervon seien internationale Regime, inter- und transgouvernementale Netzwerke und eine wachsende
Zahl internationaler Organisationen. Zweitens könne eine neue Qualität internationaler Zusammenarbeit ausgemacht werden. Nun seien gesellschaftliche Akteure anstelle von Staaten die Adressaten von Regelungsversuchen. Regelungen würden
drittens auch innerhalb der Staaten und nicht nur zwischen ihnen ansetzen. Viertens
würden in zunehmendem Ausmaß komplexe, ungewisse Probleme angegangen
werden. Die Folge sei eine wachsende Nachfrage nach internationalen Institutionen,
die klassische Regierungsformen überwinden, und damit einhergehend nach der
Institutionalisierung sekundärer Regeln (vgl. Zürn 2005: 130 ff.). Dies würde zu einer
tiefschürfenden Verrechtlichung von Governance with Governments führen, was v.a.
200
in der EU zu beobachten sei. Als Konsequenz könnten supranationale, von den nationalen Regierungen vollkommen autonome Institutionen entstehen.
Das Konzept des Global Governance erfuhr vielfältige Kritik. So würde sozialer Ausgleich durch eine Wohlfahrtspolitik auf globaler Ebene kaum gefördert, obwohl ökonomische Prozesse zunehmend auf ebendiese Ebene verlagert würden. Desweiteren seien sämtliche internationalen Organisationen nicht demokratisch legitimiert.
Grund hierfür sei u.a., dass auf globaler Ebene kein einheitlicher Demos existiert, der
legitimieren könnte (vgl. Zürn 2005: 140). Daneben weist Renate Mayntz auf ein
zentrales Problem der Modellierung hin: „Dabei ist es selbst bei politikfeldspezifischen Analysen kaum möglich, auf nationaler Ebene den Besonderheiten aller
Länder gerecht zu werden. Die Komplexität der Wirklichkeit stellt dem Desiderat,
Global Governance als Mehrebenensystem zu erfassen, kaum überwindbare Hürden
entgegen“ (Mayntz 2008: 53).
Harald Müller weist auf Schwächen zentraler Feststellungen von Autoren hin, die
Global Governance als eine Reaktion auf fundamentale gesellschaftliche Veränderungen sehen:
Denationalisierung: „Titularnationen leben mit Minderheiten in demselben
Staatswesen zusammen (China, Iran). Nationen sind in eine Staatsnation und
eine Diaspora geteilt (Ungarn, Russen, Deutsche, Juden, Serben); mehrere
Nationen teilen sich dasselbe Territorium, oft mit gewaltsamen Folgen (Bosnier/ Serben; Tutsis/ Hutus). Manche Nationen ermangeln eines Staates gänzlich (Tibeter, Kurden, Basken). In diesem Sinne war Denationalisierung immer
Teil der weltpolitischen Tatsachen“ (Müller 2009: 226). Und dennoch habe
sich Politik immer am Konstrukt der Nation orientiert: „Nation kann der Nebelwurf über dem Nebeneinander unterschiedlicher Gemeinschaften sein, kann
kulturell, aber nicht ethnisch homogen sein (wie in der Schweiz), sich auf den
gemeinsamen Verfassungspatriotismus begründen (wie in den USA) oder auf
einer nahezu konföderalen Übereinkunft bestehen, den Staat gemeinsam zu
versuchen (wie, mit Ach und Krach, in Belgien)“ (ebd.). Laut Müller sei die Nation immer noch der zentrale Referenzpunkt von Politik. Dies zeige sich etwa
im Umgang mit den Themen Migration, Wiedervereinigungs- (Korea) oder Se-
zessionsproblematiken (Kosovo) (vgl. ebd.: 227).
Entgrenzung: Zwar lasse die Bedeutung von Grenzen besonders im Hinblick
auf Ökonomie und Kommunikation nach. Allerdings zeigen sich gerade in Eu201
ropa beim Übertreten von Grenzen deutliche landesspezifische Unterschiede
wie Sprache, Verkehrsregeln. Daneben würden viele Grenzen stärker befestigt denn je, wie z.B. die EU-Außengrenze („Schengen-Raum“) oder die Gren
ze zwischen den USA und Mexiko (vgl. ebd.: 229).
De-Territorialisierung: Müller weist darauf hin, dass sich die gewalttätigsten
Auseinandersetzungen auf der Erde gerade um Territorien drehen, etwa in
Palästina oder Tschetschenien. Desweiteren hätten gerade die illegalen Maßnahmen der USA im Rahmen der Terroristenverfolgung wie Auslandsentführungen oder illegale Überflüge z.T. heftige Reaktion seitens der betroffenen
Staaten wegen der Verletzung ihres Territoriums hervorgerufen (vgl. ebd.
231).
Entstaatlichung: Obwohl eine ganze Reihe von Normen durch internationale
Organisationen gefördert würden, würden diese nur durch staatliche Sanktion
realiter durchgesetzt werden. Zudem würden Organisationen Einflusspotentiale von Staaten variieren können; einen mächtigen Staat könnten sie dennoch
nicht zu einem Zwerg machen (vgl. ebd. 233 f). Darüber hinaus würden durch
Governance durchgesetzte Regeln wie die lex mercatoria zwar ohne staatliche
Beteiligung entstehen; als Drohkulisse im Hintergrund bleibe der Staat dennoch ein zentraler Mitspieler (vgl. ebd.: 236). Erstens seien die Organisationen
auf staatlichen Schutz und staatliche Förderung angewiesen. Zweitens könne
der Staat jederzeit eigene Gesetze erlassen. Darüber hinaus sei stellenweise
eine staatliche Steuerungs- und Machtzunahme zu beobachten, wie z.B. die
Verteidigung und Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols nach dem 11.
September gezeigt habe (vgl. ebd.: 241)
5.4.4.4.6. „Weiche Steuerung“
Während die vorgestellten Governance-Konzepte in der Regel zwischen hierarchischen und nicht-hierarchischen bzw. netzwerkartigen Steuerungsformen unterscheiden, wird in einem Working-Paper des SonderForschungsBereich 700 „Governance
in Räumen begrenzter Staatlichkeit“ ein dritter Typ namens „weiche Steuerung“ ausdifferenziert. Weiche Steuerung ist keine reduzierte oder abgeschwächte Form von
Steuerung: „Auch weiche Steuerung ist Steuerung, die es stets mit Macht zu tun hat,
und zwar durchaus im Sinne der grundlegenden Weberschen Definition“ (Göhler
202
2009: 87). Mit „weich“ wird dabei der Umstand charakterisiert, „dass die Chance, eine
Steuerungsintention durchzusetzen, auf den ersten Blick deutlich geringer ist als in
Herrschaftsbeziehungen, denn Steuerung erfolgt nicht hierarchisch, von oben nach
unten, sondern horizontal“ (ebd.). An dieser Stelle kann nur auf die Diskussion verwiesen werden, inwiefern der Steuerungsbegriff komplementär mit dem GovernanceBegriff ist (vgl. ebd.: 89 f.).
Diesen dritten Typ politischer Steuerung rückt z.B. Gerhard Göhler in den Mittelpunkt
seiner Untersuchungen. Während die genannten Governance-Konzeptionen sich
meist auf Regelungsstrukturen fokussierten, gelänge es mit Hilfe des Konzepts der
weichen Steuerung die Akteure wieder stärker in den Blick zu nehmen (vgl. Göhler
et. al. 2010: 692). Anders als in kooperativen Governance-Arrangements würde die
Frage nach der Macht oder nach Hierarchien in diesem Konzept nach wie vor gestellt, wenn auch sehr dezent. Göhler sieht Macht damit nicht als Instrument der
Steuerung an, für ihn ist Steuerung vielmehr eine Machtbeziehung (vgl. Göhler 2009:
92). Weiche Steuerung wird „als horizontale Beziehung zwischen einem Akteur und
einem Adressaten gefasst“ (Göhler 2010: 693), ohne formale Strukturen oder vergleichbares vorauszusetzen. In diesem Sinn unterscheidet sie sich auch von Verhandlungssystemen oder Netzwerken, die immer auf irgendeine Form von institutioneller Festlegung angewiesen seien (vgl. Göhler 2009: 96). Es geht vielmehr um „eine Form der Machtausübung. Macht auszuüben bedeutet generell, die Handlungsoptionen der Adressaten zu strukturieren, d.h. einzuschränken oder auszurichten, sei
es intentional oder durch Strukturen, zu denen die Intentionen geronnen sind“ (Göhler 2010: 694).
Weiche Steuerung ist somit eine intentionale Machtausübung auf horizontaler (und
damit nicht hierarchischer) Ebene zur Strukturierung von Handlungsmöglichkeiten.
Horizontale Steuerung ist situationsspezifisch und nicht dauerhaft, kennt keine Hierarchien und kein institutionell gesichertes Sanktionspotential oder festgeschriebene
Verfahren. Horizontale Steuerungsgelegenheiten entstehen entweder durch gleichwertige bzw. gar fehlende Sanktionsmöglichkeiten oder durch überzeugende Argumente (vgl. Göhler/ Höppner/ De La Rosa 2008: 16 f.). Weiche Steuerung ist darüber
hinaus intentional, was bedeutet, dass erstens die Erwartungssicherheit für die
Durchsetzung von Intentionen niedriger ist, zweitens sie prinzipiell durch wechselseitige Bezogenheit bedingt ist und drittens das Steuerungsverfahren selbst zum Gegenstand der Steuerung werden kann (vgl. ebd.: 20 f.).
203
Göhler unterscheidet nun wie die Autoren des Working Papers des SFB 700 drei
Formen weicher Steuerung:
Weiche Steuerung meint demnach dreierlei:
„Steuerung durch Diskursstrukturierung: Erzeugung von (unhinterfragbarer)
Bedeutung, z.B. durch den Versuch, Themen und Interpretationen durchzu-
setzen (framing),
Steuerung durch Argumente: Einsatz von Lern- und Überzeugungsprozessen,
z.B. arguing, rhetorisches Handeln und hypocrisy,
Steuerung durch Symbole: Präsentation von Symbolen zur Erzeugung von
Resonanz bei den Adressaten“ (SFB 700 2009: 11).
Steuerung durch diskursive Praktiken geht auf Überlegungen Michel Foucaults, Ernesto Laclaus und Chantal Mouffes zurück. Dabei dreht es sich um „zunächst all jene
Praktiken der Individuen, durch die großflächige gesellschaftliche Sinnformationen,
sogenannte Wahrheitsordnungen, erzeugt werden […]. Selbstverständlich sind diese
außerordentlich vielfältig und wirken handlungsstrukturierend auf sehr unterschiedliche Art und Weise“ (ebd.). Dabei muss das Merkmal der Intentionalität spezifiziert
werden, „denn die analytischen Diskurstheorien betonen die wirklichkeitsproduzierende Wirkung von Sprache und damit gerade auch die anonymen Machtwirkungen,
die durch Diskurse hervorgerufen werden“ (Göhler 2010: 695). Dennoch wird auf
Steuerungssubjekte nicht verzichtet, wobei Handlungsintentionen innerhalb des Diskurses entwickelt würden.
Göhler summiert nun unter diesem Steuerungsverständnis verschiedene Steuerungsmechanismen. Erstens nennt er die Kategorisierung bestimmter Ereignisse, die
damit in bestimmte etwa historische oder ökonomische Zusammenhänge eingeordnet werden können. Zweitens erkennt Göhler Steuerung durch die Produktion von
Wissen, z.B. durch die Veröffentlichung bestimmter Daten, die noch interpretierbar
und mehrdeutig bleiben. Dies ändert sich drittens durch Steuerung durch die Produktion von Wahrheit. Die Daten sind nun interpretiert; alternative Wahrheiten sind damit
ausgeschlossen. Steuerung durch leere Signifikanten setzt viertens auf die Mehrdeutigkeit von Begriffen wie etwa „Demokratie“, die ein hohes Identifikations- und Integrationspotential bieten. Solche Begriffe müssten gleichsam besetzt werden, um sie
dann hegemonial verwenden zu können. Subjektivierung meint fünftens die gezielte
Beeinflussung von Selbstverständnissen, was beispielsweise über die Bereitstellung
bestimmter Entwicklungsprogramme erfolgen kann. Sechstens setzt Göhler auf die
204
Schaffung oder Vernichtung von Positionen legitimer Sprecher. Die Kombination von
Betroffenenwissen und notwendiger Anerkennung ist hierfür Grundlage (vgl. ebd.:
696 f.).
Steuerung durch Fragen und Argumente „bezieht sich auf die Möglichkeit, andere
Personen mittels Fragen oder Argumenten zu einer Änderung ihrer Einstellung oder
ihres Verhaltens zu bewegen“ (ebd.: 697), wobei der Verhaltensänderung des Adressaten i.d.R. Rechtfertigungsversuche vorausgehen. Weiche Steuerung durch Fragen und Argumente wird durch strategischen (erfolgsorientierten) oder verständigungsorientierten Sprachgebrauch vollzogen, wobei laut Göhler Verständigung eine
höhere Bindungswirkung erzielt. Verständigungsorientierte Steuerung durch Argumente entspricht etwa der Steuerungsvorstellung in der Theorie des kommunikativen
Handelns von Jürgen Habermas. Hier kommt es v.a. auf wahre, überzeugende und
damit annehmbare im Sinne von zustimmungswürdigen Argumenten an, während
strategisch orientierte Argumente auch „glatt gelogen“ sein können. (vgl. ebd.: 698).
Fragen unterscheiden sich von Argumenten dadurch, „dass sie den Rechtfertigungsmechanismus anstoßen können, ohne Gegenargumente anzuführen, d.h. Fragen können völlig offen sein, während Argumente immer in ein Bezugssystem von
Vorannahmen eingebettet sind“ (ebd.). Weiche Steuerung durch Fragen und Argumente entfalte laut Göhler v.a. dann eine Bindungswirkung, wenn die inhaltliche mit
der Beziehungsebene zusammenfalle; in diesem Fall könne auf formale Institutionen
verzichtet werden.
Steuerung durch Symbole findet nach Göhler in jedem Steuerungsarrangement statt;
Symbole sind laut Göhler „die in soziale Praktiken eingebundenen sichtbaren Träger
von Wertvorstellungen, Normen und Werten, die sie in einer sinnlich erfahrbaren
Präsentation konzentrieren“ (ebd.: 699). Symbolische Steuerung erfolgt dann dadurch, „dass sie einen motivbildenden Orientierungsrahmen bereitstellen, der die
Einschränkung
und
Ausrichtung
von
Handlungsoptionen
bewirkt“
(Cohen/
Langenhan 2009: 181, zit. nach Göhler et. al. 2010: 699). Im Bewusstsein potentieller Mehrdeutigkeit zielt sie besonders auf die affektive Ebene, d.h. „dass intentional
durch Symbole mit deren Sinnstiftung Orientierungen vorgegeben oder angeboten
werden, um auf die Handlungsoptionen der Adressaten sowohl kognitiv als auch affektiv einwirken zu können“ (ebd.). Steuerungseffekte werden jedoch durch die Interpretationsfähigkeit der Adressaten beschränkt. Mit Hilfe der Symbole soll entweder
205
Integration erzeugt (Integrationssymbole) oder die Furcht vor etwas Fremdem beschworen werden (Kampfsymbole).
Alle drei Steuerungsmechanismen fußen auf einem kulturellen Resonanzboden aus
affektiven und kognitiven Weltverständnissen. Weiche Steuerung zielt nun je nach
Form in unterschiedlichem Ausmaß auf die kognitive und affektive Ebene. Gleiches
gilt für die Differenzierung zwischen Eindeutigkeit und Mehrdeutigkeit, welche eine
zweite Dimension weicher Steuerungsmodi bilden. Grafisch lassen sich die vorgestellten Steuerungsmodi in den beiden genannten Dimensionen folgendermaßen
verorten:
Abbildung 15: Mechanismen weicher Steuerung nach Göhler et. al. 2010: 703.
Göhler geht nun einen Schritt weiter und kombiniert die drei vorgestellten Steuerungsmodi jeweils paarweise miteinander. Er weist zunächst auf die gegenseitige
Konstitution diskursiver und symbolischer Steuerung hin: „Diskurisve Praktiken tragen […] zur Herstellung des Resonanzbodens für Symbole bei. Andererseits greifen
Diskurse auf Wahrheitsordnungen zurück, die in ganz entscheidender Weise durch
Symbole hergestellt und stabilisiert werden“ (ebd.: 704). Göhler nennt als Beispiel
eine Entschuldigungsgeste, die sowohl durch das Wort als auch durch ihren symbol206
haften Charakter wirkt. Zweitens können durch eine Kombination diskursiver Praktiken mit Argumenten Handlungsoptionen strukturiert werden. Exemplarisch hierfür
spricht Göhler den Umgang mit Armen an: Über Steuerung durch Subjektivierung
(diskursiv) könnte deren Eigenwahrnehmung variiert werden, sodass sie sich mit ihrer eigenen Situation auseinandersetzen. Mittels Steuerung durch Rechtfertigung
könnte die Gegenseite dazu veranlasst werden, über eigenes Versagen hinsichtlich
des Umgangs mit Armen nachzudenken. Drittens und letztens kombiniert Göhler
Steuerung durch Argumente mit der Steuerung durch Symbole. Diese Kombination
erinnert an die Vermengung diskursiver Praktiken mit Symbolen: „Einerseits sind Argumente in vielen Fällen (vor allem in jenen, die sich auf Traditionen und Überlieferungen beziehen) auf die Darstellung und Verdichtung durch Symbole angewiesen.
Andererseits sind Symbole als Ausdruckformen in argumentativ begründbare Deutungssysteme eingebettet, die ihre Deutung und damit ihre Wirkung als Orientierungsvorgaben beeinflussen“ (ebd.: 709).
Im Gegensatz zu den anderen Governance-Konzepten muss man Göhler zu Gute
halten, dass er rein informelle Steuerungsmechanismen entwickelt und in den Blickpunkt rückt. Ob diese tatsächlich wie postuliert frei von Institutionen sind, ist dabei
eine ganz andere Frage, vor deren Beantwortung geklärt werden sollte, was denn mit
einer Institution eigentlich gemeint ist. So kann auch eine regelmäßige Entschuldigung - man denke nur an die Holocaust-Thematik - sich verselbständigen und als
Ritual institutionalisiert werden. Göhler behält zudem die typologisierende Einordnung von Steuerungskonzepten bei. Dass es sich dabei um eine rein wissenschaftliche und weniger reale Trennung handelt, gibt er selbst zu, indem er auf die Kombinationsmöglichkeiten der genannten Typen hinweist. Jedoch muss man an Göhler
wie an den anderen Governance-Autoren auch kritisieren, dass sie darauf verzichten,
theoretisch zu erklären, wie gesteuert wird; hier handelt es sich somit um ein wissenschaftstheoretisches Defizit. Daneben steht zur Debatte, inwieweit weiche Steuerung
in von Gewalt getränkten Räumen zur Durchsetzung von Politik taugt. Nicht zuletzt
fällt Göhler wieder in die alte Dichotomie von Steuerungsobjekt und Steuerungssubjekt zurück. Laut Göhler gewinne man dadurch Ergebnisse und Vorteile der Machttheorien in die Steuerungsdiskussion zurück - darüber ließe sich jedoch bestimmt
streiten.
207
5.4.5 Fazit
Es ist keineswegs klar, ob es sich bei den neuen Regierungsformen im Sinne des
Governancekonzepts um „einen epochalen Wandel ausgelöst durch reale Veränderungen von Staatlichkeit handelt […] oder lediglich um eine eher quantitative als qualitative Veränderung des Auftretens verschiedener Formen von Steuerung“ (von Blumenthal 2005: 1153).
Probleme bereitet auch die Bewertung von Governance. Auf der einen Seite entsprechen diese Regierungsformen den zunehmenden Partizipationswünschen, auf
der anderen Seite bleiben Fragen nach der Legitimation der Beteiligung privater Akteure unbeantwortet (vgl. von Blumenthal 2005: 1153). Cord Schmelzle weist darauf
hin, dass es Governance aus politikwissenschaftlicher Perspektive ebenso wie Steuerung um die Bereitstellung öffentlicher Güter oder kollektiv verbindlicher Entscheidungen gehe, d.h. es „müssen für sie im Prinzip die gleichen normativen Kriterien
gelten, die an staatliches Handeln bei der Erbringung öffentlicher Leistungen angelegt werden“ (Schmelzle 2008: 165). Problematisch sei insbesondere das Fehlen einer eindeutigen Regelungsinstanz und einer eindeutig bestimmbaren Bezugseinheit
politischer Entscheidungen, also klassische Bezugspunkte in Legitimationskonzepten
(vgl. dazu Schmelzle 2008: 162 ff.). Darüber hinaus sei jede Governance-Konzeption
quasi einem doppelten Gemeinwohlimpetus verhaftet, denn sie „will das Gemeinwohl
prozeduralistisch bestimmen, zugleich aber resultatsbezogen“ (Haus 2010: 465).
Zeitgleich würden die Vertreter jedoch die Auseinandersetzung mit Gemeinwohlkonzepten scheuen und so einen gewissen Idealismus, wenn nicht gar Naivität zeigen
(vgl. ebd.: 461). Governance müsste von daher thematisieren, wann bzw. ob es um
gemeinwohl- oder interessengeleitete Problemlösungen gehe bzw. „welche Probleme
von den verschiedenen Governance-Institutionen tatsächlich aufgegriffen und welche
anderen vernachlässigt werden (Mayntz 2008: 56).
Es darf nicht übersehen werden, dass gerade die analytische GovernancePerspektive eine Vielzahl an unterschiedlichen Typologien von Governance-Modi
hervorgebracht hat: „Ein wesentlicher Vorteil dieser Betrachtungsweise liegt insofern
darin, einen analytischen Werkzeugkasten zur Beschreibung und zum Verstehen
kollektiven Handelns bereitzustellen“ (Benz et. al. 2007: 18). Eine Vereinheitlichung
unter dem Dach der Politikfeldanalyse würde Forschungsarbeiten erleichtern und
Vergleiche ermöglichen: „Eine einheitliche Systematisierung verschiedener Modi von
Governance und ihre Anwendung sowohl auf Prozesse politischer Entscheidungsfin208
dung als auch politischer Problemlösungen würde einen wesentlichen Fortschritt gegenüber Überlegungen zur Verhandlungsdemokratie oder zum kooperativen Staat
darstellen. Governance als analytischer Zugang könnte so die Chance bieten, verschiedene Stränge der Forschung über Regieren wie der Politikfeldanalyse unter einer gemeinsamen Perspektive zu verbinden und so die Ergebnisse wechselseitig
besser kommunizierbar werden zu lassen“ (von Blumenthal 2005: 1169).
Jann weist etwa darauf hin, dass das Governance-Konzept im Grunde genommen all
jene Merkmale umfasst, die charakteristisch für die Ergebnisse der Policy-Analyse
der vergangenen Jahrzehnte waren, etwa die zunehmende Bedeutung von Netzwerken, dezentrale Problemverarbeitung und die neu erkannte Bedeutung von Verhandlungen (vgl. Jann 2009: 495 f.). Das Governance-Konzept greift damit auf ältere Forschungsergebnisse bezüglich sozialer Koordination zurück. Auch aus einer genuin
steuerungstheoretischen Perspektive zeigt sich, dass Governance nicht nur neue
Steuerungsmodi hervorgebracht, sondern bereits bekannte Konzepte gleichsam
„aufgewärmt“ hat (vgl. Grande 2012: 573). Fraglich bleibt auch, wie leistungsfähig die
neuen Steuerungsmodi sind (vgl. ebd.: 575). Und nicht zuletzt besitzen Typologien
keine Erklärungskraft; „Wirkmechanismen“ können hier nicht erschlossen werden es fehlt ein „theoretischer Kern“ (vgl. ebd.: 579).
Ob Governance als Fundament der Policy-Analyse dienen könne, wird z.B. von
Schuppert bezweifelt: „Man wird - so denke ich - die weitere Entwicklung abwarten
müssen, und ich zögere etwas, den Governance-Ansatz zum alles aufsaugenden
Megakonzept zu überhöhen“ (Schuppert 2011: 10). In eine ähnliche Richtung tendiert Michael Haus, der meint, „dass die Annahme einer alles umfassenden letztlich
eklektischen Governance-Perspektive durch einen kontrollierten Theorienpluralismus
von Governance-Konzepten ersetzt werden sollte, in denen jeweils besondere Verständnisse der Praxis des enthierarchisierten Regierens zum Tragen kommen“ (Haus
2010: 458). Nicht zuletzt habe Governance nur wenige brauchbare empirische Ergebnisse hervorgebracht: „Die Governance-Forschung ist trotz des beachtlichen empirischen Forschungsaufwandes, der in den vergangenen zwanzig Jahren betrieben
wurde, […] noch nicht ausreichend empirisch fundiert“ (Grande 2012: 571). Dies liege an einer kleinteiligen Forschungsarbeit ohne gemeinsam geteilten Rahmen - das
Theoriendefizit wurde bereits genannt. Bestätigt wird dieses Bild durch die Vielzahl
der oben vorgestellten Ansätze etc.
209
Große Ähnlichkeit weist Governance mit dem akteurzentrierten Institutionalismus auf:
„Gemeinsam ist den beiden Ansätzen darüber hinaus der fehlende Anspruch, eine
sozialwissenschaftliche Theorie zu begründen, und das Selbstverständnis als heuristischer Ansatz, als Forschungsperspektive, nach der sich das empirische Material
strukturieren lässt. Übereinstimmung findet sich auch in der Berücksichtigung institutioneller Faktoren“ (von Blumenthal 2005: 1173). Allerdings kann beiden Konzepten
angelastet werden, soziale Integration bzw. -kooperation ausschließlich auf Koordinationsmuster zwischen Staat und Gesellschaft zurückzuführen. Gleichermaßen
müssten für diese Leistung geteilte Denkmuster und Sinnvorstellungen in Betracht
gezogen, d.h. eine kognitive Dimension in den Untersuchungsfokus gerückt werden
(vgl. Benz et. al. 2007: 19).
Unübersehbar ist zudem die mangelnde Präzision einiger Definitionen von Governance. So bestimmt Arthur Benz Governance etwa als „Koordinations- bzw. Ordnungsformen […], die sich durch spezifische Struktur-Prozess-Zusammenhänge und
die durch sie bestimmten Mechanismen der Interaktion von Akteuren beschreiben
lassen“ (Benz 2006: 30). Thomas Risse und Ursula Lehmkuhl verstehen unter Governance „institutionalisierte Modi der sozialen Handlungskoordination zur Herstellung und Implementierung kollektiv verbindlicher Regelungen bzw. zur Bereitstellung
kollektiver Güter für eine bestimmte soziale Gruppe“ (Risse/ Lehmbruch 2007: 13).
Dies mag auch an der überwältigenden Resonanz des Begriffs und damit einhergehend an zahlreichen Definitionen liegen: „Eine inflationäre Verwendung führt aber
auch dazu, dass die Konturen des Begriffs immer unschärfer werden“ (Blatter 2006:
51). Oder anders ausgedrückt: „Mit der Verbreitung eines Begriffs auf immer mehr
Anwendungsbereiche sinkt dessen Klarheit fast zwangsläufig“ (Benz et. al. 2007: 9).
Diese Offenheit des Begriffs hat es jedoch auch ermöglicht, dass man damit „das
Regieren sowohl im internationalen System (jenseits des Staates) als auch innerhalb
des Staates (diesseits des Staates) erfassen kann“ (Börzel 2005: 74). So kann man
zwar dem Governance-Konzept unterstellen, es sei diffus und teils sehr vage. Andere
Autoren legen diese mangelnde Präzision jedoch als Leistungsfähigkeit aus (so z.B.
Schuppert 2011: 45).
Schuppert
lobt
etwa
die
gelungene
Perspektivenerweiterung
um
die
institutionalistische Dimension, wodurch u.a. staatliche Wandlungsprozesse nebst
dynamischen Prozessen besser eingefangen werden könnten. Dies gelte auch für
die Analyse von Verflechtungen, Interdependenzen und Mehrebenensystemen.
210
Ähnlich dazu John Pierre: „Governance theory has tremendous potential in opening
up alternative ways of looking at political institutions, domestic-global linkages, transnational cooperation, and different forms of public-private exchange“ (Pierre 2000:
241). Daneben könnte das Governance-Konzept auch Machtfragen oder Steuerungsversagen thematisieren, nicht jedoch ausbleibende Steuerung aufgrund mangelnder Steuerungsabsicht (vgl. Benz et. al. 2007: 18). In eine ähnliche Richtung gehen De La Rosa und Kötter mit ihrer Feststellung: „Ein Wert von ,Governance‘ besteht deshalb bereits darin, dass sich mit dem Begriff eine Brücke im Gespräch zwischen den Disziplinen schlagen lässt und eine Verständigung möglich wird“ (De La
Rosa/ Kötter 2008: 14). In diesem Sinne würde das Konzept an die Kybernetik der
sechziger und siebziger Jahre erinnern (vgl. ebd.: 15). Es geht also in der Summe
um eine größere Perspektive und nicht um eine präzisere Beschreibung oder gar
Erklärung.
Oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass einseitige Verhandlungslösungen
meist nicht so effektiv sind wie Verhandlungsergebnisse, die im „Schatten der Hierarchie“ eines Staates erzielt worden seien. Verhandlungen in der Politik weisen etwa
wegen Entscheidungsblockaden, suboptimalen Kompromisslösungen, fehlender Bindungswirkung und Kosten für Dritte eine besondere Brisanz bzw. Konflikthaftigkeit
auf (vgl. Mayntz 2010: 44 f.). Daran zeigt sich, dass die Governance-Debatte zunächst eine Schwächung des Staates und damit einhergehende reduzierte Teilnahmen desselben an der Generierung von Politik attestierte, um ihn dann doch quasi
durch die Hintertür wieder einzuführen. Michael Haus hierzu: „Dennoch bleibt die Diagnose des regelmäßigen Scheiterns hierarchischer Staatsinterventionen unverzichtbares Moment der Plausibilisierung auch eines analytischen Verständnisses der
Governance-Perspektive, denn ohne diese Diagnose würde die Auseinandersetzung
mit nicht-hierarchischen Formen kaum als lohnend erscheinen“ (Haus 2010: 460).
Wird die Idee eines Schattens der Hierarchie beibehalten, so eignet sich das Governance-Konzept nur für westliche Industriestaaten und gibt damit seinen umfassenden
Anspruch auf - von Governance „in Räumen begrenzter Staatlichkeit“ kann damit
keine Rede mehr sein. Anke Draude spricht in dieser Hinsicht von einem gewissen
Eurozentrismus des Governance-Konzepts (vgl. Draude 2008: 100 ff.). Die klassischen Akteurstypen würden beibehalten; es fände lediglich eine Ergänzung um „die
Gesellschaft“, also gesellschaftliche Akteure, statt: „Man bewegt sich, trotz der ohne
Zweifel differenzierteren Beobachtungen, mit der Steuerungstheorie in der kulturellen
211
,Matrix‘ […] Europas, in der Staat und Gesellschaft, Öffentliches und Privates substantiell voneinander unterschieden werden“ (ebd.: 104). Die Lösung dieses Dilemmas liege laut Draude in einem Äquivalenzfunktionalismus, der eurozentrische Beobachtungen überwinden und den Blick für weitere Formen von Governance öffnen
möchte. Dadurch sollen weitere Akteure, die sich z.B. nicht nach staatlich oder öffentlich unterscheiden lassen, erfasst und die Funktion des Regierens weiter differenziert werden, etwa nach Sicherheits-, Herrschafts- und Wohlfahrtskriterien (vgl.
ebd.: 108 f.).
212
Teil II: Ein autopoietisch fundiertes Steuerungsmodell
In den vorausgegangenen Kapiteln wurden gängige Steuerungskonzepte der Politikwissenschaft vorgestellt und ausführlich diskutiert. Es handelte sich dabei um Steuerungskonzepte, die - wie Planungsskonzepte - ihren Zenit schon geraume Zeit überschritten haben oder - wie Governance - dem aktuellen Stand der Disziplin entsprechen. Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung wurde insbesondere auf Defizite
und Mängel dieser Konzepte verwiesen, die etwa metatheoretische oder inhaltlichplausible Fragen betrafen. Dabei wurde nachgewiesen, dass all diese Konzepte bestimmte Unzulänglichkeiten aufweisen und somit keine Steuerungstheorie und kein modell vorliegt, mit welchem moderne politische Regelungsprozesse adäquat beschrieben oder sogar erklärt werden könnten. Im folgenden II. Teil dieser Arbeit soll
dafür plädiert werden, das Modell der Autopoiese als Grundlage eines passablen
Erklärungsmodells zu verwenden. Doch zuerst sollen nochmals all jene Defizite der
vorgestellten Steuerungskonzepte überblicksartig zusammengefasst werden, um
dann die zentralen Kritikpunkte gleichsam herauszudestillieren. Anschließend wird es
im Kapitel 8 darum gehen, den Transfer des Modells gemäß wissenschaftstheoretischen Kriterien vorzubereiten. Im dann folgenden Kapitel 9 soll im Rahmen einer rationalen Rekonstruktion das Modell der Autopoiese präzisiert und einem Modelltransfer zugänglich gemacht werden. Als Zwischenschritt werden im Kapitel 10 dann geläufige politikwissenschaftliche, autopoietisch fundierte Steuerungskonzepte vorgestellt und kritisch überprüft werden, bevor im Kapitel 11 das eigentliche Steuerungsmodell dargestellt werden wird.
6. Warum gängige Steuerungskonzepte verwerfen? Autopoiese
als Allheilmittel?
Zunächst wurden Rationalitätskonzepte vorgestellt, die in der Literatur meist unter
dem Schlagwort „Planung“ firmieren. Als erstes wurden diese Konzepte durch eine
Betrachtung verschiedener Dimensionen des Planungsbegriffs durchleuchtet, darunter etwa Planungsfunktionen und -typen, um zu klären, womit sich Planungstheorie
generell beschäftigt. In der Folge wurden einzelne Konzepte vorgestellt, z.B. entscheidungstheoretische bzw. systemanalytische Ansätze wie Böhrets Modell rationaler Entscheidung, gesellschaftspolitische Ansätze wie Mayntz‘ und Scharpfs Konzept
der pluralistischen Systempolitik („Aktive Politik“), kybernetische Ansätze wie
213
Stachowiaks Vorstellung von Politik als kybernetischem System oder moderne Ansätze wie etwa Gansers perspektivischer Inkrementalismus oder Konzepte kooperativer und kommunikativer Planung.
Erstens wurde kritisiert, dass all jene Konzepte an einer teils unpräzisen Begrifflichkeit leiden. So findet sich kaum eine allgemein anerkannte Definition des Begriffs
„Plan“. Darüber hinaus ist meist nur vage bestimmt, was Begriffe wie „Plan“, „Planung“, „Entscheidung“ oder „verwaltungsmäßige Entscheidungsvorbereitung“ verbindet oder voneinander trennt. Zweitens wurde bemängelt, dass sämtliche politikwissenschaftliche Rationalitätskonzepte das politisch-administrative System als den
zentralen Planer ausweisen. Diese Idee wirkt jedoch nicht sonderlich realitätsnah,
haben doch empirische Forschungen und theoretische Überlegungen schon länger
die Vorstellung von der Differenzierung zwischen Steuerungssubjekt, Steuerungsobjekt und damit verbundener kausaldeterministischer Steuerung beanstandet. Damit
verbunden ist die Überlegung, dass Planung rational sein soll, wobei hier die Rationalität des politischen Systems gemeint ist und sich durch Effizienz und Effektivität
bemisst. Dabei ist jedoch fraglich, ob es genügt, Planungsprozessen, die gesamtgesellschaftliche Entscheidungen zur Folge haben, ausschließlich die Rationalität des
politisch-administrativen Systems zugrunde zu legen. Mit diesen Überlegungen hängt
auch die Problematik langfristiger Planung zusammen. Hier wurde v.a. der Umstand
bedacht, dass zukünftige Probleme neue Betroffene zeitigt, die noch nicht antizipiert
werden können. Planung solle daher eher auf kurzfristige, konsensuale Problemlösungen anstelle auf langfristige Strukturentwicklung setzen. Dabei gerät die Vorstellung von Planung in reduziertem Umfang in Konflikt mit einem allgemein gesteigerten
Steuerungsbedürfnis. Zukunftsorientierung spiele höchstens im Rahmen von nachhaltiger Entwicklung eine Rolle. Allerdings ist nur schwer zu bemessen, was Nachhaltigkeit meint bzw. wessen Vorstellungen von Nachhaltigkeit in der Planung berücksichtigt werden sollen. Planungskonzepte eignen sich drittens kaum für empirische Forschungsarbeit. Gezeigt wurde, dass Planungstheorien empirisch prinzipiell
feststellbare Planungsprozesse nur schwerlich wissenschaftlich erfassen können.
Dies gilt umso mehr für informelle Planungsprozesse, die sich nicht in rationale (Planungs-)Schemen zwingen lassen; kybernetische Modelle missachten i.d.R. sogar
komplett, wie geplant wird. Darüber hinaus konzentriert sich die Planungsforschung
auf Planungsprozesse und übersieht zumeist die Outcomes politischer Planung. Viertens versammelt sich weitere Kritik an den Rationalitätskonzepten unter den Schlag214
wörtern der „Varietäts“- und „Komplexitätsproblematik“. Erstere beschreibt die Unmöglichkeit eines jeden politisch-administrativen Systems, für jedes gesellschaftliche
Problem eine ideale Lösung parat zu haben. Selbst wenn dies gelingen sollte, würde
Politik mit der Komplexitätsproblematik konfrontiert werden, wonach es unmöglich
sei, sämtliche Problemzusammenhänge im politischen System abzubilden. Diese
beiden Punkte spiegeln sich z.B. in der umfassenden Kritik an entscheidungstheoretischen Ansätzen bzw. am Zweck-Mittel-Handeln wieder. Damit verbunden ist fünftens eine Informationsproblematik, die darauf hinweist, dass Planung oft an zu viel
oder zu wenig Information oder der Art und Weise der Informationsverarbeitung
scheitert. Sechstens ist an dieser Stelle auch die Kommunikationsproblematik zu
nennen, wobei es wie gezeigt um Kommunikationsschwierigkeiten im Rahmen moderner Planungsprozesse geht. Jüngere Planungskonzepte lassen offen, was sie
unter Kommunikation verstehen bzw. wie Kommunikation funktioniert, obgleich sie
ebenjene Kommunikation als zentralen Baustein in Planungsprozessen ausweisen.
Nach den Rationalitätskonzepten wurden Staats- und Gesellschaftstheorien vorgestellt und kritisch beäugt. Als Beispiele für moderne Staatstheorien wurde Dietmar
Brauns kooperativer Staat, Manfred Glagows und Uwe Schimanks Selbststeuerungsarrangements, Gunnar Folke Schupperts Staatstypologie, das Konzept des Aktivierenden Staates und - etwas exotisch, da auf der kritischen Theorie basierend Joachim Hirschs politökonomischer Ansatz gewählt. Für die Gesellschaftstheorien
wurde exemplarisch Uwe Schimanks Gesellschaftsmodell und das daraus abgeleitete Konzept sozialer Steuerung vorgestellt.
Zunächst einmal leiden v.a. Staatstheorien wie die Rationalitätskonzepte an einer
unpräzisen Begrifflichkeit. So bleibt vollkommen unklar, wer oder was eigentlich „der
Staat“ ist. Meist entwickeln Autoren dieser Richtung jeweils eigene Definitionen und
rekurrieren zu diesem Zweck auf beliebige Beschreibungen des Staates. Im Hinblick
auf Präzision fallen Staatstheorien somit hinter den Entwicklungsstand systemtheoretischer Ansätze („politisch-administratives System“) zurück. Zweitens müssten moderne Staatstheorien, die i.d.R. Kooperation oder indirekte Steuerung favorisieren,
eingestehen, dass ebenjene Mechanismen keine Problemlösungen garantieren. Daneben übersehen sie, wie oft hierarchische Regelung nach wie vor Verwendung findet. Drittens vermischen solche „Theorien“ häufig die normative mit der empirischen
Ebene. Dies betrifft zum Einen die Verwechslung von normativer Erwünschtheit
staatlicher Steuerungsfähigkeit und dem politikwissenschaftlichen Forschungsinte215
resse an den empirischen oder analytischen Bedingungen soziopolitischer Steuerung. Zum Anderen geht es dabei um die Empfehlung von Steuerungsstrategien basierend auf reiner Theorie unter Missachtung jeglicher empirischer Forschungsarbeit;
auf diese Weise ersetzt normatives Denken empirische Überprüfung. Viertens bieten
Staatstheorien zumeist Staatstypen oder Typologien von Steuerungsmechanismen.
Gesellschaftstheorien postulieren allenfalls aus bestimmten Vorstellungen über Gesellschaft abgeleitete Steuerungskonzepte. Beide liefern jedoch keine ausgefeilten
Erklärungsmodelle oder Steuerungstheorien bzw. -modelle.
Auf die Staats- und Gesellschaftstheorien folgte eine Vorstellung
policy-
analytischer Konzepte. Ging es zunächst um klassische Konzepte wie den Policy
Cycle oder Werner Janns Policy-Making-Modell, wurden anschließend Konzepte und
Theorien aus dem Bereich der Netzwerkanalyse und -theorie, etwa Policynetzwerke,
und des Governance-Ansatzes vorgestellt. Letzterer wurde in Bezug auf verschiedene analytische Ebenen durchleuchtet, so z.B. in Bezug auf eine normative oder analytische Dimension, auf eher prozessuale oder strukturelle Aspekte oder nach Gerhard Göhler im Hinblick auf harte oder weiche Steuerung.
Wurde sowohl dem Policy-Cycle als auch Janns Policy-Making-Modell zunächst vorgehalten, Politik lediglich technokratisch-instrumentell zu verstehen oder sich nur auf
hierarchische Steuerung zu konzentrieren, so lässt sich erstens aus metatheoretischer Perspektive beiden Ansätzen vorwerfen, dass sie kein Kausalmodell bieten
und eine wissenschaftliche Erklärung politischer Steuerung verunmöglichen. Ähnliches gilt auch für die Netzwerkanalyse und Governancekonzepte. Den Netzwerkansätzen ist es nicht gelungen, eine Netzwerktheorie politischer Steuerung zu entwickeln. Sie zeigen allenfalls, wie Policies durch Netzwerke zustandekommen, bieten
jedoch keinen Wirkungszusammenhang dieser Policies in Bezug auf das zu steuernde Objekt. Governance-Konzepte haben lediglich Beschreibungen oder Typologien
in peto und bieten somit ebenfalls keine Erklärungen oder Theorien. Zweitens existiert für den Governance-Begriff vergleichbar wie für „Planung“ oder „Staat“ keine
allgemein anerkannte Definition, sodass der Gegenstand breiten Interpretationsspielraum lässt. Drittens taugt das Governance-Konzept nur bedingt zur Modellierung
komplexer Mehrebenenprozesse. Governancetypologien beschränken sich auf wenige Steuerungsmechanismen, dadurch werden jedoch andere ausgeschlossen. Komplexe Steuerungsvorgänge in Mehrebenensystemen können damit kaum erfasst
werden. Viertens wird dem Governance-Verständnis vorgeworfen, es sei implizit ge216
meinwohlorientiert - auch hier verschwimmt somit die normative mit der analytischempirischen Ebene. Fünftens wird meist nur ungenau wiedergegeben, wie eigentlich
gesteuert wird. So wird häufig Steuerung durch Verhandlung als empirische Tatsache festgestellt oder als Regelungsmodus empfohlen; eine theoretische Durchdringung des Verhandlungsbegriffes bleibt jedoch aus. Sechstens wird die Rolle des politischen Systems gelegentlich über- oder unterschätzt. Wird das Governance-Konzept
etwa auf Dritte-Welt-Staaten angewandt, wird Steuerung häufig durch Partizipation
privater Akteure oder Deliberation postuliert - die Rolle staatlicher Arrangements wird
dabei meist außen vorgelassen. Andererseits wird Governance in Bezug auf politische Systeme von einigen Kritikern als alter Wein in neuen Schläuchen charakterisiert, da es lediglich die Ergebnisse der Policy-Analyse wiederhole und dann ausschließlich auf westliche Staaten anwendbar sei. Hier würde zudem allen Steuerungsmechanismen der „Schatten der Hierarchie“ übergeordnet; andere Steuerungsarrangements fristen dann wortwörtlich ein „Schattendasein“.
Abschließend wurden Konzepte aus dem Gebiet der Systemtheorie vorgestellt. Zuerst wurde mit David Eastons Systemmodell ein Beispiel für offene Systeme präsentiert. Easton wurde zeitlebens für die Modellierung des Politischen als „black box“
kritisiert, denn hier wurde gerade nicht verdeutlicht, wie Politik steuert. Desweiteren
handelt es sich bei seinem Systemmodell allenfalls um begriffliche Verbindungen;
eine Erklärung von Regelungsprozessen liefert er de facto nicht. Darüber hinaus wird
auch nicht präzisiert, wie genau einzelne Faktoren aufeinander wirken; es werden im
Grunde genommen lediglich zeitliche Folgen angegeben. Nicht zuletzt blieb Eastons
Systemmodell als klassische Systemtheorie auf der Makroebene verhaften. Im Folgenden werden weitere systemtheoretische Steuerungskonzepte oder -modelle vorgestellt werden, die aber im Gegensatz z.B. zu Eastons Variante das Politische System als ein geschlossenes („autopoietisches“) System modellieren. Hier haben es
v.a. die Varianten von Niklas Luhmann und Axel Görlitz et. al. zu einer gewissen
Prominenz geschafft.
Bis zu diesem Abschnitt wurden in dieser Arbeit gängige politikwissenschaftliche
Steuerungskonzepte vorgestellt und kritisch diskutiert. Dabei hat sich gezeigt, dass
alle dieser Konzepte deutliche Mängel aufweisen. Teilweise betrafen diese Defizite
nur ein bestimmtes Steuerungskonzept; gelegentlich lassen sich aber auch Problembereiche ausmachen, die mehreren dieser Konzepte anhaften. Die zentralen Defizite
sollen hier nochmals in gebotener Kürze summiert werden:
217
Allen Konzepten wurden wissenschaftstheoretische Mängel nachgewiesen. Zunächst bestehen einige der genannten Konzepte aus einer unscharfen Begrifflichkeit.
Bleiben Definitionen schwammig, folgt daraus eine mangelnde Präzision des gesamten Konzepts. Daneben wurden teilweise Verwechslungen metatheoretischer Ebenen ausgemacht. In einem Fall wurde die normative mit der analytischen oder empirischen Ebene vermengt; andere Konzepte verzichteten auf die gesonderte und dennoch verbindende Modellierung der Makro- und der Mikroebene. Ferner handelt es
sich bei den meisten Steuerungskonzepte gerade um keine Theorie politischer Steuerung, sondern meist um Konzepte oder Ansätze, allenfalls Modelle. Staats„theorien“ oder Konzepte aus dem Governance-Bereich bieten sogar lediglich Typologien. Theorien oder Modelle unterscheiden sich jedoch ganz erheblich in ihrem Erklärungsgehalt von Ansätzen, Typologien oder Konzepten. Darüber hinaus verzichten die meisten der vorgestellten Konzepte etc. darauf, sozialtheoretische Voraussetzungen von Steuerung zu modellieren. Nicht zuletzt hat sich bei einigen Ansätzen
gezeigt, dass eine empirische Anwendung kaum oder auch gar nicht möglich ist.
Auch aus inhaltlicher Perspektive erfuhren die vorgestellten Konzepte Kritik.
Zunächst wurde bemängelt, dass in einigen der Konzepte dem politischadministrativen System ein unangemessener Platz zugewiesen wurde. So erscheint
das PaS insbesondere bei den Rationalitätskonzepten, den frühen Staatstheorien
oder auch dem Easton’schen Systemmodell als zentrales Steuerungssubjekt, wodurch weitere Akteure, Systeme, Organisationen etc., die ebenfalls auf Steuerungsprozesse einwirken können, missachtet wurden. Andererseits drängen einige Governance-Konzepte das politisch-administrative System förmlich an den Rand wie auch
autopoietische Systemtheorien diesem eine Steuerungsfähigkeit entweder ganz absprechen oder zumindest nur in reduziertem Maße zugestehen (was noch zu zeigen
sein wird). Damit einhergehend werden schlichte Steuerungsarrangements in allen
Konzepten präferiert und so eine wesentlich präzisere Einordnung des politischen
Systems unterlassen. Relevant ist zudem die Frage nach dem Umgang des politischadministrativen Systems mit der gesamtgesellschaftlichen Komplexität; in der Literatur wird diese Frage meist unter den Schlagwörtern „Komplexitäts-„ und „Varietätsproblematik“ diskutiert. V.a. Rationalitätskonzepte reflektierten ihren defizitären Umgang mit Komplexität oder Problemzusammenhängen kritisch; im Grunde genommen
treffen diese Defizite jedoch auf alle gängigen Steuerungskonzepte zu. Nicht zuletzt
reflektieren allenfalls Systemtheorien oder jüngere Alternativen zu Planungskonzep218
ten die Frage danach, wie Informationen im jeweiligen Konzept oder Modell prozessiert oder als theoretischer Baustein erfasst werden können.
Gesucht wird also eine Steuerungstheorie oder ein -modell, das
-
aus einer exakten Begrifflichkeit besteht und präzise aufgebaut ist,
-
gemäß der empirisch-analytischen Metatheorie argumentiert und auf normative Exkurse verzichtet,
-
sowohl die sozialwissenschaftliche Makro- als auch die Mikroebene ins Visier
nimmt,
-
als Modell oder Theorie das Potential besitzt, politische Steuerungsprozesse
mindestens zu beschreiben, möglicherweise auch erklären zu können,
-
sozialtheoretische Voraussetzungen von Steuerung in den Modellentwurf einbezieht,
-
Möglichkeiten zur empirischen Anwendbarkeit entfaltet,
-
dem politisch-administrativen System einen angemessenen Platz als Modellbaustein einräumt,
-
einen adäquaten Umgang mit gesamtgesellschaftlicher oder problembereichsspezifischer Komplexität gestattet und damit zusammenhängend einen plausiblen Begriff von Rationalität entwickelt,
-
und nicht zuletzt darüber reflektiert, wie Informationen kommuniziert oder verarbeitet werden können.
219
7. Wissenschaftstheoretische Vorüberlegungen
Die Theorie der Autopoiese gehört zu den Selbstorganisationstheorien. Bereits in
den achtziger Jahren wurde sie von den Sozialwissenschaften adaptiert und hat zu
Erkenntnissen beigetragen, wie der Untersuchungsgegenstand „Gesellschaft“ aus
systemtheoretischer Perspektive alternativ formuliert werden könnte. Dabei blieb jedoch eine gewisse Präzision auf der Strecke; manche Annahmen blieben in den Kinderschuhen stecken: „So erkennt man etwa, daß bei Selbstorganisationsphänomenen in physischen, chemischen und organischen Systemen katalytische und autokatalytische Prozesse sowie das Zusammenspiel bzw. die Interferenz verstärkender
und dämpfender Wechselwirkungen zwischen Elementen, die mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit ablaufen, von zentraler Bedeutung sind. Solche Hinweise führen
allerdings so lange nicht viel weiter, wie man nicht gegenstandsbezogen sagen kann,
was bei welcher Intensität oder Häufigkeit wodurch in menschlicher Interaktion verstärkt oder gedämpft wird, d.h., es ergeben sich nur – aber immerhin! – ein paar sehr
grobe Hinweise auf die Richtung, in der man suchen könnte“ (Mayntz 1991: 321). In
die gleiche Richtung geht Klaus von Beymes Fazit: „Die Theorie der Selbstorganisation hat […] die politische Theoriebildung vereinzelt erreicht. Noch ist der Erkenntnisgewinn bescheiden. Es überwiegt der metaphorische Sprachgebrauch“ (Beyme
2006: 218).
Aus diesem Grund gilt es, sich vor der fachfremden Verwendung der Autopoiesetheorie zunächst der generellen Kritik an der Übernahme naturwissenschaftlicher
Modelle bzw. Theorien durch die Sozialwissenschaften zu stellen, sie zu entschärfen
oder ggf. hieraus Konsequenzen zu ziehen und darauf aufbauend allgemeine wissenschaftstheoretische Überlegungen anzustellen. Anschließend wird eine Rekonstruktionsmethode vorgestellt werden, mit deren Hilfe die Theorie der Autopoiese
für die Übernahmezwecke präzisiert und in eine transferable Form gebracht werden
soll. Daran anknüpfend werden mit der Analogisierung, der Theorienvereinheitlichung und dem strukturalistischen Wissenschaftsverständnis nebst dem dazugehörigen Konzept der intertheoretischen Links potentielle Übertragungswege diskutiert
werden, wobei die letztgenannte Variante favorisiert werden soll. In diesem Rahmen
wird dann nicht nur die Transfermethode präsentiert, sondern werden zugleich die
Begriffe „Modell“ und „Theorie“ geklärt und ggf. präzisiert werden, was sich bei genauerer Betrachtung der vorausgehenden naturwissenschaftlichen Kritiken geradewegs aufzwingt. Im Folgenden zweiten Teil der wissenschaftstheoretischen Vorüber220
legungen wird auf sozialtheoretische Erklärungsstandards - genauer die MakroMikro-Makro-Problematik - eingegangen werden.
7.1 Theorien- bzw. Modelltransfers
7.1.1 Kritik der Naturwissenschaften an der Übernahme ihrer Modelle
und Theorien in die Sozialwissenschaften
Das naturwissenschaftliche Lager warf den Sozialwissenschaften häufiger vor, sie
seien ideenlos oder würden als Abhilfe Konzepte aus den Naturwissenschaften
übernehmen, ohne deren Kompatibilität genauer zu hinterfragen. Es wird noch gezeigt werden, wie sehr sich z.B. die Luhmann’sche Autopoieserezeption den Vorwurf
gefallen lassen musste, sprachlich sehr abstrakt - um nicht zu sagen: aufgeblasen zu sein, ohne jedoch den theoretischen Hintergrund der Autopoiesetheorie genauer
zu hinterfragen. Dies ist im Übrigen ein Vorwurf, der die Sozialwissenschaften auch
in anderen Bereichen schon oft getroffen hat (vgl. Andreski 1977: 59 ff.).
Zwei der bekanntesten dieser Kritiker sind Alan Sokal und Jean Bricmont. Die beiden
haben 1996 in einer populären sozialwissenschaftlichen Zeitschrift den Aufsatz mit
dem Titel „Die Grenzen überschreiten: Auf dem Weg zu einer transformativen Hermeneutik der Quantengravitation“ veröffentlicht (vgl. Sokal/ Bricmont 1998: 18 f.). Sie
verschwiegen jedoch, dass dieser Aufsatz voll von Absurditäten, Trugschlüssen und
logischem Unsinn war, und verschleierten dies hinter einer ihrer Meinung nach typisch sozialwissenschaftlichen Sprache, indem sie „die Parodie um Zitate berühmter
französischer und amerikanischer Intellektueller zu den angeblichen philosophischen
und gesellschaftlichen Implikationen der Mathematik und der Naturwissenschaften
herum“ konstruierten (ebd.: 19). Es ging ihnen um „den wiederholten Mißbrauch von
Ideen und Begriffen aus der Mathematik und Physik“ (ebd.: 20). Noch schlimmer war,
dass dieser Aufsatz Gegenstand der wissenschaftlichen Debatte wurde und scheinbar jede Kritik an ihm abprallte. Sokals wesentliche Kritikpunkte lauteten:
1. „Die weitschweifende Darstellung naturwissenschaftlicher Theorien, von denen man günstigstenfalls eine äußerst vage Vorstellung hat. Die gebräuchlichste Taktik besteht darin, sich einer wissenschaftlichen (oder pseudowissenschaftlichen) Terminologie zu bedienen, ohne sich übermäßig darum zu
kümmern, was die Wörter eigentlich bedeuten.
221
2. Die Übernahme von Begriffen aus den Naturwissenschaften in die Geistesoder Sozialwissenschaften ohne die geringste inhaltliche oder empirische
Rechtfertigung. […]
3. Die Zurschaustellung von Halbbildung, indem man schamlos mit Fachbegriffen um sich wirft, die im konkreten Zusammenhang völlig irrelevant sind. Der
Zweck besteht zweifelsohne darin, den wissenschaftlich nicht vorgebildeten
Leser zu beeindrucken und - vor allem - einzuschüchtern. […]
4. Die Verwendung von im Grunde bedeutungslosen Schlagwörtern und Halbsätzen“ (ebd.: 20 f., Hervorhebung im Original).
Sokal und Bricmont wollten jedoch nicht jedweden interdisziplinären Austausch verhindern und gaben deswegen ein paar Verhaltensstandards mit auf den Weg (vgl.
ebd.: 232 ff.). Erstens meinen sie, „man sollte schon wissen, wovon man spricht“,
d.h. sie fordern ein tiefes Verständnis der diskutierten Theorien (ebd.: 232). Zweitens
sollte das Thema in einer verständlichen Sprache dargestellt werden. Dies gelte für
Gebiete mit und erst recht für solche ohne sonderlich intellektuellen Tiefgang. Drittens sollten naturwissenschaftliche Begriffe nicht als Metaphern verwendet werden,
da sie einen ganzen wissenschaftlichen Kontext eröffneten, der dann verborgen bliebe. Viertens sollten wissenschaftliche Disziplinen ihren eigenen Methoden und Paradigmen treu bleiben. Fünftens sollte Autoritäten nicht nur um ihrer Autorität willen
gehuldigt werden. Wichtiger seien überzeugende Fakten und Argumente. Sechstens
sollten Behauptungen nicht mehrdeutig sein, auch wenn damit eine Einbuße an Popularität einhergehe.
Vergleichbar mit den Überlegungen Sokals und Bricmonts - wenn auch nicht gezielt
gegen die sozialwissenschaftliche Autopoieserezeption - ist die Kritik von Stanislav
Andreski. Er behauptet zunächst, es sei geradezu unmöglich, mit einem durchaus
komplexen menschlichen Hirn einen Gegenstand zu erfassen, der noch komplexer
sei, und bezog sich damit auf die Gesellschaft als Untersuchungsobjekt: „Doch wenn
wir die Auffassung akzeptieren, daß begriffliches Verstehen ein gewisses physiologisches Gegenstück hat, und dabei im Gedächtnis behalten, daß die Zahl der Neuronen und Synapsen zwar von astronomischer Größe, aber doch endlich ist, dann folgt
daraus, daß, während der Geist durchaus in der Lage sein mag, ein perfektes Modell
von Dingen, die einfacher sind als er selber, auszuarbeiten, seine Fähigkeit, Modelle
von Objekten zu konstruieren, die gleich oder komplizierter sind, sehr beschränkt ist.
Es scheint daher unmöglich, daß unser Verstehen von anderen Geistesverfassungen
222
und ihrer Aggregate je den Grad an Entsprechung von Physik und Chemie erreichen
kann, der durch die Einfachheit und Invarianz ihrer Objekte gegeben ist“ (Andreski
1977: 18).
Dabei übersieht Andreski jedoch, dass es nicht der Anspruch eines Modells ist, eine
exakte Entsprechung der Realität zu liefern, sondern diese lediglich unter Abstraktion
von Unwesentlichem - also in reduzierter oder vereinfachter Art und Weise - abzubilden. Darum wird es auch in dieser Arbeit gehen; Ziel kann also gerade nicht ein perfektes Abbild gesellschaftlicher (Steuerungs-)Prozesse sein, sondern eben ein abstrahierendes, idealisierendes und verkürzendes Modell. Desweiteren meint Andreski,
ein immenses Problem, „Generalisierungen über das Netz menschlicher Beziehungen zu machen, ist die Tatsache, daß sie sich dauernd verflüchtigen“ (ebd.). Dieses
Argument kann auf zwei Arten widerlegt werden: Erstens ist es ja kein Grund, (sozial) wissenschaftliche Ansprüche in die Altkleiderkammer zu tragen, nur weil der Untersuchungsgegenstand nicht genehm ist. Diesem Umstand muss der Wissenschaftler
entgegenkommen, was für diese Arbeit bedeutet, zu akzeptieren, dass moderne Gesellschaften ungebundener, spontaner, sprunghafter und flexibler sind. Und zweitens
weist etwa Renate Mayntz darauf hin, dass auch naturwissenschaftliche Gegenstände wie der homo sapiens oder das HIV-Virus sich entwickelt haben und dementsprechend von äußerster Komplexität seien (vgl. Mayntz 2005: 40).
Auch aus sozialwissenschaftlicher Perspektive wurde die Übernahme naturwissenschaftlicher Theorien bzw. Modelle in die Sozialwissenschaften kritisiert. Renate
Mainz wies darauf hin, dass eine korrekte Übertragung des autopoietischen Begriffsund Konzeptionsspektrums auf die Sozialwissenschaften nicht gelungen sei: „Bei
den diskursiven Übernahmen gegenstandsbezogener naturwissenschaftlicher Theorien kann allerdings von einer Übertragung im strikten Sinne praktisch nicht die Rede
sein. Wohl gibt es Versuche, mit peinlicher - und peinlich wirkender - Genauigkeit
nach sozialwissenschaftlichen Entsprechungen für Schlüsselbegriffe der naturwissenschaftlichen Theorien zu suchen, ohne daß dabei dem Isomorphieproblem die
nötige Beachtung geschenkt würde. Bei dieser Art von rein metaphorischer Übertragung handelt es sich bestenfalls um semantische Innovationen, die unserem Wissen
über die soziale Wirklichkeit nichts hinzufügen, da lediglich bekannte Sachverhalte in
einer neuen Terminologie beschrieben werden“ (Mayntz 1991: 317). Diesen Weg hat
z.B. Niklas Luhmann - überraschenderweise entgegen der Ansicht von Mayntz‘ (vgl.
ebd.) - beschritten. Analog zu Sokal und Bricmont meint sie zudem, die Übernahme
223
sei häufig vollzogen worden, um sich ein von den Naturwissenschaften gewebtes
Mäntelchen der Autorität umzulegen: „Manchmal scheint es fast so, als ob ein Soziologe, um zur kognitiven Avantgarde in unserem Fach gerechnet zu werden, von
Synergetik, Autopoiesis und deterministischem Chaos reden und sich demonstrativ
mit den Werken von Prigogine, Haken, Maturana, Thom und Eigen vertraut zeigen
muß“ (Mayntz 1991: 313).
Auch aus inhaltlicher Perspektive lehnt Mayntz die Übernahme solcher Modelle bzw.
Theorien ab, da sie meint, eine richtige Erklärung von Makrophänomenen würde dadurch trotz Verbindung von Mikro- und Makroebene verfehlt. Mayntz begründet ihre
Haltung v.a. mit der permanenten gegenseitigen Beeinflussung sozialer (Sub)Systeme: „Menschen sind fähig zur Organisation und zur kollektiven Zielsetzung.
Die Existenz mächtiger korporativer Akteure ist eine Folge davon; sie intervenieren
oder versuchen wenigstens zu intervenieren, wenn ihnen das antizipierte Ergebnis
spontaner Strukturbildungsprozesse, von Fluktuationen, Teufelskreisen und Spiralen
unerwünscht scheint. Spontane, naturwüchsige Prozesse kollektiven Verhaltens
werden so permanent umgelenkt. Nur wenige Makroereignisse bzw. Makrostrukturen
sind demzufolge wirklich reine Emergenzphänomene im Sinne naturwissenschaftlicher Paradigmen“ (Mayntz 1991: 324).
Wichtig sei in ihren Augen die Betrachtung der „Interferenz zwischen Prozessen kollektiven Verhaltens einerseits und den darauf reagierenden Steuerungsversuchen
und strategischen Interaktionen korporativer Akteure andererseits“ bzw. „die Dynamik
von Problemlösungsversuchen und der Erzeugung von Folgeproblemen“ (ebd. 324
f.). Interaktionen, kollektives Verhalten oder externe Steuerung würden demnach in
solchen sozialwissenschaftlichen Modellen oder Theorien vernachlässigt. Damit
übersieht sie jedoch einen ganzen Zweig der Literatur über autopoietisch fundierte
Sozialsysteme und Steuerungskonzepte, etwa - wie noch gezeigt werden wird - die
Konzeption der medialen Steuerung von Axel Görlitz et. al. oder Peter Hejls steuerungstheoretische Überlegungen.
Peter Fischer geht allgemein davon aus, „dass ein Transfer von Modellen in beide
Richtungen, also von den Natur- zu den Sozialwissenschaften und umgekehrt, nicht
ohne weiteres möglich ist“ (Fischer 2009: 52 f.). Er empfiehlt von daher, die Kompatibilität der jeweiligen Forschungsgegenstände zunächst außer Acht zu lassen und
stattdessen eine metatheoretische Vereinbarkeit zu überprüfen bzw. die „Gleichsetzung von sozialer und physikalischer Komplexität müsste […] erst einmal die Frage
224
nach der Logik der Sozialwissenschaften und deren Verbindungsmöglichkeiten mit
Konzepten und Theorien aus den Naturwissenschaften klären. Wird diese Differenz
der Logiken nicht hinreichend berücksichtigt, scheint ein Theorieimport nicht mehr als
nur Metaphorik“ (ebd.: 53).
Zusammenfassen lassen sich die wesentlichen Kritikpunkte an der Übernahme des
Autopoiesemodells folgendermaßen: Vorgeworfen wurde all diesen Modellen, Theorien oder Konzepten zunächst eine ungerechtfertigte oder willkürliche Übernahme
von i.w.S. Begriffsgebäuden, eine unpräzise Verwendung dieser Begriffe und deren
Paarung mit bedeutungslosen Ergänzungen. Desweiteren wurde kritisiert, sie würden
soziale Gegenstände nur unzureichend abbilden (Andreski) und Interaktions- und
Steuerungsereignisse zugunsten von Selbstorganisations- oder Emergenzprozessen
vernachlässigen (Mayntz). Darüber hinaus seien beide Disziplinen hinsichtlich ihrer
Wissenschaftslogik nicht vereinbar (Fischer, wurde von Mayntz bereits widerlegt, s.
7.1.2 ). Die Kritik bewegt sich damit auf zwei Ebenen: Auf einer metatheoretischen
Ebene wurde v.a. die teils willkürliche und methodenfreie Übernahme solcher Konzepte kritisiert. In den folgenden Abschnitten wird von daher die Möglichkeit eines
rational angeleiteten Theorientransfers diskutiert und skizziert. In diesem Rahmen
soll auch die bis hierhin verworrene Verwendung der Begriffe „Modell“ und „Theorie“
präzisiert werden. Auf einer zweiten Ebene wurden die bisherigen Versuche inhaltlich
kritisiert. Von daher wird es im Anschluss an die metatheoretischen Vorüberlegungen
darum gehen, zu zeigen, wie die Autopoiesetheorie für Steuerungsprozesse inhaltlich fruchtbar gemacht werden kann, ohne Steuerung auf die Hoffnung auf Selbststeuerungskapazitäten sozialer Systeme zu reduzieren. Diese Kritikpunkte werden im
Folgenden entschärft, sodass eine Rehabilitation interdisziplinärer Theorien- bzw.
Modelltransfers und hier besonders der Autopoiesetheorie im Rahmen dieser Arbeit
durchaus gelingen kann.
7.1.2 Prinzipielle Kompatibilität der Naturwissenschaften mit den Sozialwissenschaften
Dass Peter Fischer mit seinem Verdacht, wonach sozial- und naturwissenschaftliche
Wissenschaftslogik nicht kompatibel seien, eher danebenliegt, lässt sich etwa bei
Renate Mayntz nachlesen: „Die empirischen Sozialwissenschaften haben sich am
Modell der Naturwissenschaften orientiert und damit auch die Forschungslogik der
Naturwissenschaften übernommen“ (Mayntz 2005: 38). Somit ignoriert Fischer die 225
zumindest an der Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaften - angelehnte Ausrichtung der empirisch-analytischen Sozialwissenschaften. Denn beide Disziplinen
würden erstens ihre Gegenstände durch Beobachtung oder Indikatoren zu erfassen
suchen und zweitens Beschreibungen oder an kausalen Zusammenhängen orientierte Erklärungen ihrer Phänomene anvisieren (vgl. ebd.). Zwar würden die Naturwissenschaften auf hochentwickelte technische Geräte zurückgreifen, welche den Sozialwissenschaften nur bedingt nützten. Allerdings könnte man die Theorien, Modelle
oder Konzepte der Sozialwissenschaften als deren „Geräte“ verstehen, mit deren
Hilfe man Forschungsgegenstände aus je einem bestimmten Blickwinkel betrachten
würde (vgl. ebd.: 42).
Für eine geradezu zwangsläufige Kompatibilität der beiden Wissenschaftssphären
argumentiert z.B. Andreas Metzner. Seiner Ansicht nach seien Natur bzw. Umwelt
und Soziales sich gegenseitig ergänzende Phänomene, die lediglich aufgrund der
seit dem 19. Jhdt. fortschreitenden wissenschaftlichen Ausdifferenzierung voneinander separiert würden (vgl. Metzner 1993: 54). Dies seien jedoch lediglich begriffliche
Unterscheidungen; beide Realitäten seien seiner Meinung nach verbundene Geschehensbereiche. So seien „die Begriffe von Natur und Gesellschaft aufeinander
bezogen - sie sind Korrelatbegriffe, die sich nur im Verhältnis zum jeweils anderen
definieren“ (ebd.: 55). Ein grob gerastertes Beispiel soll die Grundidee Metzners verdeutlichen: Während in der Frühen Neuzeit noch die (naturwissenschaftlich konzipierte) Uhr als mechanistisches Gesellschaftsmodell herhalten musste, wurde im 19.
Jhdt. auf Darwins Evolutionstheorie zurückgegriffen. Analog dazu könnten moderne
Gesellschaften mit dem Paradigma der Selbstorganisation chaotischer Prozesse erfasst werden (vgl. ebd.). Nicht zuletzt würden formale Aussagen der Naturwissenschaften laut Jürgen Friedrich am Ende trotz ihres hohen Allgemeinheitsgrades immer mit empirischer Überprüfung konfrontiert werden, und seien es nur logische
Aussagen wie der Satz des Pythagoras. Eine radikale Trennung dieser Disziplinen
von den Sozialwissenschaften sei daher nicht möglich (vgl. Friedrich 1980: 119 f.).
7.1.3 Theorie? Modell? Eine erste Annäherung
Vorausgehend wurde eine Auswahl derjenigen Kritiken vorgestellt, die sich mit der
Verwendung naturwissenschaftlicher Modelle oder Theorien in den Sozialwissenschaften befasste. Auffällig war hier die meist synonyme Verwendung der Begriffe
„Theorie“ und „Modell“. So präferierten Sokal und Bricmont den Begriff „Theorie“,
226
während Andreski von „Modellen“ sprach. Allerdings hat keiner der zitierten Autoren
genauere Angaben darüber gemacht, was jeweils unter „Theorie“ oder „Modell“ verstanden worden ist. Allem Anschein nach wurde hier ein gewisser wissenschaftlicher
Konsens bezüglich dieser Begrifflichkeit vorausgesetzt.
Da es im Folgenden um eine Verwendung der ursprünglich naturwissenschaftlichen
Autopoiesetheorie in den Sozialwissenschaften geht, soll vorab eine erste Annäherung an die Begriffe „Modell“ und „Theorie“ vorgenommen werden. Dies ist v.a. deshalb notwendig, weil die später zu diskutierenden Transfermethoden sich entweder
an Modelle oder Theorien richten - hier gilt es damit, vorab eine bestimmte Auswahl
zu treffen. Zentral ist also die Frage: Was ist eine (politikwissenschaftliche) Theorie
bzw. was ist ein (politikwissenschaftliches) Modell?
In der Politikwissenschaft werden i.d.R. „Konzepte“, „Ansätze“, „analytische Rahmen“, „Modelle“ und „Theorien“ als Konzeptionen zur Erfassung einer bestimmten
Wirklichkeit unterschieden (vgl. Schubert/ Bandelow 2009: 7). Diese werden in den
Sozialwissenschaften leider trotz einer intensiven methodologischen Auseinandersetzung regelmäßig vielförmig verwendet, sodass sie „damit immer wieder mehr zur
Verwirrung beitragen als Klarheit und Übersicht zu schaffen“ (ebd.). Im Folgenden
sollen diese Begriffe geordnet und präzisiert werden.
Zunächst einmal kann man Konzepte von theoretischen Ansätzen unterscheiden. In
Konzepten werden „Begriffsdefinitionen bzw. begriffliche Unterscheidungen sowie die
damit verbundenen inhaltlichen Überlegungen bezeichnet“ (Schubert/ Bandelow
2009: 7). Hier werden lediglich Begriffe geklärt und keine logischen Zusammenhänge
hergestellt.
Dies ändert sich erst bei der Verwendung von theoretischen Ansätzen, unter welchen weitere wissenschaftliche Begriffe wie „Theorie“, „Modell“ oder „analytischer
Rahmen“ subsumiert werden (vgl. ebd.).
Analytische Rahmen besitzen Möglichkeiten, verschiedene theoretische Elemente
und ihre Zusammenhänge auf einem hohen Abstraktionsniveau zu analysieren. Sie
bieten ein Set vermeintlich relevanter Variablen nebst ihrer Beziehungen, sind jedoch
in ihrer Reichweite äußerst flexibel. Damit bilden sie quasi eine metatheoretische
Ebene, auf der bei Bedarf weitere Teiltheorien eingesetzt und kombiniert werden
können (vgl. ebd.: 8). Ein Beispiel für einen analytischen Rahmen ist der akteurzentrierte Institutionalismus, der vorgibt, Institutionen und Akteure in Konstellationen und
Interaktionen zu beachten, jedoch keine nähere Bestimmung dieser Begrifflichkeiten
227
anbietet. Was Institutionen oder Akteure sind, bleibt auf dieser Ebene noch unklar.
Eine höhere Spezifität kann über die Integration von weiteren Teil-Theorien oder Modellen gewährleistet werden.
Es besteht in den Sozialwissenschaften kaum ein Konsens darüber, was Theorien in
ihrem Kern ausmacht. Zur Folge hat das, „daß die Vorstellungen über den Charakter
wissenschaftlicher Theorien, deren Anspruch und deren Konstruktion recht uneinheitlich sind“ und damit „also in der Soziologie keine einheitliche Auffassung von Theorie
konstatiert werden kann“ (Reimann 1975: 98 f.). So weist Karl-Dieter Opp etwa auf
die teils verwirrende Verwendung der Begriffe „Gesetz“ und „Theorie“ hin: In den Sozialwissenschaften „werden auch einzelne Gesetze, die relativ kompliziert sind, d.h.
deren Wenn- oder Dann-Komponente aus mehreren Variablen besteht, als Theorien
bezeichnet. Weiterhin bezeichnet man auch mehrere Gesetze als eine Theorie, wenn
aus diesen noch keine anderen Gesetze abgeleitet wurden und wenn diese Gesetze
logisch unabhängig voneinander sind. Zuweilen werden auch die Begriffe ,Gesetz‘
und ,Theorie‘ synonym verwendet“ (Opp 2002: 39). Insgesamt lassen sich zahlreiche
Theorieverständnisse finden, z.B. „,Theorie‘ einerseits als sprachliches Gebilde von
Begriffen, abstrakten Überlegungen, Analogien, Typologien und Orientierungshypothesen; oder ,Theorie‘ als ein System von funktionalen Beziehungen zwischen theoretischen Termen, das sich an den Kriterien der formalen Logik und der empirischen
Interpretation und Bewährung der Aussagen orientiert“ (Esser/ Troitzsch 1991: 13).
Als Theoriebegriff soll zunächst an der letzteren Bestimmung festgehalten werden.
Theorien sind damit „Aussagensysteme, die auf empirisch Gegebenes Bezug nehmen, es beschreiben und erklären und nur anhand dieser Realität zu überprüfen sind
[…]. Theorien setzen sich folglich aus empirischen und analytischen Begriffen zusammen“ (Druwe 1989: 40). Vergleichbar bestimmt Opp Theorien als „eine Menge
von Gesetzen […], wenn diese durch logische Ableitbarkeitsbeziehungen miteinander verbunden sind. D.h. wenn aus einer Menge von Gesetzen andere Gesetze abgeleitet wurden, dann bezeichnet man die Gesamtheit dieser beiden Mengen von
Gesetzen als ,Theorie‘“ (Opp 2002: 39); der Theoriebegriff ist Gesetzen damit quasi
übergeordnet. Opp weist zudem darauf hin, dass Gesetze immer einen empirischen
Bezug haben, also nicht einfach analytisch wahr sind (vgl. ebd.: 37); nach diesem
Verständnis haben somit auch Theorien immer einen empirischen Gehalt.
Dass Theorien in anderen Disziplinen ggf. auch kein empirischer Gehalt zugewiesen
wird, darauf weist z.B. Hans Kammler hin. Kammler versteht Theorien als hypothe228
tisch-deduktives System nomologischer (gesetzesförmiger) Aussagen. Empirische
Theorien sind für ihn ein Spzeialfall, der für die Sozialwissenschaften besondere Bedeutung erlangt, da diese ihren Gegenstand aus der Erfahrungswelt herausnähmen.
Hielte man zu deren Charakteriisierung an dem Adjektiv „empirisch“ fest, so ließen
sich alleine mit dem Theoriebegriff auch logische oder mathematische Theorien
kennzeichnen (vgl. Kammler 1976: 101).
Für den Begriff des „Modells“ gilt ähnliches wie für den Theoriebegriff: Wenn von
Modellen oder „dem“ Modellbegriff in den Wissenschaften die Rede ist, so wird damit
i.d.R. verschleiert, dass es kein disziplinenübergreifendes Modellverständnis gibt,
sondern dieser Begriff stattdessen einer inflationären Verwendung und Bestimmung
unterliegt (vgl. Bernzen 1990: 425) - es gilt somit auch diesen Begriff an dieser Stelle
in einem ersten Schritt zu erhellen.
Wenig präzise, aber äußerst pragmatisch schlug Marx Wartofsky beispielsweise vor,
die Begriffe „Theorie“ und „Modell“ synonym zu verwenden und eine künstliche und
nur selten eingehaltene Differenzierung nicht weiter aufrecht zu erhalten. Das Ziel
sollte demnach lauten „to collapse the distinction between models [and] theories […],
and to take all of these, and more besides, as a species of the genus representation;
and to take representation in the most direct sense of image or copy” (Wartofsky
1979: 1). Es handelt sich dabei um einen präskriptiven Ansatz, wobei diese immer
mit der Gefahr konfrontiert sind, an der Wissenschaft „vorbeizuphilosophieren“ (vgl.
Bailer-Jones/ Hartmann 1999: 855). Im Gegensatz dazu möchten deskriptive Ansätze die unterschiedlichen Modellbegriffe ordnen und beschreiben, um dem inflationären Gebrauch des Modellbegriffs zu begegnen. Eine allgemein anerkannte Definition
wird über diese Vorgehensweise jedoch nicht erreicht.
Eine einfache Bestimmung des Modellbegriffs bezeichnet Modelle als „idealisierende
Nachbildung eines konkreten Objekts oder Systems. Diese Nachbildung kann material oder abstrakt-theoretisch sein“ (Bailer-Jones/ Hartmann 1999: 854). Im Zentrum
dieser Definition steht damit der Abbildungscharakter von Modellen, Eigenschaften
des Urbildes und des Abbildes (also des Modells) und die Art und Weise des Verhältnisses Urbild-Abbild. Dietrich Dörner lehnte sich mit seinem Modellverständnis an
den Abbildungsgedanken an; Modelle seien demnach zu verstehen als „Replikation
eines Realitätsausschnitts, sein Abbild, welches meist in einem verkleinerten Maßstab vorliegt; als Modellflugzeug, Modelleisenbahn usw. Zwischen dem Modell und
seinem Urbild besteht eine bestimmte Beziehung, die Modellrelation. Man kann von
229
bestimmten Merkmalen des Modells auf bestimmte Merkmale des Urbildes schließen
und umgekehrt. Bezüglich bestimmter, ausgewählter Merkmale herrscht zwischen
Modell und Urbild eine Isomorphierelation“, bei der alle Relationen erhalten bleiben
(Dörner 1987: 337). Sozialwissenschaftliche Modelle bzw. die „Abbilder“ sind i.d.R.
abstrakt-theoretisch; fraglich bleibt nun die Eigenart des Urbildes und der Relation
zwischen Urbild und Abbild.
Im Hinblick auf die Modell-Urbild-Relation bestimmte Hans Kammler den Modellbegriff mit Hilfe systemtheoretischen Vokabulars. Er meint, „daß man für bestimmte Erkenntniszwecke ein System S1, das man erforschen möchte, durch ein anderes System S2 repräsentiert, über das man mehr zu wissen glaubt oder das der Erforschung
leichter zugänglich ist. In einem solchen Fall benutzt man S2 als ,Modell‘ von S1“
(Kammler 1976: 178). Zu fragen bliebe an dieser Stelle, ob S 1 als System in der
Wirklichkeit vorliegt oder lediglich ein Konstrukt zur Erfassung eines empirischen
Phänomens ist bzw. ob das Urbild im Sinne der Definition von Bailer-Jones und
Hartmann ein „konkretes Objekt“ oder ein (gedachtes) „System“ ist. Gilt letzteres, so
kann nach Troitzsch Theoriebildung von Modellbildung unterschieden werden. Theoriebildung umfasst demnach die Auswahl eines Realitätsausschnitts und dessen Rekonstruktion als System. Modellbildung hingegen meint die Abbildung des Systems
auf ein anderes; in diesem Sinne entspricht diese Vorstellung z.B. der „Replikation“
Dörners (vgl. Troitzsch 1990: 6).
Wenn von System(theorie-)en die Rede ist, weist das darauf hin, dass sich der empirische Gehalt von Modellen - anders als etwa der von Theorien - auf ein Minimum
reduziert. Anders als Theorien weisen Modelle zunächst keinen empirischen Bezug
auf: „Unter einem (formalen) Modell versteht man ein deutlich stilisiertes und stark
vereinfachendes Muster, das einen bestimmten Typ von Zusammenhängen und Mechanismen für typische Fälle ganzer Klassen von Situationen oder Prozessen angibt.
Sie liefern somit Hypothesen über Strukturen oder Prozesse ihres Gegenstandes,
ersetzen jedoch keine empirische Überprüfung“ (Esser 1993: 120)“. Vergleichbar
damit ist die Modelldefinition von Renate Mayntz: „Modellkonstruktion will […] empirische Beobachtungen oder verbale Theorie in symbolischer Sprache formulieren, sei
es die Sprache eines Zweiges der Mathematik oder der Code einer Programmiersprache für elektronische Datenverarbeitungsanlagen“ (Mayntz 1969: 11). Modelle
sind damit formalisierte Theorien: „Bei einer formalisierten Theorie werden beschreibende Begriffe durch abstrakte Symbole ersetzt und die logische Struktur der sie
230
verbindenden Sätze wird explizit gemacht“ (ebd.: 13). Hinsichtlich ihres logischen
Aufbaus ähneln sie Theorien, aber: „von einem logischen Standpunkt aus ist über die
Struktur der Aussagen kein Unterschied festzustellen. Die zentrale Differenz wird
gängigerweise am Erklärungsgehalt ausgemacht“ (Bergmann 2000: 140). Modelle
sind in der Summe logische Konstruktionen, „analog den mathematischen Kalkülen.
Sie analysieren Strukturen“ (Druwe 1989: 40); sie „abstrahieren von konkreten Inhalten und untersuchen allein die Form“ (ebd.: 45).
Anderer Ansicht sind beispielsweise Klaus Schubert und Nils C. Bandelow. Nach
diesen bezögen sich Modelle immer auf eine bestimmte Situation und seien damit
sehr empirienah, es gehe ihnen um „konkrete Aussagen über konkrete Situationen.
Modelle sind insofern in ihrem Anwendungsbereich enger, dafür näher an der politischen Empirie. Häufig ist die Entwicklung eines (Erklärungs-)Modells für ein konkretes empirisches Problem das Ziel des Forschungsprozesses“ (Schubert/ Bandelow
2009: 9). Auch Bailer-Jones und Hartmann weisen u.a. auf die gelegentlich vorkommende Auffassung hin, wonach Modelle abstrakte Theorien für eine bestimmte Situation konkretisieren und deren Anwendung erst ermöglichen, ihnen gleichsam Zugang
zur Empirie verschaffen (Vgl. Bailer-Jones/ Hartmann 1999: 856). Dabei handelt es
sich jedoch eher um eine Nischenmeinung; in der Politikwissenschaft werden Theorien und nicht Modelle zur empirischen Überprüfung verwendet.
Herbert Stachowiak hat den Modell-Begriff anhand dreier Merkmale präzisiert. Erstens nennt er das Abbildungsmerkmal, wonach Modelle immer Modelle von etwas
„anderem“ sind, also „Abbildungen, Repräsentationen natürlicher oder künstlicher
Originale, die selbst wieder Modelle sein können“ (Stachowiak 1973: 131). Zweitens
das Verkürzungsmerkmal, wonach Modelle nie das gesamte Vorbild abbilden, sondern abstrahierend je nach Modellzweck auf bestimmte Bausteine verzichten. Drittens spricht Stachowiak von einem pragmatischen Merkmal, was meint, dass Modelle immer „für bestimmte - erkennenden und/ oder handelnde, modellbenutzende Subjekte“ und nur für „bestimmte gedankliche oder tatsächliche Operationen“ entwickelt
werden (ebd.: 132 f.). Es geht somit um die Fragen „Für wen“, „wann“ und „wozu“;
Modelle sind damit zweck-, personen- und zeitgebunden. Da Modelle das Original
i.d.R. nicht komplett abbilden (können), gilt es, zwei weitere Bereiche des Originals
und des Urbilds zu identifizieren. Stachowiak zählt all jene Attribute des Originals, die
vom Modell nicht erfasst werden, zur Abundanzklasse. Umgekehrt gehören diejeni-
231
gen Attribute des Modells, die keine Entsprechung im Original haben, zur Präteritionsklasse (vgl. Stachowiak 1983: 119 f.).
Den Zweck von Modellen sieht Dörner in einer Art spiralförmigen Entwicklung von
Theorien: „Unsere Kernthese lautet, daß die Konstruktion dynamischer Modelle, die
,Simulation‘ von Systemen also, den Gang der Theoriebildung wesentlich beschleunigt und erleichtert“ (Dörner 1987: 343). Sei man mit einem Problem konfrontiert,
würde ein Erklärungsmodell intuitiv entworfen und mit der Realität konfrontiert.
Widersprächen sich nun Prognosen der Theorie und empirische Daten, so käme es
zu einer Revision des Erklärungsmodells. Im Laufe dieses Prozesses würde die Theorie zunehmend präziser und treffender (vgl. ebd.). In diesem Sinne erzwinge Modellkonstruktion „Explizitheit, Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit“ (ebd.: 345).
Modelle sind damit Bausteine auf dem Weg zur Theoriebildung: „Ziel des Theoretikers in einem bestimmten Bereich der Wissenschaften ist die Gewinnung der richtigen Beschreibung eines Systems, als Theorie des real existierenden Systems“ (ebd.:
340).
Im Rahmen der Entwicklung von empirischen Theorien spielen Modelle demnach
eine entscheidende Rolle, deren Aufgabe von Jörg Wernecke folgendermaßen zusammengefasst wurden: „Modelle werden als ein methodischer Zwischenschritt, der
zwischen der Formulierung von ersten Hypothesen und dem vermeintlichen Ziel von
‚objektiven Allaussagen‘ in Form von probalistischen oder deduktiven Aussagen der
Theorie angesiedelt ist, verstanden. Modelle sind demnach formalsprachliche und/
oder operational-empirische Konkretisierungen der zugrundeliegenden, vorerst nur
skizzenhaft formulierten heuristischen Hypothesen. In diesem Sinne haftet Modellen
auch noch der Charakter eines hypothetischen Konstrukts an, deren Aussagen, einschließlich der damit verbundenen Geltungsansprüche, noch einer Verifikation mittels
einer empirischen Validierung, was natürlich voraussetzt, daß eine eindeutige Prüfung überhaupt möglich ist, bedürfen. Am Ende des Forschungs- und Erkenntnisprozesses steht, nach Selbstverständnis dieses Ansatzes, schließlich die empirische
Theorie, die zumeist als objektives Erkenntnisinstrument, zumindest im Hinblick auf
die Deskription des empirischen Phänomenbereichs, verstanden wird“ (Wernecke
1994: 128).
Modelle beziehen sich also in erster Linie auf formale Eigenschaften einer Situation
oder eines Prozesses - ganz unabhängig von dem jeweiligen inhaltlichen Vorgang“
(Esser 1993: 120). Sie beinhalten somit „nur“ sprachliche oder formal-mathematische
232
Variablenzusammenhänge und sind damit zunächst nicht für die empirische Forschung entwickelt (anders etwa Opp 2002: 102). Man spricht daher auch von „analytischen“ oder „formalen Modellen“. Solche formalen Modelle können hinsichtlich ihrer
Haltbarkeit nur durch Logik, nicht jedoch durch Empirie überprüft werden (vgl.
Kammler 1976: 180). Formalmodelle können weiter in Struktur- und Prozessmodelle
differenziert werden: „Benutzt man formale Systeme als ,Bilder‘ von Strukturmerkmalen des Untersuchungsobjektes, so sprechen wir von ,Strukturmodellen‘. Soll dagegen die Zustandsveränderung in der Zeit, die ,Entwicklung‘ oder der ,Ablauf‘ des Systems abgebildet werden, so hätten wir es mit ,Prozeßmodellen‘ zu tun“ (ebd.: 189).
Strukturmodelle befassen sich beispielsweise mit gleich- oder verschiedenartigen
Relationen, deren Intensität und Komplexität (vgl. ebd.: 191). Prozessmodelle konzentrieren sich hingegen auf dynamische Aspekte; diese seien in den Sozialwissenschaften von besonderem Interessen, wenn man nur an die Verhaltensforschung
denke (vgl. Dörner 1987: 339).
Realmodelle dagegen beziehen sich auf empirische Phänomene, d.h. sie besitzen
eine empirische Begrifflichkeit, bleiben dabei aber noch immer sehr abstrakt. Große
Bekanntheit erlangten im 19. Jhdt. mechanische Modelle von elektrischen, optischen
oder vergleichbaren Erscheinungen. So hatte etwa Nils Bohr das Atommodell analog
zum Modell des Sonnensystems entworfen (vgl. Kammler 1976: 183). In der Steuerungstheorie wäre etwa das Modell vom Staat als Schiff mit einem Steuermann ein
typisches Realmodell (vgl. ebd.: 184). Dabei interessierte weniger die Struktur des
Staates, wurde doch der Kapitän mit dem Steuermann meist synonym gesetzt. Vielmehr geht es hier um kurzfristige Verhaltensänderungen politischer Systeme, was
mit dem Navigieren von Schiffen durch Klippen und Stürme gleichgesetzt wurde. Anders hingegen das Modell des Organismus als Realmodell des Staates, welches mit
Beziehungen und Funktionen von Organen wesentlich mehr Wert auf die Struktur
des Staates legte als das Schiffsmodell (vgl. ebd.).
Zur Verdeutlichung des Unterschiedes zwischen analytischen Formalmodellen und
Realmodellen sei hier exemplarisch die Systemtheorie skizzenhaft aufgeführt, die
eigentlich Modelle konzipiert. Ein analytisches Modell bestünde hier in etwa aus den
Termen „Elemente“, „Prozesse“, „Relationen“ und „Funktionen“ - empirische Aussagen liegen damit nicht vor. Dieses Formalmodell wurde z.B. von David Easton in die
Politikwissenschaften eingeführt. Nach Easton gibt es beispielsweise politische Inputund Outputfunktionen, die von jedem politischen System erfüllt würden. Zwar nähert
233
er sich damit der Empirie an; faktisch weist dieses Modell aber immer noch einen
höchstens gerinfügigen empirischen Gehalt auf, sodass besser von einem Realmodell, nicht jedoch von einer politikwissenschaftlichen (System-)„Theorie“ gesprochen
werden sollte. Das Realmodell bleibt im Gegensatz zur Theorie auf einem sehr abstrakten Niveau und gestattet kaum empirische Überprüfungsmöglichkeiten.
Modelle könnten prinzipiell auch nach ihren Ebenen unterschieden werden. In den
Sozialwissenschaften
kann
allgemein
zwischen
Mikro-,
Makro-
und
Mehrebenenmodellen differenziert werden. Diese „bestehen aus mehreren Objekten,
die jeweils zu einem oder mehreren Aggregaten zusammengefaßt werden, die eventuell auch ihrerseits wieder zu Aggregaten höherer Ebene zusammengefaßt werden
können. Den Objekten kommen Eigenschaften zu, zwischen ihnen bestehen Relationen; die Eigenschaften von Aggregaten und die zwischen ihnen bestehenden Relationen ergeben sich teilweise aus Eigenschaften der Objekte der jeweils unteren Ebene“ (Troitzsch 1990: 18). Die Ebenendifferenzierung spielt auch bei der Autopoiesetheorie eine gewichtige Rolle; von daher wird in einem abschließenden Abschnitt dieser wissenschaftstheoretischen Überlegungen diese Problematik - gerade im Hinblick
auf sozialwissenschaftliche Erklärungsstandards - diskutiert werden.
Fazit dieser ersten Annäherung: Theorien bestehen aus empirischen und analytischen Begriffen, Modelle hingegen haben eher formalen Charakter. Im weiteren Verlauf dieser wissenschaftstheoretischen Vorüberlegungen wird mit dem strukturalistischen Wisenschaftsverständnis eine Präzision der Begriffe „Modell“ und „Theorie“
vorgenommen. Diese Präzision wird entlang der bisherigen Annäherung, wonach
Theorien im Gegensatz zu Modellen empirischen Gehalt aufweisen, vorgenommen.
V.a. der Modellbegriff wird hier weiter differenziert werden. Ein kurzer Ausblick:
Troitzsch weist etwa auf die leicht variierte Verwendung des Modellbegriffs hin, wonach Modelle gemäß des Strukturalismus‘ keine Abbilder der Wirklichkeit oder von
Systemen mehr seien, sondern sich lediglich auf Systeme bzw. Theorien beziehen;
„das Urbild ist nunmehr die Theorie, von der viele Modelle existieren“ (Troitzsch
1990: 143, Fußnote 31). Ferner werden unterschiedliche Modelltypen unterschieden
werden.
234
7.1.4 Theorienrekonstruktionsmethode
7.1.4.1 Rationale Rekonstruktion
Um die Theorie der Autopoiese für die folgende Diskussion und den Modelltransfer in
Dienst nehmen zu können, gilt es, dieses Modell im Rahmen einer rationalen Rekonstruktion für die genannten Zwecke zugänglich zu machen, denn „die konkrete Übertragung setzt eine präzise Rekonstruktion voraus“ (Druwe 1989: 35). Bei einer Rekonstruktion geht es laut Rudolf Carnap um „das Aufsuchen neuer Bestimmungen für
alte Begriffe. Die alten Begriffe sind gewöhnlich nicht durch überlegte Formung, sondern durch spontane Entwicklung […] entstanden. Die neuen Bestimmungen sollen
den alten in Klarheit und Exaktheit überlegen sein“ (Carnap 1928: IX, zit. nach
Scheibe 1984: 96). Bei der Rekonstruktion der Autopoiesetheorie wird es weniger um
die Ersetzung von Begriffen als vielmehr um eine zweckmäßige Anordnung gehen,
um das Modell, anders als es in der Literatur angeboten wird, präzise und intersubjektiv nachvollziehbar darzustellen.
Eine Rekonstruktion umfasst nach Erhard Scheibe sechs Bestandteile: Dazu gehören erstens das zu rekonstruierende Original und zweitens das Resultat des Rekonstruktionsvorganges, die eigentliche Rekonstruktion. Drittens erfolge dieser Vorgang nach einem gewissen Prinzip, welches Methoden oder Vorgehensweisen der
Rekonstruktion festlegt. Viertens habe eine Rekonstruktion eine bestimmte Beziehung zu ihrem Urbild, das etwa Ähnlichkeit oder bestimmte Abweichungen vom Original als Ziel der Rekonstruktion postuliert. Fünftens muss der jeweilige Kontext des
Urbildes beachtet werden. Sechstens und letztens muss - analog zu fünftens - der
Kontext der Rekonstruktion berücksichtigt werden (vgl. Scheibe 1984: 101 ff.).
Scheibe differenziert ferner zwischen drei verschiedenen Rekonstruktionstypen. Erstens nennt er die Begriffsexplikationen. Hier ist „die Klärung gegebener Begriffe die
allgemeine Rekonstruktionsidee und die Systematik eines Begriffsgebäudes das den
Rekonstruktionsrahmen Auszeichnende, insofern ein gegebener Begriff in ihn hinein
rekonstruiert werden soll“ (ebd.: 104). Exemplarisch hierfür nennt Scheibe das Wärmeempfinden des Menschen, welchem erst mit Hilfe von Thermometern und entsprechenden Theorien ein wissenschaftlich haltbarer Status verliehen worden sei.
Die zweite Rekonstruktionsvariante ist laut Scheibe die reduktive Rekonstruktion. Ihr
geht es um „die Reduktion z.B. eines Begriffs auf einen anderen oder einer Theorie
auf eine andere. Wenn nämlich z.B. eine Theorie auf eine andere reduziert wird, so
235
gibt es immer auch als ein Drittes die Rekonstruktion der reduzierten Theorie in der
reduzierenden. Die reduzierte Theorie ist dann […] das Original, die reduzierende
Theorie der Rekonstruktionsrahmen, und die Rekonstruktion ist die Form, in der die
reduzierte Theorie in der reduzierenden fortlebt“ (ebd.: 108). Den dritten Rekonstruktionstyp bezeichnet Scheibe als deskriptive Rekonstruktion. Hier handelt es sich um
„eine Beschreibung in dem gewöhnlichen Sinne, in dem wir jemandem einen Weg
beschreiben, den er gehen will, oder eine Stadt, die wir gerade gesehen haben, aber
auch in dem gehobenen Sinne, in dem wir sagen, daß die klassische Himmelsmechanik das Planetensystem beschreibe und die Quantenmechanik das Verhalten von
Atomen im Stern-Gerlach-Versuch, und schließlich auch in dem Sinne, in dem wir
oder manche sagen, die Wissenschaftstheorie beschreibe die Naturwissenschaften“
(ebd.: 111).
Auch in der gängigen Politikwissenschaft spielt die rationale Rekonstruktion als Rekonstruktionsprinzip bzw. -methode eine gewichtige Rolle. Daniel Gaus meint, diese
Methode würde zwar schwerpunktmäßig im Rahmen normativer politischer Theorie
zur Rekonstruktion moralischer Standards oder von Diskursen angewandt, würde
jedoch auch brauchbare Ergebnisse für eine allgemeine Theorie der Politik zeitigen
können (vgl. Gaus 2013: 232), wobei besser von Theorien oder analytischen Modellen als Grundlage empirischer Forschungsarbeiten gesprochen werden sollte. Gaus
begründet seine Ansicht mit Überlegungen John Deweys, der meinte, moderne Wissenschaft sei zu verstehen als „Bewusstwerden von Welterschließung als fortdauernde Rekonstruktion menschlicher Erfahrung“ (ebd.: 235). Die Welt sei nicht gottgegeben, sondern prinzipiell durch menschliche Ideen und Eingriffe wandelbar; diese
gelte es, via rationaler Rekonstruktion „bewusst“ zu machen. Dieses Vorgehen verdeutlicht Gaus exemplarisch an Habermas‘ Diskurstheorie.
Allerdings unterlässt es Gaus, vorab präzise anzugeben, nach welchen Spielregeln
oder Prinzipien eine rationale Rekonstruktion vorgenommen werden sollte. Da diese
Methode zur sprachlichen Präzision der Autopoiesetheorie verwendet und damit ein
erster Schritt auf dem Weg zu einem Theorientransfer geleistet werden soll, gilt es,
sich über deren Vorgehensweise zu vergewissern. Die Rationale Rekonstruktion umfasst nach Wolfgang Stegmüller drei Prinzipien (vgl. Stegmüller 1974: 2 ff.):
1. Similarität: Zunächst einmal müssen die Grundideen beibehalten werden.
Zentral hierbei ist die Voraussetzung, dass die Axiome der Autopoiesetheorie
236
nicht verletzt werden (vgl. Druwe 1995: 355) und die Grundideen der zentralen
Terme beibehalten werden.
2. Präzision: Ferner müssen möglichst präzise Begriffe verwendet werden. Für
Politikwissenschaftler bedeutet dies, bei Bedarf die zentralen Begrifflichkeiten
durch analytische und empirische Begriffe und eine adäquate moderne Wissenschaftssprache zu ersetzen, um jegliche Vagheit zu vermeiden (vgl. ebd.:
58).
3. Konsistenz: Schließlich darf die rekonstruierte Theorie keine (neuen) logischen Brüche enthalten. Dabei bestimmen die theorieinhärenten Definitionen
die Bedeutung der Begriffe – die Bedeutung muss also nicht zwangsläufig
dem entsprechen, was ein Begriff im Alltag meint (vgl. ebd.: 353). Bei einem
Transfer müssen somit sämtliche Begriffe der Theorie geklärt werden. Andernfalls handelt es sich um inhaltsleere Begriffe, die beliebig verwendet würden
(vgl. ebd.: 154).
Letztlich hängt eine jede Rekonstruktion vom rekonstruierenden Autor ab, was bedeutet, dass mehrere Interpretationen möglich sind: „Rekonstruktionen weichen naturgemäß vom Original ab; ihre Darstellung kann nur mehr oder weniger exakt sein,
mehr oder weniger vom intuitiven Gehalt des Textes abweichen, einen größeren oder
kleineren Teil der Theorie umfassen“ (ebd.: 59). Auszuwählen ist dann diejenige Variante mit der konsistentesten Argumentation.
Die nun vorliegende Rekonstruktion ist Ausgangspunkt aller weiteren Transferschritte. Es wird gezeigt werden, dass die Autopoiesetheorie zwar sozial- und steuerungstheoretisch interpretiert werden kann (wie das Maturana und Varela in Ansätzen auch
selbst vornehmen), dass diese Interpretation für die Sozialwissenschaften aber allenfalls abstrakte Beschreibungsformen, mit Sicherheit jedoch keine Möglichkeiten zur
empirischen Überprüfung bietet. Mit Hilfe des Konzeptes intertheoretischer Links
muss die Autopoiesetheorie nach der Rekonstruktion in die Sozialwissenschaften
übertragen werden, wo es fortan als sozialwissenschaftliches Realmodell existiert.
Zur Überprüfung an der Wirklichkeit bedarf es einer weiteren Auffüllung mit empirischen Begriffen, sodass das Realmodell nunmehr als empirisches Relativ erscheint.
Die Umwandlung in ein reales Modell bedeutet laut André Bergmann, „dass man den
empirischen Gegenstandsbereich nicht übernehmen und Geltung der Aussagen nicht
beanspruchen kann. Man übernimmt lediglich die logische Form bzw. die syntaktische Struktur eines bekannten Modells und passt die deskriptiven oder empirischen
237
Ausdrücke dem neuen Gegenstandsbereich an. Den unterstellten nomologischen
Isomorphismus muss man allerdings für den neuen Gegenstandsbereich noch bestätigen“ (Bergmann 2001: 200).
Axel Görlitz und Hans-Peter Burth meinen nun im Zuge ihrer Entwicklung eines autopoietischen Steuerungsmodells, genauer der rationalen Rekonstruktion der ursprünglichen Autopoiesetheorie, mit zwei Fragen konfrontiert zu werden: Erstens, wie sehe
das soziale Universum im Rahmen dieses Modells aus? Hier stellen sich dann Fragen etwa „nach den Eigenschaften des Menschen als sozialem Wesen und handelnden Akteur, nach der Beschaffenheit sozialer Interaktionen sowie der Entstehung
sozialer Institutionen und Strukturen“ (Görlitz 1998: 198). Das bedeutet, dass „sich
die ‚Theorie der Autopoiese‘ auf reale Gegenstände beziehen möchte“ (vgl. Druwe
1990b: 46). Zweitens gehe es darum, ob die Untersuchung von der Makro- oder der
Mikroebene aus unternommen werden soll oder ob eine Verknüpfung beider Ebenen
vonnöten ist. Hier geraten nun wissenschaftstheoretische Fragestellungen in den
Fokus, etwa Fragen danach, ob naturwissenschaftliche Standards auch für die Sozialwissenschaften gelten sollen. Allerdings meinen Görlitz und Burth mit der Rationalen Rekonstruktion bereits einen Transfer vollzogen zu haben. Hier wird jedoch die
Ansicht vertreten, dass damit lediglich eine Umformulierung oder Präzisierung der
Autopoiesetheorie geleistet worden ist; der Transfer an sich wurde noch nicht bewältigt - hierfür sind intertheoretische Links zu verwenden.
7.1.4.2 Formalisierung und Axiomatisierung
Theorien sollten im Zuge einer rationalen Rekonstruktion idealiter in Form von Axiomen, präzisen Termen und ggf. daraus ableitbaren Aussagen (Theoremen) dargestellt werden; bezüglich des Autopoiesekonzepts läge dann eine formalisierte und
axiomatisierte Theorie vor.
Formalisierung einer Theorie meint, „ihre Sprache und ihre Logik zu formalisieren.
Zuerst wird die Sprache selbst und dann das zugrundeliegende logische System syntaktisch und formal charakterisiert, d.h. so, daß nur auf die Form der relevanten Ausdrücke Bezug genommen wird“ (Przelecki 1983: 46). Präzisiert werden soll mit Formalisierung damit v.a. die logische Struktur von Aussagenzusammenhängen: „Es
geht allein um die Formalisierung von Aussagen und Begriffen der theoretischen
Sprache, damit logische Transformationen - deren Gültigkeit nur von der formalen
Struktur der Aussagen und nicht von der Bedeutung der Begriffe abhängt - exakter,
238
schneller und in vielen Fällen überhaupt erst durchgeführt werden können“ (Ziegler
1972: 13).
Karl-Dieter Opp erkennt Vorzüge von Formalisierung insbesondere im Hinblick auf
den Vergleich oder die Prüfung einer Vereinbarkeit von Theorien. Insgesamt benennt
er sieben Vorteile einer Formalisierung: Erstens würden Ableitungen leichter fallen,
zweitens kontrollierbarer und drittens falsche Ableitungen einfacher vermieden werden. Viertens würden durch Formalisierung Aussagen präzisiert und fünftens die logische Struktur solcher Aussagenzusammenhänge geklärt. Sechstens könne Formalisierung zur Ableitung neuer Theoreme aus den Axiomen führen wie auch siebtens
zur Entdeckung neuer Hypothesen führen (vgl. Opp 2002: 186 f.). Nach Ziegler weist
Formalisierung fünf Vorteile auf: Erstens könnten mit ihrer Hilfe Fehler in der Argumentation aufgedeckt werden. Zweitens sei es möglich durch Formalisierung implizite Annahmen eines Arguments oder - drittens - verschiedener Annahmen gleichsam
zu enthüllen. Viertens erspare sie überflüssige Mehrarbeit, indem auf das Wesentliche reduziert würde. Fünftens sei es erst mit formalisierten Theorien möglich, logische Transformationen durchzuführen (vgl. Ziegler 1972: 13 ff.).
Axiomatisierung der Autopoiesetheorie läge dann vor, „wenn all ihre Theoreme aus
einer entscheidbaren Teilmenge dieser Theoreme folgen“ (Przelecki 1983: 49). Was
damit genauer gemeint ist, hat etwa Hans Kammler präzisiert: „Die Aussagen einer
Theorie bilden ein System, weil sie nicht isoliert, sondern durch Beziehungen verknüpft sind. Technisch […]: aus der Menge der Aussagen sind Relationen gegeben,
die wir z.B. mit den Prädikaten ,Unabhängigkeit‘, ,Ableitbarkeit‘, ,Vereinbarkeit‘ (Konsistenz) - und (da nicht alle Theorien logisch makellos sind) manchmal auch ,Unvereinbarkeit‘ bezeichnen. Um solche Fehler, aber auch die harmloseren bloß
überflüssigen Annahmen zu beseitigen und die Aussagekraft der Theorie möglichst
genau beurteilen zu können, konstruiert man […] auch erfahrungswissenschaftliche
Theorien zuweilen rigoros durch“ (Kammler 1976: 105). Im Rahmen einer
Axiomatisierung wird demnach sowohl das Begriffsnetz mit den Grundbegriffen, ggf.
logischen Grundzeichen und Bildungsregeln für Ableitungen weiterer Begriffe als
auch das Deduktionsgerüst samt Eigenaxiomen und ggf. Axiomen der verwendeten
Logik herausgearbeitet. Axiome sind dabei die grundlegenden Aussagen einer Theorie, Theoreme hingegen aus den Axiomen abgeleitete Aussagen (vgl. Westermann
2000: 219).
239
Den übergeordneten Zweck von Axiomatisierung oder Formalisierung beschreibt Patrick Suppes folgendermaßen: „Die Rolle der Wissenschaftsphilosophie besteht in der
Klärung begrifflicher Probleme und darin, die grundlegenden Annahmen jeder wissenschaftlichen Disziplin explizit zu machen. […] Im Kontext solcher Klärung und
Konstruktion erfolgt eine philosophische Analyse hauptsächlich durch Formalisierung
und Axiomatisierung der Begriffe und Theorien, die in einem gegebenen Wissenschaftsbereich von fundamentaler Bedeutung sind“ (Suppes 1983: 26). Damit könnten folgende Ziele wissenschaftlichen Arbeitens erreicht werden: Erstens sei eine
präzise Klärung von Begriffen möglich (Expliziertheit). Zweitens würden Terminologien und Methoden der begrifflichen Analyse standardisiert und eine disziplinübergreifende Diskussion ermöglicht (Standardisierung). Drittens würden Theorien auf
diese Art und Weise von ihren „Nebenkriegsschauplätzen“ oder „Hintergrundgeräuschen“ befreit (Allgemeinheit). Viertens würden formalisierte Theorien (ergo Modelle)
einen ansonsten unerreichbaren Grad an Objektivität erreichen (Objektivität). Darüber hinaus würden fünftens die wesentlichen Annahmen in den Vordergrund gerückt
(abgeschlossene Annahmen). Nicht zuletzt würden sechstens Theorien auf diese Art
und Weise auf ihren zentralen Kern reduziert (minimale Annahmen), wobei die letzten beiden Aussagen notwendige Ergänzungen zum dritten Punkt sind (vgl. ebd.: 27
ff.).
Bergmann meint zusammengefasst, Formalisierung oder Axiomatisierung seien „erwünscht, weil sich dadurch die Forschung im ökonomischen Sinne vereinfacht und
leichter zu kommunizieren ist. Ein präziser Begriffsrahmen gewährt, dass die grundlegenden Annahmen jeder wissenschaftlichen Disziplin explizit vorliegen. In diesem
Maße bedeutet Formalisierung, noch mehr auf die Rationalitätsanforderungen Intersubjektivität und Kritisierbarkeit einzugehen“ (Bergmann 2001: 142). Im Rahmen eines Theorientransfers wird damit zudem erreicht, dass die übertragene Theorie nebst
ihren Aussagen und Gesetzen etc. nicht den von der Ursprungstheorie vorgegebenen theoretischen Rahmen verlässt. Jeder Begriff oder jedes Gesetz hat im Kontext
einer bestimmten Theorie einen bestimmten „Platz“ und einen bestimmten Bedeutungshorizont inne. Wird nun eine Theorie ohne weiteres Hinterfragen übernommen,
so wird dieser Platz ggf. verlassen - die Bedeutungshorizonte von Begriffen werden
vage, die logische Anordnung von Aussagen verschwimmt oder es werden sogar
Begriffe aus der Alltagssprache „durch die Hintertür“ eingeführt (vgl. Troitzsch 1990:
136).
240
7.1.5 Wege eines Theorientransfers
Zunächst könnte man meinen, bei der Entwicklung eines sozialwissenschaftlichen,
autopoietisch fundierten Steuerungskonzeptes handle es sich um eine vorwissenschaftliche, also dem Entdeckungszusammenhang und nicht dem Begründungszusammenhang zugehörige Arbeit. Bekanntestes Beispiel für diese Vorgehensweise ist
die Entdeckung der Schwerkraft durch Isaac Newton, dem die entsprechenden Gesetze angeblich beim Beobachten eines Apfels, der von einem Baum herabfiel, in
den Sinn kamen. Wissenschaftliche Theorie erscheint hier als Zufalls- oder Intuitionsprodukt; der Vorgang selbst entzieht sich damit jeglichen wissenschaftlichen
Standards oder Kriterien.
Nun liegt die Autopoiesetheorie jedoch bereits als naturwissenschaftliche Variante
vor. Die Konzipierung eines autopoietisch fundierten Steuerungskonzeptes zwingt
demnach geradewegs zu Überlegungen, die sich mit der Art und Weise der Übernahme beschäftigen, denn hier kommt nach Jürgen Friedrich zum Tragen, „daß die
genannten Methoden nicht aus dem Untersuchungszusammenhang des sozialwissenschaftlichen Gegenstandes selbst heraus entwickelt wurden, wie dies etwa bei
vielen Erhebungsmethoden der empirischen Sozialforschung […] der Fall ist, sondern daß diese Methoden als quasi fertiges Instrumentarium von außen an den Gegenstand herangetragen werden. Daraus ergibt sich die Frage, ob das Analyseinstrumentarium dem Gegenstand überhaupt angemessen ist“ (Friedrich 1980: 6).
Grundsätzlich liegen mit der Analogisierung, der theoretischen Vereinheitlichung von
Argumentmustern und den intertheoretischen Links drei Wege vor, die grundlegend
beschreiben, wie eine Theorie in eine andere Disziplin präzise übertragen werden
kann. Diese sollen im Folgenden erläutert werden.
7.1.5.1 Analogisierung
Theorien können einerseits durch Analogisierung übertragen werden. Dieses Vorgehen hat Peter M. Hejl im Hinblick auf Luhmanns Autopoiesekonzeption folgendermaßen beschrieben: „Man kann autopoietische Systeme als Modelle für soziale Systeme verwenden. Dabei geht man von zunächst relativ vagen Ähnlichkeiten zwischen
lebenden und sozialen Systemen aus und versucht dann, die Charakteristika autopoietischer Systeme in sozialen Systemen wiederzufinden“ (Hejl 1993: 213). Insbesondere die Unterscheidung Luhmanns von psychischen, lebenden und sozialen
Systemen gleicht Hejl der Anwendung eines mathematischen Kalküls auf verschie241
dene Gegenstände. Prinzipiell seien solche Verfahren „bewährt und unproblematisch, wenn sichergestellt werden kann, daß die für den Kalkül konstitutiven Operationen im Phänomenbereich beobachtbar sind“ (Hejl 1993: 220).
Hejl meint nun, es sei bislang eben nicht nachgewiesen worden, inwieweit die für
Autopoiese typischen Prozesse auch in Sozialsystemen abliefen (vgl. ebd.). Dies
läge daran, dass z.B. Luhmann die Autopoiesetheorie zwar verallgemeinert, aber
sich letztlich nicht von der biologischen Begrifflichkeit und dem entsprechenden Verständnis gelöst habe. Hejl zeigt dies exemplarisch an einem Fragekatalog, den u.a.
Maturana entwickelt hat, um festzustellen ob es sich bei einem System um ein autopoietisches System handle (vgl. Maturana 1985: 164 f.). Hier würde Luhmann - bei
exakter Verwendung der dort angegebenen Kriterien - wohl in große Schwierigkeiten
geraten. So würde v.a. der physikalisch verstandene Terminus „Produktion“ von
Luhmann anhand der Kommunikationen als Elemente nicht erläutert werden; stattdessen würde er lediglich postulieren, Kommunikation produziere Kommunikation
(vgl. Hejl 1993: 223). Ähnliches gelte für zentrale Begriffe wie etwa „Selbstregulierung“, „Autonomie“ oder „operationale Geschlossenheit“, deren theoretischen Hintergrund Luhmann nicht berücksichtigt (z.B. Roth 1985: 27). In dieser Hinsicht bleibt die
Autopoiesetheorie sozialwissenschaftlich nicht ergiebig.
Darüber hinaus gleiche diese Vorgehensweise einer unreflektierten Übertragung, die
einige begriffliche Unschärfen mit sich brächte. Hejl zeigt dies exemplarisch anhand
einer Definition Luhmanns für den Begriff „Gesellschaft“. So sei am Ende unklar, ob
Gesellschaft ein offenes oder geschlossenes, also ein allo- oder ein autopoietisches
System sei (vgl. Hejl 1993: 224 f.). Das gleiche gelte für Begriffe wie „Selbsterhaltung“ und „Selbstreferenz“ (vgl. ebd.: 225). Hier lasse Luhmann seine Leser im Unklaren, was er genau mit diesen Begriffen bezweckt bzw. inwieweit er das biologische Grundverständnis dieser Begriffe auf soziale Systeme anwenden möchte. In
diesem Sinne habe Luhmann „in seinem Bestreben, die Theorie der Autopoiese zu
generalisieren, gewissermaßen die Feinstruktur der Theorie vernachlässigt“ (ebd.).
Nicht zuletzt zeigt sich hier, dass Luhmann eben keine empirische Theorie, sondern
„nur“ ein analytisches Modell entwickelt hat. Die Kreierung einer empirischen Theorie
setzt - worauf der Begriff im Grunde genommen ja selbst hinweist - eine empirische
Überprüfung bzw. Prüfbarkeit voraus: „Es ist unmöglich, durch reines Nachdenken
und ohne eine empirische Kontrolle (mittels Beobachtung) einen Aufschluß über die
Beschaffenheit und über die Gesetze der wirklichen Welt zu gewinnen“ (Stegmüller
242
1978, zit. nach Wernecke 1994: 126). Und weiter: „Wissenschaftliche Erkenntnis
zeichnet sich demnach nicht alleine durch den Versuch aus, mittels des Verstandes
oder der Vernunft jene apriorischen Prinzipien, die die Wirklichkeit als empirischen
Phänomenbereich konstituieren, zu ergründen, sondern bedarf erst der Validierung
(Verifikation oder Falsifikation) auf der Grundlage induktiv-empirisch erschlossener
Beobachtungen, z.B. mittels des Experiments“ (Wernecke 1994: 126).
Um
eine
Vermengung
naturwissenschaftlicher
und
sozialwissenschaftlicher
Konzeptualisierungen á la Luhmann zu vermeiden, schlägt Hejl eine reduzierte Analogisierung vor. Hejl verzichtet zunächst auf jedwede Übertragung und koppelt stattdessen (ohne das Vorgehen genauer zu erläutern) Biologie und Sozialwissenschaften: „Man kann aber auch autopoietische Systeme in der Biologie (und eventuell
auch in der Psychologie) belassen und sie gleichsam als generative Mechanik verwenden. Man versucht dann, die den Sozialwissenschaftler interessierenden Phänomene zu konstruieren durch die Interaktionen von als autopoietische Systeme verstandenen Individuen“ (ebd.). Der Sozialwissenschaftler solle demnach die Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschung verwenden, um darauf das „Soziale“ zu gründen bzw. zu modellieren. Sozialtheorie ist damit lediglich ein eng geschnürtes Produkt biologischer Überlegungen. Hejl übersieht jedoch, dass er dabei wie Luhmann
die biologische Begrifflichkeit gleichsam als Hülsen für seine sozialtheoretischen
Überlegungen verwendet (vgl. Druwe 1988: 774).
Im für Luhmann günstigsten Falle könnte man von einer defizitär durchgeführten
Analogisierung sprechen. Nach Jürgen Friedrich gäbe es - aufgrund ausgebliebener
metatheoretischer Überlegungen - lediglich bei Modellen aus der gleichen Disziplin
erfolgreiche Analogien, z.B. beim Bohr’schen Atommodell und den Bewegungsgesetzen der Planeten. Allerdings soll nicht „der heuristische Wert der Analogiemethode bestritten werden; die Anwendung des Analogieschlusses erfordert jedoch in methodischer Hinsicht die Angabe der Attributenklasse, auf die er sich bezieht (Strukturanalogie, Funktionsanalogie usw.), und in inhaltlicher Hinsicht die Erfassung der
wesentlichen Merkmale des jeweiligen Gegenstandsbereichs“ (Friedrich 1980: 88).
7.1.5.2 Vereinheitlichung von Argumentmustern
Philip Kitcher hat der Vereinheitlichung von Erklärungen bzw. von Argumentmustern
zu einer gewissen Prominenz verholfen. Er wollte mit seinem Konzept wissenschaftsgeschichtliche Episoden besser nachvollziehen und zugleich einige Defizite
243
des klassischen Erklärungsschemas überwinden (vgl. Kitcher 1988: 193 f.). Zeitgleich behauptet er, die Idee der Vereinheitlichung sei schon immer - wenn auch „inoffiziell“ - Bestandteil des klassischen deduktiv-nomologischen Erklärungsschemas
gewesen; es sei hier immer um „das Erfassen eines Maximums von Tatsachen und
Regelmäßigkeiten mithilfe eines Minimums von theoretischen Konzepten und Annahmen“ gegangen (Feigl 1970, zit. nach Kitcher 1988: 194).
Wissenschaftliches Erklären setzt laut Kitcher auf Antworten, die sich durch wissenschaftliche Argumente speisen. Diese Argumente sammeln sich laut Kitcher in einer
Menge von Argumenten, von ihm als Erklärungsvorrat bezeichnet (vgl. ebd.: 200).
Demnach produziere Wissenschaft permanent solche Reservoirs an Erklärungsargumenten, die von Kitcher auch als „Argumentmuster“ bezeichnet werden. Diese
können mehrere Argumente (im Sinne von Erklärungen für irgendetwas) umfassen,
vorausgesetzt, „daß die Argumente dieser Menge in einigen interessanten Hinsichten
ähnlich sind“ (ebd.: 206). In dieser Hinsicht ähnelt Kitchers Verfahren der Analogisierung, auch wenn sein Vorgehen wesentlich präziser und strukturierter anmutet.
Zu einem Argumentmuster gehören mehrere Bausteine. Erstens mindestens ein
schematischer Satz, der „durch Ersetzung einiger, doch nicht notwendigerweise
aller nonlogischen Ausdrücke eines Satzes durch Schemabuchstaben entsteht“
(ebd.: 207), sodass gleichsam eine Schablone vorliegt. Ausfüllungsinstruktionen
bieten Anweisungen zur Ersetzung der Schemabuchstaben „derart, daß es für jeden
Schemabuchstaben eine Anweisung gibt, welche uns sagt, wie er ersetzt werden
soll“ (ebd.). Ein schematisches Argument besteht aus einer Folge schematischer
Sätze. Klassifikationen geben schließlich den Folgeverlauf solcher Sequenzen an:
„Ihre Funktion ist es, anzugeben, welche Glieder der Sequenz als Prämissen zu betrachten sind, welche Glieder aus welchen zu folgern sind, welche Folgerungsregeln
anzuwenden sind, und so fort“ (ebd.). Argumentmuster bestehen somit aus schematischen Sätzen, Ausfüllungsinstruktionen, schematischen Argumenten und Klassifikationen. Große vereinheitlichende Kraft haben demnach solche Theorien, die nicht nur
Erklärungen (Argumente), sondern v.a. mehrere Erklärungstypen (Argumentmuster)
vereinheitlichen. Argumente sind dann Instanzierungen von Argumentmustern.
Instanzen eines Argumentmusters liegen genau dann vor, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:
1. „Die Sequenz hat dieselbe Anzahl von Gliedern wie das schematische Argument des generellen Argumentmusters.
244
2. Jeder Satz der Sequenz ist aus dem entsprechenden schematischen Satz in
Übereinstimmung mit der entsprechenden Menge von Ausfüllungsinstruktionen erhalten worden.
3. Es ist möglich, eine Kette von Begründungen anzuführen, welche jedem Satz
den Status zuweist, welcher dem korrespondierenden schematischen Satz
durch die Klassifikation zugewiesen wird“ (ebd.: 208).
Glieder eines Argumentmusters müssen dabei nicht allesamt miteinander verkettet
sein. Ferner müssen nicht alle nonlogischen Ausdrücke durch Schemabuchstaben
ersetzt werden. Die Ähnlichkeit von Argumenten wird hinsichtlich ihrer logischen
Struktur oder ihres nonlogischen Vokabulars erreicht. Mit zunehmender Schärfe der
Bedingungen sowohl der logischen Struktur als auch des nonlogischen Vokabulars
wird die Menge möglicher Argumente eingeengt (vgl. ebd.: 209). Größte Vereinheitlichung ist dann möglich, wenn wenige Argumentmuster möglichst viele Argumente
subsumieren (vgl. Bartelbolth 1996: 440).
Als Paradebeispiel für ein Argumentmuster nennt er Newtons Errungenschaften in
der Dynamik, Astronomie und Optik, mit deren Hilfe man annahm (insbesondere im
Hinblick auf Körperbewegungen und Gravitation), daß wenige Basiskraftgesetze
entwickelt werden könnten, „ganz ähnlich dem Gesetz der universalen Gravitation,
sodaß durch Anwendung dieser Basisgesetze auf die jeweils spezifizierten Dispositionen der Letztbausteine von Körpern alle Phänomene der Natur abgeleitet werden
könnten“ (Kitcher 1988: 202). Newtons Überlegungen vereinheitlichen demnach all
jene Argumente, die der Erklärung von „Körperbewegungsphänomenen“ dienen
könnten; so wurden chemische Verbindungen oder die Reflexion mit Licht als von
Körpern vollzogene Prozesse betrachtet. Newtons Werk kann in diesem Sinne als
Argumentmuster betrachtet werden.
Die Anwendung von Kitchers Konzept zeitigt jedoch das ein oder andere unüberwindbare Problem. So scheint zunächst einmal ausgeschlossen, dass sich besonders komplexe Theorien noch auf einfache Argumentmuster zurückführen lassen
(vgl. Bartelbolth 1996: 443). Ferner lässt sich nach Bartelbolth an Kitchers Paradebeispiel der Newton‘schen Gravitationstheorie zeigen, dass eine Vereinheitlichung
zahlreiche Spezialisierungen der Teilargumente in Betracht ziehen müsste, was aber
ausbleibt (vgl. ebd.). Darüber hinaus würde sich die Flexibilität einer Theorie kaum
erschließen lassen, denn hier würden - wie Bartelbolth erneut an Newton’s Ideen
zeigt - unterschiedliche Argumentmuster instanziiert (vgl. ebd.: 444). Nicht zuletzt
245
würde durch Kitchers Konzept keine Vereinheitlichung der Wissenschaft erzielt, denn
letztlich würden auch isolierte Theorien als Argumentmuster verstanden; die Zahl der
vermeintlichen Argumentmuster würde dadurch nicht reduziert (vgl. ebd.).
7.1.5.3 Theorien-Netze im strukturalistischen Theorienverständnis
7.1.5.3.1 Wissenschaftstheoretischer Strukturalismus
Um es vorwegzunehmen: Der wissenschaftstheoretische Strukturalismus ist keine
explizite Methode zur Transferierung von Theorien. Mit dieser Methode soll laut deren Verfassern lediglich die Struktur wissenschaftlicher Theorien beschrieben bzw.
rekonstruiert werden. Zu diesem Zweck bietet er einen umfangreichen Baukasten an
Begrifflichkeiten, mit deren Hilfe der hier anvisierte Modelltransfer gelingen kann. Das
Vorgehen besteht also darin, eine strukturelle Kompatibilität a priori zu postulieren
und mit dem Instrumentarium des wissenschaftstheoretischen Strukturalismus bzw.
dem Konzept der intertheoretischen Links die Autopoiesetheorie als Grundlage eines
Theoriennetzes zu verwenden.
Joseph D. Sneed führte diese Methode für die Betrachtung von Theorien ein. Er verstand Theorien nicht mehr als Systeme satzartiger Gebilde, weshalb er seine Auffassung auch als „non-statement-view“ bezeichnet hatte, um sich vom klassischen Aussagenkonzept ein Stück weit abzugrenzen. Später wurde Sneeds Konzeption von
Yehoshua Bar-Hillel als „wissenschaftstheoretischer Strukturalismus“ bezeichnet (vgl.
Stegmüller 1987: 468). Ein Nebenziel war die Überwindung des in der Wissenschaft
bis dato geläufigen Zweisprachenkonzepts nach Carnap mit der teils problematischen Unterscheidung von analytischen und empirischen Begriffen. Sneed stützte
sich dabei auf die Konzepte der Bourbaki-Gruppe, die die Mathematik auf eine völlig
neue Grundlage stellen wollte und zu diesem Zweck mathematische Theorien nicht
mehr formalisierten, sondern mit Hilfe der Mengenlehre informell axiomatisierten (vgl.
ebd.: 470). Nach Patrick Suppes konnte mit Sneeds Methode ein einfacherer Umgang mit empirischen Theorien statt mit der bisher geläufigen Formalisierung erreicht
werden (vgl. ebd.).
Die Vertreter des wissenschaftstheoretischen Strukturalismus stießen sich an zwei
grundlegenden Defiziten moderner wissenschaftlicher Theorie. Erstens lagen viele
Theorien vor, die nur wenig Präzision und damit eine reduzierte Intersubjektivität
aufwiesen. So verführe z.B. Sigmund Freuds Theorie in dessen gesammelten Werken zu teils sehr unterschiedlichen Interpretationen (vgl. Balzer 1982: 7). Einige wis246
senschaftstheoretisch orientierte Philosophen strebten zweitens u.a. aus diesem
Grund eine vollständige Formalisierung bestimmter Theorien mit Hilfe einer Formalsprache an. Allerdings zeigte sich bald, dass selbst physikalische Theorien kaum
vollständig axiomatisierbar oder formalisierbar seien und falls doch, würde der Umgang mit ihnen äußerst komplexe Anforderungen an eine zudem noch zu entwickelnde Formalsprache stellen.
Wissenschaftstheoretische Strukturalisten möchten zur Überwindung dieser Defizite
Theorien als mengentheoretische Axiomatisierung darstellen. Bezweckt wurde damit
eine Rekonstruktion solcher Theorien mit dem Gewinn einer deutlichen Präzisierung.
Jede Theorie hat demnach „eine mathematische Grundstruktur, die beim axiomatischen Aufbau dieser Theorie festgelegt wird“ (Stegmüller 1987: 475). Nach Sneed et.
al. besteht die Aufgabe „der informellen mengentheoretischen Axiomatik […] darin,
diese Struktur so genau zu beschreiben, daß sie ebenfalls durch ein mengentheoretisches Prädikat wiedergegeben werden kann“ (ebd.: 472). Stegmüller nennt als Beispiel die euklidische Theorie, die er durch das Prädikat „…ist eine euklidische Struktur“ axiomatisieren möchte. Die Axiome selbst sind nun Bestandteil des Definiens
bzw. der Extension des Prädikats. Diese enthalten alle bekannten Grundbegriffe der
euklidischen Theorie, etwa „Gerade“, „Ebene“, „Punkte“, „koinzidiert“, „liegt zwischen“
oder „ist kongruent“ (vgl. ebd.: 471).
Es geht somit um eine Herausarbeitung des mathematischen Kerns einer Theorie mit
Hilfe informeller Mengenlehre und informeller Logik anstelle von Carnaps Formalisierung. Stegmüller meint bezüglich der Methode der informellen Formalisierung, sie
solle „kein formalsprachliches Vorgehen andeuten, sondern allein darauf hinweisen,
daß dieses axiomatische Vorgehen dem Präzisionsstandard der heutigen Mathematik genügt. Und das Attribut ,informell‘ beinhaltet, daß […] die logischen Ausdrücke in
ihrer üblichen umgangssprachlichen Bedeutung zu verstehen sind, allerdings ausgestattet mit den bekannten Normierungen im Falle des ,wenn…dann---‘. Insbesondere
sind Junktoren und Quantoren keine Zeichen einer formalen Sprache, sondern bloße
Abkürzungen“ (Stegmüller 1986: 21). Das informelle Vorgehen lässt sich zudem auch
in den Sozialwissenschaften anwenden (vgl. Burth 1999: 35), deshalb soll die Autopoiesetheorie nicht formalisiert, sondern in ihrer axiomatisierten Darstellung belassen
werden - zumal etwa Wolfgang Balzer von komplett formalisierten Theorien als einem „Grenzfall“ spricht (vgl. Balzer 2009: 60). Balzer stellt zur sprachlichen Ausformung einer (nicht formalisierten) Theorie fest: „Eine normierte Sprache ist einfach
247
und sie verfügt über den Ableitungsbegriff der Logik, der genau festlegt, wie ein Satz
A aus einem anderen Satz B abgeleitet werden kann“ (ebd.: 59).
Manche der Autoren des wissenschaftstheoretischen Strukturalismus sehen in diesem Vorgehen eine Möglichkeit zur Vereinheitlichung der Wissenschaften. In deren
Augen gewinnt die Beachtung der Einheit einer sich immer stärker ausdifferenzierten
Wissenschaft verstärkt an Bedeutung: „Science is not an amorphous bunch of
isolated propositions but rather an organic whole of interrelated theories“ (Moulines
1992: 403). Auch C. Ulises Moulines postuliert von daher eine strukturalistische Theorienperspektive, wodurch wissenschaftliche Theorien „conceived as complex
structures themselves composed of particular kinds of structures“ (ebd.) verstanden
werden. Vom klassischen Aussagenkonzept unterscheidet es sich insofern, als dass
dieses einzelne Terme oder Funktionen in den Vordergrund rückt. Der Strukturalist
hingegen versucht, die gesamte Struktur der Theorie in einer umfassenderen Art und
Weise zu ergreifen (vgl. Stegmüller 1980: 3).
7.1.5.3.2 Theorien- und Modellverständnis des Strukturalismus
Nun zum Theorienverständnis: Gegeben sei eine Theorie T, die durch ein mengentheoretisches Prädikat „ist eine mathematische Struktur S“ beschrieben wird. Die Extension des Prädikates „ist ein S“ ist dann die Menge MS(T) der verschiedenen Arten
von Modellen der vorliegenden Theorie (vgl. Stegmüller 1980: 56). Modelle sind „Re-
lationsstrukturen D, R, die aus bestimmten Grundmengen D=D1,…, Dn und Relationen R= R1,…, Rk auf den Grundmengen bestehen. Intuitiv ist das so gemeint,
daß die Grundmengen die Objekte enthalten, über die eine Theorie spricht – wobei
es verschiedene Typen von Objekten geben kann – und die Relationen geben die
Beziehungen wieder, die die Theorie zwischen diesen Objekten behauptet“ (Barthelborth 1996: 35 f.). Strukturalisten verwenden den Modellbegriff somit anders bzw.
in reduzierter Form als klassische Wissenschaftstheoretiker; Modelle sind Aussagen,
die bestimmte Strukturen einer Theorie erfüllen bzw. Abbilder einer Theorie sind und
damit nicht mehr i.w.S. Wirklichkeitsausschnitte.
Jede Theorie (T) besteht demnach aus einem sogenannten Kern K, der aus Modellen und Nebenbedingungen besteht und in der Summe aus vier Bausteinen zusammengesetzt ist, und dessen empirischen Behauptungen, die als intendierte Anwendungen (I) bezeichnet werden (vgl. ebd.: 111). Zunächst zum Theorienkern K:
248
1. Dazu gehören erstens die Modelle M, die Axiome beinhalten. Diese grundlegenden Gesetze müssen immer mindestens zwei Komponenten der Theorie
miteinander verknüpfen. Dabei kommt es nicht auf die Anzahl der Gesetze an;
so umfasst z.B. die archimedische Statik lediglich ein einziges zentrales Gesetz (vgl. Stegmüller 1986: 22).
2. Weiterhin besteht der Kern aus potentiellen Modellen Mp, die auf Axiome,
nicht jedoch theoretische Grundbegriffe bzw. Theoreme verzichten. I.d.R. gibt
es weitaus mehr potentielle Modelle als Modelle (vgl. Stegmüller 1986: 181);
diese stellen zugleich das Begriffsgerüst der Theorie.
3. Ferner existieren partielle potentielle Modellen Mpp, die auch auf die theoriebezogenen theoretischen Terme verzichten. Ihr theoretischer Hintergrund
speist sich aus anderen Theorien. Dem Strukturalismus geht es nun darum
herauszufinden, ob das vorliegende Modell selbst die Axiome der Theorie
oder lediglich deren partielle potentielle Modelle „ausfüllt“.
4. Viertens zählen Gesetze und Nebenbedingungen (C: Constraints, gelegentlich auch als Querverbindung bezeichnet, so z.B. bei Stegmüller 1987: 88 ff.)
zum Theoriekern. Diese ordnen gleichen Elementen in unterschiedlichen Systemen gleiche Merkmale zu (vgl. Druwe 1995: 383). Nebenbedingungen setzen etwa fest, „daß die Werte der theoretischen Funktionen in den einzelnen
Anwendungen in bestimmter Relation zueinander stehen; dadurch werden
diese Anwendungen ,zusammengebunden‘“ (Stegmüller 1980: 15). Ein Beispiel hierfür wäre das Festsetzen der Masse des Planeten Erde sowohl im
Sonnensystem als auch im System Sonne-Mond-Erde (vgl. ebd.). Gesetze unterscheiden sich von Nebenbedingungen folgendermaßen: „Gesetze schließen stets bestimmte mögliche Modelle davon aus, tatsächliche Modelle zu
werden. Nebenbedingungen hingegen verbieten bestimmte Kombinationen
von möglichen Modellen oder von Modellen als unzulässig“; erstere gelten
somit „in jeder einzelnen Anwendung“, die Zweiten stellen „Querverbindungen
zwischen verschiedenen Anwendungen her“ (alle ebd.: 142).
5. Die letzte Neuerung des wissenschaftstheoretischen Strukturalismus ist die
Einführung sogenannter Spezialgesetze. Diese dienen der Ergänzung oder
Verbesserung bestehender Theorien. Sie sind erstens strenger formuliert als
der bisherige Theoriekern, sodass sich die Menge der Modelle verkleinern
dürfte - damit zählen sie nur bedingt zum Theoriekern. Zweitens können sie
249
auch „nur“ die Menge der intendierten Anwendungen reduzieren (vgl. Stegmüller 1987: 501). Sie werden prinzipiell so formuliert wie das Basiselement
(T‘, K‘=M‘): „Zunächst wählt man aus der Menge Mpp der partiellen möglichen
Modelle des gegebenen Theorienelementes eine nichtleere Teilmenge M’ pp
aus. Entsprechend bestimmt man Teilmengen M‘ von M und C‘ von C. Die
Menge der intendierten Anwendungen des speziellen Gesetzes ist definierbar
als I‘=I M’pp und M’p läßt sich so einführen, daß seine Elemente neue partielle
mögliche Modelle sind (also Elemente von M’pp), zu denen noch die theoretischen Funktionen hinzugefügt wurden“ (Stegmüller 1980: 143).
Zusammengefasst besteht ein Theoriekern aus folgenden Bausteinen:
K={M, Mp, Mpp, C}
Bei aller Vielfalt können mit Hilfe des vorgestellten Vokabulars Begriffe einer Theorie
geordnet werden; so könnten die theoretischen Begriffe der Autopoiesetheorie etwa
abgekürzt als Mp(A) bezeichnet werden. Um eine erhöhten Präzisionsgrad zu erreichen, wird im wissenschaftstheoretischen Strukturalismus gelegentlich modelltheoretische Sprechweise (vergleichbar mit formaler Logik) verwendet. Wo dies nicht nötig
ist, genügt die partielle Verwendung mengentheoretischer Prädikate, die Stegmüller
als quasi-linguistisch bezeichnet (vgl. Stegmüller 1986: 24 oder Balzer 2009: 110,
113-114). Zum Vokabular einer (empirischen) Theorie gehören Begriffe aus der natürlichen Sprache, logische und spezielle Ausdrücke. Zu den logischen Ausdrücken
zählen etwa Variablenbezeichnungen für Objekte oder Sorten für Objektarten, Junktoren wie „und“, „nicht“ oder „wenn-dann“ oder Quantoren wie „es gibt“ oder „für alle“.
Spezielle Ausdrücke sind beispielsweise Gattungsbegriffe wie „Individuum“, „Gruppe“
oder „Handlung“, Relationsbegriffe wie „ist größer als“ oder „übt Macht aus über“,
Funktionsbegriffe, die oft in Werten ausgedrückt werden wie etwa der Nutzen einer
Handlung für eine Person, und schließlich Konstanten (vgl. Balzer 2009: 60 ff.). Nicht
zuletzt gehören zu Theorien Definitionen, die einerseits zur Abkürzung komplexer
Terme, andererseits „zur Klärung, Präzisierung und Bedeutungsfestlegung von Begriffen“ dienen (ebd.: 79).
Um diese Theorien empirisch überprüfen zu können, wurde der Begriff der intendierten Anwendungen (I) eingeführt. Das bedeutet, ein Modell kann evtl. „mehrere
intensional unterschiedliche, aber zum gleichen Strukturtyp gehörende, formalsemantische Modelle, d.h. Belegungen bzw. Interpretationen besitzen. […] Demnach
wird analog zur mathematischen Modelltheorie die Aussage abgeleitet, daß ein
250
Axiomensystem A einer zugeordneten empirischen Theorie Temp auch mehrere
intensional unterschiedliche empirische Interpretationen, Belegungen, somit Realisationen hinsichtlich Memp besitzen kann, wobei das Axiomensystem A als axiomatisches Darstellungsmodell und als ein in Vermittlung über eine Meßsprache strukturtheoretisch abgebildetes Modell des empirischen Phänomenbereichs fungiert“
(Wernecke 1994: 144). Empirische Aussagen einer Theorie sind damit Teilmenge der
partiellen potentiellen Modelle (vgl. Stegmüller 1980: 58). Der Strukturalismus möchte damit auch empirisch verfahrenden Wissenschaftlern gerecht werden, denn „man
kann eine empirische Theorie […] im Unterschied zu einer formalwissenschaftlichen
Theorie […] nicht einfach mit irgendwelchen Mengen abstrakter Strukturen gleichsetzen, sondern muß als zusätzliche Komponente jeder empirischen Theorie eine
Menge intendierter Anwendungen einführen“ (Westermann 1987: 29). Allerdings
müssen nicht unbedingt empirisch messbare, d.h. quantifizierbare, Anwendungen
einer Theorie vorliegen. Handelt es sich lediglich um qualitativ beschriebene Anwendungen, liegt keine T-abhängige Messbarkeit, sondern eine T-abhängige Bestimmung des Wahrheitswertes vor (vgl. Stegmüller 1985: 60).
Die intendierten Anwendungen „werden unabhängig von dieser mathematischen
Struktur pragmatisch festgelegt“ (Stegmüller 1980: 8). An gleicher Stelle spricht
Stegmüller auch von „paradigmatischer“ Festlegung, was meint: „Wir geben in einem
ersten Schritt ,typische‘ oder ,paradigmatische‘ Beispiele von Spielen an; und in einem zweiten Schritt erklären wir alle diejenigen Entitäten für Spiele, die mit den paradigmatischen Beispielen hinreichend ähnlich sind“ (Stegmüller 1987: 478). An anderer Stelle (Stegmüller 1986: 29) ist die Rede von der Regel der Autodetermination;
Erweiterungen der intendierten Anwendungen müssen demnach die theoretische
Struktur erfüllen. Demnach besteht die Aufgabe eines jeden Wissenschaftlers sowohl
in der Entwicklung von Theorien als auch in der parallelen Beschreibung von Anwendbarkeiten - diese seien gerade nicht ausschließlich aus der Theorie heraus zu
ermitteln. Die Zahl der intendierten Anwendungen einer Theorie ist prinzipiell offen; je
nach Erfolg oder Misserfolg kann sie erweitert oder reduziert werden (vgl. Stegmüller
1987: 479). Eine an bestimmte Bedingungen oder Kriterien geknüpfte Festlegung sei
von daher a priori nicht möglich (vgl. Stegmüller 1986: 28). Verbindung zu den Theoriekernen erlangen sie dadurch, dass sie die begriffliche Struktur (mindestens) der
potentiellen Modelle mit realen Begriffen auf- bzw. erfüllen (vgl. ebd.), sie selbst sind
Teilmenge der partiellen potentiellen Modelle.
251
Stegmüller sieht darin einen großen Vorteil des Strukturalismus gegenüber dem
klassischen Aussagensystem: „Die Tatsache, daß innerhalb des strukturalistischen
Vorgehens ein solcher pragmatischer Schritt vollzogen werden kann, ist, wie oben
angedeutet, einer der großen Vorzüge dieses Verfahrens gegenüber dem formalsprachlichen Vorgehen, welches tatsächlich die Anwendungen mit den möglichen
Modellen identifizieren muß und dadurch zu Inadäquatheiten, häufig zu Absurditäten,
führt“ (Stegmüller 1980: 8). Prinzipiell handelt es sich bei den intendierten Anwendungen eines Modells „um eine offene Menge, d.h. ihre Elemente werden aufgezählt,
da man nicht angeben kann, welche Anwendungen eine Theorie hat/ haben wird. I
kann sich im Laufe der Zeit beliebig ändern, je nachdem, wie sich die Forschung
entwickelt“ (Druwe 1995: 384). Korrekterweise spricht man dann auch nicht von der
Anwendung einer Theorie, sondern von der Menge der intendierten Anwendungen
(vgl. Stegmüller 1980: 138). In dieser Hinsicht unterscheide sich der wissenschaftstheoretische Strukturalismus deutlich vom klassischen Aussagensystem, denn bei
diesem seien die empirischen Behauptungen festgelegt im Sinne von „eingeengt“,
während der wissenschaftstheoretische Strukturalismus eine prinzipiell offene Menge
intendierter Anwendungen annimmt. Damit sei zeitgleich die Möglichkeit gegeben,
verschiedene empirische Behauptungen einer einzigen Theorie zuzusprechen (vgl.
Balzer 1985: 31).
Erweisen sich einzelne intendierte Anwendungen als nicht mit der Realität übereinstimmend, gilt lediglich diese Anwendung als gescheitert. Die Theorie an sich wird
nie falsifiziert, im äußersten Fall handelt es sich um eine analytische Theorie ohne
empirische Verwertbarkeit (vgl. Westermann 1987: 79). Theorien (bzw. deren Kerne)
seien von daher in dreifacher Hinsicht „immun“: Erstens ließen sich nur intendierte
Anwendungen bewähren oder verwerfen, ihre Menge sei prinzipiell offen. Zweitens
hätten sich Fundamentalgesetze meist schon so häufig bewährt, dass eine einmalige
Fehlanwendung nicht gleich zu deren Abschaffung führe. Drittens seien theorieunabhängige Messungen zur Widerlegung ebenjener Theorie prinzipiell nicht möglich (vgl.
Stegmüller 1980: 41 ff.).
Zugegebenermaßen lösen die Strukturalisten gerade nicht die Frage, wie von der
Theorie zur Empirie gelangt werden kann, sondern umgehen sie eher. Tatsächlich
kann der Strukturalismus trotz aller Kritik an Carnaps beiden Wissenschaftssprachen
selbst nur spärlich Angaben machen, wie man von der Theorie zur Empirie „kommt“:
„Das Problem besteht darin, einen Zusammenhang zwischen konkreten Systemen
252
und ,theoretischen‘ Strukturen herzustellen. Wir nehmen im folgenden an, daß ein
solcher Zusammenhang hergestellt werden kann. Ohne diese Annahme hat es keinen Sinn, von empirischer Wissenschaft zureden. Weiter nehmen wir an, daß nicht
nur eine Verbindung hergestellt werden kann, sondern daß diese Verbindung
schließlich den intendierten Anwendungen die Struktur partieller Modelle gibt. Mit
Hilfe dieser Annahme wird zugegebenermaßen der weiteste Teil des Weges zwischen Realität und theoretischen Strukturen überbrückt. Aber wenn wir hier nicht in
etwas gewaltsamer Art eine Brücke schlagen, können wir in der Wissenschaftstheorie derzeit kaum über die Betrachtung bloß formaler Strukturen hinauskommen. Wir
können nicht sagen, worin die empirische Behauptung einer Theorie besteht und
folglich auch nicht über die Gültigkeit und Testbarkeit von Theorien nachdenken. Alles, was wir ohne diese Brücke tun können, ist, die formale Struktur von Modellen
und Querverbindungen zu untersuchen - und solange die strukturalistische Wissenschaftstheorie nur dies tut, kann man ihr vorwerfen (was auch getan wird), sie sei
nichts als Logik“ (Balzer 1982: 288 f.).
Balzer deutet an dieser Stelle nur mögliche Problembereiche an, die sich bei der Beantwortung dieser Frage stellen könnten. Primär gehe es um erkenntnistheoretische
Fragestellungen und strukturalistische Feinheiten - Antworten können also nicht ausschließlich von der Wissenschaftstheorie gegeben bzw. gefordert werden (vgl. ebd.:
289 ff.). Es geht den Strukturalisten in der Summe also nicht hauptsächlich um ein
Sprachproblem bzw. um die Übersetzung von analytischer in empirische Begrifflichkeit, sondern vielmehr um die Beibehaltung der Struktur des Theoriekerns bei der
Entwicklung einer intendierten Anwendung. Einzelne Aussagen spielen zwar auch
hier eine wichtige Rolle (wie sollten Theorien auch sonst aufgebaut sein?), schwerpunktmäßig geht es den Strukturalisten jedoch um die „Untersuchung von globalen
Strukturen von Theorien“ (Stegmüller 1980: 2).
Zusammengefasst besteht also jede Theorie aus einem Kern K - Modellen, potentiellen Modellen, partiellen potentiellen Modellen, Constraints bzw. Gesetzen - und intendierten Anwendungen (I)2. Der Theoriekern wird als Theorie oder Theorie-Element
bezeichnet. Stegmüller sieht durchaus Ähnlichkeiten zum klassischen Aussagensystem, meint aber auch: „Ungewöhnlich ist unser Vorgehen nur insofern, als wir scharf
unterscheiden zwischen der Theorie und den empirischen Behauptungen dieser
2
Balzer weist darauf hin, dass zu einer empirischen Theorie im Grunde genommen auch Daten und ein Approximationsapparat gehören, wobei letzterer eine Verbindung von Daten und Modellen herzustellen vermag
(Balzer 2009: 56 f.).
253
Theorie. Die herkömmliche Denkweise weicht von der unsrigen dadurch ab, daß sie
erstens überhaupt nur diese Behauptungen betrachtet und zweitens die Gesamtheit
dieser Behauptungen selbst ,Theorie‘ nennt. Der strukturalistische Ansatz unterscheidet sich vom herkömmlichen also nicht etwa durch die absurde These, daß diese Aussagen wegfallen, sondern daß er außer diesen Aussagen zusätzlich gewisse
ihnen zugrunde liegende Strukturen betrachtet, die im Rahmen des statement view
vernachlässigt werden“ (Stegmüller 1986: 52, Hervorhebung im Original). Formal
lässt sich eine Theorie folgendermaßen beschreiben:
„X ist ein Theorie-Element nur wenn es K und I gibt, so daß
x = K,I
K = Mp, Mpp, r3, M, C ist ein Kern für ein Theorie-Element
I Mpp4“ (Balzer/ Sneed 1983: 122)
Jörg Wernecke verdeutlicht das strukturalistische Theorienverständnis an einem Beispiel: So sei Newtons Modell der klassischen Mechanik ein System, dass aus mit
Kraft und Masse ausgerüsteten Teilchen besteht und in welchem das 2. Newtonsche
Gesetz (Axiom) gilt: F = m * a (Kraft ist das Produkt aus Masse und Beschleunigung).
Wird nun das vorliegende Axiom aus dem Modell entfernt, liegt die Menge aller potentiellen Modelle Newtons klassischer Mechanik vor, d.h. nach Wernecke dass „die
potentiellen Modelle […] somit lediglich ein ,framework‘ in Form der Grundbegriffe“
liefern (Wernecke 1994: 167), im vorliegenden Beispiel also Teilchen mit Masse und
Kraft. Ferner könne nun zwischen theoretischen und nicht-theoretischen Termen unterschieden werden, in diesem Falle wären theoretische Terme Masse und Kraft,
diese beiden Begriffe werden durch Newtons Theorie theoretisch bestimmt 5. Wird
auch auf diese beiden Begriffe verzichtet, so liegt ein partiell potentielles Modell der
klassischen Mechanik vor, das nur noch aus sich bewegenden Teilchen besteht (vgl.
dazu auch Stegmüller 1980: 141). Im Gegensatz dazu sind intendierte Modelle nur
solche, die sich aus empirischen Begrifflichkeiten zusammensetzen, sie „sollen nur
jene Strukturen enthalten, die auch Beschreibungen von realen Gegenständen darstellen“ (Wernecke 1994: 169).
3
r ist lediglich eine hier nicht näher zu beschreibende Funktion, die darstellt, wie man von den potentiellen zu
den partiellen potentiellen Modellen gelangt.
4
Absatz 3 der Definition meint nichts anderes als dass Intendierte Anwendungen die Struktur der partiellen
potentiellen Modelle erfüllen müssen.
5
Zur Bestimmung theoretischer Begriffe im folgenden Abschnitt mehr.
254
7.1.5.3.3 T-Theoretizität
Im vorigen Abschnitt war mehrmals vom „empirischen Gehalt“ oder „empirischen und
analytischen Begriffen die Rede. Wie die Geschichte der Bestimmung dieser Begrifflichkeiten zeigt, ist nicht immer klar, was mit ihnen gemeint ist. Von daher soll im Folgenden ein knapper Exkurs stattfinden, an dessen Ende mit dem Konzept der „TTheoretizität“ die Lösung des Strukturalismus bezüglich der Problematik analytischer
und empirischer Begriffe präsentiert wird.
Das empirisch-analytische Wissenschaftsverständnis differenzierte lange im Sinne
des Logischen Empirismus zwischen einer analytischen und einer empirischen Wissenschaftssprache. Analytische Begriffe sollten nur mittelbar auf „die Wirklichkeit“
Zugriff haben. Sie sollten über empirische Begriffe bestimmt werden, d.h. für Wissenschaftssprache war „vorausgesetzt worden, daß ihre undefinierten Grundprädikate
beobachtbare Eigenschaften und Relationen bezeichnen und daß alle übrigen Prädikate (Begriffe) auf diese Grundprädikate (Grundbegriffe) zurückgeführt werden können“ (Stegmüller 1978: 461). Dahinter verbarg sich die Vorstellung, dass sich die
Aussagen des Theoretikers immer an der Beobachtung überprüfen lassen müssten
(vgl. ebd.: 463). Der Wahrheitswert analytischer Aussagen bemisst sich demnach
allein durch eine Bedeutungsanalyse. Dies gilt etwa für formallogische oder analytische Wahr- und Falschheiten. Empirische Aussagen hingegen bemessen ihren
Wahrheitswert mittels Überprüfung durch Erfahrung (vgl. Stegmüller 1970: 181).
Als problematisch erwiesen sich jedoch die sogenannten Dispositionsprädikate, die
nicht analytisch sind, sich jedoch auch nicht der empirischen Wissenschaftssprache
zuordnen bzw. direkt empirisch messen lassen (vgl. Druwe 1995: 381), denn sie „beschreiben keine unmittelbar wahrnehmbaren Eigenschaften, sondern solche, die erst
durch systematische Beobachtung erschlossen werden können. Dispositionsprädikate sind z.B. zerbrechlich, löslich, demokratisch, rezessiv“ (Burth 1999: 30) Nicht zuletzt leiden diese Prädikate, wenn sie einmal in eine logische Aussagenform gebracht
worden sind, an einem bestimmten logischen Bruch (vgl. Stegmüller 1978: 462).
Präzisiert wurde das Sprachverständnis des logischen Empirismus durch Rudolf
Carnap, der die Zweistufenkonzeption der empirischen Wissenschaftssprache entwickelt hat, wonach „in jeder theoretischen Erfahrungswissenschaft zwischen der Beobachtungssprache LO und der theoretischen Sprache LT“ unterschieden werden muss
(ebd.: 463). Die theoretische Sprache sollte fortan nicht mehr auf die Empirie zurückführbar sein, sondern eine eigene Sprachwelt präsentieren, in welcher Theorien als
255
Kalkül konstruiert werden und z.B. analytische Begriffe der Logik und Mathematik
umfassen (vgl. Druwe 1995: 365). Empirische Begriffe beziehen sich nach Carnap
auf „unmittelbar Gegebenes“ (ebd.), können aber auch „verschiedene Verfahren der
Zurückführung von Prädikaten auf die beobachtbaren Grundprädikate enthalten und
außerdem den ganzen komplizierten Apparat der modernen Logik zur Bildung komplexerer Aussagen benützen“ (Stegmüller 1978: 463). Zu einer empirischen Theorie
kann eine Theorie nur durch eine partielle empirische Interpretation werden, d.h. nur
einige Begriffe werden interpretiert bzw. mittels Korrespondenzregeln aus dem theoretischen Begriffsuniversum einer empirischen Überprüfung zugeführt. (vgl. ebd.:
464). Es muss darauf hingewiesen werden, dass Carnap mit der Bezeichnung „theoretische“ Begriffe „analytische“ Begriffe meinte (vgl. Druwe 1995: 365).
Carnaps Konzept wurde vielfach kritisiert; Druwe fasst die geläufigsten Kritikpunkte
folgendermaßen zusammen: Erstens würde eine ganze Reihe an Begriffen existieren, die sowohl empirisch als auch analytisch seien; Beobachtungen seien demnach
immer theoriegeladen und nicht direkt verifizierbar. Zweitens würde Carnap bei der
Generierung von Hypothesen induktiv vorgehen; dies sei jedoch logisch defizitär.
Drittens würde das Verfahren der Verifikation mehrere Mängel aufweisen, da z.B. die
Zahl der Überprüfungen immer endlich sei und von einer bestimmten Person abhingen (vgl. Druwe 1995: 367).
Die strikte Trennung von empirischer und theoretischer Sprache wurde zum größten
Kritikpunkt an diesem Konzept. So weist Burth darauf hin, dass „eine positive Bestimmung des Begriffs bzw. seiner Verwendung, etwa durch den Aufweis der Stellung, die ein theoretischer Begriff im Rahmen einer Theorie ausfüllt“, nicht geleistet
würde (Burth 1999: 31); theoretische Begriffe würden ausschließlich negativ als nicht
zugehörig zur Beobachtungssprache definiert. Diese Problematik sei darauf zurückzuführen, dass die Trennung in Beobachtungs- und Theoriesprache a priori, d.h. vor
jeder wissenschaftlichen Theoriebildung geschehe. Folglich könne Wissenschaft im
Rahmen von Theoriebildung nicht mehr darüber diskutieren, welche Begriffe innerhalb einer Theorie theoretisch sind und welche nicht; dies sei vorab festgelegt (vgl.
Stegmüller 1987: 480). Nicht zuletzt weist Druwe darauf hin, dass auch empirische
Sätze nicht wirklich an der Realität, sondern an empirisch gehaltvollen Sätzen geprüft
werden müssen: „Im strikten Sinne können Sätze nur mit Sätzen geprüft werden; der
Bezug zur Realität verlangt dann, daß diese Sätze eindeutig mit Sinnesdaten gekoppelt sind“ (Druwe 1995: 366 Anm. 3).
256
Eine Lösung dieser Probleme bot Joseph D. Sneed im Rahmen der Entwicklung des
wissenschaftstheoretischen Strukturalismus an. Theoretische Begriffe sollen laut
Sneed nicht mehr a priori bestimmt, sondern vielmehr in Bezug auf eine vorliegende
Theorie jeweils neu herausgefiltert werden. Solche Begriffe bezeichnet er dann als
„T-theoretische Terme“: „Ein in T vorkommender Größenbegriff wird dann theoretisch
bezüglich T, oder kurz einfach: T-theoretisch, genannt, wenn die Messung der fraglichen Größe voraussetzt, daß es zutreffende Anwendungen, also Wahrheitsfälle, des
diese Theorie ausdrückenden Prädikates gibt“ (Stegmüller 1987: 481). Begriffe werden also nur dann als T-theoretische Terme bezeichnet, wenn sich deren Werte ausschließlich unter Rückgriff auf ebenjene Theorie berechnen lassen, wobei sich diese
Theorie als bereits gültig erwiesen haben muss (vgl. Stegmüller 1973: 47).
Empirische Begrifflichkeiten hingegen sollen laut Sneed nicht mehr theorieunabhängig im Sinne von Carnaps Beobachtungssprache verstanden werden. Als „nicht-Ttheoretisch“ (oder ehemals „empirisch“) bezeichnet Sneed solche Begriffe, die auch
ohne die vorliegende Theorie, aber mit Bezugnahme auf eine andere Theorie, gemessen werden können (vgl. Burth 1999: 32). Auch nicht-T-theoretische Begriffe
existieren somit immer nur vor dem Hintergrund einer vorliegenden Theorie. Sie sind
ebenfalls partiell theoretisch, damit von einer anderen Theorie messabhängig und
bezüglich dieser Theorie t-theoretisch - Beobachtungen sind also immer theoriegeladen.
Troitzsch nennt hier als Beispiel die Variable „Zeit“: Diese spiele in sozialwissenschaftlichen Modellen häufig eine Rolle, gemessen würde sie jedoch mit verschiedenen naturwissenschaftlichen Methoden. In Bezug auf die Sozialwissenschaften sei
die Zeit somit ein nicht-T-theoretischer (oder eben empirischer) Term; hinsichtlich der
sie messenden naturwissenschaftlichen Modelle sei sie jedoch t-theoretisch (vgl.
Troitsch 1990: 137). Terme sind damit immer T-theoretisch, fraglich bleibt jeweils nur
in Bezug auf welche Theorie T. In der Summe handelt es sich um ein funktionales
Kriterium, „denn das Unterscheidungsmerkmal für den Gegensatz ,theoretisch nicht-theoretisch‘ bildet die Art der Verwendung der in einer Theorie vorkommenden
Funktionen“ (Stegmüller 1985: 54).
In Bezug auf empirische Überprüfungen entsteht hier ein vermeintliches Paradoxon:
Demnach würde verlangt werden, dass jede empirische Aussage zugleich theoretische Terme umfasse bzw. dass (entsprechend der Definition T-theoretischer Terme)
die Theorie schon vor der empirischen Prüfung gültig ist. Sollen empirische Aussa257
gen also nicht nur wahr (im semantischen Sinne), sondern auch richtig (im erkenntnistheoretischen Sinne) sein, so müsste immer schon eine empirische Behauptung
dieser Theorie gelten bzw. sich bereits als richtig erwiesen haben. Oder in Stegmüllers Worten: „Die Beantwortung der Frage, ob die k-te Anwendung der Theorie erfolgreich ist, muß sich auf die Beantwortung der Frage stützen, ob eine andere Anwendung dieser Theorie erfolgreich ist. Wenn die Zahl der Anwendungen einer Theorie endlich ist, so geraten wir damit in einen circulus vitiosus. Wenn die Zahl der Anwendungen dagegen unendlich ist, so landen wir in einem unendlichen Regress“
(Stegmüller 1985: 65). Als Beispiel nennt Stegmüller eine Waage, die auf der klassischen Partikelmechanik beruht und das Gewicht eines Individuums messen soll.
Wenn das Messergebnis als richtig anerkannt werden soll, bedarf es immer schon
eine vorhergehende, ebenfalls auf der klassischen Partikelmechanik beruhende und
ein richtiges Ergebnis feststellende Messung eines anderen Gewichts - dies führe
jedoch in einen Circulus Vitiosus (vgl. Stegmüller 1980: 57).
Zur Lösung dieses „Problems der theoretischen Terme“ (Stegmüller 1986: 40) existiert bislang lediglich die Ramsey-Lösung: „Darin werden die theoretischen Terme
durch
Variablen
ersetzt,
und
die
empirischen
Hypothesen
beginnen
mit
Existenzquantoren bezüglich dieser Variablen. Da die so entstehende Aussage nur
mehr den nichttheoretischen Größen einschränkende Bedingungen auferlegt, wird
dadurch die empirische Prüfbarkeit wiederhergestellt“ (Stegmüller 1980: 9). Das
Ramsey-Substitut bleibt jedoch dem alten Satz gleichwertig; lediglich die ttheoretischen Terme sind eliminiert. Mit Hilfe der Existenzquantoren wird nur die
Existenz der theoretischen Terme behauptet, nicht mehr jedoch deren theorieunabhängige Messung (vgl. Westermann 1987: 78). Dem wissenschaftstheoretischen
Strukturalismus zufolge sind solche Ramsey-Sätze partielle potentielle Modelle, also
Modelle einer Theorie, die auf Fundamentalgesetze und t-theoretische Terme verzichten (vgl. Stegmüller 1987: 486). Umgekehrt kann eine empirische Behauptung
nur dann zu einem Theoriekern gehören, wenn erstens ihre partiellen potentiellen
Modelle Teilmenge der partiellen potentiellen Modelle Mpp des Theoriekerns T sind,
zweitens diese partiellen potentiellen Modelle durch Hinzufügen von potentiellen Modellen zu einem Modell von T werden und drittens gleichzeitig die Nebenbedingungen von T erfüllen (vgl. Stegmüller 1980: 145).
Fazit dieses Ausflugs: Theoretische Terme sind solche, deren Messung immer schon
eine gültige Anwendung der Theorie voraussetzen; nicht-theoretische Terme sind
258
solche, die durch eine andere Theorie bestimmt bzw. empirisch ermittelt werden. Der
Circulus Vitiosus der theoretischen Terme lässt sich wissenschaftstheoretisch durch
Ramsey-Sätze auflösen. Zwar mag diese Bestimmung theoretischer Terme wissenschaftstheoretisch korrekt sein. Allerdings weist Manhart darauf hin, dass dieses
Verständnis für den Alltag vieler, v.a. sozialwissenschaftlicher Disziplinen unbrauchbar sei: „Für die Sozialwissenschaften ist die Definition theoretischer Terme zu unflexibel und problematisch, da in sozialwissenschaftlichen Theorien alle Begriffe Ttheoretisch sein können“ (Manhart 2007: 9). Aus diesem Grund hat Wolfgang Balzer
die Bestimmung theoretischer Begriffe leicht verändert: T-theoretisch heißt nun,
„dass ein Term t in einer Theorie T theoretisch ist genau dann, wenn er in einer genau festgelegten Weise in T messbar oder bestimmbar ist“ (Balzer 1985: 139). Balzer
entfernt somit das Gültigkeitskriterium und meint hierzu: „Die intuitive Idee ist ziemlich einfach: Term t ist T-theoretisch, wenn er in T in genau angebbarer Weise bestimmt werden kann: nämlich durch eine ,invariante‘ Meßmethode“ (ebd.: 141).
7.1.5.3.4 Intertheoretische Links
Mit Hilfe intertheoretischer Links (von Stegmüller 1987: 513 f. als „Bänder“ eingedeutscht) können laut Carlos Ulises Moulines Relationen zwischen Theorien oder
Modellen in Form von Beziehungen zwischen Strukturen hergestellt werden. Dabei
geht es nicht um „eine - wenn auch plausible - willkürliche eklektistische, sondern
eine schlüssig systematische Verknüpfung […]. Das Konzept der ,intertheoretischen
Links‘ liefert die Methode, um über Plausibilität hinaus, Argumente miteinander zu
verknüpfen“ (Bergmann 2001: 190).
Links können verstanden werden als „relations between models of different theories“
(Moulines/ Polanski 1996: 219); sie sind damit „zunächst Relationen zwischen zwei
Modellen“ (Bergmann 2001: 191). Ausgangspunkt einer solchen Beziehungsgründung sind etwa bestimmte Axiome oder formale Aussagen. Grundlage der Beobachtung solcher Relationen sind dann „atomare Relationen“, „intertheoretische Links“
oder „Links“ zwischen den elementaren Modellbausteinen (vgl. Moulines 1992: 405).
Im Grunde ließen sich solche Links zwischen einer Vielzahl an Modellen oder Theorien vorstellen; üblich sei jedoch die Dyade, d.h. Links zwischen genau zwei strukturverwandten Aussagensystemen. Ein einfaches Beispiel nach Stegmüller sind Bänder
zwischen partiellen Modellen einer Theorie und derjenigen Theorie, die eine Messung dieser Terme ermöglicht (vgl. Stegmüller 1987: 514).
259
Moulines differenziert genau zwei Typen an intertheoretischen Links, genauer
„entailment links“ und „determining links“ (vgl. Moulines 1992: 406). Entailment Links
verbinden Modelle oder Theorien auf eine generelle Art und Weise, ohne auf einzelne Konzepte Bezug nehmen zu müssen. Sie sind „somehow ,global‘, in the sense
that their general characterization need not contain any reference to particular concepts of the theories involved - though, of course, they have to appear in the formulation of the statements fixing a particular entailment link in a particular case” (ebd.).
Voraussetzung für Entailment Links ist, dass das vermeintlich stärkere Element eines
Modells M1 das äquivalente Element des Modells M2 gleichsam impliziert.
Determining Links hingegen verknüpfen einzelne Konzepte oder Terme; sie sind
„term-to-term-connections“ (Moulines/ Polanski 1996: 223). Liegt ein solcher Link vor,
bedeutet das, dass der Gehalt eines theoretischen Terms vollständig durch den anderen (den verlinkten) Term bestimmt wird. Sie unterscheiden sich folgendermaßen:
“entailment links connect laws while determining links connect terms of different theories” (Moulines 1992: 407). Moulines weist darauf hin, dass beide Links voneinander
unabhängig seien, v.a. dass Entailment Links eben nicht Determinig Links
voraussetzen: „Now, if we take only the general definitions propounded here, this is
obviously not the case, since in the general definition of an entailment link there is no
reference whatsoever to particular terms of one or the other theory, and conversely,
in the general definition of determinig links there is no reference whatsoever to the
fundamental laws of both theories” (ebd.: 409).
Eine differenzierte Variante des Links-Konzeptes haben Wolfgang Balzer und Joseph
D. Sneed (1983) vorgestellt, wobei deren Relationstypen sich den oben vorgestellten
Typen der Entailment- und Determining-Links unterordnen lassen:
Balzer und Sneed nennen zunächst die Theoretisierung, die durch Hinzufügen neuer Komponenten aus einer Theorie T eine Theorie T‘ generiert. Z.B.
können potentielle Modelle als Theoretisierung der partiellen potentiellen Modelle verstanden werden.
Zweitens verweisen sie auf Spezialisierungsrelationen, wobei spezielle Gesetze oder Constraints das vorliegende Konstrukt spezialisieren bzw. einschränken. So ließe sich etwa der empirische Anwendungsbereich einer Theorie oder die analytische Reichweite eines Modells durch Spezialisierung reduzieren.
260
Drittens gehören Reduktionsrelationen dazu, wobei schwache von starken
Reduktionen unterschieden werden. Die schwachen Reduktionen beziehen
sich lediglich auf empirische Anwendungen einer Theorie, wobei gilt: „Jede
Anwendung der reduzierten Theorie entspricht mindestens einer Anwendung
der reduzierenden Theorie und alles, was die reduzierte Theorie über eine gegebene Anwendung sagt, ist enthalten in dem, was die reduzierende Theorie
über jede entsprechende Anwendung sagt“ (ebd.: 127). Eine starke Reduktion
hingegen umfasst auch die Modelle, genauer die theoretischen Grundbegriffe
(Mp) und nicht nur die partiellen potentiellen Modelle Mpp.
Viertens und letztens stellen sie Äquivalenzrelationen dar, die dann vorliegen, wenn etwa eine Theorie T‘ auf T und umgekehrt stark (s.o.) reduzierbar
ist (vgl. ebd.: 129). Deutlicher wird diese Relation unter der Annahme, dass
die Relationsverknüpfung in beide Richtungen gleich sein muss: „In diesem
Fall haben wir eine ein-eindeutige [sic!] Übersetzung der nicht-theoretischen
Strukturen derart, daß eine Anwendung x eines Theorie-Elements T von T‘
,erklärt‘ wird genau dann wenn ihre Übersetzung x‘ von T‘ erklärt wird. Diese
Bedingung kann noch verstärkt werden durch die Forderung, daß die Übersetzung zunächst auf dem theoretischen Niveau arbeitet und von dort eine Übersetzung auf nicht-theoretischem Niveau induziert“ (ebd.). Eine schwache
Äquivalenz schließt damit die analytischen Begriffe ein, eine starke Äquivalenz
hingegen liegt dann vor, wenn sie auch die Anwendungen umfasst. Äquivalenz- und Reduktionsrelationen entsprechen somit Moulines‘ Entailment-Links.
Nun lassen sich nicht nur vereinzelte Ein-Link-Verknüpfungen vorstellen, sondern
auch weitläufigere Kombinationen. Das Ergebnis einer solchen Kopplung ist nach
Balzer und Sneed ein „Theorien-Netz“. Solche komplexen Arrangements „zeichnen
sich dadurch aus, dass sie nicht nur aus einem Theorieelement (Theoriekern plus die
Menge der intendierten Anwendungen) bestehen, sondern ein Aggregat verschiedener Theorieelemente bilden“ (Bergmann 2001: 192). Sie sind dann „via Spezialisierungsrelation zwischen einem Basis-Theorie-Element und anderen Theorieelementen als hierarchisch-netzartig (Theoriebaum) rekonstruierbar“ (ebd.). Das BasisTheorie-Element bietet also die allgemeine Grundlage einer Theorie oder auch das
„Fundamentalgesetz“ (wobei hier „Gesetz“ nicht ausschließlich als Kausalzusammenhang verstanden wird, vgl. Westermann 1987: 36), alle anderen Theorieelemente sind dann spezialisierte Anwendungen. Sie grenzen quasi die Möglichkeiten des
261
Basis-Theorie-Elements in empirischer Hinsicht ein. Reduziert wird dann das BasisElement als derjenige „Gegenstand, der ursprünglich ,Theorie‘ hieß, auf eines der
vielen Theorieelemente, nämlich auf das anfängliche Theorienelement […]. Nur seine
Stellung ,an der Spitze des Netzes‘ erinnert noch an seine ausgezeichnete Rolle“
(Stegmüller 1980: 144). Theorie-Elemente sind „die kleinsten Bausteine, die man
noch zur Aufstellung empirischer Behauptungen benutzen kann“ (Balzer/ Sneed
1983: 118). Allerdings weist der wissenschaftstheoretische Strukturalismus keine
Methode aus, mit der Fundamentalgesetze identifiziert werden können; sie werden
pragmatisch festgelegt bzw. postuliert (vgl. Westermann 1987: 37).
7.1.6 Skizze des Theorientransfers
Basistheorieelement ist die Autopoiesetheorie Maturanas und Varelas. Als ein Modell
dieser Theorie kann deren sozial- und steuerungstheoretische Interpretation gelten.
Es wird dann zu zeigen sein, dass das in dieser Arbeit entwickelnde Steuerungsmodell, das u.a. auf dem Ansatz kreativer Netzwerke basiert, ebenfalls ein Modell dieser
Theorie (also des Autopoiesemodells) ist und ggf. bestimmter Theorienrelationen
bedarf. Beide Modelle - die sozialtheoretische Interpretation der Autopoiesetheorie
nebst steuerungstheoretischer Ableitungen und das auf dem Ansatz kreativer Netzwerke basierende Steuerungsmodell - werden damit zu Theorieelementen eines
autopoietisch fundierten Theoriennetzes.
Schon 1984 wies Michael Schenk generell darauf hin, „daß das Netzwerkkonzept […]
auch in den verschiedenen Systemtheorien enthalten ist, setzen diese doch als systembildende Eigenschaft die Relationen zwischen bestimmten Einheiten voraus. Soziale Systeme stellen Relationsgebilde bzw. Netzwerke dar, deren Struktur ganz wesentlich durch die Konfiguration bzw. die formalen Eigenschaften der Relationen verkörpert wird“ (Schenk 1984: 111). Stefan Schweizer hat hervorgehoben, dass es generell mit Hilfe intertheoretische Links oder Bänder möglich sei, Selbstorganisationsmit Netzwerktheorien zu verbinden: „Wäre nun nachweislich die Grundstruktur […]
gleich, so ließe sich das Theoriennetz als hierarchischer Theorienbaum rekonstruieren, wobei die Spezialisierungsrelation zwischen dem Basis-Theorie-Element und
anderen Theorieelementen vorliegen muss. Sowohl bei den Selbstorganisations- als
auch den Netzwerkparadigmen ist von einer großen Reife derselben auszugehen, so
dass das Konstrukt des Theoriennetzes also anwendbar wäre“ (Schweizer 2003: 83).
Die Folge einer solchen Kombination wäre „sowohl erhöhter Erklärungsgehalt als
262
auch nicht zuletzt daraus resultierender Innovationsgehalt“ (ebd.: 84). Die Kombination von remodifizierter sozialwissenschaftlicher Autopoiesetheorie und dem Ansatz
kreativer Netzwerke setzt somit voraus, dass beide Konstrukte vergleichbare und
verlinkbare Argumente und Argumentstrukturen aufweisen. Bezüglich der Verlinkung
von Autopoiesetheorie und Netzwerkansatz soll hier auf die Vorarbeiten von Stefan
Schweizer verwiesen werden (vgl. Schweizer 2003, Schweizer/ Schweizer 2009,
Schweizer/ Schweizer 2011). Allerdings muss zeitgleich darauf hingewiesen werden,
dass Schweizer soziale Systeme als autopoietische und eben nicht - wie in dieser
Arbeit - als autonome Systeme versteht.
Abbildung 16: Skizze des Modelltransfers
Ein skizzenhafter Ausblick: Betrachtet man zunächst die modelltheoretische Grundstruktur von Netzwerkansätzen und Autopoiesetheorie, so fällt auf, dass beide sowohl die Mikro- als auch die Makroebene in ihrem Theoriengerüst berücksichtigen.
Während in den Netzwerkansätzen Knoten (häufig) als Individuen, Kanten als deren
Beziehungen untereinander und ein daraus resultierendes Interaktionsgefüge im
Blickpunkt stehen, so rückt die sozialtheoretisch interpretierte Autopoiesetheorie Einheiten zweiter Ordnung bzw. Individuen als autopoietische Systeme und deren Be263
ziehungen, die via struktureller Kopplung entstehen und auf diesem Wege neue
Phänomenbereiche bzw. Sozialsysteme zeitigen, in den Untersuchungsfokus (vgl.
Schweizer/ Schweizer 2011: 70 ff.). Beiden Ansätzen zentral ist somit die gegenseitige Bedingung von Akteur und Struktur: „1. Die Netzwerkakteure benötigen auch Medien zur Existenz. Ohne Medien (als andere menschliche autopoietische Systeme)
wäre die Existenz von Netzwerken nicht vorstellbar. 2. Die strukturellen Kopplungen
ihrerseits [zwischen den Akteuren, der Verf.] sind nachgerade die Existenzvoraussetzung und -bedingung von Netzwerken. 3. Die Herausbildung konsensueller Bereiche
könnte im Netzwerkparadigma als zunehmende Netzwerkinstitutionalisierung bzw. verfestigung betrachtet werden“ (ebd.: 73). Als zentrale Gemeinsamkeiten nennt
Schweizer zu Recht die folgenden: „Kompatible Verknüpfung von Makro- und Mikroebene, […] Umweltabhängigkeit, Einwirkungspotentiale auf die Umwelt, interaktive
und gestaltbare Beziehungsmuster, Interaktionsroutinen“ (ebd.: 74).
Abschließend können Kriterien für einen Theorientransfer im Rahmen des wissenschaftstheoretischen Strukturalismus angegeben werden:
1. Zunächst einmal muss sich das Basistheorieelement auf einer hohen Abstraktionsebene befinden, um eine generelle Anschlussfähigkeit zu gewährleisten.
2. Der Transfer darf keine Analogisierung sein, sondern muss entlang einer wissenschaftstheoretischen Methode (in diesem Falle „intertheoretische Links“)
erfolgen.
3. Sowohl das naturwissenschaftliche als auch das sozialwissenschaftliche Modell müssen beide eine vergleichbaren metatheoretischen Hintergrund
aufweisen (vgl. Fischer 2009: 52 f.). Dies wird im vorliegenden Fall v.a. durch
die empirisch-analytische Wissenschaftstheorie verbürgt.
4. Weiterhin müssen das Basistheorieelement und die vermeintlich kompatiblen
Modelle bzw. Theorieelemente gleichwertige Argumentationsmuster aufweisen. Hierbei handelt es sich um den Schwerpunkt des Transfers: Was sind
Modelle, potentielle Modelle oder partielle potentielle Modelle des Autopoiesemodells und inwiefern lassen sich diese Argumentationsmuster im anvisierten Steuerungsmodell wiederfinden bzw. mit welchen Links verknüpfen?
5. In diesen Rahmen gehört auch die Forderung nach Beibehaltung bzw. Kompatibilität der logischen Konsistenz.
264
6. Darüber hinaus muss die Verbindung von Theorien aus unterschiedlichen Disziplinen inhaltlich nachvollziehbar bzw. plausibel sein. So macht es kaum
Sinn, das Verhalten von Menschen auf Newtons Bewegungsgesetze zurückzuführen. Für diese Arbeit gilt, dass das sozialwissenschaftliche Modell steuerungstheoretische Überlegungen zumindest in Ansätzen aus der naturwissenschaftlichen Vorlage beziehen muss.
7.2 Erklärungsebenen
Abschließend gilt es, ein paar Gedanken zur sozialwissenschaftlichen Problematik
der Erklärungsebenen anzustellen. Es kann grob zwischen einer Makro- und einer
Mikroebene unterschieden werden, wobei Makrogrößen z.B. Staatsmodelle oder Organisationen, Mikrovariablen hingegen Individuen sein können. Moderne sozialwissenschaftliche Standards erfordern nun für Erklärungen sozialer Phänomene eine
Berücksichtigung beider Ebenen. Solche Erklärungsschemata fundieren neben gängigen wissenschaftstheoretischen Kriterien wie Präzision, Logik oder Intersubjektivität sozialwissenschaftliche Erklärungsversuche, denn „sozialtheoretische Argumentmuster untermauern die Geltung theoretischer Aussagen über einen Gegenstandsbereich“ (Bergmann 2001: 54).
In den Sozialwissenschaften gibt es langjährige eine Debatte darüber, ob Erklärungen sozialer Phänomene durch die Berücksichtigung individuellen Handelns, kausaler Abfolgen von Makroereignissen oder durch eine Verbindung dieser beiden Ebenen erfolgen müssen. Es geht damit um eine metatheoretische Fragestellung, die so
neu nicht ist: „In the social sciences a small number of never-ending debates involve
fundamental issues. One of the most intense and most long-standing of these debates is that between methodological individualists and methodological holists”
(Udehn 2002: 479).
Viktor Vanberg meint, die Sozialwissenschaften seien lange Zeit durch geradezu
dogmatische Definitionen ihres Gegenstandes davon abgehalten worden, über Erklärungsgerüste zu reflektieren: „Die Formulierung und Rezeption erklärungskräftiger
Theorien wurde in der Soziologie ganz wesentlich durch die weite Verbreitung eines
Soziologieverständnisses behindert, nach dem die Soziologie dadurch ihre Identität
als wissenschaftliche Disziplin zu finden und zu sichern hat, daß sie sich strikt gegen
jede ,individualistisch-reduktionistische‘ Interpretation sozialer Phänomene abgrenzt
und dem ,eigenständigen‘ Charakter ihres Gegenstandsbereichs durch die Formulie265
rung einer ,eigenständigen‘ eben ,nicht-individualistischen‘ [sondern kollektivistischen, der Verf.] Theorie Ausdruck gibt“ (Vanberg 1975: 2). Folge dieser Dogmatik
sei ein Nebenher und eben kein Miteinander von soziologischer Theorie und empirischer Feldforschung gewesen.
Im Folgenden sollen in der hier gebotenen Kürze mögliche Erklärungsebenen bzw. schemas vorgestellt werden. Vorstellbar sind somit Erklärungen, die sich ausschließlich auf der Mikro- oder der Makroebene bewegen, oder Schemata, die eine Verknüpfung dieser beiden Ebenen anvisieren. „Makro“ und „Mikro“ werden zur Charakterisierung von Ebenen häufig mehrdeutig verwendet, d.h. gerade nicht, „dass in allen sozialtheoretischen Annahmen die Ebenen begrifflich gleich besetzt sind. Uneinheitlich bleibt, was mit oben und unten gemeint ist, welche Konsequenzen für die
Theoriebildung daraus folgen und welchen Bezug diese theoretische Konstruktion
zur Realität hat. Je nach Ansatz findet sich als unterste Analyseebene etwa der Akteur, die einzelne Handlung oder aber die Interaktion. Auf der Makroebene kann man
z.B. auf die Konstrukte der Struktur oder Aggregationen von Handlungen,
unintendierten Handlungsfolgen oder Individuen treffen“ (Bergmann 2001: 55 f.). Eine ausführliche Diskussion solcher Erklärungsmuster hat etwa André Bergmann
(Bergmann 2001) vorgelegt, der damit an die von Viktor Vanberg vorgelegte Auseinandersetzung von 1975 anschließt; jüngeren Datums ist ein Aufsatz von Lars
Udehn (Udehn 2002).
7.2.1 Individualistisches Erklärungsschema
Zunächst einmal sind Erklärungen für die Entstehung und den Wandel sozialer Phänomene denkbar, die ausschließlich auf der Mikroebene angesiedelt sind. Solche
Erklärungsmuster werden auch als „reduktionistisch“ oder „individualistisch“ bezeichnet, in den Sozialwissenschaften firmieren sie meist unter den Sammelbegriffen
„Handlungs-„ oder „Verhaltenstheorien“. Grundlage der individualistischen Erklärungsschema sind nach Vanberg zwei Prinzipien, nämlich „zum einen der Gedanke,
daß ein aus allgemein menschlichen Verhaltensgesetzmäßigkeiten erwachsendes
Prinzip der Reziprozität (der Gegenseitigkeit, des Austauschs) Strukturierungsprinzip
sozialer Interaktion und Grundlage sozialen Zusammenhalts ist. Und […] zum zweiten der Gedanke, daß die individuellen Aktivitäten ob ihrer vielfältigen sozialen Verflechtungen immer auch Resultate zeitigen, die zwar keinen anderen Ursprung als
eben diese individuellen Aktivitäten haben, aber doch von keinem der Beteiligten in266
tendiert wurden, und daß gerade die Entstehung und der Wandel sozialer Institutionen weitgehend als Niederschlag solch unintendierter Konsequenzen einer Unzahl
individueller Aktivitäten gesehen werden müssen“ (Vanberg 1975: 30). Die grundlegende Stoßrichtung besagt, „daß alle Aussagen über große Kollektive, also Gruppen,
Gesellschaften, auf Aussagen über die in diesen Kollektiven Handelnden oder deren
Handlungen zurückzuführen, zu reduzieren (daher: Reduktionismus) seien. Dieser
psycho-soziologische, elementaristische Ansatz bestreitet die Möglichkeit, individuelles Handeln, individuelle Motive aus ,makrosoziologischen‘ Gesetzen ableiten zu
können“ (Reimann 1975: 76). Dieses Vorgehen findet sich allgemein in vielen Disziplinen wie etwa der Politikwissenschaft, der Soziologie, der Psychologie oder anderen
Verhaltenswissenschaften (vgl. Lenk 1977b: 157).
Das Individuum wird somit zum Ausgangspunkt jeder Erklärung sozialer Phänomene
bestimmt: „Makrophänomene sind auf der Basis agierender Individuen rekonstruierbar. Aussagen über Gruppen, Organisationen, Institutionen oder andere Kollektive
lassen sich auf die Eigenschaften von den darin agierenden Individuen reduzieren.
Mit Eigenschaften sind Dispositionen, Haltungen, Interessen und Verhaltensweisen
gemeint“ (Bergmann 2001: 60 f.). Reduktion meint nun in diesem Falle, dass man zur
Erklärung von Makrophänomenen Theorien, Modelle oder Hypothesen anwendet, die
eigentlich für die Individualebene geschaffen wurden. Es handelt sich demnach laut
Bergmann um eine Theorienreduktion: „Die Beziehung zwischen einfachen und
komplexen sozialen Erscheinungsformen tritt als Reduktion von komplexen Einheiten
auf. Die komplexere Ebene entwickelt sich aus dem Verhalten der Grundelemente.
[…] Theorien, die einen Makrophänomenbereich erreichen sollen, sind stets mit dem
Problem konfrontiert, nicht-psychologische Aussagen auf psychologische Aussagen
zu reduzieren“ (Bergmann 2001: 61). Laut Hans Lenk macht die Anwendung solcher
individualistischer Gesetze immer dann Sinn, wenn den Akteuren alternative Handlungsweisen offenstanden: „Jedes soziale Ereignis oder jede soziale Regularität ist
ableitbar aus vermeidbaren Dispositionen individueller Akteure“ (Lenk 1977a: 36). Es
geht dann darum, „daß ein vermeintlich unreduzierbares soziologisches oder historisches Gesetz, das eine unvermeidliche […] Verbindung zwischen zwei Sozialphänomenen behauptet, im Kontext derart untersucht und ergänzt wird, daß von dem
Ausgangssozialphänomen betroffenen Individuen nachweislich Alternativen offenstehen bzw. offengestanden hätten - außer jener, die für das zweite Sozialphänomen
charakteristischen Dispositionen zu entwickeln“ (ebd.: 37).
267
Fraglich bleibt jedoch, was damit überhaupt erklärt wird bzw. ob die Entstehung von
Makrophänomenen tatsächlich mit Aussagen auf der Mikroebene allein erklärt werden können. In den Worten Bergmanns: „Somit landet man bei der Frage auf welche
Warumfragen und Problemstellungen Reduktionen auf psychologische Aussagen
antworten“
(Bergmann
2001:
62).
Hier
wird
demnach
eine
unzulässige
Ebenenvermischung vorgenommen. Bergmann weist zudem darauf hin, dass die
Vertreter dieses Ansatzes meinen, man könne in eine Erklärung nicht sämtliche
Randbedingungen auf der Makroebene aufgrund überbordender Komplexität und
damit den gesamten sozialen Kontext einbeziehen. Aus diesem Grund müsse auf
sparsamere Verhaltenstheorien zurückgegriffen werden. Zugleich meint er jedoch,
dass diese Unkenntnis gerade über geeignete Theorien oder Modelle in den Griff zu
bekommen sei, und zwar weil Wirklichkeit in jeder Theorie immer nur ausschnitthaft
betrachtet werden könne (vgl. ebd.: 63). Letztlich „ist es Vertretern dieser Richtung
jedoch nicht gelungen, nachzuweisen, daß man in der Sozialwissenschaft in jedem
Falle auf soziokulturelle Variablen und echte, d.h. nicht auf individualistische Verhaltensdispositionen und -regelmäßigkeiten zurückführbare, generelle soziologische
Gesetzmäßigkeiten verzichten könne“ (Lenk 1977b: 165).
7.2.2 Kollektivistisches Erklärungsschema
Das kollektivistische Erklärungsschema charakterisiert Bergmann mit dem Begriff der
„Makroemergenz“ (vgl. Bergmann 2001: 63). Geläufiger ist wohl der Begriff „methodologischer Kollektivismus“; dieser „behauptet, daß individuelles Verhalten aus makrosoziologischen Generalisierungen abgeleitet werden kann und daß andrerseits
Gruppenphänomene nicht aus dem Verhalten der Mitglieder erklärt werden können“
(Reimann 1975: 76). Vertreter dieses Erklärungsschemas leiten soziale Phänomene
aus den Relationen (und eben nicht aus den Eigenschaften) der Individuen ab.
Bergmann meint nun, im Prinzip könne für dieses Vorgehen die gleiche Kritik angebracht werden wie etwa für die verhaltenstheoretische Vorgehensweise: Letztlich
handle es sich um Individualdaten und eben um keine Erklärung von Makrophänomenen: „Sofern die Aussagen Kollektiveigenschaften meinen, die beispielsweise
Durchschnitts-, Streuungs- oder Summenwerte wiedergeben, lautet die Kritik, dass
es sich bei diesen Werten jeweils um eine Klasse logischer oder statistischer Konstrukte handelt, die eine mathematische Funktion von individuellen Daten darstellen.
268
Deshalb liegen nur logische Konstrukte aus Individualdaten vor, die keinen höheren
Informationsgehalt aufweisen können“ (Bergmann 2001: 65).
Als Beispiel für eine implizite Makro-Makro-Erklärung, die jedoch als Makro-MikroMakro-Erklärung ausgewiesen wird, nennt James S. Coleman Max Webers Protestantismus-Kapitalismus-These. Tatsächlich habe er seine vermeintlichen Beweise
nicht auf der Individualebene gesammelt; dies sei bei einem historischen Rückblick
auch kaum möglich. Desweiteren kritisiert Coleman Webers Behauptung, wirtschaftliche Werte würden einem religiösen Wertesystem entspringen bzw. dieses kausal
erklären (vgl. Coleman 1995: 8 f.). Von kausalen Zusammenhängen und damit einer
wissenschaftlichen Erklärung kann jedoch keine Rede sein. Letztlich handelt es sich
nur um die Postulierung kausaler Wirkzusammenhänge, die im Prinzip nur eine Aneinanderreihung zeitlicher Abfolgen von Makrophänomenen darstellen.
Ein Beispiel für eine Erklärungsmethoden, die sich rein auf der Makroebene bewegt,
liefert Renate Mayntz mit der kausalen Rekonstruktion. Laut Mayntz geht es hier darum, „ein Makrophänomen durch Identifikation der für sein Zustandekommen verantwortlichen Prozesse und Wechselwirkungen zu erklären“ (Mayntz 2005: 84). Zentral
seien nicht statistische Zusammenhänge zwischen wenigen einfachen Variablen,
sondern durchaus komplexere Einheiten wie Akteurskonstellationen und Institutionen, deren Relationen und die qualitativ-diskursive Form der Untersuchung. Problematisch sei an solchen Untersuchungen stets das „Small-N-Problem“, also die Tatsache, dass nur wenige Untersuchungseinheiten auf der Makroebene in einem bestimmten Fall zur Verfügung stünden. Gewählt würde deshalb „die Strategie der empirischen Identifikation von Kausalzusammenhängen auf der Basis einer möglichst
breiten Erfassung der an der ,Bewirkung einer Wirkung‘ beteiligten situativen Gegebenheiten und Handlungen korporativer und kollektiver Akteure (ebd.: 85).
Mayntz differenziert Makrophänomene zunächst analytisch in vier Dimensionen aus.
Sie seien demnach kontingent, prozesshaft, historisch geformt und von der Komplexität sozialer Systeme geprägt (vgl. ebd.: 88). Viele Untersuchungen würden nur eine
der vier Dimensionen in den Blickpunkt rücken, etwa der historische Institutionalismus die Historizität. Komplexe Untersuchungen müssten jedoch idealerweise Fragen
in allen vier Dimensionen stellen. „Kontingent“ heißt, dass soziale Phänomene i.d.R.
multikausal sind. Sie basieren auf äußerst komplexen und offenen (im Sinne von
„ungewissen“) Zusammenhängen. „Prozesshaft“ bezieht sich auf den Umstand, dass
z.B. das Zustandekommen eines Gesetzes im Verlauf durch die Beteiligung hetero269
gener Akteure bewirkt wird. Mayntz wendet sich an dieser Stelle gegen schlichte statistische Zusammenhänge zwischen Merkmalen von Variablen. Können solche Prozesse verallgemeinert werden, dann sei von einem „Mechanismus“ zu sprechen (vgl.
ebd.: 89 f.). Historizität dagegen meint, dass vergangene Ereignisse durchaus soziale Phänomene prägen. Dieser Umstand würde bei der Erklärung individuellen Handelns oder auf einer Aggregation individueller Handlungen basierender Erklärungen
meist nicht berücksichtigt. In der Sozialwissenschaft firmiert dieses Vorgehen unter
dem Label „Pfadabhängigkeit“ (vgl. ebd.: 90). „Strukturelle Komplexität“ bezieht sich
auf die Mehrebenenarchitektur und funktionale Ausdifferenzierung in Subsysteme. In
den Blickpunkt rücken hier Effekte, die durch eine wie auch immer geartete Verknüpfung der Ebenen oder durch systemische Interdependenzen herbeigeführt werden
(vgl. ebd.: 92).
Renate Mayntz liefert mit der kausalen Rekonstruktion allenfalls eine Heuristik, die
bei der Suche nach relevanten Erklärungsvariablen Hinweise auf die Art der Variablen bieten kann, oder ein Erklärungsschema, dass eine Indienstnahme erklärender
Teilmodelle oder Theorien je nach gewählter Untersuchungsdimension beanspruchen muss. Nicht zuletzt scheint eine Berücksichtigung aller Variablen in einem
Untersuchungsverlauf gemäß den vier Dimensionen der kausalen Rekonstruktion
schier unmöglich. Von daher verweist Renate Mayntz zurecht darauf, dass dies in
der Sozialwissenschaft nicht geschehe und stattdessen pragmatisch auf einzelne
Dimensionen schwerpunktmäßig gesetzt werde (vgl. ebd.: 94).
7.2.3 Zwischenfazit
Zu Recht zieht Bergmann das prägnante Fazit: „Den sozialtheoretischen Argumentmuster der ,reduktionistischen Ebenenkomposition‘ und der ,Makro-Emergenz‘ gelingt es nicht, theoretische Konstrukte verschiedener Gegenstandsbereiche zu vereinen“ (Bergmann 2001: 65 f.). Es muss somit gelingen, die Makro- mit der Mikroebene
für Erklärungsschemata in einer geeigneten Weise zu versöhnen, und zwar dergestalt, dass erstens aufeinanderfolgende Makrophänomene und damit besondere
Randbedingungen zwar berücksichtigt, nicht jedoch als alleinige Randbedingungen
betrachtet werden und dass zweitens nicht lediglich individuelles Verhalten bzw.
Handeln durch individualistische Gesetze erklärt wird, sondern das „Soziale“ als der
besondere Untersuchungsgegenstand der Sozialwissenschaften nicht aus den Augen verloren wird. Deshalb ist es wohl auch verkehrt zu meinen, „daß die künstliche
270
Einschränkung der Untersuchungsansätze auf einen der genannten Typen sich
gleichsam mit der Notwendigkeit aus dem Untersuchungs- oder Gegenstandsbereich
ergibt, noch, daß die zwischen beiden Ansatztypen bestehende methodologische
Komplementarität sich unvermeidlicherweise als ein Ausschließungsverhältnis darstellen müsse, d.h. daß die Analyse eines sozialen Phänomens oder Problembereichs unter dem Handlungsaspekt notwendig den Strukturaspekt völlig vernachlässigen, ignorieren, ja, ausschließen müsse - und umgekehrt“ (Lenk 1977b: 159). Von
daher gelte es zu berücksichtigen, dass es auch Varianten gebe, die beide Ebenen
in gewissem Maße vermengen: „The main divide is between strong versions of
methodological individualism, which suggest that all social phenomena should be
explained only in terms of individuals and their interaction, and weak versions of
methodological individualism, which also assign an important role to social institutions and/or social structure in social science explanations“ (Udehn 2002: 479). Vanberg weist in diesem Rahmen darauf hin, dass es darauf ankomme zu zeigen, wie
Hypothesen der einen Ebene für die andere verwendet werden könnten (vgl. Vanberg 1975: 260). Insgesamt geht es somit um die Frage: „Wie können also Handlungsaspekt und Strukturaspekt in einer einheitlichen Theorie - also theorieintern und
möglichst nahtlos - so ineinander und miteinander verflochten werden, daß nicht wieder eine einseitige Verzerrung, aber auch nicht ein bloßes, Aneinanderklatschen‘ der
beiden Theorieaspekte entsteht?“ (Lenk 1977b: 161).
7.2.4 Makro-Mikro-Makro-Erklärungsschema
Das Destillat des vorhergehenden Exkurses lautet, dass die Erklärung sozialwissenschaftlicher Phänomene und damit auch von Steuerungsereignissen eine komplexere Erklärungsstruktur erfordert, als dies von individualistischen und kollektivistischen
Vertretern geboten wird, denn „Ebeneninterdependenzen lassen sich […] nicht als
lineare Beziehung darstellen“ (Bergmann 2001: 69). Es geht somit um einen „Aussagenzusammenhang, der über erklärende Relevanz in Form von Theoriearchitektur
informiert, ebenenspezifische Teilmodelle integriert und Gesetzmäßigkeiten in Form
von Aussagen auf und zwischen Ebenen anführen lässt“ (ebd.: 68). Bergmann weist
zwar
darauf
hin,
dass
nicht
jede
sozialwissenschaftliche
Erklärung
eine
Ebenenverschränkung erfordert (vgl. ebd.), aber wie noch zu zeigen sein wird, legt
dies die Autopoiesetheorie nahe.
271
Als ein geeignetes und modernen wissenschaftstheoretischen Ansprüchen genügendes Erklärungsschema gilt das Makro-Mikro-Makro-Erklärungsschema James S.
Colemans, auch als Coleman’sche Badewanne bezeichnet. Mit diesem Ansatz sollte
es gelingen, „dass Steuerungsereignisse auf verschiedene Weise mit unterschiedlichen Kombinationen von Teiltheorien erklärbar wären“ (ebd.: 112). Vorab muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass James S. Coleman als Wissenschaftstheoretiker und nicht als Sozialtheoretiker in Dienst genommen wird. In dieser Arbeit soll ja
eine eigenständige Sozial- nebst Steuerungstheorie entwickelt werden. Coleman wird
lediglich das grundlegende Erklärungsschema liefern, welches später von Hartmut
Esser ergänzt worden ist.
Laut Coleman besteht das zentrale „Problem der Sozialwissenschaft […] darin, zu
erklären, wie ein soziales System funktioniert. […] In der Tat ist der natürliche Beobachtungsgegenstand das Individuum. […] Die Sozialtheorie behandelt weiterhin das
Funktionieren sozialer Verhaltenssysteme, die empirische Forschung hingegen befaßt sich oft mit dem Erklären individuellen Verhaltens“ (Coleman 1995: 1); zumindest zu Colemans Zeiten stellten die Mikro- und die Makroebene in den Sozialwissenschaften zwei vollkommen disjunkte Sphären dar. Dies sei jedoch problematisch,
da „die Konzentration auf die Erklärung individuellen Verhaltens […] oft von den zentralen Fragen der Sozialtheorie fortführt, welche ja das Funktionieren sozialer Systeme betreffen“ (ebd.: 2). Nach Coleman seien etwa Parsons‘ Systemtheorie und Webers Kapitalismus-Protestantismus-These prominente Beispiele für Makroerklärungen (vgl. Coleman 2000: 57 ff.), während z.B. die Umfrageforschung und die damit
einhergehende Entwicklung von Handlungstheorien sich alleine der Mikroebene verschrieben hätten, wodurch jedoch systemische Zusammenhänge aus dem Blickwinkel geraten wären (vgl. ebd.: 60).
Coleman stellt unmissverständlich klar: „Die Hauptaufgabe der Sozialwissenschaft
liegt in der Erklärung sozialer Phänomene, nicht in der Erklärung von Verhaltensweisen einzelner Personen“ (Coleman 1995: 2). Motivation für diese Rückbesinnung war
erstens das Entstehen größerer Bezugsgruppen - weg von der Gemeinde hin zu
Städten oder gar der Nation -, und zweitens Forderungen kollektiver Akteure an die
Sozialwissenschaften, für politische Problemlösungsstrategien empirisch verwertbare
Forschungsarbeit zu leisten. Im Kern geht es um das sogenannte Mikro-MakroProblem, also um die Frage, wie individuelles Handeln soziale Phänomene erzeugt
und umgekehrt, d.h. es „geht um den Prozeß, […] durch den Unzufriedenheit in Re272
volution umschlägt; gleichzeitig auftretende Furcht bei den Mitgliedern einer Menge
zur Massenpanik führt; durch den Präferenzen, die Verfügung über private Güter und
Tauschmöglichkeiten zusammen Marktpreise und eine Umverteilung von Gütern erzeugen; durch den aus individuellen Leistungen innerhalb von Organisationen ein
gesellschaftliches Produkt entsteht“ (Coleman 2000: 68).
Deswegen führt er den Begriff des „Ziels“ bzw. des „Zwecks“ wieder ein, allerdings
nur auf der Mikroebene. Dies bedeutet, „Ziele gleichzeitig anzuerkennen und abzulehnen. Man weist sie auf der Ebene des Systems zurück, nicht jedoch auf der Ebene ihrer Bestandteile, der Akteure. Insoweit stellt eine Handlungstheorie als Grundlage von Sozialtheorie in der Tat eine funktionale Theorie auf der Ebene der Akteure
dar: Der Akteur wird als zielgerichtet Handelnder begriffen, Handlungen werden
durch ihre (antizipierten) Konsequenzen verursacht. […] Systeme bestehen aus Akteuren, und ihr Handeln oder Verhalten ist die emergente Folge der interdependenten Handlungen derjenigen Akteure, die das System konstituieren (ebd.: 58)“. Die
zentrale Frage einer Sozialtheorie muss daher lauten: „Wie verknüpfen sich die
zweckgerichteten Handlungen der Akteure zu Systemverhalten, und wie werden diese umgekehrt von den aus dem Systemverhalten resultierenden Zwängen geformt?“
(ebd.: 58 f.).
Er fordert von daher, zur Erklärung systemischen Verhaltens immer dessen Bestandteile der nächstunteren Ebene in den Blickwinkel zu rücken; die Erklärung an sich
kann dabei von qualitativer oder quantitativer Natur sein. Es sei von viel größerer
Bedeutung, wie der Wechsel von der Mikro- auf die Makroebene fundiert würde,
denn es sei diese Beziehung, „die sich als die größte intellektuelle Hürde herausstellt, und dies sowohl für die empirische Forschung als auch für eine Theorie, die
Beziehungen auf der Makroebene über den Rückgriff auf das Konzept des methodologischen Individualismus behandelt“ (Coleman 2000: 70). In modelltheoretische
Sprache umformuliert heißt das: „Konsequenterweise gründen auf der Makroebene
zum einen die Randbedingungen zu einem Zeitpunkt t 1 und zum anderen konstituiert
sich auf dieser das zu erklärende Phänomen zu einem Zeitpunkt t 2. Die Mikroebene
bildet die Gesetzesaussagen über individualistisches Zusammenhänge ab“ (Bergmann 2001: 86).
Nimmt man Individuen als Erklärungsgrundlage, bieten sich dadurch gemäß Coleman mehrere Vorteile. Erstens wurden und werden in den Sozialwissenschaften die
meisten Daten eben über Individuen erhoben. Systemisches Verhalten lasse sich
273
kaum in Daten festhalten, da mit zunehmender Systemkomplexität kaum noch dauerhaft geltende Hypothesen geschweige denn logische Datenzusammenhänge erstellt werden können. Zweitens würden Eingriffe in das System - und dies interessiert
die Steuerungsdebatte besonders - nur durch die Beeinflussung der Elemente oder
der Prozesse gelingen; Ansatzpunkt ist also die Ebene unter der zu steuernden Ebene. Hat man die Ebene, die Steuerungseffekte ermöglicht, erst einmal erfasst, dann
könnten drittens auch sinnvolle Prognosen erstellt werden. Viertens biete sein Erklärungsschema keinen Grund, bestimmte Menschenbilder wie den homo sociologicus
a priori auszuschließen (vgl. Coleman 1995: 3 ff.).
Coleman weist darauf hin, dass sein Erklärungsschema nicht postuliert, Systemverhalten sei aggregiertes Sozialverhalten. Vielmehr bewegen sich Systeme auf einer
emergenten Ebene, die eine manchmal auch nicht intendierte oder unvorhergesehene Folge individuellen Verhaltens sei (vgl. ebd.: 6). Zentral sei also der Einbau der
Handlungsebene in makrolastige Erklärungen, „da nur sie eine Verknüpfung individueller Absichten mit makrosozialen Konsequenzen ermöglichte, so daß sowohl die
Funktionsweise von Gesellschaft als auch der Motor des sozialen Wandels auf die
zweckgerichteten individuellen Handlungen zurückgeführt werden konnten, die wiederum, in bestimmten institutionellen und strukturellen Settings eingebunden waren,
von denen spezifische Handlungsanreize ausgingen und dadurch das Handeln letztlich formten“ (Coleman 2000: 55). Oder in anderen Worten: „Der Gang der Analyse
macht es erforderlich, die gesellschaftliche Ganzheit in ihre Einzelheiten (Handelnde
bzw. Handlungen) zu zerlegen; andrerseits ist die Synthese notwendig, um Aussagen über gesamtgesellschaftliche Vorgänge zu formulieren“ (Reimann 1975: 74).
Exemplarisch nennt Coleman sechs verschiedene Möglichkeiten für den Übergang
von der Mikro- zur Makroebene. Erstens könne die Handlung eines einzelnen Akteurs den sozialen Kontext anderer Individuen beeinflussen. Coleman nennt hier als
Beispiel etwas sarkastisch das Legen eines Feuers im Theater. Zweitens könnte bilateraler Austausch etwa über Verträge Resultate für ein System erzeugen. Die dritte
Möglichkeit ist laut Coleman der Wettbewerb und Transaktionen, welche eine Marktsituation schaffen. Viertens nennt Coleman kollektiv-soziale Entscheidungen, wie
etwa Wahlergebnisse. Fünftens nennt Coleman Strukturen interdependenter Handlungen in Organisationen, die bestimmte Regelsysteme etc. hervorbringen. Als
sechste und letzte Möglichkeit sieht er das Erzeugen kollektiven Rechts durch Normen und Sanktionsmöglichkeiten (vgl. Coleman 1995: 25 f.).
274
Insgesamt ergibt sich damit folgendes Erklärungsschema:
Abbildung 17: Erklärungsschema in Anlehnung an Coleman
Nicht übersehen werden darf nun, dass es sich bei Colemans Idee um keine Erklärung, sondern lediglich um ein Erklärungsschema handelt. Um dieses Schema mit
„erklärendem“ Leben zu füllen, bedarf es weiterer Teilmodelle oder zumindest aussagen, die jeweils einen Bereich dieses Schemas näher erläutern. Es geht damit
um eine komplexe Theorienarchitektur: „Verfügt ein Mehrebenenmodell für jede einzelne Ebene über ein Teilmodell, so ist das Mehrebenenmodell in der Lage, mikround makrotheoretische Aussagen gegenstandsbezogener Teiltheorien miteinander
zu verknüpfen. Fehlt einer Mehrebenenmodellierung beispielsweise ein Mikromodell,
das die Relationen auf der untersten Ebene berücksichtigt, dann kann eine solche
Sozialtheorie Gesetzmäßigkeiten auf der Individualebene nicht integrieren“ (Bergmann 2001: 77).
Welche Bereiche nun Möglichkeiten für den Einbau von Teilmodellen bieten, besagen drei Logiken, genauer die Logik der Situation, die Logik der Selektion und die
Logik der Aggregation. Diese Logiken, die v.a. von Hartmut Esser ausgeführt wurden, sollen eine kausal angeleitete Verbindung zwischen den Ebenen herstellen. Wie
bereits gesagt, wird der kausale Zusammenhang zwischen einem Makrophänomen
zu einem Zeitpunkt t1 und einem weiteren Makrophänomen zu einem späteren Zeitpunkt t2 nur vermutet; eine Erklärung bedarf jedoch eines Umweges über die Mikroebene. Insgesamt geht es den Logiken um die Beantwortung dreier Fragen: „Wie
stellt sich die ,Situation‘ […] für die Akteure dar? Wie gehen die Akteure in der Situa275
tion mit diesen Vorgaben um? Welche - oft: nicht beabsichtigten - Folgen produzieren
die Akteure mit ihrem situationsorientierten Handeln?“ (Esser/ Troitzsch 1991: 16).
7.2.4.1 Logik der Situation
Die erste Logik versucht dem Umstand gerecht zu werden, dass Akteure immer vor
einem bestimmten situativen Hintergrund - ihrer „Welt“ - handeln. Dieser Hintergrund
kann sowohl aus gegebenen objektiven Umständen als auch aus subjektiv interpretierten Faktoren bestehen: „Menschliche Verhaltensdispositionen und Handlungsmuster können kulturell und sozial induziert sein. […] Allzu offensichtlich prägen Rollenbedingungen, Rollenzwänge, soziale Kontrollen, strukturelle Reziprozitäten der
Verhaltenserwartungen und anderer Strukturfaktoren in sozialen Systemen eher das
persönliche Verhalten (einschließlich persönlicher Präferenzen) - als umgekehrt. Institutionelle Regelungen lassen sich nicht immer und ausschließlich in psychologische Einzelneigungen bzw. individualistische Verhaltensdispositionen auflösen, zumal jeder in den Rahmen bereits vorgegebener gesellschaftlicher Gruppen, einer
Kultur und deren Institutionen hineingeboren oder hineinerzogen wird“ (Lenk 1977b:
166).
Dabei wird kein kausaler Zwangsmechanismus unterstellt, der das Handeln der Individuen determiniert. Vielmehr bedeutet das, „daß die ,Objekte‘ des Sozialwissenschaftlers selbst handlungsfähige ,Subjekte‘ sind, die mit ihrem Handeln einen subjektiven Sinn verbinden. […] Die Erklärungsmodelle der Soziologie dürfen also nicht
nur die Kategorien eines externen Beobachters enthalten, sondern müssen von den
subjektiven Erwartungen und Bewertungen der Akteure ausgehen“ (Esser 1993: 83).
In der Summe wird hier „eine Verbindung zwischen der Makro-Ebene der jeweiligen
speziellen sozialen Situation und der Mikro-Ebene der Akteure hergestellt. […] In der
Logik der Situation ist festgelegt, welche Bedingungen in der Situation gegeben sind
und welche Alternativen die Akteure haben. Die Logik der Situation verknüpft die Erwartungen und die Bewertungen des Akteurs mit den Alternativen und den Bedingungen in der Situation. Diese Verbindung zwischen sozialer Situation und Akteur
erfolgt bei der jeweiligen Erklärung über Beschreibungen, über die sog. Brückenhypothesen“ (ebd.: 94). Es geht hier somit um Orientierungs- oder Wahrnehmungsleistungen der zu betrachtenden Akteure und ihre jeweilige Situationsdefinition bzw. darum, mögliche Handlungsalternativen zu rekonstruieren (Kunz 1996: 26).
276
7.2.4.2 Logik der Selektion
Dieser Logik geht es nun um die Erklärung der individuellen Handlung bzw. der
Handlungswahl, d.h. um die Frage, warum ein Individuum im Rahmen seines Kontextes genau so gehandelt hat und nicht anders. Noch einmal Esser: „Die Logik der Selektion verbindet zwei Elemente auf der Mikro-Ebene: die Akteure und das soziale
Handeln. Es ist die Mikro-Mikro-Verbindung zwischen den Eigenschaften der Akteure
in der Situation und der Selektion einer bestimmten Alternative. Hierzu wird eine allgemeine Handlungstheorie benötigt, die es zuläßt, die wichtigen Merkmale der Situation aufzunehmen. Naheliegend ist daher eine Handlungstheorie, die in ihrem Ursachteil die durch die Situation geprägten Erwartungen und Bewertungen der Akteure und in dem Folgenteil die verschiedenen, ihnen zur Wahl stehenden, Alternativen
enthält“ (ebd.: 95). Diese Handlungstheorie ist der zentrale erklärende Bestandteil
des Makro-Mikro-Makro-Erklärungsschemas: „Im Erklärungskontext stellen handlungstheoretische Argumente den Basisteil einer komplexen Modellbildung“ (Bergmann 2001: 86).
Handlungstheorien müssen laut Esser erstens kausal strukturiert sein, d.h. eine
Wenn- und eine Dann-Komponente besitzen, zweitens allgemein gültig sein, drittens
zu den Erwartungen und Bewertungen der Akteure - also ihrer Logik der Situation
passen und viertens berücksichtigen, dass es sich bei sozialen Prozessen immer um
subjektiv interpretierte Prozesse handelt, die von individuellem Wissen und individuellen Werten abhängen (vgl. Esser 1993: 95).
7.2.4.3 Logik der Aggregation
Um nun von der Mikro- auf die Makroebene zu gelangen, bedarf es einer logischen
Verknüpfung, einer sogenannten „Transformation“ oder „Aggregation“. Hier werden
nun individuelle Handlungen und kollektive Folgen entlang bestimmter Regeln miteinander verbunden: „Diese aggregierenden Verknüpfungen der Mikro- mit der Makroebene werden auch Transformationsregeln genannt. Transformationsregeln beinhalten sowohl spezielle und inhaltliche Informationen über den jeweiligen Fall, wie allgemeine und formale Regeln und Ableitungen“ (ebd.: 97). Hartmut Esser unterscheidet drei Typen an Aggregationsregeln: „Modelle der statistisch-mathematischen
Transformation, die Anwendung von institutionellen Regeln und die sog. partiellen
Definitionen“ (ebd.: 121). Ein Beispiel für den ersten Regeltyp wären Scheidungsraten, für Typ Zwei die Sitzverteilung im Parlament infolge von Wahlergebnissen und
277
für Typ Drei das psychische Ende einer Ehe, wenn einer der Partner an der Aufrechterhaltung nicht mehr interessiert ist. Allerdings wurde schon auf Bergmanns Kritik hingewiesen, wonach statistische Aggregationen keinen höheren Erklärungsgehalt aufweisen und letztlich Individualdaten seien.
Die Aggregationsregeln können durchaus die syntaktische Figur einer Hypothese
haben, d.h. sie können in eine Wenn-Dann-Formulierung gebracht werden: „Die
Wenn-Komponente formiert die Faktoren einer Bedingungskonstellation. Die DannKomponente benennt die kollektiven Effekte, auf die man logisch schliesst“ (Bergmann 2001: 88). Zu präzisieren gilt es nun, was mit der Wenn-Komponente genauer
gemeint ist. Es handelt sich dabei um „die individuellen Effekte, die aus den individuellen Propositionen und deren weiteren Anfangsbedingungen ableitbar sind. Das
heißt, sie resultieren selbst aus einem deduktiven Erklärungsrahmen und sind damit
dem Erklärungsschritt durch Transformation vorgelagert“ (ebd. f.). Solche Aussagen
werden auch als „Implikationsaussagen“ bezeichnet: „Eine Implikationsaussage ist
eine Aussage, die die Bedingungskonstellationen in der Wenn-Komponente und den
zu erklärenden Effekt in der Dann-Komponente enthält. […] Wenn nun mindestens
ein Teil der Bedingungskonstellation aus individuellen Effekten besteht, dann kann
die Implikationsaussage, sozusagen als Ableitung in der Ableitung, als Transformationsregel gebraucht werden“ (Siegwart Lindenberg 1977, zit. nach Bergmann 2001:
89). Allerdings weist Esser auf die Seltenheit solch „reiner“ Aggregationsregeln und
damit auf die Kompliziertheit der Logik der Aggregation hin. Zum Einen seien bestimmte soziologisch interessierende Phänomene historisch einmalig, sodass kaum
allgemein gültige Gesetze für die Aggregation gefunden werden dürften. Zum Anderen genügen meist keine einfach strukturierten Wenn-Dann-Gesetze; vielmehr müsste auf komplexere Annahmen zurückgegriffen werden (vgl. Esser 1993: 97).
278
Abbildung 18: Darstellung des Makro-Mikro-Makro-Erklärungsschemas nach
Hartmut Esser
Kritisiert wurde dieses Modell insbesondere für seine mangelnde Präzision die Übergänge von der Makro- zur Mikroebene und umgekehrt betreffend. Bergmann hierzu:
„Unpräzise ist, bei welchen Randbedingungen das kollektive Ereignis und ob nicht
bei unterschiedlichen situativen Randbedingungen dasselbe kollektive Ereignis eintritt. Ungeklärt bleibt somit das systematische Verhältnis zwischen Aggregationsregeln und situationsbezogenen Randbedingungen“ (Bergmann 2001: 101). Daneben
darf nicht übersehen werden, dass es inhaltlich „leer“ ist, d.h. es bedarf weiterer, tatsächlich erklärender Teilmodelle für die einzelnen Logiken. Die Vorteile des Modells
liegen auf der Hand und lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: „(1) Das
strukturell-individualistische Programm erlaubt tiefere Erklärungen als ein alternatives
kollektivistisches Programm. (2) Das strukturell-individualistische Forschungsprogramm erlaubt die Korrektur von kollektivistischen (und anderen) Hypothesen und
damit einen Erkenntnisfortschritt. (3) Das strukturell-individualistische Programm erlaubt die Erklärung sehr spezifischer Sachverhalte in sehr unterschiedlichen Situationen“ (Opp 2002: 104).
7.2.4.4 Genetische Erklärung
In dieser Arbeit soll es um die Erklärung der Steuerung sozialer Prozesse gehen.
Gerade hierfür eignet sich das Makro-Mikro-Makro-Erklärungsschema besonders,
auch wenn dies auf den ersten Blick nicht deutlich wird: „Man muß dabei und bei der
einfachen Unterscheidung einer Makro-Ebene der sozialen Strukturen und einer Mik279
ro-Ebene des Handelns der Akteure nicht stehen bleiben. Das Schema läßt sich in
allen seinen Teilen und Beziehungen erweitern, differenzieren, vertiefen und dynamisieren - wenn das für sinnvoll und nötig gehalten wird“ (Esser 1993: 102). Prozesse
werden von Esser bestimmt als „Sequenzen des Ablaufs und der Wirkungen des sozialen Handelns. Bezogen auf die drei Fragen der Entstehung, der Reproduktion und
des Wandels ergeben sich Sequenzen der Genese eines sozialen Gebildes als Kette
aufeinanderfolgender Schritte der Entstehung, der Existenz des Gebildes als Sequenz der Reproduktion und Sequenzen von Änderungen als der Prozeß eines
Wandels des Gebildes - sei es als eine Sequenz des Zerfalls, der Zuspitzung, der
internen Umstrukturierung oder der Evolution. Anders gesagt: Soziologische Erklärungen sind - immer! - letztlich Prozeß-Erklärungen, auch dann, wenn die sozialen
Gebilde ganz kompakt und unverrückbar erscheinen“ (Esser 93: 87).
Möchte man Erklärungen von Prozessen miteinander verketten, so wird das Explanandum einer ersten Erklärung zum Ausgangspunkt der Erklärung des folgenden
Prozesses; das Explanandum wird zum Explanans. Dieses Vorgehen wird auch als
„genetische Erklärung“ bezeichnet (vgl. ebd.: 102 f.). Entwickelt wurde dieses Vorgehen von Carl G. Hempel, der damit nomologische Erklärungsleistungen in den Geschichtswissenschaften ermöglichen wollte. Bekanntermaßen sperrt sich diese Disziplin gerne gegen auf Gesetzen basierenden Erklärungen und stellen stattdessen
die Einmaligkeit historischer Ereignisse oder das besondere Wirken eines Subjekts in
den Vordergrund.
280
Abbildung 19: Grundschema einer genetischen Erklärung nach Esser 1993: S.
104.
Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass solche Erklärungsschemata eine
grundsätzliche Schwäche aufweisen: „Es gibt praktisch immer externe, zufällige bzw.
zumindest nicht im Modell selbst erklärbare Bestandteile in den Randbedingungen,
die an jeder Ecke der Sequenz einen ganz anderen Weg möglich machen. Dann hat
es ein rasches Ende mit dem ,notwendigen‘ Gang der Geschichte“ (ebd.: 105). Diese
externen Störungen könne man jedoch „als zusätzliche, nicht weiter erklärte, exogene Randbedingungen modellieren, die jeweils an einer neuen Situation ansetzen“
(ebd.: 106, Hervorhebung im Original, der Verf.). Genetische Erklärungen bestehen
damit aus endogenen Randbedingungen - also dem Explanandum aus der vorhergehenden Sequenz - und bei Bedarf exogenen Randbedingungen. Selbstverständlich wird es dadurch erschwert, langfristige, evtl. sogar zeitlose, hoch generalisierte
Erklärungen oder Prognosen zu erstellen. Darum gehe es laut Esser auch nicht; zwar
müsse ein gewisser Grad an Allgemeinheit erreicht werden, jedoch würde auch die
Meteorologie keine Prognosen, die über drei Tage hinaus reichen, erstellen, wie Esser süffisant ergänzt (vgl. ebd.: 107). Erklären ließen sich damit erstens Prozesse,
die in ihrer Entwicklung „offen“ sind. Dazu gehören auch mutmaßlich gerichtete Prozesse, die im Nachhinein als kausal determiniert erscheinen, oder Prozesse der Evolution, welche ebenfalls „zukunftsblind“ ablaufen. Aber auch Prozesse der Selbstor281
ganisation, der sozialen Reproduktion oder des gesellschaftlichen Wandels oder Zerfalls ließen sich damit erklären.
Fazit dieses Exkurses in die Ebenenproblematik: Das in dieser Arbeit anvisierte
Steuerungsmodell sollte sowohl die sozialwissenschaftliche Makro- als auch die Mikroebene berücksichtigen. Wie noch zu zeigen sein wird, gelingt dies der sozial- und
steuerungstheoretisch interpretierten Autopoiesetheorie, welche im folgenden Kapitel
vorgestellt werden wird. Da das Erklärungsschema eher eine Heuristik und auf keinen Fall eine Theorie oder ein Modell ist, bedarf es der Auffüllung mit weiteren Teilmodellen oder -theorien. Im Rahmen der in die Sozialwissenschaften transferierten
Autopoiesetheorie werden diese Aufgaben auf der Makroebene vom Ansatz kreativer
Netzwerke und auf der Mikroebene von einer konstruktivistischen Handlungstheorie
übernommen; beide werden die Autopoiesetheorie zu einem politikwissenschaftlich
verwertbaren Steuerungsmodell ergänzen.
282