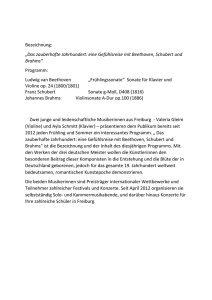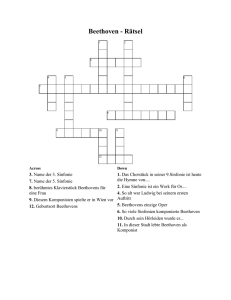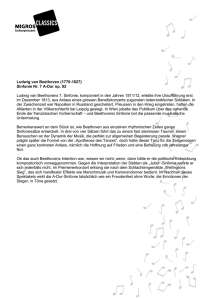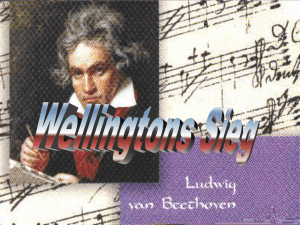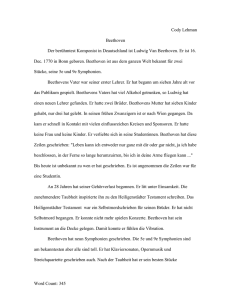„Ich componire und lebe wie ein Gott―: Beethovens und Schuberts
Werbung

Universiteit Gent Academiejaar 2010-2011 „Ich componire und lebe wie ein Gott―: Beethovens und Schuberts Selbstbild in ihren Briefen Versuch über die Möglichkeiten textimmanenter Briefforschung Promotor: Prof. Dr. Gunther Martens Verhandeling voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het behalen van de graad van Master in de Taal- en Letterkunde: Duits - Engels door Tobias Hermans - Franz Schubert, Die Taubenpost, D. 957 N°14 Dankeswort Der letzte Punkt dieser Untersuchung auf Seite 97 bedeutet das Ende einer von Oktober bis August dauernden Arbeit, für deren Zustandekommen ich vielen Leuten zu Dank verpflichtet bin. An allererster Stelle möchte ich mich bei meinem Betreuer, Prof. Dr. Gunther Martens, für seine ausführliche Hilfe beim Schreiben dieser Arbeit bedanken. Zu jeder Zeit konnte ich mich auf seinen Rat und Tat verlassen und fortdauernd hat er sich angestrengt, diese Studie mit seinen Empfehlungen zu bereichern. Weiter möchte ich auch Prof. Dr. Benjamin Biebuyck, bei dem ich immer mit wissenschaftlichen, aber auch existenziellen Sorgen willkommen war, Prof. Dr. Francis Maes, der immer dazu bereit war, mir Hilfe und Kritik aus musikwissenschaftlicher Sicht zu gewähren, und Frau Doris Dossche, für ihren spontanen Enthusiasmus und ihre äußerst wertvollen Anregungen und Korrekturen. Schließlich gilt auch weiterer Dank den Meistern selber, Beethoven und Schubert, die, wenn ihre Briefe da nicht länger zu befähigt waren, mich mit ihrer Musik immer wieder ermutigten und beruhigten. Der letzte Punkt dieser Arbeit bedeutet aber auch das Ende eines sechszehnjährigen Bildungsgangs, dessen Realisierung ich vollkommen meinen Eltern verdanke. Sie haben es mir unter allen Umständen ermöglicht, mich in allen Bereichen weiter zu entwickeln und ohne die andauernde Hilfe, Unterstützung und Liebe meiner Mutter, meines Vaters sowie meiner Brüder, wäre ich nie zu diesem Punkt in meinem Leben angelangt. Ich hoffe, dass diese Arbeit ihren jahrelangen Anstrengungen Ehre macht. Während der zweiten Hälfte meiner Schullaufbahn begegnete ich auch einem stark ökologisch bewussten Jungen, der seitdem nie von meiner Seite gewichen ist und sich durch die Jahre hindurch zu einem wirklich besten Freund entwickelt hat. Ich möchte darum gerne Bert Van der Hoogerstraete für seine standhafte, duldsame und immer treue Freundschaft danken. Kann ich mich im Übrigen nicht mit Schubert messen, so befinde ich mich allerdings auch in der glücklichen Lage, auf mehrere ergebene Freunde zurückgreifen zu können. Ihnen möchte ich hiermit Dankbarkeit zeigen, insbesondere Mieke Vandenbroucke, bei der ich immer ein hörendes Ohr und eine helfende Hand fand, und Koen Caspeele, der geduldig meine Klagelieder zuhörte. Ich widme diese Arbeit meinen Großeltern, bei denen das Glück, sie kennenzulernen, mir nicht verblieb, und Victorine Vandenhoute, als einen überfälligen Abschied und ein Zeichen der Dankbarkeit. Ich hoffe, dass sie mit Stolz auf mich hinunterblicken. Tobias Hermans, August 2011 Inhalt Dankeswort 5 0. Einführung 1. Methodologie 1.1 Selbstbild 1.2 Brief 1.3 Das Selbstbild im Brief 1.4 Fazit 1.5 Quellen 2. Künstlertum 2.1 Beethoven 2.1.1. Die Dienerschaft zum Höheren 2.1.2 Künstlertum als Frage der kreativen Autonomie 2.1.3 Die Krankheit als Gefährdung der künstlerischen Existenz 2.1.4 Kampf mit den Verlegern 2.1.5. Fazit 2.2 Schubert 2.2.1 Die Aufwertung des Individuums 2.2.2 Neuerung und Fortschritt 2.2.3 Fazit 2.3 Das Selbstbild 3. Wien und das Ausland 3.1 Die nationale Ebene: Österreich und das Ausland 3.1.1 Beethovens Drang ins Ausland 3.1.1.1 Der arme, österreichische Musikant 3.1.1.2 Die Lockung des Auslandes 3.1.2 Schubert: Verringerung des Auslandsbegriffs 3.2 Die lokale Ebene: Wien und London 3.2.1 Beethoven 3.2.1.1 Wien 3.2.1.2 London 3.2.1.3 Die virtuelle Anwesenheit im Ausland 3.2.2 Schubert 3.2.2.1 Wien als Ersatzkonstruktion 3.2.2.2 Loswerden und Neubindung 3.3. Das Selbstbild 4. Schlussfolgerungen und Selbstbild 5. Bibliografie 9 16 16 18 21 24 25 28 28 28 30 39 44 49 50 50 55 58 59 62 62 62 62 64 69 70 70 70 73 79 82 82 89 91 95 98 9 0. Einführung ―Will mann den Kern einer Komponistenpersönlichkeit erfassen, so braucht man sich nur die Streichquartette anzuhören - oder ihre Lieder‖.1 So versucht Dietrich FischerDieskau, einer der größten und bedeutendsten Musiker unserer Zeit, in dem sehr empfehlenswerten Interviewband Musik in Gespräch die Bedeutung und Relevanz kleinerer Kunstformen in dem Schaffen eines Komponisten anzugeben. Obwohl diese Behauptung in der Tat infrage gestellt und bestritten werden kann, impliziert sie im Grunde aber noch eine andere Auffassung, nämlich dass man das Wesen und die Natur eines Komponisten aus seinen Musikwerken heraus heben kann. Tatsächlich ist es oft nicht schwer, aus stilistischen Gründen schon nach einigen Takten den Namen des Komponisten zu erraten. Komplizierter wird es aber, wenn man bei genauerem Anhören eine Abspiegelung seiner Persönlichkeit zu finden glaubt. An erster Stelle hat Musik schon aber einen weniger bestimmten semantischen Wert als z. B. die Sprache und setzt dieser abstraktere Gehalt einen anderen, indirekteren Umgang mit und Interpretation von musikalischen Kunstwerken voraus.2 Außerdem steckt hinter der Suche nach einer weitgehenden biografischen Schicht in der Musik schnell die Gefahr, von Persönlichkeitsrekonstruktion in eine Persönlichkeitskonstruktion zu verfallen, die manchmal schon bestehenden Vorstellungen entspricht oder umgekehrt auch nicht selten in urban legends, die über diese Komponisten entstehen, münden und so das kollektive Bild, das sich aus diesen meistens nicht authentischen Geschichten entwickelt, prägen. 3 1 Dietrich Fischer-Dieskau: Musik im Gespräch. Streifzüge durch die Klassik mit Eleonore Bühning. Berlin: Ullstein Buchverlage 2005, S.19 2 vgl. Harry Goldschmidt: ―Musikverstehen als Postulat‖. In: Um die Sache der Musik. Reden und Aufsätze. 2., erw. Aufl. Leipzig: Reclam 1976, S.322-350; Erneuernd zur Definition des semantischen Werts sind auch Leonard Bernsteins „Norton Lectures― zum Titel The Unanswered Question, die er 1972-1973 an Harvard abhielt. In diesen sechs Vorträgen suchte er anhand Noam Chomskys Generativer Grammatik nach gleichen Strukturen in der Musik. Der dritte Vortrag „Musical Semantics― sei hier am relevantesten. Die „Norton Lectures― wurden an erster Stelle als Videoaufzeichnung herausgegeben, aber in Buchform liegt „Leonard Bernstein: The unanswered question: six talks at Harvard. Cambridge (Mass.): Harvard university Press 1976‖ vor. 3 Das beste Beispiel wäre hier die Auffassung, Gustav Mahler habe seine Kindertotenlieder für seine 1907 verstorbene Tochter geschrieben. Dieser Mythos erweist sich aber schon aus rein biografischen Gründen als falsch, indem der Liederzyklus schon zwischen 1901 und 1904 geschrieben wurde. Bei wem anders als Richard Wagner entstammen die urban legends auch der Erfindung des Komponisten selber. So hat Wagner viele Gerüchte in die Welt herumgeschickt, die ihn als Nachfolger Beethovens bestätigen 10 Ein anderer Blickwinkel auf dem Komponistennachlass, der weitere Einsichten in ihrer Person erbringen könnte, besteht aus ihrer schriftlichen Hinterlassenschaft, hauptsächlich ihren Briefen und Tagebüchern. Demgegenüber steht die eigenartige Tatsache, dass man sich aber relativ selten in einer wissenschaftlichen Weise an die Dokumente der Komponisten an sich orientiert, um durch sie einen Eindruck von ihnen zu bekommen. 4 So fügt man die Briefe der Meister meistens nur aus rein dokumentarischen, unterstützenden Zwecken in Biografien bei, oder betrachtet man sie in Studien gewöhnlich durch die Augen ihrer Freunde und Zeitgenossen,5 aber ist noch nie systematisch untersucht worden, was die schriftlichen Dokumenten selber über die Komponisten bekunden. Nur Joseph Bennet scheint dazu mit seiner „The Great würden. Die Bekannteste sei wohl, dass er eine „supposedly formative experience― miterlebt habe, als er Wilhelmine Schröder-Devrient die Leonore in Beethovens Fidelio singen hörte, durch die er sich dann von Beethoven auserwählt sah, Opernkomponist zu werden. (vgl. Barry Millington: „Myths and Legends―. In: The Wagner Compendium. A Guide to Wagner’s life and music. Edited by Barry Millington. London: Thames & Hudson Ltd. 1992, S.133) 4 Auch die Konstruktion von Komponistenbildern aufgrund sprachlicher oder schriftlicher Quellen ist aber oft auch weit von der Realität und ihnen unterliegen manchmal ebenfalls unzuverlässige oder Selbstzweck dienende, zumindest subjektive Zeugnisse. In seinem Aufsatz „‗Poor Schubert‗: images and legends of the composer― geht Christopher Gibbs kurz näher auf diese subjektive Auslegung des Komponistenbildes ein. Besonders interessant ist, wie enttäuscht Heinrich Hoffmann von Fallersleben nach einer Begegnung mit dem echten Schubert darüber war, dass dieser nicht mit ‚seinem Schubert‗ übereinstimmte (vgl. Christopher H. Gibbs: „‗Poor Schubert‗: images and legends of the composer―. In: The Cambridge Companion to Schubert. Edited by Christopher H. Gibbs. Cambridge: University Press 1997, S.37) 5 vgl. z. B. Beethoven aus der Sicht seiner Zeitgenossen: in Tagebüchern, Briefen, Gedichten und Erinnerungen. Zwei Bände. Hg. v. Klaus Martin Kopitz und Rainer Cadenbach. Unter Mitarb. von Oliver Korte und Nancy Tanneberger. München: Henle Verlag, 2009; Walburga Litschauer: ―Schubert aus der Sicht seiner Freunde‖. In: Schubert und das Biedermeier: Beiträge zur Musik des frühen 19. Jahrhunderts. Festschrift für Walther Dürr zum 70. Geburtstag. Hg. v. Michael Kube, Werner Aderhold und Walburga Litschauer. Kassel: Bärenreiter 2002, S. 139-146. Vor allem in der Schubertforschung wird in dieser Hinsicht viel wert auf die Erfahrungen seiner Freunde gelegt, und zwar dermaßen, dass die Dokumente Schuberts mit denen seiner Freunde konfrontiert werden (vgl. z. B. Franz Schubert im eigenen Wirken und in den Betrachtungen seiner Freunde. Zsgest. und hg. v. Willi Reich. Zürich: Manesse Verlag, 1971). Beispielweise hat Otto Erich Deutsch seinen Band mit schriftlichen Nachlässen von und über Schubert während des Komponisten Leben (Schubert: Die Dokumente seines Lebens. Gesammelt und erläutert v. Otto Erich Deutsch. Mit einem Geleitwort v. Peter Gülke. Erweiterter Nachdruck der 2. Auflage Leipzig 1980. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik 1996) ergänzt mit einem zweiten, in dem die Zeugnisse von Schuberts Freunde ab dessen Tod versammelt wurden (vgl. Schubert: Die Erinnerungen seiner Freunde. Gesammelt und erläutert v. Otto Erich Deutsch. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1957). 11 Composers, Sketched by Themselves―-Reihe von 1877 bis 1884 in den (damals noch) Musical Times and Singing Class Circular einen Ansatz gegeben zu haben. 6 Der Komponist, der wahrscheinlich am meisten einer sowohl zeitgenössischen als auch späteren Mythoskreation auf Basis seiner oft sagenumwoben Stücken unterworfen wurde, ist Ludwig von Beethoven (1870-1827). Obwohl sein Bild im Laufe der Jahrzehnte oft von wechselnden Akzenten und Einfallswinkeln geprägt wurde, 7 legte sich die Darstellung des großenteils in Wien tätigen Komponisten allerdings „schon früh [fest] […] auf den Ringenden oder den Mit-Sich-Kämpfenden, den Heros, der in den Rachen des Schicksals greift―. 8 Als Gegensatz zu dem ‚überimagnierten‗ Beethoven könnte man wohl seinen Zeit- und Stadtgenossen Franz Schubert (1796-1828) angeben, der „[f]or all his familiarity, […] remains a shadowy figure‖. 9 Zwar ist Schubert tatsächlich überhaupt kein Unbekannter für das weite Publikum und kursieren über ihn ebenfalls zahlreiche Geschichten, jedoch umschwebt ‚den Liederfürsten‗ noch immer ein Hauch von Mystizität. Das sich im kollektiven Gedächtnis gefesselte Bild des „zu früh verblichene[n] geniale[n] Tonsetzer[s]―10 spitzt sich vor allem zu, auf das von einem „destitute artist later sentimentalized in novels, operettas, and movies―, 11 der sein Leben völlig der ‚holden Kunst‗, durch die er sein immer scheiterndes Liebesleben überwindet, widmet und der umringt wird von einem künstlerischen, fast prä-bohèmischen Freundeskreis. Die düstren Seiten seiner Existenz, besonders 6 seine fatale Syphiliserkrankung, bleiben aber meistens siehe Joseph Bennet: ―The Great Composers, Sketched by Themselves‖. In: The Musical Times and Singing Class Circular. Vol. 18, No. 415, Sep. 1, 1877 bis Vol. 25, No. 500, Oct. 1, 1884. 7 vgl. dazu Alessandra Cornini: The Changing Image of Beethoven: A Study in Mythmaking. Santa Fe: Sunstone Press 2008. In dieser Studie die Autorin untersucht wie die Sicht auf den Komponisten während zwei Jahrhunderte gestaltet und - wie der Titel schon andeutet - stets in einer anderen Weise rezipiert wurde. Diese Studie konzentriert sich dagegen aber nur auf den subjektiven Blickwinkel der Komponisten selber. 8 Fischer-Dieskau: Musik im Gespräch, S.26; Im Film kommt diese Vorstellung von Beethoven besonders beispielhaft zum Ausdruck, wie in Immortal Beloved (1994) von Bernard Rose oder in dem rezenteren Copying Beethoven (2006) von Agnieszka Holland, wo der Komponist in beiden Fällen als ein für die Kunst lebender, nichts und niemand schonender, aber doch nicht ganz von Frauen unberührter Tyrann dargestellt wird. 9 N.N.: „Schubert: Music, Sexuality, Culture―. In: 19th-Century Music. Vol. 17, No. 1, Schubert: Music, Sexuality, Culture (Summer, 1993) , S.3 10 Franz Grillparzer zitiert nach Gibbs: Poor Schubert, S.43 11 Ebd., S.36 12 unverkannt. 12 Weiterhin wurde die Vorstellung von Schubert schon zu Lebzeiten konstruiert und ausgespielt „in relation and opposition to Beethoven‘s―13: Beethoven ist der Männliche, der Symphoniker, der Monumentale, während Schubert als der sensitivweibliche, intime, natürliche Liederkomponist dargestellt wurde. 14 Ist es bis heute nicht sicher, ob Schubert und Beethoven einander je ausführlich begegnet haben, geschweige denn, dass Schubert an Beethovens Sterbebett erschienen ist,15 so gibt es jedoch in der mentalen Konstruktion der Komponisten eine Wechselwirkung und gegenseitige Prägung zwischen den Beethoven- und Schubertbildern. Diese Arbeit wird sich mit der eher angezeigten Lücke im Forschungsstand, nämlich dem Mangel an einer systematischen Studie der Dokumente von Komponisten selbst, auseinandersetzen. Sie geht dafür aus von der zentralen Frage, was sowohl thematisch als auch methodologisch über das Selbstbild von Beethoven und Schubert zu lernen sei, aus. Die Untersuchung intendiert dabei wohl nicht, den echten Beethoven oder Schubert auszugraben und am Ende präsentieren zu können. In Analogie zu Studien mit vergleichbaren Gegenständen 16 ist sie aber davon überzeugt, dass den Briefen Beethovens und Schuberts trotz ihres vermutlich geringeren literarischen 12 Beinahe prototypisch findet sich diese Vorstellung in der erfolgreichen Operette Das Dreimäderlhaus (mit einem Libretto von Alfred Maria Willner and Heinz Reichert) wieder. In den Filmversionen der tragischen Liebesgeschichte, wie der mit Richard Tauber (1934) oder Karlheinz Böhm (1958) kommt dieses Bild des verzweifelten, letztendlich immer einsamen Schuberts noch deutlicher zum Ausdruck, obwohl es auch in dem mehr biografischen und düsteren Zweiteiler „Notturno― von Fritz Lehner (1988) unverkennbar zutage tritt. 13 Gibbs: Poor Schubert, S.39 14 vgl. Ebd., S.48-52 15 Bis heute ist es noch nicht deutlich ob Beethoven und Schubert einander tatsächlich begegnet sind. Wohl waren sie beide an dem musikalischen Leben in Wien beteiligt, und können sie nicht anders, als einander dort getroffen zu haben, aber über eine wirklich verabredete Unterhaltung ist die Forschung sich noch nicht im Klaren. Schubert war hat selber eine Entwicklung von Resignation bis zu Bewunderung von Beethoven erlebt und seinerseits war sich Beethoven sicherlich von Schuberts Werk bewusst aber hat er nie Anstalten gemacht, mit Schubert in Kontakt zu treten. Laut der Brüder Joseph und Anselm Hüttenbrenner, zwei Freunde Schuberts, hat Beethoven Schubert auf seinem Sterbebett zu sich gerufen. Die Forschung hat aber noch keine Gewissheit über diese angebliche Begegnung bekommen, da u.a. die zwei Zeugnisse einander widersprechen und andere Quelle dieses Treffen leugnen. (siehe auch Maynard Solomon: „Schubert and Beethoven―. In: 19th-Century Music, Vol.3, No.2 (Nov., 1979); Gibbs: Poor Schubert, S.48-52) 16 siehe z. B. das vierte Kapitel „Bilder vom Ich― in Anne Overlack: Was Geschieht im Brief? Strukturen der Brief-Kommunikation bei Else Lasker-Schüler und Hugo von Hofmannsthal. Tübingen: Stauffenburg 1993 oder Rudolf Käser: Die Schwierigkeit, ich zu sagen. Rhetorik der Selbstdarstellung in Texten des “Sturm und Drang” Herder- Goethe - Lenz. Dissertation. Berne u.a.: Peter Lang 1987. 13 Gehalts, mehr als bei ihrem bis jetzt großenteils geläufigen dokumentarischen Zweck zu entnehmen ist. Sie beabsichtigt dabei also, das Wie des Selbstbildes in doppelter Weise nachzuprüfen. Zuerst wird sie sich mit der methodologischen Frage, wie ein Selbstbild überhaupt literaturwissenschaftlich in Briefen vorhanden sein kann, beschäftigen, um erst darauf zu überprüfen, wie die Komponisten sich selbst sehen und wie sie dieses Selbstverständnis in ihren Briefen ausdrücken. Bei Beethoven beschränkt sich die Erforschung seiner umfangreichen Schriftsammlung großenteils auf die zwei bekanntesten Dokumente: Das Heiligenstädter Testament (1802) und sein Brief an die Unsterbliche Geliebte. Beide monumentalen Nachlässe fungieren als schriftliche Scharniere zwischen den drei großen Phasen seiner Musikschöpfung und sind die vermutlich bekanntesten Schriftäußerungen eines Komponisten in der Musikgeschichte. 17 Dennoch dienen die beiden Schriften in der Beethoven-Forschung vor allem als biografische Unterstützung, durch die man die Ereignisse im Leben des Komponisten zu erklären und deuten versucht. Wohl gibt es zu dem mysteriösen Brief an die Unsterbliche Geliebte zahlreiche Studien, diese reichen allerdings meistens nur bis zur Datierung des Briefes und der Identifikation der rätselhaften Adressatin. 18 Noch nie sind aber weder diese zwei zentralen Dokumente noch die gesamte beethovensche Schriftsammlung als selbstständige Texte betrachtet und demgemäß untersucht worden. Auch bei Schubert ist der Forschungsstand ziemlich problematisch und ergibt es sich ein Paradox. Hat Otto Erich Deutsch nämlich mit seiner eindrucksvollen Arbeit Franz Schubert: Die Dokumente seines Lebens19 eine der meist anregenden, philologischen Studien zu den Schriftstücken 17 irgendwelches Komponisten geschaffen, so ist das vgl. Francis Maes: Muziek als idee en praktijk. Een geschiedenis van de klassieke muziek. Deel 2: van Mozart tot Debussy. Gent: Uitgeverij Acco 2010, S.49-50; 61 18 Sehr lang (und wahrscheinlich noch bis zu heute) hat sich die Forschung mit der Frage, ob der Brief an die Unsterbliche Geliebte von Beethoven 1801 oder aber 1812 geschrieben wurde, auseinandergesetzt. Vladimir Karbusiky gibt in einer methodologisch sehr ausgebreiteten Studie eine Übersicht der verschiedenen Datierungen sowie ihrer Begründungen, und bestimmt das Jahr des Briefes nach sprachlicher und musikalischer Analyse auf 1801 (vgl. Vladimir Karbusiky: Beethovens Brief „An die unsterbliche Geliebte“. Ein Beitrag zur vergleichenden textologischen und musiksemantischen Analyse. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1977). Genau von dieser „musiksemantischen― Annäherung möchte diese Untersuchung aber abgehen und die Briefe wirklich in ihrem Eigenwert studieren, ohne auf ihre Beziehung zu spezifischen Werken Beethovens rückzukoppeln (siehe weiter dazu 1.2 und 1.3). 19 vgl. Schubert: Die Dokumente seines Lebens. Gesammelt und erläutert v. Otto Erich Deutsch. Mit einem Geleitwort v. Peter Gülke. Erweiterter Nachdruck der 2. Auflage Leipzig 1980. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik 1996. 14 literaturwissenschaftliche Potenzial der Sammlung noch nicht völlig ausgenützt. Genau wie seine Figur, haben auch die schriftlichen Dokumente Schuberts noch etwas Geheimnisvolles über sich und hat sich die Forschung, abgesehen von biografischen Zwecken, kaum mit seinem schriftlichen Nachlass beschäftigt. Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen deshalb so oft als möglich die von den Komponisten selbst verfassten Briefe, und nicht sosehr eine Analyse ihres vollständigen Briefwechsels. Weiter wird sich diese Arbeit, abgesehen von einigen Briefen Schuberts und Beethovens Heiligenstädter Testament, vor allem auf den Zeitraum 1815-1828 konzentrieren. Nicht nur wegen des vorhergenannten Raummangels, sondern vielmehr, weil diese Periode großenteils mit der letzten Schöpfungsphase Beethovens als auch mit der Mehrzahl von Schuberts gesamtem Briefnachlass zusammenfällt und die Arbeit so vermeide, eine zu unproportionale Analyse zwischen den beiden Komponisten darzustellen. Ausgehend von der zentralen Untersuchungsfrage oben, soll das Selbstbild unter Berücksichtigung verschiedener Fragen in den schriftlichen Dokumenten Beethovens und Schuberts nachgeprüft werden. In erster Linie wird diese Untersuchung sich auf die Frage, wie die Komponisten sich selbst in ihren Briefen sehen, richten. Neben einer reinen Bestimmung und Deutung dieses Selbstbildes, wird sie dazu ebenfalls in Betracht nehmen, ob, und wenn ja, wie das Selbstbild sich ändert und unter welchen Umständen. Darüber hinaus wäre es auch lohnend, nachzugehen, wie sich ihr Verständnis als Komponist abzeichnet und was es für sie beinhaltet. Zu diesem Punkt wäre es gerechtfertigt, ebenfalls nachzugehen, ob sich die Art und Weise, in der Beethoven und Schubert sich vorstellen, gesellschaftliche Erwartungen und Modellen fügt, oder eher von ihnen abweicht. Als Vergleichsmittel wird die Untersuchung dazu gelegentlich auch die Tagebucheinträge von Beethoven und Schubert berücksichtigen. Sollten die Komponisten nämlich versuchen, ihr „Ich― in den Briefen zu verschleiern, so wäre es relevant, um nachzuprüfen, welche Erfahrungen und Gefühle sie ihren Tagebüchern zuvertrauen, und wie sie ihr Selbst an diesen Stellen darstellen. Schließlich soll das Bild, das Beethoven und Schubert über sich selbst halten, nicht ständig auf ihr eigenes Ich bezogen werden, sondern soll die Untersuchung die einzelnen Selbstbilder auch miteinander in Verbindung setzen und sich fragen, wie sich das Selbstverständnis der beiden Komponisten zueinander verhält. Genau wie bei der 15 populären Vorstellung von Beethoven und Schubert, wäre es an dieser Stelle auch relevant, nachzugehen, ob die Komponisten, trotz der Abwesenheit einer mehrfachen, gezielten Begegnung, ihr Selbstbild beeinflussen ließen durch die psychologische Anwesenheit des Anderen. Obwohl sich diese Arbeit mit der Frage nach dem Selbstbild von Beethoven und Schubert nicht völlig dem interdisziplinären Bereich des Biografischen, Musikologischen, Soziologischen oder Psychologischen entziehen werden kann, stellt sie jedoch an erster Stelle die literaturwissenschaftliche Methode in den Mittelpunkt. Das ist der Mehrwert dieser Studie, und zugleich ihr Grundsatz: Die Überzeugung, dass Briefe vor allen Dingen als selbstständige Textdokumente behandelt werden können und dass unter Berücksichtigung sprachlicher Textimmanenz nachgeprüft werden kann, wie die Komponisten sich verstehen, wie ihr Geschriebenes dieses Verständnis sprachlich ausdrückt und umschreibt, und welche rhetorische Mittel sie dazu anwenden. Um die daraus entstandenen Folgerungen zu dem Selbstbild der einzelnen Autoren effektiver und übersichtlicher miteinander konfrontieren zu können, wird die Analyse sich auf zwei ausgewählte thematische Bereiche konzentrieren. Zuerst wird sie Beethovens und Schuberts Künstlertum besprechen, und insbesondere nachgehen wie sie sich selbst und ihre künstlerischen Tätigkeiten bewerten und wie ihre Kunstauffassungen in einem breiteren Künstlerselbstbild passen. Darauf wird sich die Untersuchung richten auf die Beziehung von Beethoven und Schuberts zu Wien und dem Ausland, d. h. in welchem Maße die beiden Komponisten sich mit ihrer geografischen Umgebung identifizieren und auf welchen (inter)nationalen Umgang sie die Verbreitung ihrer Werke anlegen. Angesichts des neuen Charakters dieser Studie, wird sie sich die Studie im ersten Kapitel aber beschäftigen mit der Darlegung einer Methodologie, d. h. mit einer Definition von Briefen und Selbstbild, und der Frage, wie diese zwei literaturwissenschaftlich produktiv miteinander vereint werden können. Diese Untersuchung nach dem Selbstbild von Beethoven und Schubert in ihren Briefen bezweckt anhand literaturwissenschaftlicher Strategien, das Selbstverständnis der beiden Komponisten textimmanent bloßzulegen. Sie wird die Meister dazu aus ihrem musikwissenschaftlichen Rahmen herausheben und erzielt anhand sprachlicher Analyse ihre bisher unerforschten Tätigkeiten und Merkmale als Briefschreiber nachzuprüfen. Am Ende erhofft diese Arbeit durch die Analyse der Selbstbilder der 16 Komponisten, einen relevanten Beitrag zum heutigen Beethoven- und Schubertbild leisten zu können, aber im Allgemeinen vor allem das bisher eher unberücksichtigtes Potenzial ihrer Schriftdokumenten nachzuweisen und anhand untersuchter Einzelfälle neue Annäherungsmöglichkeiten heranzutragen. 1. Methodologie 1.1 Selbstbild Eine Definition des Selbstbildes ist eine schwere Aufgabe, da sie nicht nur ein Bild, das man von sich selbst hält, umfasst; sie beinhaltet zugleich auch eine Vorstellung, die man von sich selbst gibt. Ein Selbstbild ist damit zugleich Selbstwahrnehmung als Selbstdarstellung. Am besten ließe sich das Selbstbild aber vielleicht definieren im Gegensatz zum Begriff „Identität―. Obwohl Rudolf Käser in seiner Studie zur Rhetorik der Selbstdarstellung im ‚Sturm und Drang‗ meint, dass Selbstdefinition „instabil― bleibt ohne die „Koinzidenz meines Bildes von mir mit dem Bilde, das sich die anderen vermutlich von mir machen―, 20 was er dann unter dem Nenner „Identität― zusammenbringt, vernachlässigt er durch diese starke Dependenz zum Anderen aber auch die individuelle Signifikanz und Eigenständigkeit, die mit dem Begriff „Selbst― verbunden sind. In dieser Hinsicht gehen Florian Hubners Überlegungen zum Identitätsbegriff etwas nuancierter hervor. Dabei bezieht er sich, unter vielen anderen, auf Tap, der Identität als ein Zusammengehen von eigenem Empfinden bzw. gesellschaftlich-kultureller Determination, betrachtet. Es geht ihm darum, dass „eine Person sich definieren, sich präsentieren, sich selbst und zu anderen erkennen geben kann oder [dass] der andere sie definieren, einordnen oder erkennen kann―. 21 Eine Feststellung, die Käser an sich auch schon gemacht hat, mit einem wesentlichen Unterschied aber: Hubner trennt ‚Selbst‗ und ‚Identität‗ voneinander. Zwar sind beide miteinander verbunden, sie „transportieren [dennoch] […] zu unterschiedliche Bedeutungen―22 um einfach gleichgesetzt zu werden. Es gibt folglich 20 Rudolf Käser: Die Schwierigkeit, ich zu sagen. Rhetorik der Selbstdarstellung in Texten des “Sturm und Drang” Herder - Goethe - Lenz. Dissertationsarbeit. Bern u.a.: Peter Lang 1987, S.XI 21 Tap nach Florian Huber: Durch lesen sich selbst verstehen. Zum Verhältnis von Literatur und Identitätsbildung. Bielefeld: transcript Verlag 2008, S.24 22 Huber: Durch lesen sich selbst verstehen, S.23 17 keine Abhängigkeit, sondern ein Wechselspiel zwischen Identität und Selbstbild für ihn. In Bezug auf diese Trennung, wird ‚Identität‗ in dieser Studie als eine Konstruktion, die objektiv und auf Distanz hergestellt wird, betrachtet, während sie ein Selbstbild ebenso als eine künstliche Gestaltung sieht, aber subjektiver und nur abhängig von der Wahrnehmung des Ich. Es ist sozusagen die subjektive Seite der Identität. Und gerade diese Seite setzt sich diese Arbeit zum Gegenstand. Da „Identität […] nicht sinnvoll diskutiert werden [kann] ohne die subjektive Wahrnehmung der Individuen zu berücksichtigen―, 23 könnte sie wohl den Ansatz zu einer größeren, kritischen Identitätsstudie von Beethoven und Schubert bilden, aber das beabsichtigt sie in keinem Fall. Sie erhebt auch gar nicht den Anspruch, am Ende ein festes, endgültiges Selbstbild vorstellen zu können. Denn genau wie ‚Identität‗ heutzutage als ein „Prozess des Herstellens und des Umbauens― 24 verstanden wird, betrachtet die Untersuchung auch das Selbstbild als etwas Veränderliches, stark von subjektiven Schwankungen Abhängiges und geht sie von seiner Vielseitigkeit aus. ‚Selbstbild‗ soll in dieser Studie vielmehr verstanden werden als einen narrativen Abdruck des Ich, der durch das Erzählen, oder genauer, Verschriftlichen seiner Ansichten und Empfindungen etwas besagt über seine Persönlichkeit, d. h. nicht nur wie wir ihn betrachten können, sondern auch wie er sich selbst sieht und darstellt. Diese Erklärung stimmt im Grunde mit dem „autoepistemischen Gewinn [der] Selbstnarration― 25 überein, den Lucius-Hoene und Deppermann beschreiben: Im Erzählen kann [der Erzähler] sich zugleich darstellen und über sich reflektieren, er erarbeitet sich Bilder und Konzepte seiner Erfahrungen und seiner Person und lässt sie auf sich wirken. Indem er sich als handelnder, fühlender und erlebender Mensch zum Ausdruck bringt, nimmt er auch zu sich Stellung, er interpretiert und bewertet sich, differenziert und vergleicht seine Erfahrungen und Erinnerungen. Damit vergewissert er sich seiner selbst und treibt gleichzeitig seine Selbsterkenntnis voran. 26 Stichwort für die Methodologie des Selbstbilds ist also seine Narrativität. 27 Dass sie dazu stark von der Sprache ausgeht, soll nicht erstaunen, da sich in der Erzählforschung, 23 Ebd., S.29 Ebd. S.26 25 Ebd. S.37 26 Lucius-Hoene und Deppermann nach ebd., S.37-38 27 Diese Auffassung von Selbstbild unterscheidet sich von Meizoz' Begriff der posture, der sich auf die Gesamtheit der Selbst- und Fremdpositionierungen des Autors bezieht und so stärker auf soziologische und biografische Parameter bezogen bleibt (vgl. Jérome Meizoz : ―Recherches sur la posture : Jean24 18 sicherlich seit dem sogenannten narrative turn28, allmählich das Bewusstsein entwickelt hat, dass sich „weite Bereiche des menschlichen Handelns und Erlebens als erzählende Prozesse verstehen und mittels Narration beschreiben lassen―. 29 Anhand literaturwissenschaftlicher Textanalyse und Interpretation wird diese Arbeit also untersuchen, wie Beethoven und Schubert sich selbst sehen und vorstellen. Sie möchte zu diesem Punkt aufgrund der Sprache ihr Selbstbild identifizieren, interpretieren und schließlich ihr Verhältnis zur Sprache überprüfen. Zweck dieser Arbeit ist also nicht, die existenzielle Gesamtheit der beiden Komponisten zu umfassen; sie möchte vielmehr zeigen, wie sie sich mittels narrativer Verarbeitung auf ihr Ich beziehen und welche Folgerungen für ihr Selbstverständnis daraus zu ziehen wären. 1.2 Brief Der Brief ist das vermutlich älteste Mittel indirekter Kommunikation und durch die Jahrhunderte hindurch haben sich viele Institutionen sowie Konventionen um ihn herum ausgebildet. 30 Diese Arbeit wird den Brief aber weder im Rahmen einer solchen historischen Briefkultur noch nach einem bestimmten Modell oder einer Theorie (wie Gellerts) untersuchen; sie wird ihn zunächst als literarische Quelle betrachten und demgemäß vor allem literaturwissenschaftliche Techniken der Rhetorik und Stilistik auf ihn anwenden. Der Brief soll in dieser Untersuchung folglich als Text und weniger als Mitteilung erscheinen - ein Unterschied, den Anne Overlack erläutert: Als Text trägt der Brief alle Merkmale der Schriftlichkeit: er ist autonom, er hat sich von seinem Verfasser abgelöst, er wird gelesen, interpretiert, anverwandelt. Als Mitteilung transponiert er eine konkrete Absicht, wendet sich an einen Jacques Rousseau‖. In: Littérature 126 (Juni 2002), S. 3-17; Jérôme Meizoz: Postures littéraires en scènes modernes de l’auteur. Essai. Genève: Slatkine Erudition 2007). 28 In einführenden Bemerkungen über die Begriffe „narrative turn― und „homo narrans―, beschreibt Cammilleri den „narrative turn― wie folgt: „Der ‚narrative turn‗ […] geht von einer veränderten Sichtweise des Menschen und seiner Sprache aus. […] Das Konzept der Narration als Denkmodus legt eine spezifische Sprach-Mensch-Beziehung zu Grunde, in der Beziehungen zwischen Narration, Selbst, Imagination, Emotion und autobiografischem Gedächtnis geknüpft werden. Diese Komponenten beziehen sich unauflöslich aufeinander―. (Chiara Cinzia Cammilleri: „Auf dem Weg zu einem narrativen Lernprozess - Neue Möglichkeiten des Mediums Film - Auszüge aus einer qualitativen empirischen Studie―. In: Thema Fremdverstehen. Hrsg. v. Lothar Bredella/Herbert Christ/Michael K. Legutke. Giesener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Gunter Narr Verlag 1997, S.256-276). 29 Ebd., S.33 30 vgl. Rainer Baanser: ―Briefkultur im 19. Jahrhundert. Kommunikation, Konvention, Postpraxis‖. In: Briefkultur im 19. Jahrhundert. Hrsg. v. Rainer Baasner. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1999, S.1-36 19 konkreten Adressaten, will in einem bestimmten Sinne verstanden werden. […] In dem Moment allerdings, da der Brief aus dem vertraulichen Verhältnis zwischen Absender und Adressat herausgelöst und von einer interessierten Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen wird, ändert sich auch die Kommunikationsstruktur zwischen Leser und Text. Ein publizierter Brief kann von den mitlesenden Dritten nur mehr als Literatur rezipiert werden.31 Zwar sind solche ausdrücklich literarischen Briefanalysen zugegeben eher selten, die Betrachtung des Briefes als eines literarischen statt zeitlichen Dokuments ist jedoch nicht weit hergeholt. Schon im 18. Jahrhundert bemerkten Theoretiker wie Lessing oder Gellert „die Nebeneinanderstellung von Brief und Roman― 32 und in seinem bedeutsamen Aufsatz über den Privatbrief räumt auch Peter Bürgel ein, dass, obwohl der Brief „nicht als Ästhetikum betrachtet werden sollte, […] die Untersuchung von Sprache, Stilgestus, rhetorischen Figuren― 33 dennoch erdenklich ist. Dazu setzt er zugleich aber auch eine wichtige Bedingung voraus: Nur immanent kann eine solche Untersuchung nicht betreiben - weil man es eben nicht mit dichterischer Fiktion, sondern letztlich mit der empirischen Person des Schreibers zu tun hat. Analyse brieflicher Sprache bedeutet so stets Analyse des Autors, und zwar nicht nur seiner intellektuellen, sondern auch seiner psychischen Struktur, entsprechend der Auffassung von Sprache als einer Manifestation reflektiver, aber eben auch unterbewußter Vorgänge im Sprechenden. 34 Und gerade das macht diese Untersuchung. Sie geht dafür von der Autonomie des Briefes aus; sie sieht ihn als eine Einzelerscheinung, als ein separates, literarisches Dokument, d. h. monologisch, und wird die Antworten der Adressaten nicht in die Analyse einbeziehen. Das könnte wohl eine Schwachstelle der Studie bilden, da der Brief tatsächlich kommunikativ angelegt ist und sich zwischen einem Sender und einem „festen, bestimmten, individuellen Adressaten― 35 bewegt (daher die übliche Metapher des Gesprächs). 36 Dennoch bekundet der Brief mehr als das Verhältnis zu einem anderen Adressaten. Er befindet sich an erster Stelle „zwischen einem Ich und der 31 Anne Overlack: Was geschieht im Brief? Strukturen der Brief-Kommunikation bei Else Lasker-Schüler und Hugo von Hofmannsthal. Tübingen: Stauffenburg 1993, S.36 32 Diethelm Bruggemann: ―Gellert, der gute Geschmack und die üblen Briefsteller. Zur Geschichte der Rhetorik in der Moderne‖. In: Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 45 (1971), S.118 33 Peter Bürgel: „Der Privatbrief. Entwurf eines heuristischen Modells―. In: Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 50 (1976), S.291 34 Bürgel: Der Privatbrief, S.291 35 Ebd., S.285 36 vgl. Bruggemann: Gellert, der gute Geschmack, S.145; Bürgel: Der Privatbrief, S.283; Overlack: Was geschieht im Brief?, S.28 20 Beziehung zwischen diesem einen Ich und einem anderen Ich―. 37 Obwohl weniger gängig, lohne es sich versuchsweise nur die erste Seite dieses Verhältnisses, nur die „eine Hälfte des Dialogs―38 zu erforschen. Eine solche Analyse des einzelnen Briefes und nicht des Briefwechsels findet sich schon in anderen Studien, die ebenfalls nur die Äußerungen der Verfasser beleuchten ohne die Antworten des Adressaten zu berücksichtigen. 39 Darüber hinaus bilden sich die literarischen Qualitäten des Briefes nicht erst durch den Dialog mit anderen Briefen aus, sondern liegen sie gerade in seiner Eigenständigkeit. Denn - so konnte man sich fragen - wenn ein Brief keine Antwort bekommt oder wenn diese nicht länger vorhanden ist (z. B. durch Verlust), verliert der unbeantwortete Brief seinen Wert dann? In keinem Fall. Das Forschungspotenzial eines Briefes fängt bei ihm selbst an. Die Perspektive vermehren sich allerdings durch die Einbeziehung seines Spannungsfelds zum Empfänger, seine wissenschaftliche Bedeutung verringert sich aber nicht, wenn auf diesen Dialog verzichtet wird. Eine Untersuchung des selbstständigen Briefes garantiert zudem in höherem Maße die Subjektivierung der Briefschreiber, die sich die Arbeit zum Ziel setzt, und vermeidet die Gefahr, das verhältnismäßige Interesse an anderen Briefschreibern sehe zu viel über den eigentlichen Gegenstand, den Komponisten selbst, hinweg. Schließlich hat das Quellenmaterial für diese Untersuchung, sicherlich in Bezug auf Schuberts Briefe, manchmal so karg die Jahrhunderte überlebt, dass die Rückwendung auf den autonomen Brief fast erforderlich sei, um eine ergebnisfähige Studie zustande zu bringen, während eine Analyse der umfangreichen Gesamtbriefsammlung Beethovens auf der anderen Seite den Umfang dieser Magisterarbeit sprengen würde. Als einzelne literarische Quelle wird diese Untersuchung also die Briefe betrachten. Dazu wird sie, wie gesagt, einerseits mit Aufmerksamkeit für die stilistischen und rhetorischen Merkmale hervorgehen, andererseits auch thematische Zusammenhänge zwischen ihnen herstellen. Genau wie bei einem fiktionalen Text, wird sie Stellen aus verschiedenen Briefen miteinander vergleichen, konfrontieren und zu einem sinnvollen Ganzen des Selbstbildes verbinden. Die Arbeit berücksichtigt dazu eher den Kotext als den Kontext, d. h., dass nicht sosehr von Bedeutung sei, unter welchen historischen oder persönlichen Umständen die Briefe geschrieben wurden, 37 Bürgel: Der Privatbrief, S.287 Overlack: Was geschieht im Brief?, S.28 39 vgl. u.a. Overlack: Was geschieht im Brief; Rudolf Käser: Die Schwierigkeit, ich zu sagen. 38 21 sondern vielmehr was sie selber besagen und was aus ihnen zu schließen wäre. Obwohl „der Sprecher zum Autor―40 wird, bleibt die Untersuchung aber noch immer gebunden an der interpretatorischen Suche nach einer intentio auctoris, denn die Intentionalität des Briefes kann sie nie ignorieren. Erst wenn sie ihn also wirklich nicht vernachlässigen kann, wird sie den biografischen Kontext einbeziehen. In allen anderen Fällen geht sie von dem Eigenwert des Briefes aus und richtet sie sich an dem Partikularen, dem Induktiven, wie Bürgel auch voraussetzt: „In diesem Sinn kann Briefanalyse den Aufstieg vom Besonderen zum Allgemeinen bedeuten, vom Individuum zu seinem sozioökonomischen Kontext―. 41 Auf den Dialog mit der übergreifenden „sozioökonomischen― Ebene geht diese Arbeit aber nicht ein, großenteils aus Raummangel, andererseits aber auch, um die ausgiebig dokumentierte Biografie der Komponisten unbedingt zu vermeiden. Ein zweite Schwäche vielleicht, ein extremes Experiment allerdings, aber an erster Stelle will diese Arbeit bloßlegen, was über das Selbstbild der Komponisten, und nicht ihr Leben, zu lernen sei. 1.3 Das Selbstbild im Brief Mit der Zentralstellung der Subjektivität und des Kotexts begibt sich diese Studie in den Bereich der Ego-Dokumente, die statt des Objektiv-makrohistorischen das Subjektivmikrohistorische beobachten. 42 Ursprünglich geprägt vom niederländischen Historiker Jacques Presser, der es als „those historical sources in which the user is confronted with an ‚I‗, or occasionally (Caesar, Henry Adams) a ‚he‗, continuously present in the text as the writing and describing subject―, 43 später als Texte, in denen „ein ego sich absichtlich oder unabsichtlich enthüllt oder verbirgt― 44 umschrieb, wurde der Begriff „EgoDokument― vor allem in der Geschichtswissenschaft aufgenommen und von Forschern wie Winfried Schulze oder Benigna von Krusenstjern ausgebreitet bzw. eingeschränkt.45 40 Ebd., S.31 Bürgel: Der Privatbrief, S.295 42 vgl. Rudolf Dekker: ―Introduction‖. In: Egodocuments and History. Autobiographical Writing in its Social Context since the Middle Ages. Ed. by Rudolf Dekker. Hilversum: Verloren 2002, S. 9, 11 43 Dekker: Introduction, S.7 44 Winfried Schulze: ―Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte? Vorüberlegungen für die Tagung ―EGO-DOKUMENTE‖. In: Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte. Hrsg. v. Winfried Schulze. Berlin: Akademie Verlag 1996, S.14 45 Schulzes Definition eines Ego-Dokuments lautet: ―Gemeinsames Kriterium aller Texte, die als EgoDokumente bezeichnet werden können, sollte es sein, daß Aussagen oder Aussagenpartikel vorliegen, die 41 22 Im Allgemeinen könnte man Ego-Dokumente verstehen als jene Texte, „die etwas über die (Selbst)Wahrnehmung und Darstellung des Ich verraten―46 und folglich den Blick des Individuell-Besonderen auf das Allgemein-Gesellschaftliche in sich mittragen. Die meist bevorzugte Gattung für die Erforschung von Ego-Dokumenten ist die Autobiografie, obwohl andere Textsorte, wie Tagebücher, Memoiren, Reisebericht und selbstverständlich auch Briefe, sich ebenfalls unter dem Terminus vereinen. 47 Als vor allem historische Quelle introduziert, erhebt sich hiernach die Frage, ob EgoDokumente auch über literaturwissenschaftliche Möglichkeiten verfügen. Obwohl kaum noch in einer umfassenden Studie betrachtet: ohne Zweifel. Schon Presser „had an eye and an ear for the literary aspects that play a more important role in egodocuments than in the official sources […]― 48 und grundsätzlich fand die Aufwertung von EgoDokumenten in den letzten Jahrzehnten „as an aspect of the cultural or linguistic turn in history―49 statt. Allmählich wuchs darüber hinaus die Feststellung, dass Ego-Dokumente auch immer eine fiktionale Seite besitzen und nicht ausschließlich wahrheitsgetreu die Wahrnehmung der Wirklichkeit darstellen. Und wo diese Erkenntnis „increasingly deterred historians, it started to attract literary critics― 50, weil man sich in dieser Weise auf der Schwelle zur Ich-Konstruktion, wie es Andreas Rutz benennt, befindet. Rutz stellt fest, dass sich „[b]ei näherer Betrachtung […] dieses Mehr and historischer Wahrheit oder Wahrhaftigkeit freilich als trügerisch [erweist]. […] vor allem für - wenn auch in rudimentärer und verdeckter Form - über die freiwillige oder erzwungene Selbstwahrnehmung eines Mensen in seiner Familie, seiner Gemeinde, seinem Land oder seiner sozialen Schicht Auskunft geben oder sein Verhältnis zu diesen Systemen und deren Veränderungen reflektieren. Sie sollten individuell-menschliches Verhalten rechtfertigen, Ängste offenbaren, Wissensbestände darlegen, Wertvorstellungen beleuchten, Lebenserfahrungen- und erwartungen widerspiegeln‖. (Schulze: Ego-Dokumente, S.28); Viele Forscher haben an diese Umschreibung Kritik geübt und Schulze vorgeworfen, seine Definition falle zu viel mit dem Begriff „Selbstzeugnis― zusammen. Vor allem Benigna von Krusenstjern hat beide Termini voneinander zu unterscheiden versucht, und verlagert die Intentionalität der Ich-Darstellung eher auf den Begriff „Selbstzeugnis― und sieht es als „selbst verfaßt, in der Regel auch selbst geschrieben (zumindest diktiert) sowie aus eigenem Antrieb, also ‚von sich aus‗, ‚von selbst‗ entstanden―. (vgl. Andreas Rutz: ―Ego-Dokument oder Ich-Konstruktion? Selbstzeugnisse als Quellen zur Erforschung des frühneuzeitlichen Menschen‖. In: Zeitenblicke 1 (2002), Nr. 2 [20.05.2011], URL: <http://wwww.zeitenblicke.historicum.net/2002/02/rutz/index.html>, S.3-4 (Absatz 6-7)) 46 Rutz: Ego-Dokument oder Ich-Konstruktion?, S.1 (Absatz 1) 47 vgl. Ebd.2 (Absatz 3) 48 Dekker: Introduction, S.8 49 Ebd., S.12 50 Ebd., S.12 23 retrospektiv angelegte Autobiografien und Memoiren […]―.51 Aber, so geht er weiter, „[a]uch erfahrungsnah im Alltag entstandene Quellen, wie zum Beispiel Briefe oder Tagebücher, dokumentieren nicht unmittelbar das ‚Ich‗ ihrer Verfasser, sondern sind ebenfalls von einer Vielzahl von Brechungen und Verfremdungen geprägt […] [wie der] Frage nach den jeweiligen Adressaten und den entsprechenden variierenden Selbstcharakterisierungen―. 52 Die „Lück[e] und [die] Auslassungen―, die aus dieser Fälschung des Ich entstehen, bilden den Kernpunkt von Rutz‗ Argumentierung: „Diese bewusst oder unbewusst unausgesprochenen, verdrängten oder versteckten Elemente eines das ich seines Verfassers reflektierenden Textes sind wesentlicher Bestandteil der Ich-Konstruktion und können unter Umständen mehr über den Autor, seine Selbstwahrnehmung sowie den Sinn und die Bedeutung seiner Selbstdarstellung verraten als der eigentliche Wortlaut des Textes―. 53 Problematisch ist allerdings, und vielleicht trifft das auf den ganzen Ausgangspunkt der Ego-Dokumente-Forschung schon ab Presser zu, wo man diese Trennung zwischen Absichtlichem und Unabsichtlichem zieht und wie man sie identifiziert, d. h. ab wann man genau über „unausgesprochen[e], verdrängt[e] oder versteckt[e] Elementen― sprechen kann. Eine Antwort darauf erwähnt weder Rutz noch die Ego-Dokumente-Forschung, die gerade auf das Objektiv-makrohistorische als Argumentmuster verzichten möchte, irgendwo vielleicht, weil sie nicht methodologisch zu erfassen sei. Gerade deshalb stellt diese Arbeit den von Rutz abgelehnten „Wortlaut des Textes― in den Mittelpunkt: Aus dem stilistischen und rhetorischen Vergleich mit anderen Briefen bezweckt sie in erster Linie, thematisch Selbstbilder aus den Briefen herauszukristallisieren und wird sie sich nur in beschränktem Maße mit der Zwitterstellung zwischen Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung befassen. Dass im Brief nämlich ein Ich vorhanden ist, wird in der Forschung allgemein anerkannt. Dazu beschränkt sie sich nicht bloß auf die generelle Tatsache, dass „[wer] Ich sagt oder schreibt […] einen Geltungsanspruch für seine Selbstdefinition [erhebt]―54, sondern richtet sie sich spezifischer auch darauf, dass „der Schreibende im Brief 51 Rutz: Ego-Dokument oder Ich-Konstruktion?, S.5 (Absatz 12) Ebd., S.5 (Absatz 12) 53 Ebd., S.7 (Absatz 15) 54 Käser: Die Schwierigkeit, ich zu sagen., S.X 52 24 [lebt]―55 und „Briefe […] einen besonders prägnanten Ausdruck des Selbst-Bewußtseins dar[stellen], d. h. sie müssen in ihrer Heterogenität doch immer auch etwas von der Identität der schreibenden Person spiegeln―. 56 Erstens ist ein Brief „intentional angelegt― 57 und besagt folglich, was das schreibende Ich erreichen vermöchte. Ihm gehören „Ordnungen, Ziele, Werte―,58 die der Brief zum Ausdruck bringt. Abgesehen von diesen „individuellen Wertorientierungen―, verstärkt die wesentlich dialogische Kommunikation des Briefschreibens die zweckhafte Pragmatik noch. Es gibt immer einen Bezug auf die Außenwelt, eine von Peter Bürgel beschriebene Dialektik zwischen Identität und Nichtidentität. 59 Gemäß seiner illokutionären Funktion 60 bezweckt der Brief nämlich nicht sosehr das Überzeugen des Selbst, sondern an erster Stelle des Anderen. In dieser Hinsicht ist das Selbstbild gewöhnlich keine explizite oder primäre Erscheinung im Schreiben; es bildet vielmehr eine zwischen den Regeln vorhandene Ebene, einen Nebeneffekt, den Overlacks Beschreibung, „Briefe transportieren Bilder vom Ich―,61 treffend veranschaulicht. 1.4 Fazit Diese Arbeit erhebt die Frage, inwieweit der Verfasser im Brief kein Gespräch, sondern ein Selbstgespräch führt. Dabei möchte sie das literaturwissenschaftliche Potenzial des Briefes, die sie als eine literarische Quelle sieht und im Rahmen der intentio auctoris, jedoch bar allzu großer Kontextualisierung interpretiert, aufwerten und ihn aus dem Bereich des beliebigen, biografischen Zitierens führen. Es wird sich als unabdingbar erweisen, trotzdem auf biografische Daten und Studien zu Beethoven und Schubert zu verweisen, aber diese Angaben dienen vor allem dazu, die Differenz zum hier 55 Overlack: Was geschieht im Brief?, S.29 Bürgel: Der Privatbrief, S.283 57 Ebd., S.284 58 Ebd., S.284 59 Laut Bürgel ist die Dimension der Identität im Brief subjekt- oder personenbezogen und die der Nichtidentität objekt- oder gesellschaftsbezogen (vgl. Ebd., S.284). Diese Studie möchte sich demnach nur an die erste Seite richten. 60 vgl. Inger Rosengren: „Die Textstruktur als Ergebnis strategischer Überlegungen des Senders―. In: Sprache und Pragmatik. Lunder Symposium 1982. Hrsg. v. Inger Rosengren. Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1983, S.157-191; Wolfdietrich Hartung: „Briefstrategien und Briefstrukturen - oder: Warum schreibt man Briefe?―. In: Sprache und Pragmatik, S.215-228. 61 vgl. Overlack: Was geschieht im Brief?, S.181 56 25 verwendeten, textanalytisch geprägten Verständnis von Selbstbild zu markieren. Denn die Neigung, Einzelstellen als Argument für Gesamtfolgerungen zum Leben des Autors zu verwenden, ist oft zu entscheidend und zudem irreführend. 62 Wie Rutz schon bemerkt, täuscht uns der Verfasser nämlich auch (un)absichtlich. Im Gegensatz zu seinem stark geschichtswissenschaftlicher Methodologie aber, möchte diese Studie die einzelnen Briefe selber sprechen lassen und erzielt sie nicht die Identifikation, sondern an erster Stelle die „Funktion der Selbstästhetisierung des Autors―63 zu erforschen. Als Ausgangspunkt setzt sie die Individualität jedes Briefes und seinen reflexiven Charakter voraus. Denn am Ende bleibt der Brief eine Gattung des zeitlichen Abstands zwischen Gedanke und Wort. Er ist ein Produkt der Überlegung, und wo man sich überlegt, dort gibt es Wahl - und deren Interpretation ist unser. Diese Untersuchung versteht sich als ein Experiment über die literarischen Möglichkeiten der Briefforschung. Sie will das zwischen den Regeln vorhandene Selbstbild von Beethoven und Schubert textimmanent mittels sprachlicher, rhetorischer, stilistischer und stellevergleichender Analyse im Rahmen festgelegter Themen ausgraben. Dazu geht es ihr nicht um endgültige Aussagen, sondern vielmehr um die Prüfung dieser Methodologie und die Anregung neuer Studien. Einen Anspruch auf die Gesamtheit eines Selbstbildes erhebt diese Untersuchung also in keinem Fall, da letztendlich „der Briefautor als menschliches Subjekt nie total gedeutet werden kann―. 64 1.5 Quellen Zum Schluss soll noch Einiges in Bezug auf die in dieser Arbeit verwendeten Briefeditionen und sekundären Quellen bemerkt werden. Die rezenteste Herausgabe von Beethovens Briefwechsel ist die des Beethoven-Hauses Bonn. 65 Vor allem aus logistischen Gründen macht diese Untersuchung aber von der Edition Kastner/Kapp66 aus dem Jahre 1975 Gebrauch. Sie ist jetzt zwar nicht die meist Vollständige mehr, aber 62 vgl. Bürgel: Der Privatbrief, S.294, Käser: Die Schwierigkeit, ich zu sagen., S.XII-XIII Ebd., S.XII 64 Bürgel: Der Privatbrief, S.285 65 Ludwig van Beethoven: Briefwechsel Gesamtausgabe. Im Auftrag des Beethoven-Hauses Bonn hrsg. von Sieghard Brandenburg. 7 Bände. München: Henle Verlag 1996/1998. 66 Ludwig van Beethovens Sämtliche Briefe. Hrsg. v. Emerich Kastner. Nachdruck der völlig umgearbeiteten und wesentlich vermehrten Neuausgabe von Dr. Julius Kapp (Unveränderter Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1923). Tutzing: Hans Schneider Verlag 1975 63 26 galt bevor der Ausgabe des Beethoven-Hauses als „the most comprehensive compilation to have appeared in German so far―. 67 Diese Briefedition ist ein Nachdruck von Julius Kapps Fassung, der 1923 Emerich Kastners aus 1910 durchsah, korrigierte und erweiterte. Sie ist wohl keine kritische Ausgabe der Briefe, dennoch reicht sie für die Zielsetzungen dieser Arbeit, die nicht ausgeht vom philologischen, sondern vom literarischen Wert dieser Briefe. Dass die Kastner/Kapp Edition keine Vollständigkeit in Anspruch nehmen kann, ist folglich weniger von Bedeutung, weil sich diese Arbeit aus Gründen des Raums sowieso auf einer Auswahl beschränken soll. Da die Briefe nummeriert sind, wird bei Zitaten auf sie mit ihrer Nummer, und nicht der Seite verwiesen. Die hier verwendeten Briefe Schuberts kommen aus der berühmten Sammlung von Otto Erich Deutsch, 68 die trotz ihres Datums bis heute noch immer die meist erschöpfende ist. Im Laufe der Jahre sind in verschiedenen Zeitschriften allmählich noch neue Briefe von Schubert aufgetaucht,69 die die Untersuchung aber nicht in ihre Analyse einbeziehen wird, hauptsächlich weil sie zu sporadisch und individuell erscheinen, um konsequent eingesetzt zu werden. Im Allgemeinen umfasst das gesamte Corpus von Schuberts Briefen viel weniger Material als den Nachlass Beethovens. Das lässt sich nicht eindeutig begründen. Vermutlich ist hier Schuberts frühes Sterbedatum (im Alter von 31 Jahren) mit im Spiel. Auch genoss er zu Lebzeiten nicht die Berühmtheit, die Beethoven beanspruchen könnte, wodurch seine Dokumente eher im Familien- und Freundeskreis blieben und nicht durch Verleger aufgekauft und versammelt wurden (wie bei Beethoven). In jedem Fall sieht sich diese Arbeit dadurch mit geringerem Spielraum konfrontiert. Wo die Analyse für Beethoven also über die Freiheit der Reduktion verfügt, soll sie in Bezug auf Schuberts Briefen sparsamer vorgehen. Trotz dieser Gedrängtheit wird die Untersuchung dennoch so präzise wie möglich den roten Faden in den Briefen bloßlegen. Sie kann allerdings nur den Anspruch auf das Tendenzielle und Allgemeine erheben. 67 Alan Tyson: ―Prolegomena to a Future Edition of Beethoven‘s Letters‖. In: Beethoven Studies 2. Edited by Alan Tyson. London: Oxford University Press 1977, S.2 68 Schubert: Die Dokumente seines Lebens. Gesammelt und erläutert v. Otto Erich Deutsch. Mit einem Geleitwort v. Peter Gülke (Erweiterter Nachdruck der 2. Auflage Leipzig 1980). Leipzig: Deutscher Verlag für Musik 1996. 69 vgl. z. B. Ernst Hilmar: ―Der neue Schubert-Brief‖. In: Schubert durch die Brille 23 (1999), S.44-45; Reinhard Van Hoorickx: ―An Unknown Schubert Letter‖. In: The Musical Times, Vol. 122, No. 1659 (May, 1981), S.291-294. 27 Schließlich ist eine kurze Verantwortung der sekundären Quellen noch angemessen. Wegen des methodologischen, aber sicher thematischen Neuigkeitswerts hat diese Studie sich kaum auseinandersetzen können mit Quellen, die auf den gleichen Gegenstand Bezug nehmen. Im kritischen Apparat hat sie trotzdem versucht, so viel als möglich, Forschungsergebnisse, die eine relevante Erweiterung oder Gegensatz liefern, einzubeziehen. Was sie aber ganz vermieden hat, ist das Zitieren biografischer Werke, weil sie den methodologischen Grundsatz dieser Arbeit durchbrechen wurden. Zum Schluss könnte an manchen Stellen der Anschein erweckt werden, dass es ein Übermaß an englischen Quellen gibt. Das hat sicherlich mit der starken Anwesenheit der angelsächsischen Forschung in Internetquellen wie JSTOR oder Google Books zu tun. Auch die wissenschaftliche Rezeption von Schubert, aber hauptsächlich von Beethoven (man denke an die berühmte, wissenschaftlich bahnbrechende Beethoven-Biografie von Alexander Wheelock Thayer 70 oder an den prominenten Forscher Maynard Solomon, der vor einigen Jahren Beethovens Tagebuch beim Beethoven-Haus redirigiert und herausgegeben hat) 71 in der englischsprachigen Welt spielt hier eine Rolle. Wenn vorhanden, hat die Untersuchung aber immer deutschsprachige Quellen bevorzugt und verwendet. 70 Thayer’s Life of Beethoven. Revised and edited by Elliot Forbes. Princeton (N.J.): Princeton university press 1970. 71 Ludwig van Beethoven/Maynard Solomon: Beethovens Tagebuch 1812-1818. Bonn: Beethoven Haus 2005. 28 2. Künstlertum Dieses Kapitel wird sich mit der Frage, wie Beethoven und Schubert ihr Künstlertum betrachten und bewerten, auseinandersetzen. Dazu werden die Ansichten der Komponisten bezüglich ihres Kunstschaffens zuerst getrennt betrachtet und aufgrund ihrer Positionierung des Künstlerseins überprüft. Erst nachdem die Untersuchung ihre Analyse für Jeden zu einem Schluss gebracht hat, wird sie beide Selbstbilder miteinander konfrontieren und nachprüfen, wo sich die Ähnlichkeiten oder aber Unterschiede situieren und wie sich diese deuten lassen. 2.1 Beethoven 2.1.1. Die Dienerschaft zum Höheren Die erste Frage, die sich in Bezug auf Beethovens Künstlertum stellen lässt, beschäftigt sich damit, wie er seine Kunstprodukte sieht, d. h., in welche Beziehung er sich zu ihnen hineindenkt. In dieser Hinsicht fällt auf, dass Beethoven sich in seinen Briefen immer einer höheren Autorität, sei es den Musen, Gott, oder der Kunst selber, unterstellt und er sich folglich gewöhnlich in eine passive Position der Niedrigkeit, sogar Abhängigkeit versetzt. Das bringen viele metaphorischen Transformationen zum Ausdruck, z. B. er sei „von den Musen― 72 oder vom „Himmel―73 abhängig. Was diese Abhängigkeit aber präzise beinhaltet, ist den Briefen nicht genau zu entnehmen. Sie könnte im Sinne eines Zugangs zu einer Inspirationsquelle aufgefasst werden, aber soll vielleicht nicht zu konkret verstanden werden. In jedem Fall erschafft sie eine Hierarchie, in der Beethoven sich als Diener der Kunst betrachtet. Diese Vorstellung bleibt während seines ganzen Lebens ein entscheidendes, nicht ganz von zeitgeistlichen 72 Beethoven an Karl Holz, 26. April 1826 (Ludwig van Beethovens Sämtliche Briefe. Hrsg. v. Emerich Kastner. Nachdruck der völlig umgearbeiteten und wesentlich vermehrten Neuausgabe von Dr. Julius Kapp (Unveränderter Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1923). Tutzing: Hans Schneider Verlag 1975 [ab jetzt abgekürzt mit BSB], Brief 1384: Holz) 73 Beethoven an Ferdinand Ries, 5. September 1823 (BSB, Brief 1165) 29 Impulsen 74 getrenntes Leitbild für seine Selbstauffassung als Künstler. 75 Nie ist Beethoven Alleinherrscher über seine Kunst, nie ist sie überhaupt seine Kunst. Damit könnte der Kern seines Künstlertums erklärt sein. Trotzdem erhebt sich dann die Frage, welche Rolle Beethoven noch für den Künstler selber übrig sieht. Es wäre ein Irrtum zu behaupten, dass er sich im Schaffensprozess völlig hintansetzt und sich jeder künstlerischen Verantwortung entzieht. Abhängigkeit besagt noch keine Unfreiheit. Gerade deshalb soll dieses höhere Abstraktum, dem Beethoven sich unterordnet, nicht als eine bloße Metapher der Inspiration gesehen werden. Es umrahmt vielmehr einen Spielraum, in dem sich der Einfluss, die Autonomie des Künstlers geltend macht. Das Begriffspaar „Kunst-Künstler― soll folglich nicht im Sinne ihres dialektischen Zusammenhangs Schöpfung - Schöpfer verstanden werden, sondern eher als zwei Extreme des konzeptuellen Übergewichts bei der Kunstschöpfung: Einerseits befolgt Beethoven das Auferlegte, andererseits markiert er ein eigenes Programm. Dieser Gegensatz soll aber in keinem Fall auf den Kontrast zwischen Tradition und Neuerung reduziert werden, da sich eine solche Trennung in Bezug auf Beethoven kaum als produktiv erweist. 76 Vielmehr drückt er den Grad an Einmischung, an Selbstständigkeit im künstlerischen Schaffensprozess, den Beethoven sich selber zumisst, aus, d. h., welche Bedeutung er noch für sich vorbehält. Wird in der nachstehenden Analyse also einen allzu personifizierenden Gegensatz zwischen Kunst 74 Diese Vorstellung ist tatsächlich eine übliche in der Frühromantik. Marcuse sagt dazu Folgendes: ―Aus dem romantischen Lebensgefühl ergab sich notwendig die der Goetheschen entgegengesetzte Lösung des Künstlerproblems, - die metaphysische Steigerung des Künstlertums und seiner Sendung: der Künstler ist ―transscendental‖ [sic], sein Reich ist nicht von dieser Welt, seine Lebensform keine Irdische‖. (Herbert Marcuse: Der deutsche Künstlerroman, Frühe Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1978, S.121). Soweit geht es aber bei Beethoven nicht. Wie sich später erweisen wird, findet Beethoven sich nicht ohne Weiteres mit einer willenlosen Unterwerfung ab, sondern sucht er auch eine eigene Freiheit in dieser ―transscendentale[n]‖ Gebundenheit. 75 vgl. Beethoven an Karl van Beethoven, 16. August 1823 (BSB, Brief 1157): ―Du kannst denken, wie ich herumlaufe, denn erst heute fing ich eigentlich (uneigentlich ist es ohnehin unwillkürlich) meinen Musendienst wieder an; […]‖. 76 Vgl. dazu Rexroths Betrachtungen: ―Nie hat Beethoven die Gültigkeit der musikalischen Tradition, wie sich ihm im Werk von Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart darstellte, in Frage gestellt, im Gegenteil: Er hat sich immer wieder auf diese Tradition bezogen. Doch er hat alle Elemente, alle kompositorischen Verfahren, aber auch alle ästhetischen Prinzipien und Aspekte dieser Tradition neu und anders beleuchtet, hat sie verändert und mit ihnen experimentiert; und er hat dabei diese operativen Verfahren seinem Willen und seinen ideellen Zielsetzungen unterstellt und nutzbar gemacht. (Dieter Rexroth: Beethovens Symphonien: ein musikalischer Werkführer. München: C. H. Beck Verlag 2005, S.33) 30 und Künstler erzeugt, so soll dieser vielmehr als ein Wechselspiel zwischen konzeptueller Gebundenheit bzw. Freiheit verstanden werden. Damit will sich die Analyse weder über Beethovens Kunst an sich, noch über den erneuenden Charakter seiner Werke aussprechen. Anhand des Kontrasts bezweckt sie vielmehr, einen unterstützenden Rahmen für Beethovens Selbstbild über seine Rolle im Schaffensprozess zu gestalten. 2.1.2 Künstlertum als Frage der kreativen Autonomie Der vermutlich wohl bekannteste Aspekt in Bezug auf Beethovens Künstlertum ist das 1802 geschriebene Heiligenstädter Testament, ein Dokument an seine Brüder, in dem er seinen existenziellen Zweifeln und Ängstlichkeiten infolge des Verlusts seines Gehörs Ausdruck verleiht. Trotz des schwermütigen Tons, zeugt der Text aber zugleich auch von Beethovens stoischer Akzeptanz des Schicksals und teilt er der Kunst einen zentralen Stellenwert zu: [S]olche Ereignisses brachten mich nahe an Verzweiflung, es fehlte wenig, und ich endigte selbst mein Leben. - Nur sie, die Kunst, sie hielt mich zurück, ach es dünkte mir unmöglich, die Welt eher zu verlassen, bis ich das alles hervorgebracht, wozu ich mich angelegt fühlte, und so fristete ich dieses elende Leben […] - So wär‘s geschehen - mit Freuden eil‗ ich dem Tode entgegen; - kömmt er früher als ich Gelegenheit gehabt habe, noch alle meine Kunstfähigkeiten zu entfalten, so wird er mir trotz meinem harten Schicksal doch noch zu frühe kommen, und ich würde ihn wohl später wünschen. - Doch auch dann bin ich zufrieden, befreit er mich nicht von einem endlosen leidenden Zustande? - Komm, wann du willst, ich gehe dir mutig entgegen. 77 Obwohl die sowohl inhaltlichen als auch stilistischen Ähnlichkeiten des Testaments zu literarischen Vorbildern einer genaueren Nachforschung wert sind, lohnt es sich in Bezug auf Beethovens Selbstbild als Künstler vielmehr, den ideologischen Grundideen nachzugehen. entelechischen 77 Der Leitgedanke dieses Bewusstsein Abschnitts entstammt Beethovens. Die fast zu deutlich einem Freitod führende Testament für meine Brüder Carl und [Lücke] Beethoven, 6. Okt. 1802 (BSB, Brief 63); Obwohl diese Studie nicht näher auf die literarischen Merkwürdigkeiten des Testaments eingehen kann, sollen dennoch kurz einige Besonderheiten gestreift werden. So ist es an sich schon eigenartig, dass Beethoven sein Testament schon zu Lebzeiten veröffentlicht. Zudem enthält das Dokument keine Verfügungen über was nach seinem Tode passieren soll, sondern stellt er gerade eine Lebenserklärung dar. Schließlich redet Beethoven in der Überschrift seine zwei Brüder an, aber richtet er den Brief im Grunde deutlich an die ganze Menschheit (daher der etwas dramatische Anfang des Textes: „O ihr Menschen―). 31 „Verzweiflung― findet ihre Gegenstimme in der „Kunst―, die nicht sosehr erschaffen wird, sondern ihn schon vorhanden, „angelegt― erscheint. Das vor allem romantisch geprägte Bild der Kunst als freie Äußerung des inspirierten Moments räumt hier deutlich einer mehr teleologischen Kunstauffassung, die eher von „an instrumentalist view of inspiration―78 zeugt, das Feld. Als wäre er ein Gefäß, durchquert die Kunst den Künstler. Beethovens Entwicklung ist nicht in einem langwierigen Bildungsprozess begriffen; er „entfaltet― seine „Kunstfähigkeiten― und arbeitet seinem innewohnenden Potenzial vielmehr zu. Dieses Verständnis beeinflusst außerdem auch die Hierarchie zwischen Schöpfer und Schöpfung. Zwar sind beide eng miteinander verflochten und gibt es eine weitgehende Interdependenz zwischen ihnen, jedoch setzt sie auch eine Passivität vonseiten des Schaffenden voraus. Der Künstler macht sich nicht die Kunst unterwürfig; er soll sich ihr gerade ergeben und ihr folgen, seiner Selbstständigkeit entsagen. Diese aktive Rolle der Kunst im Schaffensprozess erklärt auch ihre energische Bedeutsamkeit und Personifizierung im Text („die Kunst, sie hielt mich zurück―). Beethoven dagegen behält sich eine rein passive Funktion im Schaffensprozess vor. Die Kreativität gerät durch das Verständnis der Entelechie ins künstlerische Hintertreffen; der freie Wille des Künstlers wird ihrer Freiheit völlig entraubt und richtet sich nur auf das Auferlegte, das schon vorher Bestimmte. Obwohl das Heiligenstädter Testament in einer Periode großer Emotionalität geschrieben wurde, bleibt das dort entwickelte Bild des Auferlegten immer anwesend. Die stoische Hinnahme des Schicksals eines Erbitternden, deren Höhepunkt sich im Testament findet, begegnet allmählich aber auch einem Widerstand, einer Aufwertung des künstlerischen Individuums in Form eines vorgezeichneten Programms, das sich Beethoven selber zum Ziel setzt: Alles, was Leben heißt, sei der Erhabenen [sic] geopfert und ein Heiligtum der Kunst! Laß mich leben, sei es auch mit Hilfsmitteln; wenn sie sich nur finden. Die 78 W. Bronzwaer: „Igor Stravinsky and T. S. Eliot: A comparison of their Modernist poetics―. In: Comparative Criticism: Volume 4, The Language of the Arts. Edited by E. S. Shaffer. Cambridge: University Press 1982, S.180; vgl. auch: „In their rejection of the Romantic essentialistic conception of inspiration, the traditionalism of Eliot and Stravinsky reveals its Classical orientation very clearly. […] To Eliot, who follows the neo-scholastic thinking of Maritain, inspiration is always directed at the realization of a form which the artist feels inside him, rather than at the expression of emotion. […] Stravinsky described inspiration in similar terms. To him, inspiration is not the prime force or urge that brings the work of art into being, but merely the psychological reaction of the artist who is struggling with the object of his creation that must become a work― (Ebd., S.180) 32 Ohrenmaschinen womöglich zur Reife bringen, alsdann reisen. Dieses bist du dir, den Menschen und ihm, dem Allmächtigen, schuldig. Nur so kannst du noch einmal alles entwickeln, was in dir verschlossen bleiben muß. - Ein kleiner Hof - eine kleine Kapelle - - von mir in ihr der Gesang geschrieben, angeführt zur Ehre des Allmächtigen, des Ewigen, Unendlichen. So mögen die letzten Tage verfließen - - - und der künftigen Menschheit. Händel, Bach, Gluck, Mozart, Haydns Porträte in meinem Zimmer - - sie können mir auf Duldung Anspruch machen helfen.79 Beethoven setzt sich in dieser Tagebuchnotiz auf den ersten Blick fast völlig hintan. An erster Stelle tritt der Gedanke der Dienerschaft deutlich zutage. Sein Leben soll im Zeichen der Aufopferung stehen. Außerdem greift er auch die Anschauung seiner künstlerischen Entfaltung als eines entelechischen Prozess wieder auf („alles entwickeln, was in dir verschlossen bleiben muß―). Diese Unterordnung steigert sich explizit zu einer Lage der Abhängigkeit. Hat Beethovens spirituelle Berufung nämlich die Widmung einem höheren Zweck vor, so soll er sich zu dessen Erfüllung in der profanen Realität von „Hilfsmitteln― bedienen. Dieser Gegensatz zwischen Instrument und Ziel kehrt etwas später in einer übergreifenderen Form zurück. Während Beethovens „letzt[e] Tage verfließen― und sein in den Dienst „der Erhabenen― gestelltes Leben folglich vergänglich ist, bezweckt seine Kunst gerade die „Ehre […] des Ewigen, Unendlichen― und „der künftigen Menschheit―. Die dialektische Beziehung zwischen Vergänglichkeit und Ewigkeit konkretisiert sich zudem in den „Porträte[n]― großer Komponisten, die ihn aus ihrer auf Unvergänglichkeit angelegten Form des Gemäldes zu „Duldung― in seinem irdischen Leben anspornen. Beethovens passive Unterordnung kommt zudem nicht nur inhaltlich, sondern auch durch die narrative Form seines Skizzenblatts zum Ausdruck. An keiner einzigen Stelle tritt das „Ich― nämlich als Subjekt zutage. In den ersten fünf Sätzen des Entwurfs steigert der Ton des lyrischen Ichs die thematische Ergebenheit: Einerseits kreiert er mit den Befehlsformen eine hierarchische Situation des Gehorsams, andererseits trennt die Anrede in der zweiten Person das „Ich― von dem „Du― ab, was noch dadurch bekräftigt wird, dass das „Du― zum Teil des künstlichen Zwecks wird („Dieses bist du dir […] schuldig―). In der 79 Auf Skizzenblättern, 1815 (BSB, Dokument 506); Wie in der Einführung gesagt, wird diese Untersuchung nur in seltenen Fällen die Tagebucheinträge Beethovens und Schuberts heranziehen, und nur dann, wenn sich das Selbstbild ähnlich als im Brief herauskristallisiert, und sich folglich ableiten lässt, dass es sich nicht nur im Dialog mit Anderen vormacht (und so eher den Gedankengang von Annäherung an die Erwartungen der Gesellschaft, zumindest des Adressaten eröffne), sondern sich auch in den Monolog des Tagebuchs durchsetzt (obwohl der Grad an wahrhafter Introspektion nicht übertrieben werden soll, und man immer vor fälschender Selbstdarstellung auf der Hut sein muss). 33 zweiten Hälfte des Dokuments findet zwar eine Rückwendung auf die erste Person statt, dennoch erscheint diese nie als Subjekt des Satzes, sondern erst in sekundärer Position als dessen Objekt („von mir―; „in meinem Zimmer―; „mir―). Obwohl Beethoven sich sowohl inhaltlich als auch sprachlich in den Hintergrund stellt, heißt das schließlich aber nicht, dass er der Kunst freie Hand lässt. Dieser Tagebucheintrag ist keine bloß umformulierte Fortsetzung des Heiligenstädter Testaments; sie weist schon die ersten Spuren einer Programmatik, nach der sich Beethovens Kunst ihrerseits richten soll, auf: „Die Ohrenmaschinen womöglich zur Reife bringen, alsdann reisen. […] Ein kleiner Hof - - eine kleine Kapelle - - von mir in ihr der Gesang geschrieben […] So mögen die letzten Tage verfließen […]―. Beethoven sieht seine Fähigkeiten zwar als ein innewohnendes Potenzial, dennoch schafft er Rahmenbedingungen, durch die diese in ihm enthaltene Anlage zum Ausdruck kommen kann: „Nur so kannst du noch einmal alles entwickeln, was in dir verschlossen bleiben muß― (eigene Hervorhebungen). Beethoven schafft nicht länger nur dasjenige, zu dem er sich durch die Kunst befähigt glaubt; indem er sie jetzt selber auch in ein eigenes Programm einordnet, macht er den ersten Schritt, ein neues Gleichgewicht zwischen Kunst und Künstler zu ertrotzen. Dieses neu erworbene Bewusstsein steigert und konkretisiert sich in den darauf folgenden Jahren im Sinne eines deutlich umrissenen, musikalischen Projekts. Am konkretesten tritt das zukunftsgerichtete Programm 1822 in einem Brief an den Verleger Peters zutage: „Ich würde die ganze Herausgabe in zwei, auch möglich in ein oder anderthalb Jahren mit den nötigen Hilfsleistungen besorgen, ganz redigieren und zu jeder Gattung ein neues Werk liefern, z. B. zu den Variationen ein neues Werk Variationen, zu den Sonaten ein neues Werk Sonaten und so fort zu jeder Art, worin ich etwas geliefert habe, ein neues Werk […]―. 80 Im Vergleich zu den vorigen Dokumenten erfolgt in diesem Brief sowohl sprachlich als auch inhaltlich eine weitgehende Umwandlung der künstlerischen Verhältnisse. Jetzt steht deutlich ein „Ich― im Mittelpunkt, das die Handlungen ausführt und dem als Subjekt die folgenden Sätze untergeordnet sind. Darüber hinaus verweilen diese geplanten Leistungen nicht länger in einer unsicheren, weil nur durch den Tod bestimmte Zukunft (siehe oben: „So mögen die letzten Tage verfließen―), sondern grenzt Beethoven jetzt selbst den zeitlichen Rahmen deutlich ab: „in ein oder anderthalb Jahren―. Hinter der vorausgesetzten 80 Beethoven an C. F. Peters, 5. Juni 1822 (BSB, Brief 1019) 34 Programmatik steckt zwar noch ein teleologischer Hintergedanke, die entelechische Kunstannäherung ist aber verschwunden. Die Kunst verwandelt sich von der Äußerung eines innehabenden Potenzials in ein bearbeitetes Produkt, das „geliefert― wurde. Dass jedes Werk keinem schon im Voraus vorgezeichneten Modell mehr entspricht, bekundet auch die Idee der Neuerung. Das Leitbild des „neu[en] Werk[s]― durchdringt den Brief und weist darauf, dass die künstlerische Schöpfung den Hauch des schon Bestimmten, des Auferlegten nicht länger in sich mitträgt, sondern sich gerade an das Erstmalige orientiert.81 Der bisher vielleicht erzeugte Anschein, Beethoven habe sich linear vom selbstlosen Diener der Kunst zu deren absolutem Gebieter entwickelt, soll an dieser Stelle jedoch nuanciert werden. Vielmehr ergibt es sich ein Wechselspiel, eine Frage, bei wem - Kunst oder Künstler - sich der Schwerpunkt der Kunstschöpfung befindet, d. h. welchen Anteil Beethoven sich selbst im Schaffensprozess zuteilt: Wendet das Ziel seiner Kunst sich zurück auf ihre Quelle, 82 oder dient es einem eigenen Programm? Anders gesagt: Meint Beethoven, er lasse sich als Künstler durch ein schon vorausgesetztes Musterbild 83 führen oder er eigne sich eher einer ideellen Freiheit zu,84 81 Diese Besorgtheit soll nicht als ein plötzlich einsetzendes Phänomen betrachtet werden. Beethoven war sowohl nachdem als auch zuvor noch stark mit der Idee des Neuen in seinen Werken beschäftigt, vgl. „In Erwiderung Ihres Geehrten vom 15. April melde ich Ihnen, daß Herr Graf Brühl, so günstig er sich übrigens über das Gedicht Melusine von H. Grillparzer geäußert hat, doch aus dem Grunde eine andere Wahl von meiner Seite wünscht, weil obbenannte Oper mit der Undine des Baron de la Motte-Fouqué einige Ähnlichkeit hat― (Beethoven an A. W. Schlesinger, 31. Mai 1826 (BSB, Brief 1388)); „Gestern Abend erhielt ich meine Variationen, sie waren mir wahrhaftig ganz fremd geworden und das freut mich: es ist mir ein Beweis, daß meine Komposition nicht ganz alltäglich ist― (Beethoven an Karl Boldrini (unsicher), 1819, (BSB, Brief 909)). Vor allem diese letzte Aussage ist sehr auffallend und mutet beinahe avantgardistisch an: Das sogar im Auge des Schaffenden Fremde bezeugt das Neue, den erfrischenden Charakter des Werkes. 82 Das soll aber nicht heißen, dass Beethoven mit seiner Musik ein Plädoyer für l’art pour l’art formulieren will, obwohl man es, wenn man will, auch den Briefen entnehmen könnte:―Je suis habitué à faire des sacrifices, la composition de mes œuvres n‘étant pas faite seulement au point de vue du rapport des honoraires, mais surtout dans l‘intention d‘en tirer quelque chose de bon pour l‘art.‖ (Beethoven an Schlesinger, (BSB, Brief 977)); ―- Sie würden an mir den gerechten Schätzer meines lieben Schülers, nunmehrigen großen Meister, finden, und wer weiß, was noch anderes Gutes für die Kunst entstehen würde in Vereinigung mit Ihnen!‖ (Beethoven an Ferdinand Ries, 6. April 1822 (BSB, Brief 1016)); ―Es war für mich eine Herkulesarbeit, Gott gebe nur, daß ich nur meiner Kunst mich wieder ganz widmen kann.‖ (Beethoven an Nanette Streicher, 1818 (BSB, Brief 854)). 83 vgl. „Apollo und die Musen werden mich noch nicht dem Knochenmann überliefern lassen, denn noch so vieles bin ich ihnen schuldig und muß ich vor meinem Abgang in die Elysiäischen Felder hinterlassen, was mir der Geist eingibt und heißt vollenden [sic]. Ist es mir doch, als hätte ich kaum einige Noten geschrieben.‖ (Beethoven an B. Schotts Söhne, 17. September 1824 (BSB, Brief 1239)); „- Denken Sie 35 d. h., sieht er sein Werk als „Invention― bzw. eigene „Inspiration―? 85 Die Antwort lässt sich nicht eindeutig konkretisieren (und darf es vielleicht auch nicht). In jedem Fall lässt sich Beethovens inneres Spannungsfeld auch auf eine breitere, gesellschaftliche Ebene verlagern: „Der Künstler ist auf sich gestellt, malt ein Bild um seiner selbst willen, nur seinem Gewissen und Genius, seiner Idee der Kunst verpflichtet. Künstler und Kunst werden, so auf sich gestellt, unruhig, unsicher und entdeckerisch zugleich―. 86 Die skizzierten Möglichkeiten, nach denen Beethoven seine Rolle im Schöpfungsvorgang gestaltet, sollen in dieser Hinsicht nicht als zwei voneinander abgetrennte Entwicklungsphasen, sondern vielmehr in ihrer dialektischen Beziehung betrachtet werden: Beethoven entfernt sich vom strengen Ideal, das er sich, von seiner Krankheit geplagt, im Heiligenstädter Testament setzte und räumt dieses zwar bewundernswerte, jedoch unrealistische Modell einer pragmatischeren Erkenntnis das Feld, wie es in diesem Brief aus dem Jahre 1825 zum Ausdruck kommt: Glauben Sie mir, daß mir das Höchste ist, daß meine Kunst bei den edelsten und gebildetsten Menschen Eingang findet, leider wird man von dem Überirdischen der Kunst nur allzu unsanft in die (das?) irdische Menschliche hinabgezogen, allein sind es gerade nicht diejenigen, welche uns angehören, und ohne eigentlich Schätze anhäufen zu wollen oder können, müssen wir doch Sorge tragen, daß sie unser Andenken segnen, da wir nun einmal keine Großtürken sind, die bekanntlich das Wohl der Ihrigen der bloßen Zukunft und Gott anheimstellen. 87 übrigens ja kein Interesse von mir irgendwo, was ich suchte; frei bin ich von aller kleinlichen Eitelkeit; nur die göttliche Kunst, nur in ihr sind die Hebel, die mir Kraft geben, den himmlischen Musen den besten Teil meines Lebens zu opfern.― (Beethoven an Hans G. Nägeli, 9. September 1824 (BSB, Brief 1236)). 84 vgl. ―- Vieles, vieles muß ich jetzt ertragen, doch es entspringt alles aus dem Guten, was ich zum Teil vollbracht und noch vollbringen will.‖ (Beethoven an Karl Holz (?), 1825 (BSB, Brief 1374)); ―Es heißt übrigens bei mir immer; Nulla dies sine linea, und lasse ich die Muse schlafen, so geschieht es nur, damit sie desto kräftiger erwache. Ich hoffe, noch einige große Werke zur Welt zu bringen und dann wie ein altes Kind irgendwo unter guten Menschen meine irdische Laufbahn zu beschließen.‖ (Beethoven an Dr. Franz Wegeler, 7. Oktober 1826 (BSB, Brief 1436)). 85 Dieses Begriffspaar geht auf einen Unterschied Stravinskis zurück: ―He distinguishes between ‗imagination‘ and ‗invention‘, which is ‗imagination créatrice‘. ‗Invention‘ implies both ‗trouvaille‘ and ‗réalisation‘ in the concrete work. Inspiration is therefore instrumental to invention; it implies an understanding or grasping of the work-to-be-achieved, not a frenzy the urges the artist to express his feelings (vgl. W. Bronzwaer: Igor Stravinsky and T. S. Eliot, S.180) 86 Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte: Arbeitswelt und Bürgergeist, Band 1. München: C. H. Beck 1990, S.695 87 Beethoven an Fürsten Nikolaus Galitzin, 1825 (BSB, Brief 1317); Rücksicht soll man darauf geben, dass dieser Brief an den russischen Adligen Goliyzin, der Beethoven drei Jahre vorher um die Komposition der bis auf heute den Namen „Galitzin― tragenden Streichquartette Es-Dur op. 127, B-Dur op. 130 und a-Moll op. 132 gebeten hatte, gerichtet war. Diesbezüglich soll der aristokratisch anmutende 36 Auffallend in diesem Brief ist, dass, obwohl es keinem Zweifel unterliegt, dass Beethoven mit seiner Kunst „das Höchste― anstrebt, er trotzdem die „unsanft[e]― Ernüchterung, selber auf die Grenzen zwischen Ideal und Realität zu stoßen, gesteht. An erster Stelle verfehlt die Kunst ihr eigentliches Ziel und erreicht sie stattdessen diejenigen, die ihr gerade nicht „angehören―. Wäre das schon ein Missgeschick, so bildet die Tatsache, dass er dieser Situation im Grunde nicht ausweichen kann, das größte Unglück, weil Beethoven für sein „Andenken― gerade von diesem unbezweckten Publikum abhängt. An dieser Stelle ergibt sich das zentrale Paradox: Die „edelsten und gebildetsten Menschen― vergönnen Beethoven zu Lebzeiten zwar die „Schätze―, für den Anspruch auf „[ü]berirdischen― Erfolg und ewigen Ruhm Ton („bei den edelsten und gebildetsten Menschen―; der Vergleich „Überirdisch― - das „irdisch Menschliche―) etwas abgetönt werden. Dennoch wäre es falsch Beethoven, bekanntlich ein Freundfeind des Adels, als einen Schmeichler der Aristokratie darzustellen. Berühmt in dieser Hinsicht ist der Teplitzer Vorfall. 1812 sind Beethoven und Goethe einander begegnet in Bad Teplitz und zusammen einige Spaziergänge gemacht. Laut Bettina von Brentano sollten beide Künstler dabei auf Kaiser Franz I und seinen Hofstaat gestoßen sein. Als die kaiserliche Gesellschaft passieren wollte, hat Goethe, immer auf die Etikette achtend, einen Rückschritt gemacht und sich vor dem Kaiser verbeugt, während Beethoven dagegen stehen blieb und sich durch die Gruppe schlug, weil er meinte, dass gerade der Adel ihnen aus dem Weg gehen sollte. (vgl. Tim Blanning: The Triumph of Music. Composers, Musicians and their Audiences, 1700 to present. London: Penguin Group 2008, S.42). Entweder Goethe noch Beethoven hat diese Begebenheit irgendwo explizit erzählt oder bestätigt. Der Vorfall wird zwar in der Edition Kastner/Kapp durch Beethoven in einem Brief an Bettina von Arnim (Beethoven an Bettina von Arnim, Teplitz, August 1812 (BSB, Brief 342)) beschrieben, aber die Herausgeber zweifeln die Authentizität des Briefes schon selber an und kommentieren ihn mit „[ob echt?]―. Vorausgesetzt, dass das Vorkommnis also nicht ausdrücklich als wahr bestätigt wurde, könnten einige Elemente im Zusammenspiel von Beethovens und Goethes Briefen indirekt darauf hindeuten, dass die Anekdote doch einen zuverlässigen Grund besitzt. So sagt Goethe in einem Brief an Zelter Folgendes: „B. habe ich in Teplitz kennen gelernt. Sein Talent hat mich in Erstaunen gesetzt; allein er ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die zwar gar nicht Unrecht hat, wenn sie die Welt detestabel findet, aber sie freilich dadurch weder für sich noch für andere genußreicher macht.― (Ernst Lautenbach: Lexikon Goethe-Zitate: Auslese für das 21. Jahrhundert aus Werk und Leben. München: IUDICUM Verlag 2004, S.78). Seinerseits meint Beethoven in einem Brief an Breitkopf & Härtel, dass „Goethe […] die Hofluft zu sehr [behagt], mehr als es einem Dichter ziemt. Es ist nicht viel mehr über die Lächerlichkeiten der Virtuosen hier zu reden, wenn Dichter, die als die ersten Lehrer der Nation angesehen sein sollen, über diesem Schimmer alles andere vergessen können― (Beethoven: Sämtliche Briefe, Brief 340). Andererseits soll dennoch auch darauf hingewiesen werden, dass Beethoven selber über einen aristokratischen Zug verfügte. So drückt er, gewiss gegen Ende seines Lebens, den Glauben aus, er stamme von einer kaiserlichen oder königlichen Familie ab und er sei über die anderen Menschen erhoben (siehe z. B. Beethoven an Karl v. Beethoven, 1825 (BSB, Brief 1312 und 1321), Beethoven an Johanna van Beethoven, 4. August 1825 (BSB, Brief 1325) und Beethoven an Dr. Franz Wegeler, 7. Oktober 1826, (BSB, Brief 1436)). Noch bekannter ist der Vorfall, dass Beethoven auf die Kleinschreibung des „v― in „van Beethoven― verharrte, die er in Analogie zu dem deutschen „von― als einen Beleg für seine adlige Herkunft vormachte (siehe dazu auch Maynard Solomon: „Beethoven: The Nobility Pretense―. In: The Musical Quarterly. Vol.75, No. 4, Anniversary Issue: Highlights from the first 75 Years (Winter, 1991), S.207-24) 37 sollen seine Werke aber bei den breiten Massen „Eingang finden―. Diese Widersprüchlichkeit spielt sich auch auf einer breiteren Ebene ab. Während die „Großtürken―, die metonymisch wohl die ganze Aristokratie vertreten, sich ihres Gedenkens durch einen Appell an die Religion, aber auch an die Kunst (dafür sind diese Streichquartette selber beispielhaft) versichern, muss Beethoven auf dieses Ideal verzichten und seine Kunst stets einem „irdischen― Pragmatismus unterwerfen, um Anerkennung zu bekommen.88 In dieser Hinsicht zeigt sich auch auf einer mehr sozialen Ebene der zentrale Dualismus hinsichtlich der Rolle des Künstlers. Für Beethoven tritt die Kluft zwischen dem Auferlegten und dem Selbst-Erdachten nicht lediglich als ein Kampf seines Inneren ein, aber spielt er sich auch im gesellschaftlichen Alltagsleben ab: „Sie [die merkwürdigsten Konfliktverhältnisse und paradoxen Verwicklungen] bringen schlagartig ans Licht, daß zwischen den Bedingungen des Lebens und den Ansprüchen an das Vollkommene und zugleich Befreiende ein absurder Widerspruch besteht―. 89 Man könnte dagegen schließlich sagen, fast jeder Künstler befinde sich zwischen diesen zwei Extremen. Das ist zwar richtig, dennoch ist es gerade für Beethovens Selbstbild kennzeichnend, dass er sich im letzen Zeitraum seines Lebens so ausdrücklich und offen mit diesem Spannungsfeld in den meisten Briefen auseinandersetzt. Bis zum Ende seines Lebens kümmert er sich um die fragile Grenze zwischen der Sicherheit der Gebundenheit und dem Reiz der Freiheit, die sich auf vielen Makro- und Mikro-Ebenen manifestiert.90 Einige Monate vor seinem Tod lässt Beethoven sich zum Beispiel dermaßen über die Position des Künstlers aus: „In unserem Jahrhundert ist dergleichen sicher nötig; auch habe ich Briefe von Berlin, daß die erste Aufführung der Symphonie mit enthusiastischem Beifall vor sich gegangen ist, welches ich großenteils der Metronomisierung zuschreibe. Wir können beinahe keine tempi ordinari mehr haben, indem man sich nach den Ideen des freien Genius richten muß―. 91 Kennzeichnend ist hier die Metaphorisierung des Metronoms, das seine rein 88 vgl. dazu eine ähnliche Idee in Beethoven an Karl Zelter, 8. Febr. 1823 (BSB, Brief 1069): „Mein wahrer Kunstgenosse! […] Schon mehrere Jahre immer kränkelnd und daher eben nicht in der glänzendsten Lage, nahm ich Zuflucht zu diesem Mittel. Zwar viel geschrieben - aber erschrieben beinahe O! - mehr gerichtet meinen Blick nach oben; - aber gezwungen wird der Mensch oft um sich und anderer willen, so muß er sich nach unten senken, jedoch auch dieses gehört zur Bestimmung des Menschen―. 89 Rexroth: Beethovens Symphonien, S.26 90 siehe 2.1.3 und 2.1.4 91 Beethoven an B. Schotts Söhne, 1826 (BSB, Brief 1447). 38 utilitaristische Funktion übersteigt und zu dem Puls wird, an dem sich den Zeitgeist abmessen lässt. In Bezug darauf, hat „tempi ordinari― einen doppelsinnigen Sinn. Einerseits bedeutet es ganz neutral eine „übliche Taktzeit―, die sich damals durch bloße Tempobenennungen wie „Allegro― oder „Adagio―, jetzt aber mithilfe des Metronoms anzeigen lassen soll. Auf der anderen Seite besagt es „Zeiten, gleichwie wir sie gewohnt waren―. Es bringt somit den Bruch zwischen dem alten und neuen Europa, dessen Beethoven sich offensichtlich stark bewusst war, zum Ausdruck. Und das Barometer dieses Umbruchs bilden gerade die „Ideen des freien Genius―, der die Initiative in diesen neuen Zeiten ergreift. Ein Sieg der Inspiration, der Eigenständigkeit des Künstlers, die Beethoven auf dem einen Pol seiner Kunstauffassung so stark angefühlt hat, scheint sich hier zu vollziehen. Ob diese Aussage Beethovens Glauben an eine unwiderruflich neue Zeit bekundet, ist daraus nicht abzuleiten. Das würde auf jeden Fall der üblichen Beethoven-Rezeption entsprechen. 92 Seine Briefe geben darüber aber keinen Aufschluss. Gequält von einer schließlich letzten Krankheit, schreibt er zwölf Tage vor seinem Tode nämlich diesen Brief: „Wahrlich, ein hartes Los hat mich getroffen! Doch ergebe ich mich in den Willen des Schicksals und bitte nur Gott stets, er möge es in seinem göttlichen Willen so fügen, daß ich, solange ich noch hier den Tod im Leben erleiden muß, vor Mangel geschützt werde. Dies wird mir soviel Kraft geben, mein Los, so hart und schrecklich es immer sein möge, mit Ergebenheit in den Willen des Allerhöchsten zu ertragen―.93 Der Unterschied zum vorigen Bericht ist riesig. Dieser Brief liest sich fast als eine Stelle aus dem Heiligenstädter Testament. Beethovens neu 92 Unendliche Originalität, Kreativität und Reform sind wirklich Grundideen die sich immer wieder in der Beschreibung Beethovens wiederholen. 1855 schreibt z. B. Wilhelm von Lenz, ein Freund Liszts und der Begründer der klassischen Einteilung von Beethovens künstlerischer Entwicklung in drei Epochen, Folgendes: ―Unter den Händen von Händel und Bach, den großen Meistern der Fuge, welche sich selbst Zweck ist, über sich selbst aber nicht, als Trägerin der Idee, hinausgeht, war die Fuge die von der musikalischen Technik gestellte, vom Genie gelöste Aufgabe geblieben. Bei Beethoven ist die Fuge eine Seite des Unendlichen, ein Mittel, demselben näher zu kommen, der Idee zu einem prägnanten Ausdruck zu verhelfen. Er weiß es wohl, daß das Unendliche ihm zwar in Mittel, nicht aber damit sich selbst überließ. Wählend, schaffend auch in dem Mittel, steht der Dichter unter dem Begriff des Unendlichen, daß auch er nicht auszuschöpfen mag‖ (Wilhelm von Lenz: Beethoven. Ein Kunststudie. Kassel: Ernst Balde 1855, S.174). Sogar bis zu diesem Tag kehrt diese Vorstellung von Beethoven als total erneuerndem, genialem Geist zurück: „Beethoven both personified and advanced Romanticism. In music he was the true mould-breaker, establishing the model of the composer as the angry, unhappy, original, uncompromising genius, standing above ordinary mortals and with a direct line to the Almighty― (Blanning: The Triumph of Music, S.99) 93 Beethoven an Ignaz Moscheles, 14. März 1827 (BSB, Brief 1468) 39 erworbenes Autonomiebewusstsein scheint völlig zunichtegemacht zu sein. Er setzt sich wieder ganz hintan und nimmt sein Schicksal stoisch hin. Obwohl er sich nicht explizit über seine Musik ausspricht, ist es trotzdem deutlich, dass diese Aussagen über eine bloße Erklärung der Dienerschaft an Musen oder die Kunst hinausgehen. In diesem Brief entsagt Beethoven völlig dem eigenen Willen und dem Griff auf die eigene Zukunft. Sprach er zuvor noch über die „Ideen des freien Genius―, so ergibt er sich jetzt dem Schicksal und Gott, d. h. demjenigen, was ihm auferlegt wurde. Endgültige Schlussfolgerungen auf Beethovens Selbstbild bezüglich seines Künstlertums zu ziehen, wäre an dieser Stelle noch zu voreilig. Bisher wurde jedoch ein Gegensatz zwischen dem Auferlegten einerseits, und dem Erdachten, dem Programmatischen andererseits festgestellt, die sich als zwei Extreme innerhalb eines dialektischen Spannungsfelds hinsichtlich der Rolle und Selbstständigkeit des Künstlers im Schaffensprozess ergeben. Jetzt, da diese beiden Pole identifiziert wurden, erhebt sich aber die Frage, wie sie sich deuten lassen. Eine strikte Trennung zwischen Ursache und Folge wäre zwar nicht nachzuvollziehen, dennoch fällt auf, dass sich der Dualismus auch als Exponent verschiedener Ebenen aufweist. Zum einen offenbart der Kontrast Beethovens innere Interpretation seiner kreativen Eigenständigkeit, zum andern schlägt er als ein Gegensatz zwischen Gesellschaft und Individuum auch eine Brücke zu einer mehr gesellschaftlichen Ebene (vgl. z. B. die Paradoxie Überirdisch - Irdisch). Folglich soll man sich fragen, inwieweit die zwei Ebenen aufeinander einwirken und wie sie zum Zustandekommen des Gegensatzes beitragen. Die nachfolgende Analyse wird aus Gründen der Beschränkung nur zwei Aspekte beleuchten: Erstens wird sie einen inneren Grund, nämlich Beethovens (viele) Krankheiten untersuchen und zu erklären versuchen, weshalb Beethoven so oft auf seine körperliche Lage eingeht und mehr spezifisch, wie sie zu seinem Künstlertum passt. Anschließend wird sie sich richten auf die Wechselwirkung zwischen dieser inneren und der gesellschaftlichen Ebene und prüfen, wie die beiden einander berühren und wie sich Beethoven ihnen gegenüber positioniert. 2.1.3 Die Krankheit als Gefährdung der künstlerischen Existenz Beim Lesen der beethovenschen Briefe, bildet seine kränkliche Lage einen basso continuo. Und zwar dermaßen, dass man den Eindruck bekommt, der Mann sei während 40 der zwölf letzen Jahre seines Lebens fast ständig krank gewesen. An welchen körperlichen Defekten Beethoven dann genau litt, und ob er vielleicht stets verweist auf seine Taubheit, erhellen die Briefe übrigens kaum, weil Beethoven seine Krankheiten selten spezifiziert. Er redet über „[s]eine schwachen Kräfte―94 und „mehr Hindernisse […] als jeder andere Künstler―, 95 ein einiges Mal über seinen „Gehörzustand―,96 aber ausführliche (Selbst)Diagnosen teilt er nie mit. So prekär soll Beethovens Gesundheitszustand andererseits auch nicht eingeschätzt werden. Wie er in einem Brief an Karl andeutet, verwendet er sein Befinden oft auch als einen Entschuldigungsgrund oder zur Erregung Mitgefühls: „Übrigens laß immer merken, daß meine Kränklichkeit usw. und Umstände mich zwingen, mehr als sonst auf meinen Nutzen zu sehen […]―.97 Statt Mitleid oder Erstaunen, soll sich aber die Frage stellen, welche Funktion diese ständigen Verweise haben, und mehr spezifisch, wie sie dem in diesem Kapitel vorausgesetzten Künstlertum zu zuordnen wären. Obwohl diese Krankheitserwähnungen nämlich mit vielen Gründen versehen werden können, bilden sie nicht nur eine körperliche Behinderung, sondern auch eine Komplizierung der künstlerischen Tätigkeiten: „So vieles Übel hat wieder nachteilig auf meine Gesundheit gewirkt, und ich befinde mich gar nicht gut, indem ich schon wieder seit einiger Zeit medizinieren muß, wo ich kaum einige Stunden des Tages mich mit dem teuersten Geschenk des Himmels, meiner Kunst und mit den Musen abgeben kann―. 98 Die Krankheit bei Beethoven soll nicht verstanden werden als ein Künstlerbild an sich, wie in der Romantik, aber später noch ausdrücklicher im Fin de Siècle. 99 Sie bildet für Beethoven vielmehr das Gegenteil der Kunst, bezeugt eher das Irdische statt des Überirdischen, das er anstrebt (siehe 2.1.2). Beethoven sieht die Krankheit als eine Fremdheit, als einen zwar (immer) unverzichtbar anwesenden Teil seines physischen Ichs, der seiner geistigen Person aber nicht eigen ist. Das trifft ebenfalls auf den oben 94 Beethoven an Nikolaus v. Zmeskall, Januar 1816 (BSB, Brief 554) Beethoven an Ferdinand Ries, 9. Juli 1817 (BSB, Brief 748) 96 Beethoven an Johann v. Beethoven, 1822 (BSB, Brief 1035) 97 Beethoven an Karl v. Beethoven, 15. Juli 1825 (BSB, Brief 1319) 98 Beethoven an Erzherzog Rudolf, 31. Aug 1819 (BSB, Brief 907) 99 vgl. u. a. zur Romantik Laurie Ruth Johnson: „Die Lesbarkeit des romantischen Körpers. Über Psychosomatik und Text in Fallstudien von Karl Philipp Moritz und Friedrich Schlegel―. In: Die Lesbarkeit der Romantik. Hrsg. v. Erich Kleinschmidt. Berlin: Walter de Gruyter 2009, S.126-127; zur Fin-de-Siècle Christian Virchow: „Zur Eröffnung― In: Literatur und Krankheit im Fin-de-Siècle (18901914): Thomas Mann im europäischen Kontext. Die Davoser Literaturtage 2000. Hrsg. v. Thomas Sprecher. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 2002, S.9-12. 95 41 zitierten Brief zu. Auf der einen Seite nimmt „[s]o vieles Übel― Einfluss auf „[s]eine Gesundheit―, andererseits ist der Effekt auf ihn selber ein Externer: Er muss „medizinieren― und kann sich folglich kaum mit seiner Kunst beschäftigen. Auch gibt es einen selbstreferenziellen Unterschied. Bezüglich seiner Gesundheit verwendet Beethoven das Possessivpronomen „mein―, was die Folgen für seine Kunstangelegenheiten aber betreffen, so setzt er das Ich in Subjektposition. Das „Übel― setzt dem Künstler dadurch indirekt zu. Erst indem es durch seine „Gesundheit‖ passiert, wirkt es auf sein (künstlerisches) Wesen ein. In dieser Hinsicht bedroht die Krankheit Beethoven auf eine doppelte Weise: Selbstverständlich gefährdet sie seine körperliche Lage, zugleich setzt sie auch seine künstlerischen Tätigkeiten aufs Spiel. Mehr als eine Behinderung für die psychische Entwicklung des schöpfenden Individuums, bedroht die Krankheit nämlich auch die wirtschaftliche Lage. In einem gesellschaftlich ganz veränderten Wien genießt Beethoven zwar verschiedener Gönnerschaft, trotzdem soll er sich zur Aufrechterhaltung seiner Kosten noch immer an viele sowohl in- als ausländische Verleger wenden 100 : „Sie wissen, daß ich nur von meinen Kompositionen leben muß; seit meiner Krankheit habe ich nur äußerst wenig komponieren können, also auch nur äußerst wenig verdienen können, um so mehr würde es mir sehr willkommen gewesen sein, wenn Sie etwas für mich getan hätten.―.101 Dieser Brief Beethovens zeugt von einer sehr trocknen, zielgerichteten Sicht des Kunstschaffens. An erster Stelle lebt er nicht von der Kunst selber, sondern gerade von ihren Produkten, den „Kompositionen―. Außerdem erweckt „muß― den Eindruck, dass Beethoven diese Situation statt einer freien Wahl, eher als eine Verpflichtung, einen Zwang empfindet. Pragmatik herrscht außerdem auch vor in der Schlussfolgerung, die Beethoven zwischen Ursache und Folge zieht: Weil er nicht „komponieren― kann, kann er gerade nicht „verdienen―. Diese Verbindung bekundet der Parallelismus stilistisch: „nur äußerst wenig komponieren […] also nur äußerst wenig verdienen― (eigene Hervorhebungen). Die Tatsache, dass er gerade nicht auf diese 100 vgl. Donald J. Grout/Claude V. Palisca: Geschiedenis van de westerse Muziek. Vertaald door Frans Brand, Robert Vernooy en Oscar van den Wijngaard. Bewerking en eindredactie: Robert Vernooy. Amsterdam: Olympus 20067, S.605; Grout und Palisca behaupten hier, Beethoven befand sich in den letzten Jahren seines Lebens finanziell sehr wohl. Diese Meinung unterliegt aber einem Irrtum, da Beethoven am Ende seines Lebens explizit ein Benefitkonzert erbitten soll, um seine Kosten zu amortisieren (vgl. 3.2.1.2). 101 Beethoven an Charles Neate, 19. April 1817 (BSB, Brief 721) 42 Einnahmequelle zurückgreifen kann, führt am Ende dazu, dass er seine eigenen Fähigkeiten nicht länger in Anspruch nehmen kann, aber sich in eine externe Beziehung der Abhängigkeit versetzen, sie somit erweitern soll: „um so mehr würde es mir sehr willkommen gewesen sein, wenn Sie etwas für mich getan hätten―. Beethovens physische Lage erzwingt folglich einen großen Freiheitsverlust. Sie bedrängt den Schaffensprozess, aber schont zugleich auch das eigene Individuum nicht; sie greift darüber hinaus sogar sich selbst an: „- Ich befinde mich hier, wo ich sehr übel angekommen, denn meine Gesundheit steht noch immer auf schwachen Füßen, und du, lieber Himmel, statt daß andere sich beim Badegebrauch erlustigen, fordert meine Not, daß ich alle Tage schreibe […]―.102 Beethoven stellt seine Lage als eine sehr paradoxe dar: Um die Kur zu bezahlen, soll er statt sich ihrer zu „erlustigen―, gerade „alle Tage schreibe[n]―. Somit erscheint die Krankheit in dieser Briefstelle als eine sowohl interne als auch externe Bedrohung. So drastisch waren die Umstände wahrscheinlich nicht wirklich, jedoch gibt diese Aussage schon einen Hinweis darauf, wie Beethoven sie anfühlt. Das veranschaulicht die Selbstreferenz wiederum. Der Satz verfügt nämlich über drei Subjekte: „Ich―, die „Gesundheit― und der „lieb[e] Himmel―. Erstens trennen sich die „Gesundheit― und das Ich erneut voneinander ab. Die körperliche Lage erfährt zwar eine Personifikation, ihre Selbstständigkeit führt aber zugleich dazu, dass sie sich nicht mehr mit dem „Ich― gleichsetzen lässt. Dieses „Ich― fühlt sich darüber hinaus ganz separat „übel― und distanziert sich seinerseits sehr explizit von seiner Physis: Die „Gesundheit― wird nicht unter die ausdrückliche Geltendmachung („Ich befinde mich hier―) mitgerechnet und sondert sich mittels der Kausalkonjunktion „denn― von ihm ab. Dieser Schluss verbindet beide zwar, weist zugleich aber auch Indirektheit auf: Erst durch den gesundheitlichen Zustand empfindet das Ich das Übel. Alle diese Elemente waren auch Teil der obigen Analyse, dass Beethoven seine Krankheit als eine auf sich selbst handelnde Fremdheit betrachtet. In der zweiten Hälfte des Satzes gibt es anschließend ein zusätzliches, interessantes Wechselverhältnis. Das Komponieren umschreibt Beethoven nicht mehr als einen Zwang, wie im vorigen Brief, es entartet hier zu einer „Not―, einer Tätigkeit, die sich völlig außer seinem eigenen Willen abspielt und die er nicht anders als befolgen kann. Dessen zeugt einerseits das Verb „fordern―, andererseits auch die Subjektverschiebung der Apostrophe „du, lieber Himmel―, durch 102 Beethoven an Ferdinand Ries, 5. September 1823 (BSB, Brief 1165) 43 die Beethoven den eigenen Willen aus der Hand gibt. Die Handlung des Schreibens selbst gehört zwar noch zum „Ich―, auferlegt wird sie aber von einer externen Autorität. Beethoven erlebt seine Krankheit folglich nicht sosehr als eine persönliche, sondern an erster Stelle als eine Existenzbedrohung, die zumal sein Künstlertum selbst gefährdet und seine „Tätigkeiten […] [h]emmt―.103 Es greift eine Lebensweise an, die ihn zwar innerlich zur Verzweiflung bringt,104 aber trotzdem unausweichlich ist. Das besagt in keinem Fall, dass Beethoven seine Kunst als einen unverzichtbaren Teil seines Lebens empfindet; für ihn gibt es eher keine Alternative: „Wenn dies nun so fortgeht, so dauert meine Krankheit sicher bis zum halben Sommer, und was soll dann aus mir werden? Von was soll ich dann leben bis ich meine ganz gesunkenen Kräfte zusammenraffe, um mir wieder mit der Feder meinen Unterhalt zu verdienen?― 105 Beethoven überdenkt hier sehr offen sein Los, und gelangt zu der Schlussfolgerung, dass er nicht anders kann als Komponieren, man könnte es sogar derart auffassen, dass er sich nur dazu befähigt glaubt.106 Abgesehen von der Bedrohung für die künstlerische Weiterexistenz, verstehen sich Beethovens Krankheiten schließlich auch im Sinne des Gegensatzes zwischen pragmatischem Zwang und eigenem Willen. Sowohl auf Mikroals auch auf Makro-Ebene behindern sie nicht nur Beethovens individuelle, programmatische Wünsche und Zielsetzungen, sondern auch seine gesellschaftliche Position als Künstler. Indem seine Kunstwerke seine einigen wirtschaftlichen Tauschmittel sind, 107 hängt er weitgehend von ihnen ab. Deshalb muss er ein Gleichgewicht ertrotzen, das sich zwischen seinen künstlerischen Ambitionen und 103 vgl. Beethoven an Erzherzog Rudolf, 1823 (BSB, Brief 1156): „Ich bin untröstlich, sowohl wegen I. K. H. als wegen mir selbst, da meine Tätigkeit so sehr gehemmt ist―. 104 vgl. Beethoven an Nikolaus v. Zmeskall, 9. Sept. 1817 (BSB, Brief 782): „Ich probiere ohne Musik alle Tage dem Grabe näher zu kommen.; Beethoven an von Salzmann, 1817 (BSB, Brief 809): „Ich bedarf aber wieder Ihrer Hilfe, denn ich kann eben nicht viel mehr in der Welt, als einige Noten so ziemlich niederzuschreiben― . 105 Beethoven an George Smart, 6. März 1827 (BSB, Brief 1462) 106 Bemerke auch, wie die Personifizierung des Metronoms in einem anderen Brief die existenzielle Verflochtenheit von Gesundheit und Komponieren zum Ausdruck bringt: ―„Die Tempos vermittelst des Metronoms nächstens, der meinige ist krank, und muß vom Uhrmacher wieder seinen gleichen steten Puls erhalten― (Beethoven an B. Schotts Söhne, 1825 (BSB, Brief 1356)). 107 vgl. Beethoven an die Gesellschaft der Musikfreunde, 23. Jan. 1824 (BSB, Brief 1184): „[…] um so mehr, da Ihnen bekannt sein wird, daß ich leider nur durch meine zu schreibenden Werke leben kann. (bemerke auch hier wieder die Idee der Entelechie); Beethoven an Ignaz Moscheles, 18. März 1827 (BSB, Brief 1471): „Sagen Sie diesen würdigen Männern, daß, wenn mir Gott meine Gesundheit wieder geben geschenkt haben, ich mein Dankgefühl auch durch Werke werde zu realisieren trachten und daher der Gesellschaft die Wahl überlasse, was ich für Sie schreiben soll―. 44 demjenigen, das ihn die ökonomische Unterstützung der Gesellschaft vergönnt, bewegt. Wiederum trifft diese Ambivalenz auf viele Künstler zu, Beethoven aber kämpft sehr offen mit ihr in seinen Briefen. Vor allem seine Geschäftsbriefen mit Verlegern, in denen er sich fast protektionistisch als absolutistischer Gebieter seiner Werke aufspielt, bringen den Gegensatz zwischen dem durch die Gesellschaft Auferlegten und dem als Individuum Erdachten beispielhaft zum Ausdruck. 2.1.4 Kampf mit den Verlegern In dem Umgang mit Verlegern, gibt es viele beleuchtenswerte Positionen, die Beethoven einnimmt und dem Gegensatz Individuum - Gesellschaft entstammen. Alle seine Geschäftsbriefe legen den inneren Dualismus, den eigenen Willen auf irgendwelche Weise mit dem gesellschaftlich-wirtschaftlichen Rahmen zu vereinen, dar. Dieser Teil wird aber nur drei konkrete Auswirkungen dieses Kontrasts untersuchen, da eine ausführliche Analyse zu weit führend wäre und es produktiver ist, anhand einzelner Aspekte die komplexe innere Hin-und-her-Geworfenheit Beethovens kernig zu illustrieren. An erster Stelle fällt auf, dass sich Beethoven sehr deutlich als Künstler geltend machen will und sich als ein „Laie in Spekulationen―108 vormacht. Gewiss sieht er ein, dass er sich mit „kaufmännischen Dingen―109 befassen muss, dies formt aber erst einen Nebeneffekt seines Künstlertums: „Diese Anzeige betreffend, beurteilen Sie mich nicht kaufmännisch, allein die Konkurrenz darf ich auch als echter Künstler nicht verachten, bin ich doch dadurch in Stand gesetzt, meinen Musen treu zu wirken und für so manche andere Menschen auf eine edle Art sorgen zu können―. 110 Die Verhandlung seiner Werke stellt Beethoven als eine unabwendbare Folge seines Künstler-Seins dar. Dabei ist die Imago von ausschlaggebender Bedeutung: Man soll ihn nicht als Händler, als bloßen Verkäufer „beurteilen―. Als „echter Künstler― sieht er aber jedoch ein, dass er sich zugleich um „die Konkurrenz― kümmern muss, denn nur das erlaubt ihm, seinen künstlerischen und menschlichen Verpflichtungen nachzukommen. Interessant ist zudem, 108 wie Beethoven implizit seine künstlerische Beethoven an C. F. Peters, 13. Sept. 1822 (BSB, Brief 1138) Beethoven an Peter Simrock, 28. November 1820 (BSB, Brief 986) 110 Beethoven an B. Schotts Söhne, 10. März 1824 (BSB, Brief 1191) 109 Integrität herausstellt. 45 Unverfälschter als ihn gibt es keinen Künstler, und obwohl er sich mit Verlegern auseinandersetzen muss, schadet das seine künstlerische Aufgaben nicht und befolgt er „treu― den Willen seiner „Musen―. Ein anderer Brief betont diese Idee der Unvermeidbarkeit ausdrücklicher: „Kein Handelsmann bin ich und wünschte eher, es wäre in diesem Stück anders. Jedoch ist die Konkurrenz, welche mich, da es einmal nicht anders kann, hierin leitet und bestimmt―. 111 Zur Beurteilung gibt es hier keinen Platz mehr, Beethoven macht ja direkt sehr deutlich, dass er kein Kaufmann ist und bezeigt zugleich das Bedauern, dass er es nicht sein kann, 112 weil er die gesellschaftlichen Bedingungen nicht verneinen darf und er sich dazu verpflichtet sieht, sich mit ihnen abzufinden. Künstlertum und Verhandlung stehen folglich in einer engen Verbindung von Ursache und Folge für Beethoven: Als Künstler kann er nicht auf den sich nun einmal auf diese Weise entwickelten wirtschaftlichen Rahmen verzichten, um sich gesellschaftlich aufrecht zu halten. Selbstverständlich stellt sich das aber etwas nuancierter heraus. Seine Briefe verraten nämlich einen weitgehenden Opportunismus, der die von Beethoven erzwungene kreative Eigenständigkeit durch eine weitgehende Nachgiebigkeit seinen Verlegern gegenüber kompensiert: „Ich höre zwar, Cramer ist auch Verleger; allein mein Schüler Ries schrieb mir vor kurzem, daß selbiger öffentlich sich gegen meine Kompositionen erklärt habe, ich hoffe aus keinem anderen Grunde, als der Kunst zu nützen, und so habe ich gar nichts dagegen einzuwenden. Will jedoch Cramer etwas von diesen schädlichen Werken besitzen, so ist er mir so lieb als jeder andere Verleger―.113 Von ungeheuerem Selbstverrat zeugt diese Aussage zwar nicht, trotzdem wendet sich Beethoven hier doch eigentlich gegen seine eigene Werke. Ob der Verleger seiner Werke auch ideologisch beipflichtet, ist ihm einerlei. Seine Herausgeber betrachtet Beethoven nicht als Teilhaber oder Mitkämpfer im Kunstprozess; er kann wohl „hoffen―, dass sie es seien, an erster Stelle sieht er sie aber als ein Medium des Gewinns. Eine gleiche Flexibilität nimmt Beethoven auch hinsichtlich seiner Werke selber ein: Kein andres als geistliches Sujet habe ich, Ihr wollt aber ein heroisches, mir ist‘s auch recht; nur glaube auch, was Geistliches hineinzumischen, würde sehr für so 111 Beethoven an C. F. Peters, 5. Juni 1822 (BSB, Brief 1019) Im Vergleich zum vorigen Brief heißt das logischerweise, dass auch er kein ―echter Künstler‖ wäre. Diese Schlussfolgerung impliziert Beethoven aber vermutlich nicht. 113 Beethoven an Joh. Peter Salomon, 1. Juni 1815 (BSB, Brief 501) 112 46 eine solche Masse ganz am Platze sein. […] - was mich angeht, so wandle ich hier mit einem Stück Notenpapier in Bergen, Klüften und Tälern umher, und schmiere manches um des Brotes und Geldes willen, denn auf viele Höhe habe ich‘s in diesem allgewaltigen ehemaligen Phäakenlande gebracht, daß, um einige Zeit für ein großes Werk zu gewinnen, ich immer vorher soviel schmieren um des Geldes willen muß, daß ich es aushalte bei einem großen Werk. 114 Zuerst fällt Beethovens merkwürdigen Umgang mir der Thematik seiner Werke auf. Er besitzt nichts „andres als geistliches―, erklärt sich aber sofort bereit, gerade ihr Gegenteil, „ein heroisches―, zu liefern. Den Flimmer Widerstand bietet noch der Kompromiss, „etwas Geistliches hineinzumischen―, der aber durch das vorangehende „nur glaube auch―, dem das „Ich― buchstäblich fehlt, an Überredungskraft verliert. Der Grund dafür findet sich im zweiten Teil des Zitats. Die Auslassung gibt Beethovens Empfinden, diese Gefügigkeit sei ein erheblicher Eingriff in seine artistische Selbstständigkeit, wieder. Der Ton an sich bezeugt schon eine reine Degradierung des Komponierprozesses: Ein „Stück Notenpapier―; schmieren „um des Brotes und Geldes willen―; „Phäakenlande― usw. Die metaphorische Ebene gibt diese Entwertung des Kunstberufs ebenfalls wieder und illustriert das Konnotat, mit dem Beethoven den Zwang zur Verhandlung betrachtet. In den Tiefen seiner kompositorischen Tätigkeiten feiert der Opportunismus Urständ. Was er dort schafft, dient nur dem Eigennutz und verschafft ihm den nötigen Lebensunterhalt. Der Kernpunkt ist aber, dass sich auf der Höhe unlogischerweise nicht das hemmungslose, freie Komponieren, sondern nur die Ambition, „ein großes Werk― in Griffnähe zu haben, findet, weil sich der Konformismus letztendlich gegen Beethoven selber stellt: Die glühende Beschäftigung mit den täglichen Belastungen lässt keine Zeit mehr für den eigenen, künstlerischen Ehrgeiz übrig und entwertet die Position des Künstlers folglich zu einem reinen Kettenglied in einer wirtschaftlichen Ganzheit. Schließlich muss bemerkt werden, dass Beethoven die Unausweichlichkeit dieser Gefügigkeit sicher als erniedrigend empfindet, aber er sich immer seiner künstlerischen Sonderposition bewusst ist. Das schimmert schon in der Behauptung, er habe es „auf viele Höhe […] gebracht―, durch und bekräftigt den anschließenden Gegensatz zum „allgewaltigen […] Phäakenland― noch. In einem anderen Brief hebt Beethoven diesen Gedanken noch deutlicher hervor: „Meine Lage fordert unterdessen, daß jeder Vorteil mich mehr oder weniger bestimmen muß. Ein anderes ist es aber mit dem Werke selbst, da denke ich nie, Gott sei Dank, an 114 Beethoven an Vinzenz Hauschka, 1818 (BSB, Brief 856) 47 den Vorteil, sondern nur wie ich schreibe―. 115 Wiederum plädiert Beethoven hier für seine Integrität als Künstler. Er mag dazu gezwungen sein, seinen Vorteil immer zu beachten, in seinen Werken erstrebt er immer seine Normen befolgen und selber bestimmen zu können. Dazu kommt noch, dass, obwohl Beethoven selber meint, der Umgang mit Verlegern bedränge seine artistische Eigenständigkeit, er die direkte proportionale Verbindung zwischen der Anstrengung beim Komponieren und seiner Vergütung zu manipulieren weiß: „on trouve très vite des harmonies pour harmoniser des telles chansons, mais la simplicité, - le caractère la nature du chant, pour y réussir, ce n‘est pas toujours si facile comme vous peut-être croyez de moi, on trouve un nombre d‘infinion d‘Harmonies, mais seulement une est conforme au genre et au caractère de la Mélodie, et vous pouvez toujours encore donner une douzaine ducats de plus […]―. 116 Beethoven schiebt die transzendentale Ebene seines Künstlerverständnisses zur Seite und stellt sich in diesem Brief ausdrücklich als poeta faber dar. Er beschreibt einen eher mühsamen Arbeitsprozess, wobei besonders das Wortfeld des Suchens und der Bearbeitung auffällt. Als Komponist soll er den Charakter der Musik „finden― und sich durch ihren Harmonienknäuel hindurch kämpfen, um letztendlich darin „erfolgreich zu sein―. Dieses Bild findet sich betonter in den Aussagen, es sei nicht „toujours si facile― oder im Gegensatz „un nombre d‘infinion― „seulement une―. Weiter betont Beethoven hier auch abermals seine Sonderposition. Was Andere machen, nämlich „harmoniser des telles chansons― (wobei „telles― freilich eine Konnotation der Missbilligung besitzt) bezeichnet er als „vite― und leicht, aber was er macht, den Kern der Musik, d. h. die einzige richtige „Mélodie― aufsuchen, fordert eine außerordentliche Fähigkeit, was die Entgegensetzung zwischen „on― und „moi― an, durch die Beethoven seinen früheren Erfolg auf dem Gebiet des Exzeptionellen impliziert, ebenfalls zum Ausdruck bringt. Schließlich dient diese ganze Vorstellung des bearbeitenden, suchenden Komponisten, die Beethoven in diesem Brief aufhängt, den Gewinn auf seinen Werken zu vergrößern. In einer seinem Anfühlen nach mehr an Ergebnis als Ästhetik interessierten Wirtschaftswelt, stellt er seinen Anstrengungsgrad intensiviert dar, um so den Wert seiner Werke zu erhöhen und letztendlich den Gewinn zu steigern. 115 116 Beethoven an C. F. Peters, 20. März 1823 (BSB, Brief 1088) Beethoven an George Thomson, 21. Februar 1818 (BSB, Brief 843) 48 Aus Gründen der Vollständigkeit darf schließlich der Eindruck aber nicht entstehen, Beethoven sei einfach ein richtungsloser, leicht zu manipulierender Geizhals. Auf der einen Seite trifft das einigermaßen zu und lassen sich schon zu Lebzeiten Spuren einer solchen Vorstellung erkennen. 117 Während Beethoven es aber so empfindet, als stelle er sich für die Konzeption seiner Werke sehr oder zu gefügig auf, weiß er andererseits hinsichtlich ihrer Ausgabebedingungen ganz genau was er will und wie er es will. Was er auf der künstlerischen Seite aufgibt, kompensiert er durch eine starrsinnige Einmischung in die Herausgabebestimmungen. Für Verleger oder Artisten sollten Verhandlungen mit Beethoven ein wahrer Kampf gewesen sein, da er sich, wenn es seine Kompositionen gilt, sehr manifest als einziger Gebieter über sie aufspielt und sein „Recht― 118 auch äußerst explizit geltend macht: „Die Symphonie müßte gegen März herauskommen, den Tag werde ich bestimmen. Es ist diesmal zu lange gegangen, als daß ich den Termin kürzer bestimmen könnte―. 119 Schon das semantische Wortfeld verlagert Beethoven in eine dominierende Position: „müßte― haucht sowohl Verpflichtung als, durch den Konjunktiv, auch implizit die Inverzugsetzung des Verlegers. Mit dem „bestimmen― erklärt sich Beethoven zudem eindeutig als Verhandlungsführer. Es gibt noch viele Belege, diese weitgehende Unnachgiebigkeit nachzuweisen, 120 wie diesen Brief an den Verleger Probst: „Beste!! Ihr habt mich gröblich beleidigt! Ihr habt mehrere Falsa begangen: Ihr habt Euch daher erst zu reinigen vor meinem Richterstuhl allhier; sobald das Eis auftauen wird, hat sich Mainz hierher zu begeben, auch der rezensierende Oberappellationsrat hat hier zu erscheinen, um Rechenschaft zu geben, und hier gehabt euch wohl!//Wir sind Euch gar nicht besonders 117 zugetan! Gegeben ohne was zu geben auf den Höhen von Beethoven an B. Schotts Söhne, 20. Mai 1826 (BSB, Brief 1387): „Nochmals muß ich Sie bitten, daß Sie ja nicht denken möchten, ich wolle irgend ein Werk zweimal verkaufen―. 118 Beethoven an die Philharmonische Gesellschaft in London, 5. Febr. 1816 (BSB, Brief 564) 119 Beethoven an Ferdinand Ries, 22. Nov. 1815 (BSB, Brief 542) 120 vgl. Beethoven an Joh. Peter Salomon, 1. Juni 1815 (BSB, Brief 501): „Ich halte mir bloß bevor, daß ich selbige Werke auch meinem hiesigen Verleger geben darf, so daß diese Werke eigentlich nur in London und Wien herauskommen und zwar zu gleicher Zeit) […] welch‗ Geschick für einen Autor!!!―; Beethoven an Musikverlag, H. A. Probst, 10. März 1824 (BSB, Brief 1190): „Freilich ist bei dieser Symphonie die Bedingung, daß selbe erst künftiges Jahr 1825 im Juli erscheinen dürfte […]―; Beethoven an C. W. Henning, 1. Januar 1825 (BSB, Brief 1266): „Da jetzt schon ein Teil des Übels geschehen ist, so bitte ich Sie alles anzuwenden, daß dieser vierhändige Klavierauszug nicht verbreitet werde, bis ich Ihnen schreibe.―; Beethoven an Haslinger, 9. April 1826 (BSB, Brief 1383): „ […] nie werde ich gestatten, daß diese Werke unter den Titeln herauskommen, welche Sie darauf gesetzt haben―. 49 Schwarzspanien―. 121 Obwohl der Redestil des Briefs vermutlich gezielt lustig und hyperbolisch gestaltet wurde, kommt die Stellung Beethovens als Herr und Meister, als Ankläger und Richter der Verhandlungen in jedem Fall sehr betont zum Ausdruck. Beethoven schuldigt den Verleger zuerst direkt sehr heftig an: Schotts habe ihn „beleidigt― und „mehrere Falsa begangen―. Darauf folgt eben rasch der Schuldspruch: Er fordert Schotts auf, um sich wie einen Geknechteten vor ihm zu „reinigen―. Beethoven verstärkt seine Herrschaftslage noch, indem die Metonymie von „Eis― und „Mainz― ihn zu Machthaber der Natur macht und er schließlich auch noch den „rezensierenden Oberappellationsrat― zum Gehorsam aufruft. 2.1.5. Fazit Die in diesem Kapitel angeführten Fälle dienten zum Beleg eines zentralen Aspekts von Beethovens Künstlertum, nämlich dem Gegensatz zwischen dem Ich und dem Anderen. Beide Extremen bilden in seinen Briefen einen ständigen Kampf, in dem Beethoven begriffen ist. Einerseits empfindet er von der meist inneren Konzeption seiner Kunst bis zu ihrer Herausgabe einen heißen Drang, die eigenen musikalischen Gedanken und Projekten nach seiner Vorstellung von ihnen zu realisieren. Dabei erfährt er aber zugleich andauernd eine hindernde Gegenkraft, die sich in Form von forces majeurs, wie seinen Krankheiten oder den geänderten gesellschaftlichen Verhältnissen, aber auch durch einen Zusammenstoß von Prinzipien und Prioritäten mit Verlegern hervormachen kann. Diese Exponenten des zentralen Gegensatzes sollen aber nicht als getrennte Manifestierungen betrachtet werden; sie bewegen sich eher innerhalb eines dialektischen Kontinuums. So sorgt z. B. die innere Behinderung der Krankheit dafür, dass Beethoven sich gezwungen fühlt, seine individuelle Kunstkonzeption loszuwerden, indem er sich für seine Pflegung einer finanziellen Unterstützung sichern soll. Kurz gesagt versteht sich Beethovens Künstlertum als der Drang, das Individuum in künstlerischen Angelegenheiten (schöpferisch sowie organisatorisch) in den Mittelpunkt zu rücken. Eine Leistung, die er aber nie verwirklicht sah. 121 Beethoven an B. Schotts Söhne, 28. Januar 1826 (BSB, Brief 1376) 50 2.2 Schubert 2.2.1 Die Aufwertung des Individuums Versucht Beethoven die künstlerische Eigenständigkeit zu erringen, so manifestiert sich bei Schubert eine Zentralstellung und Aufwertung des Individuums, ein neues Selbstbewusstsein, indem er sich unverblümt als einziger Gebieter über seine Kunst geltend macht: „Ich befinde mich recht wohl. Ich lebe und componire wie ein Gott, als wenn es so seyn müßte―.122 Wenn auch diese Aussage am Moment eines vermutlich sehr enthusiastischen Gemütszustandes stattfand (das sieht sich auch den ersten Satz an), besagt es trotzdem doch, wie Schubert sich seiner Kunst gegenüber positioniert. Beethovens inhärente kreative Abhängigkeit räumt einem neuartigen Selbstbewusstsein. Schubert erlebt den Schaffensprozess nicht als das Befolgen des von höheren Mächten Bestimmten. Er ist dagegen selbst deren Verkörperung. Ihm gehört die künstlerische Initiative. Dennoch spürt man zugleich auch, dass nicht von einer bloßen Gleichsetzung die Rede sei und es noch immer einen Abstand gibt. An erster Stelle setzt sich Schubert nicht metaphorisch gleich mit einem Gott, d. h. er sagt nicht „ich bin ein Gott―. Er verwendet dagegen einen Vergleich, der freilich eine kausale Verbindung unterstellt, aber zugleich die getrennte Individualität zwischen dem Transzendentalen und ihm respektiert. Schubert glaubt zwar Eigenschaften einem Gott ähnlich zu besitzen, er breitet diese aber nicht zu einem charakteristischen Bestandteil seines ganzen Wesens aus. Weiter eignet er sich auch nicht eine komplette Willenserklärung zu. Im letzten Teil des Satzes assoziiert er sein Leben und Komponieren „wie ein Gott― tatsächlich mit einem Ideal, aber es gelingt ihm allerdings nicht, die Entwicklung und den Endpunkt dieses Inbildes selber zu bestimmen. Vielmehr drücken die zweifelhaften Partikel „als wenn― und der Konjunktiv II „müßte― aus, dass ein übergreifendes Schicksal, trotz Schuberts erlangter Eigenständigkeit, letztendlich noch immer über den Komponisten entscheidet. Im Vergleich zu Beethoven, fällt aber in jedem Fall auf, dass Schubert sich in den Mittelpunkt seines Kunstschaffens stellt und sich in vielen Briefen stark an dem 122 Schubert an Schober und die anderen Freunde, 3. August 1818 (Schubert: Die Dokumente seines Lebens. Gesammelt und erläutert v. Otto Erich Deutsch. Mit einem Geleitwort v. Peter Gülke. Erweiterter Nachdruck der 2. Auflage Leipzig 1980. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik 1996 [ab jetzt: SDL], S.62) 51 eigenen Kunstverständnis und Werturteil orientiert. Er spricht sich nicht selten sehr direkt über die Qualität seiner Werke aus. Während diese Ebene der Selbstanerkennung oft bei Beethoven fehlt (es sei denn, er bezwecke damit, andere Werke wie seine Missa Solemnis anzupreisen), hat Schubert eine sehr konkrete Idee über den Wert und die Bedeutung seiner Kompositionen, wie in diesem Brief an seine Freunden: „Mayrhofer‘s „Einsamkeit― ist fertig, und wie ich glaube, so ist‘s mein Bestes, was ich gemacht habe, denn ich war ja ohne Sorge. […] Jetzt lebe ich einmal, Gott sey Dank, es war Zeit, sonst wär‗ noch ein verdorbener Musikant aus mir geworden―. 123 Dass sich Schubert seines eigenen, künstlerischen Werts bewusst ist, erfordert keine Verdeutlichung. Bemerkenswerter ist aber, wie existenziell bedingt Schubert seine Künstlerschaft betrachtet. Das Gelingen oder Misslingen eines Werkes verbindet er zunächst mit einer mentalen Ruhe und Sorgenlosigkeit und sieht er als eine direkte Bestätigung eines aktiven, wertvollen Künstlertums, ja sogar als eine Voraussetzung zum Leben. Obwohl sich Schuberts Selbstwert sprachlich auch in der Behauptung „mein Bestes, was ich gemacht habe― widerspiegelt, die durch den doppelten Bezug auf sich selbst („mein― und „ich―) die Zentralstellung des Individuums illustriert, wäre es aber zu leicht, den Superlativ als Beleg für ein total selbstsicheres Bewusstsein zu betrachten. Nuancierter zeigt sich das in diesem Tagebucheintrag: O Mozart, unsterblicher Mozart, wie viele o wie unendlich viele solche wohlthätige Abdrücke eines lichtern bessern Lebens hast du unsere Seelen geprägt. Dieses Quintett ist, so zu sagen, ein‘s seiner größten kleinern Werke. - Auch ich mußte mich produciren bei dieser Gelegenheit. Ich spielte Variationen von Beethoven, sang Göthes rastlose Liebe u. Schillers Amalia. Ungetheilter Beifall ward jenem, diesem minderer. Obwohl ich selbst meine rastlose Liebe für gelungener halte als Amalia, so kann man doch nicht läugnen, d[a]ß Göthe‘s musikalisches Dichter-Genie viel zum Beyfall wirkte.124 In dieser Notiz macht sich der Selbstwert auf zwei Ebenen vor. Einerseits stellt sich Schubert auf eine Linie mit Mozart, indem er signalisiert, dass seine Musik in einem Konzert mit deren Mozarts gespielt wurde und implizit also darauf hindeutet, dass sie eine bestimmte Qualität, mit der des Salzburger Komponisten teilt. Dazu kommt die Tatsache, dass Schubert Mozarts Quintett als „ein‘s seiner größten kleinern Werke― beurteilt und er sich anschließend auf seine kleineren Liedwerke richtet, die den 123 124 Ebd., S.63 Aus Schuberts Tagebuch, 13. Juni 1816 (SDL, S.43) 52 Übergang zur zweiten bewertenden Seite dieser Stelle, in der Schubert eine sehr deutliche Idee über das Niveau seiner Kompositionen zum Ausdruck bringt, bilden. Eher analytisch beschreibt er den Beifallsunterschied von zwei Liedern und schließt sich dabei an, indem auch er das Eine „für gelungener― als das Andere betrachtet. Schubert nähert diesem Vergleich aber zugleich trocken an. Er wendet sich für sein Urteil nicht lediglich an seine Qualitäten, aber gesteht ein, dass auch der Name und das „Dichter-Genie― Goethes zum Beifall beigetragen haben. In seinem künstlerischen Selbstwertgefühl vermischt Schubert also zwei Aspekte: Zum einen besitzt er ein ausgeprägtes Gefühl der Selbstverwirklichung und Selbstachtung, zum anderen berücksichtigt er in diesem Fall die Leistungen, im Allgemeinen aber auch die Meinung Anderer. Das soll aber nicht heißen, dass Schubert sich mit irgendwelchem Standpunkt bezüglich seiner Werke zufriedengibt. Er geht oft sehr selektiv vor und fordert vom Beurteilenden ein bestimmtes Niveau des Sachverständnisses: „Was den Brief der Milder betrifft, so freute mich die günstige Aufnahme der Suleika sehr, obwohl ich wünschte, daß ich die Recension selbst zu Gesicht bekommen hätte, um zu sehen, ob nicht etwas daraus zu lernen sei; denn so günstig als auch ein Urtheil sein mag, eben so lächerlich kann es zugleich sein, wenn es dem Recensenten am gehörigen Verstand fehlt, welches nicht so selten der Fall ist―. 125 Eine normale Reaktion auf eine günstige Rezension scheint diese Stelle anfangs zu sein, bis allerdings deutlich wird, was Schubert mit diesem „lernen― meint. Den visuellen Kontakt mit der Kritik an seinem Werk braucht er nämlich nicht, um darauf die Suleika anzupassen; ihm geht es nur darum, den „Verstand― des Rezensenten zu überprüfen und nachzugehen, wie gültig dessen Beurteilung ist. Folglich soll Schuberts Anteilnahme an dem Gutachten Anderer abgetönt werden. Er ist wohl dazu bereit, es zu berücksichtigen, zuerst soll es aber seinen Normen des Kunstverständnisses entsprechen. Und nur Wenige sind dieses Ansehen Wert. Das spricht Schubert sehr direkt in einem Brief an Probst aus: „Daß ich Ihnen nicht senden werde, was ich nicht für durchaus gelungen halte, in soweit als solches dem Verfasser und einigen gewählten Zirkeln möglich ist, bedarf es wohl keiner Versicherung, indem mir ja selbst am meisten daran gelegen seyn muß, gute Werke ins Ausland zu senden―. 126 Sowohl das Selbstwertgefühl als auch die Beurteilung durch 125 126 Schubert an Vater und Stiefmutter, 25. oder 28. Juli 1925 (SDL, S.299) Schubert an Probst, 10. April 1818 (SDL, S.510) 53 Andere treten in diesem Abschnitt zutage, obwohl sich doch auch eine deutliche Hierarchie geltend macht: Die Qualität von seinen Werken bekundet sich für Schubert erst durch das, was er als „gelungen― betrachtet. Zwar versucht er diese Behauptung ein wenig zu objektivieren, da er anschließend über sich selbst in dritter Person als „Verfasser― spricht und auch andere „Zirke[l]― in die Meinungsbildung einbezieht (obgleich auch sie „gewähl[t]― sind und noch immer von seinem Gutachten abhängen), am Ende bleibt jedoch die Feststellung, dass er über die Verbreiterung seiner Stücke entscheidet. Zu dieser letzten Autonomiebehauptung erhebt sich schließlich die Frage, wie Schubert dann mit der Verlegerwelt, die schon in Beethovens Briefen prominent anwesend war und über die sich der Komponist ersichtlich entrüstete, umgeht. Eine bündige Antwort findet sich im einzig übrig gebliebenen Brief an seine Eltern: „Wenn nur mit den — von Kunsthändlern etwas Honnettes zu machen wäre, aber dafür hat schon die weise und wohlthätige Einrichtung des Staates gesorgt, daß der Künstler ewig der Sclave jedes elenden Krämers bleibt―. 127 Genau wie Beethoven, bringt auch Schubert den Verlegern wenig Vertrauen entgegen. Beethoven möchte aber zwar den Eindruck erwecken, er kenne sich gar nicht in solchen „kaufmännischen Dingen― aus, er erkannte dennoch die Unverzichtbarkeit des Verlagswesens. Schubert teilt Beethovens Enttäuschung, spürt ebenso diesen Mangel an „Honnettes― und versucht sich geradezu vollkommen von den Herausgebern zu distanzieren. In der obigen Briefstelle fällt dazu insbesondere die Trennung zwischen Künstlern und Verlegern, die er zieht, auf. Das Verlegen erniedrigt er fast zu einem Handwerksberuf, indem er erstens den merkantilischen Aspekt betont, da Verleger „Kunsthändle[r]― nur organisatorisch und vermittelnd, und nicht kreativ oder schöpferisch für ihn sind, und er sie am Ende des Zitats dazu auch noch abwertend als „Krämer―, was letztendlich mit einer unkünstlerischen, philisterhaften Konnotation einhergeht, umschreibt. Diesen Händlern gegenüber stehen dann die Künstler, für die Schubert aber ebenfalls keinen beneidenswerten Platz vorbehalten sieht. Im Gegenteil, mit einem Hauch von Staatskritik vergleicht er sie mit „Sclave[n]― des Systems, den Kleinbürgern unterworfen - ein Bild, das im Grunde ungezielt die Hin-und-her-Geworfenheit Beethovens in diesen Angelegenheiten treffend veranschaulicht. Schubert will dagegen 127 Schubert an Vater und Stiefmutter, 25. oder 28. Juli 1825 (SDL, S.299) 54 genau auf seinen ausgeprägten Selbstwert vertrauen und sich als selbstständiger Künstler geltend machen. Das heißt aber nicht, dass plötzlich mit ihm der Sieg des eigenständigen Individuums erlangt wurde. Auch er hat seine Momente des Schmeichelns und Flattierens, die im Rahmen des zuvor als so kennzeichnend und entscheidend empfundenen Selbstwerts im folgenden Brief an Mosel, der voll von Bitten und Verlangen steht, eigenartig aussehen: Ich habe die Ehre, Euer Hochwolgeb. nun den 3ten und letzten Akt meiner Oper sammt der Ouverture zum 1ten Akt zu senden, mit der Bitte, mir dann Hochderselben Meinung darüber gütigst mitzutheilen. […] Dürfte ich Hochdieselben vielleicht an Ihr so gütiges Versprechen erinnern, das Werk mit einem wohlwollenden Schreiben an Weber zu begleiten […] [und] an Freiherm von Könneritz, der nach Webers Nachricht die Leitung des Dresdener Theaters führt […] Und nun, da ich Euer Hochwohlheb. schon mit so vielen Bitten belästige, so füge ich in Gottes Nahmen ganz demüthig noch die letzte hinzu: Ob Hochdieselben nicht so gütig sein wollten, mir Ihr meiner Wenigkeit zugedachtes Opernbuch indessen zukommen zu lassen, indem ich heilig versichere, es getreulichst zu bewahren und ja Niemanden auch nur sehen zu lassen. 128 Eine ausführliche Analyse der Stelle sei hier weniger an der Ordnung. Der Unterschied zu vorigen Briefen fällt sofort ins Auge. Die vielen Anliegen erwirken eher wieder die Unselbstständigkeit statt der erhofften Ungebundenheit (obwohl das „in Gottes Nahmen― inmitten des ansonsten äußert förmlichen Redestils doch wie ein Fremdkörper vorkommt und eine gewisse Frechheit ausdrückt, gewiss im Gegensatz zu dem darauffolgenden „demüthig―) und sind auch nicht frei von Opportunismus. Vor allem die Frage nach Mosels Meinung scheint hier fehl am Platze zu sein, gerade nachdem zuvor bemerkt wurde, dass sich Schubert als Ausdruck der Aufwertung des künstlerischen Ichs stark an das eigene Urteil richtet. Folglich soll diese Bitte nicht sosehr als ein aufrichtiges Zeichen des Interesses an der Meinung Mosels, sondern eher ähnlich dem Opportunismus, wenn man will Konformismus Beethovens betrachtet werden. Solche Momente weisen sich im Briefnachlass Schuberts zugegeben auch eher selten auf, denn in den meisten Fällen nimmt er eine sehr entschlossene und geradlinige Attitüde in seinen Briefen an Verleger an und präsentiert er sich als jemand, der genau weiß, was er will: „Die Erscheinung der zwei Hefte Walzer etc. hat mich etwas befremdet, indem sie nicht ganz der Abrede gemäß erschienen sind. Eine angemessene 128 Schubert an Mosel, 28. Febr. 1823 (SDL, S.186) 55 Vergütung wäre ganz an seinem Platz―. 129 Als Erstes lässt sich diese befremdende Wirkung auf Schubert bemerken. Er äußert das Gefühl, als sei seine Musik ohne die (strengen) Richtlinien nicht länger die Seine. In doppelter Hinsicht bildet das einen bemerkenswerten Gegensatz zu Beethovens Sicht auf seine Werke und deren Herausgabe. Wie in Fußnote 81 (S.34) schon bemerkt, zeigt das Befremdende für Beethoven das Gute und das Neue, und nicht sosehr das Manko. Schubert dagegen fordert sofort einen Schadenbetrag. Weiter weist er auch gar nicht die Bereitschaft auf, um zu einem Kompromiss zu kommen. Das steht in schroffem Gegensatz zu Beethovens zuvor bemerkter Nachgiebigkeit, um Werke, hinter denen er sich künstlerisch nicht völlig scharen kann, doch herausgeben zu lassen. Schubert gibt einer solchen Flexibilität aber nicht nach. Er verharrt auf seinen eigenen Anordnungen und sieht in dem künstlerischen Defizit eine Quelle, nicht des künstlerischen (wie Beethoven), sondern des ausschließlich finanziellen Gewinns. 2.2.2 Neuerung und Fortschritt Schuberts Betonung des eigenen Individuums kommt nicht nur im ausgesprochenen Bewusstsein des Selbstwerts zum Ausdruck; sie zeichnet sich ebenfalls in seinem Streben, Neues zu schöpfen, ab. Wie er es selbst umschreibt und sieht, wandelt er mit seiner Musik Pfade, die ja noch kaum betreten sind: „Es könnte mir freylich vielleicht gelingen, eine neue Form zu erfinden, doch kann man auf so etwas nicht sicher rechnen. Da mir aber mein künftiges Schicksal doch etwas am Herzen liegt, so werden Sie, der Sie auch daran Theil zu nehmen mit schmeichle, wohl selbst gestehen müssen, d[a]ß ich mit Sicherheit vorwärts gehen muß, u. keineswegs mich der so ehrenvollen Aufforderung unterziehen kann […]―. 130 Im Vergleich zu Beethoven, der nur an seltenen Stellen solche konzeptuelle Überlegungen vorlegen kann, atmet Schubert deutlich ein neues Selbstvertrauen und zeigt sich mehr der Wille auf, sich selbst (neu) zu ‚erfinden‗, in jedem Fall immer weiter zu entwickeln. 131 Was zur gleichen Zeit aber 129 Schubert an Diabelli, 21. Febr. 1823 (SDL, S.185) Schubert an Leopold Sonnleithner, Januar 1823 (unsicher) (SDL, S.182) 131 vgl. auch Schubert an seinen Bruder Ferdinand, 12. September 1825 (DSL, S.314): „Die Art und Weise, wie Vogl singt und ich begleite, wie wir in einem solchen Augenblick Eins zu sein scheinen, ist diesen Leuten etwas ganz Neues, Unerhörtes―. 130 56 auch auffällt, ist das Fehlen einer Spontaneität bezüglich des Schaffensprozesses. Für Schubert bedeutet Komponieren vielmehr Erarbeiten als bloß der Inspiration befolgen. Das hängt selbstverständlich damit zusammen, dass er immer mehr die Eigenständigkeit beim Kreieren beansprucht. Deshalb redet er auch über „eine neue Form […] erfinden― und spürt man in seinen Formulierungen eine gewisse Planmäßigkeit. Schubert geht von Erwartungen, von einer gewissen ‚Berechenbarkeit‗ aus, aber zweifelt ihre Zuverlässigkeit zugleich auch an („doch kann man auf so etwas nicht sicher rechnen―) und kümmert sich sehr offen über sein „künftiges Schicksal―. Mit jugendlichem Enthusiasmus scheint der Zweck seiner Kunst sogar nicht die Musik selber zu sein, sondern nur „vorwärts gehen―, d. h. der Fortgang. Konkret bekundet ein sich programmatisch ausgedachter Zeitplan diesen Fortschrittsdrang. Das äußert sich exemplarisch in diesem Brief an seinen Freund Kupelwieser: „ […] überhaupt will ich mir auf diese Art den Weg zur großen Sinfonie bahnen. - Das Neueste in Wien ist, d[a]ß Beethoven ein Concert gibt, in welchem er seine neue Sinfonie, drei Stücke aus der neuen Messe und eine neue Ouvertüre produciren lässt. Wenn Gott will, so bin ich gesonnen, künftiges Jahr ein ähnliches Concert zu geben―.132 Wiederum findet sich hier das Gefühl der eigenen Weiterentwicklung sowie der Neuerung, die Schubert offensichtlich bei Beethoven konkretisiert sieht. Merklich ist auch, dass Schubert sich wohl selbstbestimmt entwickeln will und stark von den eigenen Ambitionen und Zielsetzungen ausgeht (wie sich in „so bin ich gesonnen― spüren lässt), aber dennoch nicht imstande ist, eine totale Selbstständigkeit einzufordern. Obwohl eher eine Redewendung ohne zu viel schwerwiegende Bedeutung, versteckt sich das schon beschränkt in „Wenn Gott will―, noch mehr aber prägt sich das in dem Vorbild, das Beethoven leistet und an das Schubert sich orientiert, aus. An dieser Stelle wäre es vermutlich geeignet, weiter auf Beethovens Einfluss auf Schubert fortzuführen. In einer Studie über die beiden Komponisten mag es nämlich angehen, dass zumindest einmal kurz (Beethoven erwähnt Schubert eben nie in seinen Briefen, Schubert Beethoven eher selten) auf die Beziehung zwischen beiden eingegangen wird, und zwar der Art und Weise, in der Schubert mit dem Schatten Beethovens über ihm umgeht. Es reicht nämlich nicht hin, Beethoven als dàs Leitbild Schuberts darzustellen und so den irreführenden Eindruck eines Epigonentums zu 132 Schubert an Leopold Kupelwieser, 31. März 1824 (SDL, S.235) 57 hinterlassen. Denn Beethoven ist sowohl ein Vorbild als auch ein Modell, von dem sich Schubert abzutrennen vermag und gegen das er sich wehrt. Dass Schubert in Beethoven eine Richtschnur sieht, hat sich schon oben gezeigt. Ein Jahr zuvor positioniert er sich aber noch ganz anders Beethoven gegenüber: „Da ich fürs ganze Orchester eigentlich nichts besitze, welches ich mit ruhigen Gewissen in die Welt hinaus schicken könnte, und so viele Stücke von großen Meistern vorhanden sind, z. B. von Beethoven: Ouverture aus Prometheus, Egmont, Coriolan etc. etc. etc. so muß ich Sie recht herzlich um Verzeihung bitten, Ihnen bey dieser Gelegenheit – nicht dienen zu können, indem es mir nachtheilig seyn müßte mit etwas Mittelmäßigem aufzutreten―. 133 Schuberts Bewunderung für Beethoven soll hier deutlich nicht angezweifelt werden. Dennoch spürt man auch das Zögern, einfach in Beethovens Fußstapfen zu treten. Einerseits beängstigt es Schubert, um sich durch Stücke ‚fürs ganze Orchester― auch direkt mit „großen Meistern― wie Beethoven zu messen, während er solche Schöpfungen gerade als mittelmäßig erachtet (was sich kurzum teilweise mit Harold Blooms Theorie über die anxiety of influence vereinigen lässt). Man könnte diese Haltung als Selbstzweifel interpretieren, das besagt sie aber nicht unbedingt. Schuberts Überzeugung seines Selbstwerts ist hier sicher ebenfalls mit im Spiel. Das bringen auch der Ehrgeiz, seine Werke „in die Welt hinaus [zu] schicken― und die Tatsache, dass er dazu auch den potenziellen Nachteil berücksichtigt, zum Ausdruck. Obwohl Schubert am Ende des Zitats schon selber diesen Vergleichsmaßstab angibt, soll seine Beziehung zu Beethoven nicht ausschließlich qualitativ bewertet werden. Sie wird ebenfalls dadurch gekennzeichnet, dass er den Neuigkeitswert eines Orchesterstücks nicht erkennt und er für sich keinen Beitrag zu der Musik vorbehalten sieht, wenn schon so viele Vorgänger so Vieles im Gebiet der Orchesterwerke geleistet haben. Schließlich bleibt noch ein kleines, merkwürdiges Element im Brief übrig: Schuberts Auflistung von jenen Orchesterwerken, die laut ihm Beethovens Großheit sowie die des ganzen Oeuvres bekunden. Dabei erregt die Tatsache, dass er nicht, wie man erwarten könnte, Beethovens Symphonien aufführt, die letztendlich schon damals als revolutionär galten, Aufmerksamkeit.134 Nein, Schubert erwähnt gerade Beethovens Programmmusik, also 133 Schubert an Josef Peitl (unsicher), undatiert (SDL, S.183) vgl. Paul Mies: ―Beethoven‘s Orchestral Works‖. In: The New Oxford History of Music. The Age of Beethoven 1790-1830. Volume VIII. Edited by Gerald Abraham. Oxford: University Press 1988, S.125134 58 die Musik, die sich, im Gegensatz zur Absoluten Musik, mit hier literarischen, aber manchmal z. B. auch malerischen (wie Mussorgskis Bilder einer Ausstellung, 1874), d. h. außermusikalischen Gedanken verbinden lässt. So greifen die erwähnten Egmontund Coriolan-Ouvertüren auf die Schauspiele von Goethe bzw. von Collin zurück, und war das Stück Die Geschöpfe von Prometheus als Ballettmusik bedacht. 135 Es ist schwierig zu schließen, warum Schubert hier genau nur diese Programmmusik als Beispiel anführt. Die Musikwerke gehören zwar zu den Bekannteren Beethovens, sie können freilich nicht wetteifern mit seinen Symphonien. Die Antwort ist eher bei Schuberts eigenen Musikansichten zu situieren, in die ein anderer Brief an den Dichter Rochlitz, in dem er gesteht, dass er sich selber um diese außermusikalische Ebene kümmert, mehr Einblick bietet: „[…] weil es mein sehnlichster Wunsch ist, ein reines Musikwerk ohne alle andere Zuthat, außer der erhebenden Idee eines großen durchaus in Musik zu setzenden Gedichts, zu liefern―. 136 Ohne einer solchen einmaligen Aussage allzu viel Gewicht beimessen zu wollen, lässt sich hier bemerken, wie bedeutungsvoll die „Idee― in der Musik für Schubert ist. Dafür geht er überdies nicht von der individuellen Aussagekraft der Musik selber aus. Die Musik hat wohl ihr eigenes Ausdruckspotenzial, erst als Vehikel für die im Gedicht vorhandene Idee erhebt sie sich und kommt sie in ihrer Reinheit zum Ausdruck. Berücksichtigt man folglich diese ästhetischen Überzeugungen Schuberts, so konnte man vielleicht besser deuten, warum er gerade Beethovens Programmmusik als Mustergattung für das Orchester betrachtet. 2.2.3 Fazit Die sich schon bei Beethoven manifestierende, aber jedoch nie völlig erreichte kreative Zentralstellung des künstlerischen Individuums, bekommt bei Schubert eine deutlicher umrissene Form. Mit bestimmt durch sein jugendliches Alter, wird in seinen Briefen ein intensiveres Selbstständigkeitsgefühl, das sich zweifach konkretisiert, erkennbar: erstens durch ein neues Bewusstsein des Eigenwerts, zweitens im Drang nach Neuerung und Fortschritt. Die Möglichkeit, selber einen künstlerischen Weg vorzuzeichnen und 126; zur Zeit dieses Briefes hatte Beethoven schon acht Symphonien geschrieben, nur die neunte Symphonie sollte zwei Jahre später noch aufgeführt werden. 135 Grout/Palisca: Geschiedenis van de westerse Muziek, S.603 136 Schubert an Rochlitz, November 1827 (unsicher) (SDL, S.464) 59 zu beschreiten, bildet einen roten Faden in Schuberts Briefen. Das heißt aber noch nicht, dass der Komponist sich plötzlich zu einem total unkonventionellen, freien Individuum entwickelt. Im Grunde bewegt sich in Schubert wohl ein stärkeres Selbstbewusstsein und erzielt er sein Unabhängigkeitsempfinden zu aufrechtzuerhalten, jedoch zählt die Beziehung und der Vergleich zu anderen Künstlern, insbesondere Beethoven, noch immer mit und stellt in Wirklichkeit nicht das Neue den künstlerischen Bezugspunkt dar; an erster Stelle messt sich das Neuwertige für Schubert erst durch seine Position gegenüber den großen Meistern ab. 2.3 Das Selbstbild Wenn sich letztendlich die vorhergehenden Betrachtungen bezüglich Beethovens und Schuberts Künstlertum auf ein Selbstbild gebracht werden sollen, so hat die bisherige Analyse eine ziemlich gleichlaufende Antwort auf die Frage, was sie als Künstler wollen und anstreben, formuliert, nämlich Freiheit. Dennoch versteht sich diese Freiheit sehr breit und manifestiert sie sich bei beiden Komponisten ganz anders. Beethoven bezweckt die Freiheit des Selbst. In der Konfrontation mit den vielen Rückschlägen, die er empfindet, und des fortwährenden Gefühls der Unruhe und Unzufriedenheit, dass nichts nach seinen Vorstellungen verläuft, bedeutet „ Freiheit―, die Möglichkeit das Selbst in der eigenen Hand zu haben und getrennt von auswärtigen Einflüssen zu bestimmen. Schubert dagegen besitzt ein starkes Autonomiebewusstsein und versteht „Freiheit― daher vielmehr als den Versuch, seine Selbstständigkeit zu bewahren und sichern. Ein anscheinend trivialer Unterschied vielleicht, aber dennoch von großer Bedeutung. Denn was für Beethoven als ein unerreichtes Ziel gilt, bedeutet für Schubert gerade eine Realisierung. In anderen Worten: Als Künstler treibt Beethoven ein Lebensideal, Schubert eine Lebensart. Zweck dieses Kapitels war aber nicht, die Lebensphilosophie von Beethoven und Schubert bloßzulegen. An dieser Stelle erhebt sich indessen die essenzielle Frage, wie das Künstlertum der Komponisten zu diesem Verständnis passt. Und dabei handelt es sich in erster Linie nicht um die Frage, wie sie sich als Künstler sehen. Dass beide Komponisten sich ihres künstlerischen Potenzials bewusst sind, ist über allen Zweifel erhaben. Wenn man ein Selbstbild als Gegenstand hat, wäre es eben relevanter, sich zu 60 fragen, was das Künstlersein für die Komponisten repräsentiert und wie sie es bewerten. Für Beethoven geht das Wesen seines Künstlerverständnisses überwiegend mit der Erkenntnis eines Scheiterns einher. Beethovens Künstlertum ist keine Existenzgrundlage. Es bedeutet vielmehr die Behinderung des Lebensideals, an erster Stelle Freiheit zu gewinnen. Die Musik bestimmt wohl einen ungeheueren großen Teil von Beethovens Handeln, sein Künstlertum ist dennoch seiner Kunst ähnlich: auferlegt, nie die Seine. Als Künstler realisiert sich die Erfüllung einer Pflicht, nicht der eigenen Wahl. Deswegen tritt Beethoven in seinen Briefen nie als Gebieter über die eigene Kunst oder seine eigene Fähigkeiten hervor, ringt er so offen mit der Frage seiner kreativen Autonomie und fühlt er sich innerlich oder aber auswärtig, gehemmt in demjenigen, was er macht. Beethovens Versuche, ein musikalisches Programm vorzuzeichnen, sind in dieser Hinsicht eher Versuche, seinem Leben anhand der Musik irgendwelche Struktur zu verschaffen. Als Lebensprogramm ist sie aber ohnmächtig, ihm die erlangte Eigenständigkeit zu sichern. Er lebt folglich durch seine Musik, nicht für sie. Damit möchte dieser Schluss Beethovens künstlerische Integrität überhaupt nicht in Zweifel ziehen. Aufgrund seiner Briefen zeichnet sich aber ein Selbstbild, das dem Künstlersein eher utilitaristisch und ablehnend gegenübersteht, ab. Obwohl sich bei Schubert in gewissem Maße immer das Problem ergibt, dass man sich auf viel weniger Briefmaterial verlassen kann, um zu einer nuancierten Schlussfolgerung zu kommen, fällt jedoch direkt ins Auge, dass der Komponist seine Künstlerschaft ganz anders bewertet als Beethoven. Der Betrachtung am Anfang gemäß, fällt Künstlersein für Schubert wirklich mit einer Lebensweise zusammen. Das Alltägliche und das Besondere vereinigen sich im Künstler. So kann man „ein verheiratheter Künstler― 137 oder „ein verdorbener Musikant― 138 sein, der Künstlertyp wird in jedem Fall erst durch ein Adjektiv bezeichnet und ist also Nebensache. Künstlertum besagt für Schubert seine Eigenheit (und dieses Selbstbewusstsein tritt in seinen Briefen wie gezeigt ausgesprochen hervor), aber nicht in dem Sinne, dass er sich als Auserwählter betrachtet. Schubert umschreibt sein Schaffen nicht als inspiriertes Hinwerfen; wie er es sieht, stellt es ein ständiges Arbeiten zur Bewahrung seiner Lebensart dar. 137 138 Schubert an Vater und Stiefmutter, 25. (28.) Juli 1825 (SDL, S.300) Schubert an Schober und die anderen Freunde, 3. August 1818 (SDL, S.63) 61 Schließlich lässt sich also folgern, dass sowohl für Beethoven als auch Schubert Künstlertum eher Beruf als Berufung repräsentiert. Zwar setzen sich beide Komponisten ganz unterschiedliche Ziele - die Realisierung bzw. Beibehaltung der Eigenständigkeit -, die Kunst manifestiert sich aber nie als Zweck an sich. Als Künstler suchen Beethoven und Schubert nämlich nicht nach einer seelischen „Identifikation mit der Musik―. 139 Sie betrachten ihr Künstlertum vielmehr als die Erfüllung des eigenen Nutzens. 139 Hanna Stegbauer: Die Akustik der Seele. Zum Einfluss der Literatur auf die Entstehung der romantischen Instrumentalmusik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2006, S.91 62 3. Wien und das Ausland Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Beethovens und Schuberts Blick auf Wien und das Ausland, und zwar mit der Frage, wie sie sich zu diesen lokalen bzw. regionalen und nationalen Ebenen verhalten. Im Allgemeinen werden dazu vor allem ihre Beschreibungen Beachtung gewidmet und wird sich die Frage erheben, wie sich ihr Selbstbild auf ihre Umwelt bezieht. Zuerst soll in dieser Hinsicht den nationalen Gegensatz zwischen Österreich und dem Ausland sowie der Umgang der beiden Komponisten mit ihm gedeutet und erklärt werden. Danach wird dieser allgemeine, nationale Kontrast verdeutlicht am Beispiel von ihrer Beziehung zu Wien, und für Beethoven zusätzlicherweise zu London. In einem dritten, abschließenden Teil wird sich die Untersuchung auf die spezifischen Folgen für das Selbstbildverständnis Beethovens und Schuberts und seinen Anteil in der Beziehung der Komponisten zu ihrer (geografischen) Umwelt richten, und schließlich die beiden einander gegenüberstellen. 3.1 Die nationale Ebene: Österreich und das Ausland 3.1.1 Beethovens Drang ins Ausland 3.1.1.1 Der arme, österreichische Musikant Obwohl Beethoven schon 1792 als Zweiundzwanzigjähriger von Deutschland nach Österreich übersiedelte und dort die weiteren dreiundfünfzig Jahre seines Lebens verbringen würde, identifiziert er sich in seinen Briefen nie als Österreicher. Ganz im Gegenteil: Das Bild, das Beethoven von dem österreichischen Staat beschreibt, ist rundheraus negativ. Das heißt aber nicht, dass er sich nicht um die Lage Österreichs kümmert. Etwas verblümt drückt er 1817 seine Besorgtheit wie folgt aus: „Was mich anbelangt, so ist geraume Zeit meine Gesundheit erschüttert, wozu Ihnen auch unser Staatszustand nicht wenig beiträgt, wovon bis hierher noch keine Verbesserung zu erwarten, wohl aber sich täglich Verschlimmerung desselben ereignet―. 140 Der Kern von 140 Beethoven an Franz v. Brentano, 15. Febr. 1817 (BSB, Brief 710) 63 Beethovens Beschreibung umfasst hier die Metaphorik des erkrankten Staates. Zwar bemerkt er eine fortwährende „Verschlimmerung― und mutet „keine Verbesserung― äußerst pessimistisch an, jedoch spricht er zugleich die Hoffnung, zumindest die Möglichkeit zur Gesundung aus, die sich im Verb „erwarten― versteckt. Schon bald aber schlägt dieser latente Zukunftsglaube in Pessimismus um und glaubt sich Beethoven nur noch von Unmoral umringt: „[…] wäre man bei dieser gänzlichen moralischen Verderbtheit des österreichischen Staates nur einigermaßen überzeugt, einer rechtschaffene Person erwarten zu können, so wäre alles leicht gemacht, aber aber - !!!―. 141 Der frühere Glaube an die Verbesserung der Lage hat der Hoffnungslosigkeit, die aber hier noch unausgesprochen bleibt und nur durch die stockenden Gedankenstriche insinuiert wird, das Feld geräumt. Sieben Jahren nach diesen Aussagen, 1824 also, hat sich für Beethoven aber noch immer nichts zum Guten geändert und drückt er seine Enttäuschung diesmal ganz offen aus: „Es gibt Konvenienzen, denen man unmöglich ausweichen kann, um so mehr, da ich von auswärtigen Verhältnissen abhängig bin, indem mir Österreich nichts als Verdruß und nichts zu leben gibt―. 142 Entscheidend für Beethovens Selbstbild sind hier die Schlussfolgerungen von Ursache und Folge, die er zieht. Die Unmöglichkeit, sich als Österreicher zu identifizieren, betrachtet er nicht als eine Unfähigkeit seinerseits, sondern vielmehr als eine unvermeidliche Folge. Indem ihm der österreichische Staat nämlich „nichts als Verdruß― bietet und er dadurch - mit einer dramatischen Wendung „nichts zu leben― hat, wurde er fast dazu gezwungen („unmöglich ausweichen―), sich auf das Ausland zu richten. Beethoven begründet seinen Drang ins Ausland (siehe 3.1.1.2) auf diese Weise nicht als die Folge seines Willens. Er spielt sich vielmehr als ein Opfer auf, dessen ausländische Beziehungen nicht freiwillig zustande gekommen sind, sondern das dazu getrieben wurde. Außerdem behindern diese Beschränkungen auch seine Freiheit als Künstler, indem er in einen Zustand der Abhängigkeit versetzt wurde. Extra Bestätigung finden Beethovens Versuche, sich als Opfer des Staates darzustellen, im Bild des armen österreichischen Musikanten, das er von sich gibt. Identifiziert er sich auf diese Weise nämlich doch als österreichischen Bürger, so macht 141 142 Beethoven an Nanette Streicher, 7. Juli 1817 (BSB, Brief 745) Beethoven an Diabelli (unsicher), 1824 (BSB, Brief 1211) 64 er es nur, um den Kontrast zum Ausland zu betonen. Es soll ist in dieser Hinsicht nicht erstaunen, dass er diese Formel am meisten in seinen Briefen an Ferdinand Ries, seinen Schüler in England, verwendet. Die Umschreibungen bewegen sich zwischen der eines „armen österreichischen Musikanten!― 143 über „einen armen kränklichen österreichischen Musikanten„ 144 bis zu der französischen Form „pauvre musicien autrichien―. 145 Eine frühe Kontur dieses Bildes verrät aber einen auffallenden Gedankengang, da schon hier der Gegensatz zum (Wunsch)Bild des Musikanten in England ausprägt, das sich später noch deutlicher abzeichnen wird (siehe 3.2.1.2): „Das ist nun freilich für einen Engländer nichts, aber für einen armen Deutschen oder vielmehr Österreicher sehr viel―. 146 3.1.1.2 Die Lockung des Auslandes Die Wurzeln mit seinem Vaterland hat Beethoven nie durchschnitten. In seinen Briefen verweist er meistens affektvoll auf das Land, das er als junger Mann verlassen hat. Trotz der wenig inspirierenden Umstände in Bonn, die Beethoven dazu veranlassten, nach Wien zu gehen,147 redet er in seinen Briefen nie im negativen Sinne über seine 143 Beethoven an Ferdinand Ries, 20. Januar 1816 (BSB, Brief 556) Beethoven an Nanette Streicher, 1817 (BSB, Brief 762) 145 Beethoven an Ferdinand Ries, 16. Juli 1823 (BSB, Brief 1134) 146 Beethoven an Ferdinand Ries, 22. Nov. 1815 (BSB, Brief 542); Interessant ist hier auch die Anpassung von „Deutschen― zu „Österreicher―. Der Grund dafür ist nicht eindeutig. Tatsächlich sah der deutschsprachige Raum in post-napoleontischen Zeichen, sicherlich nach dem Wiener Kongress 1815, ganz anders aus (vgl. Hagen Schulze: Kleine deutsche Geschichte. Mit Grafiken, Karten und Zeittafel. 9., aktualisierte und erweiterte Auflage. München: C. H. Beck‘sche Verlagsbuchhandlung 2008, S.78-80). Einerseits wäre eine andere Möglichkeit, dass Beethoven Wien (und Österreich) als Teil eines größeren Deutschlands oder „deutschländischen― Raums sieht. Dafür spreche einen früheren Verweis auf Wien Anfang 1815: „ich lebe beinahe allein in dieser größten Stadt Deutschlands―. Die Spezifizierung zu „Österreicher― könnte aber auch rhetorisch bedingt sein, indem die Aufteilung in kleineren Nationen es Beethoven erlaubt, die Gegensätze zwischen den Ländern zu verschärfen. Zuletzt kann es darauf deuten, dass Beethoven sich mehr Österreicher als Deutscher fühlt, sich sogar ganz als Österreicher betrachtet. Diese Auffassung ist aber unwahrscheinlich. Beethoven hat sich nämlich einerseits nur an diesen Stellen als Österreicher dargestellt, sich andererseits nie von seinem vaterländischen Deutschland distanziert (siehe 3.1.1.2). 147 Beethoven erkannte schon als Sechszehnjähriger, dass Bonn zu klein für ihn geworden war (vgl. François Martin Mai: Diagnosing genius: the life and death of Beethoven. Montreal/Quebec/Kingston: McGill-Queen's Press 2007, S.36) Seine definitive Umsiedlung von Bonn nach Wien war aber nie geplant. Sie ist eher hervorgegangen aus einer (zweiten) Reise nach der Stadt, während der er sich vervollkommnen wollte bei Haydn: „These early distinctions […] made the idea of travel to Vienna and a final apprenticeship with Haydn seem like a logical next step. […] The object of this second trip was to 144 65 Heimat. Im Gegenteil, das Ideal, das er einst von Wien gemacht hat, scheint er eher wiederum auf Deutschland zu übertragen, wie in diesem Brief an Franz von Brentano, den Ratsherren der Stadt Frankfurt: „Ihren Umgang wie Ihrer Frau Gemahlin und lieben Kindern vermisse ich gar sehr; denn wo wäre etwas dergleichen hier in unserem Wien zu finden―.148 Das zarte Bild der deutschen Familie, das Beethoven hier skizziert, bildet einen scharfen Kontrast zu dem implizit kalten Wien. Das Possessivpronomen „unserem― deutet in dieser Hinsicht also nicht auf eine emotionale Identifikation mit der Stadt hin. Vielmehr verbalisiert es die Beziehung, in der Wien als Wohnsitz zu Beethoven steht, genau wie es in Bezug auf Deutschland auch als sprachlicher Ausdruck seiner dortigen Familienbände fungiert. 149 Beethoven leugnet diese Bindungen zu Deutschland in seinen Briefen auch überhaupt nicht und gibt seine deutsche Identität nie auf. Diese Neuidealisierung seiner einst verlassenen Heimat könnte wohl zu einer allgemeinen Einstellung des grünen Grases auf der anderen Seite, oder einer gemilderten Projektion des zeitgeistlichen Wanderer-Motivs passen. Die bleibende Identifikation als Deutscher erlaubt Beethoven aber ebenfalls eine weitere Einfühlung als Opfer des Staates: „Ich hege die Hoffnung, vielleicht künftiges Jahr meinen vaterländischen Boden betreten zu können und die Gräber meiner Eltern zu besuchen―. 150 Nicht nur beschreibt Beethoven Deutschland hier als sein Vaterland; er verstärkt diese Beziehung in einem romantischen, an Schmidt von Lübecks „Der Wanderer― erinnernden Ton151 noch durch die Erwähnung der „Gräber [s]einer Eltern―. Die affektive Verbundenheit mit Deutschland steht hier jedoch nicht im Mittelpunkt. enrich his artistry through study with Haydn and, perhaps more important, to gain the imprimatur of the celebrated composer; then he would return to Bonn to assume a key position in court music affairs―. (Tia DeNora: Beethoven and the construction of genius: musical politics in Vienna, 1792-1803. Berkeley/Los Angeles: California University Press 1995, S.1). Dazu kam auch noch der Tod seines Vaters, durch den er pater familias wurde und folglich für seine zwei jüngeren Brüder sorgen musste (vgl. Jennifer Viegas: Beethoven's World. New York: Rosen Publishing Group 2008, S.23). 148 Beethoven an Franz v. Brentano, 15. Febr. 1817 (BSB, Brief 710) 149 vgl. Beethoven an Peter Simrock, 19. März 1821 (BSB, Brief 994): ―Dieser sonderbare, aber schreckliche Winter hier, wovon man in unseren Ländern keinen Begriff hat, ist schuld daran‖.; Beethoven an Luigi Cherubini, 15. März 1823 (BSB, Brief 1086): ―Nur muß die Kunstwelt bedauern, daß seit längerer Zeit, wenigstens in unserem Deutschland, kein neues theatralisches Werk von Ihnen erschienen ist‖. 150 Beethoven an Peter Simrock, 5. August 1820 (BSB, Brief 980) 151 vgl. ―Wo bist du, mein geliebtes Land? […] //Wo meine Freunde wandeln gehn,/Wo meine Toten auferstehn‖ (Georg Philipp Schmidt von Lübeck: „Der Wanderer―. In: Texte deutscher Lieder. Ein Handbuch. Hrsg. und eingeleitet v. Dietrich Fischer-Dieskau. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 200313, S.137 66 Gerade die Unfähigkeit, seine Heimat „betreten zu können―, bildet den Kern des Problems, indem er fast als ein „Expatriat― von seinem Geburtsland und seiner familialen Wurzeln abgesondert lebt. Diese Idee kommt einige Monate früher in einem Brief an Peter Simrock, der offensichtlich Beethovens Neffen Karl nach Bonn eingeladen hatte, zum Ausdruck: Was Karl betrifft, so konnte ich ihn nicht einmal nach Landshut […] bringen. Was glauben Sie, wie man schreien würde über Bonn, man würde gleich aus dieser Bonna eine Mala machen. In diesem Stück haben die Chinesen und Japanesen [sic] noch einen Vorzug vor unserer Kultur, wenn sie niemanden außer Landes lassen, da wenigstens eine andere Religion, andere Sprache, andere Sitten für sie anstößig gefunden werden können. Was soll man aber sagen, wenn man sozusagen aus einer Provinz in die andere nicht darf, wo Religion etc. alles eben so, höchstens vielleicht besser ist?!!!152 Österreich wird hier sehr deutlich zur Zielscheibe von Beethovens Zorn. Ist es schon explizit genug, dass eine Reise nach Bonn - mit einem erfinderischen Wortspiel - eine „Bonna― wäre, so macht es Wien implizit auch zu einer „Mala―. Die Parallele mit den Chinesen und, vermutlich rimae causa, „Japanesen― spielt folglich auf denselben Vergleich an. Die Einsperrung des Individuums ist nicht an sich falsch und inkorrekt, sondern nur wenn es seine Entwicklung zurückhält, soll es ein grober Verstoß sein. Diese Spießbürgerlichkeit der Wiener widerspiegelt auch die interne, sprachliche Opposition zwischen dem internationalen Referenzpunkt „China― - „Japan― - „außer Landes― und dem lokaleren „aus einer Provinz in die andere―. Abgesehen von Beethovens emotioneller Bindung zu seinem Vaterland, bildet Deutschland weiterhin eine Projektion seines Drangs ins Ausland. So behauptet er gegenüber dem Wiener Treitschke, dass ihn „ein jeder Ort Deutschlands oder anderwärts, so gut als jeden anderen wenigstens mit Gold honorieren wird― 153 oder betont er umgekehrt die Notwendigkeit seiner Anwesenheit in Deutschland: Wie gern möchte ich dem Enthusiasmus der Berliner mich persönlich beifügen können, den Sie im Fidelio erregt! […] Wenn Sie Baron de la Motte Fouqué in meinem Namen bitten wollen, ein großes Opernsujet zu erfinden, welches auch zugleich für Sie passend wäre, da würden Sie sich ein großes Verdienst um mich und um Deutschlands Theater erwerben; - auch wünschte ich solches 152 153 Beethoven an Peter Simrock, 10. Febr. 1820 (BSB, Brief 953) Beethoven an Czerny (unsicher), 1817 (BSB, Brief 522) 67 ausschließlich für das Berliner Theater zu schreiben, da ich es hier mit dieser knickerigen Direktion nie mit einer neuen Oper zustande bringen werde. 154 Auf drei Ebenen erzeugt Beethoven in diesem Brief den Gegensatz Deutschland Österreich. Zuerst betont er seine Abwesenheit in Deutschland, indem er das Bedauern ausdrückt, den Erfolg von „Fidelio― nicht selber in Empfang nehmen zu können. Obwohl er diese Enttäuschung hier nur kurz erwähnt, ist diese Idee von großer Bedeutung für seine Beziehung zu London (siehe 3.2.1.2). Zweitens stellt Beethoven eine direkte Verbindung zu Deutschland her, durch die Koppelung von dessen Theater mit seinem Wohl, deren kausale Verflochtenheit die Wiederholung von „großes― bei „Opernsujet― und „Verdienst― zum Ausdruck bringt. Im scharfen Kontrast zu diesem sowohl persönlichen als auch allgemein-künstlerischen „großen― Heil einer neuen Oper steht die „knickerig[e] Direktion―, mit der Beethoven sich auf der anderen Seite die verfremdende Distanz zu Wiens starrer Kulturpolitik zu erkennen gibt und seine Annäherungsversuche an Deutschland legitimiert. Beethovens Drang ins Ausland reicht aber weiter als nur Deutschland und geht zudem oft mit einer ökonomischen Pragmatik einher. So fühlt er sich noch ausdrücklicher zu London hingezogen (siehe 3.2.1.2) und erzielt er im Allgemeinen eine so weit wie mögliche Verbreitung seiner Werke (siehe unten und 3.2.1.3). An erster Stelle richtet Beethoven seinen Blick dazu auf Europa: „Die 8 Themata mit Variationen wie auch die Schottischen Lieder können Ihr Eigentum sein für Deutschland, Italien, Frankreich, Holland, kurz für den ganzen Kontinent. Schottland und England ist davon ausgenommen―. 155 Beethoven asseriert sich fast direkt als Führer der Verhandlungen. 156 Einerseits versetzt das Modalverb „können― ihn in der Lage, Bedingungen zu stellen. Dazu fällt auch der possessive Ton, der sich mit „Eigentum― verbinden lässt, auf. Andererseits macht es das eventuelle Erhalten der Lieder zu einer Ehrensache, einer achtbaren Auserwählung. 157 Zu diesem Punkt trägt 154 Beethoven an Anna Milder-Hauptmann, 6. Januar 1816 (BSB, Brief 553) Beethoven an Peter Simrock, 14. März 1920 (BSB, Brief 959) 156 Siehe dazu auch 2.1.4 157 vgl. hier dazu auch einen Brief an den Verleger Probst aus 1824, in dem Beethoven eine ähnliche Logik verwendet und seinen Forderungen Nachdruck verleiht, durch die Exklusivität des Werkes und das ausländische Verlangen nach ihm zu betonen: ―Letztere ist wirklich schon vergeben; aber die Symphonie betreffend, welche die größte, welche ich geschrieben habe und weswegen mir sogar Künstler vom Ausland Vorschläge gemacht haben, so wäre es zu machen, daß sie selbe erhalten könnten‖ [eigene Hervorhebungen]. (Beethoven an A. Probst, 28. August 1824 (BSB, Brief 1232)) 155 68 darüber hinaus auch die Wechselwirkung zwischen der Aussicht auf einen sehr weiträumigen Besitz zum einen, dem etwas ungelenken Versuch einer „teil und herrsche―-Regelung zum anderen, am Ende des Zitats bei. Beethovens Ehrsucht übersteigt aber die Grenzen Europas und verrät sogar einen mondialen Zug: „Gibt mir nur Gott meine Gesundheit wieder, welche sich wenigstens gebessert hat, so kann ich allen den Anträgen von allen Orten Europas, ja sogar aus Nordamerika Genüge leisten und ich dürfte noch auf einen grünen Zweig kommen―. 158 Die Realisierbarkeit dieses weltumspannenden Ehrgeizes sei weniger relevant an dieser Stelle. Wichtiger aber ist, dass Beethoven seine Neigung zum Ausland als den nächsten, erforderlichen Schritt in seiner künstlerischen Entwicklung, die er offenbar zum Stillstand gekommen glaubt, betrachtet und begründet. Die hyperbolische Häufung von „allen den Anträgen von allen Orten Europas, ja sogar aus Nordamerika― bildet einen starken Kontrast zu der Verzweiflung, die „dürfte― zum Ausdruck bringt und steigert in dieser Hinsicht das physische Leid, das Beethoven empfindet, zu einem psychischen. Zum Schluss wäre es falsch und kurzsichtig, diesen Drang ins Ausland nur als eine vergeblich gehegte Hoffnung zu betrachten. Konnte Beethoven nicht bei seinen auswärtigen Erfolgen anwesend sein, so hat er dennoch fleißig die Herausgabe seiner Werke erwirkt und äußerst erfolgreich nach ausländischen Verlegern gesucht, um seinem Wiener Rahmen zu entfliehen (siehe 3.2.1.3). Beethoven ist durch seine physische Abwesenheit auf „virtuelle―, schriftliche Verhandlungen angewiesen und nimmt in seinen Briefen eine sehr patriarchale und dominante Haltung 159 als Bestätigung eines eher romantischen Selbstbewusstseins ein: Der Künstler ist nicht nur Gebieter in der Kunst, sondern auch in der profanen Welt. Die vielen Verträge und Ausnahmen, die er als Ausdruck dieser Allmacht für die Veröffentlichung seiner Werke bestimmte, führten offensichtlich zu einer weitgehenden Verwirrung, wie für seine neunte Symphonie: „Quant au bruit dont vous m‘écrivez, qu‘il existe un exemplaire de la 9. Symphonie à Paris, il n‘est point fondé. Il est vrai que cette Symphonie sera publiée en Allemagne, mais point avant que l‘an soit écoulé pendant lequel la Société en jouir―. 160 Beethoven hat es sich selbst tatsächlich schwer gemacht. Die Symphonie ist zwar für die Londoner philharmonische Gesellschaft bestimmt, einem deutschen 158 Beethoven an Ferdinand Ries, 20. Dez. 1822 (BSB, Brief 1044) Siehe dazu auch 2.1.4 160 Beethoven an Charles Neate, 15. Januar 1825 (BSB, Brief 1268) 159 69 Verleger gehören aber die Rechte der Publikation. Dass in dieser Hinsicht „bruit[s]― über eine Fassung der Symphonie in Paris entstanden sind, ist nicht erstaunlich. Schon im Brief an sich lassen sich die wahren Verhältnisse nur schwer erfassen. Auffallend ist außerdem, dass Beethoven sich gar nicht über diese Gerüchte begeistert. Er widerlegt sie wohl, missbilligt sie jedoch nicht. In einem anderen Brief sieht er sie sogar eher als eine Bezeugung seines Erfolges: „Bremen hat sie [die 9. Symphonie] nie erhalten. Ebensowenig Paris, wie man mir von London aus schrieb. Was muß man nicht alles ertragen, wenn man das Unglück hat, berühmt zu werden!―.161 Die „Internationalität― ist komplett hier. Sowohl in Bremen als in Paris sollten falsche Gerüchte zur Herausgabe seiner Symphonie aufgetaucht sein. Darüber hinaus hat er diese Geschichte nicht aus der französischen Hauptstadt selbst, aber gerade aus London erfahren. Explizitere Schlussfolgerungen auf Beethovens Selbstbild finden sich aber im letzten Satz, in dem er diese neue bruits als ein „Unglück―, aber zugleich als eine Anerkennung, sogar eine unvermeidliche Folge seiner Bekanntheit bezeichnet. Fast wie Heines Atlas 162 nähert Beethoven seinem Ruhm negativ an, macht hier buchstäblich „aus dieser Bonna eine Mala―, steigert und bestätigt schließlich dadurch aber sein internationales Ansehen. 3.1.2 Schubert: Verringerung des Auslandsbegriffs Man könnte dagegen sagen, diese ablehnende Einstellung Beethovens sei ganz üblich und bekunde im Grunde die Gesinnung, dass das Gras auf der anderen Seite immer grüner sei. In dieser Behauptung steckt wohl ein nicht zu vernachlässigender Wahrheitsgehalt, dennoch zeigt sich anhand Schuberts Haltung Österreich gegenüber, dass es sich auch anders aufweisen kann. Bei ihm findet sich nämlich zwar auch eine Ablehnung Österreichs, dennoch wendet er sich nie explizit gegen den Staat selber. Österreich bildet eher eine auffällige Abwesenheit in den Briefen Schuberts. Er erwähnt sein Vaterland nie, sodass seine Beziehung zu Österreich nur ex negativo zum Ausdruck kommt. Das hat vor allem damit zu tun, dass er kein Eingewanderter wie Beethoven, 161 Beethoven an Ferdinand Ries, 1825 (BSB, Brief 1274) vgl. ―Die ganze Welt der Schmerzen muß ich tragen,‖ (Heinrich Heine: Buch der Lieder. Hrsg. v. Bernd Kortländer. Bibliografisch ergänzte Ausgabe. Stuttgart: Reclam Verlag 2006, S.128) 162 70 sondern „von Wien gebürtig―163 ist. Schubert identifiziert sich sehr ausgesprochen mit seiner Geburtsstadt, als bilde sie eine fast staatlich isolierte Gemeinschaft für ihn (siehe 3.2.2). Darüber hinaus gibt es ebenfalls einen Unterschied beim Auslandverständnis zwischen den beiden Komponisten: Beethoven projiziert seinen auswärtigen Drang auf die europäische, latent sogar transkontinentale Ebene, während Schubert seine Reisen im beschränkteren österreichungarischen Gebiet schon gleicherweise betrachtet. Hinsichtlich der Beziehung der Komponisten zu dem nationalen Kontrast Österreich Ausland bedeutet das aber, dass Schubert, im Gegenteil zu Beethovens groß angelegter, manchmal etwas naiver Auslandperzeption, Österreich nicht (ausgesprochen) negativ gegenübersteht, sondern sich vielmehr an die kleinere, in Beethovens Augen lokale Ebene seiner Heimatstadt orientiert und sich aus dieser geringeren Perspektive seinerseits gegen das Ausland sträubt. 3.2 Die lokale Ebene: Wien und London 3.2.1 Beethoven 3.2.1.1 Wien Von seiner Umsiedlung 1792 bis zu seinem Tode hat Beethoven in Wien gelebt - oder eher gewohnt, denn, auf seine Briefen über die Stadt hin, hat sie ihm ein nur sorgenreiches Leben verschafft. Beethoven äußert sich fast ständig im negativen Sinne über Wien und setzt sich nie gleich mit mir. Er positioniert sich vielmehr als Einzelgänger in der Stadt, der, obwohl umgeben von vielen Menschen, immer allein ist. Dieses Gefühl kommt schon 1815 deutlich zum Ausdruck: „[…] ich kann sagen, ich lebe beinahe allein in dieser größten Stadt Deutschlands, da ich von allen Menschen, welche ich liebe, lieben könnte, beinahe entfernt leben muß―. 164 Beethoven verstärkt seinen Ausdruck der Einsamkeit durch den Gegensatz zwischen „allein― und „größten―. Wien ist nicht nur „groß―, sondern bekommt durch den Superlativ einen zusätzlichen Hauch von Anonymität und Einsamkeit. Trennt dieser Kontrast Beethoven schon durch 163 Schubert an Kaiser Franz II., 7. April 1816 (SDL, S.354) Beethoven an Karl Amenda, 12. April 1815 (BSB, Brief 494); vgl. zu der Beschreibung von Wien als einer deutschen Stadt 3.1.1.1. 164 71 diesen Abstand von der Stadt ab, so schränkt „lieben könnte― zugleich die Möglichkeiten zur Integration seinerseits ein. Die Vereinsamung ist aber nicht komplett. Beethoven betont wohl die Verlassenheit in Wien, die doppelte Hinzufügung von „beinahe― nuanciert die Radikalität der Isolation und eröffnet zugleich Annäherungsmöglichkeiten. Von großer Bedeutung ist auch die Fortsetzung des Briefes, mit der Beethoven zugleich ausländische Aussichten zu eröffnen und das Ausbrechen aus Wien mittels seine Kunst zu ermöglichen versucht: „- Auf was für einem Füß ist die Tonkunst bei Euch? hast Du schon von meinen großen Werken gehört?―.165 Der Kern der Sache bleibt allerdings, dass sich Beethoven in Wien verloren fühlt 166 und sein dortiges Leben als geprüft betrachtet: „In Leipzig kann man sich schwerlich einbilden, wie man in und um Wien herum nie ungeplagt leben könne―.167 Auch hier zeichnet sich der durch die Litotes „nie ungeplagte― verstärkte Vergleich mit dem Ausland ab, der sich weiterentwickelt zu dem Gedanken, dass nebst seinem Gesundheitszustand, die Stadt ihn auch hindere an seinem künstlerischen Fortschritt, sogar seiner Existenz: „Wäre meine schon seit Jahren fortdauernde Kränklichkeit nicht, so hätte mir das Ausland soviel verschafft, ein sorgenfreies Leben, ja nichts als Sorgen für die Kunst zu haben―168 oder „[…] und daß, wenn meine Kränklichkeit nicht wäre, ich leider längst hätte müssen Wien verlassen, um für meine Zukunft unbesorgt zu sein―. 169 Dieses Gefühl der Beschränkung steigert sich zu einer feindseligen Haltung den Wienern gegenüber. Die Animosität schwächt sich während Beethovens letzter Jahre wohl zu beinahe volkstümlichen Weisheiten ab, 170 die Verweise auf Wiener in vorangehenden Jahren drücken aber ein Gefühl der Bedrohung aus, indem Beethoven sie als einen ihm feindselig gegenüberstehenden Block betrachtet („Verflucht, verdammt, vermaledeites, elendes Wienerpack!―) 171 und sie sogar der Verschwörung 165 Ebd. vgl. den Skizzenblatteintrag aus 1824, (BSB, Dokument 1255): ―Beständig alle Kräfte brauchen, anspannen; auch nicht so manches verloren, wie in Wien―. 167 Beethoven an C. F. Peters, 13. Sept. 1822 (BSB, Brief 1038) 168 Beethoven an von Könneritz, 25. Juli 1823 (BSB, Brief 1138) 169 Beethoven an Graf Dietrichstein, Ende 1822 (BSB, Brief 1052) 170 vgl. ―Du gehörst einmal schon unter die Wiener‖ (Beethoven an Karl v. Beethoven, 28. Juni 1823 (BSB, Brief 1308)); ―Vergebens, ein Wiener bleibet ein Wiener‖ (Beethoven an Karl v. Beethoven, 15. Juli 1825, Brief 1316). 171 Beethoven an Karl Bernard, 15. Sept. 1819 (BSB, Brief 911) 166 72 verdächtigt: „Es fehlen alle Berichte, während ich von beständigen Verrätereien und Komplotten höre, wohl auch selbst wahrnehme―. 172 Trotz dieser rundheraus pessimistischen Einstellung Wien gegenüber, leugnet Beethoven aber auch die Vorteile, die die Stadt ihm erbringt, nicht. Er ist sich neben seiner teils selbst gewählten Außenseiterposition, auch seiner Bedeutsamkeit für die Stadt bewusst. Dieses Selbstbewusstsein kommt an erster Stelle zum Ausdruck durch die mehrmaligen Hinweise auf die Tatsache, dass sein Name schon als Adresse genügt: „N.B. Sie haben gar keine andere Adresse nötig als ‚an Ludwig van Beethoven in Wien‗―. 173 Beethovens Bedeutung für die Stadt fungiert außerdem auch als Überredungsmittel bei Geschäftsverhandlungen. Einerseits erlaubt es ihm ausländische Verleger zu bedrängen, indem er einen möglichen Verkauf, sogar eine Schenkung an Wiener Musikanten unterstellt: „Je suis content de cette offre [100 Sterling für Streichquartette], mais il est nécessaire de vous avertir, que le premier Quatuor est si cherché par les plus célèbres artistes de Vienne, que je l‗ai accordé quelques uns d‘eux pour leur bénéfice―. 174 Abgesehen von einem gefügigen Gönner („je l‘ai accordé―), stellt sich Beethoven zugleich dar als ein sorgsamer Philanthrop, der sich um den „bénéfice― der anders so gering geschätzten Wiener kümmert. Aber auch in umgekehrter Richtung scheut sich Beethoven nicht, seine Wichtigkeit für Wien zu betonen. Während er 1815 nämlich damit beschäftigt ist, eine Zulage von 1500 fl., also finanzielle Unbesorgtheit zu sichern, lässt er die feine Bemerkung fallen, dass er, bei Misslingen, die Stadt verlassen soll: „Möge Ihre Freundschaft das Ende herbeiflügeln, denn ich muß, wenn die Sache so schlecht ausfällt, Wien verlassen, weil ich von diesem Einkommen nicht leben würde können […]―.175 Letztendlich bekam er die Zulage. 172 Beethoven an S. A. Steiner, 1816 (BSB, Brief 640) Beethoven an Moritz Schlesinger, 25. März 1820 (BSB, Brief 963); vgl. dazu auch ―My name on the address of letters is sufficient security for their reaching me― (Beethoven an Charles Neate, 25. Febr. 1823 (BSB, Brief 1075)); ‚[…] so bitte ich mir gnädigst die Aufschrift ‚An L. v. Beethoven in Wien‗ mache zu lassen, wo ich alle Briefe auch hier durch die Post ganz sicher erhalte.― (Beethoven an Erzherzog Rudolf, 1. Juli 1823 (BSB, Brief 1129)); ―In der Unterschrift an mich schreiben Sie mir „in Wien― wie gewöhnlich‖. (Beethoven an Hans G. Nägeli, 9. September 1824 (BSB, Brief 1236)) 174 Beethoven an Charles Neate, 25. Mai, 1825 (BSB, Brief 1301) 175 Beethoven an Dr. Johann Ranka, 14. Januar 1815 (BSB, Brief 476); vgl. auch die gleich subtile Drohung in einem späteren Brief an Ranka „Frage? Wie wird es denn gehen, wenn ich mich entferne, und zwar aus den österreichischen Ländern, mit dem Lebenszeichen, wird das von einem nicht österreichischen Orte unterzeichnete Lebenszeichen gelten?― (Beethoven an Dr. Johann Ranka, April 1817 (BSB, Brief 723)). 173 73 3.2.1.2 London Obwohl Beethoven seine Position in Wien vor allem für wirtschaftliche Angelegenheiten auszunützen weiß, überwiegt seine Verzweiflung an der Stadt und drücken seine Briefe ständig die Hoffnung, sie zu verlassen, aus. Für Beethoven kommen zwar viele - fast alle - europäische Länder und Städte in Betracht (siehe 3.1.1.2), London aber konkretisiert aber am häufigsten diesen Drang, ins Ausland zu gehen und dort sogar bleibend ein sorgenloses Leben für die Kunst zu führen. 176 Tragischerweise stoßen seine vielfältigen Londoner Wünsche auf externe Faktoren, die ihn dazu zwingen, auf diese Absicht zu verzichten. 177 Schon in einem Brief aus dem Jahre 1815 handelt es sich für Beethoven um den Gegensatz Wien - London. In dem Brief beschreibt er, wie sein für den Wiener Kongress geschriebenes Werk Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria (Op. 91) sehr gut in Wien, später auch in London empfangen wurde. Bisher habe der unbestimmte Adressat178 es aber unterlassen, Beethoven die gefragte „Dedikation― an ihn zu erlauben. Zweifellos fühlte sich Beethoven in seinem Stolz gekränkt. Das Problem spielt sich aber noch auf eine andere Ebene ab: Beethoven ärgert sich deutlich über die Tatsache, dass er nicht selber in London anwesend sein kann, um die scheinbar vielen Ehrenerweisungen entgegenzunehmen. Dieser Gedanke taucht fast ein Jahr später in einem Brief an Neate, den Gründer der Londoner philharmonischen Gesellschaft, noch immer auf: Avant-hier on me portait un extrait d‘une gazette anglaise nommée Morning Chronicle, où je lisois avec grand plaisir, que le société philharmonique a donné ma Sinfonie A# […] ne prenez mal si je me méfie un peu, quand je pense que le Prince régent d‘Angleterre ne me daignait pas ni d‘une réponse ni d‘une autre reconnaissance pour la Bataille que j‘ai envoyée à son Altesse, et laquelle on a donnée si souvent à Londres, et seulement les gazettes annonçaient la réussite de cet œuvre et rien d‘autre chose.179 Das bleibende Stillschweigen des Prinzregenten empfindet Beethoven deutlich als eine Schmach. Neben dieser Beleidigung, thematisiert der Brief aber auch die für Beethoven 176 vgl. dazu die Bemerkungen zu Beethoven an von Könneritz, 25. Juli 1823 (BSB, Brief 1138) in 3.2.1.1, S.71 177 Siehe dazu auch 2.1.3 178 Kastner/Knapp suggerieren als Adressat den Viscount Castelreagh. Im Brief ist nur von ―Se. K. Hoheit der Prinzregent‖ die Rede. 179 Beethoven an Charles Neate, 15. Mai 1816 (BSB, Brief 584) 74 peinliche Situation, dass er in Zeitungen erstens die Aufführung eines seiner Werke, zweitens, den Erfolg des Konzerts erfahren muss. 180 Die Fortsetzung des vorigen Briefes an den Prinzregent selbst zeugt sogar von Beethovens Furcht, trotz des Erfolges seines Werkes, ganz vergessen zu werden: „Alle Blätter waren voll von dem Lob und von dem außerordentlichen Beifalle, den dieses Werk in England erhalten hatte: nur an mich, den Autor desselben, dachte niemand, und nicht das mindeste Zeichen von Dank oder einer Erkenntlichkeit, ja nicht einmal eine Silbe Antwort kam mir von dorther zu!―. 181 Schon hier werden Beethoven die Beschränkungen seiner physischen Immobilität deutlich und, obwohl er später im Brief selber meint, dass er „auf jede Frage über [s]eine nach London gesendete Schlacht bei Vittoria, […] bloß mit Achselzucken antworten kann―, 182 verschwindet diese vermeintliche Gleichgültigkeit 180 Die ganze Episode der erwünschten Widmung bildet einen roten Faden in Beethovens Leben. Schon einige Monate vor dem obigen Brief erwähnt er sie zu Salomon.: „Vielleicht ist es Ihnen auch möglich, mir anzuzeigen, auf welche Art ich vom Prinzen-Regenten die Kopiaturkosten für die ihm übermachte Schlachtsymphonie auf Wellingtons Sieg in der Schlacht von Vittoria erhalten kann; denn längst habe ich den Gedanken aufgegeben, auf sonst irgend etwas zu rechnen. Nicht einmal einer Antwort bin ich gewürdigt worden, ob ich dem Prinz-Regenten dieses Werk widmen darf, indem ich‘s herausgebe. Ich höre sogar, das Werk soll schon in London im Klavierauszug heraus sein, — welch Geschick für einen Autor!!! Während die englischen und deutschen Zeitungen voll sind von dem Erfolge dieses Werkes im Drurylanetheater aufgeführt, das Theater selbst eine ganz gute Einnahme damit gemacht hat, hat der Autor nicht einmal eine freundschaftliche Zeile davon aufzuweisen, nicht einmal den Ersatz der Kopiaturkosten, ja noch den Verlust alles Gewinstes― (Beethoven an Joh. Peter Salomon, 1. Juni 1815 (BSB, Brief 501)). Einige Tage nach dem im Volltext zitierten Text drückt Beethoven diesen Ärger fast wortwörtlich in einem Brief an Ferdinand Ries aus: ―Man hat mir die Übersetzung einer Nachricht aus dem Morning-Chronicle über die Aufführung einer Symphonie (wahrscheinlich in A) zu lesen gegeben. Es wird mit dieser und allen anderen mitgenommenen Werken von Neate wohl ebenso gehen wie mit der Schlacht, und ich werde wohl wie von selbiger auch nichts haben, als in den Zeitungen die Aufführungen zu lesen‖ (Beethoven an Ferdinand Ries, 11. Juni 1816, (BSB, Brief 586)). Sogar sieben Jahre nach diesem Brief, wirft er Georg IV noch immer das Ausbleiben einer Antwort vor und kümmert er sich um diese paradoxe Situation: „Bereits im Jahre 1813 war der Unterzeichnete so frei […] sein Werk, genannt „Wellingtons Schlacht und Sieg bei Vittoria― zu übersenden […] Der Unterzeichnete nährte viele Jahre den süßen Wunsch, euer Majestät würden ihm den richtigen Empfang seines Werkes allergnädigst bekannt machen lasse; allein bis jetzt konnte er sich dieses Glückes nicht rühmen und mußte nicht rühmen und mußte bloß mit der kurzen Anzeige des Herrn Ries, seines würdigen Schülers, genügen […] Dies meldeten auch die englischen Journale und fügten noch hinzu, sowie auch Herr Ries, daß dieses Werkt mit außerordentlichem Beifall sowohl in London als allenthalben gewürdigt wurde. Daß es für Unterzeichneten sehr kränkend sei, alles dieses auf indirektem Wege erfahren zu müssen, werden euer Majestät seinem Zartgefühl gewiß verzeihen […]― (Beethoven an König Georg IV. von England, 1823 (BSB, Brief 1177)) 181 Beethoven an Viscount Castelreagh (unsicher), Juni 1815 (BSB, Brief 504) 182 Ebd. 75 schon bald und hegt er bis zum Ende seines Lebens den Wunsch, nach London zu gehen.183 Dieser Drang lässt sich aber nicht nur durch ein Gefühl rachsüchtiger Kränkung erklären. Wie schon gezeigt, steht Beethoven an erster Stelle in einem sehr negativen Verhältnis zu Wien und glaubt er, in London seine sowohl körperliche als auch künstlerische Lage zu verbessern, sogar seine „Rettung― finden zu können: „Wegen nach London kommen werden wir uns noch schreiben. Es wäre gewiß die einzige Rettung für mich, aus dieser elenden drangvollen Lage zu kommen, wobei ich nie gesund und nie das wirken kann, was in besseren Umständen möglich wäre―.184 Aus diesen Zeilen spricht eine totale, durch das ultimative „einzige― oder zweifache „nie― erzeugte Hoffnungslosigkeit. Darüber hinaus widerspiegelt die syntaktische Trennung der „das - was―- Konstruktion den thematisierten Zusammenstoß von dem hiesigen, bedrohenden Wien („das―) und dem dortigen, erlösenden London („was―). 185 Ein wichtigerer, zumindest ebenso bedeutsamer Grund waren vermutlich aber auch die wirtschaftlichen Vorteile, die Beethoven in London zu finden glaubte: „Ich wünschte nichts, als, ganz umsonst schreiben zu können. Auf den Standpunkt wird es je schwerlich ein deutscher oder vielmehr österreich. Künstler bringen. Nur London kann einen so fett machen, daß einem in Deutschland oder vielmehr hier hernach die magersten Bissen nicht widerstehen―. 186 Ein doppelter Unterschied erzeugt hier den Gegensatz zwischen London und Wien. Einerseits kommt die ökonomische Ebene sprachlich zum Ausdruck durch den Kontrast zwischen „fett― und „die magersten 183 Beethoven steht nicht allein in dieser London-Bewunderung. Schon nach der französischen Revolution suchten Skeptiker in der englischen Hauptstadt eine neue Form der Modernität, die sich sicherlich seit der industriellen Revolution in den ökonomischen sowie gesellschaftlichen Verhältnissen ausgebildet hatte. Allmählich gelangten einige Kritiker aber ebenfalls zu der Anschauung, dass die zunehmende Industrialisierung den humanistischen Parität- und Fortschrittsgedanken gefährdete. So hat Heinrich Heine bekanntlich anfangs eine Bewunderung für London erlebt, aber wurde sein Enthusiasmus für die Stadt von der wachsenden Anonymität und gesellschaftlichen Polarität enttäuschst. (vgl. Renate Stauf: Der problematische Europäer. Heinrich Heine im Konflikt zwischen Nationenkritik und gesellschaftlicher Utopie. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter 1997, S.139-154) 184 Beethoven an Ferdinand Ries, 19. April 1819 (BSB, Brief 888) 185 Außerdem können auch die Vorbilder anderer Komponisten, wie Händel, der fast fünfzig Jahre in London gewohnt hat, eine mehr romantische, epigonale Triebfeder bilden. Auch Haydn hat London mehrmals besucht und Mozart hatte vor seinem Tode ebenfalls Planen, eine Reise zu London zu unternehmen. (vgl. Ian Woodfield: „John Bland: London Retailer of the Music of Haydn and Mozart―. In: Music & Letters, Vol. 81, No.2 (May, 2000), S.214; 233-234) 186 Beethoven an Friedrich Treitschke, 24. Sept. 1815 (BSB, Brief 522); Bemerke auch hier wieder die zweimalige Präzision von Deutschland zu Österreich („hier―) in Fußnote 147 (S.64). 76 Bissen―. Dass sich Beethoven stark durch den von ihm erhofften Gewinn in London angelockt fühlt, zeigt sich in mehreren Briefen. Interessant ist aber, dass er den finanziellen Nutzen mit sowohl dem Unvermögen, selber Zeuge des Erfolges zu sein, als auch der Angst, vergessen zu werden, verbindet (siehe oben).187 Obwohl man sogar behaupten könnte, dieser wirtschaftliche Vorteil gliche seinen Ärger aus, so steht diese Folgerung im scharfen Kontrast mit einem zweiten, mehr geistigen Unterschied zwischen Wien und London im Brief: Die englische Hauptstadt ermöglicht für Beethoven zugleich die Erfüllung des Künstlerideals, „ganz umsonst schreiben― zu können. Diese Idee setzt eine Freiheit voraus, die Beethoven in Wien nicht zu besitzen glaubte. 188 Er meint sich schon mit diesem Künstlerideal an sich von seinen „deutsche[n] oder vielmehr österreich.― Kollegen zu unterscheiden. In dieser Hinsicht entsteht sein Wunsch, nach London zu gehen, nicht nur als ein gemütsmäßiger Trieb, sondern legitimiert Beethoven sie gleichzeitig durch den rein zweckmäßigen Unterschied, der zwischen ihm und den Österreichern besteht. Beethoven ist aber nie in London gelangt. In seinen Briefen formuliert er eine Menge von Faktoren, die ihm diese Reise im Laufe der Jahre verhindern. Wenn nicht wegen „[s]eines unglücklichen Gebrechens, wodurch [er] viel Wartung und Ausgaben bedarf―,189 so bleibt sie aus, weil er „verstrickt [ist] in so mancherlei Umstände― 190 oder weil „[s]eine Gesundheit leidet―.191 Wie dem auch sei, es läuft immer auf das Folgende hinaus: „Trotz meinen Wünschen war es mir nicht möglich, dieses Jahr nach London zu kommen―. 192 Obwohl die Anziehungskraft Londons, konkretisiert in Beethovens Bewunderung für die philharmonische Gesellschaft, deutlich groß ist, idealisiert er die Stadt auch nicht. Zwar macht er sie zu einer „Rettung― seiner Wiener Existenz, seine 187 vgl. ―Daß so etwas schon die Anerkennung eines engl. Verlegers (versteht sich in klingender Münze) verdient, glaube ich doch‖. (Beethoven an Ferdinand Ries, 25. April 1823 (BSB, Brief 1097)); ―Ich grüße Sie herzlich und bitte Sie, mich in England nicht zu vergessen, sowie auch (an) die Schildkröte von 600 Pfund vom König von England, für meine Schlachtsymphonie zu denken.‖ (Beethoven an Joh. Andr. Stumpff, 3. Oktober 1824 (BSB, Brief 1244)) 188 1823 beklagt sich Beethoven in einem Brief an Ries sehr ausgesprochen über sein unterwürfiges Verhältnis der Abhängigkeit zu dem Erzherzog Rudolf: ―Es ist zu arg geworden; ich bin ärger beim Kardinal als früher geschoren. Geht man nicht, siehe da ein crimen legis majestatis. Meine Zulage besteht darin, daß ich den elenden Gehalt noch mit einem Stempel erheben muß‖. (Beethoven an Ferdinand Ries, 1823 (BSB, Brief 1073)) 189 Beethoven an Ferdinand Ries, 9. Juli 1817 (BSB, Brief 748) 190 Beethoven an Ferdinand Ries, 30. März 1819 (BSB, Brief 886) 191 Beethoven an Ferdinand Ries, 6. April 1822 (BSB, Brief 1016) 192 Beethoven an Ferdinand Ries, 5. März 1818 (BSB, Brief 844) 77 Korrespondenz enthält zugleich auch zwei entscheidende Perioden, an denen sich ein Umschlag in seinem Englandbild ergibt.193 1816 tauchen statt Unterschiede, die ersten Parallelen zwischen Wien und London auf: „Von den 10# ist bis dato nichts erschienen, und es ist also das Resultat daraus zu ziehen, daß es in England wie bei uns Windbeutel und nicht worthaltende Menschen gibt. […] Also gibt es auch in England solche gewissenhaften Menschen, denen Worthalten nichts ist?!!!―.194 Beethoven zerreißt hier fast buchstäblich seine Londoner Idylle. Wie wenn dieser Gedanke erst jetzt bei ihm auftauche, 195 soll er anlässlich einer scheinbar trivialen Sache jetzt erkennen, dass es „also― auch in London „Windbeutel und nicht worthaltende Menschen― oder, mit einer ironischen Wendung, „gewissenhaft[e] Menschen― gibt. Obwohl diese Folgerung eigentlich erst spät oder unerwartet erfolgt, besteht Beethoven in seinen Briefen fast ein Jahr lang hartnäckig auf seinem Ärger. Schon bald hat sich seine plötzliche Erkenntnis über die Unehrlichkeit der Engländer zu einem weitgehenden Misstrauen verwandelt: „I have duly received the £5 and thought previously you would non [sic] increase the number of Englishmen neglecting their word and honor, as I had the misfortune of meeting with two of this sort―.196 Beethovens Zorn erreicht einen Höhepunkt in 1817, in einem Brief an Charles Neate: „Die Frau von Genney schwört darauf, was Sie alles für mich getan haben, ich auch, das heißt, ich schwöre darauf, daß Sie nichts für mich getan haben, nichts tun für mich und wieder nichts für mich tun werden, Summa Summarum nichts! nichts! nichts!―. 197 Die alle Zeitebenen umfassende, sechsfache Wiederholung von „nichts― und das hyperbolische „Summa Summarum― drücken rhetorisch unverhüllt Beethovens Wut aus. Nicht länge nach diesen affektiven Äußerungen aber erwägt Beethoven wieder, Reisen nach London auf Einladung der philharmonischen Gesellschaft zu unternehmen. Zusammen mit dieser Neublüte seiner LondonBewunderung („Wäre ich nur in London, was wollte ich für die philharmonische Gesellschaft alles schreiben!―),198 lichten auch sporadisch Schimmer seiner Apathie auf, 193 Obwohl Beethoven seine Kritik nicht direkt an London, sondern generalisierend an England übt, wohnen sowohl alle seine Adressaten als seine Verleger in der englischen Hauptstadt, sodass sie in concreto an London gerichtet ist. 194 Beethoven an Ferdinand Ries, 11. Juni 1816 (BSB, Brief 586) 195 siehe auch auf S.74 und in Fußnote 182 ebenda die Kränkung, die Beethoven empfindet, weil ihm der Prinzregent noch nicht geantwortet hat. 196 Beethoven an Rudolf Birchall, 1. Okt. 1816 (BSB, Brief 615) 197 Beethoven an Charles Neate, 19. April 1817 (BSB, Brief 721) 198 Beethoven an Ferdinand Ries, 20. Dez. 1822 (BSB, Brief 1044) 78 am schärfsten 1823: „Wäre ich nicht so arm, daß ich von meiner Feder leben müßte, ich würde gar nichts von der philharmonischen Gesellschaft nehmen―.199 Der Unterschied mit einem etwas späteren Brief ist erstaunend und kennzeichnend für Beethovens wechselnde Haltung London gegenüber. Fühlt er sich hier nämlich noch dazu gezwungen, das Angebot der philharmonischen Gesellschaft anzunehmen, weil er so arm ist, so bedauert er zwei Monate später, dass er wegen desselben Grundes nicht umsonst für sie komponieren kann: „[…] so würde ich selbst umsonst für die ersten Künstler Europas schreiben, wäre ich nicht noch immer der arme Beethoven―.200 Sowohl diesem Brief als auch allen Briefen im Allgemeinen ist nicht zu entnehmen, woher die sporadische Schwankungen in Beethovens Auffassung von London genau stammen. Es steht fest, dass er sich nach seinen ersten Enttäuschungen spürbar weniger positiv über die Stadt äußert und die meisten Verweise auf London eher das Bedauern ausdrücken, nicht nach ihr verreisen zu können. 201 Gegen Ende seines Lebens macht Beethoven aber doch noch einen Annäherungsversuch an die Stadt. Weil es ihm dann finanziell schlecht geht, wendet er sich von allen Ländern und Musikhäusern Europas gerade an die philharmonische Gesellschaft, um ihm aus dieser peinlichen Lage zu helfen: „Ich erinnere mich, daß die philharmonische Gesellschaft mir schon vor einigen Jahren den Antrag machten eine Akademie zu meinem Besten zu geben. In Rücksicht dessen geht denn meine Bitte an Ew. Wohlgeboren, daß, wenn die philharmonische Gesellschaft noch jetzt diesen Entschluß fassen würde, es mir jetzt willkommen wäre―.202 Natürlich will Beethoven nicht als ein reiner Bettler um Geld und Hilfe ankommen. Genau, wie er seine Bitte hier so darstellt, als gehe er auf einen früheren Antrag der Gesellschaft ein, beschreibt er sie in einem anderen Brief als die Annahme eines eher gemachten Angebots: „Die Sache ist in Kürze diese: Schon vor einigen Jahren hat mir die philharmonische Gesellschaft in London die schöne Offerte gemacht, zu meinem Besten ein Konzert zu veranstalten. Damals war ich gotlob! nicht in der Lage, von diesem edlen Antrage Gebrauch machen zu müssen. Ganz anders ist es 199 Beethoven an Ferdinand Ries., 5. Febr. 1823 (BSB, Brief 1067) Beethoven an Ferdinand Ries, 25. April 1823 (BSB, Brief 1097); siehe zu dieser Idee des UmsonstSchreibens auch S.75. 201 vgl. Beethoven an Ferdinand Ries, 9. Juli 1817 (BSB, Brief 748); Beethoven an Ferdinand Ries, 5. März 1818 (BSB, Brief 844); Beethoven an Ferdinand Ries, 30. März 1819 (BSB, Brief 886); Beethoven an Ferdinand Ries, 19. April 1819 (BSB, Brief 888) und Beethoven an Ferdinand Ries, 6. April 1822 (BSB, Brief 1016) 202 Beethoven an George Smart, 22. Februar 1827 (BSB, Brief 1455) 200 79 aber jetzt, wo ich schon bald volle drei Monate an einer langwierigen Krankheit daniederliege―. 203 Letztendlich gibt die philharmonische Gesellschaft eine Akademie zu Beethovens Ehre und bekommt er genügend Geld, um während den letzten Wochen seines Lebens bequem zu leben. Trotz dieser Akademie und Beethovens Bewunderung für und Enttäuschung mit London im Laufe der Jahre, bleibt die Schlussfolgerung am Ende seines Lebens aber dieselbe: Er war nie in London. Diese Erkenntnis kommt nie direkt zum Ausdruck in seinen Briefen, tritt in einem seiner allerletzten Briefen jedoch verhüllt zutage: „Ich ersuche Sie daher, lieber Moscheles, das Organ zu sein, durch welches ich meinen innigsten Dank für die besondere Teilnahme und Unterstützung an die philharmonische Gesellschaft gelangen lasse―.204 Nach all den Bemühungen, nach London zu gehen, braucht Beethoven noch immer jemanden, um „das Organ zu sein―, durch das er seinen Dank zum Ausdruck bringt. Die Entfernung von London hat er auf diese Weise physisch nie überbrücken können und hat sich vielmehr in den roten Faden seiner wechselnden Beziehung zu London verwandelt. 3.2.1.3 Die virtuelle Anwesenheit im Ausland Jetzt erhebt sich die Frage, was die Folgen dieses Gegensatz Wien - London bzw. Österreich - Ausland sind und wie Beethoven konkreterweise auf die allmählich wachsende Erkenntnis, er werde Wien nie verlassen, reagiert. Genau diese Desillusion, zusammen mit der etwas tragischen Tatsache, dass er trotz seines Willens nie „Kunstreisen― 205 hat machen können, bildet den Übergang von der sozusagen affirmativen Seite der Briefen, d. h. was wir ihnen direkt, fast wortwörtlich entnehmen haben können, zu dem Aspekt von Beethovens Selbstbild, der sich nur auf Basis der Briefe verhüllt ableiten lässt. Im Grunde genommen kompensiert Beethoven seine körperliche Immobilität durch gesteigerte, künstlerische Versuche, dem Wiener Rahmen zu entfliehen. Die Anwesenheit im Ausland durch seine Musik, ist für ihn von großer Bedeutung. Sie fungiert als wichtiger Ausdruck seiner Selbstbestätigung: „[…] 203 Beethoven an Ignaz Moscheles, 22. Februar 1827 (BSB, Brief 1456) Beethoven an Ignaz Moscheles, 18. März 1827 (BSB, Brief 1471) 205 So nennt Beethoven seine beabsichtigten Reisen in einem Brief an Goethe: ―Meine Kränklichkeit, seit mehreren Jahren, ließ es nicht zu, Kunstreisen zu machen und überhaupt alles das zu ergreifen, was zum Erwerb führt‖. (Beethoven an J. W. v; Goethe, 8. Febr. 1823 (BSB, Brief 1070)). Bemerke auch hier den Aspekt des Vorteils, die Beethoven mit diesen Reisen assoziiert. 204 80 es [eine Herausgabe seiner sämtlichen Werke] wäre ein in mancher Hinsicht erklekliches (?) [sic] Unternehmen, da so viele fehlervolle Ausgaben meiner Werke in der Welt herumspazieren―. 206 Durch eine „Mala― nähert Beethoven hier wieder einer „Bonna― an, ein Verfahren, das er zuvor noch verwendet hat (siehe 1.1.2). 207 Das „erkleckliche Unternehmen― ist einerseits die Folge von Beethovens Bekanntheit, indem „so viele fehlervolle Ausgaben― nicht auf dem Kontinent oder in Europa, sondern gerade „in der Welt herumspazieren―. Demnach wird sie gleichzeitig zur Bestätigung seiner Berühmtheit. Die Personifikation von Beethovens Werke durch das Verb „herumspazieren― suggeriert aber außerdem ihren sozusagen eigenen Willen und verrät die eigentliche Machtlosigkeit Beethovens, der nur zusehen kann. In dieser Hinsicht macht sein Ruhm auf der anderen Seite zugleich dessen eigene Behinderung aus. Wildwüchsig gehen seine Werke überall herum und hemmen so die äußerste Bekundung seines Rufs, nämlich eine Herausgabe seiner sämtlichen Werke. Trotz dieses Paradoxes, erzielt Beethoven sein ganzes Leben hindurch eine so groß wie mögliche Verbreitung seiner Werke, insbesondere seiner Missa Solemnis, ins Ausland. Während sich schon zuvor gezeigt hat, wie strebsam Beethoven damit beschäftigt ist, seine Werke bei auswärtigen Verlegern herauszugeben (siehe 3.1.1.2), baut er seine Missa Solemnis noch intensiver auf, indem er fast bei fast allen Fürsten Europas die Erlaubnis für eine Dedikation und folglich Anerkennung seiner Gaben erbittet: „Indem ich gesonnen bin, meine große, schon seit einiger Zeit verfaßte Messe nicht durch den Stich herauszugeben, sondern auf eine für mich, glaube ich, ehrenvollere und vielleicht ersprießlichere Art, bitte ich Sie um ihren Rat, und wenn es sein kann, um Ihre Verwendung hierbei. Meine Meinung ist, selbe an allen großen Höfen anzubieten […]―.208 Dass Beethoven durch seine Missa Solemnis Anerkennung sucht, kommt ersichtlich zum Ausdruck durch die Komparative „ehrenvollere― und „ersprießlichere―, die andeuten, wie sehr er eine Beförderung seiner Lage erhofft. Weiter fällt auch auf, dass Beethoven seine Messe etwas bombastisch als ―groß‖ 206 Beethoven an Peter Josef Simrock, 15. Febr. 1817 (BSB, Brief 711) vgl. auch Beethoven an Johann v. Beethoven, 26. Juli 1822 (BSB, Brief 1023): „Könntest Du nur die Briefe lesen, ich habe aber das Geld noch nicht genommen, auch Breitkopf & Härtel haben den sächsichen Chargé d‘affaire wegen Werken zu mir geschickt, auch von Paris habe ich Aufforderungen wegen Werken von mir erhalten, auch von Diabelli in Wien, kurzum, man reißt sich um Werke von mir, welch unglücklicher glücklicher Mensch bin ich!!! - Auch dieser Berliner hat sich eingestellt!― 208 Beethoven an Georg A. v. Griesinger, 7. Januar 1823 (BSB, Brief 1053) 207 81 umschreibt, statt die spirituellere, korrekte Übersetzung ―solenne‖ zu verwenden. Das Streben nach vornehmer Würdigung fand sich darüber hinaus schon eher verdeckt in Beethovens Ärger um das Ausbleiben einer Antwort des englischen Prinzregenten (siehe 3.2.1.2) und wurzelt teilweise selbstverständlich auch in seinem nobility pretense (siehe Fußnote 87, S.35-36). Die letztendliche Zahl adliger Subskribenten sollte zehn betragen und erstreckte sich über ganz Europa.209 Zu diesem Resultat reichten sicherlich nicht nur Beethovens Briefe. Neben die Fürsten nämlich alle selbst anzuschreiben, hat er auch wichtige Künstler, wie Luigi Cherubini und Friedrich Schleiermacher in Paris, Louis Spohr in Hessen oder sogar Goethe in Weimar, gebeten, seine Anträge zu befürworten.210 Das könnte eine triviale, zusätzliche Anstrengung scheinen, jedoch ist sie von großer Bedeutung, weil Beethoven sich davor kaum, in den meisten Fällen sogar nie, die Mühe gegeben hat, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Diese Fühlungnahme soll deshalb indizierend für die Leidenschaft, mit der Beethoven vorgeht, sein und erklärt auch die doch immer latent spürbare Schwierigkeit in seinen Briefen, sich zu anderen Künstlern richten zu müssen. Das kommt zwischen den Zeilen in dem Brief an Cherubini, den damaligen surintendant de la musique du roi, sehr schön zum Ausdruck 211 : „Ma situation critique demande, que je ne fixe pas seulement comme ordinaire mes vœux au ciel, au contraire, il faut les fixer aussi en bas pour les nécessités de la vie―. 212 Dieser französische Satz ist mehrdeutig. Auf einer ersten Ebene können sich „vœux au ciel― und „en bas― wortwörtlich auf eine göttliche Rufung bzw. die irdischen Mühsale beziehen. Das zeuge wohl von einem eher romantischen Künstlerbegriff, jedoch ist diese Sehweise ziemlich unwahrscheinlich, da sich Beethoven in seinen vielen 209 1825 listet Beethoven die Subskribenten in einem Brief an B. Schotts Söhne auf: ―1. Der Kaiser von Rusland. 2. Der König von Preußen. 3. Der König von Frankreich. 4. Der König von Dänemark. 5. Kurfürst von Sachsen. 6. Großherzog von Darmstadt. 7. Großherzog von Toskana. 8. Fürst Galißin. 9. Fürst Radziwill. 10. Der Cäcilienverein von Frankfurt‖. (Beethoven an B. Schotts Söhne, 25. November 1825 (BSB, Brief 1361)) 210 vgl. Beethoven an Luigi Cherubini, 15. März 1823 (BSB, Brief 1086); Beethoven an Friedrich Schleiermacher, 24. März 1823 (BSB, Brief 1089); Beethoven an Louis Spohr, 27. Juli 1823 (BSB, Brief 1140) bzw. Beethoven an J. W. v. Goethe, 8. Febr. 1823 (BSB, Brief 1069). 211 Joseph Bennet bemerkt diese Täuschung schon: ―If therefore he [Beethoven] lauded Cherubini to the skies, we are not bound to conclude that in reality he thought the Florentine worthy of quite so high a place‖. (Joseph Bennet: „The Great Composers, Sketched by Themselves. No. IV. Beethoven―. In: The Musical Times and Singing Class Circular. Vol. 19, Bo. 422 (Apr.1, 1878), S.659) 212 Beethoven an Luigi Cherubini, 15. März 1823 (BSB, Brief 1086) 82 Geschäftsbriefen ausführlich mit dem Volk „en bas― auseinandersetzt.213 Folglich soll das Begriffspaar in diesem Kontext sehr konkret als ein Verweis auf die französischen Verhältnisse verstanden werden. Sogar in diesem Fall gibt es aber noch Bedeutungsdifferenzierungen. „[V]œux au ciel― kann einerseits im Sinne des roi soleil metaphorisch „eine Bitte an den König― bedeuten, was explizit bedeuten würde, dass mit „en bas― Cherubini gemeint wird. Andererseits kann es auch wieder spiritueller erklärt worden, was dann aber darauf hindeute, dass der König „en bas― verweilt und Cherubini, in dem seit alters zentralistischen Frankreich, implizit sogar noch niedriger steht. Anders gesagt: wo sich Beethoven denn auch positioniert, unter oder über dem König von Frankreich (zweite bzw. dritte Möglichkeit), Cherubini befindet sich immer unter Beethoven. Ob Cherubini diese Unterstellungen durchschaut hat oder aber Beethoven tatsächlich geholfen hat, ist aus den Briefen nicht zu schließen. Er hat den Brief zwar nie beantwortet,214 aber es steht fest, dass der König von Frankreich in der ―Pränumerantenliste― aufgenommen wurde. Obwohl diese Liste letztendlich eine sehr eindrucksvolle war, haben viele Adressierten, wie die Könige von Schweden und Neapel, die philharmonische Gesellschaft St-Petersburg oder der Großherzog von Hessen, Beethoven die erwünschte Ehre auch nicht gegönnt. 215 Das aber erwähnt Beethoven nie und nirgendwo und lässt sich nur implizit den Briefen ableiten. 3.2.2 Schubert 3.2.2.1 Wien als Ersatzkonstruktion Bei Schubert sieht die Situation ganz anders aus. Während Beethoven nämlich den durch höhere Gewalt auferlegten Zwang fühlt, in Wien zu bleiben, beklagt Schubert in seinen Briefen seinerseits die Tatsache, dass er von seiner Heimatstadt entfernt ist und ihn durch Abwesenheit eine tiefe Sehnsucht befällt. Das stellt sich exemplarisch in einem Brief an Ferdinand, wenn er den Eszterházy-Kindern Musikunterricht in Zseliz 213 vgl. 2.1.4 vgl. Joseph Bennet: The Great Composers, Sketched by Themselves, S.659 215 vgl. Beethoven an König Oskar von Schweden, 1. März 1823 (BSB, Briefe 1079), Beethoven an den König von Neapel, 6. April 1823 (BSB, Brief 1096) bzw. Beethoven an die Philharmonische Gesellschaft St. Petersburg, 21. Juni 1823 (BSB, Brief 1119) 214 83 erteilt, heraus: „So wohl es mir geht, so gesund als ich bin, so gute Menschen als es hier gibt, so freue mich doch unendlich wieder auf den Augenblick, wo es heißen wird: Nach Wien, nach Wien! Ja, geliebtes Wien, Du schließest das Theuerste, das Liebste, in Deinen engen Raum, und nur Wiedersehn, himmlisches Wiedersehn wird dieses Sehnen stillen―. 216 Nach Beethovens Äußerungen über Wien, mutet dieser sehr ausgesprochene Enthusiasmus für die Stadt fast befremdend an. Schubert macht keinen Hehl aus seiner Liebe für die Stadt. Obwohl er nicht leugnen kann, dass er keinen Grund zum Klagen hat, so kann in seinen Augen ja nichts gegen Wien antreten. Die Stadt betrachtet er als eine fast unerreichbare, „himmlische― Utopie und fühlt er als einen „engen Raum― an. Die Begeisterung zeigt sich auch sprachlich durch die vielen Wiederholungen („so―; „Wien―; „Wiedersehn, himmlisches Wiedersehn―) und durch die Abwesenheit der Selbstreferenz. Schubert vergisst sich selber in diesen Sätzen nämlich buchstäblich. Nur zwei Sätze haben „ich― als Subjekt, wobei es in einem ganz ausfällt („so freue mich―). Sobald Wien dann auf den Vordergrund tritt, bewirkt die Apostrophe die völlige Zentralstellung der Stadt, der Schubert fast die Vollendung andichtet. Während es ihm in Zseliz ziemlich neutral „wohl― geht und es dort „gute Menschen― gibt, stehen Superlative im Mittelpunkt bei seiner Charakterisierung von Wien („das Theuerste, das Liebste―) und bezeichnet er das so stark ersehnte „Wiedersehn― als ein „himmlisches―. Der Grund für diese schmerzliche Sehnsucht nach Wien begründet Schubert selber durch das Gefühl, ins Ausland nicht verstanden zu werden. Diese Empfindung, ein Außenseiter zu sein, fördert Schuberts Verlangen nach Wien und erwirkt eine innere Einsamkeit: „Wenn ich die Leute um mich herum nicht alle Tage besser kennenlernte, so ging es mir noch eben so gut, wie anfangs. So sehe ich aber, daß ich unter diesen Menschen doch eigentlich allein bin, bis auf ein Paar wirklich braver Mädchen ausgenommen. Meine Sehnsucht nach Wien wächst täglich―. 217 Derselbe Kontrast als im vorigen Brief taucht hier auf. Schubert gesteht ein, dass seine Lage auf den ersten Blick kaum beschwerlich sein dürfte und sie sich sogar bessert, 218 dennoch fehlt innerlich ein entscheidender Kernaspekt, diese Auslanderfahrung zu genießen und 216 Schubert an seinen Bruder Ferdinand, 24. August 1818 (DSL, S.64) Schubert an seine Geschwister Ferdinand, Ignaz und Theresia, 29. Okt. 1918 (DSL, S.74) 218 Schubert macht solche Geständnisse öfters, vgl. ―Die mich umgebenden Menschen sind durchaus gute. Selten wird irgend ein Grafen-Gesinde so gut zusammen gehen, wie dieses―. (Schubert an Schober und die anderen Freunde, 8. Sept. 1818 (SDL, S.67)) 217 84 völlig wertzuschätzen. Zusammen mit seiner Wiener Abstammung tragen viele andere Elemente vermutlich zu dieser Sehnsucht und dem Einsamkeitsgefühl bei. In Schuberts Briefen behauptet sich jedoch ein Aspekt am meisten: die Abwesenheit seiner Freunde. Über Schuberts Freundeskreis wurde schon vieles geschrieben. Er bildet einen wesentlichen Bestandteil sowohl seines Lebens als auch in der späteren Rezeption.219 Im Gegensatz zum Unverständnis, das Schubert in der Fremde empfindet, schreibt er seinen Freunden erstens die Fähigkeit zu, ihn zu begreifen: „d[a]ß ich mit meiner natürlichen Aufrichtigkeit recht gut bey allen diesen Leuten durchkomme, brauche ich euch, die ihr mich kennt, kaum zu sagen―. 220. Dass Schubert stark an seinen Freunden hängt, äußert sich weiter auch durch den affektiven Ton, den er in den Briefen an seine Freunde anschlägt221: Wie unendlich mich eure Briefe sammt u. sonders freuten, ist nicht auszusprechen! Ich war eben bey einer Ochsen- u. Kuh-Licitation, als man mir euren wohlbeleibten Brief überreichte. Ich brach ihn, u. ein lautes Freudengeschrey erhob ich, als ich den Nahmen Schober erblickte. […] Es war mir, als hielt ich meine theuren Freunde selbst in Händen. […] Lieber Schobert! Ich sehe denn schon, es bleibt bey dieser Nahmens Verwandlung. Also, lieber Schobert: Dein Brief war mir von Anfang bis zum Ende sehr lieb u. kostbar, besonders aber das letzte Blatt. Ja ja das letzte Blatt setzte mich in volles Entzücken, du bist ein göttlicher Kerl (versteht sich im schwedischen) […].222 Mit exaltierter Freundesfreude reagiert Schubert auf die Nachrichten seiner Freunde, insbesondere von „Schober(t)―, 223 den er immer am meisten geschätzt zu haben 219 vgl. Eva Badura-Skoda: Schubert und seine Freunde. Wien: Böhlau Verlag 1999; Ilija Dürhammer: ―Schlegel. Schelling und Schubert. Romantische Beziehungen und Bezüge in Schuberts Freundeskreis‖ in: Schubert durch die Brille 16/17 (1996), S. 59-88; David Gramit: ―‘The passion for friendship‘: Music, cultivation, and identity in Schubert‘s circle‖. In: The Cambridge Companion to Schubert. Edited by Christopher H. Gibbs. Cambridge: University Press 1997, S.56-71; Im Anschluss an die literaturwissenschaftliche Vorangehensweise in dieser Arbeit bietet auch die folgende Studie einen interessanten Blickwinkel: Ilija Dürhammer: Schuberts literarische Heimat: Dichtung und LiteraturRezeption der Schubert-Freunde. Wien: Böhlau Verlag 1999. 220 Schubert an Schober und die anderen Freunde, 8. Sept. 1818 (SDL, S.67); vgl. auch Schubert an Leopold Kupelwieser (SDL, S.234): „Schon längst drängt' es mich Dir zu schreiben, doch niemals wußte ich, wo aus wo ein […] ich kann endlich wieder einmal Jemand meine Seele ausschütten. […]― 221 vgl. auch Schubert an Schober und die anderen Freunde, 8. Sept. 1818 (SDL, S.66): „Wie könnte ich euch vergessen, euch, die ihr mir alles seyd! […] Grüße mir alle möglichen Bekannten. […] jeder Buchstab von euch ist mir theuer―. 222 Schubert an Schober und die anderen Freunde, 8. Sept. 1818 (SDL, S.66) 223 Anhand dieses kleinen Wortspiels, in dem sich sprachlich die innige Beziehung zwischen Schubert und Schober widerspiegelt, zeigt sich beispielhaft, wie bedeutsam und subtil der in 2.1 vorausgesetzte literarische Wert der Briefe sein kann. 85 scheint 224 : Er freut sich „unendlich―, erhebt „ein lautes Freundgeschrey― und nennt Schober unverhohlen „ein[en] göttliche[n] Kerl―. Interessant ist aber auch der Gedanke des Briefes als Ersatz der Freunde. Für Schubert bedeutet der Brief nämlich mehr als ein rein materielles Dokument. Er bekommt dagegen auch einen emotionellen Gehalt. Der Brief war Schubert „sehr lieb u. kostbar― und wird sogar zum Substitut der Freunde. Diese Idee kehrt auch in umgekehrter Richtung, d. h. wenn sich Freunde Schuberts ihrerseits im Ausland befinden und er in Wien verweilt, 225 wieder: ―Und nun, lieber Spaun, lebe recht wohl. Schreibe mir ja recht bald u. recht viel, um die unausgefüllte Leere, welche mir Deine Abwesenheit immer machen wird, einigermaßen zu tilgen―.226 Mehr als ein reiner Ersatz für die Abwesenheit seiner Freunde, legt Schubert überdies großen Wert darauf, den Kontakt mit ihnen zu pflegen, weil diese Freundschaft eine direkte Verbindung zu Wien selber darstellt: „Ich bin noch immer Gottlob gesund, und würde mich hier recht wohl befinden, hätt‗ ich Dich, Schober und Kuppelwieser bey mir, so aber verspüre ich trotz des anziehenden bewussten Sternes manchmal eine verfluchte Sehnsucht nach Wien―. 227 Die Abwesenheit seiner Freunde verdrießt Schubert offensichtlich sehr und macht ihn nach Wien ersehnen. Es gibt zudem aber auch eine interessante Verschmelzung zwischen Ursache und Folge. Die Beziehung Wien - Freunde ist in Schuberts Augen eine metonymische: Sie werden zu 224 Aufgrund von Schuberts Erzählung „Mein Traum― (Allegorische Erzählung von Schubert, 3. Juli 1822 (SDL, S.158)) hat Maynard Solomon diese enge Beziehung zwischen Schubert und Schober, aber im Allgemeinen auch zu seinen Freunden als eine Homosexuelle interpretiert (vgl. Maynard Solomon: „Franz Schubert and the Peacocks of Benvenuto Cellini―. In: 19th-Century Music, Vol. 12, No.3 (Spring, 1989), S.193-206). Diese Behauptungen wurden schon von verschiedenen Forschern kritisiert. So behauptet Rita Steblin, dass Solomon manche Dokumente inkorrekt übersetzt, Stellen außer Kontext zitiert und auch die damalige gesellschaftliche Biedermeier-Gesellschaft in Wien falsch dargestellt hat (vgl. Rita Steblin: „The Peacock‘s Tale: Schubert‘s Sexuality Reconsidered―. In: 19th-Century Music, Vol.17, No.1, Schubert: Music, Sexuality, Culture (Summer, 1993), S.5-33). Ilija Dürhammer seinerseits betont die Analogie von Schuberts Freundeskreis zu anderen Zirkeln und Männerfreundschaften, insbesondere dessen Schlegels und Schellings, die sich seit der Frühromantik öfters ausbildeten (vgl. Ilija Dürhammer: Schlegel. Schelling und Schubert, S. 59-88). Diese Studie möchte, wie in 2.3 erläutert, auf solche stark kontextuell geprägte Deutungen verzichten und wird diese intensive Freundschaft anhand der Sprache eher als einen metonymischen Ersatz für Wien interpretieren. 225 vgl. dazu auch Schubert an Anselm Hüttenbrenner, 19. May 1819 (SDL, S.79): „Ein Jahrzehend verfließt schon, eh Du Wien wieder siehst. […] - Freylich kannst Du auch sagen, wie Caesar, lieber in Grätz der Erste, als in Wien der zweyte. Nun dem sey wie immer, ich bin einmahl fuchsteufelwild, d[a]ß Du nicht da bist―. 226 Schubert an Josef v. Spaun, 7. Dez. 1822 (SDL, S.173) 227 Schubert an Schwind, August 1824 (SDL, S.255) 86 Stellvertretern der Stadt selber.228 Mehr als brüderliche Verbundenheit veranschaulicht sich in Schuberts Freundeskreis ein wesentlicher Teil der Stadt und konkretisiert er die Sehnsucht nach und das Verlockende von Wien. Auf diese Weise erstellt der Komponist einen metonymischen Brückenschlag zu ihr. Der Ersatzhang, der sich vorher durch Gleichnisse oder Metonymie aufweisen ließ, scheint im Allgemeinen typisch für Schuberts Umgang mit dem Ausland, oder spezifischer, dem Außerwienerischen zu sein: Vor allem muß ich Dir ein Lamento über den Zustand unserer Gesellschaft wie über alle übrigen Verhältnisse ankündigen; denn außer meinen Gesundheitsumständen, die sich (Gott sey Dank) nun endlich ganz fest zu stellen scheinen, geht alles miserabl [sic]. Unsere Gesellschaft hat durch dich, wie ich es wohl voraussah, seinen Anhaltspunkt verloren. […] Als Ersatz für Dich u. Kupelwieser bekamen wir zwar 4 Individuen, nähmlich: Den ungarischen Mayr, dann Hönig, Smetana u. Steiger, doch die Mehrzahl solcher Individuen machen die Gesellschaft nur unbedeutender statt tüchtiger. Was soll uns eine Reihe von ganz gewöhnlichen Studenten u. Beamten? […] Ich bitte Dich, laß ja recht bald von Dir mich was erfahren, u. fülle die Sehnsucht nach Dir nur einigermaßen aus, indem Du mir schreibst, wie Du lebst u. webst. […] Übrigens hoffe ich meine Gesundheit wieder zu erringen, und dieses wiedergefundene Gut wird mich so manches Leiden vergessen machen, nur Dich, lieber Schober, Dich werd ich nie vergessen, denn was Du mir warst, kann mir leider niemand anderer seyn. 229 Könnte der erste Satz dieses Abschnitts die Vermutung aufwecken, Schubert leite hier „ein Lamento― über den Zustand der österreichischen oder Wiener Gesellschaft ein, so wird man irregeführt. Mit „Gesellschaft― zielt Schubert nicht auf die Öffentlichkeit, im Gegenteil, er verweist damit auf die eher geschlossene Lesegruppe seines Freundeskreises. 230 Diesen elitären Charakter der Lesegesellschaft druckt der Brief selber auch sehr explizit aus. Schon am Anfang kündigt Schubert eine Änderung der „Verhältnisse― an, die die strenge Reglementierung innerhalb der Gruppe insinuiert. Anschließend behauptet Schubert, dass alles „miserabl― geht und bekräftigt er seine 228 Schubert verweist in einem Brief an Ferdinand auf seine Freunden auch mit ―Stadt-Freunde‖ (vgl. Schubert an seinen Bruder Ferdinand, 24. August 1818 (SDL, S.63)) 229 Schubert and Schober, 30. Nov. 1823 (SDL, S.207) 230 Wie in Fußnote 220 (S.84) und 225 (S.85) schon angegeben, prägt sich bei Schubert und seinen Freunden ein stark literarisches Element aus und kam der Kreis bei gelegentlichen Leseversammlungen zusammen. Vgl. dazu Ilija Dürhammer: Schlegel. Schelling und Schubert, S.59-88 und vom selben Autor: Schuberts literarische Heimat: Dichtung und Literatur-Rezeption der Schubert-Freunde. Wien: Böhlau Verlag 1999. Thematisch etwas mehr auf Schubert selber bezogen, aber dennoch erhellend hinsichtlich des Einflussbereichs seiner Freunde ist ein anderer Artikel von Ilija Dürhammer: ―Zu Schuberts Literaturästhetik. Entwickelt anhand seiner zu Lebzeiten veröffentlichen Vokalwerke‖. In: Schubert durch die Brille 14 (1995), S.5-99. 87 innige, psychische Beziehung zur Gesellschaft, indem ihr Belang über seine eigenen physischen „Gesundheitsumständ[e]― hinaussteigt. Den Grund für diesen schlimmen Zustand situiert Schubert bei Schober, den er zum „Anhaltspunkt― des Freundeskreises erklärt und der durch seinen Umzug den zuvor erwähnten Umsturz der Verhältnisse, und folglich den Bruch der Gesellschaft verursacht habe. Sprachlich kommt die Haftung für ihr Auseinanderfallen zum Ausdruck durch das kausale „durch dich―, das schon einen Schweif der Beschuldigung in sich mitträgt. Ganz den schon zuvor angezeigten Ersatzkonstruktionen nach, versucht Schubert letztendlich auch den Verlust durch Stellvertreter aufzufangen. Diese Anstrengungen bewertet er aber als kaum gelungen. Das erklärt sich teilweise durch den eher erwähnten Elitarismus: „Was soll uns eine Reihe von ganz gewöhnlichen Studenten u. Beamten?―. Diese Aussage weist nicht nur den geschlossenen Charakter der Lesegesellschaft auf; sie legt auch den eher seltsamen, in jedem Fall nie so direkt ausgesprochenen Zug eines Erhabenheitsgedankens Schuberts bloß. Relevanter an dieser Stelle ist aber Schuberts Schlussfolgerung im letzten Satz. Er soll nämlich den Konkurs seiner Ersatzversuche erkennen und eingestehen, dass ihm „leider niemand anderer seyn― kann als Schober. Schubert wendet diese Substitutkonstruktionen darüber hinaus auch auf das Ausland selber an. Sein befremdender Charakter kommt in Schuberts Augen nicht nur hervor aus der Tatsache, dass das ihm aus Wien Bekannte dort fehlt, sondern auch weil die Fremde schon eine inhärente Uneigentlichkeit, eine vermisste Abwesenheit an sich besitzt, durch die sie sich unecht vormacht, wie es in diesem Brief aus Linz an den aus derselben Stadt stammenden, aber damals in Lemberg verweilenden Spaun zum Ausdruck kommt: Du kannst Dir denken, wie sehr mich das ärgern muß, dass ich in Linz an Dich einen Brief schreiben muss — nach Lemberg ! ! ! Hohl der Teufel die infame Pflicht, die Freunde grausam auseinander reißt, wenn sie kaum aus dem Kölch der Freundschaft genippt haben. […] Linz ist ohne Dich wie ein Leib ohne Seele, oder wie ein Reiter ohne Kopf, wie eine Suppe ohne Salz. […] und aus den Leibern manches noch anderer Linzers Dein Geist herauszublitzen scheint. Nur fürcht' ( ich, wird dieser Geist nach und nach verblitzen, und da möchte man dann vor Unmuth zerplatzen.231 Der erste Teil des Zitats mutet an dieser Stelle schon vertraut an. Schubert beklagt sich über die Tatsache, die Freunde seien nicht zusammen und wurden voneinander getrennt. 231 Schubert an Josef v. Spaun in Lemberg, 2. Juli 1825 (SDL, S.296) 88 Die paradoxe Situation aber, dass er sich in Spauns Heimatstadt aufhält, ohne dass dieser sich dort selber befindet, sieht Schubert als äußerst ärgerlich. Mit manchmal dramatischen Gleichnissen umschreibt er seine die befremdende Erfahrung, dass selbst das Ausland für ihn seine Eigenheit verliert, wenn seine Freunde nicht da sind. Dabei fällt er auf seine typischen Ersatzvorstellungen zurück. Schubert macht die Linzer Einwohner zu einem Objekt, zu einem Gefäß, in dem sie Spauns „Geist― in sich mittragen. In diesem Sinne verwandelt er des Freundes Abwesenheit in eine allgegenwärtige, zugleich aber auch leere Anwesenheit. Diese letztendliche Täuschung wird auch sprachlich bestätigt: Das Modalverb „scheint― färbt den ganzen Vergleich mit einem Hauch des Trugs und der Verbstamm „blitzen― insinuiert den momentanen, flüchtigen Charakter der Substitution. Das verdeutlicht der letzte Satz noch inhaltlich: Schubert erkennt, dass die virtuelle Anwesenheit seines Freundes bald „verblitzen― wird und am Ende nur noch der Kern seiner wirklichen Gefühle übrig bleibt, nämlich seiner „Unmuth―. Für Schubert entbehrt das Ausland weiter noch eine künstlerische Einsicht. Das lässt sich selbstverständlich mit seinem Gefühl des Unverstanden-Seins verbinden und leistet auch seiner Einsamkeit Vorschub: „Denn in Zelez muß ich mir selbst alles sein. Compositeur, Redacteur, Autiteur u. was weiß ich noch alles. Für das Wahre der Kunst fühlt hier keine Seele, höchstens dann u. wann (wenn ich nicht irre) die Gräfinn [sic]. Ich bin also allein mit meiner Geliebten, u. muß sie in mein Zimmer, in mein Klavier, in meine Brust verbergen. Obwohl mich dieses öfters traurig macht, so hebt es mich auf der andern Seite desto mehr empor. Fürchtet euch also nicht, d[a]ß ich länger ausbleiben werde, als es die strengste Nothwendigkeit erfordert―.232 Schubert fühlt sich als Künstler sich selbst überlassen. Im Grunde erfährt er ein Missverständnis der Kunst, die ihn in seiner Kompositionsarbeit bedrängt, da er zu einer Verschmelzung der künstlerischen Aufgaben verpflichtet wird. Dass nur er und außer ihm, „höchstens dann u. wann […] die Gräfinn―, niemand anders „das Wahre der Kunst― anfühlt, isoliert ihn weiterhin von seiner Umgebung. Schubert beschreibt diese Abtrennung anhand eines Intimität herstellenden Wortfelds. Die Metapher der „Geliebten― kreiert eine innige Atmosphäre, die die Evozierung des stets Intimeren anschließend noch verstärkt. Zuerst zieht Schubert sie in sein Zimmer zurück, dann versteckt er sie in seinem Klavier und 232 Schubert an Schober und die anderen Freunde, 8. Sept. 1818 (SDL, S.67) 89 schließlich verhüllt sie sich in seiner eigenen Brust. Die Auswirkung auf ihn stellt sich aber komplexer heraus. Die Einsamkeit zerreißt Schubert buchstäblich: Sie verdrießt ihn wohl, zur gleichen Zeit empfindet er dieses Leid auch als eine Freude. Der Grund dafür ist eher zweideutig. Einerseits kann der zwiespaltige Genuss des Schmerzes in die Romantik gepasst werden und destilliert Schubert eine Art Existenzbestätigung aus ihm, 233 andererseits könnte man diese plötzliche Heiterkeit mit dem letzten Satz verbinden, in dem er seine Hoffnung, bald wieder zu seiner Heimatstadt zu kommen und dort die wahre Kunst zu genießen, ausdrückt. Wie dem auch sei, die Idee, dass man im Ausland kein Kunstverständnis besitzt, bleibt Schubert hartnäckig bei. Bei seinem zweiten Aufenthalt in Zseliz macht er nämlich eine ähnliche Bemerkung, die den Kontrast zu dem unkünstlerischen Ungarn herstellt und betont: „Ich habe eine große Sonate u. Variationen zu 4 Hände componirt, welche letztere sich eines besondern Beyfalls hier erfreuen, da ich aber dem Geschmack der Ungarn nicht ganz traue, so überlasse ich‘s Dir u. den Wienern darüber zu entscheiden―.234 3.2.2.2 Loswerden und Neubindung Schließlich soll aber bemerkt werden, dass sich Schubert nicht lauter positiv über Wien äußert. In seinen Briefen tritt seine Konfrontation mit den Beschränkungen der Stadt an manchen Stellen zutage, und zwar dermaßen, dass er ihre zuvor zum Ausdruck gebrachte Vollendung anzweifelt. Schubert wird sich vor allem seiner fragilen Lage bewusst. Das dichte Netz von Freunden und Bekannten, das er um sich herumgebildet hat, wird gefährdet, wenn er einsieht, dass beim Wegfallen verschiedener Kettenglieder, sich die Lage drastisch für ihn ändern kann: „Mit der Oper ist es in Wien nichts, ich habe sie zurück begehrt und erhalten, auch ist Vogl wirklich vom Theater weg. Ich werde sie in Kurzem entweder nach Dresden, von wo ich vom Weber einen vielversprechenden Brief erhalten, oder nach Berlin schicken―. 235 Deutlich wird hier, wie anfällig Schuberts Situation ist. Den Einfluss seiner Freunde zur Befürwortung 233 vgl. zu dieser Wollust am Schmerz Knud Ejler Løgstrup: Kunst und Erkenntnis: kunstphilosophische Betrachtungen. Tübingen: J.C.B. Mohr 1998, S.58-60 234 Schubert an Schwind,, August 1824 (SDL, S.255) 235 Schubert an Josef v. Spaun, 7. Dec. 1822 (SDL, S.173); vgl. auch Schubert an Schober und die anderen Freunde, 8. Sept. 1818 (SDL, S.66): „- Daß die Operisten in Wien jetzt so dumm sind, u. die schönsten Opern ohne meiner aufführen, versetzt mich in eine kleine Wuth―. 90 seiner Werke kann er nicht länger geltend machen236 und dies verbindet Schubert mit dem Los seiner Oper. Wie wenn sich ihm erst an diesem Moment die wahre Welt und ihr Hergang eröffnet, entdeckt er, dass „Vogl wirklich vom Theater weg [ist]― (eigene Hervorhebung). Für Schubert bleibt folglich noch eine Lösung übrig: den Versand seiner Oper ins Ausland, d. h. Dresden oder Berlin. Anders als bei Beethoven, spürt man an dem von Weber erhaltenen Brief aber doch, dass diese Versuche nicht ganz seinem eigenen Willen entsprechen, zumindest nicht aus eigener Initiative zustande kommen. Diese letztendlich immer latente Abneigung des Auslandes sieht sich auch die Einsicht gegen Ende seines Lebens an, dass ihm die auswärtige Verbreitung seiner Werke auch Vorteile verschaffen könnte: „[I]ch [mache] hiermit höflichst den Antrag, ob Sie nicht abgeneigt wären, einige von meinen Compositionen gegen billiges Honorar zu übernehmen, indem ich sehr wünsche, in Deutschland so viel als möglich bekannt zu werden―. 237 Anders als bei Beethoven, hat das Ausland hier für Schubert eine hauptsächlich, ja sogar ausschließlich wirtschaftliche Bedeutung. Tatsächlich spürt man den eher zweckmäßigen Fleiß, seine Werke „gegen billiges Honorar― zu verkaufen, trotzdem beabsichtigt er damit nur Bekanntheit zu erwerben und nicht sosehr sie auch selber empfinden oder genießen zu können, was Beethoven z. B. stark in Bezug auf London ersehnt. Zwar probiert Schubert aktiv, mehr Mittel zu erhalten, um seine „Werke im Ausland zu verbreiten―, 238 dennoch bleibt er immer an seine Heimatstadt gefesselt. Dieses Spiel von Loswerden und Neubindung an Wien lässt sich auch bemerken, wenn Schubert aus Grätz (jetzt: Grodzisk Wielkopolski) nach Wien zurückgekehrt ist: Schon jetzt erfahre ich, daß ich mich in Grätz zu wohl befunden habe, und Wien will mir noch nicht recht in den Kopf, 's ist freylich ein wenig gross, dafür aber ist es leer an Herzlichkeit, Offenheit, an wirklichen Gedanken, an vernünftigen Worten und besonders an geistreichen Thaten. Man weiß nicht recht, ist man gescheidt oder dumm, so viel wird hier durcheinander geplaudert, und zu einer innigen Fröhlichkeit gelangt man selten oder nie. 's ist zwar möglich, dass ich selbst viel daran Schuld bin mit meiner langsamen Art zu erwarmen. In Grätz erkannte ich bald die ungekünstelte und offene Weise mit und neben einander zu 236 vgl. auch Schubert an Schober, 30. Nov. 1823 (SDL, S.207): „Mit meinen 2 Opern steht es ebenfalls sehr schlecht. Kupelwieser ist vom Theater plötzlich weggegangen. […]―. 237 Schubert an H. A. Probst, 12. August 1816 (SDL, S.371) 238 Schubert an B. Schotts Söhne, 21. Februar 1828 (SDL, S.495) 91 seyn, in die ich bei längerem Aufenthalt sicher noch mehr eingedrungen seyn würde.239 Dieser Brief ist ein riesiger Bruch mit Schuberts früheren Meinungen über Wien, zugleich aber auch der Einzige, in dem er so negativ über seine Heimatstadt spricht. Es gibt eine deutliche Trennung zwischen Schubert und Wien. Inhaltlich fühlt er sich ein Fremder in einer Stadt, an der er sich nur mühsam „erwärmen― kann. Wien ist nicht länger der Ort seines streng regulierten Freundeskreises, sondern nur noch einer Allgemeinheit und Unbestimmtheit, die zu wenig „geistreichen― Plaudereien führen. Sprachlich lässt sich eine gleiche Distanzierung bemerken. Schuberts Gemeinsamkeit mit Grätz widerspiegelt sich auch in seiner Position als Subjekt („daß ich mich in Grätz zu wohl befunden habe―; „In Grätz erkannte ich―), während entweder Wien selber als Subjekt erscheint („Wien will―) oder das verallgemeinernde „es―, das die Atmosphäre der unindividuellen Generalisierung ausdrückt, auf sie verweist. Die Trennung zwischen Schubert und Wien vollzieht sich jedoch nicht völlig. Zuerst fällt die Idee der Schuldigkeit auf: Er hat sich „zu wohl befunden― und schließt nicht aus, dass er „selbst viel daran Schuld― ist. Zweitens bemerkt er, dass er sich „noch nicht― an Wien gewöhnt hat, aber diese Anpassung implizit doch erwartet, was schließlich auch der Gedanke, ein zu langer Aufenthalt wäre zu befremdlich gewesen, zum Ausdruck bringt. 3.3. Das Selbstbild Am Ende dieses Kapitels erhebt sich schließlich die Frage, was diese Beziehungen zu Österreich und Wien zum einen, zum Ausland zum anderen aber für Beethovens und Schuberts Selbstbild bedeuten und wie sie ihr Handeln bestimmen. Bisher hat diese Untersuchung nämlich anhand vieler Einzelfälle zu deuten versucht, wie die Komponisten ihre Haltung Wien und dem Ausland gegenüber in ihren Briefen ausdrücken, noch nicht aber, wie diese Vorstellungen ihr Selbstbild prägen. Bei Beethoven wurde in dieser Hinsicht bisher gezeigt, dass er sowohl Österreich als Wien sehr negativ, sogar an bestimmten Stellen feindselig gegenübersteht und sich als Opfer des Staates betrachtet, ein Bild, das er zugleich auch zu seinem Vorteil auszunützen weiß. Die Gründe für diese weitgehende Antipathie sind vielfach und allerdings nicht in 239 Schubert an Frau Pachler, 27. September 1827 (SDL, S.451-452) 92 ihrer Gesamtheit ausschließlich den Briefen zu entnehmen. Im Allgemeinen fällt aber doch auf, dass Beethoven sich vor allem in seiner körperlichen, künstlerischen, aber auch ökonomischen Entwicklung behindert fühlt und dass er diesen Mangel an Fortschritt auf das hauptsächlich europäische Festland projiziert. Der konkrete Gegensatz Wien - London sollte dafür kennzeichnend sein. Zu vermeiden aber sei, dass hier das Bild eines nur nach geistigem Erfolg schmachtenden Beethovens erzeugt wird. Ebenso wichtig als Beethovens Wille zur seelischen Entfaltung, ist der wirtschaftliche Gewinn, den er im Ausland zu finden glaubte - oder nicht in Österreich fand, denn obwohl ihm das Ausland schließlich große Hoffnungen machte, hat er es nie idealisiert und auch Momente reiner Desillusion erlebt. Bei Beethovens Selbstbild in Bezug auf Wien und das Ausland manifestiert sich folglich seine ‚abwesende Anwesenheit‗, d. h. das Dasein durch seine Werke, als dessen inhärenter, kennzeichnender Teil: Beethoven überträgt, metaphorisiert seine körperliche Abwesenheit zu einer virtuellen Anwesenheit. Seine Werke bekunden nicht nur Produkte, seinem Geiste entsprossen, sondern repräsentieren, sind auch Beethoven. Sie stellen nicht nur seelische Schöpfungen dar, sondern sind gerade immer wieder Neudarstellungen des Selbst.240 Zwar steckt hier die Gefahr einer allzu romantischen Verallgemeinerung des Genies, das „der Welt abhanden gekommen― ist und „allein in [s]einem Himmel,/in [s]einem Lieben, in [s]einem Lied― 241 lebt. Beethoven war tatsächlich nicht vom Zeitgeist abgesondert.242 Doch fordert die durch sein Selbstbild 240 vgl. dazu Dietrich Fischer-Dieskaus Betrachtung in Musik im Gespräch: ―Das ist bei Beethoven anders. Da gibt es kein wirklich missratenes Stück. Die kleinste Bagatelle, die Variationenwerke, die unendlich vielen Kammermusiken, alles ist überragend. Es steckt in jedem Werk ein Funke des Neuerertums, und das Neue wird eben angeschnitten, ausprobiert‖. (Dietrich Fischer-Dieskau: Musik im Gespräch. Streifzüge durch die Klassik mit Eleonore Bühning. Berlin: Ullstein Buchverlage 2005, S. 25) 241 Friedrich Rückert: „Ich bin der Welt abhanden gekommen―. In: Texte deutscher Lieder. Ein Handbuch. Hrsg. und eingeleitet v. Dietrich Fischer-Dieskau. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 200313, S.252 242 vgl. dazu auch Alexandra Pontzens zeitallgemeinere Betrachtung des romantischen Künstlerbildes: ―Auf die Heroisierung des Künstlers als eines handlungsmächtigen Genies folgt quasi kontrapunktisch, doch vor demselben Argumentationshintergrund seine Problematisierung als reflexiver Genius. Genieästhetische Konzepte wie der Enthusiasmus-Diskurs und die platonische Inspirationslehre funktionieren als endogene Erklärungsmodelle, die Quelle und Movens künstlerischen Schaffens in das Innere des Künstlers verlagern. […] Das säkularisierte Kreativitätskonzept lenkt das Interesse darauf, wie das Vermögen wirksam wird und in welcher Weise Phantasie und psychische Individualität der Künstlerpersönlichkeit zusammenspielen. Das in der Romantik erwachende psychologische Interesse am kreativen Prozeß richtet sich stärker auf den inneren Vorgang im Individuum als auf das reale Produkt. […] Hinter dem prometheischen Künstlertypus erscheint gleichsam als sein Schatten ein neuplatonisch- 93 mitersehnte, psychische Beweglichkeit eine Revision der romantisierten Auffassung, dass „Beethoven [during his last decade] had detached himself entirely from the outer world―. 243 Eben seine geistige Neumobilisierung widerspricht dieser Ansicht. Beethoven zog sich nicht auf „a soundless world of tones that existed only in his mind―244 zurück, sondern wandte sein Geist gerade der Welt zu. Seine Werke bildeten keine Abgrenzung seines Gemüts, aber waren genau ein durch sein Selbstbild zeitlebens gelenkter Weg aus seinem Inneren in die Welt hinaus. Denn betrachtet Beethoven Wien als Beschränkung seines Fortschritts, so sieht er das Ausland als Möglichkeit zur Neuerfindung. Somit ist sein Drang ins Ausland Ursache und Folge zugleich: Was ihn einst nach Wien geführt hat, treibt ihn wieder in die Ferne. Für Schubert ergibt sich gerade das Gegenteil. Als gebürtiger Wiener hält er stark fest an seine Heimatstadt und erfährt er das Ausland als einen befremdenden, fast die Existenz bedrohenden Ort, in dem er von allem Wesentlichen, das seiner Person angehört, abgeschlossen leben muss. Obwohl er beim Heranwachsen auch auf die Grenze seines sicherlich in jüngeren Jahren idealisierten Wiens stoßt und sich allmählich einer europäischeren Ebene bewusst wird, herrscht seine Wiener Sehnsucht anhaltend vor. Auch bei Schubert steht dabei eine ‚abwesende Anwesenheit‗ im Mittelpunkt. Zur Erhaltung seiner in der Fremde als gefährdet betrachteten Eigenheit ersetzt er das Unbekannte durch das ihm Bekannte: Schuberts Freunde, als Teil seiner Heimatsstadt, ersetzen seine Abwesenheit in Wien und ihre Briefe dienen an sich zur Auffüllung ihrer Abwesenheit. Diese Ersatzkonstruktionen sind anderer Art, als deren Beethovens. Sucht Schubert stets das Affirmative von Wien und koppelt das schon Existierende auf seine Fremde-Erfahrung zurück, so erzielt Beethoven mit seinen Auslandprojektionen gerade eine Neudarstellung. Auch die zu dieser Übertragung angewendeten, sprachlichen Mittel widerspiegeln die gegensätzliche Annäherung des enthusiastischer, der mit ihm in den Konturen der sozialen Rolle übereinstimmt und auch sein Selbstbewusstsein teilt, sich aber nicht länger über die reale Produktion von Kunstwerken definiert, sondern über die reine Möglichkeit einer solchen―. (Alexandra Ponzen: Künstler ohne Werk. Modelle negativer Produktionsästhetik in der Künstlerliteratur von Wackenroder bis Heiner Müller. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2000, S.29-30). Die hier beschriebene Schwelle von Werk- zu Künstlerverständnis soll repräsentativ seine für Beethovens eigene, vermutlich ganz unbewusste Ausbreitung oder Neuwertung seiner Werke von reinem Produkt zu buchstäblichem Vehikel seines Seins. 243 Stephen C. Rumph: Beethoven after Napoleon: political romanticism in the late Works. Berkeley/Los Angeles: University of California Press 2004, S.3 244 Donald Jay Grout nach Rumph: Beethoven after Napoleon, S.3 94 Auslandes. Auf einer rhetorischen Ebene konkretisieren beide Komponisten nämlich den grundlegenden, stilistischen Unterschied, dass „[a] [m]etaphor creates a knowledge of the relation between its objects; metonymy presupposes that knowledge―. 245 Bei Beethoven gestalten die Metaphorisierungen die völlige Umwandlung seiner Abwesenheit mittels seiner Werke, während Schuberts Metonymien immer das schon Vorhandene in sich mittragen. 245 Hugh Bredin nach Stefan Cochetti: Differenztheorie der Metapher: ein konstruktivistischer Ansatz zur Metapherntheorie im Ausgang vom erlebten Raum. Hrsg. v. Constanze Breuer. Münster: LIT Verlag 2004, S.261 95 4. Schlussfolgerungen und Ausblick Der Ausgangspunkt dieser Studie über Beethovens und Schuberts Selbstbild in ihren Briefen war ein doppelter, und befasste sich zwar mit der zentralen Frage, was sowohl thematisch als auch methodologisch über das Selbstbild von Beethoven und Schubert zu lernen sei. Dabei hat sie sich mit anderen Worten einerseits einem inhaltlich bezogenen Gegenstand zugewandt, sich andererseits übergreifender dem literaturwissenschaftlichen Umgang mit Briefen gewidmet Thematisch hat sich in den Zwischenfolgerungen schon gezeigt, zu welchen spezifischen Selbstbildern in Bezug auf das Künstlertum bzw. die Beziehung zu Wien und das Ausland die Untersuchung gekommen ist. Kurz zusammengefasst - und den delikaten Nuancen damit keine Ehre erweisend - möchte Beethoven einerseits sein Leben über die Grenzen seines Künstlertums hinaussteigen lassen, und betrachtet er seine Musik andererseits als eine Projektion seines Ichs, durch die er seine Anwesenheit im Ausland virtuell realisieren kann. Bei Schubert dagegen bedeutet das Künstlersein die Aufrechterhaltung einer Lebensweise und versteht er die Beziehung zu Wien und dem Ausland als grundlegend für seine Identität. Es sei ein Irrtum jedoch, an dieser Stelle diese verschiedenen Selbstbilder in einer Gesamtheit vereinen zu wollen. Wie im Kapitel zur Methodologie bereits bemerkt, ist die Art und Weise, in der sich ein Ich manifestiert, zu unterschiedlich und komplex, um einen Anspruch auf Totalität erheben zu können. Bedeutsamer ist die Fortführung der Reflexion, d. h. die Frage, wie lohnend die Rekonstruktion eines Selbstbildes aufgrund sprachlicher Analyse ist. Dazu ist diese Studie in den Briefen von einem literarischen Wert, der etwas über die Persönlichkeit der Verfasser besagt, ausgegangen. Denn die verwendete Sprache ist mehr als ein Kommunikationsmedium. In den stilistischen und rhetorischen Strukturen der Ausdrucksweise der Komponisten trat eine Persönlichkeit hervor, die (unbewusst) Ansichten über sich selbst, ihr Handeln und ihr Denken vermittelt. Die Beurteilung der Briefe auf ihren literarischen Wert hat erwiesen, dass die Dokumente mehr als biografisches Material beinhalten und sich neue Perspektive entwickeln lassen (sollen), um das meistens noch unausgenutzte Potenzial der Gattung geltend zu machen. So hat sich diese Studie auf den literarisch-ästhetischen Gehalt der Dokumente konzentriert, aber wäre es erdenklich, den Briefnachlass ebenfalls als Träger von z. B. 96 philosophischen Ideen (wofür Maynard Solomon in Bezug auf Beethovens Tagebuch schon einen Ansatz gegeben hat)246 oder als Widerspiegelung psychologischer Prozesse zu betrachten. So beschreiben beide Komponisten auffälligerweise eine Traumszene in ihren Schriften, die sich beispielsweise nach den Theorien Freuds oder Jungs analysieren und deuten lasse. 247 Das vermutlich größte Verdienst der thematischen Ebene umfasst daher nicht sosehr die konkreten Ergebnisse, sondern eher die Tatsache, dass sie gezeigt hat, dass Briefe kein bloßes Vehikel für biografische oder geschichtliche Abstraktion sind. Sie sind mehr als Aussagen von einer historischen Person, auch Aussagen über eine subjektive Persönlichkeit. Zwar hat sich die Briefanalyse anhand literaturwissenschaftlicher Strategien als produktiv erwiesen, dennoch bleibt die Frage ihres wissenschaftlichen Mehrwerts. Demzufolge soll letztendlich die Wirksamkeit der Methode, Briefe als selbstständige, literaturwissenschaftliche Quellen zu betrachten und anhand textimmanenter Analyse zu einem Selbstbild zu kommen, ausgewertet werden. Dabei stellt sich vor allem die Frage nach ihren Möglichkeiten und Beschränkungen. Diese Studie hat in erster Linie gezeigt, dass Briefe über eine ästhetische Qualität, die sich zu einer literaturwissenschaftlichen Analyse ausnutzen lässt, verfügen. Immer soll sich eine solche Vorangehensweise aber dessen bewusst sein, dass sie sich innerhalb der Grenzen der Interpretation bewegt. Da das Gewicht der Briefe nicht in einer objektiven Wahrheit, sondern in demjenigen, was sie über das Subjektive, d. h. die Eigenpersönlichkeit der Verfasser aussagen, liegt, können die Ergebnisse das Selbstbild auch nur teilweise umfassen und beanspruchen sie letztendlich keine Vollständigkeit. Um sich aber vor der Kritik allzu großer Beliebigkeit zu bewahren, hat diese Untersuchung in ihrem zweiten Grundsatz die Prämisse vorausgesetzt, dass die traditionell kontextuell angelegte Gattung der Briefe textimmanent untersucht und gerade ausschließlich aufgrund ihres literarischen Werts beurteilt werden kann. Nicht die Wissenschaftlichkeit einer solchen textanalytischen Vorangehensweise sollte hier reflektiert werden; die theoretische Relevanz liegt vielmehr in der Frage, wie systematisch sich eine solche textimmanente Untersuchung von Briefen ausarbeiten lässt und welche zusätzliche Perspektive sie eröffnet. Wie sich 246 siehe Maynard Solomon: Late Beethoven: music, thought, imagination. Berkeley and Los Angeles: University of California Press 2003, S. 159-178 247 vgl. Beethoven an Tobias Haslinger, 10. Sept. 1821 (BSB, Brief 1000) bzw. Allegorische Erzählung von Schubert [„Mein Traum―], 3. Juli 1822 (SDL, S.158) 97 gezeigt hat im Dialog mit anderen Studien, hat die textanalytische Annäherung an die Briefe, neue Einblicke über Beethoven und Schubert zu ermitteln ermöglicht. Bekundet das noch immer keinen qualitativen Mehrwert, so deutet jedoch darauf hin, dass diese Methode auch zu grundlegend neuen Ergebnissen kommen kann. Der kritische Apparat wurde in dieser Studie verwendet, um gerade dieses zusätzliche, inhaltliche Gewicht anzudeuten. Zwar haben sich die Fußnoten an manchen Stellen unabdingbar auf musikgeschichtliche oder biografische Daten bezogen, dennoch dienten diese Verweise an erster Stelle dazu, die Position der Arbeit im wissenschaftlichen Feld zu verschärfen, und hat sich der Volltext zudem ausschließlich textgemäß mit den Briefen auseinandergesetzt. Obwohl die Analyse also in dieser Trennung zwischen Textimmanenz und erweiternden Fußnoten immer konsequent hervorgegangen ist, lohne es sich in der Zukunft, die Methodologie in anderen Studien noch geradliniger durchzuführen. So könnte die Verringerung des Kontexts durch eine strikt narratologische Vorgehensweise sich noch ausführlicher der hier angenommenen Widerspiegelung der Gedanken in der Sprache widmen oder sei andererseits die Ausbreitung auf den Briefwechsel der Komponisten besser dazu imstande, die feine Grenze zwischen Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung, die durch den Fokus auf den einzelnen Briefen in dieser Arbeit zugegeben weniger zum Ausdruck kommen könnte, zu identifizieren und deuten. Diese Studie hat sich in erster Linie aber als ein Experiment über die Möglichkeiten textimmanenter Briefforschung verstanden. Sie akzeptiert die Schwachstellen, die sich in den Schlussfolgerungen erwiesen, aber ist dennoch vor allem davon überzeugt, dass diese Untersuchung, indem sie sich Beethoven und Schubert über ihre Briefe genähert hat, bislang unbetretene Wege zu einem neuen Verständnis der Komponisten eröffnet hat. Dazu möchte sie eine weitere Anregung und einen Ansatz für neue Studien bilden. Denn, wie es Edwin Fischer, einer der größten und entzückendsten Klavierspieler je, sagt: „Der Weg vom Urbild über Psyche, Physis, Instrument zum Klang ist weit―. 248 Diese Arbeit hofft allerdings, eine lohnende Station gewesen zu sein. 248 Edwin Fischer: Musikalische Betrachtungen. Wiesbaden: Insel-Verlag 1956, S.9 98 99 5. Bibliografie Primärliteratur van Beethoven, Ludwig: Briefwechsel Gesamtausgabe. Im Auftrag des BeethovenHauses Bonn hrsg. von Sieghard Brandenburg. 7 Bände. München: Henle Verlag 1996/1998. Ludwig van Beethovens Sämtliche Briefe. Hrsg. v. Emerich Kastner. Nachdruck der völlig umgearbeiteten und wesentlich vermehrten Neuausgabe von Dr. Julius Kapp (Unveränderter Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1923). Tutzing: Hans Schneider Verlag 1975. Beethoven aus der Sicht seiner Zeitgenossen: in Tagebüchern, Briefen, Gedichten und Erinnerungen. Zwei Bände. Hrsg. v. Kopitz, Klaus Martin und Cadenbach, Rainer. Unter Mitarb. von Korte, Oliver und Tanneberger, Nancy. München: Henle Verlag, 2009. van Beethoven, Ludwig/Solomon, Maynard: Beethovens Tagebuch 1812-1818. Bonn: Beethoven Haus 2005. Heine, Heinrich: Buch der Lieder. Hrsg. v. Bernd Kortländer. Bibliografisch ergänzte Ausgabe. Stuttgart: Reclam Verlag 2006. Rückert, Friedrich: „Ich bin der Welt abhanden gekommen―. In: Texte deutscher Lieder. Ein Handbuch. Hrsg. und eingeleitet v. Dietrich Fischer-Dieskau. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 200313, S.252. Schmidt von Lübeck, Georg Philipp: „Der Wanderer―. In: Texte deutscher Lieder. Ein Handbuch. Hrsg. und eingeleitet v. Dietrich Fischer-Dieskau. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 200313, S.137. Schubert: Die Dokumente seines Lebens. Gesammelt und erläutert v. Otto Erich Deutsch. Mit einem Geleitwort v. Peter Gülke. Erweiterter Nachdruck der 2. Auflage Leipzig 1980. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik 1996. Schubert: Die Erinnerungen seiner Freunde. Gesammelt und erläutert v. Otto Erich Deutsch. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1957. Franz Schubert im eigenen Wirken und in den Betrachtungen seiner Freunde. Zsgest. und hg. v. Reich, Willi. Zürich: Manesse Verlag, 1971. Sekundärliteratur Baasner, Rainer: ―Briefkultur im 19. Jahrhundert. Kommunikation, Konvention, Postpraxis‖. In: Briefkultur im 19. Jahrhundert. Hrsg. v. Rainer Baasner. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1999, S.1-36. 100 Badura-Skoda, Eva: Schubert und seine Freunde. Wien: Böhlau Verlag 1999. Bennet, Joseph: ―The Great Composers, Sketched by Themselves‖. In: The Musical Times and Singing Class Circular. Vol. 18, No. 415, Sep. 1, 1877 bis Vol. 25, No. 500, Oct. 1, 1884. Bernstein, Leonard: The unanswered question : six talks at Harvard. Cambridge (Mass.): Harvard university Press 1976. Blanning, Tim: The Triumph of Music. Composers, Musicians and their Audiences, 1700 to present. London: Penguin Group 2008. Bronzwaer, W.: „Igor Stravinsky and T. S. Eliot: A comparison of their Modernist poetics―. In: Comparative Criticism: Volume 4, The Language of the Arts. Edited by E. S. Shaffer. Cambridge: University Press 1982, S.169-192. Bruggemann, Diethelm: ―Gellert, der gute Geschmack und die üblen Briefsteller. Zur Geschichte der Rhetorik in der Moderne‖. In: Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 45 (1971), S.117-149. Bürgel, Peter: „Der Privatbrief. Entwurf eines heuristischen Modells―. In: Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 50 (1976), S.281297. Fischer, Edwin: Musikalische Betrachtungen. Wiesbaden: Insel-Verlag 1956. Fischer-Dieskau, Dietrich: Musik im Gespräch. Streifzüge durch die Klassik mit Eleonore Bühning. Berlin: Ullstein Buchverlage 2005. Cammilleri, Chiara Cinzia: „Auf dem Weg zu einem narrativen Lernprozess - Neue Möglichkeiten des Mediums Film - Auszüge aus einer qualitativen empirischen Studie―. In: Thema Fremdverstehen. Hrsg. v. Lothar Bredella/Herbert Christ/Michael K. Legutke. Giesener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Gunter Narr Verlag 1997, S.256-276. Cochetti, Stefan: Differenztheorie der Metapher: ein konstruktivistischer Ansatz zur Metapherntheorie im Ausgang vom erlebten Raum. Hrsg. v. Constanze Breuer. Münster: LIT Verlag 2004. Cornini, Alessandra: The Changing Image of Beethoven: A Study in Mythmaking. Santa Fe: Sunstone Press 2008. Dekker, Rudolf: ―Introduction‖. In: Egodocuments and History. Autobiographical Writing in its Social Context since the Middle Ages. Ed. by Rudolf Dekker. Hilversum: Verloren 2002, S.7-20. DeNora, Tia: Beethoven and the construction of genius: musical politics in Vienna, 1792-1803. Berkeley/Los Angeles: California University Press 1997. 101 Dürhammer, Ilija: ―Schlegel. Schelling und Schubert. Romantische Beziehungen und Bezüge in Schuberts Freundeskreis‖ in: Schubert durch die Brille 16/17 (1996), S. 5988. -: Schuberts literarische Heimat: Dichtung und Literatur-Rezeption der SchubertFreunde. Wien: Böhlau Verlag 1999. -: ―Zu Schuberts Literaturästhetik. Entwickelt anhand seiner zu Lebzeiten veröffentlichen Vokalwerke‖. In: Schubert durch die Brille 14 (1995), S.5-99. Gibbs, Christopher H.: „‗Poor Schubert‗: images and legends of the composer―. In: The Cambridge Companion to Schubert. Edited by Christopher H. Gibbs. Cambridge: University Press 1997, S.36-55. Goldschmidt, Harry: ―Musikverstehen als Postulat‖. In: Um die Sache der Musik. Reden und Aufsätze. 2., erw. Aufl. Leipzig: Reclam 1976, S.322-350. Gramit, David: ―‘The passion for friendship‘: Music, cultivation, and identity in Schubert‘s circle‖. In: The Cambridge Companion to Schubert. Edited by Christopher H. Gibbs. Cambridge: University Press 1997, S.56-71. Grout, Donald J. / V. Palisca, Claude: Geschiedenis van de westerse Muziek. Vertaald door Frans Brand, Robert Vernooy en Oscar van den Wijngaard. Bewerking en eindredactie: Robert Vernooy. Amsterdam: Olympus 20067. Hartung, Wolfdietrich: „Briefstrategien und Briefstrukturen - oder: Warum schreibt man Briefe?―. In: Sprache und Pragmatik, S.215-228. Hilmar, Ernst: ―Der neue Schubert-Brief‖. In: Schubert durch die Brille 23 (1999), S.44-45. Van Hoorickx, Reinhard: ―An Unknown Schubert Letter‖. In: The Musical Times, Vol. 122, No. 1659 (May, 1981), S.291-294. Huber, Florian: Durch lesen sich selbst verstehen. Zum Verhältnis von Literatur und Identitätsbildung. Bielefeld: transcript Verlag 2008. Johnson, Laurie Ruth: „Die Lesbarkeit des romantischen Körpers. Über Psychosomatik und Text in Fallstudien von Karl Philipp Moritz und Friedrich Schlegel―. In: Die Lesbarkeit der Romantik. Hrsg. v. Erich Kleinschmidt. Berlin: Walter de Gruyter 2009, S.105-135. von Lenz, Wilhelm: Beethoven. Ein Kunststudie. Kassel: Ernst Balde 1855. Litschauer, Walburga: ―Schubert aus der Sicht seiner Freunde‖. In: Schubert und das Biedermeier: Beiträge zur Musik des frühen 19. Jahrhunderts. Festschrift für Walther Dürr zum 70. Geburtstag. Hg. v. Michael Kube, Werner Aderhold und Walburga Litschauer. Kassel: Bärenreiter 2002, S. 139-146. 102 Karbusiky, Vladimir: Beethovens Brief „An die unsterbliche Geliebte“. Ein Beitrag zur vergleichenden textologischen und musiksemantischen Analyse. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1977. Käser, Rudolf: Die Schwierigkeit, ich zu sagen. Rhetorik der Selbstdarstellung in Texten des “Sturm und Drang” Herder- Goethe - Lenz. Dissertation. Berne u.a.: Peter Lang 1987. Lautenbach, Ernst: Lexikon Goethe-Zitate: Auslese für das 21. Jahrhundert aus Werk und Leben. München: IUDICUM Verlag 2004. Løgstrup, Knud Ejler: Kunst und Erkenntnis: kunstphilosophische Betrachtungen. Tübingen: J.C.B. Mohr 1998. Maes, Francis: Muziek als idee en praktijk. Een geschiedenis van de klassieke muziek. Deel 2: van Mozart tot Debussy. Gent: Uitgeverij Acco 2010. Mai, François Martin: Diagnosing genius: the life and death of Beethoven. Montreal/Quebec/Kingston: McGill-Queen's Press 2007. Marcuse, Herbert: Der deutsche Künstlerroman, Frühe Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1978. Meizoz, Jérôme: Postures littéraires en scènes modernes de l’auteur. Essai. Genève: Slatkine Erudition 2007. Meizoz, Jérome: ―Recherches sur la posture : Jean-Jacques Rousseau‖. In: Littérature 126 (Juni 2002), S. 3-17. Mies, Paul: ―Beethoven‘s Orchestral Works‖. In: The New Oxford History of Music. The Age of Beethoven 1790-1830. Volume VIII. Edited by Gerald Abraham. Oxford: University Press 1988. Millington, Barry: „Myths and Legends―. In: The Wagner Compendium. A Guide to Wagner’s life and music. Edited by Barry Millington. London: Thames & Hudson Ltd. 1992, S.132-139. Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte: Arbeitswelt und Bürgergeist, Band 1. München: C. H. Beck 1990. N.N.: „Schubert: Music, Sexuality, Culture―. In: 19th-Century Music. Vol. 17, No. 1, Schubert: Music, Sexuality, Culture (Summer, 1993) , S.3-4. Overlack, Anne: Was Geschieht im Brief? Strukturen der Brief-Kommunikation bei Else Lasker-Schüler und Hugo von Hofmannsthal. Tübingen: Stauffenburg 1993. Ponzen, Alexandra: Künstler ohne Werk. Modelle negativer Produktionsästhetik in der Künstlerliteratur von Wackenroder bis Heiner Müller. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2000. 103 Rexroth, Dieter: Beethovens Symphonien: ein musikalischer Werkführer. München: C. H. Beck Verlag 2005. Rosengren, Inger: „Die Textstruktur als Ergebnis strategischer Überlegungen des Senders―. In: Sprache und Pragmatik. Lunder Symposium 1982. Hrsg. v. Inger Rosengren. Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1983, S.157-191. Rumph, Stephen C.: Beethoven after Napoleon: political romanticism in the late Works. Berkeley/Los Angeles: University of California Press 2004. Rutz, Andreas: ―Ego-Dokument oder Ich-Konstruktion? Selbstzeugnisse als Quellen zur Erforschung des frühneuzeitlichen Menschen‖. In: Zeitenblicke 1 (2002), Nr.2 [20.05.2011],URL:<http://wwww.zeitenblicke.historicum.net/2002/02/rutz/index.html>. Schulze, Hagen: Kleine deutsche Geschichte. Mit Grafiken, Karten und Zeittafel. 9., aktualisierte und erweiterte Auflage. München: C. H. Beck‘sche Verlagsbuchhandlung 2008. Schulze,Winfried: ―Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte? Vorüberlegungen für die Tagung ―EGO-DOKUMENTE‖. In: Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte. Hrsg. v. Winfried Schulze. Berlin: Akademie Verlag 1996, S.11-31. Solomon, Maynard: „Beethoven: The Nobility Pretense―. In: The Musical Quarterly. Vol.75, No. 4, Anniversary Issue: Highlights from the first 75 Years (Winter, 1991), S.207-24. -: „Franz Schubert and the Peacocks of Benvenuto Cellini―. In: 19th-Century Music, Vol. 12, No.3 (Spring, 1989), S.193-206. -: „Schubert and Beethoven―. In: 19th-Century Music, Vol.3, No.2 (Nov., 1979), S.114125. Stauf, Renate: Der problematische Europäer. Heinrich Heine im Konflikt zwischen Nationenkritik und gesellschaftlicher Utopie. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter 1997. Steblin, Rita: „The Peacock‘s Tale: Schubert‘s Sexuality Reconsidered―. In: 19thCentury Music, Vol.17, No.1, Schubert: Music, Sexuality, Culture (Summer, 1993), S.5-33. Stegbauer, Hanna: Die Akustik der Seele. Zum Einfluss der Literatur auf die Entstehung der romantischen Instrumentalmusik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2006. Thayer’s Life of Beethoven. Revised and edited by Elliot Forbes. Princeton (N.J.): Princeton university press 1970. Tyson, Alan: ―Prolegomena to a Future Edition of Beethoven‘s Letters‖. In: Beethoven Studies 2. Edited by Alan Tyson. London: Oxford University Press 1977, S.1-19. 104 Viegas, Jennifer: Beethoven's World. New York: Rosen Publishing Group 2008. Virchow, Christian: „Zur Eröffnung― In: Literatur und Krankheit im Fin-de-Siècle (1890-1914): Thomas Mann im europäischen Kontext. Die Davoser Literaturtage 2000. Hrsg. v. Thomas Sprecher. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 2002, S.9-12. Woodfield, Ian: „John Bland: London Retailer of the Music of Haydn and Mozart―. In: Music & Letters, Vol. 81, No.2 (May, 2000), S.210-244.