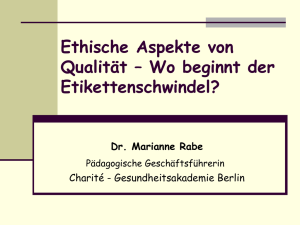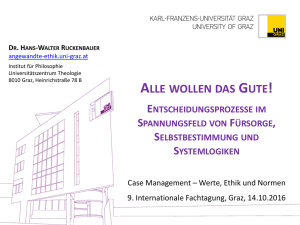Autonomie und Demenz
Werbung

Autonomie und Demenz Dr. Andreas Linsa, M.mel. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Interdisziplinäres Zentrum Medizin-Ethik-Recht Herausgegeben von Prof. Dr. Hans Lilie Prof. Dr. Hans Lilie (Hrsg.), Schriftenreihe Medizin-Ethik-Recht, Band 20, 2010 Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: ISSN 1862-1619 ISBN 978-3-86829-241-1 Schutzgebühr Euro 5 Interdisziplinäres Zentrum Medizin-Ethik-Recht (MER) Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Universitätsplatz 5 D- 06108 Halle (Saale) [email protected] www.mer.jura.uni-halle.de Tel. ++ 49(0)345-55 23 142 1 Gliederung 1. Einleitung und Problemstellung .............................................................................. 2 1.1 Autonomie als Grundbegriff der medizinischen Ethik........................................ 2 1.2. Die Arzt-Patient-Beziehung.............................................................................. 6 2. Medizinische und neuropsychologische Aspekte der Demenz ............................ 11 3. Ethische Entwürfe................................................................................................. 14 3.1. Das dialogische Prinzip.................................................................................. 14 3.2. Care-Ethik ...................................................................................................... 18 3.3. Eudaimonistische Ethik .................................................................................. 21 3.4. Verantwortungsethik ...................................................................................... 25 4. Ethik der Demenz ................................................................................................. 29 5. Zusammenfassung ............................................................................................... 40 2 1. Einleitung und Problemstellung 1.1 Autonomie als Grundbegriff der medizinischen Ethik Der Begriff der Autonomie ist ein Zentralbegriff der Moderne geworden. Er steht in der Ethik für das sittliche Freiheitsbewusstsein, in dem die normgebende Verantwortung des Menschen zur unabdingbaren Voraussetzung normativer Verbindlichkeit wird. Er wird außer in ethischen Diskursen auf zahlreiche andere Gegenstandsbereiche angewendet (etwa in Politik, Recht, Psychologie, Pädagogik oder Soziologie) und drückt dabei mitunter auch durchaus unterschiedliche Bewertungen aus. Von herausragender Bedeutung für die Ausbildung des genuin ethischen Autonomieverständnisses ist die praktische Philosophie Immanuel Kants (17241804). Nach Höffe (1983) hat „der Autonomiebegriff in der kantischen Philosophie erstmals und bis heute unübertroffen - eine präzise Ausarbeitung als ethische Leitidee“ erfahren. Zum Dreh- und Angelpunkt seiner kritischen Ethik erhebt Kant den „guten Willen“: „Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außerhalb derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille“ (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten). Dabei gibt es nach Kant keine dem Willen von außen verbindlich vorgegebenen Werte, diese werden vielmehr durch den sittlichen Willen des Menschen von ihm selbst – autonom – als moralisch verbindlich konstituiert. Sie sind dem Willen nicht vorgegeben, sondern seiner Autonomie aufgegeben. Diese Aufgabe hat den Charakter einer unbedingten Verpflichtung, des Kategorischen Imperativs. Dieser ist für Kant mehr als ein moralphilosophisches Testverfahren, er manifestiert sich als Sollensanspruch, der den Menschen zum Handeln antreibt. Autonomie besitzt in diesem Sinne eine motivationale Seite, die Kant mit der „Achtung vor dem Gesetz“ umschreibt. Der Achtung gebietende Imperativ ist dabei jedoch immer Anspruch der eigenen praktischen Vernunft, mit der der Mensch sich sein eigenes Gesetz geben und dieses konsequent lebenspraktisch vollziehen soll. Die sittliche Selbstgesetzgebung vollzieht sich konkret über die Ausbildung von Maximen, d. h. von subjektiven Grundsätzen, die darauf zu überprüfen seien, ob sie als universal geltend gewollt werden können: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne“ (Kritik der praktischen 3 Vernunft). Die kognitiven Fähigkeiten des Menschen werden so in den Dienst der sittlichen Selbstgesetzgebung gestellt: kognitive Seite der Autonomie. Moralität und Sittlichkeit haben ihren Ursprung in der Freiheit des menschlichen Willens, die zum einen Freiheit von materialen Bestimmungen, zum anderen Freiheit zur Selbstgesetzgebung bedeutet. Zur Freiheit, sich über alle Erscheinungen und die Kausalitäten der Natur zu erheben, ist nur der Mensch als vernünftiges Wesen befähigt. Genau diese Willensfreiheit als Fähigkeit zur Selbstbestimmung verleiht dem Menschen seine Würde und seinen absoluten Wert. Die Einsicht in die Autonomie des Sittlichen fällt mit der Achtung der Würde eines jeden Menschen zusammen. Die Freiheit wird von Kant als „Postulat der reinen praktischen Vernunft“ angesehen, als ein Vermögen aller Glieder der Menschheit zur Selbstgesetzlichkeit, die keine empirische Größe, vielmehr eine „transzendentale Idee“ sei. Freiheit und Würde sind somit in der sinnlichen Welt der Erscheinungen nicht beweisbar. Würde kommt für Kant in erster Linie der Menschheit als ganzer zu, an deren Würde der Einzelne teilhat, weil er mit ihr durch seine Natur verbunden ist. Daraus folgt für Kant, dass „die Würde der Menschheit an jedem Menschen praktisch anzuerkennen ist“ (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten). Jedem Menschen wird damit Personsein zugesprochen, wozu es nicht der tatsächlichen Realisierung der Freiheit in spezifischen freiheitlichen Akten bedarf. Eine menschliche Person hat „Würde vom Anfang des Lebens an und unter allen denkbaren Gestalten ihres Lebens“ (Ritschl 1989). Die Anerkennung der so verstandenen sittlichen Autonomie eines jeden Einzelnen kann nicht auf bestimmte Bereiche des Lebens und der Gesellschaft beschränkt bleiben, sondern muss alle Lebensbereiche durchwirken und prägen: Partnerschaft, Ehe, Familie, Erziehung, Bildung, Recht, Politik, Wirtschaft, aber auch den Umgang mit Krankheit, Alter und Tod. Die in der modernen Medizinethik etablierte Vorstellung von Autonomie ist die einer individuellen Entscheidungshoheit in Fragen persönlicher Belange und steht damit, wie Schöne-Seifert (2007) feststellt, „weit mehr in der liberalen Tradition eines John Stuart Mill als in der Tradition des kantischen Autonomieverständnisses“. Während Kants Autonomiekonzept, wie dargestellt, überindividuell zu denken ist, geht es in der Medizinethik vorwiegend um individuelle Überzeugungen und subjektive Werte bezüglich des eigenen Lebens. Die übliche Gleichsetzung der Begriffe 4 Selbstbestimmung und Autonomie wird daher von einigen Autoren (Knoepffler 2008, Wunder 2008) als durchaus problematisch angesprochen. Mit ihrem 1979 erstmals erschienenen, bahnbrechenden Buch „Principles of Biomedical Ethics“ haben Tom Beauchamp und James E. Childress das Prinzip des Respekts vor der Patientenautonomie weltweit bekannt gemacht. Sie bestimmen darin die Achtung der Autonomie als Anerkenntnis, dass Menschen das Recht haben, bestimmte Positionen zu vertreten, Entscheidungen zu treffen und ihren persönlichen Werten gemäß zu handeln. Im Bereich der Medizin bedeutet das: Patienten haben ein Anrecht darauf, nach fachgerechter Aufklärung, Behandlungen zuzustimmen (informed consent) oder diese abzulehnen. Ohne Einwilligung des aufgeklärten Patienten sind ärztliche Maßnahmen somit – außer in Notfällen – ethisch und auch juristisch abzulehnen. Nach überwiegend geteilter Auffassung (Faden und Beauchamp 1986) muss die Zustimmung oder Ablehnung eines Patienten mehrere Bedingungen erfüllen, um hinreichend autonom zu sein und daher Respekt zu verdienen. Zunächst muss ein Patient entscheidungskompetent sein, er muss weiterhin so informiert sein, dass er versteht, worum es geht und seine Entscheidung ohne steuernde Einflussnahme durch andere Personen fällen und geltend machen können. Schließlich müssen Zustimmung oder Ablehnung eine bewusste, intentionale Handlung sein, d. h. vom Patienten als Legitimierung oder Abweisung einer medizinischen Maßnahme verstanden werden. Dabei besitzt die erwähnte Entscheidungskompetenz eine Nadelöhr-Funktion, die zunächst erfüllt sein muss, bevor die Prozedur der Entscheidung nach Aufklärung in Gang gesetzt werden kann. Angesichts ihrer Zusammensetzung aus verschiedenen kognitiven und emotionalen Komponenten ist sie tatsächlich Hochschätzung jedoch von eine graduell Autonomie zeigt verwirklichte sich im Eigenschaft. Bemühen des Wirkliche Arztes, die Entscheidungsfähigkeit des Patienten, wann immer möglich, zu stärken. Die Kompetenzannahme wirft jedoch unweigerlich die Frage nach einer unteren Grenze auf, unterhalb derer es keine Möglichkeit der Selbstbestimmung gibt. Gibt es also Menschen, die vom Selbstbestimmungskonzept nicht erfasst werden, weil sie Informationen nicht verstehen, eigene Werte nicht reflektieren, die Folge einer Entscheidung nicht vorausdenken oder eine eigene Entscheidung einem Dritten gegenüber nicht äußern können? Oder: Kann eine eingeschränkte Entscheidungsfähigkeit die Möglichkeit zu partieller Selbstbestimmung offen lassen? Welche moralischen Prinzipien aber sind tauglich, im Falle einer krankheitsbedingt 5 eingeschränkten Autonomiefähigkeit, die davon unantastbare Würde des kranken Menschen zu sichern? Diesen Fragen wird in dieser Arbeit nachzugehen sein. Neben dem Recht auf Zustimmung oder Ablehnung medizinischer Maßnahmen und dem auf Information – beide konstituieren gemeinsam das Recht auf den informed consent – kann der Begriff der Patientenautonomie weitere Ausgestaltungen erfahren. Bobbert (2002) nennt hier unter Bezugnahme auf den amerikanischen Philosophen Alan Gewirth (1912-2004), der die Voraussetzungen der Handlungsfähigkeit eines Menschen (Freiheit und Wohlergehen) als Menschenrechte definierte, das Recht auf Festlegung des Eigenwohls, das es dem Menschen ermöglicht selbst zu entscheiden, was er für gut erachtet und was er möchte. Dieses Eigenwohl müsse der Mensch durch Selbstreflexion ermitteln, weshalb es die Aufgabe der Helfer sei, ihm die Möglichkeit dazu einzuräumen und ihn dabei zu unterstützen. Weil jeder aber das Recht habe, sein eigenes Wohl selbst festzulegen, bestehe zusätzlich zum bloßen Recht auf informierte Zustimmung zu einem unterbreiteten Handlungsvorschlag das Recht auf Wahl zwischen unterschiedlichen Alternativen, wo es diese auch immer gebe, zumal so die Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung individueller Präferenzen erhöht werden könne. Schließlich aber bedeute Respekt vor der Patientenautonomie auch, die Einengung des Handlungsspielraums eines Patienten durch institutionelle Sachzwänge, welche aus den Arbeitsabläufen des Krankenhauses oder der Praxis, aus versicherungsrechtlichen, ökonomischen oder gesellschaftspolitischen Vorgaben erwachsen können, so gering wie irgend möglich zu halten. Der professionelle Helfer trage an dieser Stelle die Beweislast; die Einschränkung des Handlungsspielraums sei begründungspflichtig. Die von Bobbert vorgeschlagene Auffächerung des Autonomiebegriffs macht zum einen deutlich, dass Autonomie nicht nur ein Abwehrrecht darstellt, sondern auch Ansprüche begründen kann und verweist zum anderen auf die Relationalität des autonomen Selbst. An dieser Stelle sind Bezüge zu den im nachfolgenden Kapitel dargestellten Modellen des Arzt-Patient-Verhältnisses aufzuzeigen. Während sowohl eine paternalistische, als auch – mit umgekehrtem Vorzeichen – eine informative Arzt-Patient-Beziehung mit sehr engen Autonomieverständnissen verknüpft sind, erfährt die Autonomie des Patienten im interpretativen und deliberativen Modell eine Förderung durch das gemeinsame Bemühen von Arzt und Patient, welches auf dessen Befähigung abzielt, am Ende eines von Vertrauen gekennzeichneten 6 interaktiven Prozesses die für ihn beste Entscheidung treffen zu können. Geisler (2004) spricht in diesem Zusammenhang von „gestützter Autonomie“ und nennt als deren Aufgaben das Bewusstmachen des Anspruchs auf Autonomie, den Abbau institutioneller Hemmnisse, die Beseitigung entwürdigender Umstände und: die Befähigung zur Autonomie durch Behandlung körperlicher oder psychischer, die Fähigkeit zur Selbstbestimmung einschränkender Störungen. Geisler betont die Bedeutung einer so verstandenen Autonomieförderung insbesondere in Situationen schwerster oder terminaler Krankheiten. 1.2. Die Arzt-Patient-Beziehung Die Arzt-Patient-Beziehung stand in der Geschichte der Medizinethik seit der Antike lange Zeit im Mittelpunkt ärztlicher Deontologien. Die neuere Medizinethik dagegen, die sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts zunächst in Amerika, mit einiger Verzögerung auch in Deutschland entwickelte, nahm zunächst vor allem ethische Konflikte am Beginn und am Ende des Lebens sowie neueste naturwissenschaftlichmedizinische Verfahren in den Blick. Die Grundlagen der Arzt-Patient-Beziehung erfuhren in dieser Zeit geringere Beachtung. Auch nach einer vorübergehenden Phase verstärkter Aufmerksamkeit in den 1970er Jahren in Deutschland gingen ethische Reflexionen und medizinsoziologische Untersuchungen zu diesem Thema erneut zurück. In den letzten Jahren jedoch wurden vor allem in den angloamerikanischen Ländern verschiedene Modelle der Arzt-Patient-Beziehung weiterentwickelt und in ihrer Wirkung erforscht. Das Verhältnis zwischen Arzt und Patient wurde, wie auch die Medizin selbst, im Wandel der Zeiten von den jeweils geltenden Leitideen und Denkmodellen beeinflusst. Dabei haben sich einige zentrale Normen und Prinzipien als überdauernd erwiesen oder gerieten nach einer Phase der Vergessenheit in verändertem Gewand jeweils erneut in den Blickpunkt des Interesses. In der jüngeren Medizinethik spielt die Reflexion über die Patientenautonomie und deren Stärkung gegenüber dem ärztlichen Paternalismus eine herausgehobene Rolle. So konnte sich in den 1970er Jahren die informierte Zustimmung - informed consent des Patienten in die vom Arzt vorgeschlagenen Behandlungsmaßnahmen als 7 ethisch-legales Minimum der Patientenautonomie durchsetzen. In den 1980er Jahren richtete die Careethik den Fokus von der Autonomiediskussion auf den Beziehungsaspekt der Arzt-Patient-Beziehung und damit auf Momente der Fürsorge, der Verantwortung und des Vertrauens. Die angesprochenen Werte charakterisieren in ihrer jeweils unterschiedlichen Wichtung die konkrete Gestalt einer Arzt-PatientBeziehung. Die Diskussion um die Systematik ihrer verschiedenen Modelle hat sich in den letzten Jahren neu belebt. Emanuel und Emanuel (1992) unterscheiden vier Muster: 1. Paternalistisches Modell: Der Arzt als Beschützer und Vormund (Eltern-, Priestermodell), der aufgrund seiner fachlichen Qualifikation am besten weiß, was gut für den Patienten ist. Die Bestimmung des besten Patienteninteresses ist anhand objektiver Kriterien möglich und kann daher unter nur eingeschränkter Beteiligung des Patienten erfolgen. Patientenautonomie bedeutet lediglich Zustimmung zu dem, was der Arzt für richtig hält. Im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Wohlergehen legt der paternalistische Arzt sein Hauptgewicht auf letzteres. 2. Informatives Modell: Es setzt eine scharfe Trennung zwischen Fakten und Werten voraus. Der Arzt versteht sich als technischer Experte, der seine Aufgabe darin sieht, dem Patienten fachliche Informationen als Entscheidungsgrundlage zu liefern. Von den Wertvorstellungen des Patienten hängt die Wahl der Behandlung ab. Hier entsteht eine erhebliche Asymmetrie dadurch, dass die Last der Entscheidungsverantwortung weitestgehend auf die Schultern des autonomen Patienten verlagert wird. 3. Interpretatives Modell: Die Wertvorstellungen eines Patienten sind nicht gänzlich festgelegt und ihm nur teilweise bewusst, sie können in konkreten Situationen miteinander in Konflikt geraten. Aufgabe des Arztes ist es daher zum einen, dem Patienten relevante fachliche Informationen zu liefern und zum anderen, gemeinsam mit ihm an der Verdeutlichung seiner persönlichen Zielvorstellungen und Ideale zu arbeiten, um danach Vorschläge zu unterbreiten, welche medizinischen Maßnahmen die herausgearbeiteten Werte realisieren können. 4. Deliberatives (abwägendes) Modell: Der Arzt als Lehrer und Freund, der sich mit dem Patienten über die besten Handlungsmöglichkeiten bespricht. Anliegen der Interaktion zwischen beiden ist es, dem Patienten bei der 8 Bestimmung und Auswahl der Behandlungsziele zu helfen, die in der klinischen Situation verwirklicht werden können. Sie überlegen gemeinsam, welche gesundheitlichen Ziele angestrebt werden könnten und sollten. Der Patient wird dabei unterstützt, nicht einfach unreflektierten Präferenzen oder reflektierten Wertvorstellungen zu folgen, sondern erhält das Angebot, im Gespräch alternative gesundheitliche Zielsetzungen und deren Wert sowie Konsequenzen für die Behandlung zu erwägen. Eine neuere Systematik (Krones und Richter 2006) nimmt die soeben vorgestellte Klassifikation auf, erweitert, differenziert und modifiziert sie. 1. Paternalistisches Modell: Dieses wird hier in gleicher Weise, wie von Emanuel und Emanuel, als stark asymmetrisches Verhältnis zwischen dem über Expertenwissen verfügenden, fürsorgenden Arzt und seinem überwiegend passiven Patienten verstanden. Es setzt ein rein naturwissenschaftliches Krankheitsmodell voraus und geht von der Möglichkeit der objektiven Bestimmung des Patientenwohls anhand allgemeingültiger Kriterien aus. 2. Vertragsmodell: Dieses umfasst zwei Konzepte, das a. Informationsmodell („informed [evidence based] choice“) sowie das b. Kundenmodell („consumerism“). Beiden ist gemeinsam, dass sie dem Patienten die größtmögliche obligatorische - Autonomie zubilligen. Im Informationsmodell wird dieser als rationaler Akteur gesehen, der aufgrund der ihm zur Verfügung gestellten oder von ihm selbst eingeholten Informationen gemäß seiner eigenen Präferenzen in alleiniger Verantwortung die Entscheidung über medizinische Maßnahmen trifft. Im Idealfall spiegeln diese Informationen den jeweils aktuellen Stand evidenzbasierter Medizin wider und beinhalten Angaben über Prognose mit und ohne Therapie, absolute und relative Risikoreduktion durch eine Behandlung sowie über das absolute und relative Risiko für das Auftreten von Komplikationen oder unerwünschter Wirkungen. Den geforderten Ansprüchen an die Aktualität und wissenschaftliche Zuverlässigkeit der Informationen sollen in jüngster Zeit entwickelte Internetportale gerecht werden. Patienten können in Deutschland über Seiten des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen – IQWiG (gesundheitsinformation.de) oder etwa des 9 Ottawa Health Decision Centre – OHDeC (decisionaid.ohri.ca) in Kanada konkrete Entscheidungshilfen in Bezug auf zahlreiche Krankheiten abrufen. Das Kundenmodell ist seit den 1990er Jahren verstärkt in die Diskussion gekommen. Der völlig autonome Patient wird als Konsument, der Arzt als Dienstleister auf dem freien Markt von Gesundheitsdienstleistungen konzipiert. Auch das Ausmaß der Information wird vom Patienten eigenverantwortlich bestimmt, so dass er gemäß seinem Recht auf Nichtwissen auf sie auch gänzlich verzichten kann, wobei der Arzt – in diesem Modell – einer Mitverantwortung weitestgehend enthoben ist, was freilich nicht unerhebliche haftungsrechtliche Probleme aufwirft, zumal Ärzte aufgrund ihres Expertenstatus rechtlich sehr wohl zur Aufklärung verpflichtet sind. Kritiker erkennen in diesem Modell zudem eine Haltung der Gleichgültigkeit und sprechen von „Autonomismus“. 3. Deliberatives Modell: Auch dieses umfasst zwei Komponenten, zum einen die a. Patientenzentrierte Arzt-Patient-Beziehung, zum anderen die b. Partizipative Entscheidungsfindung („shared decision making“, SDM). Im Zentrum der älteren patientenzentrierten Methode stehen die Informationssammlung, ein biopsychosoziales Krankheitsmodell und das Verstehen der Patientenperspektive. SDM fokussiert dagegen stärker auf den Vorgang der Entscheidungsfindung. Informationsaustausch verständigen Nach sich Arzt einem und gegenseitigen Patient über ein gemeinsames Ziel, welches sowohl die medizinischen Fakten, als auch die Präferenzen des Patienten berücksichtigt. Die dabei erzielte Übereinkunft wird als Konkordanz bezeichnet, welche die Grundlage der daraus resultierenden Adhärenz darstellt, des Umfangs also, in dem der Patient sich an die getroffenen Vereinbarungen gebunden fühlt und sich an diese hält. Bestehende Abhängigkeiten und Asymmetrien des Arzt-Patient-Verhältnisses werden anerkannt, jedoch in einem interaktiven Prozess auf ein solches Maß reduziert, welches ermöglicht. Im das Aushandeln Konzept einer der gemeinsamen relationalen Autonomie Entscheidung wird davon ausgegangen, dass Menschen, zumal als Patienten, immer in Beziehungen und Abhängigkeiten eingebunden sind, die ihre Möglichkeit zu genuin autonomen Entscheidungen einschränken oder gar unmöglich machen können. Es vernachlässigt dabei jedoch nicht die Bedeutung der Eigenverantwortung eines Patienten für den Umgang mit seiner Krankheit und 10 deren Therapie. So ist der Patient, juristisch betrachtet, Träger der Entscheidung, der Arzt wird dabei jedoch nicht aus seiner professionellen Mitverantwortung für umfassende und adäquate Aufklärung und Behandlung entlassen. Die beiderseitige Verantwortungsübernahme orientiert sich an dem vom Patienten gewünschten Maß. Das Konzept der optionalen Autonomie misst somit auch Fürsorge- und Verantwortungspflichten des Arztes eine bedeutsame Rolle zu, die darin ihren Ausdruck finden, dem Patienten genau so viel Autonomie zuzumuten, wie er selbst beanspruchen möchte. Dabei gerät jedoch auch die Pflicht des Arztes nicht aus dem Blick, der Selbstbestimmtheit des Patienten höchstmögliche Geltung zu verschaffen. Fürsorge dient hier der Herstellung größtmöglicher Autonomie und steht ihr nicht wie im klassischen Paternalismus gegensätzlich gegenüber. Es liegt auf der Hand, dass es dem Arzt nicht möglich sein wird, die Beziehung zu all seinen Patienten jederzeit nach dem von ihm favorisierten Modell uniform zu gestalten. Insbesondere die patientenseitigen Bedingungen werden von Fall zu Fall variieren. Ein komatöses Unfallopfer wird in der Nothilfesituation ein anderes Vorgehen verlangen als der wache, aber schmerzgeplagte Tumorpatient. Dessen Situation wiederum wird sich von der eines ebenfalls wachen, jedoch schwer dementen Menschen, der jegliche Fähigkeit, Sprache zu bilden und zu verstehen, eingebüßt hat, unterscheiden. Freilich wird ein Arzt eine grundsätzliche Präferenz des einen oder anderen Modells entwickeln. Die Notwendigkeit, inter- als auch intraindividuell die jeweils vorgefundene Situation maßgeblichen Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung der Beziehung zu seinem Patienten nehmen zu lassen, bleibt davon unberührt. Die vorliegende Arbeit soll unter dem eingangs erwähnten Gesichtspunkt der Autonomie als einem Leitgedanken heutiger medizinischer Ethik der Frage nachgehen, welche Konsequenzen das Vorliegen einer Demenz für die Gestaltung des Arzt-Patient-Verhältnisses besitzt. Wie weit trägt der Autonomiegedanke, wenn die Fähigkeit zur Selbstbestimmung mehr und mehr schwindet und schließlich ganz erlischt? Was bedeutet dieser Augenblick für die Würde des Betroffenen? Welche moralischen Prinzipien können hilfreich sein im Bemühen des Arztes um einen würdigen Umgang mit dem Kranken, den die Vernunft längst verlassen hat? Dazu sollen nach einer kurzen medizinischen Hinführung zum Demenzproblem einige in diesem Zusammenhang hilfreiche ethische Konzepte vorgestellt werden. Es 11 wird im Rahmen dieser Arbeit keine umfängliche Darstellung komplexer ethischer Theorien möglich sein. Daher werden jeweils ihre Bezüge zur klinischen Fragestellung ganz im Vordergrund stehen, andere Aspekte nur insofern erwähnt werden, wie es ein grundlegendes Verständnis des Entwurfes verlangt. Schließlich soll die Brücke wieder zurück zur Klinik geschlagen werden und die konkrete Anwendbarkeit der vorgestellten Theorien in der medizinischen Praxis hinterfragt werden. Welche Orientierungshilfe kann Ethik Ärzten und Pflegenden bei der Suche nach Wegen eines moralischen Ansprüchen genügenden Umgangs mit Demenzkranken bieten? Wie also kann eine „Klinische Ethik der Demenz“ aussehen? 2. Medizinische und neuropsychologische Aspekte der Demenz Demenzen gelten als die psychischen Alterskrankheiten schlechthin und sind die häufigste Ursache für Pflegebedürftigkeit. Mit steigendem Alter wird eine exponentielle Zunahme beobachtet. Die Prävalenz liegt zwischen in der Altersgruppe der 65- und 69-Jährigen unter 2%, verdoppelt sich dann aber alle fünf Jahre. Von den über 90-Jährigen leiden bereits über 30% an einer mittelschweren oder schweren Demenz. Derzeit wird in Deutschland von etwas mehr als einer Million Demenzkranker ausgegangen. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung werden wir mit diesem Problem in der Zukunft jedoch noch stärker rechnen müssen. Wenn in allen anderen Bereichen der Medizin weiter so erfreuliche Fortschritte erzielt werden, gleichzeitig aber in der Prävention und Therapie von Demenzen kein Durchbruch gelingt, wird sich die Zahl der Krankheitsfälle in Deutschland bis zum Jahr 2040 verdoppelt haben und dann bei über zwei Millionen liegen. Zur Häufigkeitsverteilung der einzelnen primären Demenzformen, die also nicht wie sekundäre Demenzen Folge anderer, etwa internistischer Erkrankungen oder unerwünschter Arzneimittelwirkungen sind, sondern auf einen pathologischen Hirnabbau (z. B. im Rahmen einer Progressiven supranukleären Blickparese - PSP, der Parkinson-Krankheit, einer Multisystematrophie - MSA, einer Lewy-KörperchenKrankheit - LBD, der Kortikobasalen Degeneration - CBD) zurückgehen, gibt es in der Literatur divergierende Angaben, wobei über die häufigste Demenzform weitestgehende Einigkeit besteht: Die Demenz vom Alzheimer-Typ (AD) macht demnach etwa 60-70% aller Demenzen aus und stellt damit die häufigste 12 neurodegenerative Erkrankung überhaupt dar. Das medizinische Demenz-Konzept ist folgerichtig am Modell der Alzheimer-Demenz ausgerichtet, auf die sich die folgenden Ausführungen konzentrieren werden. Die Diagnose einer Demenz setzt nach den gebräuchlichen Diagnosesystemen (ICD10, DSM-IV) voraus, dass eine Gedächtnisstörung sowie mindestens eine weitere kognitive Störung zu einer Beeinträchtigung der Alltagskompetenz führen. In der ICD10 wird darüber hinaus Bewusstseinsklarheit, d. h. die Abgrenzung von einem Verwirrtheitszustand verlangt, welche in fortgeschrittenen Stadien allerdings nicht mehr möglich ist. Die diagnostische Sicherheit erhöht sich bei Fortbestehen der Symptome über mehr als sechs Monate. Die Symptome einer Demenz werden klinisch unterschieden nach kognitiven Störungen, nicht-kognitiven Störungen und Störungen der Alltagskompetenz. Störungen der Kognition betreffen vor allem Gedächtnis, Lernfähigkeit, Orientierung, Sprache, Rechnen, Urteilsvermögen, logisches Denken und Auffassung. Zu den nicht-kognitiven Störungen gehören Wahn, Halluzinationen, Erregtheit und Aggressivität, Depression oder Dysphorie, Apathie, Enthemmung, Reizbarkeit und Stimmungslabilität, abnormes motorisches Verhalten sowie Störungen des Schlafes und des nächtlichen Verhaltens. Eine Beeinträchtigung der Alltagskompetenz schließlich kann sich in einer Vernachlässigung der Hygiene, der Kleidung, des Haushalts, beruflicher Pflichten oder von Hobbys äußern. Die Entwicklung der Symptome beginnt schleichend und verläuft chronischprogredient. Der Schweregrad einer Demenz kann sich somit von einer kaum auffälligen kognitiven Beeinträchtigung bis hin zu völliger Pflegebedürftigkeit erstrecken. Zur Einteilung der Erkrankung in Schweregradstadien sind verschiedene Instrumente entwickelt worden, die dazu am häufigsten benutzte Skala dürfte die Global Deterioration Scale (GDS) von Reisberg et al. sein. Dabei handelt es sich um eine eindimensionale, siebenstufige Fremdbeurteilungsskala, die im Anschluss an ein klinisches Interview ausgefüllt wird und von „keine Leistungseinschränkungen“ bis zu „sehr schwere kognitive Leistungseinbußen“ reicht. Der Auswertebogen ermöglicht darüber hinaus eine Überführung des GDS-Befundes in eine vereinfachte, für klinische Belange jedoch häufig praktikablere dreistufige Klassifikation, welche eine Graduierung in eine leichte, mittelschwere oder schwere Demenz erlaubt. Eine solche Einteilung verwendet auch Wunder (2008) in seiner Darstellung des Zusammenhangs zwischen Krankheitsstadium und Fähigkeit zur Willensbildung: 13 In Phase 1 der Demenzentwicklung (leichte Demenz) seien danach Einsichts-, Urteils- und Entscheidungsfähigkeit prinzipiell vorhanden, jedoch schwankend und u. U. durch Angst und Depressivität beeinflusst. In Phase 2 (mittelschwere Demenz) sei die Fähigkeit zur Willensbildung im Wesentlichen auf anschauungsgebundene Handlungen und Entscheidungen im Erlebnisnahraum und solche zur unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung beschränkt. Dinge müssten nun entweder unmittelbar sichtbar oder leicht vorstellbar sein, alten Wahrnehmungsmustern entsprechen und mit den noch vorhandenen Wertorientierungen beurteilbar sein, welche dichotomisch im konkret erfahrbaren und unmittelbaren Bereich angewandt werden können. In Phase 3 (schwere Demenz) könne der Kranke auf der Basis von Wohlsein und Zufriedenheit bzw. der Abwehr negativer Gefühle, also affektgeleitet Ja-NeinEntscheidungen im Bereich des unmittelbar Erlebbaren treffen. Die Diagnostik erfordert eine umfassende Anamnese und klinische Untersuchung, darüber hinaus neuropsychologische, elektrophysiologische, labor- einschl. liquordiagnostischer Verfahren sowie bildgebende Untersuchungen. Nur in seltenen Einzelfällen sind genetische oder histologische Untersuchungen des Hirngewebes sinnvoll. Die Pathophysiologie der Alzheimer-Demenz ist im Wesentlichen durch drei Mechanismen gekennzeichnet, die an dieser Stelle nur knapp umrissen, nicht näher erörtert werden sollen: Mit einer nach einem charakteristischen Muster erfolgenden räumlichen Ausbreitung einer generalisierten Neurodegeneration geht die Entwicklung von an die betroffenen Hirnregionen gekoppelten klinischen Symptomen einher. Folge der bestimmte Kerngebiete betreffenden fokalen Degeneration ist ein Mangel an Neurotransmittern, wie Azetylcholin, Serotonin oder Dopamin. Neben dem beschriebenen Neuronenverlust ist die Alzheimer-Demenz auch durch typische Ablagerungen im Hirnparenchym gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um die extrazellulär abgelagerten sog. neuritischen (Amyloid-) Plaques sowie die intrazellulär gelegenen neurofibrillären Bündel. Eine Konsequenz aus den genannten Pathomechanismen ist der Azetylcholinmangel, aus dem sich der bis heute einzige verfügbare kausal angreifende pharmakologische Therapieansatz ergibt. Azetylcholinesterase-Hemmstoffe haben ihre Wirksamkeit vor allem bei leichten und mittelschweren Demenzen zeigen können und vermögen das Fortschreiten kognitiver und Verhaltensstörungen zu verzögern. Wie auch bei anderen chronisch verlaufenden degenerativen Erkrankungen ist auch bei der Alzheimer-Demenz das Bremsen der Progression bereits als Therapieerfolg zu werten. Möglichkeiten der 14 symptomatischen Therapie zielen auf Krankheitsphänomene wie Depression, Halluzinationen, Wahn, psychomotorische Unruhe oder Schlafstörungen ab. Pharmakologische Maßnahmen sind jedoch stets nur als Teil eines umfassenden Behandlungskonzepts anzusehen, welches darüber hinaus andere Methoden, wie Bewegungstherapie, geistige Aktivierung oder Soziotherapie (Umfeldstrukturierung) berücksichtigen sollte. Zahlreiche neue Behandlungsmethoden befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen, ein Durchbruch ist gleichwohl bislang nicht absehbar. Die bislang nicht heilbare Alzheimer-Demenz ist eine die Lebenszeit verkürzende Erkrankung, sie führt im Mittel nach neun (fünf bis fünfzehn) Jahren zum Tode. 3. Ethische Entwürfe 3.1. Das dialogische Prinzip Die abendländische Tradition charakterisiert die menschliche Existenz als Geistexistenz, die durch ihr vernünftiges Sein bestimmt werde. Es waren im Wesentlichen Impulse des jüdischen Religions- und Sozialphilosophen Martin Buber (1878-1965), die im vergangenen Jahrhundert zu einer Erweiterung dieses Bildes um einen grundlegenden Aspekt führten: Buber sah in der Verwirklichung der menschlichen Existenz durch die Beziehung zwischen Ich und Du die Grundlage menschlichen Personseins und nahm so neben der geistigen Existenz die kommunikative Dimension des Menschseins in den Blick. Die Voraussetzung einer zwischenmenschlichen Kommunikation aber ist die geistig-leibliche Einheit der einzelnen Personen, zumal sich jeder Dialog auf der Grundlage des sowohl geistigen, wie auch leiblichen Seins der einander begegnenden Personen vollzieht. Bubers Ontologie charakterisiert den Menschen mittels zweier von diesem zu sprechenden „Grundworte“, nämlich des „Ich-Du“ als Ausdruck der „Welt der Beziehung“ und des für die „Welt der Erfahrung“ stehenden „Ich-Es“. Während das Es mit den Mitteln der Beobachtung oder Betrachtung erfasst wird, begegnet das Ich dem Du in der Hinwendung, im Innewerden, in der Umfassung. Das Es wird vergegenständlicht, das Du vergegenwärtigt. Die „Es-Welt“ ist zur Erhaltung des Lebens nötig, wirkliches Sein als Mensch wird nach Buber jedoch ausschließlich in 15 der Begegnung erreicht, in der sich das Ich einem jeweils einzelnen, bestimmten Du rückhaltlos und ausschließlich zuwendet, seiner inne wird und antwortet. Erst in dieser Begegnung, dem echten Dialog, wird der Mensch Person. Bubers Personbegriff ist dabei ein ausdrücklich ganzheitlicher, der den leibseelischen Menschen als Sozialwesen, in seiner historisch-kulturellen und biographischen Geschichtlichkeit umfasst. Auf der Grundlage eines Personbegriffs, der somit sowohl die dialogische Komponente als auch die geistig-leibliche Einheit des Menschen betont, entwickelte Buber seine dialogische Verantwortungsethik. Ethik im Sinne Bubers ist dabei „Antwort auf das Du“, die den Respekt vor dem Anderen und Toleranz einfordert. Buber stellte Kriterien der Dialogik auf, die auch im Hinblick auf die Begegnung zwischen Arzt und Patient wertvoll erscheinen und von zahlreichen Autoren unter diesem Gesichtspunkt aufgenommen und ausgearbeitet wurden. Genannt seien hier vor allem der Mediziner Viktor von Weizsäcker und dessen medizinische Anthropologie, der Psychotherapeut Hans Trüb („Heilung aus der Begegnung“ 1951) sowie der Philosoph Peter Kampits („Das dialogische Prinzip in der Arzt-PatientenBeziehung“ 1996). Bubers Kriterien des Dialogs, die deskriptiv sein Gelingen beschreiben, aber auch normativ als Sollensnormen zu verstehen sind, umfassen: die „Unmittelbarkeit“ zwischen den einander begegnenden Menschen, also die Forderung nach einer unverstellten Zuwendung zum Anderen, das Gebot, dem Anderen in seiner individuellen Wirklichkeit gerecht zu werden („Ausschließlichkeit“), die „Wahrhaftigkeit“ dem Anderen gegenüber, wechselseitige „Rückhaltlosigkeit“ als Grundlage von Vertrauen, „Vergegenwärtigung“ des Gegenübers in dessen Denkund Wertewelt einschließlich der eigenen Wirkung auf ihn in seiner Sicht („Realphantasie“), „Akzeptation“ des Anderen, die nicht prinzipielle inhaltliche Zustimmung, jedoch Annahme als Partner echten Gesprächs meint, schließlich „Gegenseitigkeit“ zwischen den einander begegnenden Personen. „Gegenseitigkeit“ schließt die Berücksichtigung von Asymmetrien ein. Buber bezog sie auf die zwischenmenschliche Begegnung im pädagogischen Kontext, die in der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler ein Gefälle aufweise. Aus der Überlegenheit des Lehrers leitet Buber eine besondere Verantwortung für den Schüler ab. Analog ist auch das Verhältnis zwischen Arzt und Patient von Asymmetrien geprägt. Wie groß die Aufmerksamkeit für die Beachtung der Patientenautonomie auch immer sein mag, sie wird den Wissensvorsprung des Arztes oder die mitunter existenzielle 16 Verunsicherung des Patienten durch von Krankheit ausgehende Bedrohungen der Gesundheit oder des Lebens nicht unwirksam machen können. Wie viel stärker aber werden derartige Asymmetrien ein Arzt-Patient-Verhältnis prägen, wenn Krankheit vermeintliche Sicherheiten nicht nur ins Wanken bringt, sondern die geistige Seite der geistig-leiblichen Einheit des Menschen selbst in Angriff nimmt und unaufhaltsam auszulöschen beginnt? Eine dialogische Betrachtungsweise lässt für Kampits (1996) den Reduktionismus erkennen, welchem das Arzt-Patient-Verhältnis sowohl im Falle des paternalistischen als auch des Modells einer absolut gesetzten Patientenautonomie unterworfen ist. Wird der Patient in ersterem als Objekt verstanden, das einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise und aus ihr abgeleiteten Handlungszielen unterworfen ist, während der Arzt das durch Wissen und Kompetenz ausgezeichnete autonome Subjekt darstellt, wird der Patient im letzteren dagegen als das Subjekt angesetzt, das frei und souverän entscheidet und den Arzt als Mittel zur Wiederherstellung der Gesundheit einsetzt. Dialogisches Denken aber sieht die zwischenmenschliche Beziehung als eigentliche Dimension des Menschseins. Indem sie diese Beziehung als eine zwischen Ich und Du ansetzt, geht sie sowohl über eine solche zwischen Subjekt und Objekt, als auch über eine zwischen einander gegenüberstehenden autonomen Subjekten weit hinaus. Die dialogische Grundhaltung steht dem Du anders gegenüber als einem fremden Subjekt oder gar einem Objekt. Kampits verweist auf Emmanuel Lévinas (1905-1995), von dem in der Begegnung zwischen Ich und Du konsequent eine Vorrangigkeit des Du vertreten wird. Der Andere widersetze sich dabei einem Verstandenwerden in Kategorien. Denkendes und erkennendes Erfassen des Anderen ist für Lévinas immer bereits ein Akt der Gewalt, mit dem das Anderssein des Anderen auszulöschen versucht werde. Die ursprüngliche Begegnung mit dem Anderen aber geschehe über dessen Antlitz, welches Verantwortung für ihn als ethische Urbeziehung wachrufe. Verantwortung ergebe sich aus der Schutzlosigkeit des Anderen, die einen Widerstand bedeutet gegenüber meinen eigenen Versuchen, ihn zu unterwerfen, ihn in die Gewalt des Könnens und Verstehens zu bringen. Im Antlitz des Anderen zeige sich „der Elende, für den ich alles tun kann und dem ich alles verdanke. Und ich, wer immer ich auch bin, aber ich, als jemand „in der ersten Person“, ich bin der derjenige, der über die Mittel verfügt, um auf diesen Ruf zu antworten“ (Lévinas 1992). Dialogisches Denken in der Arzt-Patient-Beziehung erkennt im an mich ergehenden Appell „Ich bin und ich leide“ Verantwortung und eine extreme ethische Anforderung, die vom Anderen 17 ausgehend an mich gerichtet wird. Es überbietet dabei jedwede Subjekt-ObjektBeziehung und zielt so auf eine Struktur jenseits von Paternalismus und Autonomie (Kampits 1996). Kampits sieht in den Prinzipien dialogischen Denkens eine Chance der Medizin, ihren ethischen Ursprung wieder zu entdecken. Spitzy (2002) verweist auf den semantischen Bezug des Begriffs der Ver-Antwortung zum Dialogischen. Sie sei die Antwort des Arztes auf den Hilferuf des Patienten, der sich zur Verzweiflung steigern könne. Im Zweifel wiederum sei die Notwendigkeit zum Vertrauen gegeben, welche eine gegenseitige sei: Der Patient schenke dem Arzt sein Vertrauen, der Arzt müsse seinerseits dem Patienten vertrauen. Aus Vertrauen und Verantwortung ergebe sich eine Haltung der beiden Subjekte zueinander, die immer wieder neu erworben werden müsse. Das dialogische Prinzip ist von Viktor von Weizsäcker (1886-1957) aufgegriffen worden. Als „Urphänomen“ seiner medizinischen Anthropologie benennt dieser den kranken Menschen, „der eine Not hat, der Hilfe bedarf“. Dieser kranke Mensch aber komme in der klassischen Pathologie nicht vor, da diese zwar die Krankheit, nicht aber das Kranksein eines Menschen thematisiere: „Krank ist hier etwas, was man erkennen kann, nicht das, was man auch selbst sein kann“. Anders verhalte es sich in der Begegnung von Arzt und Krankem. Indem der kranke Mensch, der dem Arzt als Objekt gegenüberstehe, um Hilfe bitte, mache sich im Objekt ein Subjekt vernehmbar. Da aber die Krankheit sich nicht von der Person des Kranken trennen lasse, habe der Arzt sie im Kontext des Lebensganzen dieser Person zu verstehen. Den Kranken zu verstehen bedeute für den Arzt, „dass jener Andere meint oder denkt oder fühlt oder weiß, er sei krank. Verstehen heißt also hier gar nicht das wissen, was ich weiß, sondern wissen, dass und was ein anderer weiß“. Petersen (1992) fordert vom Arzt die Fähigkeit, den Schmerz seines Patienten im Spiegel seines eigenen Inneren aufzufangen und auszuhalten und erkennt diesen Aspekt ärztlicher Dialogik im Text der Lyrikerin Marie-Luise Kaschnitz wieder: „Der Arzt – dem Inferno zugewandt: Halte nicht ein bei der Schmerzgrenze / Halte nicht ein / Geh ein Wort weiter / Einen Atemzug / Noch über Dich hinaus“. Für von Weizsäcker erschließt sich die Not des Kranken nur dem transjektiven Verstehen des Arztes, das sich dann einstelle, wenn sich im Arzt der Drang zur Überwindung der Krankheit auspräge. Dialogische Verantwortung wird so zum Leitgedanken der Medizinethik von Weizsäckers. Der Psychotherapeut Hans Trüb wiederum setzt in seinem o. g. Hauptwerk der psychologischen Anthropologie seines Freundes und Lehrers C. G. Jung eine 18 dialogische Auffassung des Menschen gegenüber und macht sie zum Leitgedanken seiner therapeutischen Arbeit. Der „Schlüssel zum zentralen und ganzheitlichen Verständnis des Menschen“ sei „in seinem partnerischen Verhältnis zum Gegenüber zu finden“: „[…] nämlich dass der Mensch nur zu sich selbst kommt und er selbst wird, insofern als er von einer transzendenten Stelle her angerufen ist und darauf antwortet. In Anruf und Antwort wird seine Personmitte […] aktualisiert und erst in dieser Aktualität das Selbst verwirklicht“. Für Trüb ist das menschliche Selbst auf „Begegnung und Begegnungserschließung angelegt und so personal bestimmt“. Die von einer dialogischen Haltung geweckte und auf gegenseitigem „personalen Vertrauen“ basierende „personale Verantwortung“ fordert vom Therapeuten einen „personalen Einsatz“, der zugleich immer darum weiß, dass die „entscheidungsetzende Instanz“ die „dem Selbst zugeschriebene personale Qualität im Patienten“ ist. 3.2. Care-Ethik Insbesondere in den angloamerikanischen Ländern hat sich in den letzten Jahren in der medizinethischen Diskussion eine Care-Ethik entwickelt, die – ausgehend von einer Betonung der relationalen und emotionalen Dimensionen menschlicher Existenz – Fürsorge und Verantwortung gegenüber Rechten und Pflichten in den Vordergrund rückt. Auslöser der aktuellen Debatte um die Care-Ethik war die Publikation empirischer Untersuchungen der amerikanischen Moralpsychologin Carol Gilligan („In a Different Voice“ 1982), in denen das von Jean Piaget und Lawrence Kohlberg erarbeitete Stufenschema der moralischen Entwicklung hinterfragt und diesem ein alternatives Modell gegenübergestellt wurde. Während die moralische Entwicklung nach Kohlberg auf das Ziel einer moralischen Orientierung an universellen ethischen Prinzipien wie Gerechtigkeit, Gegenseitigkeit, Gleichheit, Respekt vor der Autonomie und Würde des Menschen zustrebt, wies Gilligan im Ergebnis ihrer beide Geschlechter einbeziehenden Studien - Kohlbergs Probanden dagegen waren nur Männer - auf moralische Argumentationsformen hin, die sie besonders häufig bei Mädchen und Frauen gefunden hatte. Diese „andere“, nicht aber inferiore, „Stimme“ weist die Möglichkeit eines unparteilichen, moralischen Standpunktes zurück und geht stattdessen von der Abhängigkeit moralischer Urteile 19 von situativen und relationalen Kontexten aus. In der Folge wurde die Idee einer fürsorgeorientierten, weiblich dominierten Ausprägung von Moralität im Unterschied zu ihrem gerechtigkeitsorientierten, männlich dominierten Pendant sowohl im Kontext verschiedener angewandter Fragestellungen rezipiert als auch in allgemeinphilosophischen Zusammenhängen diskutiert (Übersicht in Biller-Andorno 2001). Nach Biller-Andorno (2001) setzt Care-Ethik ein relationales, leibsensibles, mit asymmetrischen und konkreten Beziehungen rechnendes Menschenbild voraus. Der Care-Ethik geht es inhaltlich im Unterschied zur Gerechtigkeitsorientierung, für die das Befolgen rationaler Regeln bezüglich individueller Rechte im Vordergrund steht, um Verantwortung, fürsorgliche Beziehungen und das Verhindern von Verletzungen Anderer. Dazu unternimmt sie den Versuch, eine konkrete Situation emotional und rational möglichst präzise nachzuvollziehen. Das Bemühen um ein Verständnis des Standpunktes des „konkreten Anderen“ spielt für das moralische Urteil eine große Rolle. Die allgemeine Moraltheorie fokussiert auf das moralisch Rechte, die politische Philosophie auf die Gerechtigkeit. Dagegen wurde Fürsorge bislang als sittlich verdienstvoll, nicht aber als allgemein gefordert und als Wert des Guten den Normen des Rechten nachgeordnet eingeschätzt. Wurde die Care-Ethik, wie oben gezeigt, zunächst in bewusster Abgrenzung zu Prinzipien- (Gerechtigkeits-) Ethiken konzipiert, unternimmt Biller-Andorno den Versuch einer Synthese, in dem sie zeigt, dass auch eine Care-Ethik nicht ohne moralische Prinzipien auskommt. Care-Ethik erinnere ontologisch an eine „beziehungsorientierte Konzeption vom Selbst“. Hieraus könne abgeleitet werden, dass sich moralische Konflikte nicht nur zwischen konkurrierenden Rechten, sondern auch zwischen situativ konkurrierenden Verantwortlichkeiten auftun können. Bei einer „Integration zum wechselseitigen Vorteil“ bestehe jedoch ein geltungstheoretischer Vorrang der deontologischen Moraltheorie, weil allein sie die Achtung des Individuums gewährleiste. Berücksichtige aber eine Care-Ethik den deontologischen Rahmen, dann könne sie sich auch erfolgreich gegen die ihr immanenten Gefahren der Heteronomie, des Paternalismus, der Beliebigkeit, der inhaltlichen Unausgewogenheit durch eine ontologische Übersteigerung des Caring als auch der Begründungsschwäche wehren. Nach Pauer-Studer (2006) bleibe eine Care-Ethik auf Beziehungen des Nahbereiches, „des besonderen Anderen“ beschränkt, da eine auf die Haltung voller 20 Anteilnahme und Zuwendung verpflichtende Fürsorglichkeitsmoral im Falle der Übertragung auf Personen des Fernbereichs eine Überforderung darstellte. Eine „Sphärentrennung“ von Gerechtigkeit und Fürsorglichkeit hält dagegen auch sie nicht für angebracht, zumal diese die Konsequenz hätte, dass der für eine Care-Ethik vorrangig relevante Bereich der Nahbeziehungen von Gerechtigkeitskriterien ausgenommen wäre. Auch müsse eine Haltung sorgender Anteilnahme allen Moralsubjekten unabhängig von ihrem Geschlecht gleichermaßen abverlangt werden, Caring sei somit als ein nach dem jeweiligen situativen Kontext zu spezifizierendes Prinzip zu verstehen. Damit aber erweise sich die strikte Gegenüberstellung einer Ethik der Prinzipien und einer Care-Ethik als unhaltbar. Eine „Frontstellung“ der Fürsorge gegen den Respekt vor Autonomie ist - so BillerAndorno - durch eine Fürsorgekonzeption zu vermeiden, welche diese in Anlehnung an Beckmann (1998) nicht als „Kompensation für eingeschränkte oder fehlende Patientenautonomie“ sondern als „ärztliche Antwort auf das Hilfsbegehren des autonomen Patienten“ versteht. Die Forderung, dass Respekt vor der Autonomie des Anderen die Basis des fürsorglichen Verhaltens sein müsse, habe unmittelbare Plausibilität. Fürsorge und Autonomie seien insofern nicht einander ausschließende, sondern einander bedingende Konzepte. Ein grundsätzlicher Konflikt bleibe nur bestehen, wenn Autonomie als Eigenschaft oder gar als Leistung missverstanden werde. Sobald Autonomie im Sinne von Unabhängigkeit, Selbstständigkeit oder gar Beziehungslosigkeit in der Lebensführung anstatt von Unverfügbarkeit und Subjekthaftigkeit gedeutet werde, ergebe sich ein Scheinkontrast zu einer Auffassung vom Menschen als einem in Beziehung stehenden, bedürftigen Menschen. Biller-Andorno sieht als Verdienst der Care-Ethik an, erneut auf die unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten eines autonomen Selbst aufmerksam gemacht zu haben, bei denen Individualität und Relationalität jeweils unterschiedlich stark betont werden. Sprechen sich Biller-Andorno und Pauer-Studer für integrative, die Kantische Ethik und den Gerechtigkeitsdiskurs um Care-Aspekte erweiternde Konzepte aus, so positioniert Conradi (2001) ihren Ansatz explizit außerhalb traditioneller ethischer Theorien. Care sei Rechten und Pflichten nicht nachzuordnen, sondern besitze eine eigene, genuin ethische Qualität, indem sie der grundsätzlichen Angewiesenheit des Menschen Rechnung trage. Care sei insofern nicht geschlechtsgebunden, es handele sich nicht um eine feminine Ethik. Da Care traditionell allzu oft für eine affektive oder gar instinktive Angelegenheit gehalten werde, liege es Conradi 21 besonders daran, es als eine sozio-historisch bedingte Form gesellschaftlicher Praxis und damit als veränderbar und veränderungsbedürftig zu verstehen. Care umfasse sowohl das Zuwenden als auch das Annehmen von Zuwendung. Die Asymmetrie von Care-Interaktionen besäße dabei eine besondere Bedeutung, denn es gehe um eine Dynamik der Macht. Eine wichtige Frage sei es, wie es gelingen könne, Machtdifferenzen wahrzunehmen und zu begrenzen, um sie nicht auf andere Bereiche der Beziehung oder der Person auszudehnen oder gar zu verabsolutieren. An Care-Interaktionen beteiligte Menschen unterschieden sich in ihren Fähigkeiten, Kompetenzen und in ihrer Autonomie. Achtung in Care-Interaktionen setze aber eine Unterstellung von Autonomie auch keineswegs voraus, sondern müsse entwickelt werden „unabhängig davon, ob eine Person ihr Gegenüber als ähnlich oder als verschieden, als mehr oder weniger autonom empfindet“. Conradi fasst eine solche Haltung mit dem Begriff der Achtsamkeit, der sowohl die Achtung aufnimmt, als auch das Anliegen ausdrückt, „dass Menschen sich anderen Menschen zuwenden, sie ernst nehmen, auf sie eingehen, für sie sorgen, sowie dass Menschen Zuwendung zulassen“. Sollte eine Begründung der Achtsamkeit einer universalisierbaren Kategorie bedürfen, so biete sich dafür die grundlegende Angewiesenheit von Menschen eher an, als ihre Fähigkeit zur Autonomie. „Auf den Punkt gebracht“ ließe sich sagen, „die Care-Ethik präferiert Bezogenheit und Differenz vor Autonomie und Konsens“. Das Erweisen von Achtsamkeit sei nicht durch die Aussicht auf eine Gegengabe motiviert, sondern bleibe letztlich immer ein Geschenk. CareInteraktionen könnten auch nonverbal sein und hätten im weitesten Sinne mit Berührung zu tun, d. h. es gehe um „Berührtsein“ von der Situation oder einer daran beteiligten Person, durchaus aber auch im Sinne körperlicher Berührungen. So seien in Care-Interaktionen „Fühlen, Denken und Handeln verwoben“. Die Integration von Gefühl und Verstand sei dabei ein zentraler Aspekt der Care-Praxis, in deren reflektiertem Handeln affektiv-emotionale und kognitive Anteile zu verbinden seien. 3.3. Eudaimonistische Ethik Die Ausgangsfrage eudaimonistischer Ethikentwürfe lautet mit Platon: Wie soll man leben? Oder: Was ist ein gutes Leben? Mit dem griechischen Wort eudaimonia verbindet sich die Vorstellung von einem Menschen, der im Besitz eines guten 22 Dämons ist, der also ein gutes, gedeihliches, lobenswertes Leben führt. Das so umrissene eudaimonische Grundproblem kann nun jedoch auf verschiedene Weise interpretiert werden. So ist in einer prudentiellen Ausrichtung das subjektiv erlebte Wohlbefinden der fragenden Person gemeint: Was ist für mich ein gutes Leben? Eine perfektionistische Auslegung des Grundproblems versucht dagegen eine objektive Qualifikation menschlichen Lebens. Während sich ein weiter Perfektionismus dabei auf das menschliche Leben im Sinne des allgemeinen Menschseins bezieht und von dessen individueller Erscheinungsform absieht, macht ein enger Perfektionismus seine Beurteilung von den besonderen Eigenschaften des Individuums abhängig und fragt daher: Was ist für diesen besonderen Menschen ein objektiv gutes Leben? Von Kant wird Eudaimonismus als Inbegriff der Erfüllung persönlicher Neigungen, als Bezeichnung der Theorien, die Moralität als Mittel zur Glückseligkeit auf einen bloß hypothetischen Imperativ reduzieren, als Widerspruch zur Sittlichkeit abgelehnt. Wo aber, wie etwa bei Platon und Aristoteles, Glück selbst sittlich bestimmt wird, ist Moralität Bestandteil des Ziels, so dass Kants Kritik hier nicht zutrifft. Alle antiken Positionen des Eudaimonismus gehen von einem prudentiellen Ansatz aus, fragen also nach dem Wohlergehen des Einzelnen, gelangen dabei jedoch zu durchaus unterschiedlichen Akzentsetzungen und zur Entdeckung auch perfektionistischer und moralischer Momente. Die Lehre Epikurs ist bestimmt vom Ziel des Glücks durch ein Leben der Lust, die alleiniger Inhalt des guten Lebens sei. Perfektionistische Momente finden sich in seiner Ethik dort, wo es um die Vervollkommnung jener habituellen Voraussetzungen geht, die den dauerhaften Besitz von Lust ermöglichen. Auch Aristoteles geht zunächst von einem prudentiellen Verständnis des guten Lebens aus, subjektiv empfundenes Wohlbefinden kann für ihn jedoch nur über die Vervollkommnung spezifisch menschlicher Vermögen, wie etwa der Verstandes- oder Sozialfähigkeit, erreicht werden. Er spricht in diesem Zusammenhang von Tugenden und führt so ein perfektionistisches Moment in seine Theorie ein. Freundesliebe sei zwar auch Verlängerung der Selbstliebe, für einen angemessenen Umgang mit dem Freund muss sich das Selbst jedoch von seinen eigenen Belangen so weit distanzieren können, dass es sie gegen die Bedürfnisse des Freundes unparteiisch abzuwägen vermag. Indem Aristoteles den Zusammenhang zwischen Wohlergehen und gelingenden, nicht nutzenorientierten Sozialbeziehungen aufweist, erreicht seine Ethik eine moralische Dimension. Ebenso steht nach stoischer Lehre die prudentielle Selbstliebe am Anfang jedes natürlichen Entwicklungsprozesses. Mit der Vernunft verfüge der Mensch jedoch über eine 23 spezifische Naturanlage, naturgemäßes Leben bedeute daher ein Leben gemäß der Vernunft. Ein zentraler stoischer Gedanke ist die Lehre von der Oikeíosis, der Aneignung und Perfektionierung der vornehmsten menschlichen Eigenschaften. Die lebenspraktischen Resultate dieser Haltung verdichten sich im Streben nach der berühmten stoischen Lebensruhe, der Ataraxia. Wichtiger sind jedoch die moralischen Konsequenzen der Oikeíosis-Lehre. Aus der Tatsache, dass das wahre menschliche Selbst an einer allgemeinen Weltvernunft partizipiert, folgt die innere Verbundenheit der Menschen untereinander. Im dem Stoizismus gewidmeten Buch III des „De finibus bonorum et malorum“ schreibt Cicero: „Daher rührt auch ein natürliches Gefühl der Zusammengehörigkeit, das die Menschen miteinander verbindet, so dass ein Mensch dem anderen schon deshalb, weil er ein Mensch ist, nicht fremd erscheinen darf“. Die Stoa lässt somit einen von basaler Selbstliebe ausgehenden Entwicklungsprozess erkennen, der schließlich zu einer Einstellung führt, die im starken Sinne moralisch genannt werden kann. Nach Hübenthal (2006) und Annas (1993) fordert der weite stoische Perfektionismus eine Lebensführung, welche die eigenen Interessen nicht anders bewertet, als die der anderen. Der moralische Adressatenkreis werde auf alle Menschen ausgeweitet. Seit der Neuzeit sind eudaimonistische Ethiken mit einer veränderten Situation konfrontiert, die vor allem durch eine sich immer stärker vollziehende Trennung von gutem Leben und Moral gekennzeichnet ist. Der unüberwindbare Pluralismus der Lebensentwürfe ließ keine gemeinsame Moral mehr zu. Moralische Begründungsversuche müssen daher nun strikte Unabhängigkeit von jeglicher partikularer Sicht zeitgenössische vom guten Leben eudaimonistische wahren. Entwürfe Im Folgenden vorgestellt sollen werden, die zwei im Zusammenhang mit der in dieser Arbeit diskutierten Frage hilfreich erscheinen. Ein bemerkenswerter Versuch der Neubestimmung des Verhältnisses zwischen gutem Leben und Moral aus eudaimonistischer Perspektive stammt von dem französischen Philosophen Paul Ricœur (1913-2005): „Das Selbst als ein Anderer“ (1996). Terminologisch verwendet Ricœur den Begriff der Ethik ausschließlich für das Streben nach einem erfüllten Leben, während die Moral dieses Streben normiert. Dabei kommt es Ricœur auf einen „Primat der Ethik gegenüber der Moral“ an, also darauf, „der moralischen Norm den richtigen Platz zuzuweisen, ohne ihr das letzte Wort zu lassen“. Bei Ricœur findet sich das Selbst in eine ursprüngliche Sozialstruktur eingebunden, die zunächst durch reziproke und symmetrische Verhältnisse gekennzeichnet ist. Sofern Praxiszusammenhänge jedoch weiter 24 reichen als die dyadischen Freundschaftsrelationen, sind auch asymmetrische Beziehungen in Betracht zu ziehen, in denen der Andere dem Selbst entweder als moralisch Fordernder überlegen oder ihm als Leidender unterlegen ist. In beiden Fällen muss es auf der personalen Ebene zwischen Selbst und Anderem zu einem fürsorgenden Austausch kommen, der das Ziel verfolgt, die ursprüngliche Symmetrie wieder herzustellen. Auf der Ebene von Institutionen findet die Fürsorge ihre Entsprechung in einer verteilenden Gerechtigkeit. Da menschliches Handeln immer auch der Gefahr eines „Hangs zum Bösen“ ausgesetzt ist, soziale Asymmetrien gar als Formen von Macht, Folter oder Tötung auftreten können, bedarf es einer universalistischen Moral, die auf der personalen Ebene der Fürsorge über die goldene Regel zur Personzweckformel des kategorischen Imperativs formalisiert sowie auf der Ebene der Institutionen in eine an Rawls angelehnte Gerechtigkeitstheorie übersetzt werden muss. Wenn bei Ricœur moralische Forderungen nur aus der Perspektive des guten Lebens verständlich werden, so bieten die Überlegungen Alan Gewirths (1912-2004) dazu eine Alternative, mit denen er noch einmal alle Dimensionen der eudaimonistischen Ausgangsfrage zur Sprache bringt und schließlich unter den oben genannten spätmodernen Bedingungen in einem einheitlichen Konzept zu vermitteln sucht. Als eudaimonistischen Leitbegriff verwendet Gewirth den der Selbsterfüllung. Deren Subjekt sei zum einen Träger von Wünschen und verfüge andererseits über eine Reihe realisierbarer Fähigkeiten. Selbsterfüllung sei nun ein verschränktes Ineinander von Wunscherfüllung (prudentielle Dimension) und Fähigkeitsverwirklichung (perfektionistische Dimension). Auch die Entwicklung moralischer Prinzipien wird von Gewirth als Folge des Strebens nach Fähigkeitsverwirklichung angesehen. Es sei dabei die den Menschen als Gattungswesen charakterisierende Vernunft, die jeder Mensch zu entfalten habe. Eine entscheidende Folge dieser Entfaltung sei die - über eine Sequenz dialektisch notwendiger Urteile zu erlangende - Einsicht in ein also rational begründetes Moralprinzip, das schließlich als limitierendes Kriterium sowohl für die Wunscherfüllung als auch für die Fähigkeitsverwirklichung wirksam werden müsse. Im Resultat der Perfektionierung des Vernunftvermögens steht bei Gewirth das vollumfängliche Recht eines jeden Menschen auf seine Handlungsfähigkeit und deren Voraussetzungen, entsprechende Rechtsverletzungen sind kategorisch verboten. Als Voraussetzungen der Handlungsfähigkeit betrachtet Gewirth sog. „notwendige Güter“, nämlich Freiheit und „Wohlergehen“. Bei den notwendigen 25 Gütern des „Wohlergehens“ unterscheidet Gewirth zum einen Elementargüter, wie etwa Leben, Nahrung oder Kleidung als Voraussetzung dafür, überhaupt handeln zu können, weiterhin Nichtverminderungsgüter, wie nicht bestohlen oder belogen zu werden, als Voraussetzung dafür, den Stand der eigenen Zielerreichung sichern zu können und schließlich Zuwachsgüter als notwendige Voraussetzung für eine Erweiterung des Stands der Zielerreichung, etwa durch Bildung. Weil die notwenigen Güter Freiheit und "Wohlergehen" für einen Handlungsfähigen kein sicherer Besitz, vielmehr von dem Verhalten der anderen Handlungsfähigen abhängig sind, sei der Handelnde logisch genötigt, gegenüber jedem anderen Handlungsfähigen einen normativen Anspruch auf diese notwendigen Güter zu erheben. Da er aber die konstitutiven Rechte für sich aus dem zureichenden Grund beansprucht, dass er ein Handelnder ist, der Ziele hat, ist er auch logisch genötigt anzuerkennen, dass jedem anderen Handlungsfähigen die konstitutiven Rechte in der gleichen Weise wie ihm selbst zukommen und dass er die aus diesen Rechten folgenden Verpflichtungen hat (Steigleder 1997). Für die Belange dieser Arbeit ist es entscheidend, darauf hinzuweisen, dass Gewirth (1978) betont: „[…] und alle Menschen sind aktuale, zukünftige oder potenzielle Handelnde“ (Bobbert 2002). Da die Moral bei Gewirth also nicht über das Streben nach Wunscherfüllung, sondern über die Perfektionierung der Vernunft ins Blickfeld tritt, sind die erlangten moralischen Forderungen in geltungslogischer Hinsicht völlig unabhängig von jeder Vorstellung vom guten Leben und können so von jedermann verstanden und eingesehen werden. 3.4. Verantwortungsethik Von Verantwortung war in den vorangegangenen Kapiteln bereits mehrfach die Rede: Sowohl die Care-Ethik als auch auf eine dialogische Anthropologie aufbauende Entwürfe betonten ihren moralischen Wert. Der Begriff einer „Verantwortungsethik“ geht auf den Sozialwissenschaftler Max Weber zurück, der ihn in seinem berühmt gewordenen, im Jahre 1919 in München gehaltenen Vortrag mit dem Titel „Politik und Beruf“ verwendete, und diente ursprünglich zur Charakterisierung der besonderen ethischen Herausforderungen des Politikers und der Abgrenzung gegen eine sich den Sachzwängen der Realität verweigernden 26 „Gesinnungsethik“. Wenige Jahre später rückte Albert Schweitzer (1875-1965) Verantwortung in den Mittelpunkt seiner Ethik. Es ging ihm um eine „Steigerung des Verantwortungsgefühls der Menschen“ in dem Sinne, dass er die Verantwortung eines jeden Einzelnen für seine persönliche Gesinnung, sein persönliches Verhalten und für die Kultivierung und Schärfung des eigenen Gewissens betonte (Kreß 2007). Schweitzer (1923) unterschied drei Ebenen der Ethik, welche Verantwortung aus Erfurcht vor dem eigenen Leben, dem Leben des Anderen und dem gesellschaftlichen Leben bedeuteten: „Zur Ethik gehört Ethik der leidenden Selbstvervollkommnung in dem innerlichen Freiwerden von der Welt […], Ethik der tätigen Selbstvervollkommnung in dem ethischen Verhalten von Mensch zu Mensch und Ethik der ethischen Gesellschaft“. Keller et al. (2009) weisen auf die Situation der modernen Medizin hin, die uns mit immer älter und immer kränker werdenden Menschen konfrontiert. Alter und Krankheit aber bedeuteten für die betroffenen Menschen nicht selten Einschränkung oder gar Verlust ihrer Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Der selbstbestimmte Patient sei vor diesem Hintergrund nicht selten eine von Juristen und Bioethikern unterstellte Fiktion. Doch selbst für einen kompetenten, gut informierten Patienten könne Selbstbestimmung Überforderung bedeuten, wenn ihr Kranksein zweifelnd, schwankend und unsicher werden lasse. Kann Verantwortungsethik in diesen Situationen Alternativen zum klassischen Paternalismus bieten? Die Autoren verweisen in diesem Zusammenhang auf die von Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) vertretene praktisch orientierte Verantwortungsethik des notwendigen Tuns. Dabei handele es sich um „ein Handeln in stellvertretender Verantwortung, in Liebe zum wirklichen Menschen“. Patient und Arzt seien im Sinne des Bonhoeffer’schen Gemeinsamen Dritten auf eine Stufe gestellt, weil der gemeinsame Grund für beide in der Christologie schon vorgegeben sei, aus welchem ein strikt christologisch gefasster Begriff der Verantwortung resultiere. Bonhoeffer begründe Ethik als Fürsorge für den Anderen theologisch mit der Gottesebenbildlichkeit des Menschen „Wer hinter dem Nächsten nicht den Fernsten weiß und diesen Fernsten zugleich als diesen Nächsten, der dient nicht dem Nächsten, sondern sich selbst, der flüchtet sich aus der freien Luft der Verantwortung in die Enge bequemer Pflichterfüllung“ - und zugleich christologisch, weil Christus im Nächsten präsent werde. Wenn es bei Bonhoeffer heiße: „Das ‚Für-andere-Dasein’ Jesu ist die Transzendenzerfahrung“ so bedeute dies: im Anderen Christus erkennen und – bei nichtreligiöser Interpretation dieser christologischen Begrifflichkeit als Diskursregel der Reziprozität – dem 27 Anderen ein Christus werden. Unter den gewandelten Bedingungen des Verhältnisses zwischen Arzt und Patient wird Verantwortung stets zweiseitig sein. Dem wird Bonhoeffer gerecht, wenn er verantwortliches Handeln so versteht, „dass es mit der Verantwortlichkeit der anderen ihm begegnenden Menschen rechnet. Eben darin unterscheidet sich Verantwortung von Vergewaltigung, dass sie im anderen Menschen Verantwortlichkeit erkennt, ja dass sie ihn seiner eigenen Verantwortlichkeit bewusst werden lässt“. Der handlungsbereite Arzt und der entscheidungsfähige Patient tragen die Verantwortung für das Patientenwohl gemeinsam. Zweiseitigkeit von Verantwortung aber begründet nach Keller et al. die Notwendigkeit des Diskurses, in dem Symmetrie ausgehandelt werden müsse. Dieser könne im Sinne einer relationalen Verantwortungsethik durchaus auch mit nonverbalen Mitteln geführt werden. Verantwortungsethische Positionen als Grundlage eines nonverbalen Diskurses seien in zahlreichen Grenzsituationen unerlässlich, so etwa am Lebensanfang und Lebensende, am Unfallort, auf der Intensivstation oder eben auch im Falle der Demenz. Verantwortung als medizinethisches Prinzip ist jedoch nicht ausschließlich im Kontext einer theologisch fundierten Ethik begründbar. So macht Homeyer (2008) in seiner Arbeit über die „Verantwortung für den kranken Menschen“ deutlich, dass eine freiheitliche, pluralistische Gesellschaft gehaltvolle moralische Kategorien benötige, die sowohl von religiösen als auch nicht-religiösen Menschen gleichermaßen anerkannt werden könnten und sieht als eine solche ethische Basiskategorie die Menschenwürde an, zumal sie nicht zufällig die Grundlage unserer Verfassungsordnung bilde. Das Prinzip der Menschenwürde, dem die Stoa und die Aufklärung zum Durchbruch verhalfen, hebe auf die Anfangsbedingungen des Menschseins ab, so dass es mit der Anerkennung eines gesellschaftlichen Wertepluralismus verträglich sei. Im Würdebegriff enthalten sei aber auch der Gedanke eines notwendigen Schutzes der Mindestvoraussetzungen menschlicher Handlungsfähigkeit, dieser wiederum sei offen für eine zur Bewältigung konkreter Konfliktsituationen im klinischen Alltag unverzichtbare differenzierte Güterlehre. Schwerdt (1998) schließlich untersucht die Prinzipien der „Philosophie des Lebens“ und der Verantwortungsethik des Philosophen Hans Jonas (1903-1993) auf ihre Verwertbarkeit in der professionellen Altenpflege, die nahe liege, zumal Jonas die Anwendbarkeit seines ethischen Prinzips auf asymmetrische Verhältnisse vertrete und Verantwortung als eine Grundverfassung des Menschen darstelle. Notwendige ethische Aufgabe der Gegenwart ist für Jonas die Einsicht in die Neuartigkeit und die 28 Dimension menschlicher Handlungsfolgen, eine Erziehung zur Selbstbescheidung des instrumentalen Weltbezugs zugunsten des Eigenwerts von Leben. Sein „neuer Imperativ“ geht von einem dezidiert physiozentrischen Standpunkt aus, eine Sonderstellung kommt dem Menschen nur als Verursacher zu, von dessen Handlungsfolgen die gesamte Natur betroffen ist. Das „Prinzip Verantwortung“ entwickelte Jonas im Wesentlichen als ökologische Ethik, in der Systematisierung seiner Verantwortungsethik beschränkte er sich jedoch nicht auf die Folgen des technischen Machtzuwachses des Menschen. Der erste Schritt auf dem Ausweg aus der Krise muss nach Jonas im Bewusstmachen ihrer Beschaffenheit und Größe bestehen. Sein Plädoyer für eine „Heuristik der Furcht“ soll jedoch nicht in Resignation münden, vielmehr resultiert aus der Offenheit des Ausgangs Solidarität und Sorge statt Gleichgültigkeit und Trägheit. Furcht soll zum Handeln auffordern, zumal ihr Gegenstand die Erhaltung dessen, um das gefürchtet werde, sei. So fordert Jonas (1984), die Furcht solle angeeignet und in die „Pflicht des Handelns“ transformiert werden. Über das Gefühl müsse das Objekt der Verantwortung dem sittlichen Interesse vermittelt werden: Sie soll über eine „Vorstellung des Übels“ das „davor zu rettende Gute“ erkennen lassen, durch das „Zurückschaudern“ vor dem Bild dessen, was der Mensch „werden könnte“, das sichtbar machen, was als „Heiliges“ unbedingt zu schützen sei. Der „eigentliche Zweck – das Gedeihen des Menschen in unverkümmerter Menschlichkeit“ – sei dann in „Ehrfurcht“ und „Demut“ erkennbar. Jonas sieht emotionale und rationale Elemente der Ethik als komplementär an. Der ethische Appell erfolgt durch die Einsicht des möglichen „An-sich-Guten“, welches objektiv die Gültigkeit der Pflicht begründet, das Gefühl vermittelt diese rationale Einsicht dem sittlichen Willen. Affizierbarkeit sei daher notwendige Bedingung zur Motivation. Erst wenn die Bereitschaft allgemein vorhanden sei, sich vom „Heil und Unheil“ anderer „affizieren zu lassen“ könne das Prinzip Verantwortung universale Anerkennung finden. Verantwortung im Sinne Jonas’ richtet sich dabei auf Lebewesen, die eine „Andersheit“ aufweisen, welche nicht durch Aufhebung oder Aneignung ihrer Andersheit überbrückbar ist. Allein ihr Sein „in der erkannten selbsteigenen Güte“, unabhängig von einem Interesse an ihm, nehme mich in die Verantwortung. Die Achtung vor dem Sein jedoch reiche allein nicht aus, um sich für es zu engagieren. Erst „das hinzutretende Gefühl der Verantwortung“ motiviere zu tätiger Moralität: „Tritt Liebe hinzu, so wird die Verantwortung beflügelt von der Hingebung der Person, die um das Los des Seinswürdigen und Geliebten zu zittern beginnt.“ Schwerdt sieht vor diesem 29 Hintergrund in Jonas’ Prinzip Verantwortung ein vervollständigtes Zusammenspiel von Gefühlen wie Furcht, Schaudern, Erschrecken, antizipierendem Mitleid, Schuld, vorauseilender Reue, Scham, Verantwortungsgefühl mit der von Schweitzer geforderten Ehrfurcht und den von Kant genannten Pflichten der Liebe und Achtung. Auch Jonas stellt seine Ethik als Pflichtethik vor. Die Pflicht resultiere aus dem Machtverhältnis, das seine Moralität als Verantwortungsverhältnis zu erweisen habe. Machtverhältnisse als übernommene Verantwortungsverhältnisse verantworten die Freiheit derer, die jeweils unter meiner Macht stehen. So verstandene Machtausübung zum Guten ist für Jonas insofern nicht einengend, sondern befreiend und kompetenzstärkend. Die Fähigkeit, Verantwortung zu tragen, ist nach Jonas wie die Sprachfähigkeit ein anthropologisches Konstituens. Aus dem Können aber folge das Müssen. Durch seine „Freiheit, sich Zwecke zu setzen, und die Macht, sie auszuführen“ qualifiziere sich der Mensch als Verantwortlicher für sein eigenes Sein und Wohlergehen und als „Treuhänder aller anderen Selbstzwecke, die irgend unter das Gesetz seiner Macht kommen“. Die menschliche Freiheit als Subjektivität, welche Welt und sich selbst objektivieren kann, sei nur das Ende eines Entwicklungskontinuums, dem es nach wie vor untrennbar angehöre. Daher sei dem Menschen Verpflichtung für die ihm „ausgelieferte Lebensfülle der Erde um ihrer selbst willen“ auferlegt. Jonas geht von der Selbstzweckhaftigkeit allen Lebens und der Würde alles Lebendigen aus. „Zum Grundwert aller Werte“, „zum ersten Ja“ mache das Sein „seine Differenz vom Nichtsein“ und Sein sei „nicht indifferent gegen sich selbst“. 4. Ethik der Demenz Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten einige ethische Entwürfe skizziert wurden, die im Hinblick auf die eingangs formulierte Fragestellung hilfreich erschienen, sollen diese nun auf ihre konkrete Anwendbarkeit auf klinische Zusammenhänge Verständnisses hin vom befragt werden. Die Arzt-Patient-Verhältnis, Tatsache für eines welches gewandelten heute der Autonomiegedanke prägend geworden ist, ließ die Frage aufkommen, welche Konsequenzen der Leitbildcharakter von Autonomie für diejenigen Situationen besitzt, in denen es gerade die Kompetenz zur Selbstbestimmung ist, die von der Krankheit mehr und mehr in Frage gestellt und schließlich zerstört wird. Die 30 Diskussion soll sich dabei zwei Schwerpunkten widmen. Zum einen: Wie wird man dem hohen Stellenwert der Autonomie im Falle einer Demenz am ehesten gerecht? Und weiter: Gibt es andere moralische Prinzipien, die in dem Maße, wie die Selbstbestimmungsfähigkeit krankheitsbedingte Einschränkungen erfährt, an Bedeutung gewinnen? Zusammengefasst: Wie kann ein würdiger Umgang mit Menschen aussehen, die von ihrer Krankheit spezifisch menschlicher Konstituenzien, wie Vernunft und Sprache, beraubt werden? In der modernen medizinethischen Debatte ist es weitestgehender Konsens, dass die Bestimmung des Wohls eines Patienten von ärztlicher Seite ausschließlich durch Einbeziehung der Erwartungen, Befürchtungen und Wünsche des Patienten selbst bestimmt werden kann. Übereinstimmung kann darüber hinaus in der Frage festgestellt werden, dass dieses Recht seine Wirksamkeit mit der Diagnose einer demenziellen Erkrankung keineswegs verliert. Eine in der klinischen Praxis äußerst relevante Frage, die dagegen immer wieder auch Anlass für Unsicherheiten und Kontroversen gibt, ist die nach der Nachwirkung eines zu einem früheren Zeitpunkt geäußerten Willens für eine spätere Situation bei vorangeschrittener Demenz. Dabrock (2007) stellt unter Bezug auf Quante (2002) zwei die Diskussion bestimmende Grundtypen philosophischer Argumentationsmuster vor: Die These einer verlängerten Autonomie geht von einer Differenzierung menschlicher Eigenschaften aus, welche diese jeweils höheren und niederen Sphären zuordnet. Als Eigenschaften höherer Dignität werden Selbstbewusstsein, Persönlichkeit oder critical interests genannt, wohingegen nicht-selbstbewusstes Streben, menschliche Persistenz oder experiental interests Begriffe zur Beschreibung der anthropologischen Elementarebene darstellten. In der Sicht dieser Position genießen Eigenschaften der ersten Gruppe einen anthropologischen und damit auch normativen Vorrang vor denen der zweiten. Frühere Willensäußerungen wären danach moralisch und juristisch höher zu bewerten als aktuelle Ausdrucksäußerungen. Die Position einer dagegen nicht verlängerbaren Autonomie geht davon aus, dass ein Mensch zu keinem definierten Zeitpunkt abschätzen kann, wie er sich zu einem späteren Zeitpunkt fühlen wird. Es gebe keine personale Identität, weshalb auch Patientenverfügungen keine Gültigkeit besitzen könnten. Wenn auch die Debatte allein innerhalb der deutschen Medizinethik zu diesem Thema bislang nicht abgeschlossen zu sein scheint, wie etwa die Beiträge von Dabrock (2007), Wunder (2008) oder Bauer (2009) zeigen, so ist jedenfalls nach der seit September 2009 geltenden Rechtslage (§ 1901a BGB) eine Patientenverfügung 31 „unabhängig von Art und Stadium der Erkrankung“ gültig. Wenn auch Dabrock bereits 2007 für eine Argumentation gemäß der These einer verlängerten Autonomie votierte, so wies er jedoch zugleich auf den hohen moralischen Preis der nunmehr tatsächlich erreichten Vorausverfügungen in Rechtssicherheit die aktuelle hin: Situation Um hinein die Autonomie verlängern und der über Ausdrucksäußerungen der aktuellen dementen Person stellen zu können, müssten aktuelle Äußerungen aufgrund ihrer geringeren kognitiven Komplexität moralisch und rechtlich geringer bewertet werden als Vorausverfügungen, weil diese von selbstreflexiven Individuen verfasst, komplexerer Art und biographisch anspruchsvoller seien und längere Zeitdimensionen im Blick hätten. Dabrock bezweifelt aber, dass der kognitive Gehalt einer Äußerung das alleinige und alles entscheidende Kriterium sein dürfe, das es erlaube, aktuelle Äußerungen eines Menschen mit geringerer kognitiver Kompetenz aufzuheben, erst recht, wenn es dabei um Entscheidungen über Leben und Tod gehe. Auch Wunder (2008) vertritt vor dem Hintergrund psychotherapeutischer Erfahrungen die Ansicht, dass noch in jedem Stadium einer demenziellen Entwicklung Kompetenzen des Verstehens, Bewertens und Selbstäußerns vorhanden seien, die von den Helfern sensibel wahrgenommen werden müssten. Es handele sich um Äußerungen in Gestalt von Mimik, Gestik, Ganzkörpersprache, Ritualen und Verhaltensweisen, welche Wünsche, Interessen, Präferenzen und Bedürfnisse repräsentierten, die in der pflegerischen und ärztlichen Tätigkeit Beachtung zu finden hätten. Der Verfasser dieser Arbeit schließt sich diesen Einschätzungen unter dem Eindruck jahrelanger Erfahrungen in der klinischen Neurologie ausdrücklich an. Diese Erfahrungen zeigen, dass eine demenzielle Erkrankung das Erleben von Lebensfreude und Glück keineswegs unmöglich macht und werden darin durch empirische Befunde anderer Autoren gestützt. Hilfreich haben sich in diesem Zusammenhang Instrumente erwiesen, welche die Lebensqualität Demenzkranker zu erfassen versuchen. Das von Kruse (2005) verwendete Heidelberger Instrument zur Erfassung der Lebensqualität Demenzkranker (HILDE) baut auf der von Lawton (1999) entwickelten Definition der Lebensqualität bei Demenz auf. Kruse nutzt für seine Erhebungen sowohl das Interview mit dem Betroffenen als auch mit dessen Bezugspersonen, vor allem jedoch – zumal es sich bei den vom ihm untersuchten Menschen um solche handelte, die nur noch eingeschränkt oder gar nicht zu sprachlicher Kommunikation in der Lage waren – die Beobachtung des Demenzkranken mit Hilfe einer methodisch anspruchsvollen mimischen Ausdrucksanalyse. Kruse konnte zeigen, 32 dass emotional bedeutsame Situationen bei demenzkranken Heimbewohnern nicht seltener von positivem (Wohlbefinden, Freude) als von negativem Befinden (Ärger, Traurigkeit) gekennzeichnet waren. Sie unterscheiden sich darin nicht grundsätzlich vom emotionalen Erleben Gesunder. Die von Wunder (2008) vorgenommene Klassifikation der Willensbildungsformen in Abhängigkeit vom Demenzstadium erlangt vor diesem Hintergrund einen weiteren Bedeutungszuwachs. Wenn die emotionale Welt Dementer nicht anders als die Gesunder Lust- und Unlustgefühle enthält, zu deren Erfassung und Differenzierung Ärzte und Pflegende in der Lage sind und wir zugleich davon ausgehen, dass selbst noch Kranke in der Phase einer schweren Demenz ihren Willen in Form affektgeleiteter Ja-Nein-Entscheidungen zum Ausdruck bringen können, so ist hiermit ein starkes Argument dafür gegeben, dass aktuelle Willensbekundungen – wie in allen anderen Fällen medizinischer Maßnahmen auch – Vorausverfügungen aufheben, sofern sie von ihnen abweichen. Zeigt also ein schwer demenzkranker Mensch erheblichen Lebenswillen, so ist sein Recht auf Selbstbestimmung nur zu wahren, indem diese Willensäußerung in der aktuell gegebenen Möglichkeit ihrer Bekundung formell respektiert und inhaltlich als Widerruf der Patientenverfügung im Sinne von § 1901a BGB Absatz 1 Satz 3 verstanden wird. Im Zweifelsfalle, wenn also die Interpretation mimischen oder gestischen Ausdrucks uneindeutig ausfällt, muss ein Grundsatz der Vorsichtsethik „in dubio pro vita“ zur Anwendung kommen. Dies darf selbstverständlich nicht von vorn herein im Sinne einer paternalistischen Aushebelung eines jeglichen Patientenwillens geschehen, aber auch nicht zu spät, „weil dann das Leben als konditionales Gut jeden Selbstbestimmungsaktes beendet“ wäre (Dabrock 2007). Wie bereits oben gezeigt, umfasst ein weiteres Verständnis des medizinethischen Autonomiebegriffs mehr als ein Abwehrrecht gegen Bevormundung und Fremdbestimmung. Das Recht auf Achtung der Autonomie des Patienten kann in diesem Sinne auch Ansprüche des Betroffenen begründen. Graumann (2007) begründet die Ableitung von Anspruchsrechten aus einer so verstandenen Autonomie mit der Unverletzlichkeit der Autonomie als moralisches Recht, die sich darin von einer begrifflich und inhaltlich abzugrenzenden situationsbezogenen Handlungsautonomie unterscheide. Umgebungsbedingungen Während eingeschränkt sein letztere durch Krankheit und könne, gehe Autonomie als moralisches Recht niemals verloren. Vielmehr leite sich aus ihr ein Recht auf Bewahrung, Förderung und Wiederherstellung auch der situationsbezogenen 33 Handlungsautonomie ab. Autonomie als unverletzliches moralisches Recht habe insofern als orientierender Maßstab ärztlichen und pflegerischen Handelns zu dienen. Der Verzicht auf eine verkürzende Auffassung von Autonomie als negatives Abwehrrecht könne den Antagonismus von Autonomie und paternalistischer Fremdbestimmung auflösen. Ein emanzipatorisches Verständnis von Autonomie werde Sorge für den besonders verletzlichen Menschen nicht als seine Rechte beschneidende Bevormundung begreifen, sondern mit ihr vielmehr die größtmögliche Förderung, Wiederherstellung oder Erhaltung ihrer Selbstbestimmungskompetenz anstreben. Erschöpft sich Ethik nun aber in der normativen Vorgabe, ärztliches und pflegerisches Tun müsse am unantastbaren moralischen Autonomierecht ausgerichtet werden? Hält Ethik auch konkrete Hilfen für Behandelnde und Pflegende bereit? Geht sie über die Vorgabe des Ziels hinaus, kann sie auch die Suche nach Wegen eines achtungsvollen Umgangs mit Demenzkranken unterstützen? Der folgende Abschnitt soll diese Fragen anhand der oben dargestellten ethischen Entwürfe zu beantworten versuchen. Beim Versuch, durch eine Zusammenschau der vorgestellten Konzepte moralische Prinzipien ausfindig zu machen, welche als gemeinsame Quintessenz und alle Theorien untereinander verknüpfende Merkmale gelten könnten, wird man auf die Begriffe der Verantwortung und der Fürsorge stoßen. Im Lichte eines emanzipatorischen Autonomiebegriffs werden diese Prinzipien nicht als Ausdruck einer paternalistischen Heteronomie sondern als die Handlungsautonomie soweit und solange irgend möglich stützend, darüber hinaus und später als Antwort der Behandler und Pflegenden auf den aus dem Leiden des Kranken ergehenden Hilferufs verstanden werden können. Schematisch ließen sich die situationsbezogene Handlungsautonomie sowie Verantwortung und Fürsorge als jeweils komplementäre Faktoren auf den Ordinaten entlang einer Zeitachse als Abszisse darstellen. Die im Verlaufe einer Erkrankung zunehmenden Einschränkungen der Handlungsautonomie lassen Verantwortung und Fürsorge eine graduell immer stärkere Bedeutung zukommen. Eine Umkehrung dieser Beziehung stößt freilich an Grenzen, so dass die Diagonale die Ordinaten etwas ober- und unterhalb der Ecken dieses Schemas schneidet. Kein Arzt-PatientVerhältnis, und habe es der Arzt auch mit einem hinsichtlich seiner Handlungsautonomie nicht im Mindesten eingeschränkten Patienten zu tun, kann ihn gänzlich aus jeglicher Verantwortungs- und Fürsorgepflicht, etwa im Sinne einer 34 adäquaten Aufklärung, entlassen. Am anderen Ende der Zeitachse dagegen wird man im Falle eines Demenzkranken in der Regel eine der Fürsorge Grenzen setzende situationsbezogene Selbstbestimmung des Patienten in Form von Willensäußerungen, und seien sie nur mehr nonverbal und affektgeleitet, anzuerkennen haben. Zu jedem Zeitpunkt aber könnte durch ein der vorgefundenen Handlungsautonomie angemessenes Maß an Fürsorge und Verantwortungsübernahme das moralische Recht auf Autonomie, das in diesem Schema den Rahmen bildete, „vollumfänglich“ gewahrt sein. Autonomie als moralisches Recht Situationsbezogene Handlungsautonomie Situationsbezogene Handlungsautonomie Verantwortung, Fürsorge Wie aber lässt sich der Stellenwert der aufgezeigten Prinzipien in einer „Ethik der Demenz“ im Einzelnen aus den verschiedenen Theorien ableiten? Welche weiteren Konsequenzen ergeben sich ggf. aus ihnen? Die Ontologie Bubers beschreibt den Menschen konsequent als im Dialog Stehenden. Die Maxime des „Hörens und Antwortens“ (Schwerdt 1998) gewährleistet größtmögliche Subjekthaftigkeit des Anderen als Anderen. Tätige Ver-Antwortung ergibt sich im dialogischen Lebensvollzug als unmittelbarer Ausfluss des Dialogs als „Antwort auf das Du“, als „Antwort auf den Anruf der gelebten Konkretheit“. Verantwortung ist nach Buber nicht im Rückgriff aus Vorschriften und Prinzipien zu gewinnen, die dem Ich-Es-Bereich zuzuordnen sind, die ethische Haltung und moralische Entscheidung zur Verantwortung ergibt sich nur aus dem Ich-DuVerhältnis, in der der einzelne Mensch persönlich angefragt ist. Auch wenn Buber seine Philosophie nicht explizit für Menschen in Grenzsituationen ausgearbeitet hat, 35 so hat er doch im Hinblick auf das pädagogische und psychotherapeutische Verhältnis formal asymmetrische Beziehungen thematisiert. Der Anwendungsbereich ärztlicher Dialogik, wie er in der Folge von zahlreichen Autoren, wie etwa von Weizsäcker, Kampits, Spitzy, Petersen u. a. dargestellt wurde, geht dabei freilich weit über die Behandlung Demenzkranker hinaus. Dennoch legt dialogisches Denken immer wieder schwerpunktmäßig Augenmerk auf Themen, die im Umgang mit dementen Menschen von besonderer Bedeutung sind. Der Verweis auf die Einheit von Leib, Geist und Seele und die Betonung der zwischenmenschlichen Begegnung als Grundlage des dialogisch-relationalen Personbegriffs vermögen dazu beizutragen, den Blick des Arztes verstärkt auf den Kranken und sein Kranksein (illness) zu richten, anstatt dessen Krankheit in den Mittelpunkt seines Interesses zu stellen. Im gegenwärtigen medizinischen Alltag dominieren stattdessen ein klinischobjektivierender Krankheitsbegriff (disease), Bürokratisierungen, Rationierungen sowie Zeitknappheit auf Seiten der Ärzte und Pflegenden (Kreß 2009). Die Dimension einer Person- oder Patientenzentrierung der Medizin ist stark zurück getreten. Geisler (1997) erklärt seinen Befund einer „sprachlosen Medizin“ nicht zuletzt mit dem „Verschwinden des Dialogischen“ und erinnert an die Verstärkung der „Ich-Einsamkeit des Subjekts“ durch die Isolation, die beinahe jede Krankheit mit sich bringe. Wie viel stärker mag diese Isolation aber dort ausfallen, wo die Ursachen der Sprachlosigkeit nicht nur auf der Seite der Ärzte und Pflegenden liegen, sondern die Krankheit selbst Voraussetzungen der den Menschen Kommunikation seiner kognitiven beraubt. Eine und sprachlichen Überwindung der Sprachlosigkeit gelinge nach Geisler nur durch Sprache, wobei Sprache bei ihm für jede Form der zwischenmenschlichen Kommunikation steht, auch für eine solche, die ein der Sprache nicht mehr mächtiger dementer Mensch verstehen kann. Bubers Dialogbegriff umfasst alle Sphären der Beziehung, der Mensch wird als leibseelischer und kontextueller verstanden (biologisch, soziokulturell, spirituell). Da, wo Interessen nicht mehr gleichberechtigt vertreten werden können, weil eingebüßte Fähigkeiten zu reflexiver Überlegung und sprachlicher Kommunikation den Diskurs erschweren und andererseits für die Behandler und Pflegenden Bedürfnisse und Wünsche auf diesem Wege von außen nicht mehr erfassbar sind, beweist die Unmittelbarkeit des dialogischen Zugangs zum Du ihre Stärken. Die dialogische Hinwendung zum Anderen lässt fremde Hilfsbedürftigkeit erkennen (und eigene zulassen) sowie die „Irrtümlichkeit eines bloß negativen Begriffs von Freiheit“ (Schwerdt 1998) und Autonomie erkennen. Bubers Freiheitsverständnis ist ein 36 entschieden positives im Sinne von Wohlwollen, Sorge und Verantwortung. Es geht von einer Haltung aus, welche, die Befindlichkeit des Anderen ertastend, wohlmeinend die Beziehung mit ihm sucht, in dem sie ihr Wesen anrühren will. Sein Verantwortungsbegriff ist kein aktivistischer, sondern ein zulassender, nach dem Motto: „Diktieren […] nicht, aber antworten“ (Buber 1947). Dialogisches Denken findet seine treffendste Abbildung im deliberativen Modell einer Arzt-PatientBeziehung. Die für dieses charakteristischen Konzepte der relationalen und optionalen Autonomie sind offen für Verantwortungsübernahme und Fürsorge jenseits einer antagonistischen Gegenüberstellung. Die Nähe des Menschenbildes der Care-Ethik zur dialogischen Ontologie Bubers ist unübersehbar. Relationalität und Leiblichkeit des Menschen sowie die Asymmetrie konkreter Beziehungen stellen für beide Konzepte konstituierende Momente dar. Während dialogische Verantwortung jedoch als Tugend verstanden werden möchte, öffnet sich die Fürsorgeperspektive der Care-Ethik der Möglichkeit einer Integration in eine deontologische Moraltheorie. Fürsorge, Verantwortung und Achtsamkeit erfahren ihre Grundlegung in der grundsätzlichen Angewiesenheit des Menschen – die in der Situation einer demenziellen Erkrankung eine geradezu extreme Zuspitzung erfährt. Wenn Care-Ethik bei der Beschreibung des praktischen Vollzugs der geforderten Achtsamkeit den Wert nonverbaler Care-Interaktionen herausstellt, so betont sie hiermit einen Aspekt, der gerade für die Betreuung Dementer von herausragender Bedeutung ist. Care bedeute sowohl „face-to-face interaction“ als auch „body-to-body interaction“. Wenn Care-Interaktionen als solche beschrieben werden, in denen Denken, Fühlen und Handeln miteinander verwoben sind, so wird damit die Situation der Betreuung eines Dementen, in der die Kommunikation immer mehr nach Kompensationsmöglichkeiten für immer gravierender werdende kognitive Defizite suchen muss, zutreffend abgebildet. Vor diesem Hintergrund wird die pflegerische Methode der Basalen Stimulation als körperorientierte Intervention (body-to-body interaction) mit „Türöffner-Funktion“ für Sinneswahrnehmungen auch bei Demenzkranken, vor allem im fortgeschrittenen Stadium, eingesetzt. Eine hohe Bedeutung kommt der Care-Perspektive im medizinethischen Kontext aber auch deshalb zu, weil sie dem hier typischerweise anzutreffenden vielschichtigen relationalen und situativen Kontext des einzelnen Kranken durch ihren empathischen Nachvollzug der konkreten Situation, ihrer Beachtung von Sinnlichkeit, Neigungen und Gefühlen sowie von symmetrischen und 37 asymmetrischen Beziehungen Beachtung schenkt und die Betrachtung der Autonomie um einen wesentlichen Gesichtspunkt, nämlich den der verschiedenen Autonomien aller Beteiligten, erweitert. Biller-Andorno (2001) illustriert diesen Aspekt am Beispiel eines Demenzkranken, dessen Familie vor der Aufgabe steht, seine Pflege und Betreuung zu organisieren. Soll der Kranke in einem Heim untergebracht oder zu Hause gepflegt werden? Unter deontologischem Aspekt sei hier sowohl nach den Optionen bestmöglichen Respekts vor der Autonomie des Betroffenen als auch nach den Pflichten des gesunden Angehörigen zu fragen, die sich aus dessen eigenem Beziehungsgeflecht ergeben. Wem gegenüber ist er sonst noch verpflichtet (Kinder, andere Angehörige)? Die Fürsorgeperspektive kann nur klären helfen, was Autonomie des Kranken und sonstige Pflichten konkret bedeuten. Ein integrativer Zugang führe dabei nicht zu einem Anspruch maximaler Fürsorge als Reaktion auf wahrgenommene Bedürftigkeit, vielmehr solle nach einer Balance zwischen eigenen Interessen und denen anderer gesucht werden. Dabei stellten sich etwa Fragen wie: In welchem Maße bedarf der Kranke gerade meiner Hilfe? Wie verhält sich dies zu meinen eigenen Bedürfnissen und den Pflichten, die ich aus anderen Beziehungen heraus habe? Eine Bestimmung der Pflichten, die für den moralischen Akteur aus einer konkreten Konfliktsituation resultieren, wird also von zahlreichen situativen und relationalen Details bestimmt, für deren Beurteilung sowohl Fürsorge-, als auch Gerechtigkeitsaspekte bedeutsam sind. Wenn dialogische Verantwortung, besonders deutlich im Konzept Lévinas’, in der Begegnung zwischen Ich und Du dezidiert die Vorrangigkeit des Du betont, so bemüht sich eine Care-Ethik, zumal in der Ausformung Biller-Andornos, in ihrem Bestreben nach „empathischer Rekonstruktion der Situation“ immer auch um den schonenden Ausgleich zwischen den Bedürfnissen aller an der Beziehung Beteiligten. Wenn Keller et al. (2009) zugespitzt formulieren: „Der Ethik des Du bei Lévinas fehlen das Ich und das Wir“ und die daraus resultierende Gefahr erkennen: „Das gesellschaftliche Wir gerät an den Rand des Handlungshorizonts, und das Ich verfällt dem Burn-out“, dann thematisieren sie damit einen für die Pflege von Dementen erhebliche Tragweite besitzenden Problemkreis, wie Angaben aus der Leitlinie „Pflegende Angehörige“ der deutschen Gesellschaft und Familienmedizin erkennen lassen: „Pflegende Angehörige, besonders von Dementen, zeigen in hohem Maß Depressionen mit Traurigkeit, Pessimismus, Reizbarkeit und Entschlussunfähigkeit. Spannungen in der Pflege verlaufen unterschwellig, entladen sich in unkontrollierbaren Wutausbrüchen mit anschließenden Schuldgefühlen. Gegenseitige Gewaltanwendungen von 38 Pflegebedürftigen und Pflegenden werden zunehmend beobachtet und sind Ausdruck großer psychischer Erschöpfung und Verzweiflung. Eine emotionale Belastung durch die Pflege geben bis zu 37% an. Mit steigender Pflegedauer nimmt die emotionale Erschöpfung zu, ebenso die Ohnmacht, nicht mehr helfen zu können, Schuld und Versagensgefühle sowie Enttäuschung über eigene Grenzen und Undankbarkeit des Kranken.“ Die care-ethische Perspektive strebt eine Harmonisierung zwischen Ich, Du und Wir an und stimmt darin mit dem Leitsatz der zitierten Leitlinie überein: „Pflege kann nur gut gehen, wenn es den Angehörigen gut geht.“ Auch die tugendethischen Ansätze eudaimonistischer Entwürfe lassen Schnittmengen mit dialogischen und care-ethischen Konzepten erkennen. Wenn etwa der Stoizismus aus seiner Oikeíosis-Lehre die moralische Konsequenz der inneren Verbundenheit aller Menschen zieht, so dass nach Cicero „ein Mensch dem anderen schon deshalb, weil er ein Mensch ist, nicht fremd erscheinen darf“, so scheint hier die Idee der aus der Begegnung mit dem Anderen erwachsenden dialogischen Verantwortung ebenso auf, wie die mit Bezogenheit und Angewiesenheit begründete Achtsamkeit der Care-Ethik. Ricœurs Bezug auf asymmetrische Verhältnisse, die den Anderen als Leidenden erkennen und dem Subjekt die Notwendigkeit des fürsorgenden Ausgleichs deutlich werden lassen, erinnert gleichermaßen an die Berücksichtigung nichtreziproker Beziehungen durch Dialogik und Care-Ethik. Der moralische Wert von Verantwortung und Fürsorge lässt sich folglich mit eudaimonistischer Argumentation ein weiteres Mal belegen. Auch eudaimonistische Ethik kann dem nach Orientierung suchenden Helfer des Demenzkranken ein Angebot unterbreiten. Eudaimonistische Ethik aber kann mit ihrer Frage nach dem „guten Leben“ auf der Suche nach Prinzipien einer „Ethik der Demenz“ einen ausgesprochen wertvollen, ganz eigenen Beitrag leisten. Sie ermuntert die Helfer zu Perspektivwechsel und Empathie. Nach Brandenburg (2009) besitzt die Grundfrage des engen eudaimonistischen Perfektionismus in der Betreuungssituation eines Demenzkranken eine herausgehobene Bedeutung: Was bedeutet für diesen Kranken ein gutes Leben? Wie oben gezeigt, wissen wir heute, dass auch schwer und dauerhaft Kranke in der Lage sind, sich wohl zu fühlen und Glück zu empfinden. Kruse (2005) konnte mittels mimischer Ausdrucksanalyse Situationen identifizieren, in denen Demente Freude und Wohlbefinden signalisierten. Dabei waren zwei Befunde von besonderer 39 Bedeutung: Zum einen zeigte sich, dass Freude vor allem durch Zuwendung und persönliche Ansprache hervorgerufen wurde – ein Befund, der erneut den besonderen Wert der Aufrechterhaltung von Kommunikation für die Lebensqualität des Demenzkranken hervorhebt. Zum anderen wurde deutlich, dass das Wohlbefinden dementer Menschen erhöht werden kann, wenn ihnen die Möglichkeit gegeben wird, den von ihnen gewünschten oder bevorzugten Tätigkeiten nachzugehen. Der Wert einer Patientenzentrierung ärztlichen und pflegerischen Handelns wird hier ein weiteres Mal unterstrichen. Brandenburg leitet aus eudaimonistischen Konzepten darüber hinaus unabhängig von diagnosespezifischen Behandlungs- und Betreuungssituationen die sittliche Verpflichtung der in der Heilkunde Tätigen ab, nicht nur für Heilung von Krankheiten und Linderung von Beschwerden zu sorgen, sondern das „gute Leben“ der ihnen Anvertrauten in umfassenderer Weise zu fördern, etwa indem sie diese auch bei der Bewältigung von Kranksein, Behinderung und Gebrechlichkeit unterstützen. Der Beitrag der Ethik Alan Gewirths – dessen eudaimonistische Theorie der Begründung von Freiheit und Wohlergehen als Menschenrechte und Voraussetzungen der Handlungsfähigkeit des Menschen, Grundlage für die von Bobbert (2002) vorgenommene (und im einleitenden Autonomie-Kapitel vorgestellte) Entfaltung des Begriffs der Autonomie im Kontext von Medizin und Pflege war – ist bereits dargestellt worden. Die besondere Situation von Menschen, die ihre Rechte nicht aktiv einklagen können, sondern schon in ihrem Ausdruck auf aktive Unterstützung angewiesen sind, erfordert jedoch Prinzipien, wie etwa das der Sorge, die aus seinem Entwurf nicht ohne Weiteres abgeleitet werden können (Schwerdt 2004). Während die Grundlegung mitmenschlicher Fürsorge und Verantwortung bei Dietrich Bonhoeffer eine offensichtlich theologische und christologische ist, stellt Hans Jonas Verantwortung als Pflicht dar, welche sich aus der Asymmetrie der Macht ergebe: Das mit spezifisch menschlichen Fähigkeiten ausgestattete Subjekt habe sich als Treuhänder aller anderen Selbstzwecke seiner Einflusssphäre zu erweisen. Was bedeutet Jonas’ Konzeption für eine „Ethik der Demenz“? Aus der bereits angesprochenen Selbstbejahung jeglichen Seins bei Jonas leitet er eine für eine „Ethik der Demenz“ nicht zu überschätzende Konsequenz ab: Leben wird bei ihm als Dynamik von Freiheit und Notwendigkeit, Glück und Leiden verstanden. Die darin zum Ausdruck kommende „Ja-Nein-Polarität alles Lebendigen“ (Jonas 1994) ist nicht überwindbar, die Veräußerung eines der Pole unmöglich. 40 Damit sind wir als Einzelner und als Gesellschaft vor die Aufgabe der Auseinandersetzung mit Lebensgrenzen und –bedingungen gestellt. Menschen müssen ihre Geschichte unter Maßgabe dieser conditio humana zu Ende bringen können, ohne dass daran weitere Bedingungen geknüpft werden dürften. Leben erschöpft sich nicht im autonomen, sondern ebenso im passiven und sozialen Vollzug. Die ethischen Konsequenzen der anthropologischen Vollständigkeit Jonas’ resultieren aus den Unterschieden im Freiheitsgrad. Verantwortung als „Korrelat der Macht“ obliegt moralisch freien Menschen gegenüber Menschen, deren Handeln weniger frei ist. Die Intuition zum Schutz von Schwachen und zur Sorge für sie wird untermauert dadurch das Wissen um die Macht und das Gefühl der Macht. Die Gestaltung einer solchen verantwortlichen Macht erfolge nach Jonas in einem „Treueverhältnis“ zum Schwachen. Verantwortung als richtiger Machtgebrauch obliegt Personen kraft ihrer Moralität, die sie gerade in nichtreziproken Beziehungen tätig bezeugen. „Verantwortung ist die als Pflicht anerkannte Sorge um ein anderes Sein, die bei Bedrohung seiner Verletzlichkeit zur Besorgnis wird“ (Jonas 1984). Das „Prinzip Verantwortung“ wird der Tatsache gerecht, dass die Mehrzahl aller Verhältnisse des Menschen nichtreziprok sind und leitet die Freiheit des Handelns als Pflichtausübung zur Wahrung der Würde. Aus Handlungsfreiheit aber ergibt sich für Jonas die Unausweichlichkeit und Nichtdelegierbarkeit von Verantwortung. Die Relationalität seiner Anthropologie und die Abkehr Jonas’ von einem reduktionistischen Menschenbild lassen wiederum Bezüge zu anderen hier vorgestellten Konzeptionen erkennbar werden. Sein Autonomieverständnis zielt weniger auf das einzelne mündige Subjekt, als auf die Gemeinschaft selbstbestimmter, zugleich in sozialen Kontexten stehender Subjekte (Schwerdt 1998). 5. Zusammenfassung Vor dem Hintergrund eines gewandelten Arzt-Patient-Verhältnisses, für das die Selbstbestimmung des Patienten prägend geworden ist, stellte sich die Frage, wie der Autonomie des Menschen im Falle einer demenziellen Erkrankung Rechnung zu tragen sei. Dazu konnte gezeigt werden, dass ein differenzierender Autonomiebegriff in der Lage ist, den aus einem verkürzenden Verständnis von Autonomie resultierenden 41 antagonistischen Gegensatz zu paternalistischer Fremdbestimmung aufzulösen. Die Konzepte von Autonomie Handlungsautonomie, als Autonomie moralischem als Recht negativem vs. situationsbezogener Abwehrrecht vs. positivem Anspruchrecht oder die der optionalen und relationalen Autonomie im Rahmen eines deliberativen Modells der Arzt-Patient-Beziehung haben sich in diesem Zusammenhang als bedeutsam erwiesen. Eine Demenz beraubt den Menschen mit Vernunft und Sprache spezifisch menschlicher Fähigkeiten. Seine davon unberührbare Würde ist gemeinsames Kennzeichen so unterschiedlicher Menschenbilder, wie des christlichen oder derjenigen der Philosophie der Stoa, Kants oder der Ethik des Lebens Jonas’. Die im Zuge einer demenziellen Entwicklung fortschreitenden Defizite verweisen jedoch auf ein das Menschsein nicht weniger konstituierendes Moment, als es seine Selbstbestimmungsfähigkeit darstellt: Menschliches Sein bedeutet auch Angewiesenheit, Bezogenheit, Verletzlichkeit. Das ausdrückliche Anerkenntnis der Ja-Nein-Polarität menschlichen Daseins schützt vor einem idealisierten Autonomiekonzept, welches sich etwa im medizinischen Alltag nur allzu oft als Fiktion zu erweisen droht. Es ist das Verdienst einiger in dieser Arbeit vorgestellter ethischer Konzeptionen, diese Dimensionen menschlicher Existenz und ihre Bedeutung für Grenzsituationen des Lebens in den Fokus genommen zu haben. Indem sie den moralischen Wert von Verantwortung und Fürsorge herausstellten und diese Prinzipien gerade nicht in eine Frontstellung zur Autonomie brachten, sondern als ethische Konsequenz anthropologischer Vollständigkeit verständlich machten, erwiesen sie sich insbesondere auch für Behandler und Pflegende demenzkranker Menschen als Quellen hilfreicher Orientierung. 42 Literaturverzeichnis: Annas, J.: The Morality of Happiness. Oxford University Press 1993, New York, Oxford. Bauer, A. W.: Eine offene Frage, was der Patient wirklich will. Mannheimer Morgen 18.06.2009, S. 3. Beckmann, J. P.: Patientenverfügungen: Autonomie und Selbstbestimmung vor dem Hintergrund eines im Wandel begriffenen Arzt-Patient-Verhältnisses. Zeitschrift für medizinische Ethik 44(1998):143-156. Bielefeldt, H.: Autonomie. In: Düwell, M., Hübenthal, C., Werner, M. H. (Hrsg.): Handbuch Ethik. J. B. Metzler 2006, Stuttgart, Weimar, S. 311-314. Biller-Andorno, N.: Gerechtigkeit und Fürsorge. Zur Möglichkeit einer integrativen Medizinethik. Campus Verlag 2001, Frankfurt. Bobbert, M.: Patientenautonomie und Pflege. Begründung und Anwendung eines moralischen Rechts. Campus Verlag 2002, Frankfurt, New York. Brandenburg, H.: Selbstbestimmung und Demenz. Vortrag im Rahmen der Sonntags-Matinée an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar am 28.06.2009: http://www.pthv.de/fileadmin/user_upload/PDF_Theo/EthikInstitut/SelbstbestimmungundDemenz.pdf (Zugriff am 20.09.2009). Buber, M.: Über Charaktererziehung. Hauptvortrag der Landeskonferenz der jüdischen Lehrer Palästinas in Tel-Aviv im Mai 1939. In: Buber, M.: Dialogisches Leben. Gesammelte philosophische und pädagogische Schriften. Gregor Müller Verlag 1947, Zürich, S. 297. Conradi, E.: Take Care. Grundlagen einer Ethik der Achtsamkeit. Campus Verlag 2001, Frankfurt. Dabrock, P.: Formen der Selbstbestimmung. Theologisch-ethische Perspektiven zu Patientenverfügungen bei Demenzerkrankungen. Zeitschrift für medizinische Ethik 53(2007):127-144. Dabrock, P.: Nikola Biller-Andorno (2001). Gerechtigkeit und Fürsorge (Rezension). Ethik Med 15(2003):321-325. Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (Hrsg.): Leitlinie Pflegende Angehörige. http://www.uni-duesseldorf.de/AWMF/ll/053-006.htm (Zugriff am 20.09.2009). Eibach, U.: Menschenwürde, Autonomie und Lebensschutz in der Geriatrie und Psychiatrie. LIT 2005, Münster, S. 13. Emanuel E. J., Emanuel L. L.: Four Models of the Physician-Patient Relationship. JAMA 267(1992):2221-2226. 43 Etzelmüller, G.: Der kranke Mensch als Thema theologischer Anthropologie. Die Herausforderung der Theologie durch die anthropologische Medizin Viktor von Weizsäckers. Zeitschrift für Evangelische Ethik 53(2009):163-176. Faden, R. R., Beauchamp T. L.: A History and Theory of Informed Consent. Oxford University Press 1986, Oxford, S. 237 ff. Förstl, H., Maelicke, A., Weichel, C.: Demenz. Taschenatlas spezial. Georg Thieme Verlag 2005, Stuttgart. Geisler, L. S.: Sprachlose Medizin? Das Verschwinden des Dialogischen. Imago Hominis 4(1997):47-55. Geisler, L. S.: Bedarfsgerechtigkeit im Gesundheitssystem? „Konkordanter Bedarf“ als unverzichtbare Voraussetzung. Die Rolle des Arzt-Patient-Dialogs. Vortrag auf der Tagung „Bedarfsgerechtigkeit im Gesundheitssystem? Zur Lage chronisch kranker und behinderter Menschen nach der Gesundheitsreform“ am 07.09.2004 in Berlin. www.imew.de/index. php?id=307 (Abruf am 08.08.2009). Geisler, L. S.: Patientenautonomie – eine kritische Begriffsbestimmung. Dtsch Med Wochenschr 129(2004):453-456. Gewirth, A.: Reason and Morality. University of Chicago Press 1978, Chicago, London. Graumann, S.: Selbstbestimmung oder Fürsorge? Patienten mit Demenz, geistiger Behinderung oder psychischer Krankheit. Vortrag auf der Tagung des Landesethikkomitees Bozen am 30.11.2007: http://www.provinz.bz.it/gesundheitswesen/bioetica/downloads/Graumann%20Selbst bestimmung%20oder%20F%C3%BCrsorge.pdf (Zugriff am 19.09.2009). Hampel, H., Padberg, F., Möller, H.-J. (Hrsg.): Alzheimer-Demenz. Klinische Verläufe, diagnostische Möglichkeiten, moderne Therapiestrategien. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH 2003, Stuttgart. Höffe, O.: Immanuel Kant. C. H. Beck 1983, München, S. 196 ff. Höffe, O. (Hrsg.): Lexikon der Ethik. Verlag C. H. Beck 2008, München, S. 117. Homeyer, J.: Verantwortung für den kranken Menschen. In: Schumpelick, V., Vogel, B. (Hrsg.): Medizin zwischen Humanität und Wettbewerb – Probleme, Trends und Perspektiven. Herder 2008, Freiburg, S. 81-102. Hübenthal, C.: Eudaimonismus. In: Düwell, M., Hübenthal, C., Werner, M. H. (Hrsg.): Handbuch Ethik. J. B. Metzler 2006, Stuttgart, Weimar, S. 82-94. Jonas, H.: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Suhrkamp 1984, Frankfurt (Main). Jonas, H.: Last und Segen der Sterblichkeit. In: Jonas, H.: Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen. Suhrkamp 1994, Frankfurt a. M., S. 89. 44 Kampits, P.: Das dialogische Prinzip in der Arzt-Patienten-Beziehung. Rothe 1996, Passau. Keller, F., Abendroth, M, Allert, G., Winkler, U., Sponholz, G.: Die Bedeutung der Verantwortungsethik von Bonhoeffer und Lévinas für die moderne Medizin. Zeitschrift für medizinische Ethik 55(2009):183-193. Knoepffler, N.: Patientenautonomie – Anspruch und Wirklichkeit am Beispiel der Sterbehilfedebatte. In: Schumpelick, V./Vogel, B. (Hrsg.): Medizin zwischen Humanität und Wettbewerb. Probleme, Trends und Perspektiven. Herder, Freiburg i. B. 2008, 37-52. Kohlen, H.: Elisabeth Conradi (2001) Take Care. Grundlagen einer Ethik der Achtsamkeit (Rezension). Ethik Med 17(2005):169-173. Kreß, H., Küpker, W.: Der Reproduktionsmediziner im Spannungsfeld zwischen ethischer Verantwortung und medizinischer Notwendigkeit. In: Felberbaum, R., Bühler, K., van der Ven, H. (Hrsg.): Das Deutsche IVF-Register 1996-2006. 10 Jahre Reproduktionsmedizin in Deutschland. Springer 2007, Berlin, S. 191. Kreß, H.: Medizinische Ethik. W. Kohlhammer 2009, Stuttgart, S. 25-29. Krones, T., Richter G.: Die Arzt-Patient-Beziehung. In: Schulz S., Steigleder K., Fangerau H., Paul, N. W. (Hrsg.): Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Eine Einführung. Suhrkamp-Verlag 2006, Frankfurt/M., S. 94-117. Krones, T., Richter, G.: Ärztliche Verantwortung: das Arzt-Patient-Verhältnis. Bundesgesundheitsbl-Gesundheitsforsch-Gesundheitsschutz 51(2008):818-826. Kruse, A.: Lebensqualität demenzkranker Menschen. Zeitschrift für medizinische Ethik 51(2005):41-57. Lawton, M. P., Winter, L., Kleban, M. H., Ruckdeschel, K.: Affect and quality of life. Journal of Aging and Health 11(1999) 169–198. Lévinas, E.: Ethik und Unendliches. Gespräche mit Philippe Nemo. Passagen 1992, Wien, S. 68. Pauer-Studer, H.: Feministische Ethik. In: Düwell, M., Hübenthal, C., Werner, M. H. (Hrsg.): Handbuch Ethik. Verlag J. B. Metzler 2006, Stuttgart, Weimar, S. 353. Petersen, P.: Dialogisches Prinzip im ärztlichen Handeln. Wien Med Wochenschr 142(1992):553-556. Quante, M.: Personales Leben und menschlicher Tod. Personale Identität als Prinzip der biomedizinischen Ethik. Suhrkamp 2002, Frankfurt a. M., S. 268-295. Ricœur, P.: Das Selbst als ein Anderer. Wilhelm Fink Verlag 1996, München, S. 210. Ritschl, D.: Person/Personalität. In: Eser, A., Lutterotti M. von, Sporken, P. (Hrsg.): Lexikon Medizin, Ethik, Recht, Herder 1989, Freiburg i. Br., S. 799. 45 Schöne-Seifert, B.: Grundlagen der Medizinethik. Alfred Kröner Verlag 2007, Stuttgart, S. 39 ff. Schweitzer, A.: Kultur und Ethik (1923). Verlag C. H. Beck 1990, München, S. 315. Schwerdt, R.: Eine Ethik für die Altenpflege. Verlag Hans Huber 1998, Bern, Göttingen, Toronto, Seattle. Schwerdt, R.: Monika Bobbert, Patientenautonomie und Pflege. Begründung und Anwendung eines moralischen Rechts (Rezension). Zeitschrift für medizinische Ethik 50(2004):104-107. Spitzy, K. H.: Verantwortung in der Medizin – aus dialogischer Sicht. Wien Med Wochenschr 152(2002):330-333. Steigleder, K.: Gewirth und die Begründung der normativen Ethik. Zeitschrift für philosophische Forschung 51(1997):250-266. Supprian, T.: Die Alzheimer-Demenz. In: Reichmann, H. (Hrsg.): Neurodegenerative Erkrankungen. Uni-Med Verlag 2005, Bremen, S. 70ff. Trüb, H.: Heilung aus der Begegnung. Ernst Klett Verlag 1951, Stuttgart. Wetzstein, V.: Diagnose Alzheimer. Grundlagen einer Ethik der Demenz. Campus Verlag 2005, Frankfurt, S. 208f. Wiesing, U. (Hrsg.): Ethik in der Medizin. Ein Studienbuch. Philipp Reclam jun. 2004, Stuttgart, S. 101-104. Wunder, M.: Demenz und Selbstbestimmung. Ethik Med 20(2008):17-25. Der Autor: Dr. med. Andreas Linsa ist Facharzt für Neurologie und derzeit als Leitender Oberarzt der Klinik für Neurologie am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus tätig. 46 In dieser Reihe sind bisher folgende Bände erschienen: Band 1 Prof. Dr. Gerfried Fischer „Medizinische Versuche am Menschen“, 2006 Band 2 Verena Ritz „Harmonisierung der rechtlichen Regelungen über den Umgang mit humanen embryonalen Stammzellen in der EG: Bioethik im Spannungsfeld von Konstitutionalisierung, Menschenwürde und Kompetenzen“, 2006 Band 3 Dunja Lautenschläger „Die Gesetzesvorlagen des Arbeitskreises Alternativentwurf zur Sterbehilfe aus den Jahren 1986 und 2005“, 2006 Band 4 Dr. Jens Soukup, Dr. Karsten Jentzsch, Prof. Dr. Joachim Radke „Schließen sich Ethik und Ökonomie aus“, 2007 Band 5 Prof. Dr. Hans Lilie (Hrsg.) „Patientenrechte contra Ökonomisierung in der Medizin“, 2007 Band 6 Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben (Transplantationsgesetz – TPG) Auszug aus dem Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz - AMG) Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens (Transfusionsgesetz TFG), 2007 Band 7 Dr. Erich Steffen „Mit uns Juristen auf Leben und Tod“, 2007 Band 8 Dr. Jorge Guerra Gonzalez, Dr. Christoph Mandla „Das spanische Transplantationsgesetz und das Königliche Dekret zur Regelung der Transplantation“, 2008 Band 9 Dr. Eva Barber „Neue Fortschritte im Rahmen der Biomedizin in Spanien: Künstliche Befruchtung, Präembryonen und Transplantationsmedizin“ und „Embryonale Stammzellen - Deutschland und Spanien in rechtsvergleichender Perspektive“, 2008 47 Band 10 Prof. Dr. Dr. Eckhard Nagel „Was ist der Mensch? Gedanken zur aktuellen Debatte in der Transplantationsmedizin aus ethischer Sicht“ Prof. Dr. Hans Lilie „10 Jahre Transplantationsgesetz - Verbesserung der Patientenversorgung oder Kommerzialisierung?“, 2008 Band 11 Prof. Dr. Hans Lilie, Prof. Dr. Christoph Fuchs „Gesetzestexte zum Medizinrecht“, 2009 Band 12 PD Dr. Matthias Krüger „Das Verbot der post-mortem-Befruchtung § 4 Abs. 1 Nr. 3 Embryonenschutzgesetz –Tatbestandliche Fragen, Rechtsgut und verfassungsrechtliche Rechtfertigung“, 2010 Band 13 Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, Dr. Marlis Hübner „Ärztlich assistierter Suizid - Tötung auf Verlagen. Ethisch verantwortetes ärztliches Handeln und der Wille des Patienten“, 2010 Band 14 Philipp Skarupinski „Medizinische, ethische und rechtliche Aspekte der Notwendigkeit einer Kinderarzneimittelforschung vor dem Hintergrund der EG-Verordnung 1901/2006“, 2010 Band 15 Stefan Bauer „Indikationserfordernis und ärztliche Therapiefreiheit: Berufsrechtlich festgelegte Indikation als Einschränkung ärztlicher Berufsfreiheit? Dargestellt am Beispiel der Richtlinie zur assistierten Reproduktion“, 2010 Band 16 Heidi Ankermann „Das Phänomen Transsexualität – Eine kritische Reflexion des zeitgenössischen medizinischen und juristischen Umgangs mit dem Geschlechtswechsel als Krankheitskategorie“, 2010 Band 17 Sven Wedlich „Konflikt oder Synthese zwischen dem medizinisch ethischen Selbstverständnis des Arztes und den rechtlich ethischen Aspekten der Patientenverfügung“, 2010 48 Band 18 Dr. Andreas Walker „Platons Patient – Ein Beitrag zur Archäologie des Arzt-Patienten-Verhältnisses“, 2010 Band 19 Romy Petzold „Zu Therapieentscheidungen am Lebensende von Intensivpatienten – eine retrospektive Analyse“, 2010