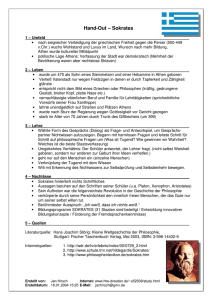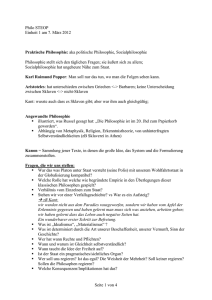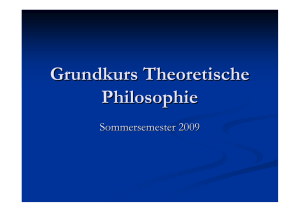GLOBALE KULTUR I Shanzhai
Werbung

GLOBALE KULTUR I Shanzhai Wir haben letzte Woche die Position von Norbert Bolz zum Thema Weltgesellschaft, Islamischer Fundamentalismus – Konsumismus kennengelernt. Seine Empfehlung in Hinblick auf religiöse Fundamentalisten ist einfach, das Virus des Konsums in Umlauf zu bringen, dann werden sich traditionale Strukturen schon von selbst auflösen, da alle aus Eitelkeit nur noch um Anerkennung über den Konsumismus ringen werden. Konsum verschafft Identität in einer globalen Weltgesellschaft mit dem Verlust traditioneller Bindungen. Nun gibt es in dieser angeblichen Weltgesellschaft kulturelle Differenzen, die sich vermutlich nicht so einfach überwinden lassen werden. Eine davon ist die Differenz zwischen Original und Kopie, die in den aktuellen Urheberrecht-Debatten immer wieder aufflammt. Besonders Südostasien aber auch China sind die Räume, denen unterstellt wird, den Weltmarkt mit Billigkopien westlicher Markenartikel zu überschwemmen. Nun ist vor einiger Zeit, 2011, ein kleines Büchlein des in Seoul (Südkorea) geborenen Philosophen Byung-Chul Han erschienen, das genau diese kulturelle Differenz von Original und Kopie untersucht. Han lehrte bis vor kurzem an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und ist mit seinen Büchern und vor allem den Begriffen, die er darin formuliert hat – »Müdigkeitsgesellschaft«, »Hyperkulturalität«, »Transparenzgesellschaft« – eine Art Kultautor geworden, der gerne auch in Magazinen für elektronische Kultur wie debug zu Worte kommt. Das Büchlein, das ich Ihnen vorstellen möchte, heißt Shanzhai. Dekonstruktion auf Chinesisch. Bevor ich das tue, müssen wir aber einen kurzen Blick auf den Kerngedanken der abendländischen Philosophie werfen und die Bedeutung des Begriffs Dekonstruktion klären. Han beginnt das Buch mit einer Bemerkung des deutschen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel aus dessen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (Erstveröffentlichung 1892), für den die Chinesen »dafür bekannt sind, zu betrü1 gen, wo sie nur irgend können«. Hegel bescheinige den Chinesen bzw. der chinesischen Kultur generell einen »angeborenen Hang zur Lüge«. Und Han gibt Hegel im Weiteren so wieder, dass es die Chinesen einem auch nicht übel nähmen, wenn der Betrug dann auffliege. Es gibt aber für Hegel, führt Han weiter aus, eine Erklärung hierfür und die liegt im Buddhismus, der für diesen das Nichts bzw. die Leere anstrebt. So sei das Absolute nicht irgendein Gott sondern eben das Nichts. Das Nichts kennzeichne im Gegensatz zum christlichen Gott nicht die Schöpfung sondern die Ent-schöpfung, die Abwesenheit, die Leere. Laut Han erklärt sich für Hegel so die »große Immoralität« der Chinesen. Han schreibt: »Das nilistische Nichts lässt, so denkt Hegel offenbar, keine Verbindlichkeit, keine Endgültigkeit, keine Beständigkeit zu. Dem nihilistischen Nichts ist jener Gott entgegengesetzt, der für Wahrheit und Wahrhaftigkeit stünde.« Und diese Vorstellung der Negativität, der Leere, ist dem abendländischen Denken, das bekanntlich mit den Griechen einsetzt, völlig fremd, ja sogar diametral entgegengesetzt. Die abendländische Philosophie, ausgehend von den Griechen über die christliche Theologie des Mittelalters bis hin zu den großen Philosophen der Neuzeit – Descartes, Kant, Hegel – zielte immer auf das, was übrig bleibt, wenn alles Vergängliche, jeder Schein, abgezogen wird. Diesen Rest nannte man dann im Gegensatz zum nur Seienden das Sein. Oder auch das Wesen, die Idee, Ding an sich … da gibt es viele Ausdrücke. Im Gegensatz zum Nichts des Buddhismus war dieses Sein aber beharrlich und nicht eben nichts. So ist auch eine der klassischen Fragen der Philosophie, zumindest ihr Ausgangspunkt, die Frage: »Warum gibt es Etwas und nicht Nichts?« Wenn man sagt, dass sich die Physik mit der Beschaffenheit der Dinge, dem Seienden und ihren Beziehung zueinander beschäftig, dann beschäftigt sich die philosophischen Disziplin der Metaphysik eben mit all den Fragen, die diese Dingwelt und ihre Beziehungen überschreiten. Die Metaphysik beschäftigt sich sozusagen mit den letzten Dingen, dem, was Bestand hat und immer währt. Eine intensive Aus2 einandersetzung mit solchen Fragen begann im Griechenland des 5. und 4. Jahrhunderts, der Zeit, die in der Kunstgeschichte als Klassik bezeichnet wird. Hier entstehen auch die klassischen philosophischen Positionen, die vor allem durch zwei Männer geprägt wurden, durch Sokrates und seinen Schüler Platon. Sokrates war sozusagen der »Meister aller Meister« unter Philosophen. Im Gegensatz zu vielen Denker seiner Zeit versuchte Sokrates Wissen zu erlangen, in dem er alles, was man bis dahin voraussetzungslos akzeptiert hatte, kritischen Fragen unterzog. So fragte er z. B. Menschen, die sich für besonders tugendhaft oder auch tapfer hielten, was den die Tugend an sich sei oder die Tapferkeit. Er führte mit solchen Fragen den Dialog in die Philosophie ein. Natürlich nerven und verunsichern solche Typen mit ihren ständigen Fragen und gefährden dadurch vermeintlich auch die öffentliche Ordnung. So hat man Sokrates, der übrigens in Athen lebte und seine Fragen stellte, vorgeworfen, die Jugend zu verderben und die Götter zu lästern. Das bedeutete damals das Todesurteil, das Sokrates akzeptierte anstatt zu fliehen und vollstreckte das durch den Schierlingsbecher. Den Begriff haben Sie möglicherweise schon mal gehört, Schierling ist eine giftige Pflanze, deren Saft zu Lähmung vor allem der Atmung führt und so einen grausamen Tod bei vollem Bewusstsein verursacht. So einen Becher mit Schierlingsextrakt musste Sokrates also schlucken. Wir haben ja schon hinreichend über das Opfer gesprochen und neben Jesus Christus ist Sokrates sicherlich das berühmteste Opfer. Allerdings auch sein Opfer verpflichtet uns seither zu einer Gegengabe bzw. hat ihn unsterblich in die Geschichte eingeschrieben. Sein berühmtester Spruch »Ich weiß, dass ich nicht weiß« begründet eben diese Rolle des Fragenden auf dem Weg zu einem gesicherten Wissen. Wer ständig redet, kann nicht schreiben und so gibt es von Sokrates keine geschriebene Lehre. Wir wissen hiervon nur von Platon, einem seiner Schüler, dessen Werke hauptsächlich aus einer Reihe berühmter Dialoge besteht, in denen, was nicht besonders verwunderlich ist, sein Lehrer Sokrates die Hauptrolle spielt. Diese Dialoge haben vornehmlich immer ein Ziel: Vorhandenes Wissen zu hinterfragen, um so letztendlich zu einem gesicherten Wissen zu kommen. Platon selbst war auch ein Getriebener, der zunächst in Athen wohnte, später aber verschiedene Rei3 sen unternahm, wo er z. B. einen Tyrannen auf Sizilien davon überzeugen wollten, dass Philosophen die besten Herrscher seien. Als er schließlich nach Athen zurückkehrte, gründete er dort eine eigene Schule der Philosophie, an der sozusagen über die Dinge des Geistes nachgedacht wurde. Das war in einem Hain, also einer Art Garten, der hieß »Akadḗmeia« und war nach dem Heros Akademos benannt. Deshalb heißen viele Ausbildungsstätten heute immer noch Akademien, Kunstakademie, Akademie für Kommunikation, Berufsakademie, etc. – das nur am Rande bemerkt. Ich will Sie aber jetzt nicht weiter mit Platon und Philosophie nerven, aber vor allem eine seine Ideen hat direkt etwas mit unserem Problem von Original und Kopie (Reproduktion) zu tun und diese Idee war prägend für alle weiteren Debatten zu dem Thema. Und die »listigen und verschlagenen« Chinesen haben diese Lehre Platons sozusagen ausgelassen, weshalb sie auch zu Weltmeistern des Kopierens werden konnten. Ich kann die Ideenlehre, so hat man im Nachhinein Platons Theorie genannt, hier nur verkürzt wiedergeben. Es ist tatsächlich etwas komplizierter, aber im Wesentlichen ist der Unterschied zwischen Platon und seinem Lehrer Sokrates wohl der, dass Platon den Menschen eine Antwort auf ihre Fragen liefern wollten, während Sokrates immer nur zeigen konnte, dass man im Grunde von falschen Annahmen ausgegangen ist und sich bei näherem Nachfragen in Widersprüche verwickelt. Die nennt man Aporien. Deshalb hat man Sokrates ja letztendlich auch zum Tode verurteilt, weil er alle ständig nur verunsichert hatte und so für eine stabile Gesellschaft zu einer Gefahr wurde. Platons Strategie ist eher, die Spreu vom Weizen zu trennen, er fragt sich, was eigentlich hinter den Erscheinungen oder einer Eigenschaft steckt, er fragt nach dem Wesen von etwas. Es gibt z. B. schöne Menschen oder schöne Dinge, aber was ist eigentlich das Wesen der Schönheit selbst? Oder in Bezug auf die Tugend, es gibt tugendhafte Menschen, aber was ist das Wesen der Tugend? So lautet Platons Erklärung also, dass die Eigenschaft eines Dinges oder Menschen schön zu sein nur Anteil nimmt an der Idee der Schönheit, wobei hier mit Idee nicht eine Vorstellung oder ein Gedanken gemeint ist, sondern die Idee ist 4 sozusagen dass allen Abbildern, allen Erscheinungen zugrunde liegende Urbild. Man sollte aber auch vorsichtig mit diesem Begriff Urbild sein, denn die Idee ist nichts Sichtbares, wir können sie nicht wahrnehmen. Ansonsten wäre sie nämlich ein Teil der sinnlich wahrnehmbaren Welt und wiederrum nur relativ. Die Idee selbst ist aber absolut, ewig während. Man kommt zu den Ideen, Begriffen wäre vielleicht ein besseres Wort, nur durch Abstraktion bzw. nur durch Denken. Alle Dinge, die wir als schön bezeichnen, haben Anteil an der Idee des Schönen, alle tugendhaften Menschen haben Anteil an der Idee der Tugend, alle Pferde an der Pferdlichkeit oder dem Begriff Pferd. So könnte man das vielleicht formulieren. Ideen sind gedachte Prinzipien, also die Idee des Schönen ist das Prinzip der Schönheit, Ideen sind »transzendente Objekte« weil sie den Bereich der sinnlichen Wahrnehmung überschreiten. Sie sind in einem jenseitigen Reich angesiedelt. Wenn wir das jetzt mal auf den Bereich der Sprachphilosophie ausdehnen, dann kann ich z. B. nur deshalb behaupten, dass dies ein Tisch ist, weil dieser einzelne Tisch der Definition oder dem Begriff eines Tisches entspricht: vier Beine, Platte oben drauf. Dann kann man noch streiten, wann ein Tisch kein Tisch mehr ist, sondern z. B. ein Stuhl. So ist für den Begriff Tisch auch wichtig, dass er keine Stuhl, keine Lampe, kein XY ist. Wenn aber nur die Ideen dasjenige sind, was Bestand hat und alles andere nur relativ zu irgendetwas ist, dann macht es Sinn auf diese Ideen zurückzukommen, da sie dann das eigentliche ewige Sein sind und die Erscheinungen, das Seiende, dagegen nur vorübergehend in Zeit und Raum. Jetzt werden einige von Ihnen, die vielleicht in der Schule schon philosophisch geschult wurden, fragen, »woher wissen wir denn überhaupt, dass es diese Ideen gibt und wie können wir zu ihnen kommen«. Um diese Frage zu beantworten, geht Platon davon aus, dass wir die Ideen schon einmal gesehen haben bzw. mit ihnen in Kontakt getreten sind. Das war vor unserer Geburt, da hat unsere Seele nämlich schon einmal die Ideen geschaut. Platon geht von einem beseelten letztendlich immateriellen Universum aus bzw. für ihn existieren eine diesseitige und eine jenseitige Welt. Aus dieser Idee folgen einige für das Denken des Abendlandes verhängnisvolle Schlüsse z. B. die Annahme einer Unsterblichkeit der Seele, der Dualismus von Leib und Seele, die 5 Abwertung des Körpers gegenüber der Seele usw. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt und Sie vielleicht sagen wollen, das ist ja wie im Religionsunterricht, dann liegt das daran, dass die christliche Theologie des Mittelalters fast vollständig alle diese Ideen von Platon übernommen hat. Platon verdeutlicht die Gedanken dieser »Ideenlehre« durch drei Gleichnisse, das Liniengleichnis, das Sonnengleichnis und das Höhlengleichnis. Die ersten beiden können Sie selbst mal recherchieren für das Höhlengleichnis schauen wir uns einen Ausschnitt aus Matrix an, der das schön illustriert. Matrix ist reiner Platonismus bzw. besser mittelalterliche Theologie – Scholastik – den Neo ist ja eigentlich der Messias, Christus, der Retter der Welt. Platon, und jetzt kommen wir zurück zum Thema von Original und Kopie, hat die Unterscheidung, die Differenz von Urbild und Abbild in das Denken eingeführt. Die Ideen wären in diesem Sinn die Originale, die in den sinnlichen Erscheinungen immer wieder reproduziert werden. Wirklichen Wert haben aber nur die Originale während die Kopien eben etwas Minderwertiges sind. Und so kommen wir auch wieder zu dem Büchlein Shanzhai. Denkonstruktion auf Chinesisch von Han zurück, wobei es jetzt an der Zeit wäre, das Wort Dekonstruktion zu erklären. Es gab selbstverständlich immer wieder Zweifel an der Lehre von Platon und dessen Vorschlag von ewigen Urbildern und vergänglichen Abbildern auszugehen. So hat sich im 20. Jahrhundert ein philosophische Strömung herausgebildet, die diese Differenz von Urbild und Abbild, Original und Täuschung, Sein und Seiendem – wie immer man das nennen mag – zu entlarven versuchte. Es hat sich dann immer wieder gezeigt, dass das, was angeblich ursprünglich ist, auch nur relativ ist und so verschiebt sich die Suche nach einem festen Halt, die Suche nach dem Ursprung von allem immer weiter und es bleiben nur Spuren dieser Suche übrig. Die Dekonstruktion ist demnach ein Verfahren, dass die Differenz von Urbild und Abbild infrage stellt. Jean Jacques Rousseau, den wir ja in der ersten Veranstaltung bereits kennen gelernt haben, als es um den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen ging, ist ein Meister dieses ursprünglichen Denkens. Die Natur ist der Ursprung, die Kultur nur eine Verirrung, also zurück zum Ursprung, zurück zur Na6 tur... Die Dekonstruktion als Verfahren beginnt übrigens mit der Dekonstruktion eines Textes von Rousseau, in dem dieser behauptet, dass die gesprochene Sprache der Schrift vorausging. Zuerst denkt man etwas, dann spricht man es aus und dann kann man es aufschreiben. Aber so hat Jacques Derrida das gezeigt, die Schrift als Verräumlichung von Worten und Buchstaben, steckt doch in der gesprochenen Sprache auch schon als Struktur drin. Denken ohne diese Struktur, ohne diesen Raum von Differenzen, sagt Derrida, funktioniert auch nicht. Und so wird das, was eigentlich in der Rangfolge laut Rousseau ziemlich weit hinten stehen sollte, die Schrift, zu etwas, was von Anfang an den Ursprung besetzt hat. Ich weiß, das ist sehr kompliziert, aber Sie sollen zumindest eine Ahnung von der Dekonstruktion haben. Byung-Chul Han macht das gleich mit seinen schönen Beispielen aus der chinesischen Tradition viel verständlicher. Der größte Unterschied zwischen dem chinesischen Denken und dem europäischen ist zunächst mal, dass im Tao der Weg viel wichtiger ist als die Ankunft. Das chinesische Denken ist eigentlich immer auf dem Weg, immer in Bewegung, während das europäische Denken zu einem Ursprung gelangen möchte, etwas, das Bestand hat. Insofern ist das chinesische Denken von Anfang an dekonkstruktivistisch, weil es diese Idee von einem Anfang, einem Ursprung, letztendlich auch einem Original leugnet. Und so kennt das chinesische Denken auch die Vorstellung eines Urhebers, eines Schöpfers nicht, das ist der Grundgedanken des Buches Shanzhai. Wo es keine Schöpfer gibt, wo alles in Bewegung, alles im Fluss von Werden und Vergehen ist, da gibt es eben auch kein Original. Die Reproduktion oder die Kopie wird also in einer paradoxen Umdrehung ursprünglicher als der Ursprung bzw. in China kennt man kulturell die Unterscheidung, die Differenz von Original und Kopie überhaupt nicht. Han vergleicht dann den griechischen mit einem buddhistischen Tempel. Während der griechische Tempel in seinem Innersten etwas verborgenes Heiliges aufbewahrt, zu dem man nur durch verschiedene Initiationen vordringen kann – das hatten wir in der Stunde über das Profane und das Heilige - ist der buddhistische Tempel nach allen Richtungen offen und hat viele 7 Fenster und Türen. Es gibt hier also überhaupt kein Inneres, also auch kein Heiliges, zu dem man vordringen könnte. Alles ist eben offen hier, verändert sich ständig, ohne zur Ruhe zu kommen. Hier einmal ein schönes Zitat von Han: »Das chinesische Denken ist pragmatisch im besonderen Sinne. Es spürt nicht dem Wesen oder dem Ursprung, sondern den veränderlichen Konstellationen der Dinge (pragmata) nach. Es gilt, den veränderlichen Lauf der Dinge zu erkennen, ihm situativ zu entsprechen und daraus Nutzen zu ziehen. Das chinesische Denken misstraut festen, unveränderlichen Wesenheiten oder Prinzipien. Diese Geschmeidigkeit oder Anschmiegsamkeit, die auf die Wesenlosigkeit, auf die Leerheit zurückgeht, erscheint Hegel offenbar als listig, unwahrhaftig oder unmoralisch.« Dann kommt eine sehr aufschlussreiche Stelle für die gegenwärtigen Debatten um die Situation der Menschenrechte in China. Han schreibt, dass die chinesische Übersetzung für das Wort Menschenrechte Ren quan lautet. Das quan hat wohl ein sehr schillerndes Bedeutungsspektrum, wodurch der chinesischen Vorstellung des Rechts auch eine extreme Flexibilität zukommt. Das quan bezeichnet wohl das Gewicht einer Laufgewichtswaage, und lässt sich dementsprechend hin- und herschieben. So sind eben auch die Menschenrechte oder die chinesische Vorstellung hiervon verschiebbar bzw. müssen immer wieder neu austariert werden. Ich betone das jetzt ohne jede Wertung, aber vermutlich wäre das im Dialog mit dem Westen sehr hilfreich, wenn man diese kulturelle Eigenheit Chinas besser verstehen würde. Wir bleiben aber bei der Kunst bzw. beim Design. Interessant für uns ist der Hinweis, dass das Zeichen für quan auch in dem chinesischen Begriff für geistiges Eigentum vorkommt (zhi shi chan quan). Auch hier scheint alles relativ und nur vorläufig zu sein. So ist List, taktische Geschickt oder gar strategisches Vorgesehen bei der Produktpiraterie oder beim Kopieren durchaus nichts Unmoralisches. Weisheit nach chinesischem Muster und Wahrheit nach europäischer Vorstellung sind deshalb nicht das Gleiche. Die Wahrheit beruht auf der Unveränderlichkeit und 8 Beständigkeit, beruht auf den „Schwergewicht des Seins«, schreibt Han, aber die Weisheit nach chinesischem Verständnis ist eben situativ, wird durch das »Laufgewicht des quan« bestimmt. In Bezug auf das Original stellt Byung-Chul Han fest, dass der Ferne Osten solche Größen wie Original, Ursprung, Identität einfach nicht kennt. Zhen-ji, das Wort bzw. Zeichen für Original, bedeutet wortwörtlich »echte Spur«. Es wird einfach das Prozesshafte, Situative im Gegensatz zum Eindeutigen bevorzugt. Und so schreibt der Autor: »Nicht eine einmalige Schöpfung, sondern der endlose Prozess, nicht die endgültige Identität, sondern die ständige Wandlung bestimmt die chinesische Idee des Originals … Vielmehr beginnt fernöstliches Denken mit der Dekonstruktion.« Es folgen dann sehr schöne Bildbeispiele, die zeigen, dass jedes Bild, jedes Gemälde könnte man sagen, einem Prozess unterzogen wird, es gibt also keine Augenblick X, der das Original kennzeichnen würde, sondern durch Siegelabdrücke oder Einschreibungen wird das Bild ständig Veränderungen unterzogen. Es wird sozusagen ein Dialog eröffnet und nicht etwas durch eine Signatur als Original gekennzeichnet. »Das Malen ist hier ein geselliger, gemeinsamer Akt.« Und vielleicht noch ein Zitat hierzu: »Die Siegelabdrücke auf den chinesischen Gemälden besiegeln nichts. Vielmehr eröffnen sie einen kommunikativen Raum …Darin unterscheiden sie sich signifikant von den Signaturen in der europäischen Malerei.« Diese Vorstellung eines Bildes vergleicht Han dann mit einem der berühmtesten Bilder der westlichen Kunstgeschichte, mit Jan van Eycks Arnolfini-Hochzeit. Das Bild ist extrem reichhaltig an Bezügen und Symbolen, für uns interessant ist aber nur die Signatur oberhalb des Spiegels, die bezeugt, dass Jan van Eyck diese gemacht bzw. gesehen hat. Im Spiegel sieht man ihn auch als Zeugen bzw. Autor der 9 Szene. Hier hat sich also nur der Maler in das Bild eingeschrieben. Weitere Veränderungen gälten als Frevel. Und noch ein letztes Beispiel für die Wertschätzung der Kopie in China. Als Hamburger Museum für Völkerkunde 2007 einige der berühmten Terrakota-Krieger zeigen wollte, bekamen sie von den Chinesen nur Repliken. Als das herauskam, wurde die Ausstellung geschlossen, »um den Ruf des Museums zu bewahren«. Nun waren aber gerade die Terrakotta-Krieger nie als Originale gedacht, sondern sicherlich auf Reproduktion und modulare Variation ausgelegt. Deshalb sind es ja so viele. Und somit waren die Repliken, die man nach Deutschland geschickt hatte, auch keine Fälschungen. So schreibt Han: »Die Herstellung von Repliken der Terrakotta-Krieger verlief von Anfang an parallel zu der Ausgrabung. Direkt an die Ausgrabungsstätte wurde eine Reproduktionswerkstatt angeschlossen. Sie stellte aber keine ›Fälschungen‹ her. Man müsste eher sagen, dass die Chinesen versuchten, die Produktion, die von Anfang an keine Schöpfung war, sondern schon eine Reproduktion war, gleichsam wieder aufzunehmen. Die Originale entstanden ja selbst in einer Serien- und Massenproduktion mit Modulen und Versatzstücken… Leitend für die modulare Produktion ist nicht die Idee der Originalität oder Einmaligkeit, sondern die Reproduzierbarkeit… Die modulare Produktion ist modulierend und variierend. So lässt sie eine große Varietät zu« Es gibt wohl auch für das Wort Kopie mehrere Wörter im Chinesischen. Einmal gibt es sogenannten Fangzhipin, Nachbildungen, bei denen der Unterschied zum Original offensichtlich ist. Und dann fuzhipin. Das sind exakte Reproduktionen von Originalen, was überhaupt nichts Verächtliches hat. Im Gegenteil, je besser das gelingt, desto größere Hochachtung genießt die Kopie. Originale und Kopien unterscheiden sich nicht wesentlich. Das beste Beispiel im Buch für diese Auffassung ist aber der berühmte Ise-Schrein in Japan. Der ist wohl das höchste Heiligtum im shintoistischen Japan. Jährlich pilgern hierhin Millionen von Japanern. Die Anlage 10 ist 1300 Jahre alt, wird aber alle 20 Jahre komplett neu errichtet. Genau deshalb wurde sie von der UNESCO aus der Liste des Weltkulturerbes wieder gestrichen. Dieser Ise-Schrein ist ein super Beispiel dafür, dass der Unterschied zwischen Original und Kopie hier total verkehrt wird, wenn nicht ganz verschwindet. Das angebliche Original nutzt sich mit der Zeit ab, weil es altert. Eine Kopie entspricht daher dem Original viel mehr als das Original selbst. Die Reproduktion, so paradox das klingen mag, versetzt das Gebäude wieder in seinen Originalzustand, während das Original sich davon immer mehr entfernt. Aber nicht nur das Gebäude sondern auch alle Tempelschätze werden permanent erneuert. Wenn ein neues Set von Schätzen fertig ist, kann das alte verbrannt werden. So kann man sagen: »Originale erhalten sich durch Kopien.« Wie in der Natur. Auch da sterben alte Zellen ab und werden durch neue ersetzt. Das Freiburger Münster ist ein ähnlicher Fall für Han. Auch hier sind fast alle Steine schon einmal erneuert worden und vom alten Bestand ist wenig übrig. Ist das dann trotzdem noch das Freiburger Münster oder nicht? Übrigens ein anderer Autor, Walter Benjamin, macht das Original an seiner räumlichen Verortung fest. Die Verortung in Raum und Zeit macht für ihn die Aura eines Kunstwerkes aus. Auch das würde aber konsequent zu Ende gedacht bedeuten, dass etwas zu einem Original werden kann, indem man es verortet. Aber die Idee des Originals war in der westlichen Welt auch nicht immer vorhanden. Sie ist dort ebenfalls historisch entstanden und zwar ungefähr im 18. und 19. Jahrhundert mit dem aufkommenden Geniekult. Eigentlich begann dieser Kult um das Original mit der Musealisierung der Vergangenheit, als man begann als Tourist die großen Orte der Vergangenheit aufzusuchen. Bis dahin hat man sogar das Kolosseum als Steinbruch benutzt – ohne schlechtes Gewissen. Diese Geisteshaltung der asiatischen Kultur in Bezug auf die Nichtexistenz eines Unterschieds zwischen Original und Kopie macht auch ihre Einstellung zum Klonen verständlicher. Dort, wo man an Reinkarnation glaubt, ist »Klonen einfach nur ein Neustart eines weiteren Zyklus der Seelenwanderung«, so zumindest der koreanische Klonforschung Hwang Woo-suk in einem Interview – Hwang Woo-kuk ist übrigens Buddhist. 11 Zum Schluss möchte ich kurz noch auf das letzte Kapitel des Buches eingehen, das ihm auch den Titel gegeben hat: Shanzhai, was so viel wie Fake bedeutet. Wobei wir vorsichtig sein sollten. Wenn man kein Original kennt, kann man auch nichts faken. Aber konkret bezog sich der Begriff auf Handys. Shanzhai-Handys sind Fälschungen von Markenhandys wie Nokia oder Samsung gewesen. Als Nokir, oder Samsing gingen die dann auf den Markt. Auch hier hatten wir es nicht einfach nur mit Fälschungen zu tun, sondern man hatte durchaus das Bedürfnis diese neuen »Marken« zu verbessern. So gab es wohl ein Shanzhai-Handy, das in der Lage war, Falschgeld zu erkennen. Sie kennen das von anderen Labels. Die werden ständig abgewandelt, langsam weichen die angeblichen Fälschungen vom Original ab, bis sie selbst fast zu einem Original werden. Alles wird einem Spiel der Abwandlungen unterzogen. Diese Kultur des Shanzhai wird auf nahezu alle kulturellen Erzeugnisse angewandt. Ist ein Roman erfolgreich, dann folgt sogleich ein Fake bzw. eine weitere Spielart, müsste man eher sagen. So existieren zahlreiche Harry-Potter-Fakes, »die das Original transformierend fortführen«. Harry Potter und die Porzellanpuppe beispielsweise. Alles wird abgewandelt und angepasst. Seine Freunde heißen Long Long oder Xing Xing, der Widersacher ist Yandomort, Harry spricht selbstverständlich fließend Chinesisch, kann aber nicht mit Stäbchen essen. Genauso beim Labeldesign, da sind der Phantasie auch keine Grenzen gesetzt: iPncne sieht wie ein abgegriffenes iPhone aus. So wird Variation und Mutation wie in der Evolution das Grundprinzip der chinesischen Produktion. »Das Neue entsteht hier aus überraschenden Variationen und Kombinationen. Das Shanzhai veranschaulicht eine besondere Spielart der Kreativität. Sukzessiv weichen seine Produkte vom Original ab, bis sie selbst zu einem Original werden.« Auch in der Politik sieht man diese extreme Wandlungsfähigkeit. Der chinesische Maoismus ist ein Shanzhai-Marxismus. Der Kommunismus selbst eine Art Shanzhia-Kommunismus, denn man hat ihn durch die Vorteile des Kapitalismus bereichert. Es gibt also keine Original-Ideologie, sondern die Ideologie ist ebenfalls ei12 nem ständigen Wandel unterworfen bzw. wird ständig verbessert. Und so sind die Schlusswort von Byung-Chul Han’s Buch auch mit der Hoffnung verbunden, dass aus diesem Shanzhai-Kommunismus irgendwann mal eine Shanzhai-Demokratie werden könnte. Literatur: Byung-Chul Han: Shanzhai. Dekonstruktion auf Chinesisch, Berlin 2011. 13