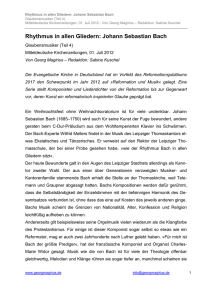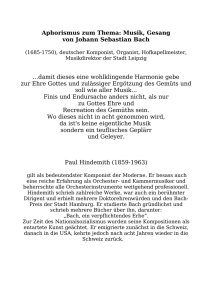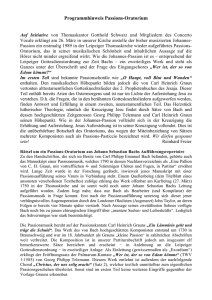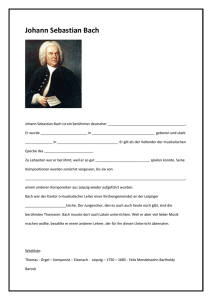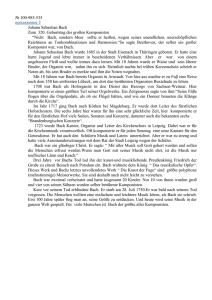Ohne Namen-1 - Staatliches Institut für Musikforschung
Werbung

Bach und die Idee musikalischer Vollkommenheit BACH UND DIE IDEE MUSIKALISCHER VOLLKOMMENHEIT* CHRISTOPH WOLFF I Daß Musik eine Gabe der Götter sei, überliefern die kultischen Traditionen aller Weltreligionen, in denen Musik eine Rolle spielt. Zum Besonderen der abendländischen Musikkultur gehört es hingegen, daß sie schon frühzeitig eine theoretische Dimension aufwies, in der das Gedankengut der griechischen Antike und des christlichen Mittelalters zu einer Synthese verschmolz, die etwas Singuläres ermöglichte, nämlich eine musikalische Philosophie: Denken über Musik, Denken mit Musik, Denken in Musik. Musik war nicht bloß göttliche Gabe, sondern zugleich ein Mittel, göttliches Wirken zu verstehen. Innerhalb des mittelalterlichen Wissens- und Lehrkanons der Septem artes liberales gehörte die Ars musica zusammen mit Arithmetik, Geometrie und Astronomie zum Quadrivium der mathematischen Künste. Die Ordnung des Kosmos ließ sich denn auch musiktheoretisch erklären, da einzig in der Ars musica Maß, Zahl und Gewicht ein proportionales System boten, das beispielsweise durch die Mensuren von Monochord-Saiten, Orgelpfeifen oder Glocken erfahrbar, hör- und beweisbar gemacht werden konnte. Die Vollkommenheit der Schöpfung Gottes ließ sich nicht besser verstehen als mit Mitteln der Musik. Gute und schlechte Proportionen konnten in Form von vollkommenen und unvollkommenen Intervallen, Konsonanzen und Dissonanzen, Wohl- und Mißklängen dargestellt werden. Die durch Maß, Zahl und Gewicht regulierte Schöpfungsordnung der Welt regierte auch die Welt der Töne, ja spiegelte sich in ihr wider. Den Regeln zuwider laufende, falsch gesetzte Töne waren darum keine Musik, sondern – nach Worten des barok- * Vortrag, gehalten am 4. Juli 1995 im Musikinstrumenten-Museum des Staatlichen Instituts für Musikforschung anläßlich der 25. Bach Tage Berlin. Auf eine Wiedergabe der Klangbeispiele durch Notenbeispiele wurde (mit Ausnahme von Beispiel 1) verzichtet; die Anmerkungen beschränken sich auf Quellennachweise. Christoph Wolff ken Musiktheoretikers Friedrich Erhart Niedt – „ein Teuflisches Geplerr und Geleyer“ (so zitiert auch von Bach in seiner Generalbaß-Lehre von 1738)1. Bach spricht in seiner Generalbaßlehre auch vom Finis, dem Endzweck aller Musik: daß sie der Ehre Gottes und der Recreation des Gemüts zu dienen habe. Wiederum in Anlehnung an Niedt spricht Bach hier gleichsam sein musikalisches Credo aus. Hier Ehre Gottes, dort Recreation des menschlichen Gemüts – es geht um die Totalität von Geist, Verstand und Sinnen, wie es die Mittlerfunktion der Musik besagt. Musik als Brücke zwischen Gott und Mensch; Kunst, die der Vollkommenheit der Schöpfung, der Natur, nachzueifern und zumindest deren Maßstäbe zu übernehmen bestrebt war. Vollkommenheit war denn auch musikalisch besser definierbar als in irgendeiner anderen Kunst. Ein so genuin musikalischer Begriff wie die griechische Vokabel „Harmonia“ bezeugt die Tragweite. „Perfectio“ bedeutete Schöpfungsnähe und Richtigkeit, Vollkommenheit (laut Johann Georg Sulzer)2 „die Identität von dem, was sein soll und was sein muß.“ Es überrascht in diesem Zusammenhang kaum, daß bei dem wohl bedeutendsten deutschen Musikschriftsteller des frühen 18. Jahrhunderts, dem Frühaufklärer Johann Mattheson, der Vollkommenheitsbegriff letztlich zum Gegenstand seines theoretischen Hauptwerkes, Der vollkommene Capell-Meister (Hamburg 1739), wird. Auf dem Titelblatt bietet Mattheson eine Vignette der Concordia discors, „die vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten“, wie sie auch für Bach die Quintessenz der Musik darstellte. Denn die Harmonie der Welt verstand man als Concordia discors, eine zwieträchtige Eintracht, das heißt in einer durch die Polarität von gut und böse, richtig und falsch, mithin Gott und Teufel bestimmten Lebensordnung. Freilich bestand kein Zweifel darüber, wer Herr über die Ordnung war. Jede Dissonanz mußte harmonisch aufgelöst werden. Eine musikalische Komposition hatte mit einem vollkommenen Klang zu beginnen und zu schließen, ja – wenn sie regelgerecht gearbeitet war – mußte sie prinzipiell auf jedem schweren Taktteil eine Konsonanz bringen. Die Trias harmonica, der musikalische Dreiklang, das Fundament aller mehrstimmigen Musik, konnte gar dazu dienen, ein so schwer faßbares Abstractum wie die Trinität Gottes, das drei in eins, hörbar – das heißt intellektuell wie sinnlich erfahrbar zu machen. 1 2 Zitiert nach: Ph. Spitta, Johann Sebastian Bach, Bd. 2, Leipzig 1880, S. 916. Artikel „Vollkommenheit“, in J. G. Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste, IV, Leipzig 1779, S. 406–407. Bach und die Idee musikalischer Vollkommenheit Der „Trias harmonica“ überschriebene Kanon BWV 1072 impliziert in dieser Hinsicht weniger theologisches als musiktheoretisches Denken. Denn der Komponist stellt dar, wie der Dreiklang nicht ein primär vertikales Klanggebilde, sondern Kumulation kontrapunktischer Linien ist (achtstimmige doppelchörige Auflösung in Neue Bach-Ausgabe VIII/1, S. 12). &c .. œ. j œ œ. j œ œ. j œ œ. j .. œ & c .. œœœ ... j . œœ œœœ .. j . œœ œœœ .. j . œœ œœœ .. j .. œœ Notenbeispiel 1 Für Bach kann dieser Kanon gleichsam als musikalisches Credo gelten, indem er den Primat des Kontrapunktes (samt Imitation und Inversion) in der Satzlehre betont. Die Kompositionslehre des späteren 18. Jahrhunderts hielt sich nicht mehr an die normativen Prinzipien einer abstrakten Ars perfecta. Die Aufklärung propagierte in deutlichem Gegensatz zur barocken Tradition und mit anthropozentrischer Emphase nunmehr den Künstler als Originalgenie. Der Ansatz dazu entstammte den Naturwissenschaften, deren neuentdeckter Empirismus im 17. Jahrhundert das Bewußtsein des menschlichen Ingeniums erweckt hatte. So wurde insbesondere der Physiker Isaac Newton „zu einem bevorzugten Genie-Paradigma“3, und ein Dichter von so unzweifelhafter Autorität wie Shakespeare galt – in der Perspektive des 18. Jahrhunderts – als „berühmtes Beispiel eines aus eigener Kraft wirkenden Genies“4. Das in England zuerst entwickelte Konzept des Genies wurde damit zur Grundidee einer neuen ästhetischen Kunst, die in erster Linie nach Originalität strebte. Diderot, auf die künstlerische Einbildungskraft anspielend, spricht vom „freien Spiel des schöpferischen Genies“5. Denn das Originalgenie fragt nicht nach vorgegebenen Gesetzen; es gibt sich eigene Regeln. Wo zwischen den Polen Ars perfecta und Geniekunst ist nun Bach anzusiedeln, wo liegt sein geschichtlicher Ort? Um die Antwort, die es zu begründen gilt, vorwegzunehmen: Es scheint, als stünde Bach im Schnittpunkt der bei- 3 Vergleiche J. Schmitt, Die Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie und Politik 1750-1945, Bd. 1, Darmstadt 1985, S. 8. 4 W. Sharpe, Dissertation on Genius , London 1755; vergleiche B. Fabian, Art. „Genie“, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. von J. Ritter, Bd. 3, Basel 1974, Sp. 282. 5 Ebenda, Sp. 281. Christoph Wolff den Prinzipien, die so unvereinbar erscheinen. Es scheint, als verknüpfe er in nahezu singulärer Weise die beiden Pole. Vollkommenheit auf der einen und Einzigartigkeit auf der anderen Seite treten denn auch frühzeitig als gegensätzliche wie sich ergänzende Begriffe auf, mit denen man sich dem Phänomen Bach zu nähern versuchte. Die Idee der Vollkommenheit führte Johann Abraham Birnbaum 1737 in die Diskussion ein6 und öffnete damit zugleich den Blick auf eine historisch-theoretische Dimension von Bachs Kunst. Die Vorstellung von Einzigartigkeit geht auf Bemerkungen Carl Philipp Emanuel Bachs bzw. Johann Friedrich Agricolas von 1750 zurück7, die damit ausdrücklich Individualität und Originalität der Musik Johann Sebastian Bachs ansprechen. II Der Suche nach der spezifischen Qualitas der Bachschen Musik, ja ihrer unverwechselbaren Eigenart, läßt sich kaum sinnvoll mit Methoden der Schaffenspsychologie begegnen. Schon allein mangels dokumentierter einschlägiger Selbstäußerungen entzieht sich Bach – in deutlichem Unterschied etwa zu Mozart, Beethoven, Wagner oder Mahler – jedwedem psycho-biographischen Zugriff. Doch widersetzt er sich keineswegs Fragen nach den allgemeinen Prämissen, historischen Voraussetzungen und Grundlagen der Kompositionspraxis. Auch über Persönlichkeit und biographischen Kontext läßt sich genügend Auskunft gewinnen. Insbesondere vermag das Studium der Genese einzelner Werke oder der Entstehungsbedingungen größerer Repertoires dazu beizutragen, gewisse kompositorische Parameter und künstlerische Konstanten aufzudecken. Es läßt sich nicht übersehen, daß Bach als Komponist in vieler Hinsicht für seine Zeit kaum als repräsentativ gelten kann. Seine Musik ist das höchst ungewöhnliche Produkt einer überaus starken und eigenwilligen Künstlerpersönlichkeit. In den rund fünfzig Jahren seiner schöpferischen Tätigkeit durchmaß Bach einen Entwicklungsprozeß, der unter seinen Zeitgenossen ohne Parallele ist. Dabei spielen Kontinuität und Wandel eine gleichbleibend determinierende Rolle. 6 Unpartheyische Anmerkungen... [1738] und Vertheidigung seiner unparteyischen Anmerkungen... [1739], zitiert nach: Bach-Dokumente, Bd. II (Fremdschriftliche und gedruckte Dokumente zur Lebensgeschichte Johann Sebastian Bachs 1685–1750), Kassel Basel 1969, Nr. 409 und 441. 7 Denkmal... [1754 gedruckt], in: Bach-Dokumente, Bd. III (Dokumente zum Nachwirken Johann Sebastian Bachs 1750–1800), Kassel Basel 1972, Nr. 666. Bach und die Idee musikalischer Vollkommenheit Als wesentlicher Eckpfeiler der Kontinuität in Bachs Musik erscheint von Anfang an der kompromißlos professionelle Zuschnitt. Bach hat sich nie dem musikalischen Dilettanten zugewandt. Sein Virtuosentum (nicht zufällig betrauert das Gedicht am Schluß des Nekrologs den „Held der Virtuosen“)8 war über Generationen hinweg fest in der zünftigen Familientradition verwurzelt und schlug sich niemals vordergründig in dem gleichmäßig hohen, für das 18. Jahrhundert durchweg extrem anspruchsvollen technischen Schwierigkeitsgrad seiner Werke nieder. Als entscheidender Faktor des Wandels in Bachs musikalischer Entwicklung gilt ein – trotz aller geographischen Beschränkung – grenzenloser Wissensdurst im Blick auf praktisch alle Aspekte der Kompositionskunst. Bachs Kenntnis der Musikliteratur seiner Tage und auch der zurückliegenden Generation war schlechterdings beispiellos, vor allem auch in der Art, wie er neu gewonnene Erkenntnisse als veränderndes und bereicherndes Moment in sein eigenes Komponieren zu integrieren verstand. Überblickt man die chronologische Spannweite des Bachschen Schaffens, so zeigt sich von den frühesten bis zu den letzten Werken ein ebenso weites wie differenziertes stilistisches Spektrum, gleichermaßen das Instrumentalund Vokalwerk betreffend: Man vergleiche nur das „Capriccio sopra la lontananza del suo fratro dilettissimo“ BWV 992 mit der Kunst der Fuge oder den „Actus tragicus“ BWV 106 mit der h-Moll-Messe. Demgegenüber wirkt der Entwicklungsspielraum eines Telemann oder Händel erheblich schmaler. Wenn man beispielsweise Händels früheste Opern und seine letzten Oratorien als repräsentative Pole seines Lebenswerkes ansieht, so stehen sich diese kompositionstechnisch und stilistisch sehr viel näher, als es die frühen und späten Werke Bachs tun. So fällt es aus heutiger Perspektive nicht schwer, Bach unter den Musikern seiner Zeit eine Sonderstellung einzuräumen. Doch besaß man im engeren Kreis um Bach schon zu seinen Lebzeiten eine ziemlich klare Vorstellung davon. Wenden wir uns den einschlägigen Quellen zu: Die berühmte literarische Kontroverse über die ästhetische Einschätzung der Kunst Bachs, ausgefochten zwischen Johann Adolph Scheibe und Johann Abraham Birnbaum in den Jahren 1737–38, entzündete sich daran, daß Scheibe Bachs Musik Verworrenheit, Mangel an Natürlichkeit und das Fehlen einer deutlich hörbaren Hauptstimme vorwarf. Es ist hier nicht der Ort, diese – im übrigen viel diskutierte – Kontroverse in ihren komplizierten Verästelungen erneut näher zu verfolgen9. Mir 8 Ebenda, Nr. 666. 9 Vergleiche G. Wagner, J. A. Scheibe – J. S. Bach: Versuch einer Bewertung, in: BachJahrbuch 1982, S. 33–49. Christoph Wolff geht es lediglich um das entscheidende Stichwort, das in diesem Zusammenhang fällt, nämlich das der musikalischen Vollkommenheit. Der eigentliche Grund für das Unverständnis Scheibes gegenüber Birnbaums Argumentation sowie für dessen – und Bachs – kompromißlose Haltung liegt in dem deklarierten Vollkommenheitsanspruch der Bachschen Musik. Der Begriff „Vollkommenheit“ taucht mehrfach bei Birnbaum auf und gipfelt in dem apodiktischen Hinweis auf „die Sonderbaren Vollkommenheiten des Herrn Hofcompositeurs“ Bach10. Dieser lapidare Verweis auf „die sonderbaren (das heißt unverwechselbaren, andersartigen) Vollkommenheiten“ Bachs war für einen Regelstreit denkbar ungeeignet. Birnbaum bezog freilich die Legitimation daraus, daß er Bach bewußt geschichtlich einordnete und dessen Prinzipien der Polyphonie und Harmonie gegenüber dem modischen Trend der modernen Skribenten mit Komponistennamen wie de Grigny, du Mage, Lotti und Palestrina zusammenbrachte. Übrigens gibt Birnbaum mit diesem Querverweis auf Repertoires in Bachs Notenbibliothek deutlich zu erkennen, daß seine Argumentation von niemand anderem als Bach selbst diktiert wurde und er lediglich als dessen literarisches Organ fungierte. So verdanken wir dem Leipziger Rhetorik-Dozenten eine überaus poetische Charakterisierung der Bachschen Polyphonie, wenn er beschreibt, wie die stimmen in den stücken dieses großen meisters in der Music wundersam durcheinander arbeiten: allein alle ohne die geringste Verwirrung. Sie gehen miteinander und widereinander; beydes wo es nöthig ist. Sie verlassen einander und finden sich doch alle zu rechter zeit wieder zusammen. Jede stimme macht sich vor der andern durch eine besondere veränderung kenntbar, ob sie gleich öfftermahls einander nachahmen. Sie fliehen und folgen einander, ohne daß man bey ihren beschäfftigungen, einander gleichsam zuvorzukommen, die geringste unregelmässigkeit bemercket. Wird dies alles so, wie es seyn soll, zur execution gebracht; so ist nichts schöners, als diese harmonie11. Bach sieht die Grundlagen der Harmonie – im Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts allgemein für Setzkunst stehend – als naturgegeben und seine Aufgabe darin, „eben dieses natürliche, durch hülffe der kunst, in dem prächtigsten ansehen der welt vorzustellen... Je größer nun die kunst ist, das ist, je fleißiger und sorgfältiger sie an der ausbeßerung der natur arbeitet, desto vollkommener glänzt die dadurch hervorgebrachte schönheit. Folglich ist es wiederum unmöglich, daß die allergrößte kunst die schönheit... verdunckeln könne“12. 10 Bach-Dokumente, Bd. 2, a. a. O., S. 349. 11 Ebenda, S. 302. 12 Ebenda, S. 303. Bach und die Idee musikalischer Vollkommenheit Schließlich sei auf diese Weise „Einsicht in die Tiefen der Weltweisheit“ zu gewinnen. Der Begriff „Weltweisheit,“ in der deutschen Frühaufklärung als Synonym für Philosophie verstanden, gemahnt an das 1732 erschienene Hauptwerk des Leipziger Universitätsprofessors Johann Christoph Gottscheds13, der gelegentlich als Textdichter für Bach wirkte. Nach Gottsched hilft die Weltweisheit – synonym mit Philosophie – zu ergründen, „wie, warum und wozu die Dinge sind“14. Damit wäre denn auch zugleich Bachs Verständnis musikalischer Wissenschaft bzw. musikalischen Denkens definiert, insbesondere seine Anwendung von angeblich „trocken scheinenden Kunststücken“15. Die Naturgegebenheit der Harmonie macht den Komponisten zum Entdecker. Denn es geht nicht vornehmlich darum, wie Scheibe als Advokat der von Birnbaum als „Skribenten“ abgekanzelten modernen Komponisten es fordert, zu einer Hauptstimme lediglich Begleitstimmen zu setzen. So schreibt Birnbaum: Vielmehr fließt das gegentheil aus dem wesen der Music. Denn dieses besteht in der harmonie. Die harmonie wird weit vollkommener, wenn alle stimmen miteinander arbeiten. Folglich ist eben dieses kein fehler, sondern eine musicalische Vollkommenheit16. Vollkommenheit ist das Ziel, das erreicht werden mag, wenn mit Hilfe „der allergrößten Kunst“ die Schönheit und das Natürliche vorgestellt werden kann. Vollkommenheit impliziert das Wissen um „die verstecktesten Geheimnisse der Harmonie“. Diese dem 17. Jahrhundert entstammende Konzeption einer vorgegebenen und nur zu entdeckenden Wirklichkeit findet ihr Korrelat nicht nur im theologischem Bereich, sondern auch in der antik-rhetorischen „Dichotomie von ingenium und studium“ als denjenigen Fähigkeiten, „die der Dichter vor aller Regelkenntnis von Natur aus mitbringt“17. Dem von Birnbaum vertretenen Vollkommenheitsanspruch der Bachschen Musik tritt in dem 1750, wenige Monate nach Bachs Tod von seinem zweitältesten Sohn und seinem Schüler Agricola verfaßten Nekrolog ein Absolutheitsanspruch zur Seite. Apostrophiert mit den Worten „Hat jemals ein Componist...“ wird darauf hingewiesen, daß Bachs Musik „keinem andern Componisten ähnlich“ sei18. Ein solches Urteil steht musikgeschichtlich wohl ohne 13 Erste Gründe der gesammten Weltweisheit, Leipzig 1733. 14 W. Schneiders, Art. „Philosophie“, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 7, Basel 1989, Sp. 711–713. 15 Bach-Dokumente, Bd. 3, a. a. O., S. 87. 16 Bach-Dokumente, Bd. 2, a. a. O., S. 305. 17 R. Warning, Art. „Genie“, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, a. a. O., Sp. 279. 18 Bach-Dokumente, Bd. 3, a. a. O., S. 87. Christoph Wolff Vorbild da. Andersartigkeit bzw. Einzigartigkeit vor und um 1750 als Kriterium für die Einschätzung der Bachschen Musik gebraucht, nimmt denn auch in der Tat die Terminologie der Genieästhetik des späteren 18. Jahrhunderts vorweg. Schon Marpurg bescheinigt Bach 1749 „besonderen Originalgeschmack, keinen aus der Nachahmung einer fremden Nation entstandenen Geschmack“19. Eine Aussage Christian Friedrich Daniel Schubarts von 1784–85 übertrifft dies noch an Deutlichkeit: „Sebastian Bach war ein Genie im höchsten Grade. Sein Geist ist so eigenthümlich, so riesenförmig, daß Jahrhunderte erfordert werden, bis er einmal erreicht wird.“ Schubart spricht überdies ausdrücklich davon, „daß man das Originalgenie eines Bachs nicht verkennen kann“20. Der Begriff des Originalgenies ist hier neu, sein auf Bach bezogener Inhalt nicht. Und es scheint, daß für den musikalischen Bereich der Genieästhetik Bach eine Schlüsselrolle zugewiesen werden muß, deren formative Ansätze bereits vor 1750 greifbar werden. Wie aber läßt sich nun die Einzigartigkeit, das Originelle oder Individuelle der Bachschen Musik fassen? Die allgemeinen Aspekte können wohl kaum präziser und bündiger formuliert werden als im Nekrolog selbst: Hat jemals ein Componist die Vollstimmigkeit in ihrer größten Stärke gezeiget; so war es gewiß unser seeliger Bach. Hat jemals ein Tonkünstler die verstecktesten Geheimnisse der Harmonie in die künstlichste Ausübung gebracht; so war es gewiß unser Bach. Keiner hat bey diesen sonst trocken scheinenden Kunststücken so viele Erfindungsvolle und fremde Gedanken angebracht, als eben er. Er durfte nur irgend einen Hauptsatz gehöret haben, um fast alles, was nur künstliches darüber hervor gebracht werden konnte, gleichsam im Augenblicke gegenwärtig zu haben. Seine Melodien waren zwar sonderbar; doch immer verschieden, Erfindungsreich, und keinem andern Componisten ähnlich21. Nach Aussage des Nekrologs besteht die zentrale Qualität der Bachschen Musik in ihrer „Vollstimmigkeit“, das heißt in ihrer harmonisch-polyphonen Konzeption. Ihre Individualität jedoch gewann sie insbesondere aus Bachs Umgang mit den „verstecktesten Geheimnissen der Harmonie“, basierend auf intimster Vertrautheit mit „der vollstimmigen Setz-Kunst, so man eigentlich Harmonie heißt“. In Ermangelung eines erst später am Konzept des Originalgenies entwikkelten Begriffsystems konnte die Eigenart der Bachschen Musik vor 1750 nur unvollständig umschrieben werden. So spricht der Nekrolog von „fremden Gedanken“ oder davon, daß Bachs Melodien „sonderbar“, „immer verschie- 19 Bach-Dokumente, Bd. 2, a. a. O., S. 461. 20 Bach-Dokumente, Bd. 3, a. a. O., S. 408 f. 21 Ebenda, S. 87. Bach und die Idee musikalischer Vollkommenheit den“ und „erfindungsreich“, das heißt „keinem andern Componisten ähnlich“ seien. Birnbaum rühmt „die erstaunliche Menge seltener und wohlausgeführter einfälle“. Damit ist nicht die traditionelle Inventionskunst (Erfindungskunst) mit ihrer sich an musikalisch-rhetorischen Modellen orientierenden Entwicklung von Themen und Melodien gemeint. Bachs Inventionskunst bewegte sich deutlich weg von der Tradition in Richtung Originalschöpfung, doch nicht einer voraussetzungslosen. So wie Bach die Harmonie als naturgegeben versteht, deren Geheimnisse es auszuschöpfen gilt, so orientieren sich seine Einfälle immer wieder an gegebenen Vorwürfen. Sie scheinen mindestens gelegentlich gar der Herausforderung zu bedürfen. In diesem Zusammenhang ist eine 1741 von einem gewissen Leipziger Magister Pitschel überlieferte Beobachtung aufschlußreich: Sie wissen, der berühmte Mann, welcher in unserer Stadt das größte Lob der Musik, und die Bewunderung der Kenner hat, kömmt, wie man sagt, nicht eher in der Stadt, durch die Vermischung seiner Töne andere in Entzückung zu setzen, als bis er etwas vom Blatte gespielt, und seine Einbildungskraft in Bewegung gesetzt hat. Der geschickte Mann... hat ordentlich etwas schlechteres vom Blatte zu spielen, als seine eigenen Einfälle sind. Und dennoch sind diese seine besseren Einfälle Folgen jener schlechteren22. Nun wird man gewiß nicht generalisieren dürfen und auf Grund dieses Hinweises weitreichende Schlüsse ziehen wollen. Dennoch scheint sich hier eine Tendenz anzudeuten, die für Bachs Kompositionsweise und die Eigenart seiner Musik überaus charakteristisch zu sein scheint. Es geht um das Prinzip der Veränderung vorgefundenen Materials im Sinne seiner weiteren Ausschöpfung, eben im Sinne der Entdeckung der „verstecktesten Geheimnisse der Harmonie“. Als einer, der im wesentlichen kompositorischer Autodidakt war, hatte Bach (laut Nekrolog) die entsprechenden Erfahrungen „größtenteils nur durch das Betrachten der Wercke der damaligen berühmten und gründlichen Componisten und angewandtes eigenes Nachsinnen erlernt“23. Dazu heißt es später noch bei Carl Philipp Emanuel Bach: „Blos eigenes Nachsinnen hat ihn schon in seiner Jugend zum reinen u. starcken Fugisten gemacht“24. Zum traditionellen Studium der Exempla classica trat bei Bach das „eigene Nachsinnen“, und zwar vor allem im Blick auf das Erlernen der Fugenkomposition. Von Anfang an muß die Komposition eines Satzes als kontrapunktische Entwicklung eines Themas für Bach von brennendem Interesse gewesen sein. 22 Bach-Dokumente, Bd. 2, a. a. O., S. 397. 23 Bach-Dokumente, Bd. 3, a. a. O., S. 82. 24 Ebenda, S. 288. Christoph Wolff Beispiel 2: Thematische Vorlage aus Johann Adam Reinken, Sonata in a für 2 Violinen, Viola und Basso continuo (Hortus musicus, 1687) von Bach – unter Eliminierung nichtthematischer Attribute wie des Basso continuo – zu einer regulären Clavier-Fuge a-Moll BWV 965/2 ausgearbeitet. Die Bach im Nekrolog bescheinigte Fähigkeit, daß er beim bloßen Anhören irgendeines Themas „fast alles, was nur künstliches darüber hervorgebracht werden konnte, gleichsam im Augenblicke gegenwärtig“25 hatte, erscheint überaus bezeichnend für seine Arbeitsweise, die sich mehr als Elaboratio (das heißt Ausarbeitung von Vorgegebenem) und weniger als Creatio (das heißt eigenschöpferischen Akt) verstand: Die Möglichkeiten zur „künstlichen Ausarbeitung“ waren latent gegeben, sie mußten lediglich „durch Nachsinnen“ entdeckt werden. Bei Bachs offensichtlich phänomenaler Kombinationsgabe konnte es darum keinen Unterschied machen, ob ein Thema von ihm selbst oder einem anderen Komponisten stammte. In jedem Fall mußte er es als Herausforderung zum Auffinden der innewohnenden kontrapunktischen Potenz empfinden. Augenscheinlich liegt in diesem Elaborationsprinzip eine der wesentlichen, noch dazu gattungunabhängigen Konstanten der Bachschen Kompositionskunst und damit seines Personalstiles vor. Sie ist zutiefst verwurzelt im Streben nach Aufdecken der „Geheimnisse der Harmonie“, in der Suche nach der „vollkommenen Harmonie“. Diese aber gilt erst dann als vollkommen, wenn „alle Stimmen miteinander arbeiten“, und zwar „ohne die geringste Verwirrung“; „jede stimme macht sich vor der andern durch eine besondere veränderung kenntbar, ob sie gleich öfftermahls einander nachahmen.“ Der Variationsgedanke spielt in diesem Elaborationsprinzip eine gewichtige Rolle. Nicht nur, daß die Imitationsdurchführung einer Fuge im Sinne von Veränderungen verstanden wird (Birnbaum rühmt „die durchführungen eines einzigen satzes durch die thone, mit den angenehmsten veränderungen“). Auch die enge konzeptionelle Verknüpfung von Variation und Elaboration in den monothematischen Instrumentalzyklen des Bachschen Spätwerkes deutet auf die weitgehende Substanzgemeinschaft der beiden Begriffe in Bachs kompositorischem Denken. Wiederholte Elaboration desselben musikalischen Gedankens zur Auslotung der immanenten harmonischen Konstellationen führt geradezu zwangsläufig zu einer Kette von Variationen. Beispiel 3: Georg Friedrich Händels Chaconne G-Dur HWV 442, deren 62 Variationen in einen schlichten zweistimmigen Kanon münden, verglichen mit der tiefschürfenden Kontrapunktik in Bachs Kanon-Zyklus BWV 1087, in dem Bach die kanonische Potenz des „Händel-Themas“ auslotet26. 25 26 Ebenda, S. 87. Vergleiche vom Verfasser, Händel – J. S. Bach – C. P. E. Bach – Mozart: in: Göttinger Händel-Beiträge, Bd. 6, im Druck. Bach und die Idee musikalischer Vollkommenheit Unter Variationsgedanken und Elaborationsprinzip läßt sich auch Bachs Bearbeitungstechnik fassen (unabhängig davon, ob die Vorlage eigenen oder fremden Ursprungs ist), vor allem aber die Parodiepraxis. Der Bearbeitungs- und Parodievorgang setzt voraus, daß verändernde – und damit zugleich bereichernde – Elaboration möglich und (aus welchem Grunde auch immer) notwendig erscheint. Parodie als Variation verstanden, das heißt als Elaboration der unausgeschöpften immanenten musikalischen Potenz, dürfte dem Bachschen Ansatz nahekommen. In dieses Elaborationsprinzip einbeziehen läßt sich auch die wiederholte Bearbeitung bzw. Harmonisierung eines Cantus firmus (vom Choralsatz im Stylus simplex über das Choralpräludium bis hin zum komplexen Choralsatz). Beeinflußt wird von ihm auch Bachs Denken in Serien und Werkgruppen, das heißt die Erprobung einer Idee in mehrfacher und verschiedener Ausführung (vergleiche u.a. Orgelbüchlein, Violin- und Violoncello-Soli, ChoralkantatenJahrgang, Clavier-Übungen). Schließlich erfaßt es Revision und beständiges Korrigieren fertiggestellter Werke, ein für Bach besonders typisches Vorkommnis: All dies ist letztlich nichts anderes als ein Zeichen dafür, daß Bach immer wieder Grund für die Suche nach besseren Alternativen hat. Dieser Grund wiederum kann nur in seinem Vollkommenheitsstreben gefunden werden, das den Impetus für fortwährende Elaboration abgibt. Beispiel 4: Anfang des Eingangssatzes der Choralkantate „Es ist das Heil uns kommen her“ BWV 9 mit zwei aufeinander bezogenen Elaborationen eines instrumentalen Concertato-Komplexes: Orchester-Ritornell ohne Cantus firmus, T. 1 ff., gefolgt von einer nahezu wörtlichen Wiederholung desselben Satzes mit Cantus firmus und „Choreinbau“, T. 24 ff. Nun kann es nicht darum gehen, Bachs Kompositionsverhalten auf eine simple Formel reduzieren zu wollen. Doch es bietet sich an, das mit dem Variationsgedanken verknüpfte Elaborationsprinzip als einen jener entscheidenden Parameter anzusehen, der Bachs Musik ihr charakteristisches Profil verleiht. Selbst dieses aber ist nur ein Schritt auf dem Wege zur Erklärung ihrer individuellen Eigenart. Es ist müßig zu fragen, ob Bach selbst seinen Werken Vollkommenheit bescheinigt hätte. Doch daß ihm Vollkommenheit – im Sinne von durch größte Kunst der Natur abgewonnene Schönheit – als musikalisches Ziel vor Augen schwebte, steht außer Zweifel. Der Begriff der Vollkommenheit kann von Birnbaum nicht grundlos zum Tenor der Diskussion erhoben worden sein. Wie steht es aber mit dem Prädikat „sonderbar“, das heißt einzigartig? Daß sich Bach der Einzigartigkeit und des unverwechselbaren Charakters seiner Musik bewußt gewesen wäre, läßt sich kaum belegen, muß aber dennoch quasi stillschweigend vorausgesetzt werden. Dafür spricht nicht nur die offensichtliche, im Kontext des damaligen sozialgeschichtlichen Umfeldes frappierende Selbstsicherheit, wie sie aus Bachs Lebensweg und seinen Verhaltens Christoph Wolff weisen gerade auch im Blick auf die Sicherung künstlerischen Spielraumes ablesbar erscheint. Ins Gewicht fällt vornehmlich seine Überzeugung, primär „Soli Deo Gloria“ zu arbeiten, und dies auf der Basis einer höchst ungewöhnlichen Vertrautheit mit dem breiten Spektrum der Musik seiner Zeit sowie mit zahlreichen Kompositionen aus zurückliegenden Epochen. Bach konnte nicht verborgen bleiben, daß seine Orgel- und Klavierwerke, die Kantaten und vokalen Großwerke wie auch die instrumentalen Ensemblewerke insgesamt, aber auch jeweils für sich genommen, ohne eigentliche Parallelen dastanden. So mußte er wissen, daß es etwa zur Matthäus-Passion kein Vorbild gab. Diese Beispiellosigkeit mußte als Ansporn für das diesen Werken innewohnende Höchstmaß an künstlicher Ausarbeitung gelten. Dem Grad der Ausarbeitung und musikalischen Vollendung bzw. Vollkommenheit steht oft als Korrelat die Drucklegung oder reinschriftmäßige Fixierung gegenüber. Daß Bach dies bei den Großwerken wie etwa der MatthäusPassion oder der h-Moll-Messe mit besonderer Sorgfalt betrieb – wie seine Reinschriften erweisen – kann wohl mindestens teilweise als Zeichen der Anerkennung ihres historischen Ranges und als Maßnahme zur Bewahrung für die Nachwelt verstanden werden. Mitgespielt haben muß freilich auch die Erfahrung des uralten Plotinschen Dilemmas zwischen Vollendung der Idee und Vollendung der Ausführung. Nur so läßt sich folgende Stelle bei Birnbaum erklären: Allein urtheilt man von der Composition eines Stücks nicht am ersten und meisten nach dem, wie man es bey der Aufführung befindet. Soll aber dieses Urtheil, welches allerdings betrieglich seyn kann, nicht in Betrachtung gezogen werden: so sehe ich keinen andern Weg davon ein Urtheil zu fällen, als man muß die Arbeit, wie sie in Noten gesetzt ist, ansehen27. „Die Arbeit, wie sie in Noten gesetzt ist, ansehen“ – dieser wohl ebenfalls von Bach selbst stammende Ausspruch weist auf den Wert des Notentextes für sich genommen, das heißt abgesehen von der konkreten Aufführung. Der schriftliche Notentext bietet nicht nur die einzige wirklich verläßliche Dokumentation der „sonderbaren Vollkommenheiten“, sondern auch das entscheidende Medium der geschichtlichen Überlieferung, die Komposition als vollendete Idee zu erkennen – und zwar im Bewußtsein der dialektischen Spannung von Bindung an die Prinzipien einer göttlichen Ars perfecta und Freiheit des in diesem Bewegungsspielraum operierenden menschlichen künstlerischen Geistes. 27 Bach-Dokumente, Bd. 2, a. a. O., S. 355. Bach und die Idee musikalischer Vollkommenheit III Es ist letztlich nur die Idee selbst, die wirkliche Vollkommenheit beanspruchen kann. Bach war sich dessen offensichtlich bewußt, – darum die behutsame Differenzierung von Schriftbild und Aufführung. Es ist schließlich auch nur die Idee, die zum Ideal werden kann. Aber Bach statuierte mit seiner Musik – im wahrsten Sinne des Wortes – ein Exempel, und dies nicht zuletzt durch sein ausgedehntes pädagogisches Wirken und den Einfluß seiner Schüler, darunter neben seinem Sohn in Carl Philipp Emanuel insbesondere Nichelmann, Agricola, Mizler und Kirnberger als die namhaftesten Theoretiker in Deutschland. Bachs Musik war aufgrund ihrer wissenschaftlichen Qualität in besonderer Weise theoriefähig, das heißt sie konnte zur Theoriebildung führen. So fungieren beispielsweise der Bach-Choral oder die Bach-Fuge bis heute als verbindliche Muster der Harmonie- und Kontrapunktlehre. Dieser Aspekt hat entscheidend die Tiefen- wie Breitenwirkung in der Rezeptionsgeschichte der Bachschen Musik beeinflußt, ließ sie frühzeitig zum Ideal werden, ein Prozeß, der um 1750 einsetzte, für die kompositionstechnischen Grundlagen der Wiener Klassik Haydns, Mozarts und Beethovens wichtige Voraussetzung bot, für das Konzept der absoluten Musik wie des autonomen Kunstwerkes – wie Carl Dahlhaus gezeigt hat28 – entscheidende Impulse gab, und insgesamt die Zukunft der Musik nachhaltig geprägt hat. Pointiert formuliert, stellte Bach der Prima pratica des 16. Jahrhunderts und der Seconda pratica des 17. Jahrhunderts eine Terza pratica zur Seite. Da Bachs Musik die Idee musikalischer Vollkommenheit aufs Überzeugendste repräsentierte, gewann sie frühzeitig paradigmatische Bedeutung für die nachfolgenden Generationen. Daß Bachs Kunst jedoch als beispielgebend in einer Zeit, die das Originalgenie pries, akzeptiert werden konnte, verdankt sie vornehmlich ihrem überaus individuellen Gepräge. In der Anders- und Einzigartigkeit der Bachschen Musik – auch gerade gegenüber der Qualität der Musik Händels, die sich sehr viel weniger scharf aus ihrem Kontext heraushebt – bestand ein entscheidendes Element, das sich mit dem Prinzip der Vollkommenheit verband. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Wirkungsgeschichte Bachs deutlich etwa von der Tradition des Palestrinastils. Zielte diese in erster Linie auf normative Gesichtspunkte, die eine genaue Stilkopie ermöglichte, so vereinigte sich in der Bach-Rezeption stets das Regelhafte mit dem Individuellen. In diesem Sinne nahm Bachs Musik schon im späten 18. Jahrhundert entscheidenden Einfluß, etwa auf den Kompositionsstil Mo- 28 C. Dahlhaus, Zur Entstehung der romantischen Bach-Deutung, in: Bach-Jahrbuch 1978, S. 192–210. Christoph Wolff zarts nach 1782 (zum Beispiel im Finale des Quartetts KV 387) oder auf Beethoven, der bereits mit Bachs Wohltemperiertem Clavier aufwuchs. Im 19. Jahrhundert griff die Bach-Rezeption auf praktisch sämtliche musikalische Gattungen einschließlich Oper über (man denke hier an Richard Wagners Charakterisierung des Meistersinger-Vorspiels als „angewandter Bach“)29. Bachs Musik wurde zum Orientierungsmaß, zum Muster für die Lösung des Problems, selbst bei Bindung an altüberlieferte Traditionen der KompositionsTechnik zu individuellen Lösungen vorzustoßen. Auch scheint es für die Auswirkungen der Bachschen Musik charakteristisch zu sein, daß sie nicht nur grenzüberschreitend, sondern auch „überparteilich“ war. Man denke nur an die Bedeutung von Bachs Kunst für so unterschiedliche, ja gegensätzliche Geister unseres Jahrhunderts wie Schönberg, Strawinsky, Bartók oder Hindemith. Der wissenschaftliche Charakter von Bachs Kunst – nicht umsonst nannte Bach sein Handwerk „musikalische Wissenschaft“ – gründet sich auf die Prinzipien der forschenden Auslotung von Harmonie und Kontrapunkt und machte sie damit zum entscheidenden Ausgangspunkt für theoretische Reflexion bis zum heutigen Tag. Doch ist die theoretische Dimension schließlich nur eine, wenngleich wesentliche Komponente der vielschichtigen Qualitäten Bachscher Musik, deren logisch-komplexe Struktur und Ausdruckskraft unmittelbar jeden Hörer erreichen. Insbesondere läßt sich die exemplarische Kraft Bachscher Musik kaum allein ableiten vom schöpferischen Drang eines Originalgenies, sondern eben auch von der Bindung an ein Denken, in dem musikalische Komposition der Vollkommenheit einer naturgegebenen Ordnung nacheifert. Die Dialektik von göttlicher Vollkommenheit und menschlicher Originalität, wie sie sich in Bachs Werk manifestiert, hat kaum jemand treffender, wenngleich in romantischer Diktion, formuliert als Johann Nicolaus Forkel am Schluß seiner Biographie von 1802: Dem wahren Kunstgeist muß es verdankt werden, daß Bach mit seinem großen und erhabenen Kunststyl auch die feinste Zierlichkeit und höchste Genauigkeit der einzelnen Theile, woraus die große Masse zusammengesetzt ist, verband, die man sonst hier nicht für notwendig hält, als in Werken, bey welchen es bloß auf Schönheit abgesehen ist; daß er glaubte, das große Ganze könne nicht vollkommen werden, wenn den einzelnen Theilen desselben irgendetwas an der höchsten Genauigkeit fehle; und daß endlich, wenn er, ungeachtet der Hauptrichtung seines Genies zum Großen und Erhabenen, dennoch bisweilen munter und sogar scherzend setzte und spielte, seine Fröhlichkeit der Scherz des Weisen war. 29 C. Dahlhaus, Wagner und Bach, in: Programmhefte der Bayreuther Festspiele 1985, S. 1–18. Bach und die Idee musikalischer Vollkommenheit Nur durch diese Vereinigung des größten Genies mit dem unermüdetsten Studium vermochte Johann Sebastian Bach das Gebiet der Kunst überall, wohin er sich wandte, so ansehnlich zu erweitern, daß seine Nachkommen nicht einmahl im Stande waren, dieses erweiterte Gebiet in seiner ganzen Ausdehnung zu behaupten; nur dadurch konnte er so zahlreich und vollendete Kunstwerke hervorbringen, die sämtlich wahre Ideale und unvergängliche Muster der Kunst sind und ewig bleiben werden30. 30 J. N. Forkel, Ueber Johann Seabstian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke, Leipzig 1802, S. 68 f.