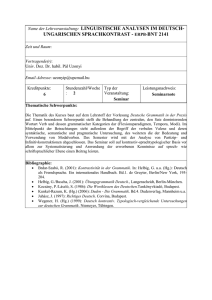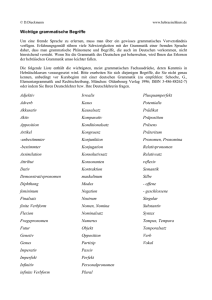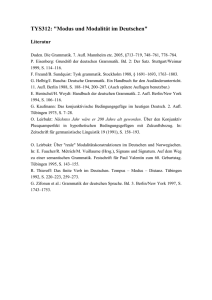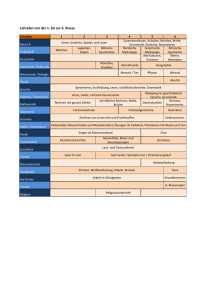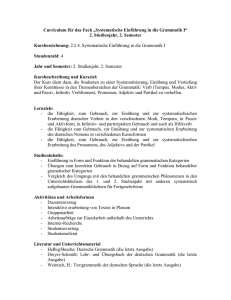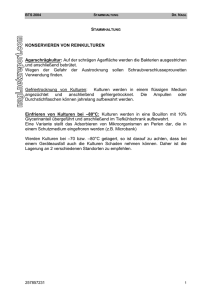0 Deckblatt_letzte Version\374
Werbung

Vorwort Lutz Götze Kulturkontrastive Grammatik – ein neuer Ansatz in Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung Resümee Während Kontrastive Grammatiken seit sehr langer Zeit existieren – also Vergleiche zweier oder mehrerer Sprachen mit linguistischen Mitteln –, sind Überlegungen zu Kulturkontrastiven Grammatiken neu. Grundlagen liefern sowohl Ideen Wilhelm von Humboldts zur unterschiedlichen Weltansicht, die in verschiedenen Sprachen deutlich wird, Gedanken Ernst Cassirers zur Symbolkraft der Sprache und Karl Bühlers Überlegungen zum Organon-Modell einerseits wie andererseits – in der Nachfolge des sowie Auseinandersetzung mit dem sprachlichen Determinismus der Sapir-Whorf-Hypothese – amerikanische Forschungsrichtungen der Kognitiven Anthropologie und Ethnosemantik, deren Vertreter vor allem Dell Hymes, John Gumperz und Erving Goffman sind. Eine Kulturkontrastive Grammatik in unserem Sinne vergleicht die deutsche Sprache mit europäischen, afrikanischen und asiatischen Sprachen nicht lediglich linguistisch, sondern vor dem Hintergrund kultureller Wurzeln und Traditionen, Entwicklungen und Normen, die die sprachlichen Ausdrucksmittel prägen und unterschiedliche Weltansichten bedingen. Diese Forschungen sind für das differenzierte Verstehen von Kulturen unerlässlich und zugleich Grundlage der Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache überall auf der Welt. Kontrastive Grammatiken gibt es seit langer Zeit: Sprachvergleiche und Reflexionen über Sprachen wurden seit mehr als 2000 Jahren bei den Ägyptern, Griechen, Indern und anderen Kulturen betrieben (Rein 1983, 7). Der Vergleich diente im Regelfall praktischen Zwecken: Mithilfe der Gegenüberstellung zweier oder mehrerer Sprachen sollten Ähnlichkeiten und Unterschiede ermittelt und zum Studium der jeweils anderen Sprache herangezogen werden. Neben den Wortvergleichen gab es aber bereits in der frühen Neuzeit das deutsch-italienische Sprachlernwerk von Georg von Nürnberg, das syntaktische Probleme beim Vergleich beider Sprachen behandelte und Deutsch- wie Italienisch-Lernenden von Nutzen war (Glück 2002). Einen ersten Höhepunkt erreichte der Sprachvergleich in Deutschland in der historisch vergleichenden Sprachwissenschaft, zumal in den Arbeiten Franz Bopps, der verwandte Strukturen zwischen dem Sanskrit und europäischen sowie weite- VII Vorwort ren asiatischen Sprachen aufdeckte und zum Begründer des Systems der indoeuropäischen Sprachen wurde. Einen zweiten Höhepunkt erlebte der strukturelle Sprachvergleich durch die in der Nachfolge Ferdinand de Saussures entwickelten Zweitspracherwerbstheorien. Deren erste und ungemein folgenreiche, die Kontrastivhypothese, besagte in ihrer ursprünglichen Fassung, dass Sprachen, die insgesamt oder in Teilen stark voneinander abwichen – also kontrastierten – als Fremdsprachen schwer zu erlernen seien und entsprechend beim Lernenden erhebliche Fehlermengen verursachten. Umgekehrt seien im Ganzen oder in Teilen strukturidentische oder zumindest ähnliche Sprachen als Fremdsprachen leichter zu erlernen und die Zahl der Fehler sei entsprechend gering. In einer rigiden Weiterentwicklung dieser Hypothese wurde sogar behauptet, aufgrund des Strukturkontrastes zweier oder mehrerer Sprachen ließen sich Fehler beim Fremdsprachenlernen nicht nur erklären, sondern sogar voraussagen. Freilich wurde diese weiter gehende Hypothese bald wieder zurückgenommen, weil sie sich in der Praxis des Fremdsprachenunterrichts als falsch erwies (Bausch/Kasper 1979). Diese Praxis relativierte alsbald freilich obendrein die Hypothese: Kenner des Fremdsprachenunterrichts wiesen darauf hin, dass es häufig gerade nicht die auffälligen Strukturkontraste zwischen Sprachen seien, die dem Fremdsprachenlernenden insgesamt Probleme bereiteten und Fehler verursachten, sondern deren Gegenteil, nämlich die Ähnlichkeiten oder Strukturidentitäten, während die Unterschiede – wenn vom Lehrer oder durch das Lehrmaterial bewusst gemacht – eher Lernerleichterungen darstellten. Juhász wies bereits 1970 auf diese faux amis, also Strukturähnlichkeiten zweier oder mehrerer Sprachen, hin, die – als Ranschburg’sches Phänomen der Homogenenhemmung – den Lernenden in die Irre führten: in der falschen Annahme, die zielsprachliche Form müsse sich notwendigerweise von der erstsprachlichen unterscheiden, produziere der Lernende eine völlig andere Form und begehe gerade dadurch einen Fehler (Juhász 1970). Die Kontrastivhypothese steht seither im Rahmen der Zweitspracherwerbshypothesen in der Kritik. Alle diese sprachvergleichenden Untersuchungen sowie deren didaktische Konsequenzen blieben der Ausdrucksseite der Sprache, also der Struktur bzw. Form, verhaftet. Unterschiedliche Bedeutungen sprachlicher Phänomene wurden allenfalls im Einzelfall erwähnt. Einen vollkommen anderen Weg ging Wilhelm von Humboldt zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Auf der Grundlage seiner hermeneutisch begründeten Sprachtheorie verglich er – auch mithilfe seines weit gereisten jüngeren Bruders Alexander – die deutsche Sprache mit asiatischen oder mesoamerikanischen Sprachen und begründete damit seine Auffassung dessen, dass jede Sprache eine Weltansicht berge, fremde Sprachen also nicht nur strukturell im Vergleich zur Erstsprache VIII Vorwort (Muttersprache) verschieden, sondern Ausdruck einer je unterschiedlichen Weltansicht seien: „Durch die gegenseitige Abhängigkeit des Gedankens, und des Wortes voneinander leuchtet es klar ein, daß die Sprachen nicht eigentlich Mittel sind, die schon erkannte Wahrheit darzustellen, sondern weit mehr die vorher unerkannte zu entdecken. Ihre Verschiedenheit ist nicht eine von Schällen und Zeichen, sondern eine Verschiedenheit der Weltansichten selbst.“ (von Humboldt 1994, 27f.) In seinem posthum erschienenen Werk Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues (1836, 57) erklärte der Tegeler Philosoph Sprache nicht als Ergon, also etwas Statisches, sondern als Energéia, also als dynamische Entität: ein Werkzeug, mit dessen Hilfe es gelinge, aus endlichen Mitteln unendlichen Gebrauch zu machen. Noam Chomsky hat später diesen Gedanken zur Grundfigur seiner Universalgrammatik gemacht: eine allen Einzelsprachen zugrunde liegende Struktur von angeborenen Ideen (innate ideas), die mit Hilfe von Transformationsregeln an die Oberflächenstruktur jeder Einzelsprache zu befördern und in einer Grammatik zu beschreiben seien (Chomsky 1966). Freilich beinhaltet Chomskys Verweis auf Humboldt einen kategorialen Fehler: Humboldt hat nie von einer Universalgrammatik, sondern stets nur von der Grammatik von Einzelsprachen gesprochen, die es zu beschreiben gelte. Humboldts forscherisches Interesse galt also der Darstellung unterschiedlicher Weltansichten in den Einzelsprachen: Neben den modernen europäischen Sprachen waren dies das Sanskrit, das Griechische, Lateinische, Chinesische, Japanische, Kawi, das Aztekische und weitere mesoamerikanische Sprachen. Allein diese umfassende Betrachtung hebt Humboldts Erkenntnis und Bedeutung weit über die kontrastiven Untersuchungen mancher heutiger Zeitgenossen hinaus, deren empirische Grundlage im Regelfall zwei und selten mehr Sprachen umfasst. Sie erklärt auch die enge und allenfalls mittlere Reichweite zahlreicher Sprachforscher des angelsächsischen, zumal nordamerikanischen, Raumes wie Chomsky, denen in aller Regel nur ihre eigene Sprache nebst geringen Kenntnissen in anderen lebenden Sprachen zu Gebote steht. Sprachvergleich ist für Humboldt das entscheidende Mittel, die Denkwelten, das Alltagsverhalten wie z. B. Höflichkeits- und Trauerbezeugungen oder die Orientierung in Raum und Zeit anderer Kulturgemeinschaften zu erforschen. Damit nähert er die Sprachwissenschaft der heutigen Anthropologie, Ethnologie und den Sozialwissenschaften an, die es damals – zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts – freilich in dieser Form als Wissenschaftsdisziplinen noch nicht gab. Doch Humboldt begriff als einer der ersten, dass die historische und vergleiIX Vorwort chende Sprachwissenschaft ohne enge Bezüge zu Nachbarschaftsdisziplinen von nur geringem Erkenntniswert bleiben müsse und das Fremde nicht erkennen könne. Traoré drückt es im vorliegenden Band anders aus: „Wenn wir also im Rückgriff auf Wilhelm von Humboldt Sprachenvergleich als ein Mittel betrachten, um, modern ausgedrückt, unter Berücksichtigung der eigenen Perspektive den Fremden in seinem eigenkulturellen Kontext zu wahrzunehmen bzw. zu verstehen, so plädieren wir dafür, bei der Kontrastierung von Sprachen im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts systemlinguistische Aspekte um kulturspezifisch-funktionale zu erweitern. Wir wollen diesen Ansatz sprachkulturspezifisch-funktionale Perspektive nennen.“ (Traoré 2008, 76) Humboldts Sprachphilosophie wurde im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – von Ausnahmen abgesehen – nicht zur Kenntnis genommen. Die historische Sprachwissenschaft, die junggrammatische Schule, später die strukturelle Linguistik sowie die generativ-transformationelle Grammatik dominierten Forschungsparadigmata und Lehrstuhlbesetzungen. Hinzu kam die verfälschende Verwendung einzelner Humboldt’scher Denkfiguren in der Inhaltsbezogenen Grammatik Leo Weisgerbers, zu Zeiten des Faschismus in Deutschland und später in der DDR: Humboldts grandiose philosophische Ansätze wurden verkannt, missachtet oder missbraucht. Zu den wenigen Forscherpersönlichkeiten, die sich der Sprachphilosophie Wilhelm von Humboldts verpflichtet fühlten und sie kreativ weiterentwickelten, gehört der aus der Marburger neu-kantianischen Schule Hermann Cohens hervorgegangene Ernst Cassirer, der mit seinen Schriften die akademische Welt seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts faszinierte: Hingewiesen aus dem Gesamtwerk sei hier lediglich auf das vierbändige opus magnum Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit (1906-1940), die Philosophie der symbolischen Formen (1923-1925), Die Sprache (1923) sowie Zur Logik der Kulturwissenschaften (1942). Cassirers Werk wurde vom Nationalsozialismus verschwiegen, Cassirer musste ins Exil nach Schweden und schließlich in die USA flüchten. In New York starb er, mitten im wissenschaftlichen Schaffen, im April 1945. Die Columbia University ehrte ihn, gemeinsam mit dem am Vortag verstorbenen amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt, mit einer Erinnerungsplakette. Auch nach 1945 war in Deutschland wegen der Dominanz strukturalistischer und generativ-transformationeller linguistischer Schulen für Cassirers Denken kein Platz. Erst mit dem Aufkommen neuerer Arbeiten zum Mythos – vor allem Hans Blumenberg und Roland Barthes – sowie dem intensiven Nachdenken über Fremdkulturalität beim Vermitteln von Literaturen und Sprachen wuchs die ErX Vorwort kenntnis, dass Wilhelm von Humboldt und Ernst Cassirer zwei Sprachphilosophen außerordentlicher Bedeutung seien, an denen hinfort kein Weg mehr vorbei führen konnte, wenn es um das Eigene und das Fremde, die Symbolkraft bei der Darstellung der Wirklichkeit und die Rolle der Sprache dabei ging: Sprache eben – ganz im Sinne Humboldts – keineswegs nur als Mittel der Abbildung verstanden, sondern selbst schöpferisch tätig. Ähnlich sieht es später Paul Klee, der über die Künste – und in Sonderheit die Malerei – schrieb, sie bildeten keineswegs nur die Natur ab (Mimesis), sondern sie machten diese sichtbar. Cassirer bringt es auf den Punkt, wenn er in seinem sprachphilosophischen Hauptwerk, der Philosophie der symbolischen Formen, meint: „Die echte Wirklichkeit kann nicht auf einmal ergriffen und abgebildet werden, sondern wir können uns ihr nur in immer vollkommeneren Symbolen beständig annähern.“ (Cassirer 1998, Bd. 3, 154) Im Zentrum der Überlegungen Cassirers steht der Dualismus von Substanzbegriff und Funktionsbegriff, der neu gedacht werden müsse, nämlich in der Weise, dass eine Annäherung an die Wirklichkeit lediglich über immer komplexere Symbole möglich sei: „Unter einer symbolischen Form soll jede Energie des Geistes verstanden werden, durch welche ein geistiger Bedeutungsgehalt an ein konkretes sinnliches Zeichen geknüpft und diesem Zeichen innerlich zugeeignet wird.“ (Cassirer 1998, Bd. 16, 79) Symbole spielen bei der Annäherung an die reale Welt eine ähnlich wichtige Rolle wie bei der Deutung des Mythos. Unter Bezug auf die drei großen Kritiken Immanuel Kants will Cassirer über die komplexeren Symbole eine Phänomenologie der Erkenntnis schaffen, die die unabhängig voneinander handelnden Bereiche von Natur- und Geisteswissenschaft wieder zusammenführt und ihre Gemeinsamkeiten bei der Erkenntnis der Wirklichkeit betont. Den neuen Rahmen der Gesamtschau, die über Kants Kritik der Vernunft hinausgeht, sieht er in einer Kritik der Kultur, in deren Zentrum die Sprache steht: „Soll die Sprache als eine wahrhaft selbständige und ursprüngliche Energie des Geistes erwiesen werden, so muß sie in das Ganze dieser Formen eingehen, ohne mit irgendeinem schon bestehenden Einzelglied desselben zusammenzufallen – so muß ihr bei aller systematischen Verknüpfung, die sie zuerst mit der Logik und Ästhetik eingeht, eine ihr eigentümliche Stelle in diesem Ganzen zugewiesen und damit ihre Autonomie gesichert werden.“ (Cassirer 1998, Bd. 11, 121) XI Vorwort Die Sprache gewinnt damit eine alle Bereiche der Erkenntnis verbindende und dennoch autonome Rolle: zentral für das Erkennen der Wirklichkeit, der Gedanken-, Gefühls-, Sozial- und Willenswelt wie des Mythos. Denken und Sprache bedingen einander; über die Sprache werden andere Kulturen symbolhaft vermittelt. Sprache als Kern des Ausdrucks von Vernunft, des sozialen Bewusstseins und des Gefühls- und Willenslebens: Cassirer hat hier die Brücke geschlagen nicht nur zu Wilhelm von Humboldt, sondern greift weit voraus und findet seine Bestätigung in neueren neurowissenschaftlichen Arbeiten von Raum und Zeit in unterschiedlichen Kulturen (Götze 2004). Dem Denken Humboldts und Cassirers ist der Ansatz einer Kulturkontrastiven Grammatik verpflichtet. Als dritten Ahnherren nennen wir den Sprachpsychologen Karl Bühler, der – ganz im Sinne Humboldts – Sprache als organon, also Werkzeug, versteht, mit dem jeder Mensch die ihm eigenen Ziele im sprachlichen Handeln verfolgt: Bühler gliedert alle verbalen Äußerungen in die Trichotomie Ausdruck (System), Appell (Signal) und Darstellung (Symbol). Zahlreiche Lebewesen verfügten, so Bühler, über Ausdrucks- und Appellstrukturen ihrer jeweiligen Sprache, lediglich dem Menschen sei darüber hinaus die Funktion der Darstellung eigen. Die drei Grundfunktionen menschlicher Sprache sieht der Wiener Sprachpsychologe im sprachlichen Zeichen manifestiert: „Es ist Symbol kraft seiner Zuordnung zu Gegenständen und Sachverhalten, System [...] kraft seiner Abhängigkeit vom Sender, dessen Innerlichkeit es ausdrückt, und Signal kraft seines Appells an den Hörer, dessen äußeres oder inneres Verhalten es steuert wie andere Verkehrszeichen.“ (Bühler 31999, 28) Bühlers geistige Nähe zu Cassirer wird unmittelbar evident beim Symbolbegriff. Darüber hinaus steht er grundsätzlich Humboldt’schen und Cassirer’schen Denkwelten nahe, indem er Sprache stets in ihrer Funktion im menschlichen Alltag versteht: Ihr Gebrauch wird vor- oder zumindest gleichrangig beschrieben mit der Form, also den Ausdrucksmitteln. Damit ist Bühler zugleich geistiger Vater aller nachfolgenden Sprachhandlungstheorien, nicht zuletzt der aus dem Denken Ludwig Wittgensteins hervorgegangenen ordinary language philosophy, die in die Theorie der Sprechakte Austins (1962) und Searles (1969, 1971) mündete, die freilich von dem universellen Geltungsanspruch ausgingen und damit die Kulturspezifik jeglichen Sprechakts verkannten. Noch einmal Wilhelm von Humboldt: Er hat sehr früh die Schwierigkeit verstanden, vor der jeder Sprachen vergleichende Forscher steht, nämlich ein tertium comparationis – also ein beiden oder mehreren zu vergleichenden Sprachen gemeinsames Drittes – zu finden, mit dessen Hilfe die Regeln der verglichenen Sprachen genau und gleichberechtigt formuliert werden können. Dies ist XII Vorwort im Grunde eine Unmöglichkeit, weshalb zahlreiche Forscher auf das griechischlateinische grammatische Vorbild zurückgriffen. Freilich gerieten sie bei zahlreichen außereuropäischen Sprachen sofort in Erklärschwierigkeiten, etwa beim Vergleichen europäischer Sprachen mit dem Chinesischen, das weder Verbflexionen noch Tempora kennt und das Phänomen Zeit mit anderen sprachlichen Mitteln ausdrückt (s. u. Mueller-Liu, 351ff.). Humboldt fordert deshalb, dass es gelte, „jede Sprache dergestalt in ihrer Eigenheithümlichkeit [zu] studiren, daß man durch genaue Zergliederung ihrer Theile erkennt, durch welche bestimmte Form sie, ihrem Baue nach, jedes grammatische Verhältnis bezeichnet.“ (von Humboldt 1994, 56) Die uns Heutigen geläufige Gleichberechtigung aller Sprachen – und damit der Kulturen, deren wichtigster Aspekt die Sprache ist – wird hier erstmals wissenschaftlich gefordert und bekräftigt. Diesem Gedanken sind alle Beiträge des vorliegenden Bandes verpflichtet. Dies gilt zumal für Europa, diesen Kontinent der Mehrsprachigkeit, die es gegen alle Versuche zu verteidigen gilt, im Zuge der Globalisierung die englische Sprache als alleinige internationale Sprache zu etablieren. E pluribus unum! Europa stellt eine Einheit in der Vielfalt dar: gewachsenen aus dem griechisch-lateinischen Erbe und den Reichtum der Verschiedenartigkeit seiner Sprachen (noch) bewahrend. Eine andere Traditionslinie leitet sich her aus der in der kritischen Auseinandersetzung mit dem linguistischen Relativitätsprinzip der Amerikaner Sapir (1949) und Whorf (1956) entwickelten anthropologischen Linguistik/kognitiven Anthropologie, deren wichtigste Vertreter Gumperz, Brown, Levinson und Goffman darstellen (Brown 1958; Goffman 1971; Gumperz/Levinson 1996). Brown betonte, dass nicht die natürlichen Einzelsprachen unser Denken bestimmten, sondern die Menschen, die zur Orientierung in der sie umgebenden Welt in ihrer Sprache Konzepte und Begriffe auf der Grundlage ihrer Ideen und Wahrnehmungen schüfen. Gumperz/Levinson kritisierten vor allem den von Whorf dekretierten Determinismus, also die Auffassung, dass jede Sprache das Denken der Menschen bestimme. Sie forderten einen Paradigmenwechsel von der bislang dominierenden Linguistik hin zu einer kognitiven Anthropologie, um das Verhältnis von Sprache, Denken und außersprachlicher Realität genauer zu bestimmen. Neue Forschungsbereiche entstanden, so die Kulturanthropologie und die Ethnosemantik, die das Besondere einzelner Sprachen und Kulturen betonten. Vertreter sind Dell Hymes und John Gumperz, deren Forschungen einer Ethnographie der Kommunikation sowie der Entwicklung von Diskursstrategien gewidmet waren. Wichtig sind darüber hinaus die Arbeiten Erving Goffmans XIII Vorwort zum frame-Prinzip, also dem Rahmen jeglicher Kommunikation, sowie zur kulturellen Normierung von Körper- und Gesichtsausdruck, also der Imagearbeit. Diese kulturrelativen Forschungen der Anthropologie und Kulturkontrastivität stehen in deutlichem Gegensatz zu Entwicklungen in Linguistik und Psychologie der nachstrukturalistischen Ära: Einerseits vertraten Noam Chomsky und seine Schüler in der Generativen Transformationsgrammatik einen mental-universalistischen Ansatz, demzufolge es eine allen Sprachen und Kulturen zugrunde liegende Basis gebe, andererseits wurde auch im Rahmen der im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts engagiert vorangetriebenen Untersuchungen zur so genannten Künstlichen Intelligenz (artificial intelligence) – ein zumindest mehrdeutiger Terminus – nach universalen Prinzipien des Gehirns geforscht, die – falls sie erkannt werden sollten – auf Maschinen übertragen werden sollten, die dergestalt zu sich selbst organisierenden Systemen neuronaler Netze zu entwickeln seien, welche dem menschlichen Denken Zug um Zug angenähert werden könnten und eines Tages in der Lage sein sollten, den Menschen zu übertreffen. Heute, zu Beginn des neuen Jahrtausends, hat sich freilich in dieser Frage eher Ernüchterung ausgebreitet. Den Forschungen der Kulturanthropologie und Ethnosemantik ist unser Ansatz einer Kulturkontrastiven Grammatik verpflichtet. Dazu gehören auch neuere Arbeiten von Geertz (1973) und Hofstede (1980, 1997) zur kulturvergleichenden Anthropologie sowie zum Kulturbegriff, den vor allem Goodenough (1964) und Bachmann-Medick (2004) auf der Grundlage der Forschungen Lévi-Strauss’ (1958, 1981) entwickelten. In Deutschland sind hier vor allem die Arbeiten Thomas’ (1991, 1993), Lüsebrinks (2008) und Götzes (2004, 2007) zu erwähnen. Ziel aller genannten Ansätze (s. u. Mueller-Liu, 117ff.) ist ein differenzierter Kulturbegriff, der gesellschaftliche wie individuelle Alltagshandlungen in ihren sprachlichen, nichtsprachlichen und parasprachlichen Aspekten zu erfassen und zu analysieren vermag. Dabei ist das dialektische Verhältnis von Sprache, Denken und außersprachlicher Wirklichkeit in unterschiedlichen Kulturen der zentrale Forschungsgegenstand, den es mit Methoden der kulturellen Anthropologie sowie der Praktischen Semantik zu erklären gilt. Die Analyse von Alltagshandlungen zum interkulturellen Handeln und zur Überwindung von Vorurteilen beim Kontakt von Vertretern unterschiedlicher Kulturen wird zum zentralen Thema. Was ist nun das Besondere und Neue an einer Kulturkontrastiven Grammatik? Sie analysiert Sprachen als Teil von Kulturen und versucht dabei, je spezifische Beschreibungsverfahren zu wählen, die der jeweiligen Sprache angemessen sind, ohne – wie in der Kontrastiven Linguistik geschehen – ein tertium comparationis zu wählen, das häufig den untersuchten Sprachen – oder einer von ihnen – nicht angemessen ist. Zugleich versucht sie, die hinter dem sprachliXIV Vorwort chen Ausdruck stehende Weltansicht zu entschleiern. Ein Beispiel möge dies verdeutlichen: Der Ausdruck von Zeit geschieht in den, auf dem griechischlateinischen Vorbild fußenden, germanischen, romanischen oder slawischen Sprachen gemeinhin über das Temporalsystem der Verben, daneben auch mithilfe von Temporaladverbien, Partikeln, Konjunktionen und Präpositionen mit zeitlicher Bedeutung. Andere, nicht-indoeuropäische Sprachen wie das Chinesische oder einige indigene Sprachen in beiden Amerika, verfügen über keine Verbflexion und kennen auch keine entsprechenden Tempusformen. Nun ist es für eine Kulturkontrastive Analyse nicht akzeptabel, dieses Phänomen lediglich als Defizit asiatischer und amerikanischer Sprachen zu charakterisieren, sondern es gilt, nach dessen Ursachen zu forschen: Das lineare Zeitbewusstsein, das dem Okzident charakteristisch ist, und der sich daraus ergebende Zeitpfeil existieren in zahlreichen östlichen, zumal buddhistisch geprägten Kulturen nicht. Dort gelten nicht die Triade der Zeitstufen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern der Moment/Augenblick und die Dauer: ein anderes, aber auch nicht zirkuläres Zeitverständnis (Götze 2004, 2007 und s. u. 233ff.). Ein Thai oder Chinese bedient sich daher anderer sprachlicher Mittel wie Partikeln oder Adverbien, um Zeitliches zu markieren (s. u. Traoré, 21ff. und Loto, 311ff.). Solche kulturellen Unterschiede muss eine Kulturkontrastive Grammatik herausarbeiten, weil sie Quelle sprachlicher Fehler etwa beim Erwerb des Deutschen als Fremdsprache sind, die freilich von Lehrern häufig – ganz im Sinne einer Kontrastiven Grammatik – oberflächenstrukturell, somit rein linguistisch interpretiert und – falsch – therapiert, werden. Eine Kulturkontrastive Grammatik unterscheidet sich aber auch deutlich von Arbeiten zur kontrastiven Pragmatik, die sich im Regelfall im Vergleich von Sprechakten/Sprachhandlungen in unterschiedlichen Sprachen (Fragen – Antworten, Fragen – Erklären, Einladen – einer Einladung folgen usw.) erschöpfen, ohne deren kulturelle Bedingtheit und/oder ethische Normen zu berücksichtigen, die das sprachliche Handeln prägen. Eine Kulturkontrastive Grammatik ist somit ein Gesamtwerk: linguistische Analyse und Vergleich unter Berücksichtigung kultureller Wurzeln und Traditionen, Entwicklungen und kulturspezifischer Normen, die Grundlage sprachlicher Äußerungen sind. Sie will zugleich, im Sinne Humboldts, den Prozess deutlich machen, der erklärt, wie sprachliche Mittel individuelle und gesellschaftliche Bilder, Vorurteile, Traditionen und Normen prägen. Sprache und Denken bedingen einander, sprachliche Form und individuelles oder gesellschaftliches Bewusstsein ebenso. Diese Anerkennung unterschiedlicher kultureller Wertesysteme freilich darf nicht zur Relativierung von Normen führen. Das alles überwölbende und verbindliche Wertesystem wird deshalb in der vorliegenden Schrift in der Deklaration der Menschenrechte der Französischen ReXV Vorwort volution von 1789 sowie der Vereinten Nationen von 1948 gesehen. Vor diesem ethischen Rahmen sind alle kulturspezifischen Wertordnungen zu interpretieren. Damit wird jeder Form eines Kulturrelativismus eine Absage erteilt. Ob mit dem Verweis auf die Interpretationsmöglichkeit einschlägiger Suren des Koran Frauendiskriminierung und feudalistische Gesellschaftsstrukturen in islamischen Ländern rechtfertigt werden oder Menschenrechtsverletzungen in China wie die Ermordung von Studenten auf dem Tian-Anmen-Platz, die Folterung regimekritischer Journalisten oder Massenexekutionen im Reich der Mitte mit dem Verweis auf Konfuzius oder die vermeintliche Störung der inneren Ruhe Chinas verteidigt werden: Dies alles und viele Verbrechen mehr sind Verletzungen der Menschenrechte und müssen verfolgt und geahndet werden. Sie sind in nichts zu rechtfertigen, schon gar nicht mit dem Verweis auf je besondere kulturelle Traditionen und damit auch nicht mit Interpretationen einer Kulturkontrastiven Grammatik. Doch diese Grammatik kann dazu beitragen, das Verständnis über die Ursachen kultureller Konflikte zu fördern und, im besten Fall, zu deren Lösung beizutragen. Diese Klärung kann aber auch bewirken, dass der Dialog scheitert, weil sie die Unvereinbarkeit grundlegender Positionen deutlich macht, die nicht durch Formelkompromisse überdeckt werden darf und soll. Bei dieser notwendigen Klärung kann zutage gefördert werden, dass die Tradition und das Wertesystem der europäischen Aufklärung einerseits und andere – zumal islamische – Wertvorstellungen nicht zusammenpassen. Necla Kelek hat recht, wenn sie in der Laudatio der Ludwig-Börne-Preisverleihung 2009 sagt: „Wir werden die strukturellen und ideologischen Hindernisse der Integration nicht beseitigen, wenn wir einem ‚Wunschdenkenǥ über den Islam verhaftet bleiben, das Gewalt nur als ein Problem von Extremisten oder als falsche Auslegung einer an sich richtigen Lehre sehen will. Wenn wir die kulturellen Differenzen nicht benennen, wird über die Integrationshindernisse weiter der Schleier gebreitet. Denn wir meinen Unterschiedliches, wenn wir dieselben Begriffe verwenden: Freiheit, Anstand, Würde, Ehre, Schande, Respekt, Dialog, das alles sind Werte und Normen, die in einer westeuropäischen Gesellschaft mittlerweile ganz anders definiert werden als in der islamisch-türkisch-arabischen Kultur“ (Kelek 2009, 21) Die einzelnen Beiträge des Bandes liefern Bausteine dieses gemeinsamen Wollens, das für das Verstehen fremder Kulturen und deren Wertesysteme einerseits sowie für die Vermittlung von Fremdsprachen andererseits – hier vor allem des Deutschen als Fremdsprache – unverzichtbar ist. So gibt es Arbeiten zum Verstehen von Zeit und Raum im subsaharischen Afrika, in China und in Thailand im Vergleich zu Deutschland, zum Genus verbi und Passiv im Thai und im XVI Vorwort Deutschen, zum Alltagshandeln beim Ausdruck der Höflichkeit sowie Trauerbezeugung in unterschiedlichen Kulturen, zur Rolle und dialektischen Umsetzung der Migrationsliteratur im subsaharischen Afrika sowie zu kulturspezifischen Lernstrategien in Kamerun und Thailand. Der Bogen ist weit gespannt. Die Beiträge wollen nicht nur ein vertieftes Verständnis des Anderen und damit einer fremden Kultur vermitteln, sondern vor allem dessen Einfluss auf die Sprache verdeutlichen. Als Konsequenz mögen die Analysen für das Lehren der deutschen Sprache im Ausland wie im Inland bessere Erklärungen liefern, als sie häufig in Handreichungen des Deutschen als Fremdsprache zu finden sind. Herausgeber und Herausgeberin wünschen, dass mit dem Konzept der Kulturkontrastiven Grammatik neue Wege in der Fremdsprachendidaktik und darüber hinaus eröffnet werden. Sie werden beim Dialog der Kulturen dringend gebraucht. Wir danken dem Verlag Peter Lang für die Publikation und die editorische Beratung, vor allem Herrn Dr. Kurt Wallat. Danken möchten wir aber besonders allen Beiträgerinnen und Beiträgern rund um den Globus: Erst durch diese weltweite Zusammenarbeit und die dadurch gewonnene Verbindung von Eigen- und Fremdperspektive war es möglich, Wilhelm von Humboldts Idee einer in den natürlichen Sprachen verborgenen je unterschiedlichen Weltansicht in die Tat umzusetzen. Das dadurch geschaffene farbige Tableau höchst unterschiedlicher Interpretationen von Vorstellungen über Raum und Zeit und von Alltagshandlungen prägt dieses Werk. Unser Dank gilt ferner Dr. Elisabeth Venohr, Frau Doris Zintel-Matzanke sowie Frau Nina Prowald für ihre stetige Unterstützung des Projekts und ihre Hilfe beim Schreiben und Korrigieren der Texte sowie bei der Einrichtung des Manuskriptes. Saarbrücken, im Juni 2009 Lutz Götze, Salifou Traoré, Patricia Mueller-Liu Literatur Austin, John L. (1962): How to do things with words. Cambridge. Bachmann-Medick, Doris (2004): Kultur als Text. Die anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft. Tübingen u. a. Barthes, Roland (1957): Mythologies. Paris. Bausch, Karl-Richard/Kasper, Gabriele (1979): Die großen Hypothesen des Zweitspracherwerbs. In: Linguistische Berichte 64, 3-35. XVII Vorwort Blumenberg, Hans (1979): Arbeit am Mythos. Frankfurt a. M. Bopp, Franz (1833ff.): Vergleichende Grammatik. Heidelberg. Brown, Roger W. (1958): Words and Things. New York. Bühler, Karl (1934 [31999]): Sprachtheorie. Darstellungsfunktion der Sprache. Stuttgart. Cassirer, Ernst Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe (1998ff.) Hg. von Recki, Birgit. Bd. 3. Hamburg. Chomsky, Noam (1966): Cartesian Linguistics. New York/London. Geertz, Clifford (1973): The Interpretation of Cultures. Selected Essays. London. Glück, Helmut (2002): Deutsch als Fremdsprache in Europa vom Mittelalter bis zur Barockzeit. Berlin/New York. Goodenough, Ward (1964): Cultural anthropology and linguistics. In Hymes, Dell (Hg.): Language in Culture and Society. New York, 36-39. Götze, Lutz (2004): Zeitkulturen. Frankfurt a. M. Götze, Lutz (2007): Zeit- und Raumbewusstsein in den Kulturen. (Vor-) Überlegungen zu einer Kulturkontrastiven Grammatik. In: Buscha, Joachim/Freudenberg-Findeisen, Renate (Hg.): Feldergrammatik in der Diskussion. Frankfurt a. M. Goffman, Irving (1971): Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommunikation. Frankfurt a. M. Gumperz, John J. (1958): Dialect Differences and Social Stratification in a North Indian Village. In: American Anthropologist 66, 668-681. Gumperz, John J./Levinson, Stephen C. (1996): Rethinking linguistic relativity. Cambridge. Hofstede, Geert (1980) Culture’s Consequences. International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills. Hofstede, Geert (1997): Lokales Denken, globales Handeln. Kulturen, Zusammenarbeit und Management. München. Humboldt, Wilhelm von (1994): Über die Sprache. Reden vor der Akademie. Hg., kommentiert und mit einem Nachwort versehen von Trabant, Jürgen. Tübingen/Basel. Humboldt, Wilhelm von (1836): Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. Berlin. Hymes, Dell (1964): Language in Culture and Society. New York. Juhász, Janos (1970): Probleme der Interferenz. München. Kelek, Necla (2009): Wir müssen den Schleier lüften. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2009. Frankfurt a. M. Lévi-Strauss, Claude (1958): Anthropologie structurale. Paris. XVIII Vorwort Lévi-Strauss, Claude (1981): Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft. Frankfurt a. M. Lüsebrink, Hans-Jürgen (22008): Interkulturelle Kommunikation. Theorieansätze und Praxisbezüge in interdisziplinärer Perspektive. St. Ingbert. Rein, Kurt (1983): Einführung in die kontrastive Linguistik. Darmstadt. Sapir, Edward (1949): Selected Writings. Berkeley. Searle, John R. (1969): Speech acts: An essay in the philosophy of language. Cambridge. Searle, John R. (1971): The philosophy of language. Oxford. Thomas, Alexander (1991): Psychologische Wirksamkeit von Kulturstandards im interkulturellen Handeln. In: Thomas, Alexander (Hg.) (1991a): Interkulturelles Organisationstraining für die USA. Saarbrücken. Thomas, Alexander (1993): Kulturvergleichende Psychologie. Eine Einführung. Göttingen. Thomas, Alexander (1993): Psychologie interkulturellen Handelns. Göttingen. Traoré, Salifou (2008): Interkulturelle Grammatik. Konzeptuelle Überlegungen zu einer Grammatik aus eigener und fremder Perspektive im Deutschen als Fremdsprache. Frankfurt a. M. Wittgenstein, Ludwig (1984): Philosophische Untersuchungen. Werkausgabe. Bd. 1. Frankfurt a. M. Whorf, Benjamin Lee (1956): Language, Thought and Reality: selected writings of Benjamin Lee Whorf. Herausg. von Carroll, John B. Cambridge, MA. Abstract Contrastive, or comparative, grammars – comparative analyses of two or more languages – have a long tradition in foreign language teaching. The notion of a culturally contrastive grammar, however, is a novel idea yet to be introduced in general and applied linguistics. Drawing upon Wilhelm von Humboldt’s insights into the different Weltanschauung represented by each language, Ernst Cassirer’s thoughts on the symbolic force of language, Karl Bühler’s organon model and the work of American linguists and anthropologists Dell Hymes and John Gumperz in the tradition of Language and Culture, culturally contrastive grammar in our sense of the term compares the structures of the German language with those of other – European, Asian and African – languages not only from a linguistic point of view but also with respect to the cultural roots, traditions and norms which condition their use and constitute the Weltanschauung of the respective speech community. As illustrated by the papers gathered in this volume, analyses of this kind are essential for an in-depth under- XIX Vorwort standing of languages and cultures and should form the basis of German language teaching all over the globe. Résumé Pendant que la grammaire contrastive, qui consiste en la comparaison de deux ou plusieurs langues sur le plan linguistique, existe depuis longtemps, les réflexions sur les grammaires culture-contrastives sont nouvelles. Elles se basent d’un côté sur Wilhelm von Humboldt et son concept de Weltansicht que les langues mette clairement en évidence, sur la notion de la force symbolique du langage d’Ernest Cassirer et de l’Organonmodell de Karl Bühler et de l’autre côté – suite au déterminisme linguistique formulé dans l’hypothèse Sapir-Whorf et les discussions qui s’en sont suivies – sur les différents courants de recherche américains en anthropologie cognitive et en ethnosémantique que représentent surtout Dell Hymes, John Gumperz et Erving Goffman. Notre concept de grammaire culture-contrastive sert à comparer l’allemand aux langues européennes, africaines et asiatiques non seulement sur le plan linguistique mais aussi et surtout sur le plan culturel en tenant compte des traditions, développements et normes qui sont propres à chaque langue et qui sont à la base des différentes Weltansichten. Ces approches sont nécessaires pour comprendre la différence entre les cultures; elles constituent en même temps la base de l’enseignement de l’allemand langue étrangère partout dans le monde. XX