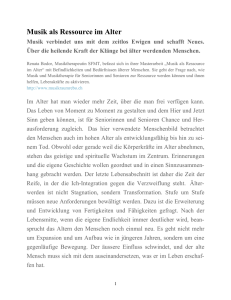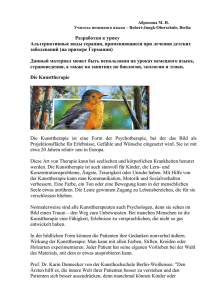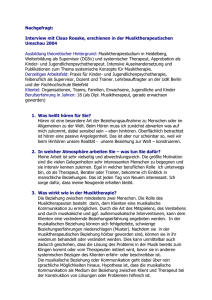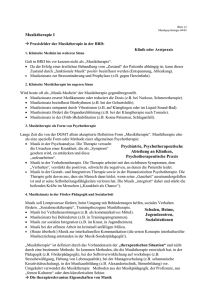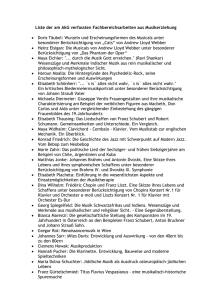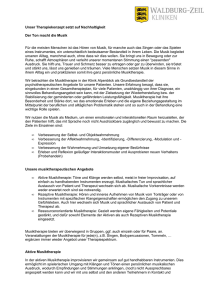Rezeptive Musiktherapie als Aspekt der ganzheitlichen Intensivpflege.
Werbung

REZEPTIVE MUSIKTHERAPIE ALS ASPEKT DER GANZHEITLICHEN INTENSIVPFLEGE Fachbereichsarbeit zur Erlangung des Diploms für den gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege an der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am AKH Linz Beurteiler: Anneliese Schauer- Mühl akademisch geprüfte Lehrerin der Gesundheits- und Krankenpflege vorgelegt von Carmen Maria Asanger Linz, im Mai 2001 Kurzzusammenfassung Die vorliegende Fachbereichsarbeit beschäftigt sich mit dem gezielten Einsatz von rezeptiver Musiktherapie bei Intensivpatienten. In einem ersten Schritt wird das spezielle Umfeld einer Intensivstation aufgezeigt. Aus der Klärung des Begriffes „Ganzheitlichkeit“ in der Pflege leiten sich allgemeine Interventionen im Bereich der Kommunikation mit Schwerkranken ab. Von der Musik als Verständigungsmittel kommt es schließlich zur Darstellung musiktherapeutischer Grundbegriffe und zur Beleuchtung diverser Intensivbereiche aus musiktherapeutischer Sicht. Zudem werden Möglichkeiten der interdisziplinären Zusammenarbeit aufgezeigt, sowie Grenzen und Irrwege der Musiktherapie im Bereich der Im Schlussteil bringt die Autorin persönliche Erfahrungen mit der behandelten Thematik ein. Abstract The presented professional work gives insight to the well-aimed employment of music therapy with intensive care patients. This analysis goes along with the idea of the holistic nursing care. At first the special environment, the sick has to face at an intensive care ward, is shown. After the purification of the term “holistic” in context with nursing care, different communicative interventions, especially for seriously ill persons are deduced. Subsequent to music as one way to communicate there is taken a closer look to the basics of music therapy. Finally the different intensive care wards are seen by the music therapeutic view. In addition ways of interdisciplinary cooperation are shown as well as the possible bounds and wrong tracks in the care with sounds. Last but not least the author tells about personal experiences with the concrete subject. 1 INHALTSVERZEICHNIS 0. VORWORT ....................................................................................................4 1. EINFÜHRUNG IN DIE PROBLEMSTELLUNG......................................5 2. DAS UMFELD DES PATIENTEN AUF DER INTENSIVSTATION .....6 2.1 Das Erleben der Umwelt aus der Sicht des Intensivpatienten................. 6 2.2 Der Faktor Angst und andere Einflüsse auf das Befinden des Kranken . 8 3. DER MENSCH IM MITTELPUNKT - EINE VISION VON GANZHEITLICHER PFLEGE ........................................................................ 10 3.1 Ganzheitlichkeit am Krankenbett.......................................................... 10 3.2 Formen der Kommunikation mit Intensivpatienten .............................. 11 3.2.1 Das Gespräch mit dem Schwerkranken ........................................ 12 3.2.2 Kommunikation mit Menschen, die nicht sprechen können......... 13 3.2.3 Die Sprache der Musik.................................................................. 14 4. 4.1 GRUNDLAGEN DER MUSIKTHERAPIE FÜR PFLEGENDE ...........18 Musiktherapie einst und jetzt ................................................................ 19 4.1.1 Rezeptive Musiktherapie............................................................... 21 4.1.2 Aktive Musiktherapie.................................................................... 23 4.2 Die Physiologie der Töne...................................................................... 25 4.2.1 Die Intervalle im Blickfeld der Musiktherapie ............................. 26 4.2.2 Rhythmos und Tonos .................................................................... 29 4.2.3 Sympatiko- und Parasympatikotone Wirkungen von Musik ........ 30 5. DER EINSATZ VON MUSIK IM INTENSIVBEREICH .......................31 5.1 Musik kontra Stressoren beim Komatösen ........................................... 31 5.2 Musiktherapie in den diversen Intensivbereichen................................. 35 5.2.1 Musik in der Anästhesie................................................................ 35 5.2.2 Musik in der inneren Medizin ....................................................... 36 5.2.3 Musik in Neurologie und Psychiatrie............................................ 37 5.2.4 Musik in der prä- und postnatalen Medizin .................................. 37 6. IRRWEGE IN DER PFLEGE MIT MUSIK BEIM INTENSIVPATIENTEN .....................................................................................38 6.1 Die Grenzen der Musiktherapie ............................................................ 38 6.2 Musische Missverständnisse im Pflegealltag........................................ 39 2 7. AUF DEM WEG ZUR GANZHEITLICHKEIT DURCH INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT ............................................. 41 8. PERSÖNLICHE GEDANKEN ZUM EINSATZ VON KLANGKÖRPERN ALS MOTOR FÜR HARMONISCHE KÖRPERKLÄNGE ............................................................................................ 44 9. ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG............................................46 10. LITERATURVERZEICHNIS....................................................................47 3 0. VORWORT Musik begleitet mich seit den ersten Tagen meiner Kindheit. Schon im Mutterleib lauschte ich - als Fötus einer Musikstudentin - den Klängen von Cello und Klavier und den Harmonien von Händel bis Chopin. Nach Abschluss der Reifeprüfung an einem musischen BORG habe ich in beruflicher Hinsicht zwar einen anderen Weg eingeschlagen, die Musik bleibt aber mein bevorzugtes Hobby. Zwischen Pflege und Musik eröffnen sich mir viele Parallelen. Beide erfordern Flexibilität und Kreativität. Musik ohne Herz, und sei sie noch so präzise, ist keine gute Musik. Gleiches gilt für die Pflege von Kranken. Im Rahmen meiner Fachbereichsarbeit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass der Einsatz von Musik in der Pflege einen berechtigten Stellenwert hat. Dabei ist es notwendig, Hintergründe zu erforschen, ein Basiswissen über musikalische Wirkungsmechanismen zu erlangen und damit eine besondere Sensibilität für eine gezielte Anwendung von Musik beim Kranken zu entwickeln. Meine besondere Aufmerksamkeit gilt der Intensivstation, weil Schwerkranke in der Institution Krankenhaus am wenigsten befähigt sind, über sich selbst zu bestimmen. Vielmehr ist ihr Alltag stark vom Handeln anderer abhängig. Musiktherapeuten unterstützen schon in vielen Kranken- und Heilanstalten auf professionelle Weise das Ärzte- und Pflegeteam. Umgekehrt können Elemente der Musiktherapie auch vom Pflegepersonal angewendet werden. Es soll unser gemeinsames Anliegen sein, dass vom Kranken mehr bestehen bleibt als ein vegetierendes Es oder eine Handvoll medizinischer Diagnosen. Musik bietet ja nicht nur die Möglichkeit, den Körper eines Menschen zu pflegen, sondern auch seine Seele. Mein Dank gilt Frau Anneliese Schauer-Mühl, meiner betreuenden Lehrerin, die mich ermutigt hat, „pflegerisches Neuland“ zu betreten und in diesem Sinne ein doch gewagtes Themengebiet aufzugreifen. Danken möchte ich an dieser Stelle auch meinen Eltern. Sie haben mich die Liebe zu einer Vielfalt von Klängen gelehrt und damit das Fundament für diese Arbeit geschaffen. Linz, im Mai 2001 Carmen Maria Asanger 4 1. EINFÜHRUNG IN DIE PROBLEMSTELLUNG Die heilende Wirkung von Musik auf den Menschen ist ein über Jahrtausende hinweg wahrgenommenes Phänomen. Die Tore zu den unterschiedlichsten musikalischen Traditionen sind vielfältig, ebenso wie deren Funktionen. Musik findet ihren Niederschlag in der Anwendung magischer Kräfte, im Verkünden von Heilslehren und Weltanschauungen. Sie dient als Brücke zu religiösen Ritualen, unterhält das einfache wie auch das gebildete Volk, macht Gefühlsausdruck möglich. Was jedoch noch viel zu sehr im Verborgenen liegt ist, dass die Wirkung von Musik wohl auch wissenschaftlich begründbar und erforscht ist. Als Therapieform erzielt Musik Erfolge sowohl auf der psychischen als auch auf der körperlichen Ebene. Wenngleich ein Bewusstsein für Musik als Pflege- und Heilmittel zunehmend vorhanden ist, erwarten uns vor allem im Akutkrankenhaus immer noch Skepsis und Vorurteile betreffend ihrer Relevanz. Vordergründig wird mit dem Maß hygienischer Standards, medizinischer Anordnungen und optimaler Medikation gemessen. Laut vor sich hin piepsende, schnaufende und surrende Maschinen erzeugen für die Verantwortlichen das trügerische Bild höchster Pflegequalität. Außer Acht bleiben da oft gleichwertige Faktoren wie der akustische Stress für den Patienten oder die Beziehungspflege (vgl. Bolay, 1999, S.VII). Der Forschungsschwerpunkt dieser Arbeit liegt im Ergründen, inwieweit Musiktherapie praxisrelevant in den Pflegealltag einer Intensivstation einbezogen werden kann. Es tut sich die Frage auf, welche Chancen die rezeptive Anwendungsform für eine ganzheitliche Pflege von Intensivpatienten bietet und worin mögliche Grenzen beziehungsweise Missverständnisse liegen könnten. Die Arbeit basiert auf einer intensiven Literaturrecherche und eröffnet neben intensivpflegerischen Perspektiven Einsicht in das Basiswissen der Musiktherapie und in ihre musiktheoretischen Hintergründe. Sie zeigt, wie Musiktherapie in den unterschiedlichen Intensivbereichen angewendet werden kann und berücksichtigt in der notwendigen Zusammenarbeit von Medizinern, Pflegepersonal und Musiktherapeuten auch interdisziplinäre Aspekte. 5 2. DAS UMFELD DES PATIENTEN AUF DER INTENSIVSTATION Der Aufenthalt auf einer Intensivstation ist meist verbunden mit einer angsteinflößenden Situation (vgl. Schäffler et al., 1998, S.1340). Umgeben von genauer Überwachung ist man trotz bester technischer Ausstattung verleitet, darüber nachzudenken, ob ein Intensivpatient noch menschliches Individuum ist oder aber eher eine Maschine Mensch, die im individuellen Überlebenskampf sich selbst überlassen bleibt. Im nachstehenden Kapitel soll das unmittelbare Umfeld eines Intensivpatienten dargestellt werden. Worin liegen die Unterschiede im Erleben der Umwelt zwischen dem gesunden Menschen und einem Intensivpatienten? Welchen Stressoren ist der Kranke ausgesetzt und wie nehmen diese Einfluss auf sein Befinden? Der Angst mit all ihren Auswirkungen auf den Patienten wird ein hoher Stellenwert eingeräumt. Auf diesem Grundgerüst aufbauend kann in den folgenden Beiträgen genauer auf pflegerische und musiktherapeutische Interventionen eingegangen werden. 2.1 Das Erleben der Umwelt aus der Sicht des Intensivpatienten Die Pflege im Intensivbereich unterscheidet sich stark von jener auf einer Allgemeinstation. Patienten sind zum überwiegenden Teil sediert, beatmet, häufig inmobil und somit in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Vieles, wozu der Gesunde selbst imstande ist, muss beim Intensivpatienten vom Pflegepersonal übernommen werden (vgl. Kretz, Korn, Reichenberger, 1985, S.3). Vom Kranken wird Anpassung gefordert, weniger aber Mitgestaltung. Es liegt dies auf der stark technisch ausgerichteten Störungsdiagnostik und -behandlung begründet, bei der der Experte für Behandlungsmaßnahmen und Gesundung verantwortlich ist. Im Gegenzug dazu verstummt der Behandelte, was zur Folge hat, dass das Erleben der Krankheit von der Gruppe der Helfer meist negativer eingeschätzt wird als vom Betroffenen selbst. Da Krankheit als fremdbestimmte Störung angesehen wird, erfolgen zunehmend Rückzug und Passivierung von Seiten des Patienten. 6 In der Folge kommt es zu einem arztgerechten unlust- und schmerzbetonten Beschwerdeverhalten. Heek spricht von einer Kultur der An-Ästhesierung. Sie reicht von der Gestaltung der Arzt-Visite, die unter weitgehendem Ausschluss des Patienten erfolgt, bis hin zum Umgang mit Sterbenden, wo anstelle begleitender Gespräche nicht selten ein Handlungsoptimismus suggerieren soll, dass alles wieder gut wird (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S.17–20). Die unterschiedlichen Bewusstseinsstadien beim Intensivpatienten haben sehr konträre Erlebniswelten der Betroffenen zur Folge. Wache Patienten vermissen auf Intensivstationen trotz verstärkter Betreuung vielfach Information und Kommunikation. In Abhängigkeit von der Grunderkrankung ist davon auszugehen, dass der Patient häufig an Schmerzen leidet. Die individuelle Mimik sowie vegetative Auffälligkeiten, Redseligkeit und hastiges Sprechen des Patienten können unter anderem Aufschluss geben über seinen psychischen Zustand. Für den Wiedererwachenden ist charakteristisch, dass er nur flüchtig kooperativ und meist unruhig ist. Erst allmählich erlangt er geistige Klarheit und seinem jeweiligen Zustand entsprechend ist es für ihn von Bedeutung, alle notwendigen Informationen zu erhalten, um sich zurechtzufinden. Unruhe und fehlende Kooperationsbereitschaft von Patienten im Delirium sind in einer hochgradigen Desorientiertheit begründet. Hingegen ist es beim Bewusstlosen nicht immer abzuschätzen, wie viel er noch oder schon wieder aufnimmt. Bedingt durch traumatische Bewusstseinsstörungen, Sedation oder Durchgangssyndrome sind Patienten oft nicht ansprechbar (vgl. Kretz, Korn, Reichenberger, 1985, S.11-14). Erfolgt jedoch z.B. aufgrund einer schlechten Kreislaufsituation eine nur schwache Sedierung, ist der Kranke begrenzt aufnahmefähig. Während es durchaus gang und gäbe ist, dem Kranken verstärkt Auskünfte über anstehende Pflegehandlungen zu erteilen, ist es umgekehrt auch für diesen bewusstseinseingeschränkten Patienten bedeutend, Gelegenheit zu bekommen sich selbst auszudrücken (vgl. Gestrich, 1998, S. 115). Es ist dies eine Aufforderung an uns Pflegende, dem Kranken Raum zu geben und eine Chance, in der Kommunikation als gleichwertiger Partner zu bestehen. 7 2.2 Der Faktor Angst und andere Einflüsse auf das Befinden des Kranken Für den Außenstehenden kommt die Intensivstation - ein Ort, der den Patienten mit Drähten und Wirrwarr einsperrt – oft einer Stätte des Entsetzens gleich. Maschinen erzeugen eine abschreckende Wirkung auf nicht aufgeklärte Angehörige genauso wie auf Berufsanfänger. Umfassende Umfragen unter genesenen und entlassenen Intensivpatienten zeigen jedoch gegenteilige Reaktionen der betroffenen Patienten. Während viele über eine Erinnerungslücke während des Aufenthalts auf der Intensivstation berichten, erzeugte bei wachen Patienten die Anwesenheit von Apparaten nicht selten ein Gefühl von Sicherheit, welches in der weiteren Versorgung auf peripheren Stationen oft vermisst wurde. Primär verantwortlich für ein Unbehagen beim wachen Intensivpatienten ist eine Reihe anderer Faktoren. Der Angst vor der Schwere der Erkrankung, möglichen bleibenden Behinderungen und Tod stehen Vereinsamung und Langeweile gegenüber. Als Belastung wird zudem der fehlende Tag-Nacht-Rhythmus empfunden. Eine Monotonie durch konstante rhythmische Monitorsignale, Überstimulation durch technisch bedingt Notfallalarme und Manipulation an anderen Patienten sind störend. Der wache Patient ist in der Regel auch ängstlich, wobei die fremde Umgebung eine zusätzliche Belastung darstellt, doch wird er das oft nicht zugeben, weil es ihm unangenehm ist (vgl. Kretz, Korn, Reichenberger, 1985, S.11-14). Diese Angstfaktoren nehmen durchaus auch Einfluss auf das postkomatöse Erinnerungsvermögen, was auf intrapsychische Abwehrvorgänge beim Patienten zurückzuführen ist. Ehemalige Intensivpatienten berichten, sie würden all das Erlebete aus dem Gedächtnis verbannen. Sie fühlten sich, als versuchten sie sich vor schrecklichen Gedanken zu schützen, denn sie fürchten sich davor zu fühlen. Es wäre besser sich nicht daran zu erinnern, dass sie bewusstlos waren (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S.26-27). Ein Interview welches im Nachhinein mit einem bewusstseinsveränderten Patienten stattgefunden hat, schildert sehr eindrucksvoll dessen vermeintliches Befinden auf einem mittelalterlichen Schlachtfeld. 8 Es gibt Aufschluss über mögliche einengende Erlebniswelten in Bewusstlosigkeit und wirft mitunter die Frage auf, ob der moderne Mensch tatsächlich noch ein Bewusstsein hat für denjenigen, den er als bewusstlos bezeichnet (vgl. Ziegler,1999, S.21). „Er selbst habe das Gefühl gehabt, dass er sich tot stellen musste, um nicht von umherparodierenden Rittern - gemeint waren die Behandelnden - getötet zu werden. In seiner Verkennung der Situation deutete er die rote Blutdruckmanschette über seinem Krankenbett als Feuerlöscher, das Hämofiltrationsgerät als Bombe, die ständig zu explodieren drohte. Die laute und formelhafte Ansprache durch das Personal wie: “Machen Sie Ihre Augen auf“, „Drücken Sie mir Ihre Hand“ erlebte er als Versuche, sich seiner zu bemächtigen“ (Hannich, 1999, S.76). Ärzte und Pflegepersonal sind vorwiegend ausgebildet, körperliche Defizite zu beseitigen, doch ist ein Umdenken notwendig, das einen leibnahen, liebevollen Handlungsdialog verlangt, der ganz im Gegensatz steht zum aktiv- kontrollierenden Umgang mit Eingetrübten und Komatösen (vgl. Hannich, 1999, S.80). Neben der naturwissenschaftlichen Grundlegung ist auch der Blick auf geisteswissenschaftliche Aspekte bedeutsam. Nur so kann es gelingen, dass sich Pflege beziehungsweise Medizin nicht auf eine einseitige Sichtweise beschränken, denn dies würde eine Verarmung und Verkümmerung des umfassenderen Auftrags einer patientenorientierten Heilkunde bedeuten. Wir stehen in einem Zeitalter, in dem die Medizin von zwei sehr gegensätzlichen Strömungen beherrscht wird. Einerseits werden immer kompliziertere Techniken und Apparaturen von immer weniger Spezialisten beherrscht. Georg Hörmann überzeichnet diese Tatsache mit der Behauptung, dass diese Experten von ihrem Spezialgebiet zwar immer mehr verstehen, jedoch vom Menschen immer weniger. Doch gibt es augenscheinlich auch viele gegenläufige Tendenzen. Man will sich bewusst nicht mehr von der Technik erdrücken lassen und befasst sich wieder zunehmend mit dem Tiefgründigen am Menschen (vgl. Hörmann,1988,S.8-9). 9 3. DER MENSCH IM MITTELPUNKT - EINE VISION VON GANZHEITLICHER PFLEGE Ein Intensivpatient ist, wie im Vorfeld konkretisiert wurde, einer Reihe von negativen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Unnatürliche Lichtverhältnisse, eine andauernde Geräuschkulisse, ständige Überwachung und Anschluss an Monitore bringen ihn mitunter in Bedrängnis und können Frustration auslösen. Die folgenden Zeilen mögen, im Hinblick auf ganzheitliches Pflegen, Aufschluss geben über die Möglichkeit, durch Kommunikation Stressauslösern entgegenzuwirken. Was bedeutet der Begriff ‚Ganzheitliche Pflege’ generell, welche Arten der Gesprächsführung bieten sich in ihrem Sinne innerhalb der Intensivpflege an und welche Rolle kann dabei Musik einnehmen? 3.1 Ganzheitlichkeit am Krankenbett Bereits um 400 vor Christus beschreibt der griechische Arzt Hippokrates die Krankheit als ein nicht lokal begrenztes Geschehen. Da der ganze Mensch krank ist, muss, so Hippokrates, auch in der Behandlung auf den ganzen Menschen Rücksicht genommen werden. Heute kommt dieser frühen Erkenntnis ein gesamter Teilbereich der Wissenschaft zu. Innerhalb der Psychosomatik werden die Wechselwirkungen von Psyche und Körper gründlicher betrachtet. Insbesondere analysiert man körperliche Erkrankungen, die ursächlich psychisch bedingt sind. Doch können umgekehrt auch psychische Störungen aufgrund von körperlichen Erkrankungen auftreten (vgl. Schäffler et al., 1998, S.5). Die World Health Organisation veranschaulicht dieses ganzheitliche Menschenbild mit folgender Definition: „Gesundheit ist der Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens, und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen“ (Van Deest, 1997, S.11-12). 10 Für die Pflege ergeben sich daraus zwei wesentliche Konsequenzen. Einerseits ist beim Erfassen der Pflegebedürftigkeit eines Kranken auf Störungen oder Defizite auf allen Ebenen zu achten. In der Planung und Ausführung müssen im Gegenzug auch alle Ansatzpunkte ausgeschöpft werden (vgl. Schäffler et al., 1998, S.5). Krankheit darf nicht nur aufgehalten oder repariert werden, sondern der Blick ist auch auf zahlreiche moderne Risiken der Zivilisation zu richten (vgl. Van Deest, 1997, S.10). Dies räumt der Prävention einen ebenso hohen Stellenwert ein wie der Behandlung von bestehenden Erkrankungen. Nur durch eine gezielte Gesundheitsförderung und durch ein Erhalten der bestehenden Ressourcen, kann neben der körperlichen Gesundheit auch ein psychisches und soziales Wohlbefinden gewährleistet werden. Vor allem auf der Intensivstation wird den Pflegenden, als wichtigstes Bindeglied zu anderen Berufsgruppen, diese nicht einfache Aufgabe zuteil, Bedürfnisse des Patienten zu erspüren und dennoch Distanz zum Geschehen zu halten, um ihrer eigenen Emotionen willen (vgl. Kagerer, 1996, S.17). 3.2 Formen der Kommunikation mit Intensivpatienten Im Hinblick auf das Einbeziehen von Körper, Psyche und Geist ist der Kommunikation innerhalb der ‚Ganzheitlichen Pflege’ ein erheblicher Stellenwert einzuräumen. Gestrich sieht in dem Buch ‚Gespräche mit Schwerkranken’ gerade darin eine attraktive Aufgabe der Krankenpflege: „Das unbedingt Reizvolle an der Krankenpflege ist, dass sie sich nicht auf einzelne Fertigkeiten und Handreichungen reduzieren lässt, und auch dann noch nicht richtig definiert wird, wenn man sagt, sie sei eine Tätigkeit der Hände, verbunden mit menschlicher Anrede. Vielmehr ist Krankenpflege erst dann richtig beschrieben, wenn man sie umfassend sieht: als helfende, heilende Zuwendung eines ganzen Menschen zu einem ganzen Menschen“ (Gestrich, 1998, S.12). Es ist vom Ausmaß der Schädigung abhängig, wie weit das Gehirn des Patienten beeinträchtigt ist und nur aus dem individuell vorliegenden Zustand lässt sich ein richtiges Handeln in der kommunikativen Betreuung folgern (vgl. Gestrich, 1998, S.109). 11 Grundsätzlich ist der Mensch umweltoffen und informationsfreudig. Werden ihm Kommunikation und Anerkennung verwehrt, erfolgt ein emotionales Verhungern bis hin zum Tod. Vielfach kommt Kommunikation mit Schwerkranken allerdings gar nicht erst zustande. Dies liegt zuallererst begründet in Ängsten vor dem Unbekannten und dem Leblosen (vgl. Ziegler, 1999, S.24-28). 3.2.1 Das Gespräch mit dem Schwerkranken Mit dem Intensivpatienten, welcher aus dem sozialen Netz gerissen und seiner körperlichen Integrität beraubt in einer ihm fremden Umgebung isoliert ist, gestaltet sich ein zufriedenstellendes Kommunizieren äußerst schwierig. Es ist selbst für Gesunde immer wieder problematisch, sich gegenseitig mitzuteilen, einander zuzuhören und zu verstehen. Das verbale Kommunizieren bedingt, dass die Fähigkeit zu sprechen und zu verstehen vorhanden ist. Daneben ist auch die Bereitschaft zur Kommunikation notwendig. Diese sogenannte soziale Kompetenz kann beim Intensivpatienten durch ein Gefühl der Einschränkung aufgrund von Beatmung, Intubation oder Tracheotomie gestört sein. Durch gezieltes Nachfragen von Seiten der Pflegekraft, wobei der Patient mit Ja oder Nein antworten kann, lassen Verständnisprobleme abklären (vgl. Kagerer, 1996, S.17-21). Für das Begleiten in schwerer Krankheit ist es hilfreich sich vor Augen zu halten, dass Menschenfürsorge im Krankenhaus bedeutet, jemanden auch in seinen Gefühlen zu begleiten. Hingegen soll das weitverbreitete Missverständnis, ihn aus seinen Gefühlen erretten zu müssen, gänzlich ausgeräumt werden (vgl. Gestrich, 1998, S.32-33). Vorraussetzung für ein gutes Gespräch ist überdies, mit all seinen Sinnen bei der Sache zu sein, dabei sich selbst anzunehmen, Sensibilität wahrzunehmen, die richtige Körpersprache zu vermitteln, sich in die Stimmungslage des anderen einzufühlen, Grenzen zu ziehen und bei alledem echt zu sein. Der Grundsatz, dass jedes Gespräch Zeit braucht, schließt das Aufbringen der nötigen Geduld mit ein. 12 Neben dem aktiven Zuhören, was meint, seinen Gesprächspartner durch Fragen, Zustimmung und Wiederholung des Gesagten in seinen Aussagen zu verstehen, sind Schweigen und Stille wichtige Grundpfeiler der Gesprächskultur (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2000, S.91-99). Was aber geschieht, wenn sich Menschen verbal selbst nicht verständigen können? Jeder von uns möchte ansprechen und angesprochen werden. Ich können wir nur durch das Wort sein, welches uns beim Namen ruft, und ‚Du’ werden wir dadurch, dass ein anderer, zu dem auch wir wieder ‚Du’ sagen können, uns wahrnimmt. Wenn Menschen durch Krankheiten in ihren Sprachfähigkeiten beeinträchtigt sind, werden sie gleichzeitig aus dem Lebenszusammenhang mit ihrer Umwelt gerissen. Es ist unermesslich, welche Bedeutung der Sprache zukommt und welche Tragweite es hat, diese zu verlieren, wenn man bedenkt, wie viel Zeit wir täglich im Gespräch auf sozialer oder beruflicher Ebene verbringen, wie oft wir das Gespräch suchen, ein dringendes Verlangen danach haben (vgl. Gestrich, 1998, S.106). 3.2.2 Kommunikation mit Menschen, die nicht sprechen können Die Aussage, dass, wer seine Sprache verliert, gleichfalls seine Umgebung verliert, wem seine Umgebung verloren geht, auch sich selbst verliert, eröffnet uns, dass es wohl eine elementare Komponente der Pflege darstellt, Kontakte zu sprachgestörten Menschen herzustellen. Während bekannte Vorschriften wie das Erklären von Pflegehandlungen bei nicht sprechenden Patienten oder das Achten auf die richtigen Worte beim Komapatienten, der mitunter gut zuhören kann, keine besondere Mühe machen, weil man nicht überprüfen kann, ob die Worte tatsächlich ankommen, erfordert es äußerste Phantasie, Kreativität, Geduld und Liebe, sich um eine wechselseitige Verständigung mit ihnen zu bemühen (vgl. Gestrich, 1998, S.106-109). Es ist von enormer Bedeutung, sich vor Augen zu halten, dass auch Bewusstlosigkeit nicht gleichzusetzen ist mit Erlebnislosigkeit. 13 Über dieses Missverständnis kommt es nämlich zu einer gravierenden Fehleinschätzung, welche das Zustandekommen einer regen Kommunikation weitgehend ausschließt (vgl. Gustorff, Hannich, 2000,S.125). Das im herkömmlichen Sinne verstandene Gespräch, welches den Austausch von Gesprochenem meint und begleitet wird von einer Bandbreite nonverbaler Komponenten, ist nur eine Handhabe, den Wahrnehmungsbeeinträchtigten anzureden (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2000, S.100). Eine Reihe nonverbaler Kommunikationsformen, nicht nur die rein unterstützenden, bieten sich an, wenn der Patient nicht ansprechbar oder komatös ist oder aber der Patient wach, allerdings nicht in der Lage ist, seine Sprechwerkzeuge angemessen einzusetzen (vgl. Kagerer, 1996, S.19). Neben dem taktilen Kontakt von der einfachen Berührung über Streicheln, Drücken bis hin zum Umarmen ist die Gestik eine der wesentlichen nonverbalen Ausdrucksformen (vgl. Kagerer, 1996, S.19-20). Die Körperhaltung jedes Menschen spricht ihre eigene Sprache. Manchmal mag sie Wohlwollen und Geborgenheit vermitteln, sie erlaubt aber auch den Ausdruck von Distanz oder Reserviertheit. Augen können von Zuneigung, Verehrung, Zorn und einer Palette anderer Gefühle erzählen. Den sprechenden Händen gelingt es, oft verbal schwer zu beschreibende Gegenstände deutlich zu machen (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2000, S.100). Versuche, durch eine verstärkte Mimik und Gestik, durch Zeichensprache und die Konzentration auf das Wesentliche, Reaktionen vom Gegenüber zu erhalten, schlagen häufig fehl, lassen uns müde werden auf weitere Signale zu warten (vgl. Gestich, 1998, S.108). Der taktile Kontakt ermöglicht vor allem beim komatösen Patienten den Aufbau einer dennoch intensiven Begegnung. Das Angebot vertrauter Düfte kann den Geruchssinn positiv stimulieren, ebenso ist das Wahrnehmen akustisch bekannter Reize wie das Hören vertrauter Stimmen von zentraler Bedeutung (vgl. Kagerer, 1996, S.20). 3.2.3 Die Sprache der Musik Solange jemand lebt, ist er mit Eindrücken und Bewegungen seiner Umgebung 14 verbunden. Als leblos und damit bewusstlos im engeren Sinn kann man ihn letztendlich erst dann betrachten, wenn er gestorben ist (vgl. Ziegler, 1999, S.32). Beim Menschen ist das Gehör der am frühesten entwickelte und daher der entscheidendste Fernsinn. Zuerst erwacht das Gehör aus der Narkose, erst dann das Auge, das bis zuletzt von Wahrnehmungen ausgeschlossen bleibt. Das Ohr nimmt Signale aus allen Richtungen des Raumes auf, was etwa beim optischen Sinn aufgrund des eingeschränkten Blickfeldes nicht möglich ist (vgl. Ziegler, 1999, S.37). Somit erscheint es naheliegend, über akustische Reize Zugang zum Patienten zu suchen. Musik ermöglicht dabei über das Gehör eine besondere Art der Kommunikation. Eine interessante Bemerkung am Rande: Während Sprache vom rechten Ohr besser aufgenommen wird als vom linken, ist dies bei der Musik genau umgekehrt der Fall (vgl. David, 1988, S.57). Physikalisch gesehen sind Sprache und Musik gleichermaßen akustische Signale. Während der menschliche Stimmapparat Timbre, Tonhöhe sowie Stimmlage unabhängig voneinander und stufenlos variieren kann, gilt dies nicht für ein Musikinstrument. Sprache vermittelt in erster Linie Information, gegebenenfalls wird diese im emotionalen Ausdruck musikalisch moduliert. Musik hingegen besitzt in der Hauptsache einen Affektcharakter, welcher mitunter durch sprachliche Information, also Gesang, moduliert werden kann. Musik ist somit wohl der intensivste emotionale Ausdruck, den sich der Mensch in seiner Kultur geschaffen hat, und gleichzeitig eine Voraussetzung für humane Existenz. Es ist keine einzige Kultur bekannt, die ohne ständiges Produzieren und Konsumieren von Musik lebt (vgl. Spintge, Droh, 1992, S.12-14). Dass Musik die Hirnpotentiale weitaus stärker anregen kann als das gesprochene Wort, ist eine bewiesene Tatsache (vgl. Van Deest, 1997, S.10). Dementsprechend wurde die Musik als Sprachmittlerin im Laufe der Menschheitsgeschichte des öfteren verdient gewürdigt. Claude Debussy meinte etwa, sie beginne dort, wo das Wort unfähig ist, sich auszudrücken. Nach Hans- Jürgen Hannich stellt die Musik eine universale, umfassende und präverbale Form der Sprache dar, die jenseits von Worten Menschen erreichen kann (vgl. Hannich, 1999, S.78). Außerdem, so Wolfgang Strobel, ist 15 die Musik wie die Sprache ein ubiquitäres, also ein überall verbreitetes Phänomen der menschlichen Kommunikation (vgl. Witzany, Schörkmayr, 1992, S.52) Diese subjektiven Aussagen werden von Forschern der Neurophysiologie konsequent bestätigt. Musiker wie Nichtmusiker sind gleichermaßen zum Schluss gekommen, dass das Ohr Tor zur Welt ist. Musik berührt im wahrsten Sinne des Wortes unvergleichlich früher als jeder andere Reiz. Soll mit Berührungen eine ebenso intensive Reaktion ausgelöst werden, wie mit akustisch-musikalischen Reizen, ist eine zehnmillionenmal höhere Reiz-Energie-Menge notwendig. Eine Begründung dafür geht bis in die Zeit der Jäger und Sammler zurück. Wollte man überleben, musste das Ohr auch im Schlafzustand, als Warnsinn vor lebensbedrohenden Wildtieren, funktionieren. (vgl. Decker-Voigt, 2000, S.40-41) Zugleich ist der Hörsinn eng mit unserer Gefühlswelt verbunden, was ursächlich an der direkten Verbindung der Ohren mit dem limbischen System, einer Art Gefühlszentrum unseres Körpers, liegt. (vgl. Van Deest, 1997, S.22). Alfred Tomatis, ein französischer Hals-Nasen-Ohren-Arzt und Musiktherapeut, lieferte Ende der 40er Jahre interessante Zusammenhänge zwischen Gehör und Verständigung. Seinen Forschungen zufolge drückt sich die gesamte Kommunikation in der Hörfähigkeit aus. Als Sohn eines Opernsängers waren viele seiner Patienten Musiker mit Stimmproblemen. Nach zahlreichen Frequenzanalysen von Gehör und Stimme kam er zur Erkenntnis, dass schlecht gehörte Frequenzen auch in der Stimme vermindert enthalten waren. Durch Verstärkung der schlecht gehörten Frequenzen ließ er die Sänger ihre korrigierte Stimme hören, was zu einem sofortigen Ausgleich des Frequenzverlustes führte. Stimmprobleme wurden daher als eigentliche Hörprobleme identifiziert. Im Verlauf seiner Studien erkannte Tomatis zudem eine enge Beziehung zwischen psychischer Verfassung seiner Klienten und ihrer Hörkurve und er stellte die Hypothese auf, dass Grundzüge der individuell unterschiedlichen Hörkurven in pränataler Zeit gelegt werden. Nach der allgemein anerkannten wissenschaftlichen 16 Auffassung kann man ab viereinhalb Monaten hören. Tomatis hingegen ist aufgrund seiner Versuche davon überzeugt, dass auditive Signale schon im ersten Monat in Form eines zellulären Gedächtnisses wahrgenommen und gespeichert werden. Da das äußere Ohr und Mittelohr aber voller Fruchtwasser sind, hört der Fetus in erster Linie über Skelettvibrationen. Tiefe Frequenzen wie Herzschlag, Darmbewegungen, Blutstrom in der Aorta, Atemfluss etc. werden, obwohl sie sehr laut sind, kaum weitergeleitet (vgl. Beckendorf, 1999, S.43-55). Hingegen wird die Stimme der Mutter, die über die Wirbelsäule in den Bauchraum und das Becken weitergleitet wird, durch die halbkugelige Form des weiblichen Beckens in den hohen Frequenzen noch zweieinhalbfach verstärkt. Gerade in den letzten Monaten einer Schwangerschaft ist durch die Verankerung des kindlichen Schädels im Becken eine intensive Kommunikation zwischen Mutter und Kind möglich. Die tiefen Frequenzen werden überwiegend im Vestibulum wahrgenommen, das mit allen quergestreiften Muskeln im Körper verbunden ist und für das Halten des Gleichgewichtes erforderlich ist. Die Haarzellen im Vestibulum werden sowohl bei Körperbewegungen als auch durch die rhythmische Einwirkung tiefer Frequenzen erregt. Daher erfolgt über tiefe Frequenzen gleichzeitig die Erinnerung an Bewegung und somit eine Stimulation des motorischen Systems über das Gehör. Je höher die Töne, umso mehr Haarzellen werden erregt. Folglich findet eine wesentlich stärkere Stimulation des Gehirns statt. So wirken Frequenzen im Bereich von 16 bis 100 Hertz einschläfernd auf die Psyche, jedoch stimulierend auf die Motorik. Zwischen 1000 und 3000 Hertz erfolgt eine Stimulation der Sprache, 3000 bis 8000 Hertz wirken belebend und vitalisierend. In einem Frequenzbereich über 8000 Hertz kommt es zu regressiven Tendenzen, zum Einnehmen von Embryonalstellungen, mitunter sogar zu vorgeburtlichen Wahrnehmungen (vgl. Beckendorf, 1999, S.43-55). Hierzu folgende Ergänzung aus der allgemeinen Musiklehre: Die Tonhöhe ist abhängig von der Anzahl der Schwingungen, je größer die Zahl der Schwingungen, umso höher auch der Ton. Der tiefste wahrnehmbare Ton hat etwa 16, der höchste um 20 000 Schwingungen je Sekunde. Diese werden in Hertz, benannt 17 nach Heinrich Rudolf Hertz, einem Physiker im 19. Jahrhundert, gemessen. Für Musik kommt nur der Tonbereich von ungefähr 30 bis 4000 Hertz in Frage (vgl. Bloch, 1973, S.4). Da die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart mit ihrem inneren Rhythmus, er entspricht ca. 0.5 Sekunden, dem Herzschlag eines Säuglings von 120 pro Minute am nächsten kommt, erinnert er uns stärker als jeder andere Komponist an diese frühe Zeit. Nach jahrelanger Forschungsarbeit beschrieb Alfred Tomatis diesen sogenannten Mozarteffekt (vgl. Beckendorf, 1999, S.58). Die Sprache Mozarts in seiner Musik übt einen befreienden, anregenden Einfluss aus. Sie bewirkt für den Zuhörer stets eine verbesserte räumliche Wahrnehmung und verhilft, unabhängig vom Geschmack des Hörenden, zu einem klaren Selbstausdruck. Vielleicht spricht in Mozarts Musik die Aura des ewigen Kindes zu uns, denn seine Talente offenbarten sich in sehr jungen Jahren. Auch in seiner pränatalen Zeit war er von Musik umgeben, durch das Violinspiel seines Vaters sowie die Lieder und Serenaden seiner Mutter (vgl. Campbell, 1998, S.42-44). 4. GRUNDLAGEN DER MUSIKTHERAPIE FÜR PFLEGENDE Der Einsatz von Musik als angewandte Therapieform erfreut sich am Beginn des 3. Jahrtausends einer bunten Vielfalt. Einen Überblick über ihre verschiedenen Anwendungen zu schaffen, ist - wenngleich nahezu unmöglich - die Absicht des folgenden Kapitels. Dann erfolgt eine Präzision der genannten Überlegungen im Hinblick auf die Intensivstation und die dortigen Möglichkeiten. Es soll beantwortet werden, welche wesentlichen Formen von Musiktherapie am Markt vorhanden sind und wo die allgemeinen Wirkungsfelder von Musik liegen. Das vordergründige Anliegen ist es, essentielle Grundlagen zum Verständnis der Musiktherapie für Pflegende herauszufiltern. Dabei ist es hilfreich, auch einige wichtige musiktheoretische Grundlagen zu erklären. 18 4.1 Musiktherapie einst und jetzt Die ältesten Zeugnisse über den therapeutischen Einsatz von Musik gehen bis ins 4. Jahrtausend vor Christus zurück und liegen in Ägypten. Damals war medizinische Behandlung eng verbunden mit religiösen Riten, wobei den Priesterärzten heilende Musik unter anderem zur Bannung böser Geister diente (vgl. Spintge, Droh, 1992, S.2-4). Neben unzähligen historischen Schriften zeugt das Alte Testament von Gesundungen, welche der Musik zugeschrieben werden. Die Geschichte des Saul erzählt, er sei durch Davids Spiel auf der Harfe von Depressionen befreit worden. „Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, so nahm David seine Harfe und spielte mit seiner Hand; so erquickte sich Saul, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm“ (1. Samuel 16,23). Auch in den Heilungszeremonien aller sogenannten primitiven Völker, etwa jener von Papua-Neuguinea, dem Amazonasgebiet oder den afrikanischen Buschmännern und den australischen Aborigines, spielt Musik eine entscheidende Rolle (vgl. Spintge, Droh, 1992, S.2-4). Die heute praktizierte moderne Musiktherapie ist nichts anderes als eine Rückbesinnung und Wiederbelebung dieser alten Erfahrungen, welche bei uns zum Teil in Vergessenheit geraten sind. Verbliebene Naturvölker ermöglichen uns, schamanische Praktiken zu studieren und diese in adaptierter Form zu übernehmen (vgl. Schroeder, 1995, S.19). Als Zielgruppe ihrer Anwendung umfasst die Musiktherapie der „zivilisierten“ Welt praktisch alle Menschen, die psychische und/oder physische Probleme haben und stellt einen Teilbereich der Psychotherapie dar (vgl. Witzany, 1992, S.53). Sie ist somit eine eigenständige Wissenschaftsdisziplin. Innerhalb der Musiktherapie kommt es - wie bereits der Name aussagt - zum Einsatz von Musik, doch handelt es sich hierbei nicht um die notwendige, alltägliche Musik, wie sie etwa beim Abtrocknen in der Küche, auf einer langen Autofahrt, im Kaufhaus oder Restaurant kaum mehr wegzudenken ist. Vielmehr gelangt in der Musiktherapie eine notwendende Musik in den Vorder19 grund, was wiederum eine entsprechende Ausbildung verlangt (vgl. DeckerVoigt, 2000, S.33-36). Der Begriff Musiktherapeut tauchte erstmals um die Wende vom 19. zum 20 Jahrhundert in London auf. Unterstützt von den zeitgenössischen Reformern, darunter Florence Nightingale, gab es Bestrebungen, auch den Krankenhäusern der Provinzstädte Musikgruppen zur Verfügung zu stellen. Die medizinische Fachpresse wie etwa Lancet und British Medical Journal berichtete über offensichtliche Erfolge und regte gemeinsam mit Ärzten zum verstärkten Einsatz von Musiktherapie an. Ähnliche Bewegungen sind Anfang des 20. Jahrhunderts aus den USA bekannt, doch sind sie ebenso wie jene in England gescheitert, unter dem Druck von medizinischer wie auch musikalischer Seite und letztendlich an dem Mangel an finanziellen Möglichkeiten. Der hohe Anteil von Veteranen des 2. Weltkrieges in den Krankenhäusern nahm einen nachhaltigen Einfluss auf die weitere Entwicklung. Musiker wurden als Teammitglieder in Krankenhäusern eingestellt und waren nunmehr herausgefordert, ihre Arbeit zu verifizieren und die Ergebnisse musikalischer Interventionen bei spezifischen Indikationen zu untersuchen, wenngleich dies aufgrund der mangelnden psychologischen und medizinischen Kenntnisse schwierig war (vgl. Bunt, 1998, S.13-15). Nach dem derzeitigen Entwicklungsstand gibt es eine Reihe von Schulen und Vertretern der Musiktherapie. Alle in einen textlichen Rahmen zu bringen wäre ein Ding der Unmöglichkeit, ist es doch grundsätzlich schon schwierig, Musik in Worte zu fassen. Eines haben aber alle Teilbereiche der Musiktherapie gemeinsam: Entgegen dem primär kurativ ausgerichteten Interventionssystem mit seiner stark technisch apparativen Struktur gehen sie davon aus, dass Gesundheit mehr mit einer umfassenden Lebenskompetenz zu tun hat als mit einer Restgröße Krankheit (vgl. Van Deest, 1997, S. 12-13). Musiktherapie räumt der Prophylaxe einen ebenso hohen Stellenwert ein wie der Therapie (vgl. Witzany, Schörkmayr, 1992, S. 48). Ihre Fundamente gehen vollständig einher mit dem Hintergrund der ganzheitlichen Pflege und lassen sich folglich mit den Ansätzen der ganzheitlichen pflegerischen Sichtweise des Menschen gut in Kombination bringen. 20 4.1.1 Rezeptive Musiktherapie Die Pioniere der Musiktherapie in Deutschland um 1945 hörten gemeinsam mit ihren Patienten Musik, welche sie entweder selbst auf Instrumenten vorspielten oder aber durch Tonträger übermittelten. Im Anschluss daran wurden Erlebnisse, Erinnerungen, Gefühle beziehungsweise Bilder, die im Zusammenhang mit dem Gehörten aufgetaucht sind, besprochen. Jene rezeptive Form musiktherapeutischer Arbeit ging lange Zeit aus von musikausübenden Ärzten, Schwestern und Pflegern und wird zum vordergründigen Inhalt der präsenten Fachbereichsarbeit (vgl. Schroeder, 1995, S. 32). Das Hören von Musik ist also Bestandteil des therapeutischen Vorgehens bei der rezeptiven Musiktherapie, wobei sowohl einzel- als auch gruppenmusiktherapeutische Methoden Anwendung finden. Die dem Patienten zu Gehör gebrachte Musik soll körperliche oder psychische Prozesse in Gang setzen, die zur Heilung bzw. Linderung von Krankheiten und Beschwerden führen. Dabei gibt es Unterschiede im theoretischen Hintergrund, in den Methoden und im Setting. Der folgende Abschnitt handelt im Detail darüber. (vgl. Frank- Bleckwedel, 1996, S.327). Bei der ‚Rezeptiven Musiktherapie’ als Psychotherapie ist die Triade Patient – Therapeut - Musik entscheidend. Die Schrittfolge der therapeutischen Beziehung orientiert sich ausschließlich an der Befindlichkeit des Patienten (vgl. FrankBleckwedel, 1996, S.327-328). Therapeutische Handlungsweisen sind darauf ausgerichtet, eine bestimmte Erlebnis- und Verhaltensbeeinflussung zu erreichen. Das darf aber nicht mit suggestiv beabsichtigten Musikwirkungen verwechselt werden, wie sie z.B. bei operativen Eingriffen eingesetzt werden. Innerhalb der dynamisch orientierten rezeptiven Gruppenmusiktherapie wird die Auswahl der Musik durch einzelne Gruppenmitglieder oder durch Gruppenbeschluss getroffen, was schließlich den Ausgangspunkt für verbale und nonverbale Interaktionen innerhalb der Gruppe darstellt (vgl. Schwabe, 1996, S. 213-216). Die reaktive Gruppenmusiktherapie (RGM) zielt darauf ab, affektiv-dynamische Reaktionen auszulösen, welche durch die Rezeption emotional stimulierender 21 Musik erzielt werden (vgl. Schwabe, 1996, S. 213-216). Kommunikative Einzelmusiktherapie (KEMT) meint die Entwicklung einer vertrauensvollen Psychotherapeut-Patient-Beziehung, wobei Musik Brücke zum gegenseitigen Vertrauen sein kann. Es ist dies nicht unbedingt Repertoire des Musiktherapeuten, sondern betrifft vielmehr Ärzte und Psychotherapeuten. Neben der KEMT ist auch die Reaktive Einzelmusiktherapie eingebettet in die psychotherapeutische Einzelgesprächsführung. Die Mobilisierung und Auslösung kurzzeitiger affektiver Reaktiven auf der Basis des Vorhandenseins angestauter, unbewältigter affektiver Spannungen beim Patienten steht dabei im Vordergrund (vgl. Schwabe,1996, S. 213-216). Die Regulative Musiktherapie (RMT) stellt den in der psychotherapeutischen Praxis am weitesten verbreiteten und international bekanntesten Bereich der rezeptiven Methode dar, welche sich mittlerweile immer mehr hin zu einer tiefenpsychologisch ausgerichteten Konzeption entwickelt hat (vgl. Schwabe, 1996 S. 317). Eine modifizierte Methode der Regulativen Musiktherapie ist das Regulative Entspannungstraining mit Musik. Dabei handelt es sich um ein psychologisches Verhaltenstraining, mit dem Ziel der psychophysischen Selbstregulierung von inneren Spannungszuständen sowie der Aktivierung von Kreativität und Lebenslust. Dies bietet sich an bei psychisch besonders belasteten Personen mit der Motivation, über regelmäßiges Training eine Besserung der Befindlichkeit zu erreichen (vgl. Schwabe, 1996, S.215). Die ungerichtete Rezeptive Musiktherapie (UREM) besteht aus regelmäßigen Musiksendungen von 20 bis 30 Minuten, welche zentral in die Patientenzimmer übertragen werden, mit dem Aufruf, sich auf Erlebniserweiterung einzulassen, sich zu überlassen und auf Persönliches, auf aktuelle Ereignisse des Therapietages zu besinnen. Diese Form ermöglicht dem Patienten, mit bestimmten Erlebnisentwicklungen zeitweise mit sich allein zu sein. Von Bedeutung ist daher, dass neben der individuellen Kontaktnahme des Patienten mit der Musik eine interpersonelle Begegnung zwischen Patient und Therapeuten stattfindet. Eingesetzt wird die 22 UREM in psychotherapeutischen Kliniken ebenso wie in Suchtkliniken und Stationen der Inneren Medizin mit psychosomatisch-psychotherapeutischer Ausrichtung (vgl. Schwabe, 1996, S.216). Im Gegensatz zur UREM werden bei der ‚Musikgeleiteten Imagination’ die entstehenden Gefühle, Bilder, Körperempfindungen, Erinnerungen und dergleichen während des Zuhörens an den Therapeuten mitgeteilt. Musik fungiert dabei als projektives Medium (vgl. Frank-Bleckwedel,1996, S.328). Musikmachen in Verbindung mit Tanzen, Malen und anderen künstlerischen Tätigkeiten ist ein neuer Aspekt in der Musiktherapie geworden. Im Bereich der Anästhesie und Schmerztherapie ist auch die funktionelle Musiktherapie von Bedeutung. Wie bereits der Name sagt, steht nicht Beziehungsarbeit sondern die Funktion der Musik im Mittelpunkt. Im Handel erhältliche Do-it-yourself- Angebote sind davon weitgehend auszuschließen. Obwohl etwa Offerte zur Raucherentwöhnung oder Entspannung durchaus therapeutische Effekte haben und sozusagen zur Bereicherung der „Hausapotheke“ werden können, fallen diese nicht unter die Kategorie „Musiktherapie“ (vgl. Frank-Bleckwedel, 1996, S.328-329). Unter dem Stichwort Klangtherapie wird der Einsatz spezieller Instrumente wie Gongs, verschiedener Trommeln, Klangschalen oder des Monochords zum Herbeiführen tranceähnlicher Zustände beleuchtet. Es sind dies spirituelle Richtungen der Musiktherapie, welche sich das Wissen außerwestlicher Heilkunde nutzbar machen und in den letzten Jahren auch in Europa mehr und mehr an Bedeutung gewinnen (vgl. Frank-Bleckwedel, 1996, S.328-239). 4.1.2 Aktive Musiktherapie Empirische Forschungsarbeiten lassen die Wirkung von Musik heute nicht mehr 23 anzweifeln. Gerade im angloamerikanischen Raum werden intensive Forschungen betrieben, was den Einsatz von Musik im klinisch-therapeutischen Zusammenhang betrifft. Die Wirkungsweisen der Musik sind mittlerweile weit über den biologisch-physiologischen Bereich geprüft und nachgewiesen (vgl. Van Deest, 1997, S.8). Im deutschsprachigen Raum ist in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg immer mehr die aktive musikalische Betätigung des Patienten im Rahmen der Musiktherapie in den Vordergrund gerückt (vgl. Gembris, 1997, S.119-127). Dabei hört der Patient ebenso auf die Töne wie bei der rezeptiven Form der Musiktherapie, doch gehen diese aus seinem eigenen Musizieren, aus dem des Therapeuten oder aber aus dem Spiel anderer Patienten hervor. Der Therapeut wiederum hört auf das Spiel des Patienten und kann so über ihn Wesentliches in Erfahrung bringen (vgl. Van Deest, 1997, S.97). Witzany und Schörkmayr kommen im Aufzeigen von aktuellen Tendenzen zu folgender Klärung des Begriffes Musik in der Musiktherapie: „Bei der Definition, was in der Musiktherapie dem Begriff „Musik“ zukommt, müssen wir also annehmen, dass es sich nicht unbedingt um Musik handelt, sondern um akustische Äußerungen, die von psychotherapeutisch kompetenten Musiktherapeuten interpretiert werden“ (Witzany, Schörkmayr,1993, S.52). Weiters gibt die Literatur von Witzany und Schörkmayr Aufschluss über die ganz speziellen Kompetenzen, welche einem Musiktherapeuten abverlangt werden: „Ein Musiktherapeut muss meines Erachtens in dem Sinne ein „Künstler“ sein, dass er echt und authentisch spielt, ohne „privat“ zu werden. Ich spreche hier vom Künstler (der sein Handwerk beherrscht) statt vom Musiker, um damit anzudeuten, dass sowohl Therapeuten als auch Musiker nur dann überzeugend sind, wenn sie in diesem Sinne Künstler sind. (...) Nach unserer Auffassung muss der Musiktherapeut zwar ein guter Musiker sein, aber nicht unbedingt Pianist“ (FrohneHagemann, S. 304, zitiert nach: Witzany, Schörkmayr,1993, S.52). 24 Es steht also nicht das perfekte Spiel sondern vielmehr das harmonierende Zusammenspiel von Therapeuten und Patient im Vordergrund. Nicht das Medium Instrument oder der Klang ist entscheidend, sondern die therapeutische Beziehung (vgl. Witzany, Schörkmayr, 1993, S.52). Improvisation ist das Alpha und Omega der aktiven Musiktherapie, in der Gruppe genauso wie einzeln. Dabei werden u.a. Tagtraum-Bilder der Patienten eingebunden. Es kann sich aber durchaus auch um Musik handeln, die an Noten gebunden ist. Dem Spielen folgt schließlich eine Gesprächsphase. Sie dient dem Austausch zwischen Patient und Therapeut und kann möglicher Inhalt für die nächste Improvisation werden (vgl. Decker- Voigt, Knill, Weymann, 1996, S.5). Auch die Wahl der Instrumente ist ein wichtiges Kriterium im Therapieverlauf und Gegenstand des therapeutischen Gesprächs. Ein Wechsel des Instruments ist dabei nicht selten, denn die Entscheidung für ein bestimmtes Instrument sowie der Umgang damit mag Aufschluss geben über die Haltung zum eigenen Körper. Beide Therapieformen - aktiv wie passiv - schließen die Begleitung des Patienten mit ein, wobei versucht wird, ihn dort abzuholen, wo er im Augenblick emotional steht. Therapie bedeutet aus der Schulmedizin übernommen und auf die Psychotherapie angewandt die Behandlung von Krankheiten mit dem Ziel der Heilung oder zumindest der Besserung beziehungsweise Linderung von Beschwerden (vgl. Schroeder 1995, S.24-26). 4.2 Die Physiologie der Töne Sämtliche Behandlungsziele, -methoden und –verfahren in der Musiktherapie haben die Nutzung des gleichen Materials gemeinsam (vgl. Van Deest, 1997, S.16). Die Elemente Rhythmus, Melodik, Harmonie und Lautstärke sind Grundpfeiler im Zusammenhang mit der musikalische Wirkung auf den Menschen (vgl. Decker-Voigt, 2000, S.55). Trotz einer Anzahl von sehr unterschiedlichen Kulturen lassen sich in allen Teilen 25 der Welt bestimmte Vorlieben für gewisse Richtungen der westlichen Musikkultur feststellen. Während Bach, Mozart, Beethoven oder Schubert auch im asiatischen Raum erfolgreich sind, wirken beispielsweise arabische Gesänge für den Europäer monoton und unverständlich. Die Musik der Beatles oder Rolling Stones, die auf den gleichen Harmonien der europäischen Klassik basiert, zählt zu den Verkaufsschlagern auf allen vier Kontinenten. Worin liegen nun die Gründe für das allgemeine Verständnis der westlichen Musikkultur? Ist die europäische Tonalität mit ihren Dreiklängen und Kadenzen, mit Dur und Moll tatsächlich eine für alle Menschen verständliche Sprache oder lässt sich die Dominanz dieser Art und Weise des Musizierens mit einer abendländischen Überheblichkeit erklären?1 4.2.1 Die Intervalle im Blickfeld der Musiktherapie Nicht alles, was an unser Ohr kommt, „klingt“. Bei Geräuschen vermeidet man das Wort Klingen und spricht statt dessen von Knarren, Brausen, Dröhnen, Klirren oder aber man setzt die Tätigkeit, die das Geräusch hervorbringt, ein, als Beschreibung des Eindruckes wie etwa Hämmern, Stampfen oder Kratzen. Nur im Bereich der Musik spricht man auch vom Klang. Den Unterschied zwischen Tönen und Geräuschen erklärt uns die Physik durch regelmäßige und unregelmäßige Schwingungsformen. Reine Töne kommen in der Natur nur selten vor, wirken sie doch grau und fahl. Im Vergleich dazu erscheint das farbenreiche Klangbild von Instrumenten eines Sinfonieorchesters wie ein Bild der Lebensfreude. Zwischen den Tönen und Geräuschen stehen die Klänge, welche sich aus einander überlagernden Tonschwingungen zusammensetzen. Die Grenze zwischen Geräusch und Klang lässt sich in 1 vgl. Zeitschrift, GEO-WISSEN, Sept. 1997 26 der Praxis schwer feststellen, denn jeder in der Natur vorkommende Klang, auch von Instrumenten hervorgebracht, besitzt Geräuschanteile. Eine Reihe von Musikforschern und Dirigenten, darunter auch Leonard Bernstein, sah damit auch einen naturwissenschaftlich belegbaren Grund für den Siegeszug der Klassik. Die Obertonreihe als eines unserer wichtigsten Grundgesetzte vermag es, Musik in emotional sehr leicht zugänglicher Weise näher zu bringen. Schon der griechische Philosoph und Mathematiker Phythagoras erkannte diese ganzzahligen Teilungsverhältnisse. Anhand eines Versuches am Monochord, einem kastenförmigen Resonanzkörper, über den er eine Saite spannte, entwickelte er die bis zur heutigen Zeit geltende Obertonreihe. Erklingt auf einer Saite das C, so teilt sich die Saitenschwingung nach festen physikalischen Regeln in gleiche Abschnitte. Dabei entstehen gleichzeitig neue Töne, immer leiser und immer höher, die die meisten Menschen zwar nicht bewusst heraushören können, jedoch als Klangfarbe wahrnehmen. So setzt sich die Obertonreihe aus jenen Tönen zusammen, die mit einem Grundton mitschwingen. Auch die Klangfarbe der menschlichen Stimme und der traditionellen Musikinstrumente ist abhängig von Anzahl, Auswahl und Lautstärke der Obertöne, welche einen beachtlichen Einfluss auf unsere Sympathie bestimmten Klängen gegenüber nehmen. Die Obertöne machen den erzeugten Schall klanglich reicher, die Frequenzen der einzelnen Obertöne sind ganzzahlige Vielfache des Grundtones und geben dem entstehenden Klang seinen besonderen Charakter, seine Klangfarbe. Stark grundtonhaltige Klänge werden als weich und angenehm empfunden. Klänge, bei denen der erste Oberton überwiegt, wirken ordinär. Dominieren sehr hohe Frequenzen, so entsteht je nach Anteil des Grundtones ein tragfähig bis scharfer Eindruck. Aus der Erkenntnis über das Vorhandensein der Obertöne ergaben sich zudem die Intervallabstände unserer abendländischen Musikkultur: Prim, Sekund, Terz, Quart, Quint, Sext, Septime, Oktave. Denn unterteilt man die Saite am Monochord mit einem Steg genau in der Mitte und zupft die halbierte Saite an, so ergibt sich genau die Oktav. Das Zahlenverhältnis 1:2 klingt also als Oktav. Wird nun die Saite dreigeteilt und in der gedrittelten 27 Saite angezupft, so erklingt die Quinte. Das Verhältnis ist 2:3. Die Intervalle sind, als Bausteine für Tonfolge und Melodiebildung, Bestandteile der Harmonie. Doch sind sie nicht bloßer Abstand zwischen zwei Tönen sondern gleichzeitig ein musikalisch bedeutendes Kraftelement (vgl. Ruland, 1990, S. 78). Absteigende Melodien beispielsweise vermitteln eher das Gefühl der Trauer, anders die aufsteigenden. Melodien, die weder eindeutig auf- noch abwärts gerichtet sind, haben hingegen einen eher erzählenden Charakter aufzuweisen (vgl. Van Deest,1997, S. 142). Die Quint vermag es, einen Patienten aufatmen zu lassen und ihn aus seiner stark krankheitsbedingten Eigenwahrnehmung herauszulösen, ihm Vertrauen zu geben für die helfende Umwelt. Während die steigende Quint als Empfindung des staunenden sich Öffnens das Einatmen betrifft, bedeutet die fallende Quint eine Empfindung des befriedigten Zu-sich-Kommens im Ausatmen, ein erlösendes Antwort-Empfangen und Boden-Finden. Das Quinterlebnis entspricht dem Bewusstseinszustand des Kindes, das mit seiner Umwelt vertrauensvoll verbunden ist und erst allmählich eine eigene Innenwelt aufbaut. Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, dass Magersüchtige eine Vorliebe für genau diesen musikalischen Ausdruck haben. Aus musiktherapeutischer Sicht gilt es, den Kranken abzuholen und in die innerliche Quart- und Terzsphäre zu leiten. Diese drücken Lebendigkeit und Lebensfreude aus. Bei Asthma oder Magengeschwüren hingegen eignet es sich, das Quinterlebnis zu intensivieren. Es sind dies Krankheiten, bei denen sensitives Seelisches zu stark ins Vegetative hinein oder besser hinunter wirkt. Hierbei gelingt es der Quint, das tief ins Innere Verknotete aufzulösen (vgl. Ruland, 1990, S.78-79). Durch das Zusammenwirken verschiedener Töne, etwa durch Akkorde oder Harmonien, entsteht ein Klang. Dabei sind Harmonien Zusammenklänge, die als wohltuend und passend empfunden werden, im Gegensatz zu den Disharmonien, den weniger schönen Klängen (vgl. Van Deest, 1007, S.97-98). Da die traditionelle Musik zumeist bestimmte Akkordverbindungen benutzt, hat sich allerdings unser Ohr schon so weit daran gewöhnt, dass uns nur mehr die Fehler ins Be28 wusstsein gerufen werden. Unsere Aufmerksamkeit konzentriert sich neben der Melodie vorwiegend auf den Rhythmus (vgl. Altmann, Reiter, Würzl, 1980, S.76). 4.2.2 Rhythmos und Tonos Rhythmen hatten von Anbeginn der Menschheit eine besondere Bedeutung. Bestimmt durch die Abfolge von Tag und Nacht, Neu- und Vollmond, der Wiederkehr der Jahreszeiten sowie des weiblichen Zyklus ist anzunehmen, dass das frühmenschliche Zeitbewusstsein zyklisch-rhythmisch gestaltet war (vgl. Spintge, Droh, 1992, S.3). In der Musik ist das Gegenspiel von Rhythmos und Tonos, von Strömen und Halten ebenso bedeutend. Das tonosartige an Musik fordert uns etwa auf zum Hinlauschen, dagegen trägt uns stark rhythmische Musik, nimmt uns mit, sie lässt uns unwillkürlich wippen, wir wollen dazu tanzen und fühlen uns bewegungsmäßig angesprochen. Je nachdem, wie stark der Rhythmus im musikalischen Erleben zu spüren ist, fühlt man sich springlebendig (vivo, vivace), frisch und munter (allegro) oder müde und schwer (grave), möglicherweise zu Tode ermattet (morendo). Dieses unterschiedliche Strömungs- und Lebensgefühl hängt zum einen vom musikalischen Tempo, zum anderen vom Verhältnis des gewählten Tempos zum Herzschlag ab. Alles, was unter einer normalen Pulsfrequenz liegt, wird als ruhig, gesetzt, behäbig bis müde empfunden, darüber als anregend bis fieberhaft hetzend. Leise, nur obenhin angetupfte Klänge in hohen Tonlagen erzeugen mehr Tonos- Lichtgefühl. Musik in legato und forte mit tiefen Komponenten und dunkler Klangfarbe belebt ein Rhythmos-, Lebens- und Kraftgefühl (vgl. Ruland, 1990, S.56-67). 29 4.2.3 Sympatiko- und Parasympatikotone Wirkungen von Musik Die Unterscheidung zwischen ergotroper und trophotroper Musik spinnt den Gedanken von Rhythmos und Tonos ein Stück weiter und ist wichtig im Hinblick auf vegetative Veränderungen, welche durch den Einsatz von Musik beim Kranken ausgelöst werden können. Merkmale ergotroper, übersetzt leistungssteigernder Musik sind neben harten Rhythmen, die sich im Verlauf des Stücks beschleunigen und vorwiegend in Dur stehen, Dissonanzen und höhere Dezibelstärken. Starke akzentuierte Rhythmusgestaltung und Stakkato-Charakter sind ebenso Kennzeichen ergotroper Musik. Sie führen zu einer Erhöhung des Blutdrucks, zu Beschleunigung von Atemfrequenz und Puls. Es kommt außerdem zu vermehrtem Auftreten rhythmischer Kontraktionen der Skelettmuskulatur. Die Pupillen erweitern sich, ein erhöhter Hautwiderstand ist bemerkbar. Demgegenüber bewirkt die trophotrope Musik als schwebende, vorwiegend in Moll stehende Musik mit geringen Dezibelstärken und deutlich vorherrschenden Konsonanzen ein Herabsetzen der Vitalparameter, Entspannung der Skelettmuskulatur, Pupillenverengung, geringeren Hautwiderstand sowie möglicherweise Beruhigung und Somnolenz. Während ergotrope Musik sympathikoton beeinflusst, stimuliert trophotrope Musik den Nervus Vagus und wirkt damit parasymphatisch. Wenn wir auch emotional gegen eine bestimmte Musik sind, auf der vegetativen Ebene reagieren wir mit ihr (vgl. Decker- Voigt, 2000, S.55-80). Dieser Ausflug in die grenzenlose Welt der musikalischen Wirkungsmechanismen verdeutlicht, dass es für den Musiktherapeuten ein umfassendes Studium erfordert, um die differenzierten Erlebnisqualitäten zu erforschen. Wenn Musik in den Pflegealltag einfließt, ist es daher notwendig, ein Empfinden für die Tragweite der musikalischen Wirkungen zu entwickeln. 30 5. DER EINSATZ VON MUSIK IM INTENSIVBEREICH Gerade im Intensivbereich, an einem vielfach als trostlos empfundenen Ort, gelingt es der Musik immer wieder, Licht in den finsteren Alltag zu bringen. Erfahrungen, dass Patienten die tage- oder sogar wochenlang keinerlei Lebenszeichen äußerten, die Augen öffneten, die Hand drückten oder sogar lächelten, spornen an zur Pflege mit Klängen (vgl. Van Deest, 1997, S.10). Das folgende Kapitel geht im Konkreten der Frage nach, welche Erfolge Musiktherapie beim kranken Menschen im Intensivbereich bisher aufzuweisen hatte und welche wissenschaftlichen Belege dafür vorhanden sind. Kann durch den gezielten Einsatz von Musik eine positive Stimulation des Patienten erreicht werden und ist dies nur einer bestimmten, dafür geeigneten Zielgruppe vorbehalten? Außerdem soll ermittelt werden, welche Krankheitsbilder im Besonderen für den Einsatz von Musik geeignet sind. 5.1 Musik kontra Stressoren beim Komatösen Die Inhalte der durch Musik hervorgerufenen emotionalen Reaktionen beim Bewusstlosen sind nicht messbar. Doch geben quantitative Aussagen in Form von vegetativen Reaktionen aufschlussreiche Auskünfte, die im Zusammenhang mit der Anwendung von Musik als Intervention gegen Stressoren sehr zielführend sind. Die Grundlagen der Musiktherorie im Hinblick auf die therapeutische Wirkung wurden im Kapitel zur Physiologie der Töne ausführlich behandelt. Nun aber stellt sich die Frage der Umsetzung: Einen wehrlosen Menschen mit Kopfhörern zu beschallen, ist wenig einfühlsam, ja beinahe brutal (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S.131). Selbst die weitverbreitete Meinung, laufende Radio und Kassettenrekorder ermöglichten ein entspannteres Arbeiten, ist eine Irrtum. Abgesehen davon, dass Fehler entstehen können, ist es oft schwierig, sich auf einen Sender zu einigen. Außerdem hört man unwillkürlich auf Geräusche, die nebenbei erzeugt werden. 31 Wenn man sich wirklich mit seinen Patienten verbindet, gehören auch die Gedanken dazu, genauso wenn man Medikamente richtet oder Spritzen aufzieht (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S. 135). Natürlich gibt es dennoch Situationen, in denen Musikhören, trotz aller Vorbehalte, sinnvoll und angezeigt erscheint, doch muss es sich um sorgfältig gestaltete Einzelsituationen handeln. Vor dem Hintergrund, für Angehörige ein Begegnungsfeld zu schaffen, ist etwa das Einsetzen von Lieblingsmusik, besonders bei einstmaligen Musikliebhabern, durchaus zu unterstützen. Zu beachten sind dabei mögliche traumatische Erlebnisse. Das Spielen der bevorzugten Literatur kann aus der Sicht des Patienten negativ besetzt sein, wird diese in Verbindung mit einem Unfallgeschehen gebracht, welches den bestehenden Krankheitszustand ausgelöst hat (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S.140). Die Wahl des richtigen Materials, was zum einen in der Arbeit mit komatösen und bewusstseinseingeschränkten Patienten nicht immer leicht ist, zum anderen die Kenntnis der verschiedenen Epochen und Stilrichtungen voraussetzt, ist sehr entscheidend (vgl. Schroeder, 1995, S.34). Je nach Art der Musik bewirkt diese eine mehr oder weniger starke Regression. Musik, die starke kulturelle Bezüge herstellt oder literarische Verbindungen durch den Text schafft, hält die Regression unter Kontrolle. Je weniger Bezugspunkte an Rhythmus, musikalischer Konstruktion oder an Instrumenten bestehen, umso größer ist die Gefahr, dass sie als beängstigend oder bedrohlich empfunden wird. Sind viele Anhaltspunkte, vor allem in Metrum und Harmonien vorhanden, kann sich das Gefühl einer affektiven und körperlichen Geborgenheit einstellen, wie etwa bei Werken von Bach, Vivaldi, Mozart aber auch bei jeder volkstümlichen Musik, bei Volks- und Wiegenliedern (vgl. Lecourt, 1979, S.117-119). Bei der Vorbereitung des Raumes zur Konfrontation des Patienten mit Musik, ist auf eine Optimierung des akustischen Umfeldes zu achten. Es sollte gewährleistet sein, dass keine Alarme durch leere Infusionsflaschen auftreten. Die Therapie darf nicht durch Visiten, Untersuchungen oder Lagerungen unterbrochen werden. 32 Dass sich der Patient in einer möglichen Schlafphase befindet, ist im Vorhinein auszuschließen. Nach sorgfältiger Auswahl der Musik berührt man den Patienten und klärt ihn darüber auf, dass man mit ihm gemeinsam Musikhören möchte. Die Betonung liegt dabei auf gemeinsam und schließt ein, dass ein Wiedergabegerät mit externen Aktivboxen in der Nähe des Patienten steht oder aber die Kopfhörer im Abstand von etwa 20 cm seitlich des Kopfes liegen. Der Patient hat das Recht, zu wissen, was er hört, und er sollte erfahren, dass es nur ein Stück sein wird. Er wird im Vorhinein darüber informiert, dass dieses abgebrochen wird, wenn man merkt dass es ihm nicht gefällt (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S.142). Die Lautstärke ist leise zu wählen, um den erwünschten Effekt zu erreichen. Die arbeitende und sich dabei bewegende Pflegekraft stuft Musik oft als sehr leise ein, für den Patienten mag sie hingegen laut wirken (vgl. Keller, 1999, S.89). Bei weitem besser bewährt als das gemeinsame Hören von Musik hat sich bei Komatösen die Methode des Singens im Atemrhythmus. Engagierte Angehörige sowie geübte Mitarbeiter im Pflegeteam können sich diese Form der Begegnung durchaus zutrauen, sofern der Patient in der Lage ist, die Frequenz der Atmung selbst zu beeinflussen beziehungsweise keine pathologischen oder extrem schnellen Atemmuster vorhanden sind. Voraussetzung ist außerdem, dass der Patient vegetativ stabil ist und keine Hirndrucksteigerung zu erwarten ist. In diesem Fall ist die Behandlung einem Musiktherapeuten zu überlassen (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S.144-145). Der Patient ist so zu lagern, dass, wenn Rückenlage nicht möglich ist, in Seitenlage wenigstens ein Ohr frei bleibt. Der Singende platziert sich so, dass er bestmöglich zum Gesicht und Brustkorb des Patienten sehen kann. Er berührt ihn, stellt sich vor und erklärt in größtmöglicher Ruhe, was ihn erwartet. Dann erfolgt zunächst ein genaues Hinhören, Hinschauen und Offenwerden für die Äußerungen, die das Gegenüber entgegenzubringen hat. All das in Erfahrung Gebrachte kann schließlich in den musikalischen Dialog aufgenommen werden. Dabei eignet sich der Atemrhythmus des Patienten am besten. Es kann sehr genau wahrgenommen werden, ob dieser flach, flüchtig, ängstlich, kräftig, ruhig oder hastig ist. (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S.144-145). 33 Der Patient kann diesen Rhythmus auch selbst beeinflussen, sogar der Beatmete ist in der Lage, seinem zentralen Rhythmus Individualität zu verleihen. Als Sänger versuche ich mich auf den Atemrhythmus des Patienten einzustimmen, ich nehme ihn auf und atme mit dem Patienten, letztlich singe ich in seinem Rhythmus. Die gesangliche Improvisation richtet sich vollkommen nach den Möglichkeiten des Patienten, sie entwickelt sich gemeinsam mit ihm. Dabei wird leise gesummt, ohne Worte. Auch Musikinstrumente haben sich in diesem Zusammenhang als eher störend erwiesen. Die eigene Stimme, als das persönlichste und flexibelste Instrument, scheint am besten dafür geeignet zu sein, sich auf den Patienten einzustellen . Es ermöglicht den direktesten Kontakt von Mensch zu Mensch und bei jedem komatösen Patienten entsteht eine ganz persönliche Musik. (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S.144-145). Die Improvisation muss erinnerbar sein, damit sie gegebenenfalls in Teilen wiederholt werden kann. Tonart- und Stil richten sich ganz nach dem Charakter der Atmung des Patienten und nach dem Gesamteindruck. Die musikalische Begegnung wird nach 6- 10 Minuten beendet, nicht zuletzt deshalb, weil die nötige Konzentration vom Ausführenden nicht länger gewährleistet ist. Die Lösung vom Patienten kann schwierig sein, daher wäre es ideal, wenn eine andere Person die Aufgabe des Ablösenden übernimmt (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S.62-70). Eine Patientin berichtet über ihr Erleben dieser Therapie: „ ... ein wunderbares Ereignis, mehr als schön, ein intensives, tiefes Erlebnis. Der Gesang der Musiktherapeutin traf mich im Herzen und ist darin geblieben. Ich erlebte, aus der Dunkelheit eines Tunnels ins Helle zu kommen. Mit dem Gesang kam das Licht. In diesem Moment fiel die Entscheidung zum Leben“ (Gustorff, Hannich, 2000, S. 67-68). 34 5.2 Musiktherapie in den diversen Intensivbereichen Die Intensivpflege verlangt es, sich eingehend mit den Besonderheiten die den komatösen Patienten betreffen, auseinanderzusetzen. Doch begegnen wir im Rahmen der Intensivmedizin einer Reihe von Krankheitsbildern, bei denen der Patient durchaus wach ist. Der Einsatz von Musik ist nunmehr aus einer völlig neunen Perspektive zu sehen. Neben der Darstellung verschiedener Fachgebiete im musiktherapeutischen Blickpunkt wird im Weiteren verstärkt auf musikalische Wirkungen beim wachen Patienten eingegangen. Es ist festzuhalten, dass kein einziger Hinweis auf eventuelle negative Effekte bei Beachtung der jeweiligen Indikationen und Kontraindikationen vorhanden ist. Nur die Epilepsie wird als mögliche Kontraindikation für Musik beschrieben (vgl. Spintge, Droh, 1992, S. 40). 5.2.1 Musik in der Anästhesie In den operativ tätigen Fachgebieten Chirurgie, Orthopädie und Urologie sowie in der fachübergreifenden Anästhesiologie liegt eine Vielzahl von Erfahrungen mit dem Einsatz anxiolytischer Musik vor. Spintge definiert die anxiolytische, übersetzt entspannende Musik, als die vom Patienten subjektiv erlebte und/oder die vom Beobachter objektiv feststellbare Abwesenheit von Angst, gemessen an den drei Verhaltensebenen der Emotion Angst: der kognitiv-verbalen, der physiologischen und der psychomotorischen Ebene. Wie in Kapitel 4 erwähnt, handelt es sich hierbei um suggestiv beabsichtigte Musikwirkungen. Eine sogenannte Hörapotheke anzulegen, ist hier durchaus sinnvoll. Während beim Komatösen Rückzug vermieden werden soll, steht jetzt die „passivierende“ Wirkung der Musik im Vordergrund. Instrumentalmusik ist dabei der Vokalmusik stets vorzuziehen. Das gesungene Wort weckt analysierende Aufmerksamkeit und regt zur Konzentration an, entgegen dem in der Anästhesie erwünschten Effekt. Spintge berichtet von klinisch kontrollierten und randomisierten Studien, die der Musik außerordentliche Erfolge zuweisen. 35 Der Einsatz von frei wählbaren Musikprogrammen wurde vom überwiegenden Anteil der Patienten als psychophysiologische Anästhesie- und Operationsvorbereitung während der präoperativen Wartezeit und der Narkoseeinleitung als psychische Stütze empfunden. Die Prämedikation von Triflupromazin (Psyquil) und Thalamonal konnte damit um 50 Prozent gesenkt werden, dabei wurde der Status des Patienten vor, während und nach der Anästhesie nicht beeinflusst. Der Prä- intra- und postoperative Bedarf an Anästhetika, Relaxantien und Analgetika blieb im Vergleich zur normalen Prämedikation unverändert (vgl. Spintge, 1988, S. 160-164). Dem anxiolytischen Effekt der Musik bedient man sich in allen Bereichen der Schmerztherapie (vgl. Spintge, Droh, 1992, S. 72). 5.2.2 Musik in der inneren Medizin Die Belastung, die durch extremen psychophysischen Stress für den Patienten entsteht, kann laut Aussage der Kranken am ehesten durch menschliche Betreuung aufgefangen werden. Eine individuelle psychische Betreuung ist aber nur in seltenen Fällen möglich. Klapp setzte daher bei Herzinfarktpatienten einer Intensivstation entspannende Musik ein. Nachdem die Befragten der Sache zunächst eher ablehnend gegenüberstanden, äußerten sie sich hinterher nahezu einhellig positiv (vgl. Spintge, Droh, 1992, S.71). Cathie E. Guzetta, Krankenschwester und Präsidentin der Holistic Nursing Consultans in Dallas, hat umfassende Studien an drei Krankenhäusern in Washington D.C. durchgeführt. Dabei wurde durch gezielte Entspannungs- und Musiktherapie die durchschnittliche Herzfrequenz der Herzkranken von 100 auf 80 Schläge pro Minute gesenkt, der systolische Blutdruck konnte von 150 auf 130 mm/Hg herabgesetzt werden. Koronare Komplikationen und Angstzustände wurden gemindert, die peripheren Temperaturen von 22,2 Grad C auf 34, 4 Grad C gehoben, ein Zeichen, dass die Patienten entspannter waren (vgl. Campbell, 1998, S. 304-306). 36 5.2.3 Musik in Neurologie und Psychiatrie Erfahrungen mit Hirngeschädigten bestätigen, dass diese zur Zeit der Rehabilitation extrem empfindliche Hörer sind. Dadurch, dass sie aufmerksamer und genauer hören, hören sie tiefer und sind leicht verletzbar. Musikstücke aus dem klassischen Bereich, welche von uns unter den Bedingungen der Alltagswahrnehmung als angenehm oder nicht weiter aufregend erlebt werden, können daher extreme Reaktionen herbeiführen. Gefühle bis hin zur Lebensbedrohung werden beschrieben. Somit ist bei instabileren Patienten mit Musik aus der Konserve Vorsicht geboten (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S.140). Im Gemeinschafskrankenhaus Herdecke hat sich hierbei das Singen im Atemrhythmus bewährt. Begonnen wurde mit Menschen, die aufgrund von Hirninfarkten oder Hirnblutungen, nach Schädelhirntrauma oder nach Reanimation bewusstlos waren. Einige dieser Patienten wünschten auch im wachen Zustand, vor allem, wenn sie noch beatmet wurden, weitere musiktherapeutische Betreuung. Bei Alkoholikern im Delirium wurde die Erfahrung gemacht, dass die Musiktherapie in der beschriebenen Form eher verwirrte, als dass sie hilfreich war (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S. 69). 5.2.4 Musik in der prä- und postnatalen Medizin Den Erkenntnissen Tomatis zufolge ist das ungeborene Kind vielen sensorischen Einflüssen ausgesetzt. Während der gesamten fetalen Zeit erlebt das Kind den Rhythmus des Herzschlages der Mutter. Demzufolge erzeugen Rhythmen die das Neugeborene daran erinnern, eine beruhigende Wirkung (vgl. Van Deest, 1997, S.90). Tomatis betont außerdem, dass die ‚stimmliche Ernährung’ für die Entwicklung eines kleinen Menschen ebenso notwendig ist wie die Milchflasche (vgl. Tomatis, 2000, S.217). Das Kind soll mit dem schon vor der Geburt vertrauten Klang aufwachsen, indem die Mutter einen Text auf Tonband spricht, der mehrmals täglich vorgespielt wird. Bis zur 35./36. Lebenswoche sind die Gehörknöchelchen ins Gewebe eingebettet, die Mutterstimme ist daher über Knochenleistung zu übertragen (vgl. Van Deest, 1997, S. 93-94). 37 6. IRRWEGE IN DER PFLEGE MIT MUSIK BEIM INTENSIVPATIENTEN In der Anwendung von Musiktherapie ist es sehr entscheidend, sich vor Augen zu halten, dass Musik zwar heilen kann, sie läuft aber auch Gefahr, überschätzt zu werden. Sie kann schaden und damit zu Krankheit, Wahnsinn und auch zum Tod führen (vgl. Decker-Voigt, 2000, S. 74). Es ist heute eine bewiesene Tatsache, dass schnelle Musik auch den Pulsschlag beschleunigt und dass durch Musik Blutdruck-, Herzrhythmus- und damit auch EKG-Veränderungen hervorgerufen werden können. Verschiedene Musikrichtungen, darunter Heavy Metal und Techno vermögen es, tranceartige Zustände hervorzurufen und sie können im Rhythmus gegen den Hertzschlag auch den Tod herbeiführen. Die folgenden Zeilen gehen der Frage nach, welche Kontraindikationen, Grenzen und Irrwege sich in der Arbeit mit Musik im Krankenhaus ergeben können. 6.1 Die Grenzen der Musiktherapie Musiktherapie heißt auch, die Grenzen der musikalischen Chemie zu kennen (vgl. Hegi, 1998, S. 19). Musik ist kein Wundermittel, sondern sie ist lediglich ein Medium der Verständigung und des Austauschs. Manchmal erreicht sie uns und unsere Gefühle oder Stimmungen, ein andermal wieder gelingt es ihr nicht (vgl. Van Deest, 1997, S. 18). Musikalische Erlebnisse mit Hilfe der Sprache zu beschreiben, ist ein mühsames Unterfangen und es wird in jedem Falle unvollständig bleiben. Wahrscheinlich liegt in genau dieser Offenheit die besondere Faszination, welche Musik ausmacht. Fest steht: Jeder Mensch kann in der Musik nur das fühlen, wozu er selbst imstande ist. Jeder Mensch erlebt seine eigene Trauer und seine eigene Fröhlichkeit. Natürlich geben bestimmte Musikstücke bzw. Musikstile unterschiedliche Tendenzen vor. Doch kann zum Beispiel fröhliche Musik einen traurigen Menschen aufheitern, einen anderen kann sie aber gerade aufgrund ihres heiteren Charakters zum Weinen bringen (vgl. Van Deest, 1997, S. 19). 38 Demnach kann Musik nicht verordnet werden wie ein Medikament, das eine, für alle Menschen zu jeder Zeit gleiche Wirkung hat. Darin liegt die Stärke der Musik, dass sie jeder im Prozess des Wahrnehmens, des Hörens neu erschafft, jeder auf seine Weise und in Abhängigkeit von der aktuellen Befindlichkeit, dem Geschmack und der Hörsituation (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S. 131). 6.2 Musische Missverständnisse im Pflegealltag Immer wieder findet man in der Literatur die Unterscheidung zwischen passiver und aktiver Musiktherapie. Gerade die Bezeichnung „passiv“ führt allerdings möglicherweise zu einer gravierenden Fehleinschätzung. Es ist richtiger von rezeptiver Musiktherapie zu sprechen, denn obwohl der Patient nicht am Musizieren beteiligt ist, ist es dennoch ein weitreichend aktiver Prozess, der die auditive Wahrnehmung, rationale und vor allem emotionale Verarbeitung bis zu vegetativen Reaktionen umfasst (vgl. Burkhardt, 1988, S. 129). Musik wird mit den Ohren gehört, jedoch mit dem ganzen Körper gefühlt. Der Patient ist also nur äußerlich ruhig, das Zuhören selbst ist ein sehr aktiver Prozess. Er wird begleitet von biologischen und seelischen Vorgängen, was eine genaue Beobachtung des Patienten erfordert. Puls, Blutdruck und Atmung verändern sich, Hautreaktionen sind eine mögliche Antwort auf das durch die Musik Erlebte. Freude, Schmerz, Angst sowie Trauer oder Langeweile können verstärkt wahrgenommen werden (vgl. Schroeder,1995, S.41). Musiktherapie ist nicht gleich Berieselung. Eine Komastimulation im Sinne von je mehr desto besser birgt sogar große Gefahren für den Kranken, denn es drängt ihn in die anfangs beschriebene Rolle eines Wesens, von dem erwartet wird, auf unsinnige, pauschale Reize wie ein Automat zu reagieren. Verängstigung, Rückzug und Verwirrung sind dann Ergebnis der ursprünglich erwünschten vertrauensvollen Hinwendung eines Menschen zu einem Menschen (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S.127). Bei sedierten Patienten ist Musikhören kontraindiziert. Sie sind aus guten Gründen medikamentös ruhiggestellt und sollten nicht durch Musik ein konträres Signal erhalten (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S.141). 39 Es sei erwähnt, dass Schmerzprovokationen bei somnolenten oder bewusstlos erscheinenden Patienten kontraproduktiv ist. Welche Mutter käme auf die Idee, ihr schlafendes Kind zu schlagen? Vielmehr wird sie die Phase des Erwachens langsam herbeiführen um nicht einem geschockten, schreienden Kind ins Auge sehen zu müssen (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S.127). 40 7. AUF DEM WEG ZUR GANZHEITLICHKEIT DURCH INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT Das Wohlergehen des Patienten ist ein wichtiges Ziel im täglichen Krankenhausbetrieb. Um dies zu ermöglichen, bedarf es der Zusammenarbeit mehrerer Professionen. Welche berufsübergreifenden Erfordernisse aber birgt die Vision ,Ganzheitliche Pflege’ tatsächlich und wie kann interdisziplinäre Kooperation bezogen auf die Arbeit mit Musik in der Intensivpflege stattfinden? Das Bundesgesetz über Gesundheits- und Krankenpflegeberufe von 1997 unterscheidet für den gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege drei wesentliche Aufgabenbereiche. Dazu gehören eigenverantwortliche, mitverantwortliche und interdisziplinäre Aufgaben, wobei der interdisziplinäre Tätigkeitsbereich jene Tätigkeiten aufgreift, die sowohl die Gesundheits- und Krankenpflege als auch andere Berufe im Gesundheitswesen betreffen. Die Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege haben dabei Vorschlagssowie Mitentscheidungsrecht und sie tragen die Durchführungsverantwortung für alle von ihnen in diesen Bereichen gesetzten pflegerischen Maßnahmen. 2 Viele Erfahrungen der letzen Jahre zeigen, dass die Mitarbeit von Musiktherapeuten im Intensivbereich zunehmend als Bereicherung und Entlastung empfunden wird, gerade im Bezug auf die Betreuung komatöser Patienten. Eine Unterstützung von medizinischen Seite ist in diesem Fall Voraussetzung. Die Nachfrage nach Seminaren zum Thema Musiktherapie sowie nach Beratung auf diesem Sektor ist enorm. Dem Wunsch von Stationsmitarbeitern, eine Therapie mitzuerleben sollte man als Musiktherapeut entsprechen. Umgekehrt braucht dieser Hilfestellungen vom Pflegepersonal. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist im Intensivbereich stark gefordert, auch was das Einbeziehen von Musik anlangt. Eine Erläuterung der Hygienevorschriften, z.B. über die Notwendigkeit von Masken, Kittel, Handschuhen oder aber den Verzicht darauf, ist für den Musiktherapeuten sehr hilfreich. 2 41 Das Erhalten zusätzlicher Eckdaten aus Anamnese und Biographie des Patienten ebenso wie Angaben zum Hörvermögen sind Grundlage für den Start einer Therapieeinheit. Ein Austausch, ähnlich einer pflegerischen Dienstübergabe, über die Befindlichkeit des Patienten, seine Bewusstseinslage oder Äußerungen seinerseits werden notwendig sein. Das Wissen über die Veränderung der Beatmungsart, der Sedierung ist auch für den Therapeuten essentiell genauso wie der Umgang mit Angehörigen (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S.146-147). Dagmar Gustorff, Musiktherapeutin im Intensivbereich, berichtet, dass Teambesprechungen und Übergaben zunächst eine große Herausforderung bedeuteten, v.a. was das Vereinen der unterschiedlichen Sprachstile und Wahrnehmungsschwerpunkte von Intensivmedizin und Musiktherapie betrifft. Doch erwähnt sie auch die gegenseitige Bereicherung, die sich dann einstellte, wenn ein Austausch gelingen konnte, was sich positiv auf die Entwicklung der Patienten auswirkte (vgl. Gustorff, Hannich, 2000, S.70). Dass ein Musiktherapeut in der Intensivmedizin präsent ist, bedeutet einen Idealfall, eher aber die Seltenheit. Ein Bericht von Helmut Schillo, einem Stationspfleger im neurologischen Intensivbereich in Deutschland, schildert eindrucksvoll, wie sein Pflegepersonal mit Musik arbeitet. Und er fordert uns heraus, mutig zu sein: „Wir sind in den allermeisten Fällen auf den Einsatz von Musikkonserven angewiesen. In den allermeisten Fällen heißt das, auch wir haben durchaus die Möglichkeit, mit Musik in direkten Kontakt mit den Patienten zu treten. Es mag Ihnen vielleicht seltsam erscheinen, aber was hindert Sie denn daran - außer den verwunderten Blicken Ihrer Kollegen - einem Patienten etwas vorzusingen? Oder animieren Sie die Angehörigen, beim Kranken zu singen. In unser aller Vorstellung ist das Singen mit Kindern, etwa vor dem Schlafengehen, völlig normal. Warum sollte es nicht auch mit Patienten, die in ihrer geistigen Fähigkeit auf diese Stufe zurückgeworfen wurden, gehen und ihnen gut tun? [...] Und wenn wir selbst in diesen Minuten zur Besinnung kommen und uns der Hektik der Intensivstation etwas entziehen, wäre das nicht das schlechteste Ergebnis.“3 3 vgl. http:/www. Pflegenet.com/praxis/konzepte/musik.html 42 Nach einer ausführlichen Auseinandersetzung mit der behandelten Thematik sei diesem Zitat folgende Anmerkung seitens der Autorin hinzuzufügen: Aus dem Bericht von Helmut Schillo geht hervor, dass eine Vertiefung mit fundierter Literatur zum Einsatz von Musik beim Patienten stattgefunden hat, das sichtbare Engagement ist erfreulich. Die Musiktherapie des 21. Jahrhunderts umfasst jedoch eine eigene Wissenschaftsdisziplin. Dies heißt auch, dass es nicht mehr die singenden Ärzte und Schwestern sein sollten, die versuchsweise dem Patienten Gutes tun wollen. Besonders im Bereich der Esoterik tauchen vermehrt Offerte auf, die als Musiktherapie verkauft werden, es sei dahingestellt, inwieweit dabei wirtschaftliche Faktoren vordergründig sind. Fest steht, dass es für den Laien in der Beurteilung von Angeboten durchaus schwierig werden kann, die Qualität richtig einzustufen. Ebenso wie Ergo- und Physiotherapeuten einstmalige Aufgaben der Pflege übernommen und ausgeweitet haben, steht die Arbeit mit Musik am Patienten in erster Linie jenen zu, die diese auch professionell ausführen können. Pflegende vermögen dem Patienten durch unterstützende Gespräche und Zuwendung in der psychologischen Betreuung eine enorme Kraftquelle sein, doch eine notwendige Psychotherapie ersetzen sie nicht. Ähnliches gilt für die Musiktherapie mit Intensivpatienten. Eine der herausforderndsten, um nicht zu sagen schwierigsten Kompetenzen in der Krankenpflege kann es sein, wachsam zu werden. Pflegequalität hat nicht nur mit Handlungen sondern auch mit Management zu tun. Unsere Aufgabe ist es, den Patienten ins Zentrum zu rücken, uns für ihn einzusetzen und in diesem Sinne Berufsgruppen zusammenzuführen. Damit wir dem Kranken die bestmögliche Behandlung gewähren können, ist es erforderlich, informiert zu sein- in vielen Bereichen. Dies bedeutet wiederum, dass es deutlich wertvoller sein kann, Überblick zu bewahren und bescheid zu wissen auf allen Ebenen, als selbst Hand anzulegen. 43 8. PERSÖNLICHE GEDANKEN ZUM EINSATZ VON KLANGKÖRPERN ALS MOTOR FÜR HARMONISCHE KÖRPERKLÄNGE Ich denke zurück an den 26. Juni 2000. Es ist jener Tag der in meinem Herzen das Fundament gelegt hat für das nun vollendete Werk. Vor mir zeichnet sich das Bild einer Diplomfeier im Festsaal des Neuen Rathauses in Linz. Im Mittelpunkt standen dabei dreizehn Klangkörper, darunter ein Klavier, eine Querflöte und elf Mitglieder unseres Schülerchores. Meine Aufgabe war es, den Rahmen für eine gelungene Diplomverleihung zu schaffen und damit die Absolventinnen und Absolventen des Jahrganges 1997/2000 würdig vom Schülerdasein zu verabschieden. Die laufenden Probenarbeiten waren, getrieben von der Hektik des Schulalltags und der doch großen Anspannung, die ein Auftritt vor mehreren hundert Zuhörern mit sich bringt, manchmal alles andere als harmonisch. Umso schöner sind aber meine Erinnerungen an die Reaktionen der Festgäste auf unsere Darbietungen. Die Aussage einer Lehrerin, sie hätte beim Erklingen unserer Lieder ein unheimliches Kribbeln verspürt und das Kompliment unseres medizinischen Schulleiters vor der versammelten Festgemeinschaft, er habe selten zuvor einen derartig feierlichen Abschluss erlebt, bleiben mir als dankende Anerkennung bestimmt noch lange im Kopf. Besonders berührt haben mich auch die zahlreichen Lobeshymnen von Seiten der Diplomandinnen und Diplomanden. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie Klänge die Aufmerksamkeit des Menschen wecken können und wie es Musik vermag, Gefühle in uns wachzurufen. Es kommt bestimmt nicht von ungefähr, dass für viele Kinder der erste Weg beim Eintritt in unser Haus zum Klavier führt oder dass eine bettlägerige Frau und ehemalige Musikerin im Seniorenheim beim Hören von Mozart und Chopin ein deutliches Schmunzeln über die Lippen bringt. Meine Erfahrungen mit Klangtherapie an mir selbst reichen von der frühen Kindheit bis in die Gegenwart. Jegliche Form von Musik, aktiv wie auch passiv, dient mir als Ausgleich zu Schule und Arbeit. 44 Wenn ich in den ersten Lebensjahren zu Mozarts Zauberflöte reflektorisch eingeschlummert bin, so behalte ich heute kurz vor Prüfungen durch das Summen von Liedern klaren Kopf. Die Erkenntnis, dass weniger oft mehr sein kann, ist für mich ein sehr elementare. Der Blick in die lachenden Gesichter der onkologischen Patienten unseres Krankenhauses, kurz vor Weihnachten, wird mir unvergessen bleiben. Aus dem Hilferuf der Stationsschwester, einige Schülerinnen mögen für den alljährlich auftretenden Chor kurzfristig einspringen, wurde schließlich ein gemeinsames Musizieren mit Patienten und Personal. Der Advent ist eine emotional hochbesetzte Zeit, besonders für Sterbende. Schön, dass im Dezember 2000 anstatt mancher Träne ein Stück Freude und ein Funken Hoffnung entsprungen sind. 45 9. ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG Die nun abgeschlossene Forschungsarbeit bietet nur ein Hineinschnuppern in die bearbeitete Thematik. Ebenso wie Musik in ihrer Vielfalt keine Grenzen kennt, so besitzen auch die Menschen an denen wir handeln verschiedenste Persönlichkeiten, jede mit ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen. Den Patienten der Onkologie habe ich eine einschneidende Erfahrung in meinem persönlichen Erleben mit Musik zu verdanken. Was theoretisch bekannt und rational nachvollziehbar ist, durfte ich nunmehr hautnah spüren. Ihnen gilt damit auch das Schlusswort, denn sie haben mir beigebracht was es bedeutet, Musik in der rauen Wirklichkeit als heilsam zu empfinden. Jenes spontan gelungene Weihnachtsfest inmitten von Schwerkranken soll uns lehren, Musik kennt keine starren Strukturen wie wir sie im Krankenhaus häufig gewohnt sind. Während Medizin und Administration strenge Genauigkeit und rationelles Handeln fordern, verlangt der Umgang mit Musik in erster Linie Kreativität, Mut und Offenheit. Es lassen sich weder Standards noch vorgefertigte Diagnosen erstellen, die uns das Pflegen mit Klängen erleichtern. Die Pflege des neuen Jahrtausends ist aber eine immerzu emanzipiertere, im Aufbruch stehende Profession. Durch den zunehmenden Wissenschaftscharakter, hin zu akademischen, eigenständigen Pfaden verdient das Einbinden von Musik in den ganzheitlichen Pflegealltag mehr als nur einen Gedanken. Die zentrale Aufgabe der Pflegenden liegt darin, Offenheit zu schaffen für neue Wege und jenen Raum zu lassen, die den Patienten auf professionelle Art und Weise mit Klängen unterstützen können. Dies ist meines Erachtens auch die Quintessenz zur anfangs gestellten Leitfrage, welche detailliert beantwortet werden konnte. In diesem Sinne möchte ich mit den Worten von Florence Nightingale schließen, die als eine der ersten Befürworterinnen der Musiktherapie, meinte: „Krankenpflege ist eine Kunst und fordert - wenn sie zur Kunst werden soll - eine ebenso große Hingabe, eine ebenso ernste Vorbereitung wie das Werk eines Malers oder Bildhauers, denn was bedeutet die Arbeit an toter Leinwand oder kaltem Marmor im Vergleich zu der am lebendigen Körper, dem Tempel für den Geist Gottes? Krankenpflege ist eine der schönsten Künste, fast hätte ich gesagt, die schönste aller Künste.“ (zitiert nach: Gestrich, 1991, S. 13) 46 10. LITERATURVERZEICHNIS ALTMANN, P.; REITER, H.; WÜRZL, E. (1980): Musikstudio 1. Arbeitsbuch für Musikerziehung in der 9. und 10. Schulstufe mit Beiträgen von Nardelli, R., Schmaus, B., Wanker, G. und Wosien, B., Österreichischer Bundesverlag, Wien. BECKEDORF, D. (1999): Warum Mozart? in NEANDER. K.- D. (Hrsg.): Musik und Pflege, Urban & Fischer, München, Jena. BLOCH, W. (1973): Allgemeine Musikkunde. Eine Einführung in die Grundbegriffe der Musik für jedermann, Österreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, Wien. BOLAY, H.V. (1999): Gedanken zum Geleit- oder Gedanken zur gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Relevanz von Musik in der Pflege in NEANDER, K. D. (Hrsg.): Musik und Pflege, Urban & Fischer, München, Jena. BUNT, L. (1998): Musiktherapie. Eine Einführung für psychosoziale und medizinische Berufe, Beltz Verlag, Weinheim, Basel. BURKHARDT, R. (1988): Rezeptive Musiktherapie in HÖRMANN GEORG (Hrsg.): Musiktherapie aus medizinischer Sicht, Ferdinand Hettgen Verlag, Münster. CAMPBELL, D.(1998): Die Heilkraft der Musik. Klänge für Körper und Seele aus dem Amerikanischen übersetzt von Ilse Fath-Engelhardt, Droemersche Verlagsanstalt, München. DECKER- VOIGT, H.- H. (2000): Aus der Seele gespiegelt. Eine Einführung in Musiktherapie mit vier Beiträgen von Eckhard Weymann, Wilhelm Goldmann Verlag, München. ESCHEN, J. TH. (1996): Aktive Musiktherapie in DECKER- VOIGT, H.- H.; KNILL, P. J., WEYMANN, E.: Lexikon Musiktherapie, Hogrefe-Verlag, Göttingen, Bern, Toronto, Seatle. FRANK-BLECKWEDEL, E.-M. (1996): Rezeptive Musiktherapie in DECKERVOIGT, H.- H.; KNILL, P. J., WEYMANN, E.: Lexikon Musiktherapie, HogrefeVerlag, Göttingen, Bern, Toronto, Seatle. GEMBRIS, H. (1997): Zur Situation der rezeptiven Musiktherapie in BERGER, L. (Hrsg.): Musik, Magie und Medizin, Junfermann, Paderborn. 47 GESTRICH, R.(1998):Gespräche mit Schwerkranken. Krisenbewältigung durch Pflegepersonal, 2. vollst. überarbeitete Auflage, Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln. GUSTORFF, D; HANNICH H.- J. (2000): Jenseits des Wortes. Musiktherapie mit komatösen Patienten auf der Intensivstation, Verlag Hans Huber, Bern, Göttingen, Toronto, Seattle. HANNICH, H.- J. (1999): Der musiktherapeutische Dialog als Zugang zum bewusstseinsveränderten Patienten auf der Intensivstation in NEANDER, K. D. (Hrsg.): Musik und Pflege, Urban & Fischer, München, Jena. HEGI, F. (1998): Übergänge zwischen Sprache und Musik. Wirkungskomponenten der Musiktherapie, Junfermann, Paderborn. HÖRMANN, G. (1988): Zum interdisziplinären Verhältnis von Musik und Medizin in HÖRMANN, G.(Hrsg.): Musiktherapie aus medizinischer Sicht, Ferdinand Hettgen Verlag, Münster. KAGERER, F. (1996): Kommunikation auf der Intensivstation in BOONEN, A; HEINDL- MACK, J. (Hrsg.): Pflege in der Intensivmedizin, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York. KELLER, C. (1999): Musik auf der Intensivstation in NEANDER K.- D. (Hrsg.): Musik und Pflege, Urban und Fischer, München, Jena. KRETZ, F.-J.; KORN, A; REICHENBERGER, S. (1985): Allgemeine Intensivmedizin in KRETZ, F.- J. (Hrsg.): Intensivmedizin für Pflegeberufe, Thieme, Stuttgart. LECOURT, E. (1979):Praktische Musiktherapie, Otto Müller Verlag, Salzburg. RULAND, H.(1990): Musik als erlebte Menschenkunde. Praxis der Musiktherapie Bd.9,Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York, Bärenreiter Verlag, Kassel, Basel, London. SCHÄFFLER, A; MENCHE, N; BALZEN, U; KOMMERELL, T. (Hrsg.) (1998): Pflege Heute. Lehrbuch und Atlas für Pflegeberufe, Gustav Fischer, Stuttgart, Jena, Lübeck, Ulm. SCHROEDER,W.C.(1995): Musik, Spiegel der Seele. Eine Einführung in die Musiktherapie, Junfermann, Paderborn. SCHWABE, C. (1996): Methodensystem der Musiktherapie in DECKERVOIGT, H.- H.; KNILL, P. J., WEYMANN, E.: Lexikon Musiktherapie, HogrefeVerlag, Göttingen, Bern, Toronto, Seatle. SCHWABE, C. (1996): Regulative Musiktherapie in DECKER- VOIGT, H.- H.; 48 KNILL, P. J., WEYMANN, E.: Lexikon Musiktherapie, Hogrefe-Verlag, Göttingen, Bern, Toronto, Seatle. SPECHT-TOMANN, M.; TROPPER, D. (2000): Hilfreiche Gespräche und heilsame Berührungen im Pflegealltag, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hongkong, London, Mailand, Paris, Singapur, Tokio. SPINTGE, R. (1988): Musik und Medizin- Biologie und Therapie. Einführung in das Thema unter Berücksichtigung historischer, anthropologischer und aktuellmedizinischer Gesichtspunkte in HÖRMANN, G.(Hrsg.): Musiktherapie aus medizinischer Sicht, Ferdinand Hettgen Verlag, Münster. SPINTGE, R; DROH, R. (1992): Musik- Medizin. Physiologische Grundlagen und praktische Anwendungen, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York. TOMATIS, A. (1997): Das Ohr und das Leben. Erforschung seelischer Klangwelten aus dem Französischen übersetzt von Lorenz Häflinger, Walter Verlag, Düsseldorf, Zürich VAN DEEST, H. (1997): Heilen mit Musik. Musiktherapie in der Praxis, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & CO, München, Trias- Thieme Verlag, Stuttgart. WITZANY, G.; SCHÖRKMAYR J. B. (1992): Musiktherapie. Analyse und Kritik aktueller Tendenzen in der Musiktherapie, Heyn- Verlag, Klagenfurt. ZIEGLER, A. (1999): Wieviel Gehirn braucht der Mensch. Dialogaufbau im Koma und apallischen Syndrom in NEANDER, K. D. (Hrsg.): Musik und Pflege, Urban & Fischer, München, Jena. 49