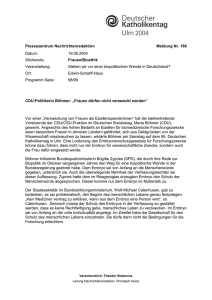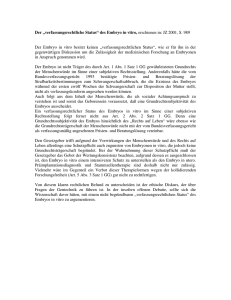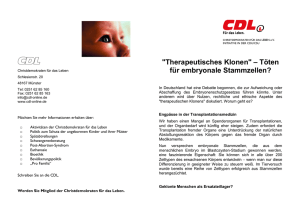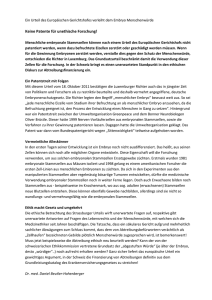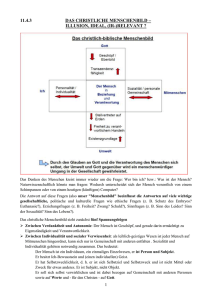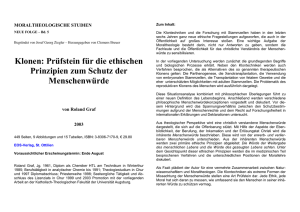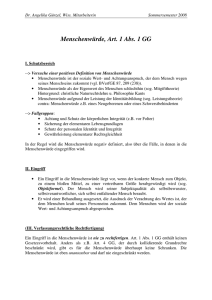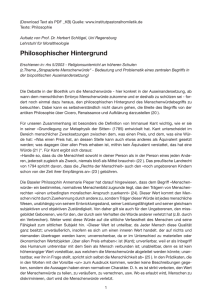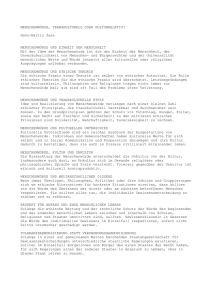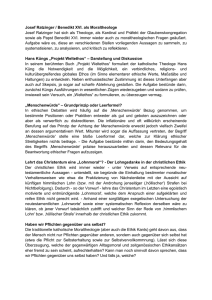14/2003 - PH Weingarten
Werbung

ethik report IBE Nr. 14 / November 2003 Editorial • Schwerpunkte der Ausgabe und Neues aus dem IBE Presse- und Literaturspiegel Informationen und Rezensionen zu ethischen Themen aus Tagespresse, Fachzeitschriften, Gremien und von Fachtagungen herausgegeben vom Institut für Bildung und Ethik der Pädagogischen Hochschule Weingarten Leibnizstraße 3 88250 Weingarten Tel.: 0751/5018377 e-mail: [email protected] • Biopolitik - Kursänderung der Bundesregierung in der embryonalen Stammzellen-forschung - Gendatenbank in Estland • Bioethik Neue Forschungsergebnisse zu adulten Stammzellen • Aktive Sterbehilfe Tötung von Wachkomapatienten? Rezensionen • Gunda Schneider-Flume, Leben ist kostbar. Wider die Tyrannei des gelingenden Lebens • Themenheft: Menschenwürde. Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie Tagung • Bioethik: Jahrestagung des Nationalen Ethikrates: Der Umgang mit vorgeburtlichem Leben in anderen Kulturen 2 Editorial Liebe Leserin, lieber Leser, der vorliegende ethik-report beschäftigt sich mit folgenden Schwerpunkten: Biopolitik Verschiedene Publikationen thematisieren eine mögliche Kehrtwende der Bundesregierung in der ethischen und rechtlichen Positionierung zur Frage der Zulassung der Forschung an embryonalen Stammzellen. Wir dokumentieren die ethischen Argumentationslinien und den öffentlichen Streit um diese zentrale biopolitische Frage. Am Rande Europas, in Estland, wird, fast unbemerkt, die größte Gendatenbank der Welt aufgebaut. Auf dieses biopolitische Ereignis, das verknüpft ist mit positiven genwirtschaftlichen Erfolgsprognosen und mit dem Fehlen eines öffentlichen bio- und informationsethischen Diskurses, machen wir aufmerksam. Bioethik In seinem Bericht von der Jahrestagung des Nationalen Ethikrates „Der Umgang mit vorgeburtlichem Leben in anderen Kulturen“ am 23. Oktober in der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften geht Eike Bohlken den Fragen nach der Möglichkeit einer interkulturellen und interreligiösen Bioethik nach. Diejenigen Gegner einer Forschung an embryonalen Stammzellen, die sich von der ethisch unbedenklicher erscheinenden Forschung an adulten Stammzellen Erfolge versprechen, werden von einer Nachricht aus den Forschungslabors der Universität Düsseldorf enttäuscht sein: Adulte Stammzellen können (auch) nicht alles. Sterbehilfe Der spektakuläre Fall eines reanimierten Wachkomapatienten wirft Fragen nach einem Leben in Würde, dem Wert von Patientenverfügungen und der Berechtigung aktiver Sterbehilfe auf. Der Streit zu diesen ethisch relevanten Fragen wurde stellver- 3 tretend von dem Anwalt des Betroffenen und einem evangelischen Arzt in der ZEIT geführt. Die Würde des menschlichen Lebens Edgar Thaidigsmann rezensiert ein Buch und einen Sammelband zu grundlegenden Fragen eines menschlichen Lebens in Würde. Das Buch von Gunda SchneiderFlume: „Leben ist kostbar. Wider die Tyrannei des gelingenden Lebens“ setzt sich aus biblisch-theologischer Perspektive kritisch mit der philosophischen Vorstellung des gelingenden Lebens auseinander. Im Sammelband der letzten Ausgabe von „Concilium“ werden unterschiedliche Akzente zur Rede von der Würde des Menschen vorgestellt. Neues aus dem IBE Für die interne Entwicklung des IBE gibt es weiter Erfreuliches zu vermelden: Ende Oktober hat Monika Fuchs als freie Mitarbeiterin im Rahmen des Forschungsund Nachwuchskollegs „Bioethik im Horizont ethischer Bildung“ ihre Arbeit aufgenommen. Bevor sie an der PH Weingarten das Promotionsaufbaustudium absolvierte, war Frau Fuchs als Grund- und Hauptschullehrerin in Vaihingen/Enz tätig. Ihr Dissertationsvorhaben im Rahmen des FuN-Kollegs, Fachbereich Evangelische Theologie, beschäftigt sich mit „Unterrichtsforschung im Themenfeld Bioethik – Pränatalund Präimplantationsdiagnostik im Religionsunterricht der Sekundarstufe I.“ Die neueste Studie des IBE: „Berufsmoralische Kompetenz im Organisationskontext von Sozialunternehmen. Eine Pilotstudie zum Umgang mit Wertkonflikten in sozialen Unternehmen in kirchlicher Trägerschaft“ von Rolf Prim (Vorstandsmitglied des IBE) und Hans-Martin Brüll (wissenschaftlicher Mitarbeiter im IBE) wird am 12. Dezember 2003 im Schloss Liebenau offiziell vor geladenen Gästen präsentiert und diskutiert. Danach besteht die Möglichkeit, die Studie über die Homepage der Pädagogischen Hochschule Weingarten unter http://www.ph-weingarten.de/homepage/hochschule/fakultaeten/institute/ibe/veroeffentlichungen.html 4 herunterzuladen. Die Studie ist auch über die Adresse des Instituts (siehe Titelseite) als Broschüre in Papierform zu beziehen. Für die Redaktion Hans-Martin Brüll und Edgar Thaidigsmann Presse- und Literaturspiegel Biopolitik Kursänderung der Bundesregierung in der embryonalen Stammzellenforschung Heidrun Graupner: Zwischen Menschenwürde und Recht auf Leben. Matthias Drobinski: „Die Beweislast hat der Embryo“ (Interview mit Dietmar Mieth); In: Süddeutsche Zeitung vom 30.10.03, 2 Robert Spaemann: Freiheit der Forschung oder Schutz des Embryos? In: DIE ZEIT vom 20.11.03, 39 Rafaela von Bredow/Gerd Rosenkranz: Schröders Versuchsballon. In: DER SPIEGEL 45/03, 208-212 Mit der sich andeutenden Kehrtwende in der Biopolitik, markiert durch die unlängst in Berlin gehaltene Rede von Bundesjustizministerin Zypries, beschäftigen sich die Autoren Graupner und von Bredow/Rosenkranz. Ausgangspunkt ist die Frage nach dem Beginn menschlichen Lebens sowie – damit verbunden – nach dem Zeitpunkt, ab dem einem Embryo der im Grundgesetz verankerte Schutz der Menschenwürde zukommt. Brigitte Zypries hat mit ihrer Rede eben diese Diskussion erneut entfacht, indem sie dem Embryo in vitro das Recht auf Menschenwürde ab- und erst mit seiner Einpflanzung in den Mutterleib zuerkennen will. Sie legitimiert ihre These mit dem Hinweis, dass es bis zum Zeitpunkt der Nidation die „lediglich abstrakte Möglichkeit“ gäbe, sich als Mensch weiter zu entwickeln. „Abstrakt“ insofern, als der In-VitroEmbryo nicht nur auf den Schutz des Staates, „sondern v.a. auf eine austragungsbe- 5 reite Frau“ angewiesen sei. „Hierzu kann der Staat niemanden verpflichten. Wir müssen also aufpassen, dass wir den Grundrechtsschutz nicht auf etwas richten, was wir realistischerweise nicht erfüllen können.“ Diese Position verschafft Zypries nicht nur Distanz zur Amtsvorgängerin DäublerGmelin und zum Bundestagsbeschluss vom Januar 2002, sie löst zugleich eine neue Debatte über die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Embryonenforschung aus. Auch Gerhard Schröder kritisiert die geltenden Regelungen im Bereich der Biopolitik als unzureichend, wollten „die Chancen, die in der Biotechnologie liegen,“ wirklich wahrgenommen werden. Graupner formuliert als Frage, ob ein solcher Kurswechsel nicht konsequenterweise ein neues Gesetz für die Verwendung embryonaler Stammzellen in der Forschung nach sich ziehen müsste, weil sonst das geltende Stammzellenimportgesetz – zumal vor dem Hintergrund der Zypries’schen Argumentation gelesen – eine Einschränkung darstellte? Dass nicht nur der Bundeskanzler, sondern auch Wirtschaftsminister Clement und Bildungsministerin Bulmahn über eine Gesetzesnovelle nachdenken, ist, so Graupner, seit längerem bekannt. Von Seiten der Wissenschaft wird der Ruf laut, die Forschung zumindest an überzähligen, nicht mehr zur Verwendung vorgesehenen Embryonen aus dem Reagenzglas zuzulassen. Zypries kommt dieser Forderung nun entgegen; mit ihrem Verweis auf das Grundrecht der Forschungsfreiheit eröffnet sich auch die Notwendigkeit einer Abwägung zwischen kollidierenden Grundrechten. Graupner skizziert den Argumentationsgang der Ministerin: Generell hat der Gesetzgeber seinen Schutzauftrag für das menschliche Leben wahrzunehmen, dazu ist Spielraum nötig. Während die Menschenwürde durch das Grundgesetz absolut geschützt ist, gilt dieser absolute Schutz nicht für das Recht auf Leben. D.h. die „Abschaffung“ des per Grundgesetz gesicherten Schutzes auf Menschenwürde beim In-Vitro-Embryo bewirkt zugleich die Schaffung einer Rechtsgrundlage, denn „mit einem Gesetz“, so Zypries, „dürfe in das Recht auf Leben eingegriffen werden, es lasse Spielraum für Abwägungen mit den Grundrechten der Eltern und Forscher“. Der SPIEGEL zitiert weiter: „Wann immer also Regierung und Parlament dies für „erforderlich“ hielten, sei eine Lockerung des Stammzellengesetzes ohne das Risiko einer Kollision mit der Verfassung möglich.“ Die Konsequenzen einer solchen Betrachtungsweise sind Zypries bewusst. Die – wenn überhaupt – bislang lediglich einen Spalt weit geöffnete Tür zur Embryonenforschung könnte damit aufgestoßen werden. (Eine klare Absage allerdings erteilt 6 Zypries dem Klonen, sowohl von Menschen als auch zu Forschungszwecken, ebenso einer Zulassung der PID. Diese berühre „das Lebensrecht und müsste grundlegende Auswirkungen auf den Umgang unserer gesamten Gesellschaft mit Krankheit und Behinderung nach sich ziehen.“, wie zusammenfassend bei Graupner zitiert wird.) Bleibt die Suche nach Gründen für den Vorstoß der Bundesjustizministerin. Immerhin kam ihre zunächst „ohne erkennbaren Anlass vorgenommene Umorientierung“ in der Frage, ab wann die Menschenwürde zuerkannt werden könne, zu einem Zeitpunkt, der, so von Bredow/Rosenkranz, Freund und Feind gleichermaßen überraschte. Die beiden Autoren werten zum ersten Zypries’ Vorstoß als Bemühung, „ihrem nach Innovation strebenden Kanzler zu gefallen.“ Das Vorhaben Schröders, Biotechnologie als „Versuchsballon“ zu starten und „Biotechnik zum Leitprojekt einer OptimismusKampagne“ zu machen, sehen von Bredow/Rosenkranz in diesem Zusammenhang eher fragwürdig; biotechnische Grenzüberschreitungen trügen im gemeinen Volk eher zu Verängstigung bei, auch habe der Vorstoß auf Seiten der Kirchen vor allem Enttäuschung und Besorgnis ausgelöst. Bezogen auf die Suche nach Gründen könnten zum zweiten Drobinskis Interviewfragen auch als Offerte gelesen werden. So z.B., ob die Rede zugleich „Signal für eine neue Bioethik-Politik der Bundesregierung ist?“ oder ob dahinter „die Angst steckt, dass irgendwann alle Länder forschungsfreundliche Gesetze haben, nur die Deutschen nicht und die Forschung mit Stammzellen dann eben im Ausland läuft?“ Zum dritten schließlich spielt der Standortfaktor Biotechnologie seine Rolle, würde doch eine Lockerung der aktuellen Rechtslage der Unzufriedenheit deutscher Stammzellenforscher entgegenwirken, die Begrenzung auf Stammzelllinien von vor dem 01.01.2002 aufheben und v.a. angestrebte Kooperationen mit ausländischen Kollegen erleichtern. Die Politik hat insofern Handlungsbedarf, als die Regierung dem Parlament bis Jahresende einen ersten Erfahrungs- bericht zum Stammzellgesetz vorlegen muss. Und – so von Bredow/Rosenkranz – sollte dieser Bericht Unzufriedenheiten von Forschern enthalten, dann wäre nach Zypries’ Rede das Kriterium für eine Gesetzesrevision gegeben. Zypries’ Rede kann allerdings nicht jeden überzeugen. Reaktionen von Seiten der Opposition und des Koalitionspartners zeigen anhaltende Zweifel und Bedenken an 7 ihrer Argumentation; Proteste kommen auch aus den Reihen der Ethiker, namentlich von Dietmar Mieth. Seine im Interview vorliegenden Aussagen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 1. Die Menschenwürde des Embryos von Anfang an stellt die Forschung unter Legitimationsdruck, warum der Embryo zu Forschungszwecken getötet werden darf. Bei vorliegender Umkehrung des Sachverhaltes durch Installation einer Gleichrangigkeit der beiden Rechte „Forschungsfreiheit“ und „Lebensrecht des Embryos“ käme plötzlich dem Embryo die Beweislast zu. 2. Die nicht austragungsbereite Frau schafft durch ihre Verhütung – auch mit Spirale – einen anderen Status als der Forscher bei bewusstem Verwerfen des Embryos. 3. „Die normative Kraft des Faktischen kann keine Grundlage für den Gesetzgeber sein.“ Die Tatsache überzähliger Embryonen allein legitimiert also noch keine Forschung. Auch Robert Spaemann hat die Bundesjustizministerin nicht überzeugt. Der emeritierte Philosophieprofessor nimmt zunächst ebenfalls Bezug auf jenen „Versuchsballon“, den restriktiven gesetzlichen Rahmen der Embryonen- und Stammzellenforschung von Regierungsseite infrage zu stellen und bemerkt, dass Gerhard Schröder „nichts davon hält, die biomedizinische Forschung durch Gesichtspunkte des Embryonenschutzes einzuschränken“. Spaemanns besonderes Augenmerk gilt dann dem Ort, an dem die Rede gehalten wurde. Der Tatsache, dass Zypries ihren Vortrag in einer relativ politikfreien Zone hielt, trägt er Rechnung, indem er die Universität als einen „Ort der Wahrheitsfindung“ charakterisiert und die Kennzeichen universitärer Lehre (keine Durchsetzung von Standpunkten, allein Argumente zählen, das Interesse ist jeweils nur Gegenstand von Argumenten und begründet deren Gewicht) zum Maßstab seiner Prüfung von Plädoyer und Argumentation Brigitte Zypries’ macht. Während ihr Plädoyer gegen PID und anonyme Samenspende akzeptiert wird, verdient es die „Argumentation zugunsten einer Lockerung des Embryonenschutzes im Zusammenhang der Stammzellforschung näher betrachtet zu werden“. Spaemann versucht, diese Argumentati- 8 on im Spannungsfeld von „Freiheit der Forschung oder Schutz des Embryos?“ schrittweise zu entkräften. Argumentation in der Rede von B. Stellungnahme von R. Spaemann Zypries 1. Diese Argumentation ist in sich nicht stimWährend Zypries im Zusammenhang mit PID das „Lebensrecht mig. Ù Lebensrecht und Zuerkennung von Würde eines Embryos“ anführt, wird be- hängen untrennbar zusammen, sie verschaf- zweifelt, ob dem in vitro erzeugten fen dem Menschen den „Status eines Sub- Embryo Menschenwürde zukommt. jektes von Rechten, nicht nur eines Mittels für die Zwecke anderer.“ Ù Die Zuerkennung von Lebensrecht gegenüber dem Embryo ist damit bereits die Zuerkennung von Menschenwürde. Ù „Wo es um die Existenz eines Wesens geht, zählt die Perspektive dieses Wesens selber, ob es also zur Gemeinschaft gehört oder nicht.“ Wohl kann einer freiwillig sein Interesse dem anderer unterordnen, doch der „Embryo ist noch nicht so weit, sein Leben „opfern“ zu können.“ Der Versuch, einen Menschen umzubringen, solange er von anderen Menschen abhängig ist, ist nicht zu rechtfertigen. 2. Die Verwertung von Leben ist kein legitimes Ziel der Forschung. Das Grundrecht auf Leben des Ù Forschungs- und Wissenschaftsinteresse ist Embryos kollidiert mit dem Grund- begrenzt durch die Achtung vor den Rechten recht der Forschungsfreiheit und ist anderer und der Rechtsgemeinschaft (vgl. gegen dieses abzuwägen. Staatsrechtler M. Kriele). Ù „Gibt es also überhaupt ein Lebensrecht des Embryos – was Frau Zypries auch für in vitro 9 erzeugte Föten zugesteht – dann wird dadurch die Forschungsfreiheit nicht eingeschränkt, sondern sie kann sich a priori auf die Verwertung von zu diesem Zweck getöteten Embryonen nicht erstrecken (...) so wenig wie auf andere menschenverbrauchende Experimente. Deren Verbot wurde noch nicht als „Eingriff“ in das Grundrecht der Forschungsfreiheit bezeichnet.“ Konstitutive Merkmale der Menschenwürde: 3. Menschenwürde ist nichts, was von uns verliehen wird. 9 „Respekt vor dem Eigenwert der Person und jeder individuellen Existenz“ 9 „die Möglichkeit der Eigenver- Ù Das spräche faktisch – ohne dass Spae- antwortung und der selbstbe- mann das der Ministerin zu unterstellen ge- stimmten Lebensgestaltung“ denkt – altersdementen und behinderten 9 Menschenwürde ist abhängig Menschen ihre Würde ab. von Anerkennung - wessen Menschenwürde nicht anerkannt und respektiert wird, der besitzt keine. So leitet Zypries her, „dass zwar der Embryo im Mutterleib Men- Ù Spaemann nutzt nun eben diesen Argumen- schenwürde besitzt, nicht aber der tationsgang, wenn er schreibt, dass die „Er- in vitro erzeugte.“ In der Auseinan- zeugung in vitro den Embryo ja erst in die dersetzung um PID macht die Mi- unnatürliche Lage bringe, ohne Mutterleib zu nisterin wiederum geltend, dass die existieren.“ Insofern lässt sich die Aberken- künstliche Erzeugung von Embryo- nung seiner Menschenwürde so nicht herlei- nen, um sie der PID zu unterziehen ten, das Argument ist nicht haltbar. „erst den Konflikt herbeiführt, der dann ggf. zu Lasten des Embryos gelöst wird.“ 10 4. Die „lediglich abstrakte Möglichkeit“ Bis zum Zeitpunkt der Nidation be- Ù Dies kommt einer Umkehrung des in der Ab- steht die „lediglich abstrakte Mög- treibungsdiskussion erreichten bedingungs- lichkeit“, sich als Mensch weiter zu losen Schutzes des Menschseins in der Pet- entwickeln. rischale gleich. „Abstrakt“ insofern, als der In-Vitro- Ù Zweifelsohne ist der In-Vitro-Embryo für seiEmbryo nicht nur auf den Schutz ne Entwicklung als Mensch auf äußere, nicht des Staates, „sondern v.a. auf eine naturgegebene Hilfen angewiesen. Mit der austragungsbereite Frau“ angewie- selben Beweisführung könnte aber auch sen ist. dem Kleinkind die „lediglich abstrakte Möglichkeit“ seiner Weiterentwicklung zu- und entsprechende Hilfsmaßnahmen abgesprochen werden. Für Spaemann ergibt die Zypries’sche Logik einen vollständigen Zirkel: „Weil die Bedingungen nicht gegeben sind, müssen sie auch nicht gegeben werden.“ Das wiederum entspräche jener „Definition von Menschenwürde, zu der deren Anerkennung als konstitutives Merkmal gehört. Eine nicht anerkannte und respektierte Menschenwürde existiert nicht. Anerkennung heißt also Verleihung.“ (Den tatsächlichen Anspruch des skizzierten Zirkels auf Gültigkeit empfiehlt er der Ministerin zur Reflexion.) Schlussendlich greift Spaemann noch die Problematik der A-und-B-Logik auf: In der bio-ethischen Debatte bliebe im Gegenteil sogar die Möglichkeit, die Zustimmung zu A zurückzunehmen, „sehend, dass das schreckliche B aus dem scheinbar harmlosen A folgt. Diese Möglichkeit gehört zur Würde des Menschen, der Mut dazu ist eine Sache der Moral.“ DNA-Datenbank in Estland Tom Schimmeck, Patriotisches Kataster. In: Die Zeit vom 28.Mai 2003, 31 In Estland wird die größte DNA-Datenbank der Welt errichtet, die bis 2007 die Genund Gesundheitsdaten von einer Million Esten speichern soll. Die Betreiber wie Nut- 11 zer der Datenbank erhoffen sich bessere Medikamente. Der Staat und die Wirtschaft des Landes bauen auf den wirtschaftlichen Erfolg der Bio-tec-Branche. Der Staat unterstützt das Projekt mit einem großzügigen Genforschungsgesetz. Ethisch begründete Auflagen bestimmen, dass der Spender eine rechtsverbindliche Einverständniserklärung unterschreibt, die allerdings jederzeit widerrufen werden kann. Eine DNA-Probe kann auf Antrag jederzeit vernichtet werden. Die Datenbank gehört einer staatlichen Stiftung. Das Gesetz verbietet allerdings Daten mittels Zwang oder finanziellen Lockungen einzutreiben. Wissenschaftler, die ohne Einverständnis der Spender arbeiten, droht sogar drei Jahre Haft. Dennoch werden auch Ängste gegenüber dem Datenbankprojekt beschrieben: Manche Esten fürchten heimliches Klonen. Befürchtet wird auch ein Genklau durch fremde Mächte. Auch von der Gefahr der Vergiftung mittels bestimmter Gene wird gesprochen. Ein öffentlicher und organisierter Diskurs zur totalen Erfassung von Gendaten findet allerdings nicht statt. Dieser Fatalismus des Volkes – so der Autor – sei die Kehrseite der Innovationsfreudigkeit. Forschung an adulten Stammzellen als Alternative? Joachim Müller-Jung, Da haben wir den Zellsalat. Mythos Alleskönner: Sind adulte Stammzellen nur Fusionskünstler? In: FAZ vom 13.10.2003 Neue Erkenntnisse in der Stammzellenforschung tragen zur Entmythologisierung der Alleskönnerschaft von adulten Stammzellen und deren unterstellte Möglichkeit als ethisch unbedenkliche Alternative zur Forschung an embryonalen Stammzellen in Frage. Eine Forschergruppe um Prof. Pfeffer vom Institut für Medizinische Mikrobiologie der Universität Düsseldorf hat in Experimenten an Mäusen herausgefunden, dass die Zellfusion von adulten Stammzellen ein ganz natürlicher Vorgang ist. Eine Zellfusion ist die unabdingbare Voraussetzung für die Gewinnung und die Entwicklung von ganzen Körperteilen. Allerdings schaffen die Forschungsergebnisse aus Düsseldorf keine Klarheit, inwieweit fusionierte Zellen nicht nur das Aussehen, sondern auch auf Dauer die Funktion echter, geschädigter Körperzellen übernehmen können. In einigen Fällen hat sich sogar herausgestellt, dass bestimmte Gene der Fusionsprodukte nach einer gewissen Zeit einfach „abgeschaltet“ werden. 12 Aktive Sterbehilfe Tötung von Wachkomapatienten? Streitgespräch zwischen Wolfgang Putz und Andreas Zieger: Der letzte Wille. In: Die Zeit vom 20.11.2003, 29 Dem Streit zugrunde liegt der Fall des 33-jährigen Wachkomapatienten Peter K., der nach einem missglückten Suizidversuch im Wachkoma lag. Die Ärzte stellten die Beatmung ab. Dennoch hat Herr K. überlebt. Nun weigern sich die Ärzte, den Patienten durch Entziehen der künstlichen Ernährung sterben zu lassen. Er kommt auf Wunsch und Vermittlung des Vaters in ein Heim, das sich auf Wachkomapatienten spezialisiert hat. Vor seinem Selbstmordversuch hatte Herr K. in einer Patientenverfügung erklärt, dass er in einem derartigen Zustand nicht weiterleben möchte. Diesem Wunsch wollen die Ärzte nun nachkommen, indem sie die künstliche Ernährung einstellen wollten. Genau dies lehnen aber die Pfleger ab, weil sie sagen: Peter will leben. Diesen Fall wird demnächst der Bundesgerichtshof entscheiden müssen. In diesem Musterprozess steht viel auf dem Spiel: die Überlebenschancen von Komapatienten, die Bedeutung der Patientenverfügung und die Frage nach der Berechtigung von assistiertem Suizid oder aktiver Sterbehilfe. In Deutschland leben derzeit ca. 8000 Menschen mit dem sogenannten apallischen Syndrom. Ihre Körper sind meist vollständig gelähmt. Wichtige Körperfunktionen (Atem, Herzschlag) sind jedoch intakt. Sie reagieren (wahrscheinlich) nicht auf ihre Umwelt, obwohl sie die Augen öffnen können. Sie werden mit künstlicher Ernährung und einer aufwändigen Pflege am Leben erhalten. Auf diese Weise können sie über Jahre leben. In äußerst seltenen Fällen wachen Patienten aus dem Koma auf und können bestimmte Lebensfunktionen wiedergewinnen. Der Streit dreht sich um drei Fragenkreise: Ist ein so geführtes Leben menschenwürdig? Darf man solche Patienten sterben lassen? Oder muss man es, weil eine Patientenverfügung vor dem Krankheitsfall vorliegt? Wolfgang Putz, der Anwalt von Herrn K., argumentiert für eine möglichst präzise Patientenverfügung vor Eintreten der Komasituation. Dort soll der Wille des Patienten, welche lebensverlängernden Maßnahmen er wünscht bzw. nicht mehr wünscht, als für den Arzt bindend festgehalten werden. Andreas Zieger, Leiter eines Evangeli- 13 schen Krankenhauses, plädiert aus ärztlicher Erfahrung dagegen, weil es eine keine Patientenverfügung gibt, die eins zu eins umzusetzen wäre. Beide Diskutanten sind sich uneins, wie der Zustand und Wille des Komapatienten zu interpretieren sei. Pütz hält den Zustand von Komapatienten für menschenunwürdig. Aus „dem Grimassieren eines Sterbenden Willensbekundungen“ herauslesen zu wollen, hält er für unzulässig. Auch die Tatsache, dass Komapatienten atmen können und möglicherweise Hunger und Durst empfinden, hält er für nicht hinreichende Gründe, die Nahrungszufuhr zu unterbrechen. Er bestreitet im Gegensatz zu Zieger, dass Patienten Hunger und Durst verspüren. Er stellt sogar die Frage an Angehörige und Pflegepersonal, was sie berechtigt, die mangelnde Atmung oder die fehlende Nahrung zu ersetzen. Dagegen findet Zieger es „absurd“, „ dass sich ein Arzt oder eine Schwester unethisch verhalten, wenn sie einem Patienten Nahrung geben oder seinen Durst stillen.“ Pütz bestreitet mithilfe von medizinischen Gerichtsgutachten (zumindest im Fall von Herrn K.), dass dieser auf seine Umwelt reagiert. Dagegen argumentiert Zieger, dass Komapatienten einem Schlaf-Wachrhythmus folgen, ihr Herz ohne Hilfe schlägt, sich die Herzfrequenz bei äußerer Stimulation verändert, beispielsweise wenn Musik ertönt oder bekannte Stimmen gehört werden oder wenn sie berührt werden. In Einzelfällen wurden sogar Fortschritte bis hin zum Lächeln beobachtet. Weil diese Lebenszeichen erkennbar sind, besteht – nach Zieger - kein Grund zu einer Tötung von Wachkomapatienten. Pütz hält hingegen nicht das Leben für die wichtigste Richtschnur für ärztliches Handeln, sondern den Willen des Patienten. So darf - nach Pütz - der Arzt in Kauf nehmen, einen Menschen sterben zu lassen, weil ja nicht der Arzt, sondern der Patient mittels einer möglichst präzisen Willensbekundung in einer vorzeitigen Patientenverfügung das Risiko einer Fehlentscheidung übernimmt: „Eine Patientenverfügung stärkt nämlich die Selbstbestimmung, aber sie nimmt dem Patienten auch Chancen.“ Auf den Einwand Ziegers, ob nicht das ärztliche Gewissen belastet werde, wenn der Arzt möglicherweise dem Patienten eine Lebenschance genommen habe, erwidert Pütz: „Nein, weil der Patient auf diese Chance verzichten wollte.“ Für Zieger ist nicht nur die Patientenverfügung handlungsleitend. Auch Angehörige und das Pflegepersonal werden in den Interpretationsprozess des Patientenwillens miteinbezogen. Putz postuliert hingegen ein Recht auf Selbstbestimmung am Lebensende. In diesem Sinn fordert er auch eine Patientenverfügung für diejenigen, „die eine Lebensverlän- 14 gerung um jeden Preis wollen“. In dieser Position sieht Zieger eine Perversion der Medizin: „Das hieße dann, die kranken Menschen müssen bitten, dass sich Ärzte um sie kümmern.“ Er sieht vielmehr in der Patientenverfügung eine mögliche „Untergrabung des Vertrauensverhältnisse zwischen Arzt und Patient.“ Er befürchtet, dass Ärzte – noch durch den ökonomischen Druck in Krankenhäusern befördert - sich nicht mehr die Mühe machen, den Wachkomapatienten nach allen Regeln der Kunst zu behandeln. Außer der gemeinsamen Ablehnung der aktiven Sterbehilfe nach dem niederländischen Modell und der Forderung nach einer besseren Ethik- und Palliativausbildung der Ärzte waren im Streit zwischen den beiden Kombattanten keine gemeinsamen Positionen zu entdecken. Man darf nun auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofes gespannt sein. Rezensionen Gunda Schneider-Flume, Leben ist kostbar. Wider die Tyrannei des gelingenden Lebens, Vandenhoeck Transparent Bd. 66, 2002, 143 S. Ein dem Umfang nach schmales, vom Inhalt her gewichtiges, in der Sprache engagiertes Büchlein ist anzuzeigen. Die Intention Der Untertitel zeigt den Sachverhalt an, mit dem sich die Verfasserin auseinandersetzt: mit der Idee des „gelingenden Lebens“ in ihren lebenswidrigen Folgen für den Umgang der Menschen mit sich selbst und mit anderen. Sie zeigt, dass mit dieser Idee eine Forderung aufgerichtet wird, wonach menschliches Leben seine Güte durch den Ausweis seiner Qualität erst erarbeiten muss. Diese Forderung einer teleologisch ausgerichteten Rechtfertigung menschlichen Lebens schließt ein Urteil über nicht oder noch nicht gelungenes Leben ein. Dagegen wird die biblisch bezeugte Geschichte Gottes mit den Menschen ins Feld geführt. Sie widerstreitet diesem Urteil von „Gelingen“ und „Misslingen“. Leben ist von vornherein und überschießend über allen aufweisbaren Qualitäten gut. Das zuvorkommende Urteil des Schöpfers „siehe, es war sehr gut“, widerstreitet dem Unternehmen, die grundlegende Güte und 15 Akzeptanz des Lebens von Bedingungen abhängig zu machen. Das immer neue Erzählen der Geschichten biblischer Gotteserfahrung verhindert nach Schneider – Flume, dass die verschiedenartige Darstellung und Entfaltung menschlichen Lebens einem „Totalurteil“ über Gelingen oder Misslingen unterworfen wird, das das Geschenk des Lebens von der Wurzel her vergiftet. Lebensabträgliche Wirkung der Forderung von „Identität“ und „Integrität“ Die Verfasserin konkretisiert ihre These von der „Tyrannei“ der Forderung, dass Leben gelingen müsse, an Beispielen aus dem Bereich der Entwicklungspsychologie und der Medizin. Dabei zeigt sie, wie sich unter dem Schein eines erst einzulösenden Heilsversprechens ein Zwang ergibt, der zerstörerische Folgen hat. Im Bereich der Entwicklungspsychologie ist es vor allem die Theorie der psychosozialen Identität bei Erik H. Erikson, der die kritische Aufmerksamkeit der Verfasserin gilt. Die Identität einer Person ist für Erikson kein fertiges Bild, vielmehr ein Prozess, in dem das Ich im Ausbalancieren von Krisenerfahrungen, die für bestimmte Entwicklungsstufen charakteristisch sind, seine Identität und Integrität auf dem Weg zur Ganzheit der reifen Persönlichkeit synthesierend organisiert. Religion und Glaube sind in diesem Prozess für Erikson von fundamentaler Bedeutung. Bei aller Würdigung des Hilfreichen dieser Theorie findet Schneider-Flume in der sie leitenden Ganzheitsvorstellungen von „Identität“ und „Integrität“, wie sie auch in der Religionspädagogik wirksam geworden sind, und in der in diesen Vorstellungen wirksamen Idee der Kontinuität und zeitübergreifenden Einheitlichkeit des Lebens eben jenes Leitbild vom gelingenden Leben, das im Versprechen zugleich einen Druck in Richtung Gelingen ausübt. Es wird darin lebensabträglich, dass er „die Krisen zumindest verstärkt, wenn nicht gar provoziert“ (57). Denn das Fragmentarische, Abgebrochene und Disparate des Lebens wird dann als Scheitern wahrgenommen und verworfen. Die Forderung der „Gesundheit“ als unheilvoller Heilsersatz Schneider-Flume analysiert die religiöse Aufladung der biologisch verstandenen „Gesundheit“ zum höchsten Gut und zeigt, wie diese Utopie im Verbund mit neuen technischen Möglichkeiten wie z.B. PID ein Verständnis von Krankheit produziert, das behindertes und beschädigtes Leben diskriminiert. Ein biologischer Begriff von Unversehrtheit wird verabsolutiert und der Unwille, beschädigtes Leben anzunehmen und zu tragen, produziert und gesteigert. Hinter diesem Verständnis von Gesundheit 16 und Krankheit findet die Verfasserin als leitende Ideen die Forderung nach Autonomie und Vervollkommnung des Lebens. Diese laden das Gelingen des Lebens der Verantwortung des Individuums auf und unterwerfen mit der Forderung, dass auch das Sterben „in Würde“ gelingen müsse, noch den eigenen Tod der „Tyrannei“ dieser Idee. In neuer und zugleich archaischer Weise wird dann wieder Schuld zugerechnet für Krankheit und „nicht gelingendes Leben“ und Sterben. Dagegen bringt die Verfasserin das biblische Verständnis von Leben ins Spiel. „Leben“ erweist sich in der Kraft tragender Beziehung, die das beschädigte Leben trägt und erträgt aus einer allem Tun, Leisten und Machen vorangehenden Bejahung heraus, die dem Leben aus der bejahenden Zuwendung, dem Gedenken und Erbarmen Gottes heraus zukommt. Würdigung Das Büchlein hat in Form und Sprache eher den Charakter eines Manifestes als den einer Abhandlung. Es enthält in nuce die Ideen und den Stoff für ein umfassenderes Werk, in dem ein am biblischen Zeugnis gewonnenes Verständnis des Lebens in einen lebensförderlichen Streit mit einem biologistischen Verständnis des Lebens tritt, das mehr oder weniger ausdrücklich normativ und religiös aufgeladen ist mit Forderungen, die lebenswidrige Folgen haben. Die Verfasserin macht dabei die Perspektive einer vor allem von den Lob- und Klagepsalmen inspirierten, von Martin Luthers Rechtfertigungslehre her belehrten und in dessen Auseinandersetzung mit der aristotelischen Ethik belehrten Theologie geltend. Sie denkt vom Evangelium als der frohen Botschaft her, das dem „Gesetz“ da widerspricht, wo es nicht dem Leben dient, sondern sich unter dem Schein falscher Versprechen von „Gelingen“ zum Herrn des Lebens macht, um gerade so eine lebensabträgliche Wirkung zu entfalten. Es bleibt freilich die Frage zu stellen ob es ausreicht, sich theologisch und ethisch nur in der grundsätzlichen Ganzheitsperspektive zu bewegen. Zu recht macht die Verfasserin das Recht des begrenzten, fragmentarischen und beschädigten Lebens geltend und bringt es ideologiekritisch gegen gängige Leitvorstellungen zum Zuge. Doch wird es nötig sein, sich noch mehr in die Sphäre konkreter ethischer Entscheidungen zu begeben. Gerade dann, wenn der Druck zum „Gelingen des Lebens“ weggenommen wird, sind wir von neuen technischen Möglichkeiten her vor viele dornige Entscheidungen gestellt. Da wäre dann im Einzelnen zu zeigen, wie sich die Befreiung von der „Tyrannei des gelingenden Lebens“ in konkreten Entscheidungen 17 am Beginn und am Ende des Lebens ebenso wie in seiner Mitte auswirkt. Interessante Hinweise dazu aber finden sich schon in dem Büchlein. Edgar Thaidigsmann Themenheft: Menschenwürde. Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie, 39.Jg., Juni 2003, H. 2 Das Juniheft der Zeitschrift „Concilium“ ist dem Thema „Menschenwürde“ gewidmet. Eine international gemischte Autorenschaft befasst sich in erhellender Weise mit verschiedenen Aspekten dieses für die zeitgenössische Rechtsdebatte, Politik und Ethik zentralen Begriffs. Es ist nicht möglich, an dieser Stelle die einzelnen Beiträge angemessen zu würdigen. Doch soll ein Eindruck davon gegeben werden, unter welchen Gesichtspunkten der Begriff diskutiert wird. Inflationärer Gebrauch Seit der Charta der Vereinten Nationen (1945) und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) ist „Menschenwürde“ in viele internationalen Pakte und Konventionen als Grundbegriff eingegangen. An ihm müssen sich andere Werte messen lassen und elementare Menschenrechte werden von ihm abgeleitet. Mit der Durchsetzung des Begriff und seiner verbreiteten Inanspruchnahme wird er freilich unscharf und zum Deckmantel partikularer Interessen. Unklar wird, wen oder was der Begriff eigentlich schützt. Dies zeigt sich auch in der bioethischen Debatte. Dazu kommt eine Unsicherheit in der Begründung des Begriffs. Je nach Begründung kann es sein, dass bestimmten Menschengruppen Menschenwürde gerade aberkannt wird. Autonomie vor Menschenwürde? Mehrere Autoren stellen einen Wandel im Verständnis der menschlichen Würde fest. Vielfach wird sie mit der Autonomie des einzelnen, selbst zu entscheiden, identifiziert, so dass aus der Achtung vor der Würde eines Menschen z.B. die Achtung vor der Selbstbeurteilung eines Menschen wird, der seinen physischen Zustand als men- 18 schenunwürdig bewertet und daraus die Forderung auf ein Recht zum „Sterben in Würde“ kraft assistierter Euthanasie ableitet. Damit wäre der Begriff der Menschenwürde seines Charakters entkleidet, wonach sie unverlierbar und unveräußerlich ist und sich gerade da zu bewähren hat, wo in bestimmter Perspektive von „menschenunwürdig“ gesprochen wird. Wem wird Menschenwürde zuerkannt? Die Philosophie Kants bietet einen markanten Orientierungspunk zur Bestimmung der Menschenwürde. Kant bestimmt die Würde des Menschen klassisch dahingehend, dass eine Person jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst, nie nur als Mittel gebraucht werden dürfe. Die Würde einer Person hat keinen Preis und ist damit dem Tausch entzogen. Eine Person ist für Kant dadurch bestimmt, dass sie an der menschheitlichen Vernunft teilhat. Wie aber steht es dann mit menschlichen Wesen, denen z.B. moralische Autonomie fehlt, deren Vernunft durch angeborene Behinderung oder durch Altersdemenz unter das Vermögen höherer Tierarten gesunken ist? Wird hier nicht die Grenze eines jeden rationalistischen Ansatzes deutlich? Was bringen Glaube und Theologie ein? Besonders interessant sind Überlegungen zu der Frage, was Glaube und Theologie in die Debatte um die Begründung und das Geltendmachen von Menschenwürde einzubringen haben. Der Begriff der Menschenwürde ist für eine theologische Ethik auch deshalb von besonderem Interesse, weil er die theologischen Grundeinsichten der Gottebenbildlichkeit des Menschen und seiner Geschöpflichkeit in einen Begriff übersetzt, der allgemein kommunikabel ist. Desto schärfer ist freilich die Frage nach seiner Bedeutung zu stellen. Mehrere Beiträge zeigen, dass die Würde des Menschen, soll sie nicht rationalistisch bedingt und verengt werden, seine Verletzlichkeit einbeziehen muss. Würde ist gerade da zuzuerkennen, wo der Mensch seine Erhabenheit verloren hat, vorgebliche Zeichen von Würde fehlen und seine Hinfälligkeit, seine Kontingenz und Sterblichkeit sichtbar wird. Verwiesen wird in den Beiträgen auf die Geschichte vom barmherzigen Samariter (Lk 10), auf den Gottesknecht in Jes 53, aber auch auf Sophokles’ „Ödipus auf Kolonos“, wo es heißt: „Wenn ich nichts bin, werde ich wahrhaft zum Menschen“(177). Beziehungsdenken statt Substanzdenken: In den Überlegungen zur Achtung der Menschen „in seiner Unwürdigkeit“ wird sichtbar, dass die Zuerkennung von Würde 19 nicht an vorhandenen Attributen einer Person festgemacht werden darf, soll Würde nicht nur für bestimmte Menschen reserviert werden. Würde wird in Beziehungen zuerkannt und elementar bedeutsam. Wichtig ist dabei die Beziehung, die für den schwachen Menschen eintritt und ihm dabei Würde zuerkennt. Eine Bedingung aber dafür, dass Würde auch dem ‚nichtigen’ Wesen zuerkannt wird, ist, dass es von Menschen kommt (vgl. Gen 5,3). Als Grundeinsicht ergibt sich: „Menschenwürde“ ist nicht empirisch aufweisbar. Sie verdankt sich einer transzendentalen Sphäre. Doch bedarf es dessen, dass sich das Transzendentale hinabbeugt zum „Unwürdigen“. In dieser Hinsicht vor allem hat die Theologie etwas Eigenes einzubringen. Edgar Thaidigsmann Tagung Bericht von der Jahrestagung des Nationalen Ethikrates „Der Umgang mit vorgeburtlichem Leben in anderen Kulturen“ am 23. Oktober in der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften Berlin Die zweite Jahrestagung des Nationalen Ethikrates hatte sich ein anspruchsvolles Thema gewählt. Prallen schon hierzulande in der Frage des Umgangs mit vorgeburtlichem Leben sehr unterschiedliche Perspektiven aufeinander, so erweiterte die Tagung den Fokus noch einmal durch den Vergleich mit der Diskussion in anderen Kulturkreisen. Diese Erweiterung sollte einen kulturübergreifenden Vergleich ermöglichen und die Grundlage für eine interkulturelle Bioethik liefern. Der Vergleich von Unterschieden wie Gemeinsamkeiten zwischen den Kulturen könne dazu verhelfen, partielle Konsensmöglichkeiten zu finden, so Ethikratmitglied Regine Kollek in der Einführung. Dass die Sicht der verschiedenen Kulturkreise über die religiösen Vorstellungen des Islam, des Hinduismus, des Judentums, des Buddhismus sowie des Konfuzianismus dargestellt wurde, mochte zunächst als eine verkürzende Gleichsetzung von Kultur und Religion erscheinen. Diesem kulturphilosophischen Manko wurde jedoch dadurch entgegengewirkt, dass den einleitenden Vorträgen über „Perspektiven des Islam“, „... des Hinduismus“ etc. jeweils ein zweiter Vortrag bzw. ein zweiter Teil folgte, der die konkrete gesellschaftliche Praxis „in ausgewählten islamischen 20 Ländern“ bzw. in Indien, Israel und China analysierte. Bei diesen Analysen kamen dann zum einen auch wirtschaftliche und soziale Faktoren zur Sprache. Zum anderen kristallisierte es sich als entscheidende kulturübergreifende Gemeinsamkeit heraus, dass bei allen vorgestellten Religionen erhebliche Unterschiede zwischen theologisch-dogmatischen Lehrmeinungen und alltäglichen Glaubensvorstellungen und Handlungsweisen auftreten. Die dem strukturellen Aufbau der Tagung zugrunde liegende These von einem Primat der Religion innerhalb der Kultur wurde so wieder ein Stück weit zurückgenommen und überprüfbar gemacht. Eine Einführung in die theologische Position des Islam gab Sadek Beloucif (Professor für Anästhesie und Intensivmedizin in Amiens und Mitglied des französischen Ethikrats). Maßgebliche Quellen für den Umgang mit vorgeburtlichem Leben seien der Koran, die Hadiths (Sprüche und Handlungen Mohammeds) sowie Teile der Jurisprudenz, die als unmittelbarer Ausdruck des moralisch Richtigen betrachtet würden. Das menschliche Leben gelte als beseelt und gottgegeben und werde allenfalls punktuell als verbesserungsfähig angesehen. Dieser Auffassung entspreche ein gelassenerer Umgang mit Krankheiten oder Behinderungen, die nicht als Strafe oder Benachteiligung Gottes gesehen würden. Die Vernichtung jedes einzelnen, auch vorgeburtlichen Lebens werde als ein ,Töten der Menschheit‘ aufgefasst. Als Zeitpunkt der Beseelung werde mehrheitlich der 40. Tag nach der Befruchtung angesehen, eine zweite einflussreiche Meinung setze die Beseelung zeitgleich mit der Befruchtung an. Abtreibungen seien daher, wenn überhaupt, nur bis zum 40. Tag nach der Befruchtung zu rechtfertigen, z.B. nach einer Vergewaltigung. Aus der Gottgegebenheit des Lebens resultiere für islamische Theologen eine vollständige Ablehnung des reproduktiven Klonens. Künstliche Befruchtungen seien nur dann akzeptabel, wenn das Prinzip der Elternschaft („parent offspring relation“) nicht verletzt wird – Samenspenden oder Leihmutterschaften kämen daher grundsätzlich nicht in Frage. Therapeutisches Klonen könne dagegen als Arbeit mit bereits geschaffenem Leben betrachtet werden und müsse daher nicht zwangsläufig eine Einmischung in die Schöpfung darstellen. Auch hier gelte jedoch, dass die Wissenschaft nachweislich dem allgemeinen Interesse – d.h. etwa der Heilung von Krankheiten – zu dienen habe und darauf achten müsse, sich nicht der Anmaßung gegenüber Allah schuldig zu machen. Ein Klonen zu reinen Forschungszwecken, das nicht bei einer 21 konkreten Krankheit ansetze, werde nicht akzeptiert, da rein wissenschaftliche Intentionen nicht per se als moralisch gute Intentionen gewertet würden. In unmittelbarem Anschluss an diese theologischen Ausführungen stellte Dr. Carla Makhlouf Obermeyer (Harvard School of Public Health, Weltgesundheitsorganisation) eine Schilderung des konkreten Umgangs mit Abtreibungen in einigen islamischen Ländern (Bangladesch, Ägypten, Indonesien, Iran, Libanon und Marokko) entgegen. Sie unterschied dabei zwischen den drei Ebenen der Gesetze und der Politik, der konkreten Umsetzung im Gesundheitssystem sowie spezifisch ortsgebundener Praktiken. Die erste Ebene entspreche am ehesten den Vorstellungen der islamischen Lehrmeinung. Die meisten Gesetze seien alt und ließen wenig Raum für Abtreibungen. Allerdings gäbe es schon hier verschiedene Schulen. Als gesetzlich anerkannte Gründe für eine Abtreibung kämen vor allem eine Rettung des Lebens der Mutter oder der Schutz ihrer Gesundheit in Betracht. Soziale Indikatoren würden nur in drei islamischen Ländern anerkannt. Betrachte man jedoch den Übergang von der Ebene der Gesetze zu jener der Umsetzung im Gesundheitssystem, stoße man auf eine Reihe von „Schlupflöchern“. So sei etwa in Ägypten Abtreibung zwar grundsätzlich verboten, aber unterlassene Lebensrettung ebenfalls strafbar. In der Praxis führe dies zu einer stillschweigenden Akzeptanz der Abtreibung, sofern das Leben der Mutter bedroht ist. Im Iran seien Abtreibungen dann möglich, wenn zwei Ärzte Gefahren für die Gesundheit der Mutter diagnostizierten. Diese Praxis sei jedoch eng mit einem symbolischen Akt der Kompensation verbunden: Als Preis für die erfolgte Tötung des Fötus, müsse ein Blutgeld (diyeh) an den Arzt gezahlt werden, dass dieser dann später zurückerstatte. Auch auf der Ebene des individuellen Handelns fänden sich eine Reihe von Schlupflöchern für ein von den religiösen Prinzipien abweichendes pragmatisches Handeln. Dabei gehe es auf der einen Seite um Fragen der Kategorisierung („labelling“), auf der anderen Seite um individuelle Glaubenshaltungen. So würden einerseits Frauen, die bei sich selbst Blutungen hervorrufen, um einen Arzt zum Abbruch der Schwangerschaft zu bewegen, nicht verfolgt. Dem entspreche eine Haltung, die alle auf die Schwangerschaft bezogenen Fragen und Probleme als „Frauensache“ verstehe. Andererseits hofften Frauen, die abgetrieben haben, auf eine verständnisvolle Haltung Allahs, der letztlich über das Leben des Fötus entscheide und ihnen ihre Sünde ver- 22 geben könne. Das Christentum, so Obermeyers Fazit, sei im Vergleich hierzu rigoroser. Der Islam könne besser mit Grauzonen leben. Den Status des Fötus in den traditionellen Schriften des Hinduismus entwickelte die Religionswissenschaftlerin Katherine K. Young (Montreal) aus den zentralen Begriffen von Karma und Dharma. Das Karma (wörtlich: „act“) umfasse alle Arten von Handlungen bzw. Akten (also auch mentale Akte und Sprechakte) und sei auf die Erhaltung der kosmischen Ordnung gerichtet. In ihm flössen kosmische Zeit und individuelles Leben zusammen, da es – ähnlich wie die DNA – von Leben zu Leben weitergegeben werde. Während Karma in allen Formen des Lebens enthalten sei, bekomme es im menschlichen Leben eine besondere Bedeutung, da es allein in dieser Daseinsform verbessert werden könne. Der Begriff des Dharma (verwendet u.a. für Religion, Ethik, Gesetze, Sitten) stehe im Zentrum einer Lehre von vier Zielen und vier Stufen des Lebens. Er biete Orientierung für eine gute Regierung wie für eine gute Lebensführung des Einzelnen. Auf der dritten Stufe des „householders“ beinhalte er die Pflicht, zu heiraten und Kinder zu zeugen als eine Schuldigkeit gegenüber den Ahnen. Der moralische Status des Fötus ergebe sich aus seiner Zusammensetzung aus männlicher und weiblicher Flüssigkeit, einem Nährmedium, dem Lebensprinzip (Jiva) und der Seele bzw. einem „subtle body“, der das Karma enthalte. Die Beseelung finde bereits während der Befruchtung statt, und der Embryo gelte von Anfang an als Person, die sich in der weiteren Entwicklung nur deutlicher manifestiere. Der Schutz des Fötus werde zudem durch das Prinzip der Gewaltlosigkeit (Ahimsã) gefördert, das zu einer grundsätzlichen Ablehnung der Abtreibung führt. Ausnahmen bildeten die Schwangerschaft nach einem Ehebruch oder durch einen Mann, der einer niederen Kaste angehört. Die in diesem Falle ,gerechtfertigte‘ Abtreibung ziehe jedoch die Ausstoßung aus Kaste und Familie nach sich. Eine moralisch und sozial akzeptierte Ausnahme vom Schutz des Fötus bestehe nur dann, wenn das Leben der Mutter durch die Geburt gefährdet sei. Zu Beginn ihres Vortrags über die konkrete Praxis in Indien wies die Medizinsoziologin Dr. Jyotsna Gupta (Leiden) darauf hin, dass der Hinduismus gegenwärtigen fundamentalistischen Strömungen zum Trotz eine stark in Bewegung befindliche Religion darstelle. Auch die indische Kultur sei alles andere als homogen. Gupta bezog 23 sich vor allem auf die in Indien seit längerem akzeptierte Praxis der Familienplanung und das mit den neuen diagnostischen Verfahren verstärkte Problem der geschlechtlichen Selektion. Um die Bevölkerungsexplosion einzudämmen, setze die indische Regierung auf politische Programme zur Familienplanung für Familien mit zwei oder mehr Kindern. Im Zuge dieser Programme sei es auch zu einer Liberalisierung der Abtreibung gekommen, da diese ein wichtiges Mittel zur Reduzierung der Geburtenrate darstelle. Abtreibungen würden in Indien häufig spät durchgeführt, was vor allem an der Frage der Erkennbarkeit des Geschlechts des Fötus hänge. Seit den 20er Jahren würden in Indien immer weniger Mädchen geboren, da Töchter vielfach aufgrund der traditionellen Mitgiftsregelungen als finanzielle Belastung für die Familie betrachtet werden. Sowohl geschlechtliche Selektion als auch vorhergehende Tests seien mittlerweile gesetzlich verboten. Die rechtlichen Regelungen würden jedoch trotz entsprechender Kampagnen der Regierung („sex selection is a crime“) weitgehend unterlaufen. So seien die Tests nach dem Verbot lediglich teurer geworden und würden jetzt unter euphemistischen Titeln wie „family balancing“ angeboten. Hinzu komme, dass die Regierung auf der anderen Seite bemüht sei, Indien eine möglichst gute Ausgangsposition für den Wettbewerb in den neuen Reproduktionstechnologien zu verschaffen. Neben den besagten Testverfahren gäbe es zudem einen Handel mit Leihmutterschaften, der weitgehend über das Internet abgewickelt werde, sowie im Hinblick auf künstliche Befruchtung Praktiken des „egg sharing“ oder „sperm sharing“ – häufig innerhalb einer Familie. In der Diskussion, die sich auch um die Frage drehte, was ,der Westen‘ tun könne, erinnerte Jyotsna Gupta daran, dass indische Forscher und Ärzte, ohne die keine geschlechtlichen Selektionen stattfinden könnten, ihre Ausbildung zumeist in Europa und Amerika erhielten. Hier könne durch eine Verstärkung medizinethischer Bestandteile des Studiums viel bewegt werden. Katherine Young sprach sich für eine Förderung des theologischen Dialogs innerhalb des Hinduismus aus, da es auch in diesem selbst verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und damit durchaus Gegengewichte gegen fundamentalistische oder frauenfeindliche Auslegungen gebe. Die Perspektiven des Judentums referierte der Rabbiner und Kinderneurologe Prof. Avraham Steinberg (Jerusalem). Er äußerte Zweifel daran, dass es möglich sei, Begriffe wie „Leben“ oder „Beginn des Lebens“ wissenschaftlich zu definieren, da diese nicht wirklich wissenschaftlich seien. Im Hinblick auf den Umgang mit vorgeburtli- 24 chem Leben müsse zunächst festgehalten werden, dass aus jüdischer Perspektive nicht von eigenen Rechten des Fötus gesprochen werden könne. Ihm komme zwar von Anfang an eine gewisse Würde zu. Ein moralisches Recht erhalte er aber erst als „integraler Bestandteil der Mutter“. So würden Embryonen in der Petrischale oder im Reagenzglas lediglich als Prä-Embryonen verstanden. Dieser Betrachtungsweise korrespondiere die Ablehnung eines absoluten Punktes, von dem an von unverletzlichen moralischen Rechten gesprochen werden könne. Der präimplantierte ,Embryo‘ gelte noch nicht als menschliches Leben, der im Mutterleib befindliche Embryo sei auf dem Wege einer biologischen Progression dorthin. Ähnlich wie im Islam herrsche auch im Judentum die Auffassung vor, dass der Fötus erst nach 40 Tagen beseelt werde. Für die Zeit davor könne daher über seinen moralischen Status debattiert werden. Sein „natürliches Potenzial für menschliches Leben“ sei noch gering, und eine gut begründete Abtreibung in dieser Phase stünde nicht per se im Widerspruch zu theologischen Prinzipien. Dies ändere sich nach dem Ablauf der 40 Tage. Eine Abtreibung sei dann nur noch bei bestehender Lebensgefahr für die Mutter zu akzeptieren. Aufgrund der Betrachtungsweise des nicht implantierten ,Embryos‘ als Prä-Embryo sei gegen das Klonen als Technik nichts einzuwenden. Diskutiert werden müsse lediglich die moralische Legitimierbarkeit der mit dem Klonen verfolgten Ziele und der entstehenden Folgen. Die Forschung an embryonalen Stammzellen stelle keine Hybris dar, sondern nutze einen Freiraum innerhalb der Schöpfung. Dieser Haltung entspreche eine starke Bejahung des wissenschaftlichen Fortschritts. Diesen theologischen Überlegungen stellte der Mediziner Simon Glick (Beer Sheva) eine Schilderung der Praxis in Israel gegenüber. Er wies zunächst darauf hin, dass auch Israel keineswegs eine kulturell homogene Bevölkerung habe. Verschiedene religiöse Vorstellungen und Lebensweisen gäbe es nicht nur bei Juden und Moslems, sondern auch bei orthodoxen und säkular orientierten Juden. Während des englischen Protektorats wurden Abtreibungen mit bis zu 14 Jahren Haft bestraft. 1966 wurde das Strafmaß auf fünf Jahre heruntergesetzt. Die soziale Praxis habe sich jedoch dahingehend entwickelt, dass eine Verfolgung nur bei Fällen von Pfuscherei stattgefunden habe. Nach einer Gesetzesänderung von 1977 blieb die Abtreibung zwar weiterhin grundsätzlich verboten, es wurden jedoch fünf Indikatoren festgelegt (u.a. psychische und soziale Probleme der Mutter), die eine Abtreibung 25 dennoch legalisierten. Als Ergebnis der daraufhin von den religiösen Parteien in Gang gebrachten politischen Diskussion wurde die soziale Indikation wieder aus dem Gesetz gestrichen. Diese Streichung sei jedoch ohne praktische Auswirkungen geblieben, da weite Teile der Öffentlichkeit und insbesondere der Krankenhauskomitees eine liberalere Auffassung verträten. So würden soziale Indikatoren nach wie vor berücksichtigt und lediglich unter andere Kategorien gebracht. Kennzeichnend für die israelische Gesellschaft sei eine hohe Fortschritts- und Technikakzeptanz. Dies führe zu einem starken Einsatz von Gentests und In-vitroBefruchtung, der vom Gesundheitssystem finanziert werde. Ein fünfjähriges Moratorium der Klontechnik laufe 2004 aus. Versuche, an der vorherrschenden Haltung zur Abtreibung und zum Einsatz der Gentechnik in der Humanmedizin etwas zu ändern, sollten laut Glick nicht auf Gesetzesänderungen, sondern auf Aufklärungskampagnen setzen. Die Diskussion konzentrierte sich vor allem auf die theologische Position. Die Auffassung der Beseelung am 40. Tag entspringe einem „vormodernen Umgang mit heiligen Texten“, so eine Kritik. Ethikratmitglied Hans-Jochen Vogel sprach sich gegen eine zu offene Haltung im Umgang mit embryonalen Stammzellen aus. Eine vorschnelle Akzeptanz würde die Diskussion, wo gute Zwecke beginnen und enden, auf eine schiefe Ebene bringen. Steinberg hielt dem entgegen, dass das Judentum Absolutismen ablehne und Abwägungsstrategien vorziehe. Er sehe einen inflationären Gebrauch des Argumentes der schiefen Ebene (slippery slope-Argument). Die 40Tage-Regel sei nicht willkürlich, sondern habe für sich, dass erst ab diesem Zeitpunkt die Organ-, Glieder- und Knochenbildung einsetze. Der Fötus erreiche damit eine wichtige Stufe auf dem Weg zur Gottesebenbildlichkeit. Auch hier handele es sich jedoch um ein zwar wichtiges („distinctive“), aber nicht absolutes Kriterium. Die theologische Perspektive des Buddhismus erläuterte der Religionswissenschaftler Dr. Damien Keown (London). Der Buddhismus habe keine ausgeprägte Tradition ethischer Debatten. Es gebe aber eine Reihe von Regeln zum Umgang mit vorgeburtlichem Leben, die sich aus alten Schriften oder aus der traditionellen Interpretation dieser Schriften gewinnen ließen. Wie für den Hinduismus, aus dem er sich historisch entwickelt habe, spiele auch für den Buddhismus das Prinzip der Gewaltlosigkeit (ahimsã) eine entscheidende Rolle. Es erstrecke sich auf den Umgang mit allen Formen des Lebens, also auch mit Tieren und Pflanzen. Töten sei daher grundsätz- 26 lich moralisch verwerflich. Über die Reinkarnationslehre erfahre der Begriff des menschlichen Lebens aber auf der anderen Seite auch eine Relativierung zu einem bloßen Durchgangsstadium. Geburt und Tod bildeten nicht mehr als „Drehtüren“ zu weiteren Formen des Daseins. Das Leben gelte zudem nicht als von einem Schöpfergott gegeben. Es entstehe dann, wenn drei Voraussetzungen zusammenträfen: Geschlechtsverkehr, Fruchtbarkeit sowie ein nach Wiedergeburt suchender Geist. Der theologischen Auffassung stehe die gesellschaftliche Praxis in buddhistischen Ländern wie Japan und Thailand diametral entgegen: In Thailand seien Abtreibungen zwar verboten, würden aber in großer Anzahl illegal durchgeführt. In Japan seien sie sogar gesetzlich erlaubt. Aufgrund seiner Auffassung hielt Keown, selbst kein Buddhist, reproduktives Klonen innerhalb des Buddhismus für theologisch vertretbar, da jenem keine Vorstellung der individuellen Gottgegebenheit des menschlichen Lebens entgegenstehe. Damit verliere das künstliche Schaffen ,neuen‘ Lebens seine Skandalträchtigkeit. Zu guter Letzt erläuterte Prof. Ren-Zong Qiu (Beijing) die Perspektiven des Konfuzianismus und die gesellschaftliche Praxis in China. Für den Konfuzianismus gelte der Mensch als ein Wesen zwischen Himmel und Erde, dem die Aufgabe zufalle, eine Verbindung zwischen diesen Sphären herzustellen. Er solle der Natur assistieren, um ihr Werk mit zu verwirklichen. Diese Aufgabe erstrecke sich in zwei Richtungen: Auf der einen Seite komme es dem Menschen zu, über die Entwicklung und Aufrechterhaltung der „Familienwerte“ einen Ort der Moralität als soziale Brutstätte der Fürsorge und Liebe zu schaffen. Auf der anderen Seite stünde der Auftrag, der weder sehenden noch reflexionsfähigen Natur die richtige Ausrichtung zu geben („rectifying nature“). So sei es Pflicht der Eltern, genetische Test durchzuführen, um alle zum Wohle der Entwicklung des Kindes nötigen Therapiemaßnahmen einleiten zu können. Grenzen für Korrekturen der Natur lägen in der Wahrung der Person („personhood“) und in der Erhaltung natürlicher Vielfalt. Abtreibungen und verbessernde Eingriffe in die Keimbahn seien nicht zu rechtfertigen. In der Schlussdiskussion ging es um den Stellenwert von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den verschiedenen Kulturen im Umgang mit vorgeburtlichem Leben und um die Möglichkeiten einer interkulturellen Bioethik. Der Religionswissenschaftler Prof. Hans G. Kippenberg (Max-Weber-Kolleg Erfurt) hob die Gleich- 27 setzung von Religion und Kultur positiv hervor. Es sei primär die Religion, die in der Lage sei, ein soziales Band zwischen Bürgern sowie zwischen Lebenden und Ungeborenen zu knüpfen. Im Hinblick auf den vorgenommenen Vergleich der Religionen warnte er jedoch davor, dass der durch die Innovationen und die versprochenen Therapiemöglichkeiten der Biotechnologien ausgeübte „Medizindruck“ zu einem Wettbewerb der Religionen führen könne, welche von ihnen am besten bzw. offensten mit den technischen Möglichkeiten umgehen könne. Ethikratmitglied Therese NeuerMiebach wies darauf hin, dass Vorstellungen über vorgeburtliches Leben kein Fixum seien, sondern auf zweckgeleiteten, gesellschaftlichen Übereinkünften beruhten. Die Konzentration auf theologische Inhalte, von denen ein Großteil der Teilnehmer vermutlich nur bruchstückhafte Kenntnisse besaß, führte dazu, dass die Tagung über weite Strecken den Charakter einer (gelungenen) Informationsveranstaltung hatte. Im Vergleich zu der komplexen Vielfalt der vermittelten theologischen Kenntnisse blieb der systematische Ertrag der Tagung dagegen eher schmal. Der Vergleich der verschiedenen Religionen führte auf zwei zentrale Gemeinsamkeiten. 1.) Das menschliche Leben – ob vor- oder nachgeburtlich – ist allen Religionen heilig. 2.) Im Hinblick auf die konkrete Bedeutsamkeit und Achtung dieser Heiligkeit scheinen heutzutage in allen Kulturkreisen massive Diskrepanzen zwischen theologischer Lehrmeinung und gesellschaftlicher Alltagspraxis zu bestehen. Muslimische, hinduistische, buddhistische und konfuzianistische Gesellschaften sind in dieser Hinsicht offenbar nicht muslimischer, hinduistischer, buddhistischer oder konfuzianistischer als europäische Gesellschaften christlich. Gegenüber den genannten Gemeinsamkeiten bleiben als Hauptunterschied, verschiedene, wenn auch nicht allzu verschiedene Antworten auf die Frage, wann das Leben des Menschen beginnt. Alles in allem leistete die Tagung einen wichtigen Beitrag zu einer interkulturellen Bioethik. Um dem mit diesem Titel erhobenen Anspruch vollends gerecht zu werden, müsste vor dem Hintergrund der gewonnenen Erkenntnisse der Versuch unternommen werden, die verschiedenen Horizonte von Religion, Wissenschaft und nichttheologischer Ethik in eine übergeordnete Perspektive zu integrieren. Eike Bohlken