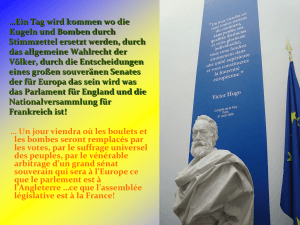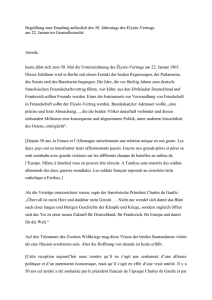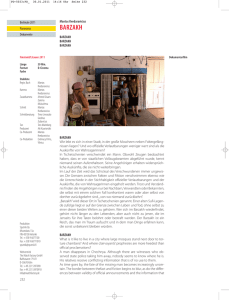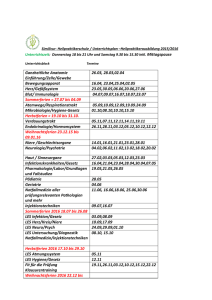Leseprobe - Philharmonie Luxembourg
Werbung

musique spectrale rainy days 2005 musique spectrale rainy days 2005 Philharmonie Luxembourg 19.11.–27.11.2005 Etablissement public Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte Impressum © Philharmonie Luxembourg, 2005 Etablissement public Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte 1, Place de l’Europe L-1499 Luxembourg www.philharmonie.lu www.rainydays.lu ISBN-10 2-9599696-0-X ISBN-13 978-2-9599696-0-7 Für den Inhalt verantwortlich: Matthias Naske Redaktion: Bernhard Günther, Dominique Escande Redaktionelle Mitarbeit: Raphael Rippinger Design: Pentagram Design Limited, Berlin Satz: Bernhard Günther Druck: Victor Buck Printed in Luxembourg Die Texte auf den Seiten 26–33, 42 f., 50–53, 70–75, 83, 96, 104, 112–117 sind Originalbeiträge. Nous remercions / Dank an: Tristan Murail, Michaël Lévinas, Philippe Hurel, Hugues Dufourt, Dr. Nina Polaschegg, Dr. Louise Duchesneau, Roula Safar, Martin Kaltenecker, Georg Friedrich Haas, Jürg Wyttenbach, David Andras; Festival Wien modern (Berno Polzer), Konzerthaus Wien (Dr. Thomas Schäfer), Festival Musica Strasbourg (Jean-Dominique Marco, Camille Vier), Centre de Documentation de la Musique Contemporaine / Cdmc Paris (Isabelle Gauchet Doris, Corinne Monceau), Internationales Musikinstitut Darmstadt (Jürgen Krebber), WDR Köln (Frank Hilberg), Universal Edition Wien (Angelika Dworak), Schott Musik International Mainz (Annegret Strehle), Tritó Barcelona (Toni Cruanyes), ZKM Karlsruhe (Susanne Wurmnest), Ircam Paris (Michael Fingerhut, Sandra El Fakhouri), BARC / Ballet Atlantique (Régine Chopinot) Tous droits réservés / Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved Official Carrier of the Philharmonie Prélude Herzlich Willkommen! Guy Lelong: L’unification spectrale Peter Niklas Wilson: Faszination des Hybriden Gérard Grisey: Zur Entstehung des Klanges Stefan Fricke: Wandern im Klang Questions en pointillés à Michaël Lévinas Questions en pointillés à Hugues Dufourt Hugues Dufourt: Ästhetik der Transparenz. Spektrale Musik Philippe Hurel: La musique spectrale – à terme! Questions en pointillés à Philippe Hurel 6 8 11 15 21 26 30 34 38 42 Programme 19.11.2005 20:00 «Les Espaces Acoustiques» – SWR Sinfonieorchester & Lucilin Gérard Grisey (Guy Lelong): Les Espaces Acoustiques Gérard Grisey: Les Espaces Acoustiques Frank Hilberg: Die akustischen Räume 20.11.2005 18:30 Volker Staub: «Vianden» – Mikroskopische Musik Hans-Jürgen Linke: Die Arbeit am geteilten Klang Volker Staub: Motorsirenen Ernstalbrecht Stiebler: Vianden 22.11.2005 20:00 «Vortex Temporum» – Ensemble intercontemporain Tristan Murail: La barque mystique Philippe Hurel: Tombeau in memoriam Gérard Grisey Grisey: Vortex Temporum Frank Hilberg: Im Strudel der Zeiten Peter Niklas Wilson: Geschichte und Geschichtslosigkeit 23.11.2005 20:00 «Professor Bad Tr ip» – Ictus Ensemble Jean-Luc Plouvier: Le Professeur Bad Trip et sa leçon de Chose 23.11.2005 21:30 «Bad Club» – Mad Fred: Romitelli remix session 25.11.2005 20:00 «Classiques du XXe Siècle» – Orch. Philharmonique du Luxembourg Guy Wagner: René Mertzig Tristan Murail: Gondwana Hugues Dufourt: La voix solitaire de l’homme Bernhard Günther: Wildes Wald- und Felsental Richard Wagner: Dichtkunst und Tonkunst 26.11.2005 18:00 «La nuit du piano spectral» – Wendeberg, Lévinas, Hodges Bernhard Günther: The soft machine Jean-Philippe Rameau: Le corps sonore Olivier Messiaen: Catalogue d’oiseaux Karlheinz Stockhausen: Klavierstücke V–VIII Peter Niklas Wilson: Riesiger intellektueller Appetit Pierre Boulez: Sonate «Que me veux-tu» Pierre Boulez: Die Welt der Klangfarben Hèctor Parra: Impromptu David Robert Coleman: Fleuve Dominique Escande: Prismes Michaël Lévinas: Anaglyphe Michaël Lévinas: Triller à la Villa d’Este György Ligeti: Etudes pour piano Aleksandr Scriabine: Explication de la vibration Tristan Murail: Territoires de l’oubli Georg Friedrich Haas: Hommage à György Ligeti Eberhardt Klemm: Die «Etudes» von Claude Debussy Georg Friedrich Haas: Franz Schubert. Die unvollendete Klaviersonate C-Dur D 840 27.11.2005 11:30 «Portrait Giacinto Scelsi» – United Instruments of Lucilin Tristan Murail: Scelsi, dé-compositeur Jürg Wyttenbach: Einige Erinnerungen an Scelsi 27.11.2005 14:30 Luxembourg Sinfonietta / Berceuse Bernhard Günther: Blick in den blauen Himmel Éric Denut: L’écriture vigilante de Michaël Lévinas Éric Denut: «Les ‹Aragons›» Gérard Grisey: Wolf Lieder Brice Pauset: Transkription als Erinnerung Peter Niklas Wilson: Grenz-Gesänge. Notizen zu Gérard Griseys «Quatre chants» 46 47 49 50 54 56 60 63 66 67 68 69 71 75 78 79 82 84 87 90 93 96 98 102 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 117 118 120 122 123 124 125 127 130 132 139 142 143 146 148 150 151 152 Service Interprètes & ensembles. Index & Biographies Compositeurs & œuvres. Index 158 170 4 PRELUDE 5 Herzlich willkommen! Das Festival rainy days ist das beste Mittel, um Farbe in die grauen Tage des Novemberwetters zu bringen. Mit einer erlesenen Auswahl von Musik der Komponisten unserer Zeit bieten die rainy days Gelegenheit, die Vielfalt, die Lebendigkeit und den Einfallsreichtum kennenzulernen, in denen sich die Musik der Gegenwart von nichts übertreffen lässt. Hinter dem Festival rainy days, 1999 vom Luxemburger Komponisten Claude Lenners ins Leben gerufen, steht unsere Begeisterung für Musik als Kunst unserer Zeit. Wir freuen uns, Sie in der Philharmonie begrüßen zu dürfen zu persönlichen Begegnungen mit dieser außergewöhnlichen Musik und den Künstlern, denen wir sie verdanken. Die rainy days zeigen sich im Gründungsjahr der Philharmonie Luxembourg an neuem Ort und in neuem Licht. Zu den United Instruments of Lucilin und der Luxembourg Sinfonietta (beide am 27.11.) sind mit dem Ensemble intercontemporain aus Paris (22.11.) und dem Ictus Ensemble aus Brüssel (23.11.) zwei der renommiertesten europäischen Ensembles für zeitgenössische Musik in der Philharmonie zu hören. Erstmals finden während der der rainy days auch zwei Orchesterkonzerte statt: zur Eröffnung des Festivals spielt das SWR Sinfonieorchester Freiburg und Baden-Baden gemeinsam mit den United Instruments of Lucilin die luxemburgische Erstaufführung der Espaces Acoustiques von Gérard Grisey (19.11.). Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg widmet sich der Musique spectrale im Rahmen der «Classiques du XXe Siècle» (25.11.). Wir freuen uns, dass IBM und LGNM als Träger dieser traditionsreichen Konzertreihe zu den neuen Kooperationspartnern der rainy days gehören – ebenso wie wir uns freuen, dass erstmals die Musik der rainy days in den Händen eines DJs zu hören sein wird (23.11.). In ganz Europa gibt es kaum einen zweiten Ort, an dem eine so große Offenheit und Wachheit gegenüber divergierenden kulturellen Traditionen spürbar ist wie in Luxemburg. Diese Freiheit in der Wahl der Perspektive machen sich auch die rainy days 2005 zunutze. Kaum etwas wäre dazu besser geeignet als die Musique spectrale: Ab den 1970er Jahren unter Federführung einer jungen französischen Avantgarde auch als Reaktion auf in Deutschland entwickelte Strömungen der zeitgenössischen Musik entstanden, wäre eine polarisierende Gegenüberstellung aus Luxemburger Sicht allzu einfach. Die rainy days erlauben sich folgerichtig den Blick auf Parallelen, Querverbindungen und Seitenblicke – verbunden mit dem Wunsch, die Musique spectrale nicht als isoliertes Phänomen, als säuberlich geordnetes ‹Kapitel der Musikgeschichte›, sondern als vielfältig verwurzelte Entwicklung von Gedankengängen und Tendenzen unserer Zeit hörbar werden zu lassen. Dazu dient – neben Publikumsgesprächen, Filmen und einem Werkstattkonzert mit Volker Staub (20.11.) – auch der vorliegende Band, der Originalbeiträge der Komponisten ebenso umfasst wie bereits klassische Texte aus der Anfangszeit der Musique spectrale. Dass das spätherbstlich regennasse Element des Wassers während der rainy days 2005 als glitzernder, spielerischer, energisch lebensspendender Stoff in Erscheinung tritt – von den «unendlichen Fluten der Harmonie» in «Siegfrieds 6 Rheinfahrt» von Richard Wagner (25.11.) und Les jeux d’eaux à la Villa d’Este von Franz Liszt in der Nuit du piano spectral (26.11.) über den Vortex Temporum Griseys und die Barque mystique von Tristan Murail (22.11.) bis zum leuchtenden Arc-en-Ciel von Giacinto Scelsi (27.11.) – ist nicht ausschließlich Zufall. Die Musik lebt. Der Regen kann kommen. Bernhard Günther Dramaturg Matthias Naske Director General Claude Debussy 1911 Lebrecht Photo Library 7 L’unification spectrale Guy Lelong1 1 Ce texte est un extrait de l’essai «Penser la musique spectrale. Des Espaces acoustiques de Gérard Grisey aux acoustiques spatialisées de Marc-André Dalbavie», à paraître aux éditions M.F. Reproduit avec l’autorisation de Guy Lelong et des éditions M.F. 2 Gérard Grisey, «Structuration des timbres dans la musique instrumentale», in: Le timbre: métaphore pour la composition. – Paris: Ircam / Bourgois, 1991, p. 356 Cette dénomination a été officialisée par un article manifeste de Hugues Dufourt, «Musique spectrale» [1979], repris dans Hugues Dufourt: Musique, pouvoir, écriture. – Paris, Christian Bourgois, 1991, p. 289–294 3 Gérard Grisey: «Vous avez dit spectral?», Contemporary Music Review, 1999 4 Rien de mieux que le début de Partiels pour dix-huit musiciens, composé en 1975 par Gérard Grisey, et qui deviendra la troisième pièce de son cycle Les Espaces Acoustiques, pour comprendre les opérations fondatrices de la musique spectrale. Le son d’un mi de trombone, que lancent des coups d’archets de contrebasse, est aussitôt simulé par une agrégation sonore réalisée par l’ensemble instrumental. Plus précisément, le spectre des fréquences qui composent ce mi de trombone a été analysé à l’aide d’un sonagramme, et les fréquences les plus saillantes de ce son – appelées «partiels» en acoustique – sont ensuite jouées simultanément par les différents instruments de l’orchestre qui, de ce fait, se mettent à fusionner en un timbre global, sonnant comme un trombone démesurément agrandi. La simulation ainsi réalisée suggère en fait un spectre synthétique qui «n’est autre que la projection dans un espace dilaté et artificiel de la structure naturelle des sons»2. En raison de cet agrandissement, le son résultant ne ressemble pas vraiment à un son de trombone, mais paraît seulement en provenir. Pour que le rapport du mi de trombone à sa simulation par l’ensemble instrumental soit plus manifeste, le phénomène est d’ailleurs plusieurs fois répété et ces répétitions donnent chaque fois lieu à des transformations de plus en plus marquées. La «musique spectrale» doit sa dénomination à cette méthode de composition, fondée sur l’analyse spectrale du son.3 Mais cette technique, consistant à composer à l’intérieur du son, a surtout ouvert la voie à une pensée du matériau musical, tout à fait neuve. La mutation qui la caractérise peut être ainsi schématisée: alors qu’auparavant l’on pouvait seulement combiner entre eux des sons existants (les notes des instruments ou des objets sonores fixés sur bande), l’on peut désormais composer les sons eux-mêmes. Bien plus, comme la méthode d’analyse spectrale permet de rapporter à un même modèle acoustique unificateur l’ensemble des phénomènes sonores, il devient possible de modéliser, et donc d’intégrer pareillement, aussi bien les sons purs (ceux des instruments traditionnels) que les sons complexes ou «bruiteux» (notamment les percussions), sans qu’ils paraissent étrangers l’un à l’autre, et cette découverte allait provoquer un élargissement radical du champ musical. Dans le dernier texte qu’il ait écrit, Gérard Grisey a précisé les enjeux du projet spectral.4 Plus encore que la musique sérielle, la musique spectrale est parvenue à intégrer l’ensemble des phénomènes sonores parce qu’elle «proposait une organisation formelle et un matériau sonore directement issus de la physique des sons tels que la science et l’accès à la microphonie nous la donnaient alors à percevoir». Cette initiative aux sons opère un retournement comparable à celui opéré par Mallarmé un siècle plus tôt, puisque là où celui-ci élaborait ses poèmes à partir des caractéristiques langagières des mots, les compositeurs spectraux n’élaborent plus leur musique à partir d’un thème ou d’un motif, même réduit à une structure, mais à partir des caractéristiques physiques du son. Prenant donc pour unité conceptuelle de base non plus la note mais la fréquence, la musique spectrale peut intégrer tous les sons, du bruit blanc au son sinusoïdal. Elle quitte ainsi le système tempéré en faisant une utilisation intensive des 8 micro-intervalles. À l’opposé du sérialisme intégral, qui avait tenté de définir les constituants ultimes de la musique, les compositeurs spectraux redéfinissent le matériau de base de la musique afin de pouvoir intégrer l’ensemble des phénomènes sonores. Ainsi, alors que le sérialisme intégral s’était vu contraint de neutraliser l’harmonie par le recours au chromatisme absolu, la musique spectrale la réintègre en la repensant. En faisant fusionner acoustiquement les différents sons simultanés d’un orchestre, la musique spectrale invente en effet «un être hybride pour notre perception, un son qui, sans être encore un timbre, n’est déjà plus tout à fait un accord»5. En fait, comme ce sont les instruments de l’orchestre qui réalisent ces fusions sonores, chaque instrument ajoute son timbre particulier et résiste ainsi à la fusion générale. Le son résultant est donc beaucoup plus riche et Gérard Grisey a d’ailleurs qualifié cette technique de «synthèse instrumentale». Il est aussi caractérisé par un étirement, qui est l’une des marques de la musique spectrale à ses débuts, car l’agrandissement microphonique du son entraîne aussi son agrandissement temporel. Mais surtout, ces sonorités hybrides de la musique spectrale proposent une harmonicité nouvelle, parce qu’elles dépassent l’ancienne dissociation de l’harmonie et de l’orchestration, au profit d’un art renouvelé du timbre où ces notions sont redéfinies au sein d’une même entité. Cette aptitude de la musique spectrale à repenser l’harmonie et à rapprocher le son instrumental du son électronique n’est, cela dit, pas sans antécédents. Ainsi Stockhausen a-t-il conçu les accords de Stimmung pour six vocalistes à partir d’un spectre harmonique, si bien que le son obtenu semble outrepasser le seul cadre vocal de l’œuvre. De même, certaines pièces purement instrumentales, comme Metastasis de Xenakis, Atmosphères de Ligeti ou Musique pour dix-huit musiciens de Steve Reich, sonnent parfois de façon électronique, parce qu’elles proposent une perception globale de leurs différents éléments.6 Mais pour avoir bénéficié des travaux de l’acousticien Emile Leip, voire des premiers essais de musique de synthèse réalisés par John Chowning et Jean-Claude Risset, qui repensaient le timbre à partir d’une nouvelle modélisation de la hauteur, les compositeurs spectraux ont franchi un seuil supplémentaire en annexant les régions sonores provenant des aspects microphoniques du son. Aussi les œuvres spectrales comptent-elles les réussites les plus remarquables quant à l’intégration des sons électroniques et instrumentaux, comme en témoignent, par exemple, Jour, Contre-jour de Gérard Grisey pour treize musiciens, orgue électrique et bande magnétique 4 pistes (1979) ou Désintégrations de Tristan Murail pour 17 instruments et bande magnétique synthétisée par ordinateur (1982–1983). Mais elles ont aussi réintégré les régions sonores que l’avant-garde musicale des années cinquante avaient rejetées à la suite de Schoenberg, parce qu’elles rappelaient trop les polarités de la musique tonale. Autrement dit, la musique spectrale est parvenue à «unifier», au sein d’un même système acoustique, l’ensemble de phénomènes sonores avant elle largement dispersés. De ce point de vue, l’unification accomplie par la musique spectrale est exemplaire, car elle lève les «interdits» décrétés par les avant-gardes, sans céder pour autant à la moindre tentation restauratrice. Reprenant en effet à l’état de fonction sonore certains des agencements que les sériels avaient «interdits» (l’octave, la consonance, la régularité rythmique…), elle les dissocie des formes historiques qui leur ont donné naissance pour les rétablir «dans un contexte plus ample»7 qui relativise leur réemploi et les fait entendre de façon toute autre. Plus précisément, ces agencements, réintégrés au sein d’une physique sonore nouvelle ayant pour unité conceptuelle de base la fréquence au lieu de la note, s’entendent différemment parce qu’ils ont été redéfinis, de façon fonctionnelle, comme phénomène acoustique périodique. Gérard Grisey: «La musique: le devenir des sons» [1982], repris dans Conséquences N° 7–8, 1986, p. 127 5 Ligeti est plus particulièrement parvenu à ce résultat en intégrant des phénomènes temporels dont la durée est inférieure à ce que l’oreille peut percevoir (inférieure à environ 1 / 20 de seconde). Dès lors, la musique franchit un «seuil de fusion» avec lequel les phénomènes temporels superposés ne peuvent plus être distingués et accèdent du coup à l’infraperceptif, en produisant un effet sonore tout à fait inhabituel. György Ligeti, «Musique et technique» [1981], repris dans Neuf essais sur la musique. – Genève: Contrechamps, 2001, p. 201. 6 Gérard Grisey, «Vous avez dit spectral», op. cit. 7 9 8 «Les dérives sonores de Gérard Grisey» [entretien avec Guy Lelong], art press N° 123, p. 47, mars 1988, repris dans revue éc / artS N° 1, 1999. 10 Là où la musique sérielle, contrainte de rejeter les polarités de la musique tonale pour assurer sa cohérence fondée sur l’absence de hiérarchie, relevait d’une logique de l’interdit, la musique spectrale, parce qu’elle a su restituer ces polarités et régularités dans un contexte unificateur, relève d’une logique de l’intégration. Synthétisé par cette déclaration de Gérard Grisey: «Je ne crois donc pas aux rejets mais aux fonctions»8, ce souci de réintégrer des agencements que les avant-gardes avaient rejetés a d’ailleurs conduit les compositeurs spectraux à trouver des solutions inattendues. À l’inverse des musiques néo-tonales qui réutilisent telles quelles, c’est-à dire de manière régressive ou anti-historique, les fonctions de la tonalité, la musique spectrale intègre certaines régularités du phénomène sonore, et plus particulièrement la consonance, au sein d’un formalisme acoustique général, qui leur accorde une toute autre fonction, de la même façon, si l’on veut, qu’Einstein intègre la physique classique newtonnienne en la régionalisant au sein d’un formalisme plus ample. À cet égard, cette réintégration fonctionnelle non restauratrice, réussie par la musique spectrale, pourrait servir de référence à l’ensemble du champ artistique, pour échapper aux interdits décrétés par les avant-gardes, sans pour autant revenir à des modèles anciens. Faszination des Hybriden Notizen zur Musik Gérard Griseys Peter Niklas Wilson Es war ein großer Auftritt. Als die Eleven Olivier Messiaens am Pariser Conservatoire, die sich 1973 zur «Groupe de l’Itinéraire» zusammengeschlossen hatten, das internationale Parkett betraten, begleiteten sie ihre musikalischen Fanfaren mit Manifesten. Manifeste wirken nach innen wie nach außen: Sie dienen der Selbstversicherung, der Festigung des Kollektivs und der Abgrenzung gegen das Andere, sind sowohl Ausdruck freundschaftlicher Solidarität wie Kampfansagen gegen den Rest der Welt. Im Falle der «Groupe de l’Itinéraire» waren die Gegner an zwei Fronten auszumachen: die Vertreter eines verselbständigten Strukturdenkens in der Tradition des Serialismus und die Nostalgiker des Neoexpressionismus. Letztere wurden von den Newcomern rasch abgefertigt: «Wir erleben, wie sich die Liebhaber des Vergangenen zu einer Parade versammeln: Apostel der neuen Einfachheit, einfältige Expressionisten oder modehörige Kleinmeister […]. So sei jedem sein Weg zurück gegönnt: Gestern war es noch der Primitivismus, heute ist es die aggressive Nostalgie.» So Hugues Dufourt, mit Gérard Grisey, Tristan Murail und Michael Levinas einer der Wortführer der «L’Itinéraire»-Clique – die sich siegessicher gab, den Königsweg eines neuen Komponierens gefunden zu haben: «Für uns hingegen ist der Weg deutlich vorgezeichnet: kompositorische Disziplin, Mut zum künstlich Gemachten, entschiedener Rationalismus. Nur auf diesem Wege verwandeln sich die Träume in schöpferische Impulse.» «Nur so – und nicht anders»: der Ton des Manifests. Und so verkündete eine «L’Itinéraire»-Broschüre auch in eher zeituntypischer Zukunftseuphorie: «L’Itinéraire – ce sera demain!» Doch der emphatisch verfochtene Rationalismus à la «L’Itinéraire» wollte eben auch ein anderer sein als der der Väter, als die strukturelle Ratio eines Boulez, die klingende Mathematik eines Xenakis. Wie Grisey in einem Darmstädter Vortrag mit dem programmatischen Titel «La musique: le devenir des sons» («Die Musik: Das Werden der Klänge»)1 polemisierte: «Wir sind Musiker, und unser Modell ist der Klang und nicht die Literatur, der Klang und nicht die Mathematik, der Klang und nicht das Theater, die bildenden Künste, die Quantenphysik, die Geologie, die Astrologie oder die Akupunktur!» 1 «Zur Entstehung des Klanges», vgl. S.15 ff. Der Klang: Kraftfeld statt Objekt Der Schauplatz Darmstadt – in jenen Jahren von der Ausstrahlung Brian Ferneyhoughs und Helmut Lachenmanns dominiert – war probat gewählt. Bereits bei seinem ersten Darmstadt-Auftritt anno 1978 hatte Grisey postuliert: «Es ist von nun an nicht mehr möglich, die Klänge als definierbare und permutierbare Objekte zu betrachten. Mir erscheinen sie eher wie Kraftfelder in der Zeit. Diese Kräfte – ich verwende bewusst dieses Wort und nicht den Begriff ‹Form› – sind unendlich beweglich und fluktuierend; wie Zellen kennen sie eine Geburt, ein Leben und einen Tod und neigen zu einer kontinuierlichen Transformation ihrer Energie.» «Es ist von nun an nicht mehr möglich», «nur auf diesem Weg»: kein Wunder, dass der selbstgewisse Ton der jungen Franzosen für einige Irritationen sorgte. Als Klangsensualisten – eben ‹typisch französisch› – tat sie mancher KomplexismusGläubige gern ab, und die biologistische Metaphorik Griseys konnte Anlass bieten, 11 die «L’Itinéraire»-Ästhetik als musikalisches Zeitgeist-Phänomen zu belächeln, die Kompositionen des Kollektivs als grüne Schonkost für jene, die der klanglichen Rigorosität «wahrer» Neuer Musik nicht gewachsen waren. (Wie formulierte Grisey: «Mit einer Geburt, einem Leben und einem Tod ähnelt der Klang einem Lebewesen. Die Zeit ist seine Atmosphäre und sein Territorium. […] Es ließe sich von einer Ökologie des Tons als einer neuen Wissenschaft träumen, die den Musikern zu Gebote stünde.») Indes: Griseys Darmstädter Vorlesungen stellten rasch klar, dass hier kein romantischer Hobby-Ökologe am Werke war, sondern ein scharfer Analytiker, der seine kompositorischen Entscheidungen wohl zu begründen wusste, dessen Komponieren auf akustischen Analysen und kohärentem Strukturdenken beruhte – nur dass dieses Denken den Klang stets als integrale Gestalt, nicht als zergliederbare Größe begriff (Grisey: «Die von der seriellen Musik eingeführte Idee definierter und isolierter Parameter scheint veraltet und unfähig, den klanglichen Phänomenen gerecht zu werden.»). Der Kern von Griseys Alternativ-Programm zu ParameterTabellarik und Postromantik gleichermaßen lässt sich auf vier Punkte kondensieren: — das Konzept eines «biomorphen» Komponierens, das den Klang als lebendigen (Mikro-)Organismus begreift, dessen innere, von akustischen Forschungen freigelegte Dynamik zum Modell musikalischer Gestaltung auf allen Wahrnehmungsebenen wird — das Konzept eines spektralen Komponierens, das aus – harmonischen wie inharmonischen! – Spektren vorgefundener Klänge eine neue, prozessual zwischen Klang und Geräusch vermittelnde Harmonik konstruiert, ohne Berührungsängste mit dem Gespenst der Tonalität — das Konzept einer «weichen» Periodizität, deren Modell der Herzschlag, nicht das Metronom ist — das formale – und wiederum biomorphe – Modell des zyklischen Wechsels von Spannung und Entspannung, Aktivität und Ruhe, wie es im Kreislauf des Atmens gegeben ist. «Synthèse instrumentale» Dass dies keine bloßen Kopfgeburten waren, sondern tragfähige Prämissen für eine Musik mit prononciert eigenem Ton, bewiesen spätestens Griseys Ensemblekompositionen Périodes für sieben Spieler (1974) und Partiels für 18 (oder 16) Musiker (1975), zwei Stücke, die zu Keimzellen des groß angelegten Zyklus’ Les Espaces acoustiques wurden. Typisch für diese (und spätere) Stücke ist Griseys Technik der «synthèse instrumentale», der instrumentalen Simulation vom Klangspektren: Teiltonspektren eines Klangs werden von einem Ensemble nachgebildet, indem jedem Instrument ein Teilton zugewiesen wird. Das verlangt nicht nur eine hoch entwickelte mikrotonale Spielkultur, es führt auch zu zwitterhaften Gebilden zwischen Klangfarbe und Akkord: Da die das Spektrum simulierenden Instrumentaltöne ja jeweils eigene Obertöne aufweisen, entsteht eben kein getreues Abbild des spektralen Modells, sondern ein weitaus komplexeres, irisierendes spektrales Gebilde. Aber dann ist dieses Zwitterhafte ja ohnehin ein Signum von Gérard Griseys Musik: Das Hybride von Naturmetaphorik einer- und rigider rationaler Kontrolle andererseits, von verbalem Mord an den seriellen Vätern und munterem Hantieren mit Fibonacci-Reihen, von Biomorphem und Technomorphem (denn Grisey simuliert qua «synthèse instrumentale» nicht nur «natürliche» Klangspektren, sondern auch die Wirkungsweisen elektronischer Geräte wie Bandpassfilter oder Harmonizer). Das faszinierend Zwitterhafte der Griseyschen Klänge: zwischen Ton und Geräusch, zwischen Tonalität und Atonalität, zwischen Klang und Akkord (Grisey: «ein hybrides Etwas für unsere Wahrnehmung, ein Klang, der nicht mehr wirklich Klangfarbe ist, ohne aber schon ein wirklicher Akkord zu sein, eine Art Mutant der heutigen Musik»). Das Zwitterhafte zwischen der demonstrativen Ablehnung außermusikalischer Modelle, Inhalte und Programme («Wir sind Musiker und unser Modell ist der Klang…») und einem durchaus spürbaren Sensorium für die rituelle, sakrale Dimension von Musik. Denn durch die musikalischen Dimensionsverschiebungen, die musikalische Mikroskopierung, 12 die Grisey vornimmt, indem er mikrozeitliche Prozesse des Klanglichen in die Makro-Zeit der musikalischen Form transponiert, entsteht eine neue Form der Zeitlichkeit, die Allusionen an die «heilige Zeit», die der Alltags-Zeit entrückte Zeit des Rituals, wie sie Mircea Eliade beschreiben hat, weckt. In Griseys Worten: «Die Komposition von Prozessen steht außerhalb der Gestik des Alltagslebens und erschreckt uns gerade dadurch. Sie ist unmenschlich, kosmisch und beschwört die Faszination des Heiligen und des Unbekannten; so gelangen wir zu dem, was Gilles Deleuze als Herrlichkeit (Glanz) des ES definiert: eine Welt der noch nicht persönlichen Individuationen und der vorindividuellen Sonderbarkeiten.» Dass diese Faszination des «Heiligen und Unbekannten» in Griseys Musik noch eine andere Dimension hat, nämlich seine intensive Beschäftigung mit der altägyptischen Mythologie, ihrem Dualismus von Sonnen- und Schattenwelt, hat sich in mehreren Kompositionen unmittelbar niedergeschlagen, so Anubis-Nout für Kontrabassklarinette (1983), Jour, contre-jour für Ensemble und Tonband (1978 / 1979) und Griseys Abschiedswerk Quatre chants pour franchir le seuil (1999). Und man mag spekulieren, inwieweit Grisey, der Rompreisträger, nicht nur von den unendlichen Klangbändern der Musik Giacinto Scelsis, sondern auch von der musikalischen Metaphysik des römischen Aristokraten beeindruckt gewesen sein mag, den er 1974 kennenlernte. Tradition als Thema War Griseys frühe Musik – wie die seiner «L’Itinéraire»-Mitstreiter – von der Rhetorik der Abgrenzung bestimmt, der Neu-Setzung eigener Ideen, so kam es seit Mitte der Achtziger zu einer Annäherung an die Vergangenheit, einer Thematisierung von Tradition. Die ästhetischen Prämissen von Griseys Musik, wie sie oben skizziert wurden, legen nahe, dass Griseys Musik im Kern eine der Vermittlung, des allmählichen Übergangs, der Transformation ist, nicht des Kontrasts, der scharfen Konturen. Das bedeutete nicht nur Ausgrenzung bestimmter Aspekte traditionellen Komponierens, sondern auch die Gefahr klanglicher Klischees. Mit dem Quintett Talea (1986), das im Titel auf mittelalterliche Techniken der Zeitgestaltung verweist, betrieb Grisey quasi kompositorische Selbstkritik: «In Talea nähere ich mich zwei Aspekten der Musiksprache, von denen mich meine Untersuchungen der Synthèse instrumentale, der Mikrophonie des Klangs und der Transformationen entfernt hatten, nämlich Geschwindigkeit und Kontrast.» Und noch direkter in die Höhle des Löwen, nämlich in die Gefahrenzone der Klischees französischen Komponierens, begab sich Grisey mit dem Sextett Vortex temporum (1995), das Griseys Verfahren der Dehnung und Stauchung von Spektren und Zeitdimensionen auf ein historisch belastetes Material anwendet, basiert das Stück doch auf einer Arpeggio-Figur aus Ravels Daphnis et Chloé. Das sollte man nun freilich nicht als Heimkehr des verlorenen Sohns in den sicheren Hort der Musique francaise begreifen, sondern als selbstbewusste Geste eines Meisters, der sich aus der Souveränität der eigenen Position mit der Vergangenheit beschäftigen konnte. Oder, in Griseys Worten: «Es handelt sich hier freilich nicht um tonale Musik; es geht vielmehr darum, zu erfassen, was in ihrem Funktionieren an heute noch Aktuellem und Neuem steckt.» Es war ein großer Auftritt, damals, um 1980. Doch die internationale Wirkung ließ auf sich warten. In Frankreich wurde Grisey schnell zur Ikone einer ganzen Komponistengeneration, die man – auf die Modellwirkung von Partiels abhebend – scherzhaft «Les Partielistes» taufte. In Deutschland verlief die interpretatorische, kompositorische, musikologische Rezeption widerstrebend, mit starker Zeitverzögerung, ja kam erst vor einigen Jahren wirklich in Gang. Unterdessen hatten sich die Fronten längst verändert. Nicht von ungefähr widmete Grisey den dritten Satz von Vortex temporum Helmut Lachenmann – und Lachenmann replizierte in poetischer Emphase: «Griseys Musik: geheimnisvolles Vehikel – ohne Geheimnisse – für leuchtende Reisen des Hörens in die Verwandlung. Lustvoll irritierende Erfahrung von Klang und Zeit – sich ständig transformierend, zerfallend und sich kristallisierend: Phönix und Asche zugleich. Griseys Musik macht die Sinne und den Geist jedesmal auf andere Weise staunen – und sie staunt selbst mit.» 13 Gérard Grisey Photo: Guy Vivien 14 Zur Entstehung des Klanges Gérard Grisey1 Die verschiedenen Prozesse, die bei der Veränderung eines Klangs in einen anderen oder einer Klanggruppe in eine andere auftreten, bilden die eigentliche Basis meiner musikalischen Schreibweise, die Idee und den Keim jeder Komposition. Der Baustoff kommt von der Klangentstehung her, von der Makrostruktur und nicht umgekehrt. Anders gesagt, es gibt kein Grundmaterial (Melodiezelle, Tonkomplex, Notenwerte etc.), von dem die große Form eine Art Entwicklung im nachhinein darstellen würde. Es ist der Prozess, der am Anfang steht; er bestimmt die Veränderung der Klangfiguren und führt dazu, ohne Unterlass neue zu schaffen. Ich bin selbst erstaunt zu entdecken, bis zu welchem Punkt die erzeugten Klänge durch diese Prozesse diejenigen überholen, und zwar sehr weit, die man sich a priori abstrakt und zeitlos vorstellen könnte. In meiner Musik kann der Klang niemals für sich selbst betrachtet werden, sondern er ist immer durch den Filter seiner Geschichte gegangen. Wohin geht er? Wo kommt er her? Diese Fragen stelle ich mir in jedem Augenblick bei der Partitur, die ich gerade schreibe. Schließlich könnte man sagen, dass der Baustoff nicht mehr so sehr als autonome Quantität existiert, sondern dass er zu reinem klanglichem Werden sublimiert ist, das sich ohne Unterlaß in Veränderung befindet. Ungreifbar für den Augenblick lässt er sich nur in der Zeitdauer aussondern und ergreifen. Aber diese Versicherung führt mich dazu, ihren Inhalt richtig zu erklären; denn gerade durch die Funktion ihrer eigenen akustischen Qualitäten sind die verschiedenen Klangtypen in den Prozess integriert und determinieren eine gewisse Zeit. Es existiert also eigentlich ein Netz fortwährender Relationen, ein beständiges Hin und Her des Gedankens zwischen Baustoff und Prozess, wie zwischen Mikround Makrokosmos. Zu determinieren, von welcher Klangfigur er ausgeht und zu welcher anderen Figur er hinläuft, darin scheint mir die grundsätzliche Wahl das heutigen Komponisten zu bestehen. Bleibt noch die Zeit, die Zeit dieser Veränderung, die die Form selbst seines Taumels ist. Orientierungspunkte Es wäre noch zu sagen, dass unsere begrenzten Sinne Markierungen brauchen, um irgendeine Bewegung wahrzunehmen. Es handelt sich weder um eine Klangzelle noch darum ein Grundmaterial zu entwickeln, sondern um eine Art überaus einfacher Orientierungspunkte, die jeder wahrnehmen und behalten können sollte. Wir werden zwei davon festhalten: die rhythmische Periodizität und das harmonische Spektrum (andere Form der Periodizität). Wahrnehmung: Das Ähnliche und das Verschiedene Unsere Wahrnehmung ist relativ; ununterbrochen vergleicht sie das Objekt, dessen sie eben inneward, mit einem anderen – zuvor gewahrten oder noch virtuellen Objekt, das in unserem Erinnerungsvermögen lokalisiert ist. Unterschied oder Fehlen eines Unterschiedes qualifizieren alle Wahrnehmung. Auszug aus Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik, Band XVII. – Mainz: Schott, 1979, S. 73–79. Abdruck mit Genehmigung von Schott Musik International GmbH & Co. KG Mainz. Der hier im Wortlaut der originalen deutschen Fassung wiedergegebene Text erschien auf Französisch unter dem Titel «La musique: le devenir des sons» [1982], Conséquences N° 7–8, 1986. 1 15 Wir ordnen Wahrgenommenes nicht, indem wir es auf eine einheitliche Norm beziehen, sondern indem wir es in ein Netz von Beziehungen einfügen, um seine Eigenart zu fassen. Anders ausgedrückt: ein Ton existiert nur vermöge seiner Individualität, und diese Individualität gibt sich nur in einem Kontext zu erkennen, der sie beleuchtet und rechtfertigt. Daher betrachte ich es – für den Komponisten – als entscheidend, nicht aufs bloße Material mehr einzuwirken, sondern auf den Leerraum, auf die Distanz, die einen Ton von einem anderen trennt. Das Ähnliche und das Verschiedene als eigentliche Basis der musikalischen Komposition in Angriff zu nehmen erlaubt uns tatsächlich, zwei Klippen zu umschiffen: die Hierarchie und die Gleichmacherei. Zuerst ist es nötig, bei jedem Klang die Qualitäten auszusondern, die ihn von allen anderen unterscheiden, und die, weit davon ihn zu isolieren, seine unersetzliche Eigenart herausstellen. Diese Qualitäten können nur durch akustische Übung eingeschätzt werden. Wir entdecken nun, dass jeder Klangtyp für unser Ohr eine besondere Prägnanz hat: So wird ein aus harmonischen Obertönen bestehender Klang niemals dieselbe Prägnanz haben wie weißes Rauschen oder ein aus unharmonischen Obertönen gebildeter Klang; eine Oktave wird für das Ohr niemals denselben Reibungsgrad besitzen wie eine kleine Terz. Handelt es sich darum, eine alte kulturelle Hierarchie wiederaufleben zu lassen: gute Intervalle, schlechte Intervalle, Konsonanzen, Dissonanzen? Überhaupt nicht. Das wäre ein Rückfall in einen vergangenen Dualismus das hieße auch zu ignorieren, dass der kulturelle Kontext oder die Klangentstehung die Klangqualitäten insofern beeinflussen können, als die Eigenart radikal umgewendet wird. Ich ahne unterdessen, dass irgendwo in unserer Wahrnehmung eine Grenze existiert ein Nullpunkt, den zu überschreiten unmöglich ist, ohne im Absurden unterzugehen. Das wäre diese Schwelle, von der ich sprach. Von dieser Schwelle aus sollte sich die gesamte Musik entwickeln. Der zweite Punkt führt die Organisation dieses Baustoffes ein, was noch weitere Kapitel nötig machen wird. Inzwischen halten wir fest, dass alle Klänge vom reinen Sinuston bis zum weißen Rauschen daran teilhaben können. Ohne sie dominieren zu wollen, müssen wir lernen, mit der Natur der Klänge zu spielen, indem wir die verschiedenen Arten und Rassen, die sie uns vorschlägt voll akzeptieren. Zwischen der tonalen oder neo-tonalen Hierarchie und dem seriellen oder neoseriellen Egalitarismus existiert ein dritter Weg. Unterschiede zu erkennen und anzuerkennen. Trachten wir endlich danach, zugleich Nivellierung und Kolonialisierung zu vermeiden. Geschichte Die Wissenschaft hat uns die Wichtigkeit des horizontalen Netzes der im Kosmos existierenden Beziehungen entdecken oder wiederentdecken lassen. Wir sind am Anbruch einer neuen Ära die erstmals eine Musik stammelnd hervorbringt, die versucht, alle Klänge zu integrieren, und deren Formen aus dem Netz der Verbindungen entstehen, die zwischen den Klängen existieren. Um das zu vollbringen, sind wir gerade dabei, ein Klangkontinuurn klar herauszustellen, in dem jeder Klang durch und für die Klänge lebt, die ihn umgeben, die ihm vorangehen oder ihm folgen. Das Diskontinuum wird später kommen, wenn diese Beziehungen ausreichend klar geworden sind. Dynamismus Es ist mir nicht länger möglich die Töne als festgesetzte und untereinander permutierbare Objekte aufzufassen. Sie erscheinen mir eher wie Bündelung zeitlich gerichteter Kräfte. Diese Kräfte – ich verwende den Ausdruck mit Bedacht und 16 bediene mich nicht des Wortes Form – sind unendlich beweglich und fließend; sie leben wie Zellen, haben eine Geburt und einen Tod und tendieren vor allem zu einer ständigen Transformation ihrer Energie. Der unbewegliche, fixierte Ton existiert nicht so wenig wie die Felsschichten der Gebirge unbeweglich sind. Es macht geradezu die Definition des Tones aus, dass er vorübergeht. Weder ein isolierter Augenblick noch auch eine Folge genau beschriebener isolierter und aufeinandergereihter Augenblicke vermöchte ihn zu definieren. Einer besseren Definition des Tons könnte uns wohl einzig die Kenntnis der Energie, die ihn je und je durchfährt, und des Gewebes der Wechselwirkungen näherbringen, das alle seine Parameter bestimmt. Es ließe sich [von] einer Ökologie des Tons als von einer neuen Wissenschaft träumen, die den Musikern zu Gebote stünde … Schon die Praxis des elektronischen Studiums lehrte uns, die Komponenten des Tons nicht als isolierte Tatbestände aufzufassen, wie es die serielle Musik mit ihrer säuberlichen Bestimmung und Trennung seiner Parameter getan hatte, sondern als ein komplexes Netz vielfältiger Interaktionen und Reaktionen zwischen eben diesen Parametern. Jeder weiss zum Beispiel, dass zwei Töne deren Frequenzen sehr nah beieinanderliegen, Schwebungen hervorrufen. Sind diese Schwebungen sehr schnell, so bewirken sie eine Änderung der Klangfarbe, sind sie langsamer, so zeigten sie periodische Ereignisse, die wir als Rhythmen wahrnehmen. Ebenso weiß man, dass die Lautstärke bestimmenden Einfluß auf die Tonhöhenwahrnehmung hat, dass ein Erkennen der Klangfarbe in hohem Maß von der Dauer eines Tons abhängt etc. Man könnte die Aufzählung dieser Überlagerungen, die von unserem Wahrnehmungsvermögen und seinen Grenzen gezeitigt werden, ins Unendliche fortsetzen. Andererseits ist es nicht überflüssig, daran zu erinnern, dass die Parameter nur ein Leseraster sind, eine Simplifikation, eine Art Axiom, welches es uns überhaupt ermöglicht das Problem des Tons anzugehen. Es kommt ihnen jedoch keinerlei reale Existenz zu, denn wir nehmen den Ton global und total – nicht analytisch – wahr. Kultur Es sei mir gestattet, an dieser Stelle all jenen öffentlich zu danken, die mir dazu verholfen haben, der Musiker zu sein, der ich heute bin, an jenen, die mich durch das Beispiel ihrer Musik dazu gezwungen haben, ausreichend neidisch zu werden, um ihnen nacheifern zu wollen. Ich nenne: O. Messiaen, G. Scelsi, K. Stockhausen, F. Cerha, E. Varèse, I. Strawinsky, B. Bartok, A. Webern, G. Mahler, C. Debussy, R. Wagner, L. v. Beethoven, W. A. Mozart, L. Couperin, J. S. Bach, C. Monteverdi, G. Frescobaldi, J. Ockeghem, G. de Machault … und all die kollektiven Autoren der außereuropäischen Musikarten, der thibetanischen, der balinesischen, der japanischen, der pygmeischen… Wenn ich sollte es der Zufall, Namen oder Völker vergessen habe, so mögen diese sicher sein, wenn auch nicht auf dieser Liste, so doch in meinem Gedächtnis präsent zu sein. Jede Ähnlichkeit zwischen den Klängen, die ich verwende und jene, die man bei den obengenannten Autoren finden kann, ist mit Wissen und Willen unbewusst. Tempus ex machina Unter Berücksichtigung nicht nur des Klanges, sondern, mehr noch, der wahrgenommenen Unterschiede zwischen den Klängen, wird der Grad der Voraussehbarkeit oder besser der Voraushörbarkeit zum wahren Grundstoff des Komponisten. Folglich bedeutet Handeln nach dem Grad der Voraussehbarkeit das direkte Komponieren der musikalischen Zeit, d.h. der wahrnehmbaren Zeit, nicht der chronometrischen Zeit. 17 Stellen wir uns ein klangliches Ereignis A vor, gefolgt von einem anderen Ereignis B. Zwischen A und B existiert, was man die Dichte der Gegenwart nennt, eine Dichte, die keine Konstante ist, sondern, die sich ausdehnt oder zusammenzieht unter Einwirkung des Ereignisses. Wenn nämlich der Unterschied zwischen A und B quasi gleich null ist, anders gesagt wenn der Klang B vollkommen vorhersehbar ist scheint die Zeit in einer bestimmten Geschwindigkeit abzulaufen. Im Gegensatz dazu läuft die Zeit, wenn Klang B vollkommen anders ist, in einer anderen Geschwindigkeit ab. Es muss auch Zeitlöcher geben, die dem, was Flugppassagiere Luftlöcher nennen, entsprechen. Die messbare Zeit ist keineswegs aufgehoben, jedoch verbirgt die Wahrnehmung, die wir von ihr haben, den linearen Aspekt für einen mehr oder weniger langen Moment. So lässt uns z. B. ein unerwarteter akustischer Schock über eine gewisse Zeitspanne schnell hinweggleiten. Die Klänge, die während der Zeit der Dämpfung wahrgenommen werden – der Zeit, die uns notwendig ist, um ein relatives Gleichgewicht wiederzufinden –, haben keineswegs mehr den gleichen emotionellen, noch den gleichen zeitlichen Wert. Dieser Schock, der den linearen Ablauf der Zeit durcheinander bringt, und der eine heftige Spur im Gedächtnis hinterlässt, verringert unsere Fähigkeit, die Folge des musikalischen Vortrags zu begreifen. Die Zeit hat sich zusammengezogen. Im Gegensatz dazu lässt uns eine Folge von extrem vorhersehbaren, klanglichen Ereignissen einen großen Wahrnehmungsspielraum. Das geringste Ereignis gewinnt an Wichtigkeit. Dieses Mal hat die Zeit sich ausgedehnt. Im übrigen ist es diese Form der Vorhersehbarkeit – jene ausgedehnte Zeit die wir benötigen, um den mikrophonischen Aspekt des Klangs zu erfahren. Alles spielt sich so ab, als ob der Zoomeffekt, der uns die innere Struktur der Klänge nahe bringt, nur auf Grund eines Umkehreffekts funktioniert, der die Zeit betrifft: Eine Art Zeitlupe. Je mehr wir unsere Hörschärfe erweitern, um die mikrophonische Welt zu erfahren, desto mehr schränken wir unser Zeitgefühl ein, so dass wir relativ große Zeitwerte brauchen. Vielleicht ist dies ein Gesetz der Wahrnehmung, das man wie folgt formulieren könnte: Die Schärfe der auditiven Wahrnehmung ist umgekehrt proportional der Schärfe der zeitlichen Wahrnehmung. Dies lässt sich auch mittels einer einfachen Energieübertragung erklären. Wir wissen z. B., dass die visuelle Wahrnehmung (Film, Fernsehen) soviel Energie verbraucht, dass man die Lautstärke steigern muss, um eine ausreichende Hörempfindung zu erreichen. Wir sind hier weit von der Zeit entfernt, wie sie die Musiker des 20. Jahrhunderts strukturierten. Innerhalb dieser Strukturen erscheint die Zeit wie eine Gerade, die, bestimmten Proportionen folgend, unterteilt ist; der Hörer befindet sich demnach in der Mitte dieser Linie miteinbegriffen. Um verständlich zu machen, worum es geht, hätte ich nur die von Olivier Messiaen zwischen umkehrbaren und nicht umkehrbaren Tonlängen, aufgestellten Unterscheidungen zu zitieren, zudem jene von Pierre Boulez zwischen symmetrischen und asymetrischen Tonlängen. Diese statische und räumliche Vision der Zeit ist eine reine Abstraktion, eine Methode der Komposition, die auf der Ebene der unmittelbaren Wahrnehmung keinerlei Realität besitzt. Einem Musikwerk gegenüber sind wir nämlich nicht, wie etwa einem Raum gegenüber, passiver Beobachter auf einem unbeweglichen Punkt. Der Standpunkt der Wahrnehmung ist im Gegenteil seinerseits ständig in Bewegung, da es sich ja um die Gegenwart handelt. Ich vermute im übrigen, dass wir die Zeit eines Musikwerkes von einer anderen Zeit aus erfahren, die der Rhythmus unseres Lebens ist. Es muss demnach so etwas wie eine Perspektive existieren, eine Fluchtlinie, die die Klänge deformiert, je nachdem, wie diese sich unserem Gedächtnis einprägen. 18 Zu der Zeit-Klang-Dynamik, die wir beschrieben haben, kommt diejenige die durch die Beziehungen verwirkt wird, die zwischen der Zeit des Hörers (seinem Herzrhythmus, seinem Atemrhythmus, seiner Ermüdung im Augenblick des Hörens) und der mechanischen Zeit des Klanges bestehen, der ihn wie eine Art Fruchtwasser umgibt. Zwischen den verschiedenen Zeitebenen gibt es ab und zu Gänge, offene Stellen, die zusammenfallen, verklärte Augenblicke, in denen uns der Klang bis zur Ekstase erfüllt, da er zu einem gegebenen Zeitpunkt genau die Menge ist, die unsere Leere erwartete, oder aber genau die Leere, nach der unser von physiologischen Rhythmen gesättigter Körper trachtete. Messias Ich bin kein Messias, falls Sie es noch nicht bemerkt haben. Es wäre auch zu sagen, dass wir in den letzten Jahren die Gelegenheit hatten, eine reiche sorgfältig gesammelte und sortierte Ernte einzubringen. Was mir im Gegenteil sehr, sehr wichtig erscheint, ist, dass die Beobachtungen und Untersuchungen, die ich mich hier zu formulieren bemühe, auch von anderen Komponisten meiner Generation hätten ausgedrückt werden können. Es scheint mir in diesem Moment die Gegenrichtung von dem zu beginnen, was man vor einigen Jahren als Auseinandersplittern der Stile und Ästhetiken beschrieb; wir nehmen teil an der Bildung vielleicht nicht etikettierbarer Gruppen, zumindest jedoch am sehr fruchtbaren Austausch zwischen verschiedenen Komponisten. Ich möchte hier besonders eine Art Kollektiv im musikalischen Denken aufzeigen, das sich um das Ensemble de l’Itinéraire bildete, und das so verschiedene Komponisten einbezieht wie Tristan Murail, H. Dufourt, J. P. Ostendorf und mich. Sehr nahe dieser Tendenz befinden sich Komponisten, die die Synthese des Klangs mit dem Computer anstreben: am Ircam J. C. Risset und D. Wessel oder in Stanford J. Chowning. Ich bedaure, nicht die Zeit zu haben, um Ihnen solche Partituren wie Mémoire-Erosion von T. Murail, L’orage d’après Giorgione von H. Dufourt, Solo für Orchester von J. P. Ostendorf, Y Ahora vamos por aqui von M. Maiguashca vorführen zu können, Partituren, bei denen der musikalische Unterschied nur zu offensichtlich ist, die aber dieselbe Bemühung in der Ausarbeitung einer Sprache zeigen, die von der inneren Struktur des Klangs ausgeht. Wir haben gemeinsam das gleiche Misstrauen gegenüber der Abstraktion, dasselbe Augenmerk auf die unmittelbare Wahrnehmung, dieselbe Suche nach der als letztem Schritt einer inneren verborgenen Komplexität zu Tage tretenden Einfachheit und oft dasselbe Material, das sich aus der Anwendung der Erfahrungen des elektronischen Tonstudios und der akustischen Forschung in der Instrumentalmusik ergibt. 19 Tristan Murail Photo: Philippe Gontier 20 Wandern im Klang Ansätze und Umwege zur Musik Tristan Murails Stefan Fricke1 Sich von einem Klang umgeben zu lassen, gleichsam in ihn einzutauchen, zu wandern, ist nicht nur ein uralter Wunsch des Menschen, der erst in der zeitgenössischen Musik der letzten Jahrzehnte Gestalt angenommen hat, er war vor Jahrtausenden schon Wirklichkeit. In südfranzösischen Höhlen sind gerade an jenen Stellen Felsbilder zu finden, die sich durch extreme Hallwirkungen oder Schallspiegelungen von der sonstigen Raumakustik absetzen. Und in einem unterirdischen Höhlensystem auf Malta entdeckte man ein durch Menschenhand in die Felswand gehauenes Loch, in das gerade ein Kopf hineinpasst. Lange Zeit wusste die Forschung nicht, den Zweck dieses Funds zu bestimmen, bis irgendjemand schließlich auf die Idee kam, seinen Kopf hineinzustecken und verschiedene Töne zu summen. Bei einem Ton muss der Experimentierfreudige wohl ziemlich erstaunt gewesen sein, der Summton ließ seinen ganzen Körper sanft vibrieren. Er hatte durch Zufall seinen individuellen Eigenton stimuliert, was ihn in einen Klang kleidete, ihn selbst ‹in Ton setzte›. Von diesem heute als «Summloch» bekannten Artefakt, das einst sehr wahrscheinlich zu holistischen Therapien eingesetzt worden ist, hat der Wahrnehmungsforscher und SinnenExperimenteur Hugo Kükelhaus Nachbildungen geschaffen, denen man an manchem öffentlichen Platz als freistehender Steinquader begegnen kann. Die Umsetzung des Im-Klang-Seins findet sich auch in vielen ostasiatischen Musikkulturen, die mit Glocken, Gongs, Klangschalen und Obertongesang Räume entstehen lassen, die einzig aus Schallwellen zu bestehen scheinen. Hingegen sind die Vorstellungen, das Innere des Klangs zu erforschen oder selbst ihm Klang sein zu wollen der abendländischen Musik weitestgehend fremd geblieben. Erst seit einigen Jahrzehnten zeigen sich europäische Komponisten zunehmend daran interessiert. So präsentierte Johannes Goebel bei den Donaueschinger Musiktagen 1993 eine riesige kubische Orgelpfeife. Der SubBassProtoTon, den der Konstrukteur allerdings nicht als Kunstwerk oder Klanginstallation verstanden wissen will, ist «die einzige Pfeife, das einzige nicht-elektronische Instrument, bei dem man im Klang selber sein kann». Um die explizite Erforschung des Klangraums geht es auch im Spätwerk von Luigi Nono: «Es ist das Unhörbare oder Unerhörte, das den Raum nicht erfüllt, sondern ihn entdeckt, ihn erst offenbart. Es erzeugt ein plötzliches, unmerkliches Im-Klang-Sein, ein Sich-Teil-des-Raumes-Fühlen, ein Erklingen-Spielen (Doppelbedeutung von suonare!).» Für Nono ist es allein der Klang, der einen Raum freilegt, öffnet, füllt, ihm Gestalt gibt, und inmitten dieses Klangs bewegen wir uns, hörend. Der Komponist Johannes S. Sistermanns gestaltet ebenfalls Räume, um im Klang zu sein. Seit Mitte der neunziger Jahre arbeitet er mit Piezo-Membranen, die einen bisher ungegangenen Weg der akustischen und visuellen Ortserschließung ermöglichen. Denn mit den Piezos lassen sich nahezu alle Materialien selbst in Schwingung versetzen, ohne die Architektur zu verändern, ohne sichtbare Zutaten, ohne Lautsprecher oder Kassettenrekorder hineinzutragen. «Das dem Raum Eigentümliche muss sich von ihm selbst her zeigen», hat einmal Martin Heidegger notiert, und für Sistermanns’ Klangkunst ist dieser Satz Programm. Einen anderen Weg, ins Innere des Klangs zu gelangen, wählte in den fünfziger Jahre Giacinto Scelsi. Er löst den Klang in sein Spektrum auf, um den sezierten Der Text erschien erstmals im Almanach Wien modern 2000. – Saarbrücken: Pfau, 2000. Wir danken Wien modern und dem Pfau Verlag für die Abdruckgenehmigung. 1 21 Ton in allen seinen Eigenschaften zu untersuchen, seine Binnenverhältnisse freizusetzen, den Blick hinter die akustische Fassade freizugeben. Bei Scelsi «wird nicht mehr ‹kom-poniert› (nebeneinander- und übereinandergestellt), sondern ‹de-komponiert›, der Klang sogar ganz einfach ‹hingestellt›.» Diese Aussage stammt von dem französischen Komponisten Tristan Murail, einem der zentralen Vertreter der spektralen Musik, der während eines zweijährigen Aufenthaltes als Stipendiat der französischen Akademie in Rom Kontakte zu Scelsi unterhielt und dessen Klangerforschung ihn maßgeblich beeinflusst hat. Murails eigenes Schaffen gilt fortan dem Klanginneren. Doch bevor es Anfang der 1970er Jahre zu dieser wichtigen Begegnung mit Scelsi kam, hatte der 1947 in Le Havre geborene Murail von 1967 bis 1971 am Conservatoire National de Musique de Paris Komposition bei Olivier Messiaen studiert und 1971 den rennomierten «Prix de Rome» erhalten sowie die OndesMartenot-Klasse von Jeanne Loriod und Maurice Martenot absolviert. Parallel dazu studierte er an der Pariser Universität Arabische Sprachen, Wirtschaftsund Politikwissenschaft. Als er 1973 von seinem Rom-Stipendium nach Paris zurückkehrte, gründete er gemeinsam mit den Komponisten Gérard Grisey (1946-1998), Hugues Dufourt (* 1943) und Michaël Lévinas (* 1949) die «Groupe de l’Itinéraire» (die Gruppe der Wegstrecke), einem Zusammenschluss von Komponisten und Interpreten, die sich für neue Verbindungen von Instrumenten und Elektronik interessierten. Zudem schrieben die vier Komponisten – Grisey und Lévinas hatten wie Murail bei Messiaen studiert, Dufourt bei Jacques Guyonnet in Genf – eine Musik, die trotz aller personellen Unterschiede seit Ende der siebziger Jahre Gemeinsamkeiten besitzt und unter dem Begriff der «Spektralmusik» zusammengefasst wird. 1 vgl. S. 34 Was darunter zu verstehen ist, formulierte 1979 Hugues Dufourt in seinem programmatischen Essay Ästhetik der Transparenz:1 «Die Arbeit ist nun direkt auf die inneren Dimensionen der Klänge gerichtet. Sie geht von einer allumfassenden Kontrolle durch das Obertonspektrum aus und besteht darin, aus dem Material Strukturen zu gewinnen, die aus diesem Spektrum abgeleitet sind. Die einzigen Klangeingenschaften, auf die man Einfluss nehmen kann, sind dynamischer Natur. Es handelt sich um fließende Formen, um Schnittpunkte innerhalb von Veränderungen, deren innere Bewegungen den Gesetzen der unausgesetzten Wandlung unterstehen. Die Musik ereignet sich nun in Form von Schwellenwerten, Schwankungen, Interferenzen, orientierten Prozessen.» Und ähnlich heißt es in Tristan Murails Vortrag Die Revolution der komplexen Klänge, den er 1980 bei den Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik gehalten hat: «Die Erforschung des Klangs erlaubt eine auf der Analyse des Klangs basierende musikalische Schreibweise, die die inneren Kräfte der Klänge als Ausgangspunkt in der kompositorischen Arbeit verwendet.» Die Musik der Spektralisten, deren Entstehen erst durch computergesützte Klanganalyse und -synthese möglich wurde, versteht sich sowohl als eine Absage an den zwar durchaus geschätzten, aber historisch überkommenen Serialismus als auch an jegliche neoromantisierende Musik wie etwa die der Neuen Einfachheit. «Ich» – so Murail – «mache Musik, indem ich wie ein Bildhauer das Klangmaterial aushöhle und die Form enthülle, die im Steinblock verborgen ist, und nicht, indem ich sie aus Bausteinen konstruiere, wie es bei einer traditionellen Annäherung oder im Kontrapunkt, einschließlich dem Seriellen, der Fall ist.» Die spektrale Musik ist eine prozesshafte, eine fließende, die Klangfarben permanent transformiert. Diese Einsicht haben die Spektralisten aus der Mikrostruktur des Klanges gewonnen, er ist nicht statisch, sondern besitzt einen zeitlichen Verlauf. In Murails 1978 entstandener Komposition Treize couleurs du soleil couchant für Flöte, Klarinette, Geige, Cello und Klavier, das als typisches Werk der Spektralisten gilt, obgleich der Komponist das heute nur eingeschränkt gelten lässt, resultieren die Bindeelemente zwischen den einzelnen Instrumentalklängen aus ihren gemeinsamen Ober- und Differenztönen sowie aus 22 subharmonischen Beziehungen. Die Verkettung geschieht also nicht durch äußere Berührungspunkte, sondern folgt inneren Verwandschaften, was eine klangliche Logik evoziert. Murail schreibt zu seinen 13 Farben der untergehenden Sonne: «Ich bin fasziniert, weniger von den eigentlichen Farben des Sonnenuntergangs (die häufig ein wenig übertrieben sind), sondern von der Art und Weise, in der die Farben sich verändern, sich verwandeln, schnell und doch unmerklich von einer zu anderen wechseln. Das Licht spielt das gleiche Spiel. Die Sonnenstrahlen durchdringen Farbschicht für Farbschicht und werfen zugleich brutal und hinterhältig Lichtblitze in den verschiedensten Nuancen.» Die 13 Farben hat Murail genau charakterisiert: Jeder Farbe ist eines der 13 Grundintervalle (von Prime bis Oktave) zugeordnet, die eines nach dem anderen ineinander übergleiten, wobei sie auch akustische Mischfarben durchlaufen: geräuschhafte Klänge, unbestimmte oder auch sehr komplexe Harmonien. Murails 13 Farben weisen, was nicht nur der Titel nahelegt, impressionistische Züge auf. Das Bild von Claude Monet, das dem Impressionismus den Namen gab, hieß Impression, soleil levant (1872), was allerdings die Umkehrung des Murailschen Titel bedeutet. Überhaupt gibt Murail, der das farbenreiche Werk Claude Debussys bewundert, seinen Werken gerne recht bildhafte, assoziationsreiche Titel und lässt sich von Werken der Bildenden Kunst inspirieren. So beziehen sich die 1988 komponierten Vues aériennes (Luftspiegelungen) für Horn, Geige, Cello und Klavier auf Monets Bilder, die die Kathedrale von Rouen zu verschiedenen Tageszeiten im stetig wechselnden Licht zeigen. Auch das Kammermusikwerk La Barque mystique (1993) ist durch die bildende Kunst angeregt worden. Eine Serie von Pastillen des symbolistischen Malers Odilon Redon lieferte die abstrakte Vorlage der Komposition. «Komplexität und Klarheit der farblichen Beziehungen» – schreibt Murail in seinem Werkkommentar – «wo sich apriori unvereinbare Nuancen vereinen, Formrhythmen, wo verwischte Flächen und neblige Farben mit scharfen Strichen und starken Farben kontrastieren: all dies findet seine Entsprechung in der Architektur und der harmonischen Palette der Musik.» Trotz der kleinen Besetzung (Flöte, Klarinette, Geige, Cello und Klavier) ist Die mystische Barke orchestriert: die Instrumentalkombinationen wechseln stetig, um eine Vielzahl von Klangfarben zu gewinnen; ergänzend dazu wechseln die Instrumente selbst oft ihren eigenen Klangcharakter. Solche Klangkombinationen gewinnen die spektralen Komponisten aus der analytisch-synthetischen Arbeit mit dem Computer. «Die digitalen Techniken haben die Prozeduren von Murail hervorgerufen» – schreibt der englische Komponist und Pianist George Benjamin treffend – «oder zu ihrer Erfindung beigesteuert. Dank der digitalen Technologie wurden neue instrumentale Mittel erschlossen, die anders nicht auszuführende von Klangfarben und mikrotonale Verflechtungen ermöglichten.» In seinem Orchesterwerk Gondwana, das im Auftrag der Darmstädter Ferienkurse entstand und wo es 1980 uraufgeführt wurde, als dort zum ersten Mal die «Groupe de l’Itinéraire» ihre Arbeit präsentierte, verschmelzt Murail einzelne Instrumentaltöne zum Spektrum eines stetig fluktuierenden Glockenklangs. Das Verfahren, Instrumente auf der Basis der Computeranalyse zu einer neuen Klangfarbe zu verschmelzen, nennen die Spektralisten «Synthèse instrumentale», mit der sie die überaltert geglaubte Instrumentalmusik wiederentdeckten. Der Titel Gondwana bezieht sich übrigens einerseits auf eine historische Landschaft Indiens, die südlich des Ganges gelegen haben soll, andererseits auf den ehemaligen Großkontinent auf der Südhalbkugel, der in die (Sub-) Kontinente Südamerika, Afrika, Vorderindien, Australien und die Antarktis zerfiel. Murails Musik spiegelt das Thema, indem bestimmte Elemente auseinanderdriften, deformiert und zu neuen Formationen zusammen geschoben werden. Die Vielfalt der außermusikalischen Sujets, die Murail musikalisch aufgreift, ist groß und findet sich in nahezu allen seinen Werken. Neben Werken der Bildenden Kunst, geologischen Aspekten, Naturerscheinungen (etwa in der 1969 komponierten Kammermusik Couleur de Mer, in das Erinnerungen an das Meer seiner Heimatstadt Le Havre eingegangen sind und dem er als Motto 23 ein Zitat aus einem Gedicht seines Vaters vorangestellt hat) können das auch Bibelverse sein oder physikalische Phänomene. In dem Solo-Bratschenstück C’est un jardin secret, ma soeur, ma fiancée, une fontaine close, une source scellée von 1976, komponiert anlässlich der Hochzeit zweier Freunde, entwickelt sich quasi als Ergänzung des im Titel angesprochenen, einer Zeile aus dem Hohelied Salomos (4, 12), nach prozessualen und feinsten Veränderungen der Spieltechniken eine geheimnisvolle Figur heraus. Die deutsche Übersetzung dieser Passage lautet bei Luther: «Meine Schwester, liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Born.» In Ethers (1978) für Flöte und fünf Instrumente – der Solist hat alle vier Flötentypen zu spielen – thematisiert Murail die von der griechischen Kosmologie bis in die Physik des 19. Jahrhunderts hineinreichende Debatte um den ‹Äther› als Weltseele, später als der allerfeinste Stoff, der alle Materie durchdringt, den Weltraum erfüllt und der allerlei mechanische sowie elektromagnetische Erscheinungen hervorbringen kann. Erst Albert Einsteins Relativitätstheorie zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts ging von der Nichtexistenz des Äthers aus. «Atherische» Äußerungen des Solisten stehen nun ganz im Zentrum der verschiedenen Abschnitte von Ethers. Pro Abschnitt gibt der Solist einen modellhaften Stoff vor, den das Ensemble, gleichsam von ihm durchdrungen, imitiert, wobei durch kontinuierliche Abweichungen neue Texte entstehen. Die Form des Stückes ist allerdings nicht blockhaft, sondern folgt einer eleganten Kurve, deren Tempo wie auch die Massivität des Klangs ständig im Wandel begriffen sind. So auch der Äther, an dessen Existenz man nun glauben kann oder nicht, der letztgültige Beweis seiner Existenz bzw. Nichtexistenz steht noch aus. Bewiesen werden muss allerdings nicht mehr, dass das Ausloten des Klanginneren ein Spezifikum der Musik von Tristan Murail ist. Der Wunsch vom Im-KlangSein ist noch genauso aktuell wie vor mehreren Jahrtausenden, und er scheint kontinuierlich zu wachsen. 24 Blick zur Decke im Foyer der Philharmonie Luxembourg Photo: Jörg Hejkal 25 Questions en pointillés à Michaël Lévinas La musique spectrale, c’est … Il ne saurait être question ici de redéfinir en quelques lignes ce qu’a pu représenter dans les année 80, pour les compositeurs, les conséquences complexes et diverses de la musique spectrale. Il faudrait pour cela, se référer aux nombreux ouvrages consacrés à cette question: On peut tout de même dire que la musique spectrale représente à la fin du XXe siècle la nouvelle prise de conscience qu’il existe par delà la recherche de l’utopie musicale par la combinatoire de l’écriture, des lois acoustiques et spectrales du timbre. Ces nouvelles modalités de la prise de conscience des lois acoustiques sont, bien sur, rendues possibles par ce que l’on a appelé à cette époque, les nouvelles technologies et les ouvertures que la technique et l’informatique ouvraient dans le champ analytique du timbre et de sa perception. Nous passions alors à l’ère de l’informatique et de la synthèse. La perception spectrale du timbre engendrait des écritures et des formes rigoureuses et organiquement liées aux lois du matériau sonore. C’était un tournant décisif qui a bouleversé le concept même de musique contemporaine. Cette nouvelle «acuité auditive» avait une histoire. Je pense bien sur à Ravel, Debussy, Varèse, Ligeti, Scelsi, Stockhausen, la musique électro-acoustique et le concept de l’Ircam. On peut considérer (et cela est très caractéristique du XXe siècle européen-centriste), que la musique spectrale allait dans le «sens de l’histoire». Il est incontestable qu’elle a joué un rôle à la fois fédérateur (notamment les progrès dans le domaine de la connaissance acoustique et par conséquent la redéfinition de «l’harmonieux et le perceptible») et elle a permis l’éclatement des langages des jeunes compositeurs héritiers de ce courant de l’écriture musicale. Le développement de la musique spectrale Des sons, spectres, formes, filiation historique (Rameau, Liszt, Debussy,…) à la musique spectrale J’ai évoqué des créateurs du XXe siècle. On peut, bien sûr, inscrire le courant spectral dans la grande tradition française, celle de Rameau. Ce moment très décisif de la fin d’un XXe siècle qui était celui des grands espoirs progressistes et émancipateurs d’une Europe prophétique (mais aussi un siècle des idéologies perverties et retournées) m’évoque dans le domaine de la peinture le dialogue entre Seurat et Chevreul. Ce qui est certain, c’est que le courant spectral appartient à une trajectoire qui remonte au coeur du XVIIIe siècle musical européen, celui de la stabilisation du tempérament et les conséquences de cette stabilisation dans le domaine de l’écriture instrumentale, la naissance de l’orchestre «occidental» et l’histoire des formes avec la «prise de conscience spectrale». Une période est close. L’outil conceptuel a changé. Le concept d’orchestration ne peut plus être celui de Berlioz. Il serait d’ailleurs plus exact de dire que Berlioz aurait eu besoin des outils d’analyse spectrale pour étendre le concept d’orchestration. On peut aussi craindre qu’il aurait perdu avec l’analyse strictement spectrale, le sens de la métaphore du timbre et qu’il aurait ramené le musical à la pure matérialité du timbre. Il ne serait 26 devenu qu’un pur orchestrateur. C’est là que se situe, pour nous aussi, au seuil du XXIe siècle, les limites de l’approche strictement spectrale de la musique. Mes connexions personnelles aux idées et aux sons de la musique spectrale Souvenirs personnels, rencontres, influences, expériences, … Je garde le souvenir d’un moment particulièrement fondateur du «courant spectral». Il s’agit de la session de Darmstadt en 1972. J’y ai été envoyé par Olivier Messiaen avec Gerard Grisey. Nous avons entendu pendant une semaine Stockhausen analyser Stimmung puis Mantra. Il nous a fait entendre la «relation organique des hauteurs entre elles». Le SI BEMOL FILTRE, LA FONDAMENTALE, engendrait le spectre harmonique. LA FORME GLOBALE ET LE TEMPS MUSICAL étaient engendrés par ce spectre, lui-même engendré par la fondamentale: un cours fondateur qui renouvelait le dogme combinatoire et unificateur de la cellule génératrice, le passage de la série au timbre. C’était le long cheminement de Stockhausen depuis Gruppen et Momente. Il serait trop long ici de retracer toute l’histoire qui a suivi en France. À mon retour, j’ai écrit une œuvre basée sur un spectre acoustique et la mise en vibration spatiale d’une caisse claire (vibration par sympathie), Appels. Grisey a écrit Périodes, puis Prologue qui mettait aussi en vibration le système sympathique des cordes du piano et la caisse claire. Nous inventions une écriture et une forme générée par le timbre et sa spatialité. Chez moi la spatialité de l’appel et la dramaturgie du cor, engendraient une «phrase musicale»: une mélodie nouvelle inspirée par l’essence instrumentale. Il y avait là une divergence fondamentale avec Grisey. Nous ne savions pas que nous faisions de la musique spectrale. Le terme «Musique spectrale» sera formulé plus tard, avec Murail et Dufourt, à l’Itinéraire, en 1978? Par la suite, j’ai divergé par rapport aux préoccupations strictement spectrales. J’avais entrevu un risque de simplification formelle liée au principe même du processus spectral et une limitation de la poétique du «musical» à la matérialité du timbre. (Ce que j’évoquais plus haut à propos de Berlioz: la perte de la dimension métaphorique et «corporelle» du timbre; l’identité de l’instrumental). Je percevais aussi dans le concept de cellule génératrice, un avatar d’une mentalité sérielle un peu appauvrissante et limitative. Je pensais au concept d’accident, de révélation de l’idée musicale, d’au-delà du système, de caprice du musical, de rencontre avec la textualité. Il y a eu une sorte de rupture du groupe des «compositeurs spectraux fondateurs», quand j’ai exprimé ces réserves, lors de ma conférence à Darmstadt en 1982. Cette séparation des individualités m’a semblée naturelle. En ce qui me concerne, cela m’a permis d’écrire des œuvres assez indépendantes: Ouverture pour une fête étrange, Par-delà, Rebonds et mes 3 opéras, La conférence des oiseaux, Go-gol et les Nègres. J’ai pu ouvrir d’autres voies; le travail sur les chimères sonores et l’hybridation à l’Ircam ainsi que la poly-modalité et les polyphonies paradoxales (Préfixe, Rebonds, Go-gol, Les nègres, Par-delà). Quelques œuvres phares dans l’histoire de la musique J’ai enregistré l’intégrale des sonates de Beethoven et le Clavier bien tempéré de Bach. La rencontre avec Messiaen, Scelsi et Stockhausen a marqué mon itinéraire de compositeur. Récemment, les enregistrement des Préludes de Debussy des Études 27 de Scriabine et Ligeti ont fait évoluer mon travail de compositeur. Ne me demandez pas de définir en quelques lignes ces influences ou ces choix, d’autant que j’ai une classe d’analyse au Conservatoire de Paris et que mon année se passe à explorer sans cesse de vastes champs du patrimoine musical occidental. Il est vrai que l’étude récente des œuvres de Messiaen (sans la présence du Maître) m’a aidé à percevoir les ambiguïtés très riches de la relation qu’il établit entre les langages du XIXe et du XXe siècle et sa capacité à reformuler musicalement des archétypes préclassiques au coeur des modernités de son époque. La relation entre sons, mots, littérature, peinture, couleurs … dans vos œuvres; l’attitude et l’esthétique de la musique spectrale – une perspective vers le futur Mon rôle initiateur du courant spectral et les distances que j’ai formulées plus haut, ce que j’appelle l’au-delà du timbre, la genèse (chez moi) de la phrase mélodique, la conscience historique que j’ai de la transversalité entre formes musicales et textualités peuvent laisser entrevoir la relation que j’établis par exemple entre musique et théâtre dans mes opéras ou dans Les Aragons. Les prédications d’avenir sont souvent malheureuses. J’ai indiqué le tournant qu’a représenté la prise de conscience spectrale dans les années 80. Je ne peux répondre que pour moi. Depuis ma pièce Rebonds, je tente de formuler une écriture acoustique qui redonne un rôle essentiel à la dimension polyphonique de la perception acoustique. Mon travail formel se structure autour d’une polyphonie d’échelles basées sur des spectres harmoniques superposées en relations micro-intervalliques. Le temps formel s’organise par un processus d’altération progressif des échelles. Ce que je décris là n’est pas une prophétie esthétique. Je veux seulement indiquer que la relation d’engendrement formel des processus par le spectre, n’est qu’un moment historique de cette écriture. 28 Michaël Lévinas Photo: Christophe Daguet 29 Questions en pointillés à Hugues Dufourt La musique spectrale, c’est … La musique spectrale désigne une nouvelle esthétique, en rupture avec le néosérialisme. Elle s’attache à la découverte du son comme énergie plutôt que comme nombre. La théorie spectrale est une sorte de problématique impressionniste appliquée à la musique. La sonorité ne se manipule pas, elle est réfractaire à la dislocation paramétrique. La musique spectrale est un art de la transition continue. La forme y est identifiée au devenir de son matériau. Elle se réduit à un flux indépendant de tout contour. La musique spectrale est un art informel délié de toute considération du motif. Dans l’Impressionnisme pictural, la substance lumineuse absorbe les formes. Dans le colorisme spectral, le timbre brise le cadre des «bonnes formes». La musique spectrale insiste sur les glissements de valeur, les chevauchements de phases, les déformations de milieux, les jeux de torsion interne. La musique spectrale est le refus des formes isolées. C’est une plastique sonore de masses et de tons. A l’instar de l’Impressionnisme, la musique spectrale est un art fondé sur une analyse des données des sens. Comme la peinture impressionniste a été confrontée aux découvertes scientifiques de Chevreul, la musique spectrale a vécu l’arrivée de l’informatique dans la musique. C’est une musique marquée par la prévalence du timbre: la sonorité y acquiert une valeur en soi, détachée de son substrat mécanique. La musique spectrale est issue d’une pratique et d’une réflexion collectives, engagées à l’Itinéraire, au début des années 70. Mes connexions personnelles aux idées et aux sons de la musique spectrale Le terme de «musique spectrale» apparaît pour la première fois dans le manifeste que j’ai écrit en 1979 pour Radio-France et la Société Internationnale de Musique Contemporaine. Ce manifeste résulte d’une réunion que nous avions tenue au sein de l’Itinéraire, Michaël Lévinas, Tristan Murail, Gérard Grisey, Roger Tessier et moi-même. Il s’agissait de faire le bilan des problèmes de composition qui nous paraissaient essentiels, en deçà de nos esthétiques personnelles. Les questions de théorie, de langage, de forme et de durée nous rapprochaient. Par contre, nos esthétiques personnelles nous ont plutôt opposés. Nous partagions une réticence commune à l’égard du divisionnisme néosériel et nous avions un intérêt commun pour les questions musicales relatives au traitement du timbre et du temps. En bref, le traitement de la transformation continue nous paraissait plus important que l’activité combinatoire. Beaucoup de choses nous distinguaient néanmoins sur le fond. Gérard Grisey devait beaucoup à Stockhausen, Ligeti et Emile Leipp. Michaël Lévinas était un famillier du GRM [Groupe de Recherche Musicale]. J’ai moi-même pratiqué l’électro-acoustique auprès de Jacques Guyonnet au Studio de Musique Contemporaine de Genève. Tristan Murail était un spécialiste des ondes Martenot et un organiste avant de devenir un spécialiste de la musique 30 Hugues Dufourt Photo: Christophe Daguet 31 composée avec l’assistance de l’ordinateur. Nous sommes tous également redevables à Claude Pavy, guitariste et ingénieur, de notre connaissance des techniques de la variété. Le sens même de la musique spectrale a changé, chacun ayant eu tendance à identifier ce qualificatif à son œuvre. Pour Grisey, qui a toujours été en désaccord avec le terme même de musique spectrale, celle-ci a signifié essentiellement une musique tirée des techniques de modulation d’amplitude et de fréquence. Pour Michaël Lévinas la musique spectrale s’est infléchie vers une dramaturgie du son, caractérisée par ses irruptions, ses incantations, ses proférations. La musique spectrale de Michaël Lévinas est devenue un art de la diatribe sonore. Tristan Murail est celui qui est allé le plus loin dans l’investigation de l’informatique et son application au traitement de l’orchestre. Son esthétique chatoyante se fonde sur les antinomies du calcul et de la pensée. Roger Tessier, qui m’est, en un sens, le plus proche, a exploré le monde des textures et du clairobscur. J’ai appelé moi-même musique spectrale une musique qui passe de la prédominance des hauteurs à celle du timbre. Le timbre est le paramètre central du siècle. La composition musicale est une composition de processus graduels. La musique spectrale est la possibilité d’appliquer des processus compositionnels au niveau de la structure du son. Nous somme tous redevables de cette mutation, à l’œuvre de Jean-Claude Risset. La musique spectrale ne traite plus d’un mouvement dans l’espace mais d’un mouvement générateur d’espace. En changeant d’échelle, la musique change de langage. Je caractériserais ma propre musique comme une musique fondée sur l’énergie, qui devient une composante significative de l’esthétique musicale. La notion de timbre s’entend comme une variation dans le temps de la distribution de l’énergie sonore. De nombreux musiciens nous ont rejoints et pour comprendre les relations que nous avons entretenues avec les musiciens de notre génération, il faut se reporter au beau portrait d’époque que Pierre-Albert Castanet m’a consacré dans son ouvrage intitulé Hugues Dufourt, 25 ans de musique contemporaine aux éditions Michel de Maule. L’auteur y retrace en fait l’histoire de la musique avancée en Europe de 1968 à 1994. Le développement de la musique spectrale La musique spectrale se situe au carrefour de plusieurs tendances qui l’ont précédée. Elle prend ses attaches auprès de l’idée de substance sonore propre à Debussy qui, elle-même, dérive de la sensibilité harmonique de Rameau. Elle tire également son origine de Varèse qui voulait la libération du son, la globalisation de l’univers sonore, l’expansion volumétrique de la musique. Varèse fut, à l’instar des Futuristes, le musicien de la vitesse et de la synthèse. Nombre de musiciens de l’Itinéraire se sont inspirés de Ligeti et de ses techniques de fusion et de différenciation. Xenakis a apporté l’idée d’arborescence, Ligeti celle de ramification, Stockhausen celle de continuum sonore. Toutes ces tendances se sont cristallisées dans la musique spectrale qui a intégré les données de l’informatique musicale et de la psycho-acoustique qui en est issue. La musique spectrale n’aurait pas vu le jour sans la mutation introduite par la synthèse sonore, avec les travaux fondamentaux de Mathews, Pierce, Risset, Moorer, Grey et tant d’autres. On peut également rattacher à la dynamique spectrale, l’œuvre de La Monte Young, celle de Gilles Tremblay, Claude Vivier, Horatiu Radulescu, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, Marc-André Dalbavie, François-Bernard Mâche ou George Benjamin. La musique spectrale signifie bien davantage que la modélisation du son au moyen du spectre harmonique. Elle a représenté la conquête de l’inharmonicité, de la différenciation du bruit, des interférences entre catégories psycho-acoustiques différentes, de la micro modulation ainsi que de tous les facteurs de la dynamique 32 sonore. La musique spectrale fait du temps, l’agent de constitution de toutes les formes sonores. La musique spectrale, c’est le spectre plongé dans le temps, c’est la distorsion. Quelques œuvres phares dans l’histoire de la musique Les Espaces acoustiques de Gérard Grisey; Territoires de l’oubli, Ethers ou Gondwana de Murail; Appels, Voix dans un vaisseau d’airain, Voûtes de Lévinas, Mortuos Plango, Vivos Voco de Harvey, L’orage d’après Giorgione et Saturne, de votre serviteur. La relation entre sons, mots, littérature, peinture, couleurs … dans vos œuvres J’ai toujours pensé que l’histoire de la musique pouvait se comparer à l’histoire du mouvement des styles picturaux chez Riegl. Le problème central est, pour Riegl, le passage de l’ordonnance géométrique de la Renaissance à l’espace du XVIIe siècle hollandais. Riegl conçoit l’histoire de la peinture comme celle de l’émergence de la subjectivité; une subjectivité qui l’emporte peu à peu sur les contraintes objectives de la représentation. L’espace dans la peinture devient à la fois le symbole naturel et le milieu réel d’une subjectivité active, consciente de soi et autonome. Je pense que, de même, la musique a fait, au cours de ce siècle, émerger irrésistiblement la couleur comme une dimension à la fois autonome et prédominante. On peut caractériser la musique du XXe siècle comme un art de la modulation colorée. L’attitude et l’esthétique de la musique spectrale – une perspective vers le futur La musique spectrale représente essentiellement un changement dans nos modes de penser la musique. Ce n’est plus une musique qui se fonde sur des catégories traditionnelles bien séparées comme la mélodie, le contrepoint, l’harmonie ou le timbre. La musique spectrale est au contraire une musique de catégories mitoyennes et d’objets hybrides. Ces objets se situent à la frontière de deux ou plusieurs dimensions; timbre et harmonie, harmonicité et inharmonicité, hauteur et bruit… La musique spectrale est l’exploration des transitions continues entre des domaines traditionnellement hétérogènes; elle créé des mixtes. Son problème est celui du franchissement des seuils de la perception. Son hypothèse de travail est l’interférence ou l’intermodulation. Cette conception a été rendue possible par l’avènement de l’informatique, qui a unifié le domaine sonore et établi les divers types de transition entre des notions aussi diverses que la hauteur, le bruit, le timbre ou l’harmonie. Nous avons changé à la fois d’échelle, de langage et d’optique. Je ne sais si la musique spectrale a un avenir, mais elle a en tout cas une histoire et même un passé. 33 Ästhetik der Transparenz Spektrale Musik Hugues Dufourt1 Die radikalste Umwälzung, die die Musik des 20. Jahrhunderts erfahren hat, ist sicherlich technologischer Art. Sie rührt von der immer rascheren und allgemeineren Verwendung der Platten und Membranen her, die nach und nach die alten Instrumente ersetzten, welche noch mit Saiten und Röhren funktionierten. Die Idiophone und Membranophone des Schlagzeugs, die Gehäuse der Lautsprecher bilden ein umfassendes Instrumentarium von weltweiter Verbreitung. Die neue Organologie bringt eine Poetik der Klangenergie hervor. Nachdem die Tradition des mechanischen Instruments die dynamischen Faktoren des Klangs verdrängt hatte, werden sie nun durch das Schlagzeug und die Elektrizität befreit: Es handelt sich dabei um ein Zivilisationsphänomen von noch ungekanntem Ausmaß. Die Aufnahme-Technologie hat das Aufkommen akustischer Formen mit sich gebracht, die der klassische Instrumentenbau gerade verhütet hatte: die Teiltöne beim Ein- oder Ausschwingvorgang, das sich ständig fortentwickelnde dynamische Profil der Klänge, das Geräusch, komplexe massive Klänge, «Multiphonics», Texturen, Resonanzen und so weiter. All diese ungenau und verschwommen wirkenden Prozesse waren damals ausgeklammert oder zumindest nur als ein Restbestand beibehalten worden, weil sie auf Unbeständigkeit und Unordnung verwiesen. Heute aber stehen sie im Zentrum der musikalischen Erfindung. Die Hörsensibilität hat sich sozusagen umgestülpt. Sie kümmert sich nur noch um winzige Schwankungen, um Rauheiten, um Texturen. Die Plastizität des Klangs, seine Flüchtigkeit, die winzigsten Veränderungen haben eine unmittelbare Suggestivkraft bekommen. Was nun in Klangform vorliegt, ist seine morphologische Instabilität. Nur sie erlangt Bedeutung. 1 Die deutsche Übersetzung dieses Textes von 1979 stammt von Martin Kaltenecker und erschien erstmals im Almanach Wien modern 2000. – Saarbrücken: Pfau, 2000. Wir danken Martin Kaltenecker, Wien modern und dem Pfau Verlag für die Abdruckgenehmigung. 34 Man mag nach den Gründen für diese Umkehr fragen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie den traurigen Zeitläuften zugeschrieben werden muss. Es handelt sich eher um eine positive Reaktion auf neue Erfahrungen, die direkt mit einem Stil korrespondieren, welcher einer Energiekultur entspringt. Unsere Kunst und unsere Informationssysteme haben die historischen Privilegien der mechanischen Aktion abgeschafft: Der Klang wird nicht mehr in den Kategorien von Erhaltung, Wiederholung, Identität erfaßt. Dementsprechend verzichtet man auf transitive Vorstellungen von direkter Verbindung und linearer Abfolge. Das Komponieren, dergestalt befreit von den Vorschriften einer analytischen Sprache, besteht nicht mehr darin, Töne zu verbinden oder isolierte Parameter zu kombinieren. Doch beschränkt sich der Erfolg der instabilen Formen nicht darauf, die Tatsache zu bestätigen, dass die Elektroakustik und das Schlagzeug eine Klasse von Klängen hervorgebracht haben, die für die Darstellung eines neuen Weltbilds geeigneter wäre. Dieser Erfolg ruft eine Bekehrung zu einer neuen Mentalität hervor und drückt diese aus. Das Musikinstrument ist im zwanzigsten Jahrhundert das Agens einer wahren Revolution des Denkens. Dieses manifestiert sich vor allem in einer Bewußtmachung der Veränderungen, die durch die Technologie in die Natur der Klänge eingeführt wurden. Erstens. Zuallererst handelt es sich um eine Veränderung des Maßstabs. Die Elektronik unterzieht das Klangphänomen einer Art Mikroanalyse, die neue Ordnungsstrukturen und ein Feld ungeahnter Möglichkeiten eröffnet. Die Techniken der optischen Klangdarstellung (vom Spektrographen bis zum Computer) erlauben es, präzise auf Details der akustischen Schwingung einzuwirken und ihr kleinste Veränderungen beizubringen. Das Prinzip des Schlagzeugs ist davon nicht eigentlich verschieden: Es besteht darin, gewisse Schnitte im Klangphänomen vorzunehmen, die ihre Prägnanz durch übermäßige Verstärkung mittels Resonanzböden erhalten. Schlagzeug und Elektroakustik verstärken und dezentrieren so in unterschiedlicher Weise den Wahrnehmungsapparat. Zweitens. Das Klangobjekt nimmt sich anders aus. Es erscheint wie ein Feld spontan verteilter Kräfte, einer dynamischen Konfiguration gehorchend, deren Faktoren man nicht trennen und deren Etappen man nicht unterteilen kann. Wichtig ist die Einheit der globalen Form und die Kontinuität seiner allmählichen Erscheinung. Man wirkt daher auf eine Ordnung untereinander solidarischer Funktionen ein, die das Komponieren zu Methoden der synthetischen Klangerzeugung zwingt. Drittens. Die Kategorien des musikalischen Denkens werden ebenfalls von Grund auf erneuert. Sie sollen Situationen von Übergang und Interaktion steuern, das Spiel voneinander abhängiger Variablen, vernetzter Eigenschaften. So ähnelt der Kompositionsprozeß in dieser Hinsicht einer ununterbrochenen Bewegung von Ausdifferenzierung und Integrierung. Das Klangmaterial stellt sich, wenn man so will, als eine dynamische Feldstruktur dar – es handelt sich um komplexe Volumina, Dichteverhältnisse, Orientierungen, wolkenförmige Gestalten. Die Aufgabe des Komponisten besteht also darin, Achsen anzulegen, Kreisläufe und Wege, die das Wechselspiel der Differenzen und Variationen regeln. Die Arbeit des Komponierens ist nun direkt auf die inneren Dimensionen der Klänge gerichtet. Sie geht von einer allumfassenden Kontrolle durch das Obertonspektrum aus und besteht darin, aus dem Material Strukturen zu gewinnen, die aus diesem Spektrum abgeleitet sind. Die einzigen Klangeigenschaften, auf die man Einfluß nehmen kann, sind dynamischer Natur. Es handelt sich um fließende Formen, um Schnittpunkte innerhalb von Veränderungen, deren innere Bewegungen den Gesetzen der unausgesetzten Wandlung unterstehen. Die Musik ereignet sich nun in Form von Schwellenwerten, Schwankungen, Interferenzen, orientierten Prozessen. All diese Dimensionen des musikalischen Denkens werden durch eine neue Ausdruckskraft bereichert und verlangen nach einer allgemeinen und differenzierten Behandlung. Der neue Klangraum stellt eine rationale Ordnung auf, in der die funktionalen Zusammenhänge den Vorrang vor isolierten Strukturen haben. Diese letzteren werden nur durch das Spiel ihrer gegenseitigen Determination definiert. Das Prinzip der Funktionsfelder kommt daher der Notwendigkeit entgegen, instabile Formen und dynamische Verläufe zu kontrollieren. Schließlich entspricht es der Logik dieser Beziehungen innerhalb der Klanggestalten selbst, dass sie eine unbewegliche und nicht vorantreibende Bewegung nahelegen: Es handelt sich um polarisierte und nach innen gewundene Räume, um gedachte Erweiterungen und Umgestaltungen. Die Bewegung gewinnt gewissermaßen an Tiefe, oder löst sich in reiner Intensität auf. So wird die Musik zu einer Kunst der Spannungsverteilung. Unter den Ästhetiken, die der unseren vorausgingen, ist die einzige, der ich eine grundlegende Bedeutung beimesse, die der seriellen Musik. Sie verdient eine systematische Gegenüberstellung, um herauszufinden, was uns mit ihr verbindet und was uns von ihr trennt. 35 Für die serielle Musik bleibt die Einheit des Werks gewissermaßen im Hintergrund. Die Arbeit des Komponisten richtet sich auf Beziehungskomplexe, die Ordnungen verschiedener Natur und Größe ins Spiel bringen. Der Komponist strebt eine Entfaltung des Klangraums an, dessen Konfiguration instabil ist, auf viele Richtungen hin orientiert, und mittels ständig sich gabelnder Verteilungstypen gestaltet. Man gelangt dorthin nur über Strukturkonflikte und antagonistische Zuordnungen. Die serielle Komposition beruht also auf einer grundlegenden Kraft, wobei sie konkurrierende und auf sich bezogene Systeme reduzieren und miteinander verschlingen muss. Sie versucht, aus dem Register der dynamischen Möglichkeiten, die diese interne Zusammenstellung der Formen ermöglicht, systematisch Vorteil zu schlagen. Die plastische Kraft wird einer Ordnung von logischen Verbindungen vollkommen untergeordnet. Die Einheit des Werks drückt sich zwar in Spannungen, einer reliefartigen Dynamik und Kontrasten aus, beruht aber ausschließlich auf einer versteckten Architektonik. Die Fragmentierungen, die sie vornimmt, werden von der gleichzeitigen Suche nach einer unterschwelligen strukturellen Einheit ständig eingeholt und kompensiert. Diese Verbindung der Logik mit der Dynamik scheint mir bezeichnend und grundlegend für die Darmstädter Schule zu sein. Deshalb hat das serielle Denken bewußt den Standpunkt der Totalität zurückgewiesen. Der Serialismus postulierte das gleichzeitige Gelten ebenso zwingender Normen – die parametrische Organisation der Tonhöhe, Dauer, Klangfarbe, Lautstärke und sogar der Agogik; er musste darum darauf verzichten, den Teil vom Ganzen abzuleiten – ein so differenziertes Ganzes, dass die Eigenschaften des Ganzen die Eigenschaften der Elemente bewahren und voraussetzen, welche es differenzieren. In der Praxis aber kann man nicht den Standpunkt sowohl lokaler als auch totaler Determination vertreten. Deshalb ist die Einheit des seriellen Werks von Bedingungen abhängig, die jenseits der Art seiner Darbietung stehen. Die serielle Form erscheint immer als negative Hohlform, sie zeugt von einem Zusammenhang, dessen innere Logik sich dem unmittelbaren Verständnis entzieht. Die wesentlichen Beziehungen sind grundsätzlich verdeckt, sie erscheinen nicht mit den Figuren und Gesten, die sie hervorbringen, sondern tauchen ihrerseits innerhalb einer Diskontinuität auf, einem disparaten, asymmetrischen Stil, dem hörbaren Aufeinanderprallen einer vehementen Komplexität. Die strukturelle Vereinheitlichung wird niemals manifest, sie ist nur gedacht. Diese Art der Beschaffenheit hat den seriellen Stil hervorgebracht. Es handelt sich um eine Kunst blitzender Splitter und Kontraste. Die Ordnung erscheint in ihrer Grundkonfiguration als Kehrseite jener Dynamik, die sie ermöglicht. Daher auch die Wahl des Unvollendeten und die Vorliebe für im Entstehen begriffene Ordnungen. Daher ebenfalls jene Erschütterungen der Dauer, die über Intensivierung und Neukonzentration ihrer Momente fortschreitet. Die Zeit erscheint als Abfolge radikalen Neubeginns: eine vorzeitliche Turbulenz, doch auch eine Trockenheit, die Wüste, die Trauer der Löcher und Brüche. Wir teilen mit dem Serialismus seine genetische Auffassung der Musik. Doch behaupten wir auf dieser gemeinsamen Achse genau die gegenüberliegende Position. Was uns verbindet und meines Erachtens nach die Musik der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts kennzeichnet, ist die Intuition einer Welt, die sich vom Ursprung her in der Gesamtheit ihrer Dimensionen begreift und aus der Einsicht in die eigenen Notwendigkeiten weiterexistiert. Das musikalische Werk schließt sich um sich selbst. Es verzehrt sich in der Hervorbringung seiner eigenen Entstehungsbedingungen. Diese Verinnerlichungsbewegung behauptet sich vor allem, indem sie jegliche Referenz, jeglichen Bezug zurückweist und radikal intransitiv bleiben will. Im Hinblick auf die Ausarbeitung zeugt sie von einem Hang zum Hinauszögern jenes Moments, in dem sie von einer Form fixiert wird. Diese wird nie thematisiert, nie eingekreist: Sie bleibt die immer entschwindende Grenze eines unaufhörlichen Entstehungsprozesses. 36 Im Gegensatz zur seriellen Ästhetik jedoch fassen wir das Werk als eine synthetische Totalität auf, deren Artikulationen, deren Verlauf und Zeitstil sich aus grundlegenden Übereinstimmungen ableiten. Das Entstehen des Werks wird aus einer funktionalen und totalen Perspektive gesehen. Wichtig ist der Geist dieser Verwirklichung, welche sich als ständige Verteilung der Gleichgewichte und der Rollen nach gegenseitigen Vorstellungen darstellt. Es gibt eine Grundvereinbarung zwischen dem Gesamtentwurf und seiner Unterteilung. Was unsere Ästhetik ausmacht, ist der nach innen gewundene Charakter einer Zeitdauer, die in einer Art Kreisbewegung die Ordnung der Vorbedingungen und der Abweichungen absorbiert. Die Umkehrbarkeit ist komplett. Das musikalische Werk ist genetisch in dem Sinne, dass es sich ständig die Bedingungen seines eigenen Ablaufs aneignen muss, um in dieser Reihe von Integrationen die innere Norm seiner eigenen Entwicklung zu finden. Die Art, in der das Werk sich organisiert, fällt mit der Weise zusammen, wie es sich in der Zeitdauer entwickelt. Die Kongruenz ist vollkommen. Vom seriellen Dualismus bleibt keine Spur mehr übrig. Die innere Struktur eines Funktionsfelds ist vollkommen sichtbar, restlos. Wir kommen so, in gleicher Perspektive, zu einer Umkehrung der seriellen Ästhetik. Die Hauptunterschiede zwischen serieller Musik und derjenigen, die ich «spektral» nennen werde, seien im folgenden kurz erläutert. Die serielle Musik macht sich eine regionale und polynukleare Kompositionsweise zu eigen; die spektrale Musik nimmt den Standpunkt der Totalität und einer operativen Kontinuität ein. Erstere verdeckt ihre innere Logik und verleiht dem Verlauf des Werks eine latente Einheit; letztere kehrt ihre konstitutive Ordnung nach außen und macht ihre Einheit manifest. Jene tendiert zur Intuition des Diskontinuierlichen und legt die Musik als eine Verschachtelung struktureller Räume an; diese wird getragen von der Intuition einer dynamischen Kontinuität und denkt die Musik als ein Netz von Interaktionen. Erstere gewinnt ihre Spannungen durch Zusammenziehung, die andere durch Differenzierung. Die eine verringert ihre Konflikte durch partielle Auflösungen, die andere durch Regulationen. Die spektrale Musik gründet sich auf eine Theorie der Funktionsfelder und eine Ästhetik der instabilen Formen. Sie bezeichnet auf dem Weg, den der Serialismus öffnete, einen Fortschritt zur Immanenz und zur Transparenz. In dieser Hinsicht bedeutet die Doppeldeutigkeit von innen und außen, das Vermögen der Form, sich als zu sich selbst antithetische Form zu konstituieren, die kontinuierliche Wandlung, der Wille, Ursachen gleichzeitig mit ihren Folgen darzustellen, all dies seitens der Kultur eine Anstrengung zu systematischer Wiederaneignung. Zum Beweis möge nur die exemplarische Erneuerung der traditionellen instrumentalen Praxis angeführt sein, der Streicher und Bläser: Auch sie wird von der neuen Klangästhetik ergriffen, einer Ästhetik der Transparenz. 37 La musique spectrale … à terme! Philippe Hurel Comme le soulignait Gérard Grisey, la musique spectrale n’est pas une technique close mais est une attitude. Pourtant 25 ans après Partiels du même Grisey, les «spécialistes» de la musique contemporaine ne veulent voir dans les œuvres dites spectrales qu’un savoir-faire harmonique et formel trop hédoniste s’ils sont des nostalgiques du chromatisme sériel, ou un discours trop complexe s’ils sont acquis au néo-classicisme marqué par le retour au modalisme. Comme souvent dans l’histoire de la musique, le discours esthétique s’établit autour de concepts qui sont déjà développés depuis fort longtemps et que les jeunes compositeurs connaissent dès leurs premières années de formation. Parler de musique spectrale a un sens si l’on ne s’en tient pas à l’utilisation du spectre – entité intégrant à la fois l’harmonie et le timbre – qui n’est qu’un aspect de «l’attitude» que décrivait Grisey, et qui paradoxalement n’intéresse pas toujours les compositeurs issus de ce courant esthétique. Mais alors, que reste-t-il aujourd’hui de cette aventure? Quelle attitude adoptent les compositeurs qui ont rencontré cette musique? Plus que les problèmes harmoniques du spectre, de temps «étiré» ou temps «contracté», de microphonie ou de macrophonie, de seuil… qui sont la marque de Grisey, ce sont les conséquences mélodiques, rythmiques et formelles de l’aventure spectrale qui stimulent les compositeurs plus jeunes. Dans un article encore inédit de la Contemporary music review, Gérard Grisey dresse un tableau des conséquences notoires du spectralisme. Dans le paragraphe «conséquences formelles», on peut lire cette phrase: – «Utilisation d’archétypes sonores neutres et souples facilitant la perception et la mémorisation des processus.» Voici un point sur lequel les nouvelles générations héritières du spectre divergent, me semble-t-il. Cette neutralité du matériau permettant de mieux percevoir les opérations et les processus, n’est d’ailleurs pas l’apanage de la musique spectrale. C’est un point partagé par les musiciens répétitifs mais aussi par des artistes d’autres domaines. Je pense par exemple au mouvement BMPT [Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier, Niele Toroni] et particulièrement à Daniel Buren qui revendique cette position. Les bandes de 8,7 cm de large, communes à toutes ses œuvres lui ont permis dans un premier temps d’organiser la forme sans mettre en avant le matériau puis, par voie de conséquence, de prendre conscience du contexte et de créer l’œuvre in situ.Sans vouloir rapprocher les arts, on peut penser que ce minimalisme est proche du travail que celui de Grisey a effectué dans une pièce comme Vortex Temporum. Il suffit d’analyser cette œuvre pour mieux comprendre. Elle est entièrement fondée sur une ‹gestalt› tirée d’un motif du Daphnis et Chloé de Ravel, plus précisément du Lever du jour. La neutralité du matériau apparaît ici de manière éclatante dans la mesure où le motif n’est qu’un arpège brisé dont il ne restera plus tard que le dessin, l’enveloppe qui gère toute l’œuvre. Ainsi, dans le premier mouvement, Grisey pourra assimiler le motif successivement à un sinus, une onde carrée et enfin une onde en dent de scie. On peut imaginer aisément qu’une telle 38 neutralisation du matériau puisse permettre des opérations nombreuses, souples et perceptuellement efficaces. Si cette démarche s’est révélée très riche, il n’en demeure pas moins que cette neutralité du matériau entraîne inévitablement une perception identique de la figuration mélodique et rythmique. On ne retient, en dehors des processus et de leurs avatars, que des mouvements scalaires – gammes, arpèges, batteries, bariolages – qui, pour beaucoup de compositeurs plus jeunes, ne semblent pas suffisamment typés sur le plan morphologique. Car, loin d’être minimale, la musique des jeunes compositeurs regorge de matériaux prégnants, variés et hétéroclites et c’est là une de ses différences fondamentales avec le spectralisme de Grisey. Tout se passe comme si les jeunes compositeurs étaient à l’affût de ces matériaux afin de les corrompre. Car pour les nouvelles générations, la référence mélodique et rythmique n’est pas un problème. Bien plus, elle fait partie du jeu. Il s’agit aujourd’hui de composer la cohérence à partir d’éléments hétérogènes, voire contradictoires. Le problème n’est plus tellement de passer de la microphonie à la macrophonie, du timbre à la mélodie par exemple, mais plutôt d’un élément culturel reconnaissable à une structure plus globale, voire d’une citation du répertoire à un discours personnel … et surtout de contraindre l’élément «impur», de le neutraliser a posteriori par le biais de l’écriture et de le faire cohabiter avec les éléments qui l’entourent. Cette forme de dialectique excède l’esprit spectral. Pourtant, pendant l’écriture, les leçons tirées du spectralisme servent encore, car une partie de l’attitude globale est restée la même. Il reste l’objectivité du discours – au sens goethéen du terme – l’absence de gestes inutiles générés par des techniques de développement obsolètes au profit de processus clairs gérés par des opérations de contraintes. Il reste aussi la recherche du «nécessaire et suffisant» et le refus de toute justification extérieure à la musique. Un anti-romantisme encore goethéen que Grisey aurait approuvé. Mais le matériau a changé, et c’est là un point important, car en se voulant plus «signifiant», il finit heureusement par bouleverser la forme. D’ailleurs, dans l’histoire de la musique spectrale, ce bouleversement de la forme a eu lieu très rapidement. En effet, très vite, les compositeurs de ma génération marqués par le spectralisme ont revendiqué le droit à la répétition. Répétition de motifs, de situations musicales, réexposition de sections … et ce n’est pas une coïncidence si cette revendication s’est manifestée au moment où ils tentaient de refuser la neutralité du matériau. D’une part, ils voulaient en finir avec «l’hypnose de la lenteur» et l’absence de retour en arrière due à «l’obsession de la continuité», d’autre part, les matériaux plus typés qu’ils utilisaient donnaient enfin la possibilité d’être répétés de manière plus perceptible. Ainsi, alors que Grisey réitérait plusieurs fois un objet pour le transformer lentement sans possibilité de véritable retour en arrière, les compositeurs de ma génération injectaient des répétitions, des boucles et des retours en arrière dans de grands processus linéaires, ce qui était tout à fait contraire à l’attitude spectrale de l’époque. En ce qui me concerne, c’est avec Pour l’Image (1986 / 1987) que j’ai commencé à traiter ce problème et c’est particulièrement avec les Six miniatures en trompe-l’œil et Flashback que j’ai tenté de résoudre la dichotomie entre processus linéaire et répétition. Dans ce domaine, Grisey s’est rangé à l’avis des plus jeunes de manière tardive. Il suffit d’écouter Vortex Temporum de 1996 et la «réexposition» du début de la pièce dans le troisième mouvement. L’efficacité de cette «réexposition» est d’ailleurs due au fait que le motif réexposé est encore assez typé rythmiquement et harmoniquement – malgré sa neutralité mélodique – pour être facilement reconnu. 39 Ces considérations sur le matériau et la forme nous amènent ainsi à nous poser plus précisément la question du rythme, l’un des problèmes majeurs auxquels s’attaquent les jeunes compositeurs. Revenons à Grisey. Dans le paragraphe «conséquences temporelles» du texte cité plus haut, on peut lire: – «exploration des seuils entre rythmes et durées» Le mot «seuil» est d’une importance capitale car il définit l’essence même de la musique spectrale et particulièrement de celle de Grisey qu’il caractérisait luimême de «liminale» (du latin «limen», le seuil). Dans sa musique, cette notion d’exploration des seuils est présente à d’autres niveaux que le rythme: passage de la macrophonie à la microphonie, de l’harmonicité à l’inharmonicité, de la fusion à la diffraction, du continu au discontinu … On pourrait dire que chez Grisey, le rythme n’apparaît que comme le résultat des opérations effectuées sur le timbre qui contiendrait ses propres pulsations internes, qu’il n’est en fait qu’une conséquence une fois le seuil franchi. Là encore, la nouvelle génération se distingue dans la mesure où les modèles rythmiques employés sont généralement d’ordre macrophonique et souvent de connotation culturelle repérable. Le modèle pourra être un structure rythmique issue des mouvements naturels ou «concrets» d’objets qui nous entourent (Philippe Leroux), elle pourra être empruntée à la musique extra-européenne (Benjamin de la Fuente), ou à une œuvre du répertoire proche (Frédéric Verrières), à un modèle généré par ordinateur revisité par la musique ethnique (Mauro Lanza), au monde des musiques marquées par le jazz, le rock … Ce qui relie cependant ces compositeurs – pour ne citer qu’eux – à l’attitude spectrale, c’est la référence à un modèle acoustique. Il ne s’agit plus de «gérer» des durées mais bien de travailler à partir de situations rythmiques claires et reconnaissables, certainement pas neutres. Il en va de même de la mélodie qui, comme je le soulignais plus haut, n’apparaît plus seulement, chez les plus jeunes, sous la forme scalaire la plus neutre, mais plutôt, déjà composée, sous forme de référence à un modèle existant ou de métaphore de ce modèle. À ce propos et toujours dans le même texte, Grisey écrit: – «établissement de nouvelles échelles et – à terme – réinvention mélodique.» Le «à terme» est significatif de ce qu’imaginait Grisey et de ce que devront découvrir maintenant les compositeurs plus jeunes. Grisey n’en aura malheureusement pas eu le temps. En effet, on peut remarquer que la mélodie, dans sa musique, n’est souvent qu’un déploiement organisé des harmoniques. Les divers solos instrumentaux de Talea ou de Vortex temporum en sont la preuve. Dans ces pièces, on observe que Grisey cherche une nouvelle manière d’envisager la mélodie, mais elle reste trop inféodée à l’harmonie / timbre pour trouver sa pleine autonomie. Pourtant, dans les Quatre chants pour franchir le seuil se dessine une nouvelle approche de la mélodie, notamment dans la Berceuse où la partie de flûte s’individualise de façon si frappante que les autres instruments semblent l’harmoniser. Du côté de la jeune génération, rien ne se dessine de très probant dans ce domaine et le travail sur le rythme s’avère plus fructueux notamment grâce aux manipulations informatiques. Il semblerait que la mélodie, longtemps boudée par les musiciens de l’avant-garde, puis neutralisée par les musiciens spectraux ou répétitifs, ne soit pas encore un paramètre «revisité» de manière totalement efficace par les jeunes compositeurs. On peut remarquer cependant que l’utilisation de matériaux culturellement connotés conduit les jeunes compositeurs à refuser la séparation des paramètres. Alors que Grisey rétablissait les notions de consonance / dissonance et de modulations, les jeunes compositeurs tentent de 40 rétablir les relations entre mélodie, rythme et harmonie. Le caractère prégnant qu’ils souhaitent donner à leurs matériaux, les pousse dans cette voie, sans qu’elle soit encore véritablement explorée. La réinvention mélodique est en cours, mais attendons, … à terme! Revenons encore au texte de Gérard Grisey. Dans le paragraphe «conséquences harmoniques et timbriques», on peut lire: – «Éclatement du système tempéré» Qu’en est-il aujourd’hui de l’utilisation des micro-intervalles? Il semble que pour beaucoup de jeunes compositeurs, l’écriture en quart-de-ton a été perçue comme un passage obligé sous l’influence du spectralisme ambiant. Beaucoup l’ont abandonnée et dans le même temps, ont simplifié leur musique pour se réfugier dans un passéisme décevant. Pour les jeunes compositeurs héritiers de l’aventure spectrale, les micro-intervalles et les échelles non tempérées restent un champ d’investigation très important. Pourtant l’utilisation des quarts ou des huitièmes-de-ton n’est pas systématique dans leurs œuvres, ainsi que c’était le cas chez leurs aînés. La composition s’effectuant à partir de matériaux qui peuvent être macrophoniques, il ne s’agit plus, dès lors, d’écrire obligatoirement de manière non tempérée. De plus, le rythme n’étant plus la conséquence de l’observation du timbre ou des manipulations qu’on lui fait subir, rien n’oblige alors le compositeur à utiliser systématiquement les micro-intervalles. Il s’ensuit une nouvelle manière plus libre de les utiliser: telle section dont le caractère dominant sera la complexité polyphonique et rythmique ne gagnera rien à être écrite en quarts-de-tons, telle autre plus harmonique et microphonique ne pourra exister sans eux. Ce contraste entre les techniques d’écriture participe aujourd’hui de la composition et comme nous le signalions plus haut, il s’agit bien de composer la cohérence en dépit des contradictions. Cette liberté retrouvée des compositeurs plus jeunes leur permet de jouer sur des contrastes plus larges que la seule opposition harmonique / inharmonique ou sinus / bruit blanc. Loin de s’opposer au spectralisme, cette position le corrobore puisqu’il élargit le champ des seuils à franchir: désormais, il faut organiser les passages du tempéré au non-tempéré et ceci, sans hiatus stylistique. Il faudrait un long article pour faire l’inventaire des derniers prolongements de la musique spectrale, mais l’on s’apercevrait rapidement qu’ils reposent sur le même désir de contraindre et d’unifier les éléments les plus contradictoires, réaction normale d’une génération à qui l’on a fait croire que la cohérence existe a priori, dès l’engendrement du matériau. Mais si l’on remarque que les nouvelles générations n’hésitent pas à utiliser des éléments et des techniques hétérogènes et à emprunter des modèles culturels connotés, on est amené à penser que cette nouvelle musique ne peut être que post-moderne (Gérard Grisey, lui-même, conscient de ce qu’il découvrait, qualifia de post-modernes ses Quatre chants pour franchir le seuil lors de notre dernière rencontre!). Elle l’est, au sens étymologique du terme, dans la mesure où les nouvelles générations, tout en participant aux recherches et au développement de nouvelle techniques d’écriture, ne veulent plus prendre de position «historiciste» comme l’ont fait leurs aînés. Pourtant, cette nouvelle musique n’est en aucun cas néoclassique ou nostalgique car elle se tourne vers l’avenir et sait tirer les conséquences qui s’imposent des expériences récentes. Devant la pluralité des expressions musicales, les jeunes compositeurs veulent ouvrir les oreilles et plier tous les matériaux à leurs exigences. Plus que toute autre, l’attitude spectrale, sans dogme, ouverte au monde et au son, permet cette démarche compositionnelle. 41 Questions en pointillés à Philippe Hurel Mes connexions personnelles aux idées et aux sons de la musique spectrale Souvenirs personnels, rencontres, influences, expériences, … Mon premier choc fut l’écoute à la radio de Dérives de Grisey pour ensemble et orchestre (pièce qui n’est jamais reprise malheureusement) alors que je préparais mon petit déjeuner. J’avais trouvé le son de cette pièce inouï, entre électroacoustique et orchestre et j’en oubliai de manger. Après ce «coup de massue» et l’oubli – j’ose le dire – du nom du compositeur (à l’époque, je m’intéressais plus aux musiques combinatoires), j’ai ressenti la même émotion à l’écoute de Partiels, une année plus tard. Cette fois-ci, le nom du compositeur – Gérard Grisey – se marqua à tout jamais dans ma mémoire et je décidai de le rencontrer. Malheureusement pour moi, il enseignait à Berkeley / California et je pris la décision de m’informer sur le courant spectral dont il était l’initiateur. Je fis rapidement la rencontre de Tristan Murail avec lequel je pris quelques leçons portant sur la relation entre musique et ordinateur – il s’agissait plutôt de rencontres avec des jeunes compositeurs – et je me mis à analyser les partitions de mes deux aînés. Très rapidement, mon écoute intérieure bascula et j’écrivis une pièce pour ensemble: Diamants Imaginaires (1983), utilisant les techniques spectrale et notamment le mixage de sons générés par modulation de fréquences joués à la fois par 2 synthétiseurs et un grand ensemble qui en «actualisait» les partiels. À propos de cette pièce, j’écrivis à cette époque: «Si dans ces pièces j’ai utilisé deux synthétiseurs numériques, ce n’est pas à des fins décoratives, mais structurelles: la machine peut être considérée comme un générateur de modèles acoustiques que l’orchestre pourra simuler (le synthétiseur, à ce moment là, absorbera l’orchestre), ou comme un instrument traditionnel de type percussion par exemple (le synthétiseur sera alors absorbé par l’orchestre détenteur de modèles acoustiques).» Cette pièce fut remarquée par Gérard Grisey à sa création à Metz et par Tristan Murail grâce à l’enregistrement du concert. À partir de ce moment-là, j’ai entretenu des relations suivies avec Grisey et Murail aussi bien amicales que professionnelles. Ce fut le début de mon travail sur le son et les processus spectraux. Le développement de la musique spectrale Des sons, spectres, formes, filiation historique (Rameau, Liszt, Debussy,…) à la musique spectrale La musique spectrale a été initiée par Gérard Grisey et l’on ne peut pas dire que son œuvre soit typiquement française, même si son art de l’instrumentation est lié à l’histoire de la musique française de Debussy à Messiaen, en passant par Dutilleux (que Grisey admirait). Ainsi, la forme, chez Grisey, participe fortement de l’esprit germanique, je crois, que l’on peu trouver chez Wagner; les prémisses du rêve de transformation du son dans le temps, de processus. Pour exemple, le prélude de Parsifal qui n’est autre qu’un long processus d’ouverture du spectre sonore. Mais, par ailleurs, on peu aussi trouver chez Ravel, cette idée de processus 42 en germe. Le Boléro en est un exemple et cette œuvre populaire est pourtant d’une grande complexité puisqu’il s’agit d’un long processus d’accumulation orchestrale et de changement de couleur. Daphnis et Chloé en est un autre et le Lever du jour se présente aussi comme un processus d’ouverture du spectre assez remarquable. D’ailleurs ce n’est pas par hasard si Grisey s’est emparé du motif de flûte du Lever du jour pour son Vortex Temporum. La grande ambiguïté, et c’est là toute son influence germanique, c’est qu’il traite ce motif comme une ‹gestalt› qui lui permet de structurer toute la forme de sa pièce, et cette stratégie compositionnelle n’est pas spécialement française. J’aimerais parler ici de Murail auquel je dois beaucoup, mais puisqu’il apparaît dans cet ouvrage, il saura parler de son travail lui-même. Quelques œuvres phares dans l’histoire de la musique Une œuvre phare: Parsifal, beaucoup de chefs-d’œuvre, de Guillaume de Machaut à nos jours. La relation entre sons, mots, littérature, peinture, couleurs … dans vos œuvres Relations avec la couleur et peinture, aucune pour moi … du moins directement. En revanche, sans m’étendre sur l’architecture, je dirais que j’aurais bien diu mal à écrire sans la fréqeuntation des bâtiments de Renzo Piano, Rem Koolhas, Norman Foster ou Jean Nouvel, pour ne citer qu’eux. Avec la littérature, juste un exemple formel qui m’aura marqué: Dans la première partie de La Montagne magique de Thomas Mann, le principal personnage, Hans Castorp rencontre un jeune homme beau, blond, aux yeux bridés. Thomas Mann ne nous dit pas clairement que Hans Castorp en tombe amoureux, mais la relation entre les deux jeunes gens est ambigüe; ce type de relation n’étant pas rare dans l’œuvre de Mann (cf. Mort à Venise). Quand le beau jeune homme quitte l’école, il donne à Hans une méche de cheveux dans une petie boîte de d’allumettes. Ce récit assez long et précis de Mann à propos du jeune homme beau et blond semble dénué d’intérêt et de sens puisqu’il apparaît inopinémént dans le livre où il ne semble pas avoir sa place. Dans la seconde partie de La Montagne magique, Hans Castorp, malade, réside au sanatorium, le Berghof, et alors qu’il déjeune dans la grande salle du restaurant, entre une femme, Madame Chauchat. Il ne la connaît pas encore et le lecteur ne sait rien d’elle. Pour la décrire, Mann se contente de dire:elle est belle, blonde avec les yeux bridés. Pour le lecteur, ces quelques mots suffisent pour faire la connaissance de Madame Chauchat et comprendre ce que sera la relation entre elle et Hans. Ainsi,un gand nombre de pages après l’aventure de l’école, on sait, en quelques mots que Madame Chauchat deviendra l’objet amoureux de Hans et le premier récit de l’école devient compréhensible, prend sa place dans la forme de l’œuvre. Pour moi, cet exemple, comme d’autres dans Proust, Joyce, James ou Diderot, fut une importante leçon de composition. Autres grands écrivains qui m’ont marqué, Georges Perec pour son travail sur les contraintes et la forme (La disparition est pour moi l’un des plus grands livres des temps) et Claude Simon pour son travail formel. J’ai même écrit une pièce en l’hommage de Leçon de choses, livre de Simon dans lequel plusieurs «histoires» se succèdent sans apparente logique dans un premier temps et qui prennent un sens au fur et à mesure de la lecture de l’ouvrage. Bien d’autres écrivains pourraient être cités. 43 44 PROGRAMME 45 Les Espaces Acoustiques Dimanche / Sonntag / Sunday 19.11.2005 20:00 Grand Auditorium SWR Sinfonieorchester Freiburg und Baden-Baden United Instruments of Lucilin Fabrice Bollon direction Danielle Hennicot alto Gérard Grisey: Les Espaces Acoustiques (1974–1985) «Prologue» pour alto seul (1976) 15’ «Périodes» pour sept musiciens (1974) 16’ «Partiels» pour seize ou dix-huit musiciens (1975) 23’ — «Modulations» pour trente-trois musiciens (1976 / 1977) 17’ «Transitoires» pour grand orchestre (1980 / 1981) 21’ «Epilogue» pour quatre cors soli et grand orchestre (1980) 11’ 90’ 46 Les Espaces Acoustiques Gérard Grisey Propos recueillis par Guy Lelong Tout a commencé avec Périodes pour sept musiciens, qui a été créé en 1974 à la Villa Médicis. Cette pièce consiste, d’un point de vue formel, en une succession d’épisodes et, dans le dernier d’entre-eux, j’expérimentais pour la première fois une technique qui me paraissait devoir être développée. J’avais en effet analysé, à l’aide d’un spectrogramme, le son d’un «mi» de trombone et réalisé ses principaux composants (la fondamentale et ses harmoniques) par les instruments de Périodes. Cela ouvrait la voie à une nouvelle pensée harmonique et à ce que j’ai appelé plus tard la «synthèse instrumentale». Il me fallait donc écrire une suite et ce fut Partiels pour 18 musiciens (1975) qui inclut les instruments de Périodes. Puis, je décidai finalement de constituer un cycle entier qui commencerait par une pièce pour un seul instrument, et finirait par le grand orchestre. Comme l’alto jouait un rôle prépondérant dans Périodes, la pièce soliste se devait d’être écrite pour cet instrument et ce fut Prologue pour alto seul (1976). J’ai composé, en fonction des commandes, les trois autres pièces du cycle: Modulations pour 33 musiciens (1976–1977), Transitoires pour grand orchestre (1980–1981) et, enfin, Epilogue également pour orchestre (1985); mais c’est aussi sous l’aspect esthétique et musical que Périodes constitue le départ de ce cycle, car c’est là que j’ai cherché à définir les premiers fondements acoustiques et psychologiques d’une technique capable d’intégrer l’ensemble des phénomènes sonores. Plus précisément, c’est dans Périodes que j’ai commencé à contrôler différents degrés de tension harmonique (harmonicité / inharmonicité) et à operer, sur le plan rythmique, des oppositions entre «périodique» et «apériodique». C’est aussi dans Périodes qu’apparaît la forme générale du cycle, une forme quasi respiratoire construite autour d’un pôle (le spectre de «mi»), à partir duquel s’articulent, en s’en éloignant plus ou moins progressivement, toutes les dérives sonores proposées – l’éloignement étant perçu comme un facteur de tension, et le retour comme un facteur de détente. Les Espaces Acoustiques m’apparaissent aujourd’hui comme un grand laboratoire où les techniques spectrales sont appliquées à diverses situations (du solo au grand orchestre). Certaines pièces ont même un aspect démonstratif, quasi didactique, comme si je m’étais appliqué, dans l’euphorie de la découverte, à faire saisir au mieux les caractéristiques du langage que j’inventais peu à peu. Ma technique s’est évidemment affinée au cours de la composition du cycle, puisque j’ai progressivement intégré un espace sonore non tempéré, exporté l’écriture instrumentale des principes qui provenaient des studios électroacoustiques, et enfin, précisé la notion de processus. Le terme de processus que j’oppose à celui de développement, signifie qu’il ne s’agit plus d’obtenir un discours musical par prolifération du détail, mais plutôt de déduire d’un trajet fixé à l’avance le détail des zones traversées. Cela permet de proposer à l’auditeur des parcours qui relient tel état caractérisé de la matière sonore à un autre (par exemple, de la consonance au bruit), en passant par des zones où tout repère catalogué semble aboli. En d’autres termes, le processus gère la contradiction entre le connu et l’inconnu, le prévisible et l’imprévisible, 47 intègre des surprises sur un fond relativement repérable. Les différentes pièces des Espaces Acoustiques peuvent être jouées séparément; mais lorsqu’elles sont jouées ensemble, elles s’enchaînent les unes aux autres et chaque fin de pièce appelle la suivante. Ainsi, à la fin de Prologue, l’alto est envahi par les instruments de Périodes et la section finale de Périodes est amplifiée par le début de Partiels. Comme la fin de Partiels se dirigeait progressivement vers le silence, je l’ai finalement reliée à l’absence de musique: l’entracte, ce qui m’a permis de résoudre à la fois une transition musicale et un problème d’ordre pratique (il n’est en effet pas possible de laisser trop longtemps en place un orchestre qui ne joue pas; avec la solution de l’entracte, il y a seulement 18 musiciens sur scène pendant la première partie, et l’orchestre n’apparaît au complet qu’avec la seconde). Le raccord entre Modulations et Transitoires est plus complexe: la dernière section de Modulations est un long crescendo, mais comme les cordes du grand orchestre de Transitoires s’y insèrent progressivement, l’intensité finalement atteinte apparaît soudain très supérieure à l’intensité maximale que les 33 instruments de Modulations pouvaient produire jusque là: c’est donc un tuilage par débordement. La fin de Transitoires est écrite pour alto seul et cite certains fragments de Prologue; ces fragments sont alors repris par les quatre cors solistes dans Epilogue. La mise en relation de la fin du cycle avec son début, si elle a évidemment une fonction de bouclage, permet aussi aux Espaces Acoustiques de se terminer sur une perspective nouvelle. En effet, les éléments de Prologue, qui sont principalement mélodiques, se déroulent à une vitesse qui est, plus ou moins celle du langage (ou celle du récitatif de la musique classique), alors que la temporalité à l’œuvre dans Périodes, Partiels, Modulations et Transitoires est au contraire extrêmement étirée; Epilogue, qui conserve cette temporalité tout en citant des fragments de Prologue, superpose donc des vitesses qui sont sans rapport; cette superposition engendre des tensions entre des forces contraires, voire des discontinuités ou des ruptures, et l’effet produit est assez dramatique. Ce sont des dimensions que j’ai développées dans des pièces ultérieures. Certains passages des Espaces Acoustiques donnent lieu à un traitement visuel quasi théâtral. Ainsi, dans Périodes, l’alto, d’abord désaccordé (la corde de «do» est accordée un ton plus haut), doit être réaccordé vers la fin pour des raisons musicales: plutôt que de le dissimuler, j’ai préféré l’exhiber et l’intégrer théâtralement dans la pièce. La fin de Partiels se dirige progressivement vers le silence, mais le silence parfait n’existe pas; il y a toujours un auditeur qui tousse, des instrumentistes qui font tomber leurs sourdines ou qui commencent à ranger leurs affaires! Aussi ai-je mis en scène cette impossibilité du silence; en fait deux processus alternent: le premier va du son vers le silence et le second du silence vers un ensemble de bruits empruntés à la vie quotidienne des instrumentistes (pages qu’on tourne, cornistes qui vident leur eau, cordes qui rangent leurs archets); mais à la fin, c’est vraiment le silence, car même le public est tenu en haleine: le percussionniste, qui écarte lentement deux cymbales qu’il tient à bout de bras, laisse croire qu’un coup formidable va être frappé, mais il est arrêté par l’extinction des lumières qui signalent le début de l’entracte. En terme musical, c’est une gigantesque anacrouse, une levée dont l’accent n’est donné qu’après l’entracte par le premier accord de Modulations; sauf que le percussionniste manque son coup et les cymbales ne sont en fait frappées qu’à la toute fin de Modulations… Une dernière aventure de ce genre a lieu au début de Transitoires: le percussionniste, seul éclairé, écarte de nouveau lentement ses deux cymbales, pendant que les autres instrumentistes citent un fragment de Partiels. 48 Les Espaces Acoustiques Gérard Grisey Commencé en 1974 et achevé en 1985, le cycle des Espaces Acoustiques est constitué de six pièces instrumentales. L’unité de ce cycle est réalisé par la similitude formelle des différentes pièces, et par deux points de repères acoustiques: le spectre d’harmoniques et la périodicité. Je résumerais ainsi le langage utilisé dans ces pièces: – ne plus composer avec des notes, mais avec des sons; – ne plus composer seulement les sons mais la différence qui les sépare (le degré de pré-audibilité); – agir sur ces différences, c’est-à-dire contrôler l’évolution (ou la non-évolution) du son et de la vitesse de son évolution; – tenir compte de la relativité de notre perception auditive; – appliquer au domaine instrumental les phénomènes expérimentés depuis longtemps dans les studios de musique électronique. Ces applications sont beaucoup plus radicales et perceptibles dans Partiels et Modulations; – rechercher une écriture synthétique dans laquelle les différents paramètres participent à l’élaboration d’un son unique. Exemple: l’agencement des hauteurs non tempérées crée de nouveaux timbres; de cet agencement naissent des durées etc. La synthèse vise d’une part l’élaboration du son (matériau), d’autre part les différentes relations existant entre les sons (formes). 49 Die akustischen Räume Gérard Griseys «Les Espaces Acoustiques» Frank Hilberg Es ist wohl keine besondere Übertreibung, wenn man Gérard Griseys Zyklus Les Espaces Acoustiques als eine Enzyklopädie des Klanges betrachtet. Des Instrumentalklanges um genau zu sein, denn die sechs Stücke kommen ohne elektronische Mittel aus. Auch die Größe des Unterfangens – knapp hundert Minuten Spieldauer – auch die zwölfjährige Entstehungszeit und der Umfang der eingesetzten Mittel deuten auf enzyklopädische Dimensionen. Dabei stand keineswegs planerische Absicht am Anfang, vielmehr entwickelte sich die Idee nach der Komposition von Périodes und Partiels. Alle Stücke (mit Ausnahme des Epiloque) können einzeln aufgeführt werden, doch ergibt sich die Idee im Nacheinander, «da jedes den akustischen Raum des vorigen erweitert» (Grisey). Stück für Stück werden diese Klang-Räume größer und komplexer: auf das Bratschensolo Prologue folgt Periodes für sieben Spieler, dann Partiels für 18 Musiker, Modulations für 33köpfiges mit 33 Ausführenden, das orchestrale Transitoires und schließlich der Epilogue für großes Orchester mit vier SoloHörnern. Die einzelnen Stücke sind vielfältig aufeinander bezogen und miteinander verzahnt. Zum einen wird ein Staffelstab zwischen ihnen weitergereicht indem Motive oder Figuren vom Ende eines Stückes den Beginn des nächsten bilden, zum anderen ist ein Netz von Zitaten, von wiederkehrenden Elementen über den Zyklus gelegt. Vor allem aber: «Die Einheit des Ganzen beruht auf der formalen Ähnlichkeit der Stücke und auf zwei akustischen Anhaltspunkten: dem Obertonspektrum und der Periodizität.» (Grisey) Grisey fasst die musikalische Sprache von Les Espaces Acoustiques folgendermaßen zusammen. Er will: – nicht mehr mit «Noten, sondern mit Tönen komponieren», Klang, nicht Tonsatz ist sein Gegenstand; – graduelle Abstufungen zwischen Klängen gestalten; – die Geschwindigkeit von Entwicklungen (oder Nicht-Entwicklung) der Klänge kontrollieren; – der Relativität unserer Wahrnehmung Rechnung tragen; – Phänomene der Akustik und Psychoakustik musikalisch umsetzen; – schließlich einen «synthetischen Stil» anstreben, in dem die verschiedenen akustischen Ebenen nicht nur die einzelnen Klänge bestimmen, sondern auch die Gesamt-Form seiner Stücke. Zu diesem Zweck analysiert er im elektronischen Studio einen charakteristischen Klang und leitet daraus Strukturen ab, die er in seinen Partituren umsetzt. Für Partiels analysierte er die Teiltonstruktur eines tiefen Posaunentons, in Transitoires verschiedene gestrichene oder gezupfte Kontrabasstöne, in Modulations die Formanten von Blechblasinstrumenten mit verschiedenen Dämpfertypen. Technisch-elektronische Mittel spielen für die Analyse seiner Ausgangsmaterialien eine Rolle, für die Ausführung allerdings nicht. Grisey hat nur sehr selten Elektronik in seinen Stücken eingesetzt. 50 Prologue (1976) Die Bratsche ist das Leitinstrument des ganzen Zyklus, sie tritt immer wieder solistisch oder als Zentrum eines Ensembles auf und so ist es nur folgerichtig sie mit einem langen Solo beginnen zu lassen. Ihre Saiten sind auf einen Akkord gestimmt und Resonatoren beeinflussen zusätzlich ihren Klang. Sie skandiert eine Melodie, wobei Grisey Wert darauf legt, dass diese nicht ein Ton-für-Ton-Gebilde ist, sondern eine «Gestalt», die einer fortwährenden Veränderung unterzogen ist, die sich spiralig um die Grundform schraubt. Das Spektrum wird allmählich zu komplexen, geräuschhaften Klängen hin verschoben. «Die melodische Silhouette bestimmt die Gesamtform, die Tempi und das Auftauchen von zwei Arten von Einschüben: den Herzschlag (kurz / lang) und das Echo. Eine einzelne Stimme, doch auch eine abstrakte und konzessionslose Struktur – ich hoffe, hier formuliert zu haben, was für mich die Musik ausmacht: eine Dialektik zwischen Rausch und Form.» (Grisey) Périodes (1974) Vor den Augen und Ohren des Publikums wird die Bratsche höher gestimmt und am Ende des Stückes wieder neu eingestimmt – eine Prozedur, mit der ein Konzert gewöhnlich eröffnet, aber nicht beendet wird. Diese Marginalien zeigen, dass Grisey (obwohl ihn ja eigentlich nur reine Klangphänomene interessieren) durchaus visuelle, szenische Elemente in seine Stücke aufnimmt. Immerhin haben sie ja auch musikalisch-psychologische Effekte, wie man sehen wird. Die Anlage des Stückes hat Grisey analog zum menschlichen Atem gestaltet, mit vernehmlichem Einatmen, Ausatmen und Atempause. Diese und andere Periodizitäten – wie bereits im Titel ausgesagt – spielen hier eine entscheidende Rolle. «Die Periodizität wird hier als beschwerlich erlebt, ein Pol, wo die Abwesenheit einer neuen Energie uns zwingt, uns buchstäblich im Kreise zu drehen, bevor eine Anomalie entdeckt wird, die den Keim für eine neue Entwicklung, einen neuen Ausflug bildet. Die Periodizitäten ähneln jedoch nicht denen, die ein Synthesizer produzieren könnte: Ich bezeichne sie als unscharf, wie unser Herz und unser Gang nie präzis und periodisch sind, sondern einen fluktuierenden Spielraum besitzen, der sie interessant macht.» (Grisey) Wie angedeutet, ist das Stück durch mehrere «Atemzyklen» (und auch der Herzschlag der großen Trommel ist problemlos wahrnehmbar) gegliedert, wobei die Zeitstrukturen ausschließlich aus dem Spektrum der ungeraden Obertöne abgeleitet ist, das in diesem Stück verwendet wird – ein typisches Beispiel für Griseys Übertragung von akustischen Sachverhalten auf musikalische Gestaltung. Partiels (1975) In diesem Stück spielt der Kontrabass eine zentrale Rolle. Er greift das Schlussmaterial des Vorgängerstücks auf und hat ein emphatisches Solo (über einen Ton), das die erste Hälfte des Stückes dominiert. Mit dem Titel Partiels (frz. «Teil…») hat Grisey angedeutet, dass es sich um den Teil eines größeren Werks handelt. Und zum anderen hat er einen Verweis auf die Akustik gegeben, wo die Partialtöne, die Teiltöne (oder auch «Obertöne») die Eigenschaften eines Klanges ausprägen. «Zwei Charakteristika markieren die Entwicklung der Klänge: Periodizität und Obertonspektrum. Diese sehr leicht zu identifizierenden Elemente erlauben eine Kontinuität und eine Dynamik des Stücks, das ziemlich genau die zyklische Form des menschlichen Atmens übernimmt (Einatmen – Ausatmen – Atempause, oder: Spannung / Zusammenfall – Entspannung – Sammeln der Energie).» (Grisey) Partiels hat Grisey berühmt gemacht und ist gewissermaßen das Referenzstück des Spektralismus. Im deutschsprachigen Raum ist es bekannt geworden, weil Peter Niklas Wilson ihm 1988 eine ausführliche kompositionsästhetische Analyse gewidmet hat. Mit ihm hat Grisey die «Instrumentalsynthese» erprobt, jener Kompositionsweise, wo durch ein Instrumentalensemble oder Orchester Klänge erzeugt werden, die einem einzigen neuen, unbekanntem, virtuellen Instrument zugehören könnten. 51 Dem atmenden, herzklopfendem ersten Teil steht eine zunehmende Ausdünnung des zweiten Teils gegenüber. «Der Schluss bewegt sich auf die Stille zu, doch gibt es keine vollkommene Stille – immer räuspert sich ein Zuhörer oder die Spieler lassen ihre Dämpfer fallen oder fangen an zusammenzupacken… So habe ich die Unmöglichkeit der Stille inszeniert, wobei zwei Abläufe miteinander abwechseln: der erste führt vom Klang zur Stille, der zweite von der Stille zu einer Reihe von Geräuschen, die dem Alltag der Spieler entnommen sind – Notenblätter wenden, Entwässern der Blechblasinstrumente, Hantieren mit den Bögen etc. Am Ende aber wird es wirklich still, denn der Hörer selbst hält den Atem an: der Schlagzeuger, der die Arme mit den beiden Becken langsam ausbreitet, erweckt die Erwartung eines lauten Schlages. Plötzlich aber erlischt das Licht, was den Beginn der Pause signalisiert. Musikalisch betrachtet handelt es sich um einen gigantischen Auftakt, wobei der Takt selbst erst nach der Pause auf den ersten Akkord von Modulations fällt…» Modulations (1976 / 1977) «…nur verfehlt der Schlagzeuger seinen Beckenschlag, der erst ganz am Ende von Modulations ausgeführt wird…» (Grisey im Gespräch mit Guy Lelong) Dennoch ein furioser Auftakt des nunmehr groß gewordenen Ensembles mit 33 Spielern. Eine Erregung, die sich rasch beruhigt und in das freie Fluten eines stehenden Klanges übergeht. Das scheint paradox, aber durch An- und Abschwellen einzelner Teiltöne des Gesamtklanges wird er bewegt. Etwa, als ob eine unbelebte Theaterbühne durch verschiedenfarbige Scheinwerfer die aufleuchten und verglimmen dynamisiert würde. Schließlich verebbt auch dieses Wogen und aus der Stille, dem Nichts hebt eine neue Welle an. Einmal mehr ähnelt Griseys Musik einem (Riesen-)Organismus, der sich atmend regt. In einem Kommentar zu Modulations fasst Grisey noch einmal die Grundlagen seiner Ästhetik in etwas technischem Vokabular zusammen: «Die Form dieses Stücks ist die Geschichte der Töne selbst, aus denen es besteht. Die Klangparameter sind orientiert und geleitet, damit mehrere Modulationsprozesse entstehen, die größtenteils auf Entdeckungen der Akustik fußen: Obertonspektren, Teiltonspektren, Formanten, Durchgangstöne, Zusatztöne, Differentialtöne, weißes Rauschen, Filtrierungen usw. Die Analyse der Sonogramme von Blechblasinstrumenten und ihrer Dämpfer hat es mir ermöglicht, ihre Klangfarben synthetisch wieder zusammenzustellen oder sie im Gegenteil zu verzerren.» (Grisey) Transitoires (1980 / 1981) Zu Beginn von Transitoires ist einmal mehr der Beckenschläger zu sehen, der sowenig zum Zug kommen durfte. Auch hier wieder nicht, allein von einem Scheinwerfer beleuchtet, hält er beide Becken zusammen um sie langsam auseinander zu bewegen – ganz das Gegenteil eines Schlages. Die anderen Instrumentalisten zitieren derweil ein Fragment von Partiels – ist es Spott oder nur eine weitere Pointe? Das Orchester ist nun mit allen Mannen vertreten (84 Spieler), und Grisey gibt das auch zu erkennen, baut gewaltige Klangwände auf, die er apart wieder zusammenfallen läßt, plötzlich galoppieren Pauken und Trommeln einher, als seien die Walküren erneut entfesselt, doch auch diese verlieren sich rasch in der Ferne – bei Grisey bleibt nichts unverändert, beständige Wandlung ist die Regel. Selbst wenn etwas zitiert wird, wie das Solo des Kontrabasses aus Partiels, wird es nun von der ganzen Kontrabass-Gruppe übernommen und in einen neuen Kontext gestellt. «Mit ihrem weiten akustischen Raum realisieren Transitoires, und später Epilogue, was in den anderen Stücken des Zyklus latent vorhanden war: Der Filter wird fortgenommen, die Zeit auseinandergezogen, die Spektren explodieren bis hin zum 55sten Oberton und wahre spektrale Polyphonien durchziehen den gesamten Tonraum. Man findet in diesem Stück dasselbe Ausgangsmaterial, dieselben 52 Kraftfelder und dieselben Prozesse wie in den vorhergehenden. … Erinnerung, Wiederkehr und Aufbrechen: In Transitoires kommen auf diese Weise unvermutete Aspekte des Materials zutage und münden in eine ‹primäre› Melodie, eine Art Wiegenlied, die Prologue entnommen ist.» (Grisey) Epilogue (1985) Und dieses «Wiegenlied» ist denn auch die Brücke zum Epilogue. Und zugleich natürlich die Rückbindung zum Anfang. Zuvor aber übernehmen die Solohörner das Material und reiten in einer furiosen Eskapade über den spektralen Regenbogen – mit mannigfach gezielten Verstimmungen über einen schlitternd bewegten Untergrund. Sie stoßen ihre mikrotonalen Fanfaren heraus, ein letzter Schlag der großen Trommel und der gewaltige Zyklus ist zu Ende. «Ist es ein Abschluss? Ich bezweifle es. Ich musste eher willkürlich einen ‹entropischen› Prozess unterbrechen, der nach und nach das offene System der Espaces Acoustiques angreift.» (Grisey) Dem siedenden Geist ist nun mal ein Abschluss nicht geheuer. Seine Phantasie treibt ihn fort und fort und fort… 53 «Vianden» – Mikroskopische Musik Dimanche / Sonntag / Sunday 20.11.2005 18:30 Foyer Volker Staub Leitung Anne La Berge Flöte Ivo Nilsson Posaune Michael Weilacher Schlaginstrumente und Teilnehmer des Workshops (Klangtheater AG der Viktoriaschule Darmstadt unter der Leitung von Christina Troeger) Volker Staub und Workshop-Teilnehmer: Mikroskopische Musik (Uraufführung / création) ca. 20’ — Volker Staub: Vianden für Flöten, Posaune, Stahlsaiten und Schlaginstrumente (Uraufführung der überarbeiteten Fassung / création de la nouvelle version) 55’ — Volker Staub: Solo für Motorsirenen N° 33 ca. 20’ Backstage: Dimanche / Sonntag / Sunday 20.11.2005 18:00 Foyer Exposition: L’aménagement hydro-électrique de Vianden: sources de la composition Vianden Ausstellung: Das Kraftwerk in Vianden als Quelle der Komposition Vianden 54 Volker Staub (links) und Michael Weilacher Photo: Andreas Arnold Die Arbeit am geteilten Klang Ein Gespräch über Musik und Ordnung mit dem Komponisten und Instrumentenbauer Volker Staub Hans-Jürgen Linke Hans-Jürgen Linke: Sie sind Komponist und erfinden und bauen für zahlreiche Ihrer Werke Musikinstrumente. Heißt das, dass Sie Klangvorstellungen folgen, die mit den vorhandenen Instrumenten nicht realisierbar waren? Volker Staub: So planvoll bin ich nicht vorgegangen. Ich habe schon von klein auf in der Werkstatt meines Großvaters gebaut und gebastelt. Als ich dann ernsthaft anfing, Musik zu machen, habe ich festgestellt, dass all die Metallrohre und Holzstücke, die dort herum lagen, einen eigenen Klang hatten. Diese Hörerfahrung kennt jeder. Wie haben Sie diese Erfahrung wissenschaftlich organisiert? Während meines Studiums habe ich mich bei Johannes Fritsch theoretisch mit dem beschäftigt, was er «Allgemeine Harmonik» nennt, also mit Stimmungssystemen in verschiedenen Kulturen, mit Obertonverhältnissen und solchen Dingen. Vor diesem Hintergrund habe ich die Klänge der Gegenstände in Großvaters Werkstatt untersucht und zum Beispiel herausgefunden, dass die Metallteile eine völlig andere Obertonstruktur hatten als sie der Theorie nach eigentlich haben sollten, dass es also unharmonische Obertonspektren gab. Ich habe dann angefangen, diese komplexen Klänge zu analysieren. Vieles hat zu der gängigen Obertontheorie nicht richtig gepasst – ein Phänomen übrigens, das man auch im Glockenbau kennt. Weil mir diese Mischklänge so gut gefielen, habe ich angefangen, damit zu arbeiten. Ich fühle mich übrigens nicht als Erfinder von Musikinstrumenten, eher als Finder. Einige meiner Klangerzeuger könnten fast aus archaischen Kulturen stammen. Erst durch die differenzierte musikalische Betrachtung und Handhabung werden sie zum Material der zeitgenössischen Musik. Das chromatische System war für Sie von vornherein nur eine von vielen möglichen Ordnungen im Tonraum? Genau. Bei Johannes Fritsch war zu lernen, dass es außer der Temperatur mit zwölf Tönen in der Oktave aber auch eine mit 20, 24, 30 Tönen pro Oktave gibt. Wir haben solche Stimmungen entworfen und an Monochorden dargestellt. Wir haben auch gelernt, dass es in den Obertonreihen vom zehnten, elften Oberton an plötzlich ganz andere Intervalle gibt, reine Intervalle, die aber nicht mehr der temperierten zwölftönigen Stimmung entsprechen. Ausgangspunkt für diese Forschungsarbeit war für Sie also der sehr komplexe Parameter Klang. Die ersten Stücke, die ich geschrieben habe und zu denen ich heute noch stehe, sind um 1982 entstanden. Ich habe dafür Glasballons mit abgesägten Böden hergestellt. Deren Klänge habe ich analysiert und in Tabellen eingetragen, geordnet und miteinander in Beziehung gesetzt nach Tonhöhe, Energie, Schwebungsintensität, Farbe, Klangdauer. Diese Glasglocken haben nahezu individuelle, teilweise sehr komplizierte Klänge, denen man weder mit temperierter Stimmung 56 noch mit gängigen Obertonspektren zu Leibe rücken kann. Man muss jeden einzelnen Klang so aktzeptieren, wie er ist. Ihr Material ist also zunächst nicht notierbar gewesen, sondern einfach vorhanden – eine Welt, die man sich durch Analyse erst aneignen musste. Ja, so habe ich meistens gearbeitet: Ich habe Anordnungen von Gegenständen geschaffen, mit denen Klänge erzeugt werden, die ich erst noch erforschen musste. Für die Forschungsergebnisse wiederum musste ich eine Notation erfinden. Notiert habe ich die Instrumente selbst mit Nummern oder Buchstaben und bestimmte Spielvorgänge, also Bewegungen am Instrument. Es gibt in Ihrem Sortiment mehrere Gruppen von Instrumenten: Perkussions-, Saitenund elektroakustische Instrumente. Wenn wir uns zunächst den Perkussionsinstrumenten zuwenden, also Baumstämmen, Glasglocken, Metallteilen, Marmorstücken, die angeschlagen werden: Welche Rolle spielt dabei der Parameter Rhythmus? Alle diese Instrumente erzeugen sehr komplexe Klänge, die keiner bekannten Systematik zuzuordnen sind. Die Baumstämme zum Beispiel haben die Eigenschaft, dass ein einziger Stamm eine ungeheure Vielfalt an verschiedenartigen Klängen hervorbringen kann. Genauso ist Rhythmus für mich auch eher ein Feld der Forschung als eines von fertigen Strukturen. Mein Lehrer Johannes Fritsch hat in Köln einen Verlag in einem Hinterhaus, wo ich Instrumente lagern und arbeiten konnte. Wenn es windig war, klapperten dort die Schiefertafeln an den Dachgauben. Irgendwann habe ich dieses Klappern, das mich häufig beim Arbeiten störte, aufgenommen und versucht, die Rhythmen zu transkribieren. Aus diesen Transkriptionen habe ich notierbare Rhythmen abgeleitet. Im Prinzip ist auch dieses Material chaotisch, aber dadurch, dass die Ziegel in einer bestimmten Weise aufgehängt und angeordnet waren und dass auch die Mechanismen der Geräuscherzeugung durch Wind oder Regen begrenzt waren, konnte man Regelmäßigkeiten erkennen. Im Grunde ist das eine ähnliche Arbeit wie mit den Klängen. Die Rhythmen sind organisch. Allerdings entwickle ich Rhythmen auch durch Konstruktion, etwa durch Überlagerung festgelegter Muster und Reihen. Aber Sie arbeiten nicht wie ein Mathematiker, der komplexe Systeme auf einfache Grundlagen reduziert? Wenn ein komplexer Klang oder ein komplexer Rhythmus analysiert und in seine Bestandteile zerlegt ist, dann ist er natürlich nicht mehr ganz. Und das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Wenn ich eine Armbanduhr zerlege, habe ich die Einzelteile, aber keine Armbanduhr mehr – ich gebe allemal der Uhr den Vorzug gegenüber ihren Einzelteilen. Gehen wir weiter zu Ihren Saiteninstrumenten, die oft erstaunliche Größen haben. Stimmt, eines habe ich auch hier vorm Haus: zwei vierzig Meter lange Saiten, die von Wind und Regen gespielt werden. Traditionelle Saiteninstrumente sind so gebaut, dass sie mit der Länge und Beschaffenheit der Saiten und der Größe und Beschaffenheit des Resonators klar erkennbare Tonhöhen erzeugen. Das heißt, dass eine Vielzahl von Obertönen unterdrückt wird. Bei meinen Saiteninstrumenten haben mich vor allem diese Obertöne interessiert. Die Form, die ich gewählt habe, ist die des klassischen einsaitigen Monochords, also des rationalsten aller Instrumente, das seit der Antike zur Bestimmungen von Intervallproportionen und mathematischen Verhältnissen verwendet wird. Im Gegensatz zur etwa einen Meter langen Saite eines normalen Monochords, verwende ich fünf bis acht Meter lange, sehr dünne Klaviersaiten. Wenn man sie mit dem Bogen streicht, kommt ein unglaublich komplexer Klang voller Obertöne heraus, weil die Saite als Ganze schwingt, aber zugleich auch als zwei Hälften, drei Drittel, vier Viertel … als hundert Hundertstel. Und jede dieser Unterteilungen erzeugt 57 ihre eigene Frequenz. Wenn ich auf solch einer langen Saite spiele, moduliere ich das Klangvolumen mit bestimmten Techniken, um bestimmte Frequenzbereiche zu isolieren und Übergänge zu schaffen in andere. Ich kann immer nur einen Ausschnitt des Gesamtklangs der Saite hörbar machen, der als Ganzer unfassbar ist. Was benutzen Sie als Resonator? In der Regel ein Ölfass, aber man kann diesen Klang auch magnetisch abnehmen und elektronisch verstärken. Das leitet über zur dritten Instrumentengruppe, den elektroakustischen. Meine elektroakustischen Instrumente stehen schon in einer langen Tradition. Ein Pionier auf diesem Gebiet war der Engländer Hugh Davis. Das Prinzip ist, ein Körperschallmikrofon oder, wenn der verstärkte Gegenstand aus Metall ist, ein magnetisches Mikrofon an einem Objekt anzubringen, das feinste Schwingungen erzeugt, die man normalerweise nicht hört. Es geht also um die mikroskopische Wahrnehmung einer Klangwelt, die für unser Ohr sonst nicht zugänglich ist. Dann gibt es noch eine vierte Instrumentengruppe, mit der Sie sich beschäftigt haben, nämlich Sirenen. Wie kommt man dazu, ein öffentliches Alarmsystem als Musikinstrument zu verwenden? Entwickelt habe ich das um 1990 im Rahmen eines Theaterstücks, das sich über die 600 Meter lange Kölner Südbrücke erstreckte. Das Publikum konnte das Stück von einem Schiff aus verfolgen. Ich habe nach einem gigantischen Instrument gesucht, das im Gegensatz zur Menschenmusik der Instrumentalisten und Sänger, die an bestimmen Punkten der Brücke zu hören war, den gesamten Schauplatz zum Klingen bringen konnte. Wie exakt lässt sich das steuern? Ich habe Transformatoren vorgeschaltet, mit denen man Tonhöhe, Lautstärke und Glissandi relativ genau steuern kann. Allerdings wird die Sache umso unüberschaubarer, je mehr Sirenen man verwendet. Es gibt ein Missverhältnis zwischen Anlauf- und Betriebsstromstärke. Man braucht viel Energie, bis eine große Sirene in Gang gekommen ist, aber wenn sie läuft, tut sie das mit vergleichsweise geringer Energiezufuhr. Wenn ich also einen bestimmten Wert eingebe, braucht sie unter Umständen zwei Minuten, bis der erreicht ist. Das macht die Sache ein Stück weit unplanbar. Durch diese Trägheit der Instrumente ist der Gesamtklang in kontinuierlicher Bewegung. Ab und zu hört man vorübergehend ein wiedererkennbares harmonisches Gebilde, das aber sofort wieder verschwindet. Sie spielen die Sirenen live? Ja, im Freien oder in großen Räumen. Diesen vom Zivilschutz her bekannten Warnklang mit Anfangs-Glissando und anschließendem langen Halteton gibt es bei mir kaum. Es entsteht eher ein orgelartiger Klang des ganzen Ensembles aus bis zu neun Sirenen, der sich ständig verändert. Sirenen sollen Menschen vor Gefahren warnen. Was hat das mit Odysseus und mit Ihrer Musik zu tun? Ich glaube, das Bedrohliche am Sirenenton ist das Kontinuierliche, das NichtUnterteilte. Alle Musikinstrumente erzeugen klare, in Intervallen voneinander getrennte Tonhöhen oder Rhythmen, die die Zeit unterteilen. Der Klang der Sirenen dagegen ist fließend und formlos wie das Wasser, durch das 58 Odysseus reist und das ihn nicht loslässt. Er muss sich an den Mast fesseln lassen, um der Verlockung der Sirenen, des Formlosen, vielleicht auch dem Wahnsinn zu widerstehen – Mast und Fessel vertreten die Ordnung. Ich finde, dass nicht nur der Name, sondern auch die Musik der Sirenen eine Beziehung zum Mythos hat. Schließlich werden Sirenen öffentlich eingesetzt, um vor Bedrohung zu warnen; ihre Beziehung zur Gefahr gehört zum Mythos. In der Musik der Sirenen ist jede andere Musik enthalten. Sie enthält immer auch nur die Idee des Unendlichen. Sie kann es symbolisieren, indem sie die Zeit nicht mit rhythmischer Unterteilung strukturiert und parzelliert. Aber sie endet schließlich doch, wenn man ihr den Strom abstellt. 59 Motorsirenen Volker Staub 1989 begann ich zusammen mit der Kölner Performance-Künstlerin und Tänzerin Angie Hiesl die Arbeit an dem Stück Rheinrot. Der Aufführungsort von Rheinrot war die Kölner Südbrücke und die angrenzenden Uferregionen der Poller Wiesen und des Kölner Hafengeländes. Die Aufführungen waren im Juni 1990, begannen bei Einbruch der Dunkelheit und dauerten etwa zwei Stunden. An verschiedenen Orten auf, über und unter der Brücke sowie auf beiden Seiten des Ufers kreierte Angie Hiesl eine Szenerie, die zu meiner Musik für Sopran, Männerchor (Köln Vingst 1861 e. V.), Blechbläser, Schlagzeuger und Motorsirenen in Beziehung trat. Die Musiker wurden dabei zu Akteuren in den theatralischen Bildern. Das Publikum erlebte die Aufführung von einem Rheindampfer aus, der dem Geschehen von der einen Rheinseite zur anderen auf dem Wasserweg folgte. In diesem Umfeld entwickelte ich das Instrumentarium der Motorsirenen. Ich suchte nach einem Instrument, das es mir ermöglichen sollte, den gesamten Schauplatz (die Südbrücke hat eine Länge von 600 Metern) erklingen zu lassen, und gleichzeitig das optische Verhältnis der kleinen Menschen zu der gewaltigen Brückenkonstruktion ins Musikalische zu transformieren. Ich erstand sieben Motorsirenen unterschiedlicher Größe (mit Endtonhöhen von 510 bis 1480 Hertz), deren Motoren mit Stelltransformatoren gesteuert werden sollten. Die Transformatoren erlaubten es mir, die Tonhöhen und hierzu analog die Lautstärken der Sirenen recht präzise zu kontrollieren. Die akustischen Klangerzeuger wurden sodann über die ganze Brücke verteilt. Wenn ich nun von meinem zentralen Bedienungsort aus das riesige Instrument steuerte, erzeugte es einen gewaltigen, orgelartigen Klang, eine Klangmasse, die hinsichtlich ihres Volumens, ihrer Lautstärke und Dauer in keinem Verhältnis mehr zur Menschenmusik der Sänger, Bläser und Schlagzeuger zu stehen schien. Aber auch sehr leise, langsam glissandierende und verschmelzungsfähige Klänge konnten mit den Sirenen hervorgebracht werden. Natürlich erweckte diese Musik nachts am vergifteten Rhein mit seinen Frachtschiffen, vor der stählernen Eisenbahnbrücke, den tosenden Güterzügen und der erleuchteten Großstadt zahlreiche Assoziationen, die allerdings aufgrund der Steuerungsmöglichkeit und der fast chorischen Anordnung der Sirenen ihrer Eindeutigkeit beraubt wurden. Die Motorsirenen heulten nicht auf, sondern hoben langsam einen glissandierenden Gesang an, der sanft durch den Tonraum schwebte und dennoch die grenzenlose Lautstärke und Dauer ahnen ließ. Ganz im Gegensatz zu allen Musikinstrumenten, die den Tonraum oder die Zeit rastern, zergliedern und damit erfahrbar und verstehbar machen, erzeugen die gesteuerten Sirenen den vormusikalischen Klang eines noch nicht oder nicht mehr strukturierten akustischen Kontinuums, in dem alle historische Musik unterschiedslos enthalten zu sein scheint. Ihr Klang ist ebenso verlockend wie bedrohlich, fast gefräßig und erweckte besonders damals am Rhein Assoziationen zu den mythologischen Sirenen der Odyssee bzw. zur ‹Rheinsirene› Loreley. Es ist anzunehmen, dass sowohl ihr mythologischer Name als auch ihre normale Verwendung als Signalinstrumente zur Warnung vor Katastrophen oder Angriffen auf die Gesellschaft in enger Beziehung zu den Klangeigenschaften der Sirenen 60 stehen. Das grenzenlos Kontinuierliche erscheint als bedrohlicher Gegenpol zur bewußt strukturierten und organisierten Welt und verheißt gleichzeitig Liebe, Selbstaufgabe und Transzendenz. Seit ihrem ersten Erklingen im Jahr 1990 auf der Kölner Südbrücke habe ich die Sirenen in mehreren Kompositionen, zuletzt in Konzert Tel-Aviv (2000), verwendet. Von all meinen Instrumenten tragen sie am meisten den Charakter des Experimentellen. Auch wenn sie mit Potentiometern gesteuert werden, sind ihre Klangverläufe niemals exakt kontrollierbar. Die Klänge verschmelzen oft in so hohem Maße, dass eine einzlene Sirene weder akustisch identifiziert noch gezielt intoniert werden kann. Die kleinste Tonhöhenveränderung einer Sirene moduliert den Klang des ganzen Ensembles, und allzu oft verändert sich sein Klangbild ganz von alleine durch kleinste Schwankungen der Spannung und der Stromstärke – zum Ärger oder zur Freude der tatenlos zuhörenden Interpreten. Die Zerstückelung des Regenbogens Eine erstaunliche Entsprechung zu den zuvor geäußerten Gedanken über den Klang der Motorsirenen als Verkörperung des Kontinuierlichen im Reich der Töne und deren Verhältnis zu Struktur und Geschichte findet sich im nachstehenden Mythos der nördlich des Amazonas lebenden Arekuna über den Ursprung des Fischgifts, den Claue Lévi-Strauss im ersten Band seiner Mythologica erzählt. Er enthält u. a. die Episode von der Zerstückelung des mörderischen Regenbogens, einer im Reich der Farben ebenfalls kontinuierlichen Erscheinung, in der alle Wellenlängen farbigen Lichts von rot über gelb und grün bis violett stufenlos enthalten sind. Der Mythos handelt von einem besonderen Kind, dessen Bad im Fluss zahlreiche Fische sterben lässt. Diese vom Vater und der Großmutter geheimgehaltene Eigenschaft wird unter den Verwandten und in der Dorfgemeinschaft bekannt. Von nun an geht das Baden des Kindes mit einem öffentlichen Fischfang bzw. dem Sammeln der toten Fische einher. Dies beobachten die fischfressenden Vögel, und der Tuyuyu-Vogel fleht den Vater an, das Kind für die Vögel in einem Becken am Fuß eines Wasserfalls baden zu lassen, in dem es viel mehr Fische gebe. Der erschrockene Vater gibt schließlich dem unaufhörlichen Drängen des Vogels nach, und so trifft sich die Familie mit den versammelten Vögeln am Becken, das, wie alle sehen, voller Fische ist. Der Vater befiehlt seinem Sohn einzutauchen, doch dieser hat Angst vor dem tiefen und drohenden Wasser. Der Vater drängt stärker; entzürnt springt der Sohn ins Wasser, taucht hierhin und dorthin. Und sein Vater sagt: «Es ist genug, mein Sohn! Es sterben schon viele Fische! Komm heraus!» Doch das zornige Kind will nicht hören. Es sterben sehr viele Fische. Schließlich steigt der Schwimmer auf einen Felsen in der Mitte des Beckens und legt sich mit dem Bauch nach unten darauf, ohne ein Wort zu sagen. Er friert sehr, denn er war zornig und erhitzt ins Wasser gesprungen. Und während die Männer und die Vögel damit beschäftigt sind, die toten Fische einzufangen, stirbt er in aller Stille. Während er unter Wasser war, hatte ihn Keyemé – der Regenbogen in Form einer großen Wasserschlage – mit einem Pfeil angeschossen. Keyemé ist der Großvater der Wasservögel; der Eingang seiner unterirdischen Wohnung liegt in der Tiefe des Beckens, in dem der unheilvolle Fischfang stattgefunden hatte.1 Der Vater macht die Vögel für den Tod seines Sohns verantwortlich und fordert sie auf, ihn zu rächen. Vergeblich tauchen zunächst die Vögel, dann die irdischen Vögel, dann die Vierfüßler nach Keyemé. Drei Vögel, die das bisherige Geschehen nur aus der Ferne verfolgt haben, bieten ihre Hilfe an, tauchen und töten den Regenbogen in der Tiefe des Wassers. 1 Kursiv gesetzte Zitate: Lévi-Strauss, Claude: Mythologica I. Das Rohe und das Gekochte. – Frankfurt am Main, 1971, S. 336 ff. Mit Hilfe einer um den Hals geschlungenen Schlingpflanze gelang es den Männern und Tieren, das Ungeheuer an Land zu ziehen. Es wurde gehäutet, in Stücke geschnitten und verteilt. Je nach Art und Farbe des Stücks, das jedem zufiel, erwarben die Tiere sei es ihre Schreie, ihre anatomischen Besonderheiten ihr Fell oder Federkleid. 61 Kulewénte (der Vater) legte den Körper seines Sohnes in einen Korb und ging von dannen. Die Großmutter nahm den Korb und ging auf gut Glück los. Aus dem Korb floss zuerst das Blut, dann das verwesende Fleisch, woraus der Timbó entstand, aus dem das Fischgift gewonnen wird. Aus den Knochen und Geschlechtsteilen entstand der schwache Timbó, aus dem übrigen Körper der starke. Die Großmutter verwandelte sich schließlich in einen Ibis, einen Fresser von Regenwürmern, die die Männer als Fischköder benutzen. Motorsirenen Photo: Archiv Volker Staub 62 Vianden Zur Komposition von Volker Staub Ernstalbrecht Stiebler Eine ganz wesentliche Eigenschaft des Klanges bestimmt die Formenwelt der inzwischen zuweilen abendfüllenden Kompositionen von Volker Staub: die Transparenz, die Durchlässigkeit des Klangmaterials, das seinerseits Materie durchdringt und zugleich selbst durchlässig ist. Diese Permeabilität des Klanges weitet Volker Staub aus auf die gesamte formale Anlage seiner Kompositionen. So wie sich die einzelnen Klänge gegenseitig beeinflussen und durchdringen, genauso formieren sich verschiedene Kompositionen zu einer neuen, höher organisierten Einheit, wie zum Beispiel in Suarogate, das auf der bei Wergo erschienenen CD des Deutschen Musikrates aus 23 Stücken besteht, oder wie bei der heute aufgeführten Komposition Vianden, deren 13 Einzelstücke das Werk in drei Abschnitte gliedern. Zuerst erklingen drei der Einzelstücke simultan, lediglich an den Rändern der drei Abschnitte, zu Beginn oder am Ende, sind die einzelnen Kompositionen allein zu hören. Die ersten beiden Abschnitte dauern je 15' und bestehen aus je drei simultan erklingenden Kompositionen und einem Verbindungsstück, der letzte von ca. 30' aus sechs solchen Kompositionen, ebenfalls mehrfach simultan. Diese 13 Stücke gehören aber durch ihre Genese und ihre instrumentale Faktur ihrerseits in verschiedene zyklische Zusammenhänge, die nun auf eine die Komposition von Vianden charakterisierende Weise fragmentarisch in den neu geschaffenen Zusammenhang hineinreichen. Es gibt fünf solcher Kompositionszyklen, die ganz oder teilweise in Vianden präsent sind und die durch ihre Instrumentation unterschiedliche Klangbereiche darstellen. Das sind erstens Weiche Gesänge für Stahlsaiten, die gleich anfangs im ersten Abschnitt zu hören sind, simultan mit dem zweiten Bereich, dem Zyklus Für Metalltrommeln. Es folgt als dritter Klangbereich das Duo für Flöte und Posaune, eine vierteilige Kompositon in traditioneller Instrumentalfarbe, die ganz in Vianden aufgeht; in diesen Bereich gehören auch die Solostücke für Flöte und Posaune. Der vierte Klangbereich sind die Waldstücke für Baumstämme, Stimme, Regenstab und Vogelstimmen, die erst im zweiten Abschnitt erklingen zusammen mit einem Flötensolo und dem zweiten der Stahlsaitenstücke; der fünfte Bereich am Schluss sind die Rutenstücke im dritten und letzen Abschnitt von Vianden zusammen mit den fünf Kompositionen aus den anderen Klangbereichen. Der Titel Vianden führt auf verschlungenem Wege in die musikalische Welt des Volker Staub, nämlich in die Werkstatt seines Großvaters, eines Architekten, in der die verschiedensten Materialien, vor allem Holz und Metall, lagerten, und in der schon der Schüler eine ihn faszinierende Klangwelt jenseits der sogenannten Kunstmusik entdeckte, die ihn bis heute nicht losgelassen hat. Hier untersuchte er das Material auf seine Klangeigenschaften und hier begann er seine Instrumente zu bauen, die die Charakteristik und Ursprünglichkeit des vorgefundenen Materials hörbar, den Klang im musikalischen Sinne variierbar, also spielbar machen sollten. In dieser Werkstatt (eigentlich dem Geburtsort des Komponisten Volker Staub) fand er auch Pläne seines Großvaters für 63 ein Kraftwerk in Vianden / Luxemburg, die er nun ebenso wie die anderen Materialien aus der Werkstatt in den Kompositionsprozeß, gleichsam als FormMateriale, mit einbezog – darin spiegelt sich ein wesentlicher Grundzug seines Komponierens: ein ungewöhnliches, häufig elementares Klangmaterial, dann aber eine sehr differenzierte kompositorische Bearbeitung. Das Programm heißt nicht Einfachheit, sondern Ursprünglichkeit des Klanges – und eine klanggemäße, der natürlichen Differenziertheit des Materials gemäße kompositorische Bearbeitung. Aber auch die Einfachheit seiner Instrumente ist nur eine scheinbare. Ist ein Baumstamm einfach? Einfachheit in der Kunst ist nicht Einfachheit, sagt Ad Reinhardt. Die ästhetische Qualifizierung hat andere Regeln. Das ästhetisch-artifizielle Umfeld von Volker Staubs Klangmaterial ist vielschichtig. Da spielt «arte povera» eine Rolle als Abkehr von Megatechnik und Konsumwelt, eine ökologische Beschränkung der Mittel – ich baue meine Instrumente selbst – und zugleich eine Pioniermentalität, die an Thoreau erinnern mag und auch an noch Älteres, Archaisches. – Eine Annäherung an sogenannte «primitive» Musik-Kulturen wird erkennbar. 1 Lévi-Strauss, Claude: Mythologica II. Vom Honig zur Asche. – Frankfurt / Main: Suhrkamp, 1972, S.112 Zu den Waldstücken notiert Volker Staub: «Der instrumentale Ausgangspunkt der […] Kompositionen befindet sich nicht im Lichte der Kultur. Er liegt im ungeformten Naturzustand, aus dem heraus durch die Komposition und den Vortrag des Musikers das Instrument weniger physisch als metaphorisch erschaffen wird,» und er verweist auf einen von Lévi-Strauss überlieferten südamerikanischen Mythos: «…und ein Vogel höhlte die erste Trommel aus, schlug sie die ganze Nacht und verwandelte sich am nächsten Tag in einen Menschen».1 Die archaische Kraft von Musik, ihre Verbindung zu alten, vielfach schon ins Vorbewußte abgesunkenen Traditionen, wird durch die eigene Klangarbeit mit den alltäglichen Materialien erfahrbar, viel fragmentarischer zwar und vermittelter als durch den Import von «Original-Afrika», dafür aber in einer heutigen, uns betreffenden, artifiziellen Realität. Aber auch heutige Instrumente, wie die Sambatrommel, «Surdo» genannt, ein Aluminiumfass, auf beiden Seiten mit einem Kunststoffell bespannt, haben ihn zu eigenem Instrumentenbau, zu dem der Metalltrommeln angeregt. Sie beginnen in Vianden simultan mit dem Klang der Stahlsaiten, die in den Zyklus Weiche Gesänge gehören, der mit drei neuen Stücken in Vianden vertreten ist. Die Entstehung dieser Instrumente geht auf Staubs eigene Experimente beim Bau von Monochordinstrumenten zurück und auf die Anregungen durch den Converter von Bob Hates, den Volker Staub u.a. in seinem fast fertiggestellten Buch «Jenseits 440 Hertz, Texte zum experimentellen Instrumentenbau» beschreibt. Alvin Lucier, Ellen Fullman und Paul Panhuysen haben im Prinzip ähnliche Klangerzeugungen entwickelt. Um den ursprünglichen Klang der Materialien zu erhalten, ist die Notation von Staubs Musik von großer Genauigkeit und bestimmt das Niveau der sehr differenzierten Komposition, hier wirken die Kölner Studienjahre bei Johannes G. Fritsch nach. Die Intention, Natur, natürliche Klänge zu verwenden, führt zur häufigen Verwendung von Naturtonreihen, die sich in unserem Tonsystem nur annähernd durch mikrotonale Intervalle wie Viertel- und Achteltöne darstellen lassen. Die Genauigkeit in Bezug auf die Klangfarbe wird auf alle Parameter ausgedehnt, vor allem auch auf die formale Entwicklung. Der Ablauf, die Überlagerung und Positionierung der einzelnen Stücke ist minutiös festgelegt. Instrumentarium und zuweilen auch der Gestus der Musik könnten improvisatorische Verfahren nahelegen; das Gegenteil ist der Fall, ganz in der Tradition der «Neuen Musik», die um so freier und improvisierter klingt, je genauer sie komponiert und notiert wurde. Die Auseinandersetzung mit postseriellen Kompositionstechniken, die Konfrontation der eigenen «GeräuschKlinger» mit modernen Orchesterinstrumenten, wie hier Flöte und Posaune, ihre Transplantation in die eigenen, originellen Klang-Konkretionen rücken 64 diese der Kunstmusik näher; die traditionellen Instrumente aber geraten in einen umfassenderen, historischen Kontext und bekommen dadurch einen anderen Stellenwert. Sie werden gleichsam zum Träger von Musikgeschichte, changierend zwischen Gegensätzlichkeit und Verwandschaft zur experimentellen Klangwelt Volker Staubs. Bis heute lebt seine Musik aus diesem Widerspiel, das dazu anregt, die Musik neu zu bestimmen, ihre Herkunft und gerade auch ihre Künstlichkeit als eine materialbezogene zu verstehen – keine Vergeistigung, eher eine Materialisierung von Musik. Die Komposition «dient» dieser Materialisierung und wird in ihrer artifiziellen Differenzierung und ihren geschichtlichen Manifestationen erkennbar. Am Ende von Vianden erklingt das Rutenstück, zuletzt als Solo, ein Beispiel für Volker Staubs zuweilen durchaus poetische «Instrumentation», die sehr wohl von der symbolischen Kraft der Instrumente weiß. Bei einem Aufenthalt im Künstlerhaus Schreyahn entdeckte Staub sehr große Gräser, die er zunächst für das Schafgarben-Orakel des chinesischen I-Ching verwenden wollte. Aber er erfand damit keine Zufallskonstellationen wie John Cage, sondern er fand die sublime Klangnatur dieser «Instrumente», als eine Begegnung von Kunst und Natur, ein Stück ZEN-Kultur, getreu jener alten, von Cage mehrfach zitierten Maxime, die die Einheit von Kunst und Leben einfordert. 65 Vortex Temporum Mardi / Dienstag /Tuesday 22.11.2005 20:00 Espace Découverte Solistes de l’Ensemble intercontemporain Emmanuelle Ophèle flûte Alain Billard clarinette basse Samuel Favre percussion Dimitri Vassilakis piano Jeanne-Marie Conquer violon Christophe Desjardins alto Eric-Maria Couturier violoncelle Tristan Murail: «La Barque mystique» pour ensemble instrumental (1993) 13’ Philippe Hurel: «Tombeau» pour percussions et piano – in memoriam Gérard Grisey (1999) 13’ — Gérard Grisey: «Vortex Temporum» I–III pour piano et 5 instruments (1994–1996) 37’ Backstage: Mardi / Dienstag /Tuesday 22.11.2005 19:00 Introduction avec des musiciens de l’Ensemble intercontemporain et films sur Gérard Grisey / Publikumsgespräch mit Musikern des Ensemble intercontemporain und Filme über Gérard Grisey Les Chants de l’Amour de Gérard Grisey. Génèse d’une Œuvre (1985) Réalisation: David Andras 18’ Gustave. Musique pour «La Tour Eiffel» (1987) Production Musée d’Orsay, la Sept, MC 93 Bobigny, Compagnie Chopinot 6’ 66 La Barque mystique Pour flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano (1993) Tristan Murail La Barque mystique emprunte son titre à une série de pastels d’Odilon Redon. En dehors de raisons anecdotiques, liées aux circonstances de l’écriture de cette pièce, la référence à cet artiste «symboliste» n’est pas fortuite. Complexité et évidence des relations colorées où se marient des teintes a priori incompatibles, rythmes des formes où plages floues et couleurs brumeuses forment contraste avec des traits incisifs et des à-plats vivement colorés trouvent leur équivalent dans les architectures et dans la palette harmonique de la musique. En dépit de son instrumentation réduite, La Barque mystique est véritablement «orchestrée». C’est une orchestration miniaturisée, qui fonctionne comme une pièce d’horlogerie. Les instruments changent de rôle à chaque instant, les alliages varient sans cesse, le tout devant concourir à l’édification de formes globales. L’effet final, comme dans tout mouvement d’horlogerie, dépend d’une extrême précision de l’exécution – dans les hauteurs, micro-tonales, dans les rythmes, avec leur tempo fluctuant, et dans les timbres. Odilon Redon: La Barque mystique (~1890–1895) Pastel on wove paper 51 x 63.5 cm The Woodner Collection, New York 67 Tombeau in memoriam Gérard Grisey pour piano et percussion (1999) Philippe Hurel Quand Gérard Grisey nous a quittés, j’avais commencé à écrire la pièce pour piano et vibraphone commandée par le Shizuoka Hall. Le ton en était enjoué. L’immense tristesse dans laquelle je me trouvai brusquement me fit abandonner le projet initial dont il ne reste que l’effectif instrumental. Comment rendre hommage à Gérard sinon en essayant d’écrire ma propre musique: il n’y aurait donc pas de citations ni d’influences repérables. Pourtant, la violence du solo de piano de Vortex Temporum de Grisey fut le point de départ. Ainsi, je refusai de lire la partition tout en me servant de la force du solo comme d’une métaphore possible. Je n’avais jamais été confronté à ce type de travail. La pièce prit rapidement l’allure d’un rituel et le vibraphoniste se vit attribuer de nombreux instruments supplémentaires comme les cloches à vache, les gongs thaïlandais, les crotales, le tambour de bois … autant de moyens pour «perturber» le piano sans le désaccorder comme l’avait fait Grisey. Pour la première fois, ma musique ne sera pas objective, ainsi que la qualifiait Gérard. J’ai eu beaucoup de mal à en calculer le matériau et mon abandon par instant à l’intuition la plus complète n’aurait peut-être pas plu à son dédicataire. Pourtant, c’est bien l’esprit de Gérard qui règne dans cette pièce; je n’aurais pu l’écrire sans lui. «Au fond, nous avons beau faire, nous sommes tous des êtres collectifs; ce que nous pouvons appeler notre propriété au sens strict, comme c’est peu de chose! Et par cela seul, comme nous sommes peu de chose! Tous, nous recevons et nous apprenons, aussi bien de ceux qui étaient avant nous que de ceux qui sont avec nous…» (Johann Wolfgang von Goethe, 17 février 1832) 68 Vortex Temporum pour piano et 5 instruments (1994–1996) Gérard Grisey Le titre: Vortex Temporum («Tourbillon de temps») définit la naissance d’une formule d’arpèges tournoyants répétés et sa métamorphose dans différents champs temporels. J’ai tenté ici d’approfondir certaines de mes recherches récentes sur l’application d’un même matériau à des temps différents. Trois ‹Gestalten› sonores: un événement originel – l’Inde sinusoïdale – et deux événements adjacents – l’attaque avec ou sans résonance et le son entretenu avec ou sans crescendo –; trois spectres différents: harmonique, inharmonique «étiré» et inharmonique «comprimé»; trois temps différents: ordinaire, plus ou moins dilaté et plus ou moins contracté, … tels sont les archétypes qui président à Vortex Temporum. Outre la formule tourbillonnaire initiale directement issue de Daphnis et Chloé, le vortex m’a suggéré une écriture harmonique centrée sur les quatre notes de la septième diminuée, accord rotatif par excellence. En effet, en considérant tour à tour chaque note de l’accord comme note sensible, il permet de multiples modulations. Bien entendu, il ne s’agit pas ici de musique tonale, mais bien plutôt de saisir ce qui dans son fonctionnement est encore aujourd’hui actuel et novateur. Ainsi, cet accord est ici à l’intersection de trois spectres précédemment décrits et en détermine les différentes transpositions. Il joue donc un rôle nodulaire dans l’articulation des hauteurs de Vortex. On le retrouve littéralement inscrit dans les quatre fréquences du piano accordées un quart de ton plus bas, cette atteinte au sacro-saint tempérament du piano rendant à la fois possible une distorsion du timbre de l’instrument et une meilleure intégration aux différents micro-intervalles nécessaires à la pièce. Dans Vortex Temporum, les trois archétypes précités vont circuler d’un mouvement à l’autre dans des constantes de temps aussi différents que celui des hommes (temps du langage et de la respiration), celui des baleines (temps spectral des rythmes du sommeil) et celui des oiseaux ou des insectes (temps contracté à l’extrême où s’estompent les contours). Ainsi grâce à ce microscope imaginaire, une note devient timbre, un accord devient complexe spectral et un rythme une houle de durées imprévisibles. Les trois sections du premier mouvement, dédié à Gérard Zingsstag, développent trois aspects de l’onde originelle, bien connus des acousticiens: l’onde sinusoïdale (formule tourbillonnaire), l’onde carrée (rythmes pointés) et l’onde en dents de scie (solo de piano). Elles déroulent un temps que je qualifierais de jubilatoire, temps de l’articulation, du rythme et de la respiration humaine. Seule, la section de piano nous porte aux limites de la virtuosité. Le deuxième mouvement, dédié à Salvatore Sciarrino, reprend un matériau identique dans un temps dilaté. La ‹Gestalt› initiale s’entend ici une seule fois, étalée sur toute la durée du mouvement. J’ai cherché à créer dans la lenteur une sensation de mouvement sphérique et vertigineux. Les mouvements ascendants des spectres, l’emboîtement des fondamentaux en descentes chromatiques et les filtrages continus du piano, génèrent une sorte de double rotation, un mouvement hélicoïdal et continu qui s’enroule sur lui-même. 1 Dans: CD Gérard Grisey: Vortex Temporum, Talea. Ensemble recherche.– Accord Una Corda /WDR, 1996. Reproduit avec l’autorisation de Naïve. 69 Au premier mouvement qui développe dans la discontinuité les différents types ondulatoires, le troisième mouvement, dédié à Helmut Lachenmann, oppose un long processus permettant de créer entre les différentes séquences les interpolations qui paraissent impensables. La continuité s’impose peu à peu et avec elle, le temps dilaté devenu une sorte de projection à grande échelle des événements du premier mouvement. La métrique déjà malmenée au cours du premier mouvement est ici souvent noyée dans le vertige de la durée pure. Les spectres à l’origine du discours harmonique et déjà développés dans le second mouvement, s’étalent ici, afin de permettre à l’auditeur d’en percevoir la texture et de pénétrer dans une autre dimension temporelle. Le temps contracté fait aussi son apparition sous la forme de saturations fulgurantes et permet de réentendre à une autre échelle les différentes séquences du troisième mouvement. Entre les différents mouvements de Vortex Temporum sont prévus de courts interludes. Les quelques souffles, bruitages et ombres sonores qu’on y entend sont destinés à colorer discrètement le silence malhabile et quelquefois même, la gène involontaire des musiciens et des auditeurs qui reprennent leur souffle entre deux mouvements. Ce traitement du temps de l’attente, ce pont jeté entre le temps de l’auditeur et celui de l’œuvre, n’est pas sans rappeler ceux de Dérives, de Partiels ou de Jour, Contre-jour. Ici, bien entendu, ces quelques bruits ne sont pas sans rapports avec la morphologie de Vortex Temporum. Abolir le matériau au profit de la durée pure est un rêve que je poursuis depuis de nombreuses années. Vortex Temporum n’est peut-être que l’histoire d’un arpège dans l’espace et dans le temps, en-deçà et au-delà de notre fenêtre auditive et que ma mémoire a laissé tourbillonner au gré des mois dévolus à l’écriture de cette pièce. Vortex Temporum est une commande jointe du Ministère de la Culture, du Ministerium für Kunst Baden-Württemberg et de la Westdeutscher Rundfunk Köln, à la demande spécifique de l’Ensemble Recherche. En outre, je tiens à remercier la Fondation Henry Clews et la Fondation des Treilles qui m’ont accueilli dans un lieu propice à la composition de cette pièce. 70 Im Strudel der Zeiten Gérard Griseys «Vortex Temporum» (1993) Frank Hilberg Vortex temporum ist ein überaus imaginativer Titel. Vortex, vertex, vertigo; Wirbelnde Winde, strudelnde Schlünde; wirbeln, kreiseln, rotieren, tanzen; Woge, Welle, Drift. – Wirbel oder Strudel? «Vortex» ließe sich in beide Richtungen übersetzen, doch scheint die Bewegungsenergie von Griseys Musik eher dem kontinuierlichen fließenden, aquatischen Element zu gleichen als dem Wirbeln der Luft, die in raschen Wechseln und plötzlichen Böen umherkapriolt. Vortex temporum ist ein bemerkenswertes Stück, ein Meilenstein der Kammermusik am Ende des vergangenen Jahrtausends. Bemerkenswert nicht allein durch seine Ausdehnung (die nie das Gefühl der Länge aufkommen lässt), sondern durch die Vielzahl der Kreuz- und Querbezüge innerhalb des Werkes. Gérard Grisey hat sein musikalisches Material in so vielschichtiger Weise ausgeprägt, dass alles – auch das scheinbar weit voneinander entfernt Liegende – wie aus einer gemeinsamen Idee geschöpft scheint. Das Werk für sechsköpfiges Ensemble (Flöte, Klarinette, Violine, Viola und Violoncello und einen solistisch herausgestellten Pianisten) entstand in den Jahren 1994 bis 1996. Es ist in drei Teile gegliedert, die je von einem Interludium abgeschlossen werden. Der besseren Übersicht willen hier zunächst ein kurzer Überblick (die Zeitangaben sind nur Anhaltspunkte zur Verdeutlichung der ungefähren Proportionen): I. Teil 3 Abschnitte: A. Drehfigur, Bläser und Klavier (3') B. Variationen über einen Rhythmus, Streicher (5') C. Klaviersolo. 3 Minuten Interlude 1 Zarte, ratternde Geräuschklänge (1,5') II. Teil Langsame Drehfigur, verschieden instrumentiert (8') Interlude 2 Zart rauschende Streicherklänge (1') III. Teil Beginnt wie Teil I, langgestreckter Prozess (16') Interlude 3 Eigentlich ein Postludium. Ausklang des Stücks (2') Mit Gérard Grisey hat ein neues Kapitel der Musikgeschichte begonnen – ein französisches, denn die Art dieses Komponierens und Denkens blieb für mehrere Jahre innerhalb der Grenzen Frankreichs, wo die Priorität des Klanglichen (vor dem Konstruktiven, dem Polyphonen, dem Melodischen) allerdings eine eigene, 71 lange Tradition hat. Grisey wurde am 17. Juni 1946 in Belfort geboren und ist im Alter von 52 Jahren am 11. November 1998 in Paris gestorben. Er erhielt seine musikalische Ausbildung 1963–1965 am Konservatorium in Trossingen und 1968–1972 bei Olivier Messiaen am CNSM in Paris. Weitere Studien bei Henri Dutilleux, Seminare bei Karlheinz Stockhausen, György Ligeti und Iannis Xenakis in Darmstadt 1972 rundeten seine Erfahrungen ab. 1973 gründete er zusammen mit Huques Dufourt, Tristan Murail, Michaël Lévinas und Roger Tessier die «Groupe de l’Iterinaire», eine Arbeitsgemeinschaft von Komponisten und Interpreten die der Ästhetik des «Spektralismus» verpflichtet war. In den 1980er Jahren wurde er Dozent in Kalifornien und Paris. Sein Buch Musique et psychologie (Paris 1986) wurde sehr einflußreich. «Wir sind Musiker, und unser Modell ist der Klang und nicht die Literatur, der Klang und nicht die Mathematik, der Klang und nicht das Theater, die bildenden Künste, die Quantenphysik, die Geologie, die Astrologie oder die Akupunktur!» Mit diesen Worten macht Grisey unmissverständlich klar, dass Ausgangspunkt und Endzweck seines Komponierens stets der Klang selber ist und keine darüberhinausgehenden Botschaften, Weltanschauungen, Befindlichkeiten oder sonstiges anderes. Stets geht er von klanglich-akustischen Phänomenen aus, die er innerhalb der musikalischen Sphäre formuliert. «Der Titel Vortex Temporum bezeichnet die Entstehung einer Formel aus sich drehenden und wiederholenden Arpeggien und ihre Metamorphose in verschiedenen Zeitfeldern.» – Grisey spricht hier bereits die Bedeutung der Zeit an, genauer gesagt mehrerer Zeiten – denn der Komponist legt Schichten verschiedener Zeiten an. Um sie gut voneinander abheben zu können, beschränkt er sich auf ein reduziertes Material aus dem er all seine «Gestalten» (eines der wenigen französischen Lehnwörter aus dem Deutschen) ableitet. Im Wesentlichen unterscheidet er drei mal drei «Archetypen»: – drei klangliche Gestalten: a) Sinusschwingung (ein «Ur-Ereignis»), b) Impuls (mit oder ohne Nachhall) und c) gleichbleibender Klang (mit oder ohne Crescendo); – drei verschiedene Spektren: a) Obertonfolgen, b) ausgedehntes und c) komprimiertes «Inharmonique»; – drei verschiedene Tempi: a) mittel, b) breit oder c) kontrahiert. «In den drei Sätzen kreisen die drei genannten Archetypen in Zeit-Konstanten, die so verschieden sind wie die des Menschen (Sprach- und Atemzeit), der Wale (Spektralzeit der Schlafrhythmen) sowie der Vögel und Insekten (extrem kontrahierte Zeit mit verwischten Konturen). Durch dieses imaginäre Mikroskop wird eine Note zur Klangfarbe, ein Akkord zum Spektralkomplex und ein Rhythmus zum Konglomerat von unvorhersehbaren Dauern.» (Grisey) Die anfängliche «Drehformel» ist ein Zitat aus Maurice Ravels Ballett Daphnis et Chloé, eine Reverenz an einen Komponisten, der ebenfalls sehr genau wußte, wie man beim Hörer Schwindelgefühle erzeugt. Eine der vielen Arten Griseys den Hörer taumeln zu lassen, liegt darin, vier (der 88) Töne des Klavieres gezielt um einen Viertelton nach unten zu verstimmen. Der Effekt ist in etwa so wie eine Alltagsunfallerfahrung, die wohl jeder kennt: steigt man eine Treppe hinab und eine der Stufen ist ein weniges tiefer als erwartet, so kann man leicht das Gleichgewicht verlieren und hinabstürzen – eine gehörige Adrenalinausschüttung ist jedenfalls garantiert. Es war Gérard Zinsstag, der bemerkte, wie genau kalkuliert die «verstimmten» Töne in dem Stück auftauchen: der Erste nach dreieinhalb Minuten, der Zweite nach vier Minuten, der Dritte nach sechseinhalb, der Vierte erst nach zehneinhalb Minuten! Nicht von ungefähr kennt Zinsstag dieses Stück sehr gut; der erste Teil ist ihm gewidmet. Und zuvor hatte sich Grisey Zinsstags Stück Tempor 72 (für die gleiche Besetzung) genauer angesehen. Gérard Zinsstag: «Es herrscht zwischen uns ein Einvernehmen, das auf gemeinsamen gastronomischen und önologischen Sympathien beruht, sowohl als auf dem Anerkennen und dem Risiko, das jeder Komponist eingeht oder eingehen sollte und das man auf folgende lapidare Formel reduzieren kann: ein Komponist, der zu wagen weiß, ist ein guter Komponist. Als ich das neue Stück hörte, dessen ungewöhnliche Dauer mich sofort frappierte, geriet ich in Bewunderung über soviel symphonischen Erfindungsreichtum, musikalische Souveränität und ästhetisches Wagnis.» Die drei Abschnitte des ersten Teils sind elementaren Schwingungsformen der Akustik nachempfunden, der Sinusschwingung, der Rechteckschwingung und der Sägezahnschwingung. Den Sinuskurven ist die Kontur einer gleichförmigen Welle zu eigen, die man in den Spielfiguren des Beginns unschwer wiedererkennen kann. Der zweite Abschnitt (Rechteckschwingung) ist durch einen Rhythmus gekennzeichnet, der Pausen bzw. Haltetöne durch Sechzehntelaktivitäten trennt. Die Sägezahnschwingung (eine Kurve die dem Versuch von Kindern ähnelt, Haifischzähne zu zeichnen) sind in dem Klaviersolo nachgezeichnet, wo Akkorde aus den tiefen Lagen «schräg» in die hohen Lagen laufen und dann unvermittelt abstürzen. Diese Schwingungsformen «verlaufen in einem Tempo, das ich als jubilierend bezeichnen würde – das Tempo der Artikulation, des Rhythmus und des menschlichen Atmens.» Der zweite Teil ist dem italienischen Komponisten Salvatore Sciarrino gewidmet. Auch er zeigt sich mit einer Gegenwidmung erkenntlich: «Das Rascheln von ein paar Sandkörnchen, die der Wind fortträgt, erkannte die steinernen Berge wieder, grüßte sie, und diese bedankten sich. Nun grüßen die Berge das Rascheln des Sandes, und dieser bedankt sich.» Ganz in der bescheiden-selbstbewußten, poetischen Art, in der Sciarrino die Welt zu betrachten pflegt. In diesem zweiten Teil nimmt Grisey das bereits bekannte Material in gedehntem Tempo wieder auf. Die Anfangsgestalt ist hier nur einmal, über die ganze Dauer des Satzes gestreckt zu hören – das sind immerhin knapp acht Minuten. Hier ist eines der Grundprinzipien des Spektralismus angewendet: die Längung (oder Verkürzung) einer Figur um Maßstäbe in erklecklicher Größe. Was eben eine achtel Sekunde dauerte, kann jetzt acht Minuten währen. Mikrokosmos reicht dem Makrokosmos die Hand. Für die Wahrnehmung hingegen sind die Unterschiede gigantisch. So extrem wie der Flügelschlag eines Kolibris im Vergleich zum Flossenschlag eines Wales. «Ich habe versucht, in der Langsamkeit den Eindruck von sphärischer, schwindelerregender Bewegung zu schaffen. Die aufsteigenden Bewegungen der Spektren und das Versinken der Grundtöne in chromatischen Abwärtslinien und die fortwährende Filtrierung im Klavier bewirken eine Art doppelter Rotation, eine helikoidale [schraubenförmige] und kontinuierliche Bewegung, die sich um sich selber dreht.» (Grisey) Zwischen den Sätzen von Vortex Temporum sind kurze Zwischenspiele eingeschoben, die aus luftholenden Momenten, aus hauchenden Fermaten bestehen. Luftgeräusche, wehendes Scharren und wispernde Klänge «sollen die unfreiwillige Stille färben, die entsteht, wenn Musiker und Zuhörer zwischen zwei Sätzen Atem holen.» (Grisey) Nicht von ungefähr sind es Klänge, die den Werken Helmut Lachenmanns entlehnt sind, denn Grisey selbst hatte zuvor fast nie Instrumentalgeräusche verwendet. Der ganze dritte Teil ist Lachenmann gewidmet (und unausgesprochen wohl auch die Interludien). Sie zeugen von einer Wertschätzung, die auf Gegenklang stößt. Helmut Lachenmann: «Griseys Musik: geheimnisvolles Vehikel – ohne Geheimnisse – für leuchtende Reisen des Hörens in die Verwandlung. Lustvoll irritierende Erfahrung von Klang und Zeit – sich ständig transformierend, zerfallend und sich kristallisierend: Phönix und Asche zugleich. Griseys Musik macht die Sinne und den Geist jedes mal auf andere Weise staunen – und sie staunt selbst mit.» 73 Dieser dritte Teil beginnt mit den bereits vom Anfang bekannten Figuren, die aber rasch einen anderen Verlauf nehmen und einem langen Entwicklungsprozess unterliegen. Die Ereignisse des ersten Satzes sind – es läßt sich erst nach und nach feststellen – in größerem Maßstab projiziert. Aber auch bereits im zweiten Satz durchgeführte Prinzipien – die Umfärbung von Spektren – sind hier auf das Material angewendet. «Die komprimierte Zeit zeigt sich auch im Aufblitzen von übersättigten Momenten, die die verschiedenen Sequenzen noch einmal in einem anderen Maßstab zu Gehör bringen.» So ist das Stück denn die fortwährende Metarmorphose von Figuren, Harmonien und Rhythmen, die unter Mikroskop und Fernglas ganz verschiedenes Aussehen annehmen, die aber als «Gestalt» eine charakteristische Ausprägung haben, die dem ganzen Werk Form und Dauerhaftigkeit verleihen. «Vortex Temporum ist vielleicht nicht mehr als die Geschichte eines Arpeggios im Raum und in der Zeit, diesseits und jenseits unseres Hörfensters. Ein Arpeggio, das mein Gedächtnis nach dem Willen der Monate, in denen dieses Stück niedergeschrieben wurde, aufgewirbelt hat.» (Grisey) 74 Geschichte und Geschichtslosigkeit Peter Niklas Wilson «Vortex temporum ist vielleicht nicht mehr als die Geschichte eines Arpeggios im Raum und in der Zeit, diesseits und jenseits unseres Hörfensters. Ein Arpeggio, das mein Gedächtnis während der Monate, in denen das Stück niedergeschrieben wurde, emporgewirbelt hat.» (Gérard Grisey) Das Arpeggio ist eine der vertrautesten Klangchiffren der abendländischen Musik. Es ist ein Zwitter zwischen Harmonik und Melodik: die horizontale, sukzessive Darstellung der Vertikalen, des simultanen Akkords – und eines der meiststrapazierten musikalischen Mittel, bewährter Erzeuger akustischer Füllmasse, sattsam bekannt aus Klavieretüden und Salonmusik-Miniaturen gleichermaßen wie der orchestralen Breitwand von Filmmusiken und den unendlichen Pattern-Mustern von Minimal-Partituren oder New-Age-Meditationstapeten. Ein Komponist, der heute das Arpeggio zum Thema eines vierzigminütigen Stücks Kammermusik macht und als Komponenten dieses Arpeggios obendies noch die vier Töne des verminderten Septakkords, jenes besonders verschlissenen Klischees romantischer Modulationskünste, wählt, ist entweder bodenlos naiv – oder aber besonders raffiniert. Wer Gérard Griseys Musik kennt, darf getrost Letzteres annehmen. Wohl ist das Ausgangsmaterial das banalste, das man sich vorstellen mag. Doch eben auf der Basis des Allzu-Vertrauten ist es möglich, ein Wahrnehmungs-Spiel von einzigartiger Subtilität zu inszenieren. «Wir sind Musiker, und unser Modell ist der Klang und nicht die Literatur, der Klang und nicht die Mathematik, der Klang und nicht das Theater, die bildenden Künste, die Quantenphysik, die Geologie, die Astrologie oder die Akupunktur!» Mit solchen Worten proklamierten Gérard Grisey und seine Mitstreiter der «Groupe de l’Itinéraire» eine neue Ästhetik des Klangs, des reinen, von Geschichte und Geschichten befreiten sonoren Materials. Der Essay, dem diese polemische Formulierung entstammt, nannte sich programmatisch «La Musique – le devenir des sons» – «Die Musik: das Werden der Klänge». Und wenn Gérard Griseys Musik etwas erzählt, dann eben dies: die Genese, Transformation und Destruktion von Klängen, oder, wie Grisey sagt: «Mit einer Geburt, einem Leben und einem Tod ähnelt der Klang einem Lebewesen. Die Zeit ist seine Atmosphäre und sein Territorium.» Der Klang als Kreatur: das ist zweifellos ein biologistisches Verständnis des Akustischen, und von der Biologie ist es in Griseys Denken dann auch nicht weit zur Ökologie: «Es ließe sich von einer Ökologie des Tons als einer neuen Wissenschaft träumen, die den Musikern zu Gebote stünde.» Eine «Ökologie der Klänge», wie Gérard Grisey sie begriff, ist ein Zwitter von Biologie und Poesie, von High Tech und Archaik, von nüchterner akustischer Analyse des Klanggewebes und der Inszenierung sonorer Rituale in den Grenzbereichen der Wahrnehmung. Vortex temporum, der «Wirbel der Zeit», ist die Geschichte eines Arpeggios, seine Metamorphose in verschiedenen Zeit-Schichten, und letztlich erzählt uns das Stück weniger über das Arpeggio an sich als über unsere Art, Klänge in verschiedenen «Zeitfenstern» zu hören. Die Dreizahl spielt eine tragende Rolle in der Konstruktion: In drei Sätzen entfaltet Gérard Grisey seine Zeit-Leinwände. 75 Drei Klanggestalten prägen das Stück: die Welle, der Impuls und der gehaltene Ton. Drei Typen harmonischer Spektren bringt Grisey ins Spiel: das reine Spektrum der Obertonreihe, gedehnte und gestauchte Spektren – Techniken, die nicht nur eine Umstimmung des Klaviers, sondern auch das mikrotonale Spiel von Bläsern und Streichern erfordern. Und drei Zeit- und Tempoebenen gibt es in Vortex temporum: Normale Zeit, verlangsamte und verdichtete Zeit – temporale Schichten, die in Griseys biomorphem Musikdenken wiederum mit verschiedenen Lebensformen assoziiert sind: «In den drei Sätzen kreisen die drei Archetypen in Zeitkonstanten, die so verschieden sind wie die des Menschen (Sprach- und Atemzeit), die der Wale (Spektralzeit und Schlafrhythmen) sowie die der Vögel und Insekten (extrem zusammengezogene Zeit). Durch dieses imaginäre Mikroskop wird ein Ton zur Klangfarbe, ein Akkord zum Spektralkomplex und ein Rhythmus zu einer Welle von unvorhersehbaren Dauern.» Wenn uns Gérard Grisey mit Vortex temporum die Geschichte der Wahrnehmung eines Arpeggios erzählt, wie es in verschiedenen Vergrößerungsstufen eines akustischen Mikroskops erscheint – in Originalgröße im Eröffnungssatz, extrem vergrößert im mittleren, hin- und hergezoomt zwischen Diminution und Augmentation im letzten – so kann der Komponist die musikalische Geschichte dieser elementaren Figur doch nicht ignorieren. Und so tritt Grisey die Flucht nach vorn an: indem er die Anfangsfigur von Vortex temporum aus Maurice Ravels Daphnis et Chloé entleiht. Mit seinem Rekurs auf Ravels Arpeggien-Gewebe definiert Gérard Grisey einen Bezug zu einer spezifisch französischen Tradition, doch ohne jede Nostalgie. Das Arpeggio, durch die analytische Brille des Klangforschers Grisey betrachtet, ist zu etwas anderem geworden: «Es handelt sich hier freilich nicht um tonale Musik; es geht vielmehr darum, zu erfassen, was in ihrem Funktionieren an heute noch Aktuellem und Neuem steckt.» Von solchem «Funktionieren» ist Gérard Griseys Musik weit entfernt. Das sprachähnliche, erzählende Moment, das Klang-Geschehen ist in ihr aufs Äußerste zurückgenommen. Auch ilzbläser und drei Streicher? Erst ein Alternieren lange gehaltener Klänge der Bläser- und Streicher-Trios, die fast durchweg als einheitliche Klang-Körper behandelt werden (womit das Sextett, wie Grisey betont, eigentlich als Duo gedacht ist). Dann Bläser allein. Dann Streicher allein. Dann wieder der Wechsel beider, schließlich die Aufsplitterung des Bläser-Korpus in «Duos» und «Soli», die dem nach wie vor kompakten Streicher-Block gegenübertreten. So lapidar ließe sich die «Geschichte» dieser halben Stunde Musik wiedergeben, die gerade acht Partiturseiten in Anspruch nimmt. Die Kargheit dieses Resümés deutet an, dass Entscheidendes in dieser Musik anderswo zu suchen ist. Zum Beispiel in der Zerbrechlichkeit der multiphonen Bläser-Klänge und der nicht minder instabilen Streicher-Flageoletts, fragiler sonorer Elemente, deren nie gänzlich von den Spielen zu beherrschende Eigendynamik ein mikroskopisches Leben in die Töne hineinbringt, das die langen, statischen Notenwerte des Partitur-Textes Lügen straft. Zum Beispiel in der Dramaturgie von Klang und Stille, die mit bis zu achtzigsekündigen Pausen so weit getrieben ist, dass sie die Wahrnehmung immer wieder an den Rand dessen treibt, was noch als Klang-Zusammenhang, als MusikStück zu erfahren ist. Dieser Grenzgang wagt zugleich Extreme in der Balance von Ensemble-Klang und Eigen-Klang des Aufführungsraums, des Publikums, des akustischen Ambientes. Oder, wie Gérard Grisey in anderem Zusammenhang formulierte: «Die Musik ist Körper und Projektionsfläche zugleich. Ich begreife das Hören als eine eigene Bewegung und somit ist [die Musik] auch die Erkundung dessen, was es heißen könnte, das Hören bei sich selbst bleiben zu lassen.» 76 Pierre Boulez leitet eine Probe des Ensemble intercontemporain. Photo: Aymeric Warme Janville 77 Professor Bad Trip Mercredi / Mittwoch /Wednesday 23.11.2005 20:00 Salle de Musique de Chambre Ictus Ensemble Georges-Elie Octors direction Michael Schmid flûtes Dirk Descheemaeker clarinette Philippe Ranallo trompette Igor Semenoff violon Paul Declerck alto François Deppe violoncelle Tom Pauwels guitare, banjo Gery Cambier guitare basse Miquel Bernat percussion Jean-Luc Plouvier piano Alexandre Fostier régie son Tom Bruwier régie lumière Fausto Romitelli: Professor Bad Trip (1998–2000) Lesson I Lesson II Lesson III 45’ Backstage: Mercredi / Mittwoch /Wednesday 23.11.2005 21:00 Espace Découverte Conférence publique avec Jean-Luc Plouvier (en français / Publikumsgespräch in französischer Sprache) Mercredi / Mittwoch /Wednesday 23.11.2005 21:30 Espace Découverte «Bad Club» Mad Fred / Grand Duchy Grooves: Romitelli remix session Daniel Neumanns visuals 78 Le Professeur Bad Trip et sa leçon de Chose Jean-Luc Plouvier «Depuis que je suis né, je baigne dans les images digitalisées, les sons synthétiques, les artefacts. L’artificiel, le distordu, le filtré – voilà ce qu’est la Nature des hommes d’aujourd’hui», dit Fausto Romitelli, né à Milan en 1963. A 28 ans, le compositeur s’installe à Paris pour suivre les cours d’informatique musicale à l’Ircam. Il étudie les techniques «spectrales» initiées par Gérard Grisey et Tristan Murail: élaboration de complexes sonores où fusionnent harmonie et timbre; simulation acoustique des sons électroniques; modélisations «surréelles», par l’écriture, des phénomènes acoustiques sous formes de torsions, compressions, dilatations de la matière musicale. Ce grand chantier dédié à la plasticité du son, Romitelli en perçoit rapidement la possible liaison avec l’univers du rock alternatif et psychédélique. Une musique dont l’énergie, l’impureté, le recours impatient et anarchique aux artifices électroniques subjuguent plus d’un compositeur: de plain-pied dans l’époque et contre l’époque, cette musique délivre une charge de violence apparemment inintégrable par la musique d’écriture. Que faire de ça? Qu’on la cite, qu’on la pastiche, et on reste au seuil. On préfèrera dès lors la bouder, en feignant de croire qu’elle appartient totalement à la stratégie marchande; on sait pourtant que c’est faux. C’est armé des notions spectrales de «sons inharmoniques», de «filtrages fréquentiels», de «distorsion du spectre», que Romitelli entame sa négociation. La seule qui compte pour lui: s’approprier froidement ce délire-là sans renier son métier. Sans recourir à l’improvisation ni à la simplification, il élabore méticuleusement, au fil des œuvres, un style instrumental qui accueille toutes les ressources du son sale, les phrasés capricieux des ‹guitar-heroes› et toutes les mutations harmoniques de la clarté vers l‘absolue distorsion. Dans le cycle Bad Trip que nous présentons sur ce disque, sa poétique «obsessionnelle, répétitive et visionnaire» (ce sont ses termes) est en place. On peut y voir le Manifeste de Romitelli, qu’il place sous l’étoile d’Henri Michaux. Inspirée des descriptions par le poète des effets de la mescaline, la musique de Bad Trip procède par flux et reflux, rafales de vagues de plus en plus denses et de moins en moins stables: pureté harmonique d’abord, puis longue montée des scories et du désordre. Les processus à l’œuvre dans Bad Trip s’enracinent toujours dans de courtes et naïves propositions, des «complexes» de bribes mélodiques un peu glissantes , d’harmonies séduisantes et fragiles, de brèves ornementations exaltées comme des soupirs. Sans avoir le temps de se déployer, ce matériel est d’emblée pris de secousses. Il se répète, mais on comprend qu’il était mutant, infesté de virus: il devient monstre. Les éléments du complexe s’hystérisent, se maniérisent et développent des métastases expressives, chacun pour son compte. L’harmonie s’alourdit, se surcharge; le son se sature; les glissandi s’amplifient et parcourent tout le spectre sonore, le temps musical se contracte… La musique de Bad Trip ne se ‹développe› jamais: elle s’aggrave. «L’artificiel, le distordu, le filtré»: c’est de cette Nature dévoyée que traitent les Leçons du Professeur Bad Trip, aussi étrangères à la mélancolie qu’à l’optimisme technologique. Les pionniers de la musique électro-acoustique évoquaient 79 1 Eric Denut: «Fausto Romitelli. A short index» 2 ibidem aisément «l’infini des possibles» et les «ressources inouïes» de l’art de «composer le son». Au pays du Bad Trip, on n’en est plus là, serait-ce même sous la forme d’un deuil. Comme le repère finement Eric Denut, l’élément du timbre chez Romitelli ne se donne plus comme ressource infinie, mais comme agent mutilateur.1 Là où se cherche la mise en forme par la reprise, la paraphrase et l’amplification, l’élément «timbre» défait les promesses et contredit les attentes en imposant d’improbables mutations, «figure abominable et indomptable»2. En exergue de la partition de Professeur Bad Trip, Fausto Romitelli place ce paragraphe de Connaissance par les gouffres d’Henri Michaux: «Une vaste redistribution de la sensibilité se fait, qui rend tout bizarre, une complexe continuelle redistribution de la sensibilité. Vous sentez moins ici, et davantage là. Où «ici» et «là»? Dans des dizaines d’«ici», dans des dizaines de «là», que vous ne connaissiez pas, que vous ne reconnaissez pas». 80 Ictus Ensemble Photo: Ictus 81 Mad Fred Photo © Tim Lecomte 2005 82 Bad Club Romitelli remix session Mad Fred Resident DJ at The Elevator Bar in Luxembourg, Mad Fred plays everything from punk and new wave to electro, acid, house and hip-hop. His style is bouncy, infectious and dangerously rhythmical. His main influences are DJs and producers like Tiefschwarz and DJ Hell. In summer 2005 he did a small tour through India with renowned DJs as Rainer Klang and Ferenc. Later he played in Berlin and opened for international acts like Stereo MC’s and Vitalic. Besides deejaying, he launched in January 2005 Luxembourg’s first electronic music Label «Grand Duchy Grooves», which released the Top Ten Single It’s in you by Fano feat. Willi Sun. He also produces electronica under his pseudonym «project m» and was featured on several compilations. The Bad Club Sessions are a mixture of his both identities: half live-set and half dj-session, using samples from Romitelli’s work and mixing it with experimental electro-sounds. Mad Fred will integrate some of his new songs and will take the audience on to a journey into mind-tickling music. Be prepared! 83 Classiques du XXe siècle Vendredi / Freitag / Friday 25.11.2005 20:00 Grand Auditorium Orchestre Philharmonique du Luxembourg Pierre-André Valade direction Gérard Caussé alto René Mertzig: Poèmes (1945 / 1946) I Cerisiers en fleurs III Vendanges mosellanes IV Flocons de neige vers la Noël 25’ Tristan Murail: Gondwana (1980) 17’ — Hugues Dufourt: Le Cyprès blanc (2004; commande de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg) 30’ Richard Wagner: Götterdämmerung. Siegfrieds Rheinfahrt (1876) 11’ Backstage: Vendredi / Freitag / Friday 25.11.2005 19:30 Introduction avec Hugues Dufourt et Olivier Frank (en français / Publikumsgespräch in französischer Sprache) En collaboration avec LGNM et IBM 84 Chers invités, Chers amis des «Classiques du XXe siècle», L’édition 2005 des «Classiques du XXe siècle» est marquée par deux changements importants. D’abord c’est la Philharmonie qui nous accueille pour la première fois dans sa salle de concert prestigieuse. Aussi c’est la première fois que le concert traditionnel IBM est intégré au sein du festival de musique contemporaine: «rainy days». Ainsi non seulement les invités de la société IBM Luxembourg, mais également les mélomanes luxembourgeois et amateurs de musique contemporaine ont la possibilité de participer à cet événement musical très particulier. Ces innovations se sont réalisées néanmoins dans une certaine continuité. En effet, la société IBM reste le sponsor unique de ce concert et la Société Luxembourgeoise de Musique Contemporaine (LGNM – Lëtzebuerger Gesellschaft fir Nei Musek) reste responsable pour la programmation musicale. Et, comme depuis la première édition en 1985, c’est l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg qui nous présentera avec virtuosité les œuvres musicales. Cette année nous vous présentons pour la première fois une œuvre d’un de nos «classiques du XXe siècle», en l’occurrence le Poème pour orchestre du compositeur luxembourgeois René Mertzig. Né à Colmar Berg en 1911, René Mertzig a étudié le violon, le piano, et la composition au Conservatoire Royal de Bruxelles. Dès sa fondation par Henri Pensis en 1933, Mertzig fut membre de L’Orchestre Symphonique de Radio-TéléLuxembourg comme violoniste, puis comme pianiste et accompagnateur jusqu’en 1976, année de sa retraite. Il est mort le 17 septembre 1986 à l’age de 75 ans. Pour René Mertzig, qui avait étudié en compositeur et musicien chevronné de manière détaillée toutes les évolutions historiques de l’écriture musicale, la forme et la structure devaient, avant tout, être au service du contenu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’occupant allemand avait banni d’innombrables compositeurs, et non des moindres, des salles de concert. Quelle révélation pour un jeune musicien fût alors, à la libération, la découverte des coloris chatoyants, tantôt sensuels, tantôt transparents et raffinés de l’orchestration d’un Claude Debussy ou d’un Maurice Ravel. Cette empreinte devait à tout jamais se greffer sur son bagage classique qui englobait Richard Strauss, Hector Berlioz et Manuel de Falla. C’est ainsi qu’à l’âge de 34 ans, René Mertzig composa en 1945 son Poème en quatre mouvements pour grand orchestre. La création fût réalisée par l’Orchestre Symphonique de l’INR (Institut National Belge de Radiodiffusion) sous la direction de son chef Franz André. L’œuvre de Mertzig comporte une trentaine d’œuvres dont en majeure partie, des pièces pour grand orchestre, jouées et enregistrées par l’Orchestre Symphonique de RTL. Mais hélas, son opéra Lëtzebuerger Rousen, composé en 1952 en langue luxembourgeoise attend toujours sa création! La LGNM a publié dans ses Editions trois CD présentant des œuvres de René Mertzig: la Rhapsodie Chorégraphique, le Konzertstück pour trombone et orchestre, le Quatuor à cordes, le Trio à clavier N° 2 et les Trois esquisses pour orchestre à cordes. À part la création artistique en tant que telle, c’était aussi le statut de créateur qui se trouvait être au cœur des préoccupations de René Mertzig. Rappelons la naissance de la Chambre syndicale des Arts et des Lettres en 1952, fer de lance dans le combat destiné à conférer sa juste place à la création artistique au 85 Grand-Duché. Tous les adhérents à cette Chambre syndicale ont ouvert les portes et ont tracé les chemins aux générations qui les ont suivis. (Michel Stoffel, Lucien Wercollier, Edmond Goergen, René Mertzig et Jules Krüger). Ce fût également René Mertzig l’initiateur de la Société nationale pour la propagation de la musique symphonique en 1955 et plus tard en 1983 il prêta son concours à la fondation de la LGNM. Ce soir nous rendons ainsi hommage à un de nos plus grands compositeurs qui se battait en faveur d’un idéal artistique et humaniste tourné tout entier vers la musique et les autres, au point d’en négliger ses propres intérêts. Au nom de la «Lëtzebuerger Gesellschaft fir Nei Musek» et au nom de IBM Luxembourg nous vous souhaitons une excellente soirée. Marcel Wengler Président de la LGNM Marcel Origer Directeur de IBM Classiques du XXe Siècle 1985 Alban Berg 1986 Erik Satie 1987 Sergueï Prokofieff 1988 Arnold Schoenberg 1989 Charles Koechlin, Ernest Chausson, Francis Poulenc, Albert Roussel 1990 Bohuslav Martinů 1991 Charles Ives, Carl Ruggles 1992 Arthur Honegger 1993 Béla Bartók 1994 Silvestre Revueltas, Heitor Villa-Lobos, Alberto Ginastera, Carlos Chavez 1995 Igor Stravinsky 1996 Aaron Copland 1997 Karl Amadeus Hartmann 1998 Hans Werner Henze 1999 Maurice Ohana 2000 Allan Pettersson 2001 Karol Szymanowski 2002 Einojuhani Rautavaara 2003 Iannis Xenakis 2004 Klaus Huber 86 René Mertzig (1911–1986) Guy Wagner1 Jede Aufführung eines Werkes von René Mertzig macht deutlich, dass er ein Komponist hohen Ranges ist, der seit langem verdient hätte, über die Grenzen des Landes hinaus bekannt zu werden. Auch wenn es eine ganze Anzahl von Tonaufnahmen seiner Kompositionen gibt, so bedurfte es doch der jüngsten Sensibilisierungskampagne, um die Bedeutung des Komponisten der breiteren Öffentlichkeit bewusst zu machen. Immerhin kann René Mertzig jetzt, wie viele seiner Kollegen, erleben, dass die jüngeren Komponisten sich um sein Werk bemühen und ihm die Möglichkeit geben, gehört zu werden. Dies war lange Zeit nicht der Fall, und besonders die sechziger und siebziger Jahre kamen einer großen Durststrecke gleich: Mertzig verstummte, nachdem er lange Jahre hindurch einsame Kämpfe zur Förderung der Luxemburger Musik gefochten hatte. René Mertzig wurde am 11. August 1911 in Colmar-Berg geboren. Durch den Vater kam er in Berührung mit der Musik, später sang er im Kirchenchor; die Gregorianik machte starken Eindruck auf ihn. Seinen ersten Musikunterricht erhielt er am hauptstädtischen Konservatorium. In Brüssel führte er das Studium der Violine und des Klaviers weiter, beschäftigte sich aber vor allem mit Komposition. Besonders die französischen Impressionisten sollten ihn beeinflussen. Nachdem er sein Studium in Brüssel erfolgreich abgeschlossen hatte, bewarb er sich um eine Stelle im damals neugegründeten Sinfonieorchester von Radio Luxemburg. Zuerst wirkte er als Violinist, später als Pianist des Orchesters, dem er mehr als 40 Jahre angehörte. Inzwischen hatte er sich mit zahlreichen Initiativen zu einer größeren Verbreitung der Luxemburger Musik vorgewagt. Ihm verdanken wir die Gründung der Société Nationale pour la Propagation de la Musique Symphonique, die einen wichtigen Beitrag zur Förderung des zeitgenössischen Musikschaffens lieferte und zahlreiche Werke zur Aufführung brachte. Des weiteren brachte er den Vorschlag ein, regelmäßig Luxemburger Komponisten im Rundfunkprogramm vorzustellen. Dazu Léon Blasen, der die Sendung moderiert und seit 21 Jahren leitet: Weil ich zu dieser Zeit schon musikalische Sendungen bei Radio Luxemburg machte, sprach ich mit Nic. Weber, dem damaligen Chef der Luxemburger Sendungen, und mit Claude Fischer, der für die musikalischen Programme bei Radio Luxemburg verantwortlich war, über dieses Problem, und es wurde beschlossen, dass ich jeden Monat auf UKW ein Konzert mit zeitgenössischer Musik (sinfonische Werke ausländischer und einheimischer Komponisten) zusammenstellen und vorstellen sollte. Diese Reihe von Konzerten begann am 3. Juli 1960. Als erste bedeutsame Komposition von René Mertzig gelten seine Quatre mélodies pour baryton et orchestre, die 1942 geschrieben wurden und auf drei Texte von Eichendorff und einen von Victor Molitor, dem vormaligen Direktor der Luxemburger Nationallotterie. Der französische Einfluss ist unverkennbar. Die Lieder deuten aber schon den Weg in die Verinnerlichung an, die charakteristisch für René Mertzig werden sollte. Auszug aus: Wagner, Guy: Luxemburger Komponisten heute / hrsg. von der Luxemburger Gesellschaft für Neue Musik. – Luxemburg: Editions Phi (Reihe Musik), 1986 1 87 1945 / 1946 entstand Poème, ein Werk in vier Teilen: Cerisiers en fleurs, le vent, les abeilles; 2. Par une aube de juillet au fil de l’eau; 3. Vendanges Mosellanes; 4. Flocons de neige vers la Noël. In dieser Schöpfung stellt die Spannung zwischen dem Angeeigneten – und wer denkt bei den Titeln nicht schon an Debussy? – und dem Persönlichen das eigentliche Novum dar: Mertzig sucht seine Handschrift. Sie prägt sich schon stärker in den Trois mélodies für Bass und Orchester von 1947, wo vor allem die Klangfarben des Orchesters das feinsinnige Gestaltungsvermögen des Komponisten verdeutlichen. Dieses artikuliert sich noch stärker in der Rhapsodie choréographique aus demselben Jahr. Es handelt sich hier um eine Orchesterfantasie über drei Tanzformen: einen Wiener Walzer, einen spanischen und einen slawischen Tanz. Sie werden miteinander verbunden durch das sensible Klangbild, das Mertzig zu gestalten weiß. Expressionistische Farbigkeit charakterisiert auch den Cycle Symphonique (1950 / 1951), von Léon Blasen zu Recht als Werk der Übergangszeit bezeichnet. Hier erreicht Mertzigs Kunst der Instrumentierung ihren Höhepunkt. Er will sie so leuchtend wie mögliche haben, macht aber gleichzeitig deutlich, dass diese Farbigkeit nicht Selbstzweck ist. Er bindet sie in die formale Struktur der einzelnen Teile dieser sinfonischen Suite ein, die klassisch ist – 1. Toccata; 2. Pantomime grave; 3. Gigue; 4: Menuet gai et burlesque; 5. Finale – und gibt dem Werk eine außerordentliche Dynamik. Sozusagen als Pendant zu diesem veräußerlichten Werk entsteht 1951 ebenfalls ein Trio en mi für Klavier, Violine und Violoncello, das zu seinen ernsthaft-eindringlichsten und feinfühligsten Kompositionen gehört. Wieder im Gegensatz hierzu, die Suche nach der großen Form: die Gestaltung einer Oper mit Ballett auf einen Text von Emile Faber, Lëtzebuerger Rousen. Die von RTL aufgenommenen Auszüge lassen auf die lyrische Grundkomponente des Werkes schließen und auf René Mertzigs Sinn, die Stimmen optimal einzusetzen. Eine zweite Phase in Mertzigs Schaffen kann man mit der Symphonie des Impressions Vives (1953 / 1954) ansetzen. Das Werk besteht aus vier Teilen, von denen das einleitende Andante maestoso ein Leitthema vorstellt, das den ganzen Satz bestimmt, im Finale wieder auftaucht und von großer rhythmischer Prägnanz ist. Der zweite Satz Poco sostenuto entwickelt sich aus zwei kontrastierenden Themen, die polyphon verarbeitet werden und die Klangfarben der Instrumente sehr prägnant zur Geltung kommen lassen. Das Scherzo zielt ganz auf Konzentration hin, während das Finale den Charakter eines großen sinfonischen Marsches hat, der aus dem Leitthema des ersten Satzes erwächst. Mit diesem Werk hat Mertzig eindeutig seinen Stil gefunden. Er beruht auf dem Respekt vor der großen musikalischen Tradition, sowohl was die Formen, als was die Grenzen der Tonalität betrifft. Mertzig will kein Revolutionär sein, kein Neuerer um jeden Preis, vor allem nicht um den der Ehrlichkeit und Authentizität. Und gerade die Ehrlichkeit, die sein Schaffen charakterisiert, macht auch seine Stärke aus. In den folgenden Werken wird seine dialektisch anmutende Arbeitsweise zwischen Suche nach ausdruckstarken Klängen und Hinzielen nach immer größerer Abstraktion sehr deutlich. So bestehen von dem 1954 entstanden Werk La Cité éblouissante zwei verschiedene Fassungen: eine Suite enfantine für Klarinettenquintett und eine Sérénade für acht Instrumente, die auf besondere Klangwirkungen hinzielt. Der Weg in die Verinnerlichung und die Abstraktion führt 1955 zum 2. Trio für Klavier, Violine und Violoncello, das höchste Ansprüche an die Interpreten und Zuhörer stellt, und zu den Trois Esquisses für Streichorchester. Er erhält seine Erfüllung im Quatuor à cordes von 1961. Kenner halten dieses Werk in vier Sätzen mit seinem polyphonen und klanglich-rhythmischen Reichtum für das absolute Meisterwerk der einheimischen Musikproduktion, da es Mertzig hier gelingt, ein wunderbares Gleichgewicht zwischen Intelligenz und Sensibilität, zwischen Kraft und Grazie herzustellen. Diesem Werk gehen zwei Kompositionen auf Texte von Edmond Dune: Enfantines, Poèmes pour récitant et orchestre voraus. Acht Gedichte in Prosa wechseln sich ab mit acht Musikstücken, die Mertzigs persönliche Handschrift klar erkennen lassen. Etwa zur selben Zeit (1958 / 59) entsteht ebenfalls auf einen Dune-Text Le Tambourin et la guitare, ein 88 Quatuor dramatique pour quatre personnages, tambourin et guitare. Die vier Personen sind die Zeit, das Leben, der Mann und die Frau: eine eindringliche Fragestellung um das menschliche Dasein. Mertzigs Schaffen kreist dann, ab 1962 noch stärker um eine neue Sinngebung für alte Formen und exakte Rhythmen. In diesem Jahre entsteht die Rythmes Souverains, deren ganz verschiedenartig gestalteten Teile durch die rhythmische Grundstruktur untereinander verbunden sind. 1963 entsteht ein Konzertstück für Posaune und Orchester, welches das Soloinstrument auf gleiche Ebene mit den Orchesterinstrumenten stellt und neue Dialog-Formen zwischen Solisten und Ensemblemusikern zu verwirklichen sucht. In seiner Synthèse symphonique von 1964 schafft Mertzig dann tatsächlich die Synthese seiner kompositorischen Gedanken: Genau eingesetzte Instrumentalmittel verwirklichen Klangfarben, die Inhalte verdeutlichen, wobei der Akzent auf einer feinsinnigen melodischen Entwicklung liegt, die durch dichte harmonische und prägnante rhythmische Strukturen getragen wird. 1968 entsteht Mertzigs letztes Werk, seine Estampes für Basssolo und Orchester in vier Sätzen, die durch ein sehr schönes Flötensolo eingeleitet werden. Fast karg die Klänge zu Etreintes, dem 2. Satz auf einen Text von Mertzigs Sohn Robert. Der 3. Satz ist dem Schlagzeug sordino vorbehalten, bevor Sang (Blut) eine ausdruckstarke Intensität vermittelt, vor allem, weil Mertzigs Sprache in ihrer Zurückhaltung, ihrer Noblesse und Ehrlichkeit nie exzessiv wirkt. Die Intensität kommt ‹von innen›. Mertzig beweist, wieder einmal, seine künstlerische Reife, seine ganz persönliche Sprache, die gewiss von Strauß, mehr noch von Debussy und Ravel, erlernt ist, aber sehr wohl ihre eigene Diktion gefunden hat. Mertzig meidet jeden ‹billigen› Effekt; auch der stärkste Orchesterausbruch wird noch zurückgenommen. Man könnte Winckelmanns Wort von der ‹edlen Einfalt, stillen Größe› anwenden, um die Grundhaltung dieser Musik zu charakterisieren. Mertzigs Schweigen seitdem ist um so mehr zu bedauern. 89 Gondwana pour orchestre (1980) Tristan Murail1 Comme pour Mortuos Plango, Gondwana explore le domaine des sons inharmoniques. Curieusement, les deux pièces datent d’ailleurs de la même année, sans qu’il n’y ait aucun rapport entre elles, autre que l’utilisation de modèles de cloche, et la mise en forme de relations entre phénomènes sonores. Les cloches de Gondwana sont imaginaires – à la différence de celle de Mortuos Plango. Au début de la pièce, je voulais faire entendre, au moyen de l’orchestre, de larges sonorités de cloches. N’ayant en fait aucun modèle à ma disposition, et ne cherchant d’ailleurs pas à créer la pure imitation d’un objet sonore, j’ai pensé à un procédé technique utilisé en informatique musicale pour produire des sonorités de type cloche: la «modulation de fréquence». Cette technique, mise au point par John Chowning, puis popularisée plus tard par les synthétiseurs Yamaha des séries DX et TX, repose sur l’utilisation de deux sons générateurs appelés «porteuse» (carrier) et «modulante» (modulator). Les fréquences de la porteuse et de la modulante se combinent entre elles pour produire un certain nombre de sons résultants. […] Ces calculs sont évidemment très simples, en tout cas en ce qui concerne les hauteurs résultantes (pour les intensités, c’est plus complexe). En revanche, du point de vue musical, c’est un peu plus compliqué car les calculs étant réalisés en hertz, il va falloir transformer ces fréquences en notes de musique, donc faire l’opération d’approximation à la note de musique utilisable la plus proche. Donc, si on travaille en quarts-de-tons, il s’agira de chercher le quart-de-ton le plus voisin des hauteurs calculées. […] Cette progression est organisée par harmonicité croissante. Il existe en effet un rapport direct entre la qualité plus ou moins consonante ou dissonante de l’intervalle produit par la porteuse et la modulante, et le résultat plus ou moins harmonique ou inharmonique de la modulation. Ainsi, le premier agrégat, étant basé sur l’intervalle dissonant sol dièse – sol, est-il très inharmonique. Puis, les intervalles formés par la porteuse et la modulante devenant de plus en plus consonants, les agrégats orchestraux progressent vers l’harmonicité. […] Dans: Tristan Murail: Modèles et artifices / Textes réunis par Pierre Michel (Extraits des Conférences de Villeneuve-lès-Avignons, 9–13 juillet 1992). – Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2004, p. 119. Reproduit avec l’autorisation de Tristan Murail et des Presses Universitaires de Strasbourg. 1 90 Tous ses agrégats paraissent bien complexes à la lecture, mais ils ne le sont pas autant qu’on pourrait l’imaginer à l’audition. En effet, qu’ils soient issus de modulations de fréquence ou de séries harmoniques, ils ont la particularité de présenter un certain degré de fusion de leurs composantes. Ceci est dû aux relations de fréquences bien précises que ces techniques engendrent, tout autant qu’au jeu des intensités et des timbres. Les intensités des sons résultants d’une modulation de fréquence créée par l’ordinateur sont en effet variables, et sont fonction de la valeur de l’indice de modulation. On peut les calculer précisément au moyen des fonctions de Bessel, mais c’est assez compliqué. En composant Gondwana, je n’ai pas cherché à modéliser la modulation de fréquence de manière aussi fidèle, et j’ai simplement considéré que, grossièrement, les indices les plus élevés donneraient les intensités les moins fortes. À cela s’ajoute le rôle des profils dynamiques. On sait qu’une enveloppe percussive favorise la fusion des composantes des spectres inharmoniques. Le profil dynamique d’un son de cloche est caractérisé, non seulement par son attaque percussive, mais aussi par des évolutions différentes de chacun des partiels. Les composantes aiguës disparaissent en premier, les unes après les autres, pour ne laisser résonner finalement qu’un son simple et unique: celui qu’on appelle le bourdon. Les profils dynamiques des complexes sonores initiaux de Gondwana s’inspirent de ce modèle. Les attaques des cuivres et bois sont renforcées par des percussions, et des composantes aiguës des accords (les sons d’indice de modulation plus élevé) s’éteignent rapidement, laissant résonner plus longuement un sol dièse, celui de la modulante, qui fait ici figure de «bourdon». On a vu que cette première section de Gondwana était marquée par un processus conduisant à une harmonicité croissante. Les enveloppes dynamiques sont, elles aussi, affectées par un processus de transformation: le point de départ est bien le profil de la cloche, associé à un spectre inharmonique, mais au point d’arrivée, les agrégats orchestraux revêtent un profil semblable à l’enveloppe dynamique d’un son de cuivre, associé à un spectre semi-harmonique. L’enveloppe de cloche a une attaque brutale, suivie d’une extinction exponentielle; l’enveloppe cuivrée, quant à elle, présente un transitoire d’attaque moins abrupt, pendant lequel les harmoniques s’étagent du grave à l’aigu, formant ce pic, d’intensité et de timbre, qui est caractéristique de l’attaque «cuivrée», cette attaque étant suivie d’une phase d’entretien plus ou moins stable. […] Réalisation orchestrale de la première section J’ai utilisé souvent le terme «agrégat» plutôt qu’«accord», et j’ai souvent parlé de «fusion». En effet, ce qui est recherché ici, c’est la création de larges sons synthétiques à partir de combinaisons orchestrales bien spécifiques: notion d’«harmonie-timbre», réalisée par la technique de «synthèse instrumentale». On a vu que le choix des rapports de fréquence et d’intensité est crucial. Mais l’orchestration doit, elle aussi, être étudiée soigneusement. Théoriquement, pour construire des spectres, qu’ils soient harmoniques ou inharmoniques, on devra additionner des fréquences pures (sinusoïdales), leur somme créant la perception d’un timbre. Si au lieu de sons sinusoïdaux, disponibles seulement avec des techniques électroniques, on utilise des sons instruments, on rajoutera au spectre théorique les composantes spectrales de chacun des instruments. L’agrégat obtenu s’en trouvera donc beaucoup plus complexe. La complexité finale dépendra évidemment des timbres choisis. Si j’avais orchestré mes agrégats avec, par exemple, des bassons, hautbois, cuivres avec sourdine sèche, cordes, etc., j’aurais ajouté tellement d’harmoniques que le résultat final en aurait été – plus que complexe: brouillé. La structure harmonique des spectres calculés par modulation de fréquence risquait de se retrouver noyée par la multitude de partiels émis par l’orchestre. Il convenait donc d'utiliser, autant que possible, des instruments au spectre assez peu riche. Le cœur de l’accord, qui correspond aux sons d’indice de modulation plus faible, donc d’intensité plus forte, est joué par des cuivres. Le son des cuivres, sans sourdine, est assez concentré sur les premiers harmoniques, et reste donc assez clair. Les sons correspondant aux indices élevés, plus aigus, mais aussi moins intenses, seront logiquement joués par des bois, les cordes étant délibérément mises de côté, leur spectre trop riche et légèrement bruité risquant de brouiller l’effet de re-synthèse orchestrale. Les hautbois sont utilisés mais jouent généralement dans l’aigu, où leur spectre est plus simple. Quelques percussions (clochestubes, vibraphone) servent à préciser le transitoire d’attaque de la cloche; elles se dé-synchroniseront, puis disparaîtront totalement, à mesure que le paradigme «cloche» se métamorphosera en paradigme «cuivre» (à l’attaque plus «molle»). Enfin, pour symboliser le «bourdon» de la cloche, il me fallait un son aussi pure que possible: j’ai choisi finalement le tuba, car il possède dans cette tessiture $ 91 (sol dièse 2), un timbre très centré sur le fondamental (c’est pour cette raison que dans les traités d’orchestration on vous dit souvent que le «tuba» est très volumineux, que son timbre est «gros» – par opposition, par exemple, au hautbois ou au violon qui sont qualifiés de «fins» ou «intenses», ce qui signifie en fait que leurs harmoniques sont très dispersées sur tout le spectre). Si la technique de modulation de fréquence a servi dans cette première section de Gondwana à bâtir des structures de blocs, de larges agrégats harmonie-timbre, elle permettra aussi, dans d’autres passages de la pièce, de créer divers types de formes et de contours. Par exemple, dans la section F, l’engendrement des hauteurs par modulation de fréquence va produire des structures harmonico-mélodiques, des sortes de contours en «éventail». Une fréquence centrale, do 1 / 4 3, résidu d’un processus précédent, joue le rôle de la porteuse. La modulante, très petite au départ, croît progressivement, tandis que l’indice de modulation croît également. Au lieu de sonner toutes ensemble, les paires de sons résultants (Chaque «paire» consiste en un son additionnel et un son différentiel) entrent les unes après les autres, produisant donc cet effet d’éventail autour d’une séquence centrale, ou encore, de vague qui déferle. Cet effet est semblable à celui que l’on obtient en synthèse par modulation de fréquence, lorsqu’on accroît progressivement l’intensité de la modulante. Les premières vagues présentent un écart de fréquence minime (modulante et indice petits), puis un processus s’organise jusqu’à remplir largement la tessiture de l’orchestre. Les contours des vagues sont joués par des hautbois, cor anglais et bassons: il s’agit en effet de les mettre en relief, d’où le choix d’instruments à timbre très riche, qui se détachent sur les résonances jouées par les cuivres et les cordes, comme un effet de pédale au piano. […] Dans l’orchestration finale, l’approximation a souvent été faite au demi-ton le plus proche, à cause de la vitesse des traits à jouer. Dans les deux dernières vagues, on remarque que les sons trop graves ont été éliminés. On voit également que la ligne inférieure commence par descendre, comme dans les autres vagues, mais ensuite remonte. C’est l’effet de repliement: pour des valeurs élevées de l’indice de modulation, la résultante différentielle devient négative. Une fréquence «négative» ne saurait évidemment exister – du moins dans l’univers que nous connaissons…[…] Les agrégats de la première section de Gondwana contiennent un très fort effet de repliement. […] 92 La voix solitaire de l’homme Entretien avec Hugues Dufourt Propos recueillis par Laurent Feneyrou1 Du concerto… Antiphysis, Le Cyprès blanc et le Concerto pour piano sont en principe trois œuvres indépendantes. Mais dans les trois, je me suis confronté à la même difficulté, celle d’un genre réputé impossible: le problème fondamental du concerto est le rapport du soliste au tutti qui l’environne. En deçà des préoccupations formelles, se pose aujourd’hui la question de la subjectivité, de l’expression subjective. Celle-ci ne peut plus être sociable, sur le modèle d’une sociabilité transcendantale à la Haydn ou Mozart, car cette sociabilité précède l’expérience des guerres napoléoniennes, lesquelles ont mis un terme définitif aux grands espoirs d’une paix universelle, et par conséquent à la forme concertante, voire à la forme classique du quatuor. Que peut être un concerto aujourd’hui? Il ne se fonde plus ni sur la sociabilité transcendantale du classicisme, ni sur l’aventure romantique du héros, ni sur les accents dolents du style fin de siècle, ni sur une «nouvelle objectivité», où le soliste, personnage marmoréen, impassible et impersonnel, se délivrerait ou se virtualiserait dans une structure essentiellement hétérophonique. Quoiqu’on fasse aujourd’hui, dès qu’un soliste est entouré d’un ensemble ou d’un processus de transformation, l’hétérophonie domine. Le problème fondamental me paraît être l’abandon structurel de la pensée polyphonique. Le concerto ne doit pas se plier à une totalité. Il ne s’agit donc pas de mimer la voie subjective dans le tutti. Mon but est de réintroduire cette voie subjective, fût-ce au titre de la protestation. J’ai ainsi procédé non par opposition, mais plutôt du tout à la partie, la voix du soliste étant finalement une résultante médiatisée du tutti. Dans Le Cyprès blanc, la sonorité de l’orchestre est une immense extension, une caisse de résonance de la sonorité de l’alto. J’ai choisi l’alto pour des raisons analogues à celles que Wagner avait invoquées pour déplacer le centre de gravité de son orchestre et le baisser d’une octave: le générateur n’est plus le do de la clef d’ut, mais celui de la corde grave de l’alto. En essayant de repenser ces rapports de l’orchestre et du soliste, je les ai fait procéder d’une commune origine, de cette octave essentielle de laquelle naît l’orchestration. C’est l’octave génétique. L’alto entre tardivement dans le discours. C’est un geste délibéré de ma part, qui peut faire penser à la grande introduction du Premier Concerto pour piano de Brahms. Cet alto émerge non comme une voix solitaire, mais comme un filament, s’émancipe et conquiert son existence au fur et à mesure du mouvement. Dans la seconde partie, s’opère une sorte de dédoublement. L’orchestre et l’alto sont réunis par des rapports harmoniques et timbriques extrêmement étroits, mais s’ignorent mutuellement. Est-ce pour autant un non-concerto? Je ne le pense pas. Le problème de la musique ou de ses genres consiste à identifier et à cristalliser l’essence du rapport social et du rapport intersubjectif qui caractérise une société. Or, nous sommes dans une société d’incommunicants. Et bien, ce sera un concerto d’incommunicants! Nous vivons dans la plus grande discontinuité, dans l’urgence, la hâte, la peur panique… Par conséquent, la façon la plus fondamentale de rejeter cela, c’est de proposer l’autre terme de l’alternative pour obtenir la médiation, la durée lente, la conquête d’une plasticité sonore qui se moque éperdument des contraintes Paris, mai 2004. Extrait du programme de Musica 2004, N° 18–19, Strasbourg, pp. 54–56. Reproduit avec l’autorisation de Jean-Dominique Marco, directeur général du festival et Laurent Feneyrou. 1 93 sociales. Mais ne pas communiquer, c’est aussi ce que l’on appelle la spéculation philosophique. Le terme même de spéculation désigne un au-delà des conditions de possibilité du monde. Dans la tradition philosophique, les mondes spéculatifs sont, par définition, par essence, des mondes d’incommunicants. J’ai donc replié en quelque sorte une tradition philosophique, la spéculation, sur un genre musical, celui du concerto. Le Cyprès blanc est un hommage aux lamelles orphiques qui accompagnaient le mourant et l’instruisait de la conduite à tenir lorsqu’il serait confronté à l’au-delà. Le seul témoignage circonstancié et fiable est celui de Platon, qui avait fréquenté les théoriciens de l’orphisme lors de ses voyages en Sicile. Mais aujourd’hui, nos connaissances transfigurent et embellissent la nature de l’orphisme. Ce n’est plus un mythe, mais une réalité épigraphique, ce qui est inscrit dans les tombes. Il s’agit d’une religion, ou plutôt d’une science religieuse, dont l’origine assignable se situe au VIIe siècle avant J.-C., au cours d’un épisode extrêmement sombre et douloureux: le monde homérique n’est plus viable, et le bassin méditerranéen, ou du moins la Grèce entre dans une guerre civile où elle a failli sombrer. De cette crise naîtront la tyrannie, puis la démocratie. Je ne me suis évidemment pas intéressé à de vagues spéculations sur la religiosité orphique, mais plutôt à l’orphisme comme l’une des premières formes de conscience historique. L’orphisme en un sens, c’est la conscience de soi que prend le pessimisme historique. Au VIIe siècle avant J.-C. se constitue une sorte de dualisme étranger au monde homérique, et la conscience de l’au-delà est au fond l’expression religieuse, métaphorique, d’une impasse historique et politique. Toutes ces raisons m’ont conduit à cette image, unique, du cyprès blanc, arbre de lumière, ambivalent, où le mourant abolit définitivement le monde qu’il ne réintègre pas, et s’échappe du cycle des métempsycoses, vers l’au-delà d’une mémoire qui se rattache à l’éternité. Cette vision des choses se situe aux antipodes de mes orientations politiques. Je pense l’optimisme aujourd’hui absolument illusoire, c’est l’affaire des songe-creux. Mais je ne cultive pas pour autant le pessimisme, parce que celui-ci ouvre toujours la porte à la réaction, au conservatisme, à la culture de la noirceur et finalement à l’abandon de toutes les valeurs de la création, de l’histoire, de la pensée. J’avais donc toutes les raisons de m’intéresser à ces lamelles dans des temps aussi troublés que les nôtres, et qui ressemblent étrangement aux conditions historiques qui ont rendu possible l’émergence d’une conscience religieuse comme l’orphisme. …à la musique pour piano Il me faut revenir à des considérations autobiographiques. Je n’ai pas suivi la voie de musicien professionnel, ce qui m’a souvent conduit à ne pas mentionner des éléments de ma formation. J’ai été l’élève de Louis Hiltbrand, qui était alors l’assistant de Dino Lipatti au conservatoire de Genève, où il dispensait un enseignement du plus haut niveau. Ma situation était inconfortable, puisque je n’étais pas de taille à assumer le devenir auquel cette classe me destinait. Il m’a fallu faire mes preuves, apprendre beaucoup de musique, cette base du répertoire pianistique qui va de Bach à Liszt et à Bartók. Hiltbrand était un grand pédagogue qui connaissait ce répertoire par cœur – et l’on était prié d’en faire autant –, mais il vivait surtout dans une sorte de religion de l’art qu’il a profondément inculquée à ses élèves. J’ai donc fait mes études dans une tradition d’écriture austro-allemande, mais dans un pays de langue française, et j’ai ainsi abordé Debussy à travers le prisme d’une langue étrangère, comme une musique étrangère dont il me fallait acquérir l’idiome. Mais la base, c’était le classicisme et le premier romantisme. Parallèlement, et sans doute grâce à d’autres musiciens parmi lesquels Roger Accart à Lyon, je n’ignorais pas la situation de la musique européenne avancée et j’écoutais régulièrement Messiaen. Mes deux formations étaient en quelque sorte concomitantes. Mais quand je dus écrire pour le piano, un problème se posa, car le piano «combinatoire», le piano éclaté des techniques post-bartókiennes et post-debussystes constituait un autre langage. C’était autre chose que du piano. L’effort de An Schwager Kronos et de Meeresstille est un effort 94 de synthèse pour retrouver des racines pianistiques qui avaient un peu disparu chez les sériels et pour renouer un rapport personnel pacifié à cet instrument. Les romantiques ne nous avaient pas attendu pour inventer le timbre du piano et pour traiter cette problématique du timbre bien avant qu’elle ne se pose explicitement à l’orchestre. Pourquoi Schubert, pourquoi Schumann, pourquoi Chopin? Sous leurs doigts, les accords acquièrent une extraordinaire puissance harmonique et témoignent d’une grande conscience des valeurs acoustiques. La technique du piano repose sur la musculature de la main. Cette façon de traverser tout un clavier sans bouger est une immense conquête romantique, c’est la conquête des équilibres, des notes intermédiaires chez Schumann, de la vélocité et des registres les plus extrêmes, mais dans l’immobilité psychique et motrice la plus absolue. La disposition de la main est toute à l’extension, ce n’est plus du tout la main du claveciniste. Mais l’extension est telle que c’est une pure projection du mouvement du dos et que toute l’emprise du pianiste sur le clavier participe d’une nouvelle forme de culture instrumentale, d’une nouvelle approche de la sonorité, d’une nouvelle façon de penser le rapport des voix, qui n’est plus du tout fondé sur l’égalité, mais au contraire sur la spécificité et l’inégalité de chaque doigt. Mais il y a plus, il y a ces traits, ces rages, ces tournures, ces dilutions de l’accord dans de vastes tessitures, dont le point culminant se trouve chez Debussy, dans le chatoiement harmonique de La Cathédrale engloutie. La culture pianistique est une lente conquête par la main, par le bras, par les formes d’une pensée qui n’est pas celle de l’écriture, du moins pas exclusivement. Cette conquête est aussi acoustique. Selon moi, les musiciens simplement formés à l’écriture sont patauds. Pour un compositeur, il est essentiel, et c’est une conviction très ancrée en moi, de faire ses classes instrumentales, d’avoir cette culture instrumentale absolument vitale, sinon d’être instrumentiste.» 95 Wildes Wald- und Felsental «Siegfrieds Rheinfahrt» von Richard Wagner als spektrale Musik an der Grenze zwischen Harmonie und Melodie Bernhard Günther «Wachsende Morgenröte, immer schwächeres Leuchten des Feuerscheins aus der Tiefe» – so steht es in der Partitur der Götterdämmerung, gegen Ende des Vorspiels. Und was dann kommt, gehört zu den erstaunlichsten Stellen der Orchestermusik des 19. Jahrhunderts: Der Beginn von «Siegfrieds Rheinfahrt» ist – dem steten Fließen eines breiten, tiefen Stromes folgend – ein einziger, sich endlos erstreckender Basston. Erst nach rund drei Minuten treten die bis dahin wie am Rande des Gesichtsfelds in den tiefen Blechbläsern und tiefen Streichern auftauchenden Motive allmählich in den Vordergrund, in den Klarinetten (allmählich beweglicher), dann in den Geigen (die eine weit ausholende Steigerung in Gang setzen), und noch immer trägt der Basston die gesamte, heftiger werdende Bewegung, welche sich über ihm aufschichtet. Erst nach rund vier Minuten schert ein heftiger Einsatz des gesamten Orchesters entschlossen aus dem breiten Fluss der Harmonik aus. Musik, komponiert um 1870, wird hörbar als «un art de la transition continue» – wie Hugues Dufourt am Anfang dieses Bandes (vgl. S. 30) die Musique spectrale unserer Zeit charakterisiert. 1 Dahlhaus, Carl: Wagners Konzeption des musikalischen Dramas. – Kassel u.a.: Bärenreiter, 1990 [1971], S. 151 Es liegt nahe, dass Richard Wagner in «Siegfrieds Rheinfahrt» – einem der längsten und prägnantesten Orchesterzwischenspiele im gesamten Zyklus «Der Ring des Nibelungen» – die Grenzen zwischen Orchestermusik und Gesang auslotete, und innerhalb der Möglichkeiten der Orchestermusik wiederum die Grenzen zwischen Harmonik, Klang und Melodie. Anhand von Richard Wagners Text «Oper und Drama» (1852) hebt der Musikwissenschaftler Carl Dahlhaus Wagners zentrale These hervor, «daß eine Melodie, die ihre Bestimmtheit weder einem Text noch einem szenischen Vorgang verdankt, die also weder dichterisch noch dramatisch oder choreographisch ‹gerechtfertigt› ist, entweder ein leeres, nichtssagendes Getön – also überhaupt keine Melodie – sei oder als Ausdruck eines unbestimmten Verlangens, das seinen Gegenstand sucht, erscheine»1 – was aus Wagners Sicht der Beleg dafür sei, «daß die Symphonie von sich aus danach strebe, von Unbestimmtheit in Bestimmtheit überzugehen und zu einem Teilmoment des musikalischen Dramas zu werden». Das Nachdenken über die Grenzen zwischen musikalischen Themen und Motiven einerseits und Klang wie Harmonik andererseits ist charakteristisch für die Komponisten der Musique spectrale der Gegenwart. Es ist – bis hin zur glitzernden, bei Wagner wie bei Grisey, Dufourt und Hurel oft wie aus dem Wasser geschöpften Metaphorik; bis hin zum manifestartig entschlossenen Tonfall der Sprache – überraschend, den Komponisten Richard Wagner über hundert Jahre zuvor beim Erkunden ebendieser Grenzen zu erleben. 96 Spektralanalyse der ersten drei Minuten von Richard Wagners Orchesterkomposition Siegfrieds Rheinfahrt. Der höchste ‹Gipfel› der Kurve, links im Bild, veranschaulicht die außergewöhnliche Bedeutung des über die gesamten drei Minuten liegenden Bass-Grundtons. 97 Dichtkunst und Tonkunst im Drama der Zukunft Richard Wagner1 Wir haben bis jetzt die Bedingungen für den melodischen Fortschritt aus einer Tonart in die andere als in der dichterischen Absicht, soweit sie bereits selbst ihren Gefühlsinhalt offenbart hatte, liegend nachgewiesen und bei diesem Nachweis bewiesen, daß der veranlassende Grund zur melodischen Bewegung, als ein auch vor dem Gefühle gerechtfertigter, nur aus dieser Absicht entstehen könne. Was diesen, dem Dichter notwendigen Fortschritt aber einzig ermöglicht, liegt natürlich aber nicht im Bereiche der Wortsprache, sondern ganz bestimmt nur in dem der Musik. Dieses eigenste Element der Musik, die Harmonie, ist das, was nur insoweit noch von der dichterischen Absicht bedingt wird, als es das andere, weibliche Element ist, in welches sich diese Absicht zu ihrer Verwirklichung, zu ihrer Erlösung ergießt. Denn es ist dies das gebärende Element, das die dichterische Absicht nur als zeugenden Samen aufnimmt, um ihn nach den eigensten Bedingungen seines weiblichen Organismus’ zur fertigen Erscheinung zu gestalten. Dieser Organismus ist ein besonderer, individueller, und zwar eben kein zeugender, sondern ein gebärender: er empfing vom Dichter den befruchtenden Samen, die Frucht aber reift und formt er nach seinem eigenen individuellen Vermögen. Wagner, Richard: Oper und Drama. – Leipzig: Weber, 1852 (Gesammelte Schriften, Band 4). Dritter Teil: Dichtkunst und Tonkunst im Drama der Zukunft (Auszug) 1 98 Die Melodie, wie sie auf der Oberfläche der Harmonie erscheint, ist für ihren entscheidenden rein musikalischen Ausdruck einzig aus dem von unten her wirkenden Grunde der Harmonie bedingt: wie sie sich selbst als horizontale Reihe kundgibt, hängt sie durch eine senkrechte Kette mit diesem Grunde zusammen. Diese Kette ist der harmonische Akkord, der als eine vertikale Reihe nächst verwandter Töne aus dem Grundtone nach der Oberfläche zu aufsteigt. Das Mitklingen dieses Akkordes gibt dem Tone der Melodie erst die besondere Bedeutung, nach welcher er zu einem unterschiedenen Momente des Ausdruckes als einzig bezeichnend verwendet wurde. So wie der aus dem Grundtone bestimmte Akkord dem einzelnen Tone der Melodie erst seinen besonderen Ausdruck gibt – indem ein und derselbe Ton auf einem anderen ihm verwandten Grundtone eine ganz andere Bedeutung für den Ausdruck erhält –, so bestimmt sich jeder Fortschritt der Melodie aus einer Tonart in die andere ebenfalls nur nach dem wechselnden Grundtone, der den Leitton der Harmonie, als solchen, aus sich bedingt. Die Gegenwart dieses Grundtones, und des aus ihm bestimmten harmonischen Akkordes, ist vor dem Gefühle, das die Melodie nach ihrem charakteristischen Ausdrucke erfassen soll, unerläßlich. Die Gegenwart der Grundharmonie heißt aber: Miterklingen derselben. Das Miterklingen der Harmonie zu der Melodie überzeugt das Gefühl erst vollständig von dem Gefühlsinhalte der Melodie, die ohne dieses Miterklingen dem Gefühle etwas unbestimmt ließe; nur aber bei vollster Bestimmtheit aller Momente des Ausdruckes bestimmt sich auch das Gefühl schnell und unmittelbar zur unwillkürlichen Teilnahme, und volle Bestimmtheit des Ausdruckes heißt aber wiederum nur: vollständigste Mitteilung all seiner notwendigen Momente an die Sinne. Das Gehör fordert also gebieterisch auch das Miterklingen der Harmonie zur Melodie, weil es erst durch dieses Miterklingen sein sinnliches Empfängnisvermögen vollkommen erfüllt, somit befriedigt erhält, und demnach mit notwendiger Beruhigung dem wohlbedingten Gefühlsausdrucke der Melodie sich zuwenden kann. Das Miterklingen der Harmonie zur Melodie ist daher nicht eine Erschwerung, sondern die einzig ermöglichende Erleichterung für das Verständnis des Gehörs. Nur wenn die Harmonie sich nicht als Melodie zu äußern vermochte, also – wenn die Melodie weder aus dem Tanzrhythmus noch aus dem Wortverse ihre Rechtfertigung erhielte, sondern ohne diese Rechtfertigung, die sie einzig vor dem Gefühle als wahrnehmbar bedingen kann, sich nur als zufällige Erscheinung auf der Oberfläche der Akkorde willkürlich wechselnder Grundtöne kundgäbe – nur dann würde das Gefühl, ohne bestimmenden Anhalt, durch die nackte Kundgebung der Harmonie beunruhigt werden, weil sie ihm nur Anregungen, nicht aber die Befriedigung des Angeregten zuführte. Unsre moderne Musik hat sich gewissermaßen aus der nackten Harmonie entwickelt. Sie hat sich willkürlich nach der unendlichen Fülle von Möglichkeiten bestimmt, die ihr aus dem Wechsel der Grundtöne, und der aus ihnen sich herleitenden Akkorde, sich darboten. Soweit sie diesem ihrem Ursprunge ganz getreu blieb, hat sie auf das Gefühl auch nur betäubend und verwirrend gewirkt, und ihre buntesten Kundgebungen in diesem Sinne haben nur einer gewissen Musikverstandsschwelgerei unsrer Künstler selbst Genuß geboten, nicht aber dem unmusikverständigen Laien. Der Laie, sobald er nicht Musikverständnis affektierte, hielt sich daher einzig nur an die seichteste Oberfläche der Melodie, wie sie ihm in dem rein sinnlichen Reize des Gesangsorganes vorgeführt wurde; wogegen er dem absoluten Musiker zurief: «Ich verstehe deine Musik nicht, sie ist mir zu gelehrt.» – Hierwider handelt es sich nun bei der Harmonie, wie sie als rein musikalisch bedingende Grundlage der dichterischen Melodie miterklingen soll, durchaus nicht um ein Verständnis in dem Sinne, nach welchem sie jetzt vom gelehrten Sondermusiker verstanden und vom Laien nicht verstanden wird: auf ihre Wirksamkeit als Harmonie hat sich beim Vortrage jener Melodie die Aufmerksamkeit des Gefühles gar nicht zu lenken, sondern, wie sie selbst schweigend den charakteristischen Ausdruck der Melodie bedingen würde, durch ihr Schweigen das Verständnis dieses Ausdruckes aber nur unendlich erschweren, ja dem Musikgelehrten, der sie sich hinzuzudenken hätte, es einzig erschließen müßte – so soll das tönende Miterklingen der Harmonie eine abstrakte und ablenkende Tätigkeit des künstlerischen Musikverstandes eben unerforderlich machen und den musikalischen Gefühlsinhalt der Melodie als einen unwillkürlich kenntlichen, ohne alle zerstreuende Mühe zu erfassenden, dem Gefühle leicht und schnell begreiflich zuführen. Wenn somit bisher der Musiker seine Musik sozusagen aus der Harmonie herauskonstruierte, so wird jetzt der Tondichter zu der aus dem Sprachverse bedingten Melodie die andere notwendige, in ihr aber bereits enthaltene, rein musikalische Bedingung, als miterklingende Harmonie, nur wie zu ihrer Kenntlichmachung noch mit hinzufügen. In der Melodie des Dichters ist die Harmonie, nur gleichsam unausgesprochen, schon mitenthalten: sie bedang ganz unbeachtet die ausdrucksvolle Bedeutung der Töne, die der Dichter für die Melodie bestimmte. Diese ausdrucksvolle Bedeutung, die der Dichter unbewußt im Ohre hatte, war bereits schon die erfüllte Bedingung, die kenntlichste Äußerung der Harmonie; aber diese Äußerung war für ihn nur eine gedachte, noch nicht sinnlich wahrnehmbare. An die Sinne, die unmittelbar empfangenden Organe des Gefühles, teilt er sich jedoch zu seiner Erlösung mit, und ihnen muß er daher die melodische Äußerung der Harmonie mit den Bedingungen dieser Äußerung zuführen, denn ein organisches Kunstwerk ist nur das, was das Bedingende mit dem Bedingten zugleich in sich schließt und zur kenntlichsten Wahrnehmung mitteilt. Die bisherige absolute Musik gab harmonische Bedingungen; der Dichter würde nur das Bedingte in seiner Melodie mitteilen und daher ebenso unverständlich als jener bleiben, wenn er die harmonischen Bedingungen der aus dem Sprachverse gerechtfertigten Melodie nicht vollständig an das Gehör kundtäte. 99 Die Harmonie konnte aber nur der Musiker, nicht der Dichter erfinden. Die Melodie, die wir den Dichter aus dem Sprachverse erfinden sahen, war, als eine harmonisch bedingte, daher eine von ihm mehr gefundene, als erfundene. Die Bedingungen zu dieser musikalischen Melodie mußten erst vorhanden sein, ehe der Dichter sie als eine wohlbedungene finden konnte. Diese Melodie bedang, ehe sie der Dichter zu seiner Erlösung finden konnte, bereits der Musiker aus seinem eigensten Vermögen: er führt sie dem Dichter als eine harmonisch gerechtfertigte zu, und nur die Melodie, wie sie aus dem Wesen der modernen Musik ermöglicht wird, ist die den Dichter erlösende, seinen Drang erregende wie befriedigende Melodie. Dichter und Musiker gleichen hierin zwei Wanderern, die von einem Scheidepunkte ausgingen, um von da aus, jeder nach der entgegengesetzten Richtung, rastlos gerade vorwärtszuschreiten. Auf dem entgegengesetzten Punkte der Erde begegnen sie sich wieder; jeder hat zur Hälfte den Planeten umwandert. Sie fragen sich nun aus, und einer teilt dem andern mit, was er gesehen und gefunden hat. Der Dichter erzählt von den Ebenen, Bergen, Tälern, Fluren, Menschen und Tieren, die er auf seiner weiten Wanderung durch das Festland traf. Der Musiker durchschritt die Meere und berichtet von den Wundern des Ozeans, auf dem er oftmals dem Versinken nahe war, dessen Tiefen und ungeheuerliche Gestaltungen ihn mit wohllüstigem Grausen erfüllten. Beide, von ihren gegenseitigem Berichten angeregt und unwiderstehlich bestimmt, das andere von dem, was sie selbst sahen, ebenfalls noch kennenzulernen, um den nur auf die Vorstellung und Einbildung empfangenen Eindruck zur wirklichen Erfahrung zu machen, trennen sich nun nochmals, um jeder seine Wanderschaft um die Erde zu vollenden. Am ersten Ausgangspunkte treffen sie sich dann endlich wieder; der Dichter hat nun auch die Meere durchschwommen, der Musiker die Festländer durchschnitten. Nun trennen sie sich nicht mehr, denn beide kennen nun die Erde: was sie früher in ahnungsvollen Träumen sich so und so gestaltet dachten, ist jetzt nach seiner Wirklichkeit ihnen bewußt geworden. Sie sind eins; denn jeder weiß und fühlt, was der andere weiß und fühlt. Der Dichter ist Musiker geworden, der Musiker Dichter: jetzt sind sie beide vollkommener künstlerischer Mensch. Auf dem Punkte ihrer ersten Zusammenkunft, nach der Umwanderung der ersten Erdhälfte, war das Gespräch zwischen Dichter und Musiker jene Melodie, die wir jetzt im Auge haben – die Melodie, deren Äußerung der Dichter aus seinem innersten Verlangen heraus gestaltete, deren Kundgebung der Musiker aus seinen Erfahrungen heraus aber bedang. Als beide sich zum neuen Abschiede die Hände drückten, hatte jeder von ihnen das in der Vorstellung, was er selbst noch nicht erfahren hatte, und um dieser überzeugenden Erfahrung willen trennten sie sich eben von neuem. – Betrachten wir den Dichter zunächst, wie er sich der Erfahrungen des Musikers bemächtigt, die er nun selbst erfährt, aber geleitet von dem Rate des Musikers, der die Meere bereits auf kühnem Schiffe durchsegelte, den Weg zum festen Lande fand und die sichren Fahrstraßen ihm genau mitgeteilt hat. Auf dieser neuen Wanderung werden wir sehen, daß der Dichter ganz derselbe wird, der der Musiker auf seiner vom Dichter ihm vorgezeichneten Wanderung über die andere Erdhälfte wird, so daß beide Wanderungen nun als ein und dieselbe anzusehen sind. Wenn der Dichter jetzt sich in die ungeheuren Weiten der Harmonie aufmacht, um in ihnen gleichsam den Beweis für die Wahrheit der vom Musiker ihm ‹erzählten› Melodie zu gewinnen, so findet er nicht mehr die unwegsamen Tonöden, die der Musiker zunächst auf seiner ersten Wanderung antraf; sondern zu seinem Entzücken trifft er das wunderbar kühne, seltsam neue, unendlich fein und doch riesenhaft fest gefügte Gerüst des Meerschiffes, das jener Meerwanderer sich schuf, und das der Dichter nun beschreitet, um auf ihm sicher die Fahrt durch die Wogen anzutreten. Der Musiker hatte ihn den Griff und die Handhabung des Steuers gelehrt, die Eigenschaft der Segel und all das seltsam und sinnig erfundene Nötige zur sicheren Fahrt bei Sturm und Wetter. Am Steuer dieses herrlich die Fluten durchsegelnden Schiffes wird der Dichter, der zuvor mühsam Schritt 100 für Schritt Berg und Tal gemessen, sich mit Wonne der allvermögenden Macht des Menschen bewußt; von seinem hohen Borde aus dünken ihm die noch so mächtig rüttelnden Wogen willige und treue Träger seines edlen Schicksales, dieses Schicksales der dichterischen Absicht. Dieses Schiff ist das gewaltig ermöglichende Werkzeug seines weitesten und mächtigsten Willens; mit brünstig dankender Liebe gedenkt er des Musikers, der es aus schwerer Meeresnot erfand und seinen Händen nun überläßt – denn dieses Schiff ist der sicher tragende Bewältiger der unendlichen Fluten der Harmonie, das Orchester. – Götterdämmerung Dritter Aufzug, Erste Szene, Zwischen dem Vorspiel und dem ersten Aufzug Wildes Wald- und Felsental am Rheine Die drei Rheintöchter, Siegfried. Die drei Rheintöchter: Frau Sonne sendet lichte Strahlen; Nacht liegt in der Tiefe: einst war sie hell, da heil und hehr des Vaters Gold noch in ihr glänzte. Rheingold! Klares Gold! Wie hell du einstens strahltest, hehrer Stern der Tiefe! Weialala leia, wallala leialala. Frau Sonne, sende uns den Helden, der das Gold uns wiedergäbe! Ließ’ er es uns, sein lichtes Auge neideten dann wir nicht länger. Rheingold! Klares Gold! Wie froh du dann strahltest, freier Stern der Tiefe! 101 La Nuit du piano spectral Samedi / Samstag / Saturday 26.11.2005 18:00 Salle de Musique de Chambre Michael Wendeberg piano Michaël Lévinas piano Nicolas Hodges piano 18:00 Michael Wendeberg Jean-Philippe Rameau: Pièces de clavecin avec une méthode pour la mécanique des doigts: 5. Le rappel des oiseaux (mi mineur / e-moll) (1724) 2’ Olivier Messiaen: Catalogue d’oiseaux: VII / 3 Le courlis cendré [Der Große Brachvogel / Numenus arquata] (1956–1958) 10’ Karlheinz Stockhausen: Klavierstück VII (1954 / 1955) 7’ Pierre Boulez: Sonate III: Formant III / 2 Constellation – Miroir (1955 / 19…) 8’ 18:50 Hèctor Parra: Impromptu (2005, création / Uraufführung) 3’ David Coleman: Fleuve (1997) 6’ Maurice Ravel: Miroirs: 1. Noctuelles; 2. Les oiseaux tristes; 4. Alborada del gracioso (1904 / 1905) 15’ 19:45 Michaël Lévinas Michael Lévinas: Anaglyphe (1995) 11’ Franz Liszt: Années de Pellerinage. Les Jeux d’eau à la Villa d’Este (~1870) 4’ György Ligeti: Etudes pour piano, 1er livre: II. Cordes à vide; V. Arc-en-ciel (1985) 6’ Alexander Skrijabin: Trois Etudes op. 65 (1911 / 1912) 7’ 21:00 Tristan Murail: Territoires de l’oubli (1977) 25’ Franz Liszt: Nuages gris (1881) 3’ 21:45 Nicolas Hodges Georg Friedrich Haas: Hommage à György Ligeti für einen Pianisten an zwei um einen Viertelton verstimmten Klavieren (1983–1985) 15’ Claude Debussy: Etudes (2ème cahier): 11. Pour les arpèges composés; 12. Pour les accords (1915) 8’ 22:20 Franz Schubert: Sonate für Klavier Nr. 15 in C-Dur (do majeur) D 840 (1825) 35’ François Couperin: Pièces de Clavecin (Sixième Ordre): Les baricades mistérieuses (1717) 2’30 102 Photo: Raphael Rippinger 103 The soft machine Anmerkungen zur Nuit du piano spectral Bernhard Günther Die Vorstellung einer an natürlichen Formen orientierten, sich auf den Klang konzentrierenden Musik ist – selbstredend – viel älter als die Musique spectrale, mit der Komponisten im späten 20. Jahrhundert Kontraste zur Technik- und Konstruktionslastigkeit der Gegenwart schufen. Es ist dennoch erstaunlich, dass gerade das Klavier, diese vermeintlich nüchtern-neutrale musikalische ‹Universalmaschine›, seit rund dreihundert Jahren Komponisten zur Erzeugung von Farben, Klängen und Formen herausfordert, die einem auf starr zwölf Töne pro Oktave geeichten Instrument verschlossen scheinen könnten. Im 16. und 17. Jahrhundert war «Clavier» noch der Begriff für alle mit Hilfe einer Tastatur zu spielenden Instrumente, beziehungsweise darüber hinaus überhaupt für Tonsysteme mit diskreten Tonhöhen. Mit dem Aufkommen des Generalbasses galt das Tasteninstrument – italienisch bündig «istromento perfetto» genannt – bereits als zentrales Handwerkszeug des Kapellmeisters und als «Mutter aller Harmonie» (J. Fr. Majer 1732). Von der Erfindung des Quintenzirkels im 18. Jahrhunderts bis zur Zwölftonmusik im 20. Jahrhundert bildet der präzis umgrenzte Tonvorrat des Klaviers den Referenzpunkt harmonischen Denkens. Und doch wird es in der Klavierliteratur oft gerade dort erst «pianistisch», wo von der kapellmeisterlichen Techniktreue des «What you see is what you get» nichts mehr durchschimmert. Ob es – wie David Robert Coleman (S. 112) anmerkt – der himmelweite Unterschied zwischen dem Notenbild und dem Spiel von Rachmaninov ist; ob von Rameau bis Messiaen der Versuch unternommen wird, eine derart komplex strukturierte Klangfigur wie Vogelgesang mit Tasten zu erfassen; oder ob gerade hochkonzentrierte Technik und Etüde in lebendige Gestalten umschlagen wie bei Debussy oder Ligeti – erst wenn es zwischen die Zeilen getrieben wird, entfaltet das Klavier sein wahres Potenzial. Von einer klaren Trennlinie zwischen «natürlichen» und «technischen» Nutzbarmachungen des Klaviers kann allerdings keine Rede sein. Daher sind auch in der «Nuit de piano spectral» zwei Werke aus dem Weichbild jener – so will es das Klischee – technikorientierten Seriellen Musik zu hören, der die Musique spectrale schließlich als Gegenentwurf entgegengestellt wurde. Doch auch und gerade die Mitte der 1950er Jahre entstandenen Klavierkompositionen von Boulez und Stockhausen entfalten eine unmittelbare Klangsinnlichkeit, die den – Achtung! – komplex geballten Wolken Franz Liszt oder den irritierenden Spiegelungen Ravels in nichts nachsteht. Um mit Hilfe des Wohlgeordneten Klaviers solcherart vielfältigen organischen Formen Atem einzuhauchen, bedarf es außergewöhnlicher Interpreten. Mit Michael Wendeberg, Michaël Lévinas (der als Komponist wie als Pianist – unter anderem der historischen Uraufführung von Murails Territoires de l’oubli – zu den zentralen Figuren der Musique spectrale gehört) und Nicolas Hodges steht eine Nacht der in allen Spektralfarben leuchtenden Klavierklänge bevor. Es bleibt zu erwähnen, dass auf den außergewöhnlichen Ablauf des Abends abgestimmte Stärkungen im Foyer erhältlich sind. 104 Le corps sonore Jean-Philippe Rameau Jean-Philippe Rameau: Observations sur notre instinct pour la musique et son principe (1754). Reprint de Rameau, JeanPhilippe: Observations … – Genève: Slatkine Reprints, 1971, pp. 35–27 105 Catalogue d’oiseaux Olivier Messiaen Mein Umgang mit den Vögeln hat viele Leute zum Lachen gebracht, weil die Vögel für sie ‹kleine Vögel› sind. Sie glauben, dass es niedere Tierarten sind, weil sie so klein sind. Das ist vollkommen idiotisch – außerdem gibt es auch einige sehr große Vögel. […] Ich habe begriffen, dass der Mensch viele Dinge gar nicht erfunden hat, sondern dass viele Dinge bereits um uns herum in der Natur existierten. Nur hat man sie nie wahrgenommen. Es war viel die Rede von Tonarten und Modi: Die Vögel haben Tonarten und Modi. Man hat auch viel von der Teilung der kleinen Intervalle gesprochen – die Vögel singen diese kleinen Intervalle. Auch spricht man seit Wagner von Leitmotiven: Jeder Vogel ist ein lebendiges Leitmotiv, weil er seine eigene Ästhetik und sein eigenes Thema hat. Man spricht weiter heute viel von aleatorischer Musik: Das Erwachen der Vögel, wenn sie alle zusammen singen, ist ein aleatorisches Ereignis. Ich habe also die Vögel gewählt – andere den Synthesizer. 106 Klavierstücke V–VIII Karlheinz Stockhausen Typoskript Karlheinz Stockhausen, ca. 1955 Archiv Universal Edition Wien 107 Riesiger intellektueller Appetit Karlheinz Stockhausen, David Tudor und die amerikanische Avantgarde Peter Niklas Wilson […] Die heroischen Aufbruchsjahre des Serialismus, deren Produkt Stockhausens frühere Klavierstücke sind, gehören bereits der Geschichte an. […] Nicht, dass diese Musik in vier Jahrzehnten irgend etwas von ihrer Radikalität eingebüsst hätte, sich zum ästhetischen Normalfall abgeschliffen hätte. Im Repertoire gewöhnlicher Klaviersoireen sucht man sie nach wie vor vergebens. Nicht ohne Grund: Zu vehement bleibt ihre Geste der Negation. Wie Stockhausen 1955 in einer Einführung zu Klavierstück I schrieb: «Für die jetzige musikalische Sprache ist das sehr typisch: keine Melodie mit Begleitung, keine Haupt- und Nebenstimme, kein Thema und keine Überleitung, auch nicht harmonische Verbindungen komplizierterer und einfacherer Art als Spannung und Auflösung oder synkopierte Rhythmen, die in regelmässige aufgelöst würden.» «Keine», «nicht» aber was dann? Eine Musik, in der «alles zu allem überleitet», die «sich ständig im Fluss befindet […], ohne das Verweilenwollen beim Augenblicklichen, bei den schönen Stellen.» Verwirklicht zunächst in einer «punktuellen Form», in dem jeder Ton in all seinen Eigenschaften individuell behandelt wird (u.a. noch in Klavierstück IV), dann – z.B. in Klavierstück I – in einer «Gruppen-Form», in der der Versuch unternommen wird, «die Gleichberechtigung in höher organisierten Organismen mit charakteristischen Gruppenbildungen zu komponieren». Historisch legitimiert fühlte sich Stockhausen dabei durch Gruppenbildungen, wie er sie in Anton Weberns Klaviervariationen fand – doch war dies eine Legitimation a posteriori, wie überhaupt Stockhausens kompositorische Praxis der theoretischen Formulierung vorausging (was nebenbei das gebetsmühlenartig wiederholte Argument widerlegt, serielles Komponieren sei nur eine mechanische Ausarbeitung eines leblosen rationalen Konstrukts gewesen). «Die Begriffe», schrieb Stockhausen 1955 über die Genese von Klavierstück I, «fand ich erst viel später – wie ich denn auch zu der Zeit noch nicht eine einzige Webernanalyse gemacht hatte und erst wenige Werke Weberns in Darmstadt einmal gehört hatte». Dass dieser Webern-Eindruck dennoch aussergewöhnlich profund war, hört man den Klavierstücken I–IV, zumal dem dritten, an. Und sogar andere, weit weniger offensichtliche Traditionsstränge lassen sich in diesen scheinbar so radikal traditionsverneinenden Miniaturen ausmachen: So lässt sich das vierte als eine Art zweistimmige Invention hören – nur dass die Stimmen nicht durch lineare Kontinuität, sondern durch extrem unterschiedliche Dynamik-Niveaus voneinander abgesetzt sind. Der Text ist erstmals erschienen im Booklet der CD Karlheinz Stockhausen. David Tudor, piano. – hat ART CD 6142 (1994). Wiedergabe hier in stark gekürzter Form. 108 Zwischen den Klavierstücken I–IV (1952–1953) und V–VIII (1954–1955) liegt nur ein Jahr – aber ein für Stockhausens Komponieren äusserst folgenreiches. 1953 und 1954 arbeitete Stockhausen vorwiegend an seinen ersten elektronischen Werken, den Studien I und II. Und im Herbst 1954 lernte er John Cage und David Tudor kennen, die eine Europatournee unternahmen. Tudor hielt sich einige Tage bei Stockhausen auf und machte ihn mit Cages Music of Changes, Morton Feldmans Intersection 111 und Klaviermusik von Christian Wolff bekannt. «Stockhausen war begeistert von der Neuheit der Klänge und der Vielfalt der Anschlagsarten», berichtete Tudor später über dieses Treffen, das den Beginn eines kreativen Austauschs zwischen New York und Köln markiert. «Ich war wie ein Bote zwischen den Staaten und Europa», resümierte Tudor später treffend. Denn er war es, der bereits 1950 die amerikanische Erstaufführung von Boulez’ Zweiter Klaviersonate gespielt hatte – die einen tiefen Eindruck auf Cage machte –, und in den folgenden Jahren Werke von Stockhausen, Pousseur, Nilsson und anderen Europäern nach Amerika brachte. Er war es, der die Klaviermusik der «New York School» (Cage, Feldman, Wolff, Brown), die zum grössten Teil for seine exzeptionellen Fähigkeiten konzipiert worden war, in der Alten Welt vorstellte – und damit nicht nur Stockhausen inspirierte. In Stockhausens Klavierstücken V–VIII sind die Spuren der Begegnung mit Tudor und den Klavierpartituren in seinem Reisegepäck jedenfalls ebenso deutlich auszumachen wie die Erkenntnisse der Sondierung der elektronischen Klangwelt. Die hochdifferenzierten Pedalisierungsvorschriften, stumm gedrückten Tasten, Flageolett und Echowirkungen und Cluster, die in Stockhausens zweitem Zyklus von Klavierkompositionen verlangt werden – Vorschriften, wie man sie in den Klavierstücken I–IV vergeblich suchen wird – sind ebenso Reaktion auf Tudors pianistische Offenbarungen wie ein Versuch, jene individuellen Ein- und Ausschwingvorgänge einzelner Klangkomponenten, wie sie im elektronischen Studio herstellbar waren, fürs instrumentale zu erschließen. Dabei führte dieser doppelte Erkenntnisprozess nicht bloss zu einer immensen Bereicherung der seriell abgetönten Klangfarbenpalette, sondern auch zu einer entscheidenden Flexibilisierung des Zeitgefüges: Die neuen Klänge hatten, wie Stockhausen erkannte, eine Eigenzeit, die sich nicht ohne weiteres in ein prädeterminiertes temporales Gerüst einpassen wollte. Und so finden sich in Stockhausens Erläuterungen zum zweiten Zyklus der Klavierstücke nicht von ungefähr vorsichtige Anklänge an das Feldmansche «Don’t push the sounds around» oder das Cage’sche «Let sounds be sounds»: «Eigenzeiten der Klänge» […] treten immer stärker an die Stelle der Uhrzeit oder der Zählzeit; eine Reihe neuer Anschlagsformen (Flageolettwirkungen, ‹Echos›, viele Grade der Pedalisierung modulieren die Farbspektren des Klaviers) wird zur Bestimmung von sogenannten Zeitfeldern herangezogen, in denen der Spieler ständig auf das Eigenleben der Klänge und Klangfiguren reagiert. […] 109 Sonate «Que me veux-tu» Pierre Boulez Ma sonate, avec les cinq formants qu’elle comporte, est, pour reprendre cette appellation, une sorte de «work in progress». Il m’est de plus en plus étranger de concevoir des œuvres comme productions fragmentaires; j’ai une prédilection marquée pour les grands «ensembles», centrés autour d’un faisceau de possibilités déterminées. (Là, encore, l’influence de Joyce!…) Aussi bien les cinq formants me laissent-ils sans doute le loisir d’engendrer d’autres «développants», s’imposant comme des touts distincts, se rattachant, toutefois, par leur structure, aux formants initiaux. Ce Livre constituerait un labyrinthe, une spirale dans le temps. Mais revenons aux cinq formants réels. Je les ai ainsi appelés par analogie avec l’acoustique. On sait qu’un timbre est rendu caractéristique par ses formants; j’estime que, de même, la physionomie d’une œuvre provient de ses formants structurels: caractères spécifiques généraux, susceptibles d’engendrer des développements. Chacun d’eux apparaît dans chaque pièce, exclusivement, afin de pouvoir, plus tard, constituer ces «développants», que j’ai mentionnés, par échange, interférence, interaction, destruction. Le nom donné à ces formants cerne leur physionomie, met l’accent sur leurs caractéristiques individuelles: 1. Antiphonie; 2. Trope; 3. Constellation, et son double: Constellation – Miroir; 4. Strophe; 5. Séquence. Chacun de ces formants est susceptible d’une plus ou moins grande détermination, suivant les degrés de liberté que l’on peut prendre vis-à-vis de la forme globale, ou des structures locales. […] Le troisième formant s’appelle Constellation; il est réversible: on a, d’un côté de la feuille la forme originale, de l’autre côté, la succession rétrograde, appelée Constellation – Miroir. Il doit être joué une seule fois, naturellement dans l’une de ses deux transcriptions. Pourquoi cette pièce est-elle double figure d’elle-même? Parce que sa place est immuable au centre des formants, mais j’expliquerai plus loin la relation des formants entre eux, suivant une constitution générale. Le texte est écrit en deux couleurs, rouge et vert: la couleur verte se rapporte aux ensembles intitulés: points; la couleur rouge aux ensembles intitulés: blocs. Ces deux titres décrivent exactement la morphologie des structures employées; points: structures à base de fréquences pures, isolées – les accords se produisent seulement par la rencontre dans le même instant de deux ou plusieurs points; blocs: structures à base de blocs sonores sans cesse variant, pouvant être frappés verticalement ou se décomposant horizontalement dans une succession très rapide (de manière qu’on ne perde pas d’oreille, si je puis dire, l’identité d’un bloc). Extrait de: Pierre Boulez: Points de repéres. – Paris: Christian Bourgois, 1995, pp. 156–160. Reproduit avec l’autorisation de Christian Bourgois Editeur. Texte écrit en 1960. 110 À des ensembles ponctuels, s’opposent, par conséquent, des ensembles agrégatifs; autrement dit, à une neutralité d’identité invariable (fréquence pure), s’oppose une individualité caractérisée variable (bloc sonore). Je ne décris là que le principal critère organisateur de cette pièce; il y en a d’autres naturellement, secondaires, adjacents, comme le timbre – du son direct au son réverbéré en passant par la zone intermédiaire –, le registre délimitant le champ de fréquences dans lequel se mouvra tel ensemble –, etc. Die Welt der Klangfarben Pierre Boulez Die Welt der Klangfarben läßt sich, wie übrigens auch die der Lautstärken, nicht so leicht in den Griff bekommen. Merkwürdigerweise gründet sich der gewöhnliche Gebrauch von beiden auf genau gegenteilige Charakteristiken: die Klangfarben werden – bis auf einige seltene Erforschungen der Annäherung und Verwandtschaft zwischen Instrumentalgruppen – meist in diskontinuierlicher Weise verwendet, während die Dynamik in der Mehrzahl der Fälle eine kontinuierliche Geste benutzt. Eine der größten Schwierigkeiten, denen man bei der Wiedergabe zeitgenössischer Musik begegnet, ist die Verwirklichung einer diskontinuierlichen Dynamik, die sich bis zur Stunde lediglich auf Akzente wie «subito sforzando» oder «subito piano» eingeschränkt sieht. Indessen kann man auf diesen beiden Gebieten auch nicht dieselbe Strenge einhalten wie bei Höhen und Dauern. Einerseits gestattet die Organisation der Klangfarben den Begriff des Schnittes nicht in der Art, wie er oben aufgestellt wurde; wenn man mit Frequenzen oder Dauern arbeitet, hat man es mit einfachen linearen Gegebenheiten zu tun – das gleiche gilt sogar für elektroakustisch gemessene Lautstärken; die Klangfarbe hingegen ist eine komplexe Funktion von Höhe, Dauer und Lautstärke: das Kontinuum der Klangfarbe schließt folglich das Kontinuum dieser komplexen Funktion selbst mit ein. Auf der anderen Seite hat die Lautstärke in der musikalischen Praxis einen viel beschränkteren Umfang als die drei anderen Toneigenschaften, und für den Schnitt besteht, außer bei der Kontrolle durch Meßgeräte, die Chance der Präzision nur im Fall genügender Breite; das Gebiet der Lautstärken – reduziert im Umfang und durch die natürlichen Beschränkungen des Schnittes, wie es ist – läßt nicht die gleiche Mannigfalt der Mittel zu. Der übliche Gebrauch von Klangfarben und Lautstärken drückt nur diese Grundgesetze ihrer Existenz aus. Man kann, ohne die Grenzen und Unzulänglichkeiten dieser «Umschreibung» zu verkennen, die Benennung «glatt» und «geriffelt» auch hier wieder aufgreifen, indem man sie der Komplexität der Klangfarbe angleicht und auf die Begrenztheit der Lautstärke einengt: vor allem aber bleibt die Dialektik Kontinuität – Diskontinuität in Kraft. Was die Klangfarben betrifft, läßt sich eine gegebene Folge von Klangfarben oder Klangfarbengruppen, die eine Periode bilden, als «modulo» nehmen; der Schnitt wäre folglich – in Analogiebildung – jedes Element oder jede Elementgruppe, aus denen sich die Periode zusammensetzt; der Brennpunkt definierte sich dann durch gleiche Familie mit ähnlichen Klangfarben. Vermittels dieser Angleichung lassen sich die großen Einteilungen des geriffelten und glatten Raumes auch auf die Klangfarben übertragen. Ich möchte übrigens betonen, daß ich unter Klangfarbe nicht allein das eigentliche Klangspektrum verstehe, sondern auch den Einschwingvorgang, den stationären Klangzustand und den Vorgang der Ausschwingung, von denen die Entwicklung des Klangspektrums nicht zu trennen ist; mit andern Worten: ich erfasse die Klangfarbe nicht nur unter ihrem statischen, sondern auch in ihrem kinetischen Aspekt. Auszug: Pierre Boulez: Musikdenken heute 1 / aus dem Französischen übertragen von Josef Häusler und Pierre Stoll – Mainz: Schott, 1963 (Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik, Band XVII), S. 81–83. Abdruck mit Genehmigung von Schott Musik International GmbH & Co. KG Mainz 111 Impromptu Hèctor Parra Impromptu a été écrit en 2005 en mémoire du compositeur catalan Joaquím Homs, décédé en 2003, et commandé par le pianiste Jordi Masó. Dans cette pièce, les textures du début, à caractère presque spontané, grandissent et s’enflamment pour se vaporiser rapidement dans des nuageuses harmonies de registres extrêmes. Les stèles de résonance laissées par la troisième pédale agissent comme des axes de force qu’unissent les polyphonies complexes qui s’opposent aux homorythmies strictes. En même temps, le caractère percussif et nerveux des graves étouffées du piano produit une activation de la masse harmonique crée par les accords denses du registre central, tout en tissant un discours changeant et de nature éphémère. L’interprétation offerte par Michael Wendeberg à la Philharmonie Luxembourg le 26 novembre 2005 constitue la création mondiale de cette pièce. 112 Fleuve David Robert Coleman Fleuve is a prelude for piano written in 1997. As the title suggests, the music unfolds through stream-like gestures through the different registers and resonancelayers of the piano. At this time I was interested in developing new «harmonic colours» that could still be expressed by the possibilities of the normally tuned piano. These harmonic «colours» oscillate between quasi-spectral and modal realms whilst avoiding any systematic fixation. I have always been interested in Skriabins last Preludes op. 74. Perhaps my piece is a kind of «hidden commentary» on some of the chords and resonance structures in Skriabin’s last enigmatic and visionary little pieces. I have also always been interested in a static, oneric approach to sonority. I love the Debussy Etudes, especially «Pour les Quarts» and «Pour les Sonorites Opposés». I am interested in Wagners recontextualisation of harmony through colour, meaning in his case, orchestration, the way an A major chord changes its appearance through registral placing and coloration as in the opening of Lohengrin. Another interest / «point de repère» is the agogics of interpretation and the way notation can be made simple and complex enough to open the interpreter’s performance to declamatory, agogic possibilites. In this sense I have always been fascinated by Wagner’s essay on conducting and the way tempo should serve and enable musical characterisation. So although Fleuve is notated more or less conventionally, I have tried to do this in such a way that the music, through a first-class interpreter, obtains an improvisatory character, without boxing the interpreter in through over-fussy complexistic notation. Often I have used characterisation markings such as «poco hesitando al commincio» or «tornando al tempo primo» rather than too complex rhythmic writing. In fact some of the most subtle rhythmic playing I have ever heard is Rachmaninov playing his own music. What a fascinating relationship there is there between extreme clarity in the musical notation and agogic subtlety in the performing. About the harmony, apart from late Skriabin, I have also been influenced by a piece like Tristan Murail’s Territoires de l’Oubli where spectral pitch calculations, such as the chord generating technique of Frequency Modulation are approximated to the 12 tempered pitches, thereby, even without the delimitation of microtonality, discovering a coherent colourful harmonic language. In my music the chords are generally derived from Ring-modulation models, whereas the melodic line has a modal character. 113 Prismes … Miroirs de Maurice Ravel (1875–1937) Dominique Escande Le 16 juin 1904, Ricardo Viñes présenta Maurice Ravel à Cipa Godebski chez qui, en présence du peintre Pierre Bonnard, le compositeur joua le premier mouvement de sa Sonatine pour piano op.40. En octobre, il interpréta chez Maurice Delage, Les oiseaux tristes, la seconde pièce des Miroirs qu’il venait de composer à Levallois-Perret, près de Paris. Ravel avait alors trente ans et à son actif, une solide formation de pianiste et compositeur, lorsqu’il fit connaître Miroirs aux «Apaches», jeunes peintres, musiciens et écrivains de l’avant-garde qui se réunissaient régulièrement. Chacune des cinq pièces de Miroirs leur sera dédiée dont la première, Noctuelles, à Leon-Paul Fargue, la seconde, Les oiseaux tristes au virtuose catalan Ricardo Viñes («car il était drôle de dédier à un pianiste une pièce qui n’avait rien de pianistique») et Alborada del gracioso, la quatrième, évoquant les guitares et castagnettes, à Michel Dimitri Calvocoressi. Riccardo Viñes en assura la création, le 6 janvier à la Société Nationale de Musique, salle Érard. Ravel, pianiste compositeur Le style pianistique de Ravel s’est élaboré minutieusement, depuis qu’à l’age de 6 ans, il fut initié au clavier par Henri Ghys. René Charles, qui lui enseigna les rudiments de l’harmonie à partir de 1887, soulignait l’attirance précoce de Ravel pour les dissonances aiguës et les frottements de l’accord de septième majeure et de ses renversements. Deux ans plus tard, Ravel entra au Conservatoire dans la classe de piano d’Anthiome et en 1891, dans celle de Charles de Bériot, où il rencontra Ricardo Viñes. Muni d’un premier prix de piano, ses audaces harmoniques déconcertèrent cette fois son professeur, Emile Pessard. Les renversements de neuvièmes et cadences modales de ses premières œuvres reflètent la double influence de Chabrier et Satie, tandis qu’en 1895, sa Habanera pour deux pianos, contient des pédales obstinées et sixtes napolitaines sur pédale, enchaînées aux septièmes, qui seront l’un de ses signatures harmoniques. Ravel bénéficie d’un entourage stimulant, et développe dans Jeux d’eau (1901), une technique de clavier nouvelle qui le rapproche de Debussy. Sa technique, étroitement liée à l’élaboration harmonique, s’éloigne peu à peu de l’écriture debussyste, héritière de Chopin et des luthistes, pour se rapprocher de celles de Liszt et des clavecinistes auxquelles il emprunte la virtuosité. Ravel est également maître du trille, sorte de pendule oscillant, allant du consonant au dissonant. Harmoniste, Ravel étend l’accord dissonant, sachant avec une sensibilité logique, y trouver les notes pivots qui font accent, préciser la ligne mélodique et rythmique de son discours musical. Miroitements et scintillements harmoniques Au delà du jeux pianistique et de l’harmonie, Ravel avait à l’esprit la qualité acoustique des sonorités et était sensible aux expériences scientifiques concernant l’analyse de la structure du son: «J’ai l’impression que les récents progrès en acoustique, permettent d’appliquer aux sons des mesures aussi nombreuses et variées que celles utilisées par d’autres moyens d’expression artistique, comme l’architecture. Je dirais même que, depuis que le jeune savant russe Theremin a perfectionné ses premiers instruments et 114 peut maintenant, transformer les vibrations de l’éther en vibrations musicales de n’importe quelle hauteur, intensité et qualité désirées, la partie sonore de la musique semble être parvenue à portée de l’analyse»1. En 1905, nul ne pouvait ignorer la révolution picturale impressionniste, le réalisme lumineux qui substitue aux principes antérieurs de primauté du contour, de la ligne et du modelé, un système optique capable de contrefaire la lumière par un jeu de petites touches juxtaposées ou d’exalter les couleurs par une utilisation, sans doute plus instinctive que dictée par la Loi du Contraste simultané de Chevreuil (1839). Cette perception visuelle instantanéiste du temps, cet art de capter les irradiations infiltre la matière musicale. Dans cette optique, les Miroirs avoisinent les Reflets dans l’eau (extrait des Images I ) de Claude Debussy, également composés en 1905 et dans lesquels les procédés optiques de la peinture impressionniste et les procédés acoustiques de la musique semblent se rejoindre. On retrouve dans Miroirs, les touches juxtaposées et les suites d’accords différenciés dont l’impression globale provoque une sensation d’irisation, les reflets produits d’octaves en octaves et des procédés de réverbération en écho. Car le miroir, est également une technique musicale, que J.S. Bach utilisait déjà dans L’Art de la fugue. Le procédé musical du miroir consiste à appliquer le renversement des intervalles à l’ensemble des voix de la polyphonie. Les éléments mélodiques et harmoniques de celle-ci se trouvent ainsi reproduits systématiquement dans l’ordre inverse, comme s’ils étaient réfléchis par un miroir… Cette technique est également expérimentée par le peintre Pierre Bonnard que Ravel rencontre cette même année 1905. Par l’emploi de la technique du miroir, Ravel montre qu’il ne renonce pas à la dialectique du développement et aux rigueurs de la construction pour donner priorité au plaisir immédiat du timbre et de la couleur harmonique au risque de sombrer dans le vague et le flou, l’informel et l’éphémère. Maurice Ravel: «La musique contemporaine» (introduction au concert du 7 avril 1928 au Rice Institute, Houston /Texas, où Ravel joua La Vallée des Cloches (Miroirs). Dans: Ravel, M.: Lettres, écrits, entretiens. – Paris: Flammarion (Harmoniques), 1989 1 Pierre Bonnard: procédé en miroir dans son esquisse de la Seine à Vernon, vers 1929, crayon gris sur papier marouflé, 12,7 x 16,5 cm. The Minneapolis Institute of Arts Miroirs, que nous dites-vous … L’effet optique du miroir permet également à Ravel d’imaginer une harmonie très différente de ce qu’il avait conçu jusqu’alors, ce qu’il exprime dans son Esquisse biographique: «Les Miroirs (1905) forment un recueil de pièces pour le piano qui marquent dans mon évolution harmonique un changement assez considérable pour avoir décontenancé les musiciens les plus accoutumés jusqu’alors à ma manière. Le premier en date de ces morceaux – et le plus typique de tous – est à mon sens le second du recueil: les Oiseaux tristes. J’y évoque des oiseaux perdus dans la torpeur d’une forêt très sombre aux heures les plus chaudes de l’été. Le titre des Miroirs a autorisé mes critiques à compter ce recueil parmi les ouvrages qui participent du mouvement dit impressionniste. Je n’y contredis point, si l’on entend parler par analogies. Analogie assez fugitive d’ailleurs, puisque l’Impressionnisme ne semble avoir aucun sens précis hors du domaine de la peinture. Ce mot de miroir en tout état de cause ne doit pas laisser supposer chez moi la volonté d’affirmer une théorie subjectiviste de l’art. Une phrase de Shakespeare m’aidera sur ce point à préciser une intention toute opposée: «La vue ne se connaît pas elle-même avant d’avoir voyagé et rencontré un miroir où elle peut se connaître» ( Jules César, Acte I, scène 2). Le titre de la première pièce, Noctuelles (du latin ‹noctua›, chouette) se rapporte aux papillons de nuits ou autres espèces de la famille des noctuidés. En ré b majeur, la partition se nourrit d’arpèges volubiles. Ravel y introduit un nouvel agrégat harmonique: l’enchaînement sol dièse, si, ré sol bécarre au la b, si, ré, sol. Ravel y enchaîne souvent l’accord de septième diminuée avec son appogiature supérieure, non résolue à la septième ou neuvième mineure sans septième. Tout semble fusion, glissement, notes de passages, suggérant de gros papillons battant des ailes. Les traits sont plus acides que dans Jeux d’eau. 115 Les procédés diffèrent dans Les oiseaux tristes, à la mélancolie statique, de tempo lent. Les oiseaux semblent traîner leurs roulades et se délecter de dissonances sur basses mouvantes. La tonalité de mi b s’éclaire passagèrement d’un ré dièse. Les oiseaux tristes ne sont pas isolés dans l’œuvre de Ravel: La Goélette, l’Indifférent dans Schéhérazade, Le lento du Quatuor, retracent le monde naïf et poétique des contes pour enfants. Si les harmonies font songer à Moussorgski, le dessin thématique est clairement celui des oiseaux, que l’on retrouvera avec le Paon ou le Martin-Pêcheur de la fin du Grillon des Histoires naturelles. Tout autre est l’esprit de l’Alborada del gracioso (assez vif, ré mineur), dans lequelle Ravel fait appel au monde hispanique qui est celui de sa mère, originaire d’Aranjuez. On y entend déjà des bribes de l’Heure espagnole (1907), de la Rhapsodie espagnole (1907), ou du Boléro (1928). Ravel se concentre ici sur la forme et la construction, retrouvant les incises de la Habanera, la nostalgie des guitares et des harmonicas. Les incises sont ici nerveuses et pures, presque graphiques. Des arides staccatos, se dégagent un thème de danse en ré mineur et un motif protéiforme qui se réduit à un triolet de doubles croches. Rythmicien, Ravel utilise un continuo qui lui permet de se renouveler sans sortir de sa proposition rythmique initiale. Les œuvres d’inspiration hispanique renouvellent sa manière et lui permettent de lutter contre l’Impressionnisme dont il voulait se libérer. Ravel souhaitait des accords très serrés, comme des pincements de guitare. Son adresse dans le glissando en doubles notes tenait probablement à la forme de son pouce. L’essentiel étant de donner l’impression d’un jet rapide se terminant par un accent. Les Miroirs furent qualifiés de «Debussy glacé», sans émotion; d’un Ravel qui dissèque «la plaque froide de son miroir» et «examine à la loupe les images artificielles qui s’y sont fixées». Accusé par Lalo d’avoir plagié, l’enjeux des Miroirs se situe ailleurs que dans le contexte éclectique et compétitif du langage en formation de l’année 1905. Car les Miroirs continueront bien après Debussy et Ravel, par les images étranges qu’ils renvoient, à fasciner le monde musical, des Miroirs du languedocien Déodat de Séverac aux Miroirs de Jésus d’Olivier Messiaen. 116 Anaglyphe Michaël Lévinas Cette pièce a été une commande du Concours Marguerite Long 1995. Elle est dédiée à la mémoire de ma mère. La commande pour un concours international impliquait un cahier de charge: l’œuvre devait exiger un grand niveau de virtuosité. Anaglyphe est une série de variations sur un «motif secret», un thème difficilement identifiable mais structuré sur un mode 2 et des rythmes grecs antiques. Ce thème a été pris chez Scriabine. L’écriture polyphonique du piano consiste à superposer des strates en subdivisant les registres du piano et en utilisant la pédale sostenuto. On peut retrouver dans les ornementations du «motif secret», des «désinences» et des «arpèges renversés» qui ont déterminé la couleur du piano dans la première de mes Trois études (1992). 117 Triller à la Villa d’Este Michaël Lévinas1 Dans: Lévinas, Michaël: Le compositeur trouvère. Écrits et entretiens (1982–2002) / Textes réunis et annotés par Pierre-Albert Castanet et Danielle Cohen-Lévinas. – Paris: l’Harmattan (L’Itinéraire), 2002, pp. 55–58. Reproduit avec l’autorisation de Michaël Lévinas. 1 Franz Liszt: Années de Pèlerinage, deuxième année, Italie, 1838–1848 2 Michaël Lévinas explore la résonance du piano. 3 Par exemple le Concerto pour un piano espace N° 2 de Michaël Lévinas. 4 Michaël Lévinas a enregistré le premier Cahier des Préludes de Debussy en 1998 chez Arion /Vérany. 5 L’écriture et l’instrument L’étude des traits des Jeux d’eau à la Villa d’Este 2 pourrait permettre de cerner plus précisément le rapport étroit entre l’écriture musicale et ce phénomène sonore quelque peu étrange et magique que l’on nomme «virtuosité». À la lecture des témoignages de l’époque sur Liszt, nous trouvons souvent les termes de «diabolique» et de «sur-humain». Or, ces quelques lignes tenteront de montrer comment, pour Liszt, la virtuosité mène à une nouvelle conception du son instrumental et du rôle de ce timbre dans l’élaboration d’une œuvre. En ce sens, les Jeux d’eau à la Villa d’Este représentent l’exemple le plus frappant.3 Œuvre presque totalement libérée de toute forme de programme, elle correspond à un processus de composition concentré sur la recherche sonore. Il s’agit là d’une composition révolutionnaire qui influe sur notre musique contemporaine. Prenons le premier trémolo-trille de cette pièce. Le trémolo et le trille en triples croches n’ont pas de fonction mélodique. Ils sont fondus par la pédale, et provoqueront un effet de nuage, comme dirait Xenakis. La phrase mélodique jouée à la main gauche est comme amplifiée par le jeu de résonances harmoniques des trémolos et des trilles. Le trille devient une sorte de vibration. Trilles et trémolos ont la même fonction et se rejoignent dans le même mode de jeu: entretenir cette «vibration harmonique» inspirée des bruits de l’eau dans les loggias du jardin de Tivoli. Ce premier exemple est fondamental. Liszt provoque par la rapidité du jeu pianistique, une fusion des notes. Cela détermine une exécution obligatoire non «dessinée» (contrairement à la tradition de l’ornementation). Une telle écriture instrumentale de ces trilles et de ces trémolos abat d’un seul coup des frontières entre mélodique et harmonique, durée de la vibration des fréquences du piano et articulation des notes. Ainsi, ce trait pianistique nous permet de réfléchir à quelques origines cachées de la virtuosité, origines que l’on pourrait trouver déjà dans les trilles du premier mouvement du Cinquième Concerto Brandebourgeois de Bach. Certes, Liszt n’était pas le seul à son époque à utiliser la virtuosité comme une approche particulière et un «mixage» de sons. Un souvenir que Hanon raconte dans ses exercices de piano sur l’interprétation publique du «grand trémolo» par Thalberg, nous indique que l’auditoire percevait dans cette performance une «sorte d’ébranlement comme un tremblement de terre». Mais les Jeux d’eau de la Villa d’Este n’en restent pas à ce stade de l’élémentaire. On pourrait dire, à une seconde lecture qui ne se limiterait pas à l’analyse classique, que la forme est issue de cette idée de «virtuosité-timbre», et d’une étude acoustique essentielle au piano moderne. Le piano espace Les loggias de la villa d’Este, de dimensions diverses, ont toutes un espace acoustique réverbéré. Le bruit de l’eau (bruit blanc trillant et vibrant) est filtré et comme «fusionné» par les temps de réverbération, la pression des jeux d’eau et 118 l’espace. Chaque loggia réfléchit et projette le bruit de l’eau comme l’architecture d’une scène à l’italienne. Le piano, avec sa réverbération incorporée (pédale et caisse de résonance), avait pour Liszt les mêmes caractéristiques acoustiques que ces loggias. Le «traitement» de la virtuosité des notes du piano par la pédale suggère ce bruit vibrant de l’eau travaillé par l’espace de la loggia. Que de variations de l’eau à Tivoli! La moindre fontaine qui distille des gouttelettes dans le sur-aigu est amplifiée et modulée. Nous voyons ainsi se définir une forme inspirée de ces multiples filtrages des fontaines de Tivoli, mais aussi apparaître les grandes possibilités du piano moderne: le piano espace.4 Les Jeux d’eau de la Villa d’Este peuvent être entendus comme une série de variations sur ce «timbre-virtuosité» déjà cité. Il ne sera qu’accompagné par la mélodie. Ici, le timbre-virtuosité deviendra cristallin dans l’aigu, puis redescendra dans le grave. Les limites de la notation et l’improvisation dans la virtuosité Ces diverses analyses nous laissent supposer que la notation de Liszt a souvent une fonction de «mémento». L’interprétation de Liszt par lui-même était sans doute fondée sur une sorte d’aléatoire. Tout cela n’était pas de l’imprécision. Il y avait dans sa conception de l’œuvre une autre utilisation des notes, des inflexions et des phrasés. Il est souvent inutile chez Liszt de partir, comme chez Beethoven, d’une liaison pour comprendre un «phrasé». L’effet global, le spectre harmonique d’un enchaînement des notes, est souvent plus important que l’énoncé et l’intonation de la courbe mélodique. C’est là que se trouvaient sans doute les marques de l’improvisation de Liszt-interprète de ses œuvres. C’est en cela sans doute que la virtuosité «lisztienne» et les Jeux d’eau dans la Villa d’Este ont exercé une telle influence sur l’Impressionnisme de Ravel et Debussy5. Les fontaines à la Villa d’Este. Photos: B. Pediconi / N. Marziali / G. Bianchi, www. villadestetivoli.info 119 Etudes pour piano György Ligeti1 Wie kam ich auf die Idee, hochvirtuose Klavieretüden zu komponieren? Der auslösende Umstand war vor allem meine ungenügende pianistische Technik. Das einzige Musikinstrument, das in meiner Kindheit in unserer Wohnung stand, war ein Grammophon. Ich verschlang Musik von Schallplatten. Erst als ich vierzehn Jahre alt war, konnte ich bei meinen Eltern durchsetzen, daß ich Klavierunterricht bekam. Da wir kein Klavier besaßen, ging ich täglich zu Bekannten, um zu üben. Als ich fünfzehn war, mieteten wir schließlich einen Flügel. Ich wäre so gerne ein fabelhafter Pianist. Ich verstehe viel von Anschlagnuancen, Phrasierung, Agogik, vom Aufbau der Form. Und spiele leidenschaftlich gerne Klavier, doch nur für mich selbst. Um eine saubere Technik zu bekommen, muß man mit dem Üben noch vor dem Eintreten der Pubertät beginnen. Diesen Zeitpunkt habe ich aber hoffnungslos verpaßt. Meine – bis jetzt fünfzehn – Etüden (ich möchte noch weitere schreiben!), sind also das Ergebnis meines Unvermögens. Cézanne hatte Schwierigkeiten mit der Perspektive. Die Äpfel und Birnen in seinen Stilleben scheinen jeden Augenblick wegrollen zu wollen. In seiner eher linkischen Darstellung der Wirklichkeit bestehen die gefalteten Tischdecken aus starrem Gips. Und trotzdem, welches Wunder hat Cézanne mit seinen Farbharmonien vollbracht, mit der emotionell durchseelten Geometrie, mit seinen Rundungen, Volumina, Gewichtsverlagerungen! So etwas möchte ich anstreben: das Umwandeln von Ungenügen in Professionalität. Ich lege meine zehn Finger auf die Tastatur und stelle mir Musik vor. Meine Finger zeichnen dieses mentale Bild nach, indem ich Tasten drücke, doch die Nachzeichnung ist sehr ungenau: es entsteht eine Rückkopplung zwischen Vorstellung und taktil motorischer Ausführung. So eine Rückkpplungsschleife wird – angereichert durch provisorische Skizzen – sehr oft durchlaufen. Ein Mühlrad dreht sich zwischen meinem inneren Gehör, meinen Fingern und den Zeichen auf dem Papier. Das Ergebnis klingt ganz anders als meine ersten Vorstellungen: die anatomischen Gegebenheiten meiner Hände und die Konfiguration der Klaviertatatur haben meine Phatasiegebilde umgeformt. Auch müssen alle Details der entstehenden Musik kohärent zusammenpassen, die Zahnräder müssen greifen. Die Kriterien dafür befinden sich nur zum Teil in meiner Vorstellung, zum Teil stecken sie auch in der Klaviatur – ich muß sie mit der Hand erfühlen. 1 Der Text ist erstmals erschienen im Booklet der CD György Ligeti: Works for Piano. Pierre-Laurent Aimard. – Sony Classical SK 62308 (Ligeti Edition N° 3). Abdruck (gekürzt) mit freundlicher Genehmigung des Komponisten. 120 Da in adäquater Klaviermusik taktile Konzepte fast so wichtig sind wie akustische, berufe ich mich auf die vier großen Komponisten, die pianistisch dachten: Scarlatti, Chopin, Schumann, Debussy. Eine Chopinsche Melodiewendung oder Begleitfigur fühlen wir nicht nur mit unserem Gehör, sondern auch als taktile Form, als eine Sukzession von Muskelspannungen. Der wohlgeformte Klaviersatz erzeugt körperlichen Genuß. Eine Quelle solcher akustisch motorischen Genüsse ist die Musik vieler afrikanischer Kulturen südlich der Sahara. Das polyphone Zusammenspiel mehrerer Musiker am Xylophon – in Uganda, in der Zentralafrikanischen Republik, in Malawi und an anderen Orten – sowie das Spiel eines einzigen Ausführenden am Lamellophon (Mbira, Likembe oder Sanza) in Simbabwe, in Kamerun und in vielen anderen Gegenden haben mich veranlaßt, ähnliche technische Möglichkeiten auf den Klaviertasten zu suchen. (Ich verdanke dabei sehr viel den Aufnahmen und theoretischen Schriften von Simha Arom, Gerhard Kubik, Hugo Zemp, Vincent Dehoux und mehrerer anderer Ethnomusikologen.) Wesentlich waren für mich zwei Einsichten: einmal die Denkweise in Bewegungsmustern (unabhängig vom europäischen Taktdenken), zum anderen die Möglichkeit, aus der Kombination von zwei oder mehreren realen Stimmen illusionäre melodisch rhythmische Konfigurationen zu gewinnen (die gehört, doch nicht gespielt werden), analog zu Maurits Eschers unmöglichen perspektivischen Gestalten. In Automne à Varsovie spielt ein einziger Pianist mit beiden Händen simultan in zwei drei, manchmal vier verschiedenen Geschwindigkeiten – scheinbar. Das Stück Ist eine Art Fuge mit Diminutionen und Augmentationen von 3 zu 4 zu 5 zu 7. Die Kenntnis der superschnellen «Elementarpulsation» in der afrikanischen musikalischen Denkweise hat die Polyrhythmik (und «Polytempik») in dieser Etüde ermöglicht. Doch verwende ich nur eine technische Idee aus der afrikanischen Bewegungskultur, nicht die Musik selbst. In Afrika sind stets gleichlange Zyklen oder Perioden durch einen gleichmäßigen Beat (der meist nicht gespielt, sondern getanzt wird) getragen, und die einzelnen Beats lassen sich in zwei, drei, manchmal auch vier oder fünf «Elementareinheiten» oder schnelle Pulse unterteilen. Ich verwende aber weder die zyklische Form noch die Beats, dafür als Grundraster die Elementarpulsation. Dasselbe Prinzip benutze ich in Désordre für Akzentverrückungen, die dann illusionäre Musterdeformationen entstehen lassen. Der Pianist spielt rhythmisch gleichmäßig, nur die ungleichmäßige Akzentverteilung führt zu scheinbar chaotischen Konfigurationen. Noch eine Grundeigeinschaft der afrikanischen Musik war für mich wichtig: die Simultanität von Symmetrie und Asymmetrie: Die Zyklen werden immer asymmetrisch gegliedert (z.B. zwölf Pulse in 7 + 5), obwohl der gedachte Beat regelmäßig weiterläuft. Weitere Einflüsse, die mich bereicherten, kommen aus der Geometrie (die Musterdeformation aus der Topologie und selbstähnliche Gebilde aus der fraktalen Geometrie), wobei ich Benoît Mandelbrot und Heinz-Otto Peitgen wesentliche Anregungen verdanke. Und dann meine Bewunderung für Conlon Nancarrow. Aus seinen Studies for Player Piano habe ich rhythmische und metrische Komplexität gelernt. Er hat aufgezeigt, daß es Räume für rhythmisch melodische Subtilitäten gibt, die weit außerhalb der Grenzen liegen, die wir bisher in der «Modernen Musik» kannten. Ferner spielte für mich die Jazzpianistik eine große Rolle, vor allem die Poesie von Thelonious Monk und Bill Evans. Die Etüde Arc-en-ciel ist fast ein Jazzstück. Doch sind meine Etüden weder Jazz noch Chopin-Debussy-artige Musik, auch nicht afrikanisch, nicht Nancarrow und keinesfalls mathematische Konstrukte. Ich habe von Einflüssen und Annäherungen geschrieben was ich aber komponiere, läßt sich schwer einordnen, es ist weder avantgardistisch noch traditionell, nicht tonal und nicht atonal – und keinesfalls postmodern, da mir die ironische Theatralisierung der Vergangenheit fernliegt. Es sind virtuose Klavierstücke, Etüden im pianistischen und kompositorischen Sinne. Sie gehen stets von einem sehr einfachen Kerngedanken aus und führen vom Einfachen ins Hochkomplexe: Sie verhalten sich als wachsende Organismen. 121 Explication de la vibration Aleksandr Scriabine1 Chaque état de conscience est relation avec les autres états de conscience. Cela veut dire que toute représentation de quoi que ce soit est la négation de tout le reste. Dans cette négation, je me mets en relation avec autre [chose], c.-à-d. je lutte inconsciemment avec l’image consciente qui demeure en moi de cet autre. De la part de la conscience, j’éprouve autre [chose], du nouveau. D’autre part, [j’éprouve] tout le reste dans son aspiration à s’emparer de ma conscience. L’exaltation de cette lutte détermine le contenu qualitatif de l’état vécu par moi (par ex. différentes couleurs comme différentes quantités de vibrations dans une unité de temps). Mais cette représentation d’autre [chose] est seulement une relation à l’état vécu par moi, et se détermine comme sa négation, c.-à-d. comme une vibration qui est une certaine élévation du niveau d’activité. Les objets se différencient par le niveau d’activité, pour ainsi dire par la quantité de vibrations dans une unité de temps. Chaque moment donné dans l’histoire est la négation de tout le passé de l’humanité. Donc chaque moment qui suit est une élévation du niveau d’activité par rapport au précédent, comme se rapportant à la même quantité de moments que les précédents + lui-même. J’entends par là la création géniale. Plus puissante est l’image du passé, plus rapidement il envahit la conscience, plus grande est l’élévation de niveau indispensable pour son exclusion hors de la sphère de la conscience. C’est pourquoi toute l’histoire de l’humanité est élévation, dans son dernier moment – extase. Chacun des états de conscience est un point-limite dans le mouvement vibratoire. la vibration est la relation des états de conscience, et est le matériau unique. Leur apparente oscillation nous donne le schème des oppositions et leur identité dans la vibration. Chaque état de conscience, comme tel, est une sphère close, impénétrable aux autres états de conscience qui sont aussi des sphères closes. Dans ce fait de la fermeture de la sphère de chaque état se dissimule le fait de la démultiplication d’une conscience unique, dans laquelle sont contenus tous ses états. Dans le mouvement vibratoire, les points extrêmes de chaque oscillation sont des moments et peuvent être perçus seulement en tant que limites du mouvement vibratoire. En eux-mêmes, étant des moments, ils ne peuvent être perçus; c’est par là que s’explique ce fait que chacun des états existe seulement dans le système de relations, et en dehors de lui est impensable. Extrait de: Alexandre Scriabine. Notes et réflexions. Carnets inédits /Traduction et présentation: Marina Scriabine. – Paris: Klincksieck (l’Esprit des formes), 1979, pp. 67–68. Reproduit avec l’autorisation des éditions Klincksieck. © Klincksieck 1979 1 122 La différenciation dans la vibration des points extrêmes de chaque oscillation contient en elle l’idée du temps et de l’espace. Chacun des états de conscience est la négation de n’importe quel autre. Territoires de l’oubli Tristan Murail1 À l’époque de [la] composition [de Territoires de l’oubli ], j’utilisais encore très peu ce que l’on a vu précédemment – calculs de fréquence, calculs rythmique, techniques informatiques. Néanmoins, il y a déjà dans cette pièce quelques premières approches de ces techniques. Il se présente bien sûr une difficulté majeure dans l’écriture pour le piano: le tempérament égal, qui oblige à une approximation plus grossière des fréquences spectrales. Deuxième difficulté: mon écriture, à l’époque de la composition des Territoires de l’oubli, fonctionnait beaucoup par masses sonores, mouvements subtils, progressions insensibles, évolutions de timbre, tuilages de textures, etc. Toutes choses assez faciles à réaliser à l’orchestre, ou même pour de petits ensembles. Mais le son percussif, non entretenu du piano rendait malaisée la construction de semblables structures. De fortes contraintes peuvent cependant amener à recourir à des solutions créatives; j’ai donc essayé de jouer avec ces contraintes. L’une des réponses à ces problèmes est l’utilisation de la pédale droite du piano: elle reste enfoncée du début jusqu’à la fin de la pièce. Tous les sons résonnent donc toujours jusqu’à leur extinction naturelle. À contre-pied d’une attitude répandue couramment dans la littérature pianistique contemporaine, l’idée de base a été de considérer le piano, non pas comme un instrument de percussion, mais comme un instrument de résonance. On ne peut évidemment pas éviter d’entendre les attaques, la percussion des marteaux, mais ce qui nous intéresse ici, c’est la transformation progressive de la résonance globale du piano. La pièce est écrite avant tout pour ces résonances, et non pour créer des effets percussifs ou rythmiques. Pour cette raison, l’écriture est assez souple. Comme la résonance d’un piano n’est pas totalement prévisible – cela dépend de plusieurs facteurs, notamment de la salle dans laquelle on joue – il y a une certaine flexibilité rythmique: on peut interpréter la longueur des points d’orgue, on peut répéter certains fragments, afin de laisser les résonances s’épanouir ou s’éteindre. Puisque Territoires repose sur des processus, des transformations graduelles d’une texture en une autre, le pianiste a la tâche très délicate de réaliser ces changements progressifs. Il ne lui suffit pas de se concentrer sur l’instant; il lui faut garder en mémoire l’évolution progressive d’un passage musical, bien comprendre quelle est la nature de la transformation, quel est l’objectif visé, et guider donc ces processus qui sont parfois très longs (ils peuvent durer 4–5 pages), de manière à ce qu’ils soient clairement restitués à l’auditeur. Parmi ces processus, il y a par exemple des accélérations ou des ralentissements très progressifs. Il faudra bien doser le ralenti ou l’accéléré, pour ne pas risquer d’arriver trop tôt au tempo visé, ce qui entraînerait un moment statique non désiré. La même observation peut s’appliquer aux nuances. La complexité du jeu pianistique augmente lorsqu’on se trouve en face de processus superposés. Par exemple, souvent, un processus s’éteint pendant qu’un autre est en train de naître. Ou encore: une matière musicale est transformée de telle façon qu’elle devient méconnaissable, et du résultat obtenu, du résidu, naît un nouveau processus, et ainsi de suite. Les processus se «tuilent» sans cesse, ce qui rend d’ailleurs difficile de diviser la pièce en sections claires. Dans la partition, les lettres font surtout office de points de repère pour l’interprète ou pour l’analyste, mais ne correspondent pas nécessairement à des césures très marquées à l’écoute. Dans: Tristan Murail: Modèles et artifices / Textes réunis par Pierre Michel (Extraits des Conférences de Villeneuve-lès-Avignons, 9–13 juillet 1992). – Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2004, pp. 159–160. Reproduit avec l’autorisation de Tristan Murail et des Presses Universitaires de Strasbourg. 1 123 Hommage à György Ligeti Georg Friedrich Haas Die Hommage à György Ligeti ist das dritte und letzte Stück einer Serie von Arbeiten, in denen Techniken anderer Komponisten auf die speziellen klanglichen Gegebenheiten zweier im Vierteltonabstand gestimmter Klaviere übertragen werden. Diese Stücke werden jeweils von einem einzelnen Interpreten / einer einzelnen Interpretin realisiert, der / die zwischen den beiden Instrumenten sitzt, die rechte Hand auf der einen und die linke Hand auf der anderen Klaviatur. (Die weiteren Hommagen beziehen sich auf Josef Matthias Hauer und auf Steve Reich.) Ligetis Methode, Klänge unmerklich zu verändern, einzelne Töne langsam einbzw. auszublenden, wird auf das Klavier in der Weise übertragen, dass Akkorde rasch und lautstark repetiert werden, wobei die Veränderungen der Tonhöhen durch ein möglichst weiches ‹fade in› beziehungsweise ‹fade out› realisiert werden. Es kommt dabei auch zu Verdeckungen und Überlagerungen vierteltönig benachbarter Tonhöhen. Die rechten Pedale beider Klaviere bleiben während des ganzen Stückes niedergedrückt, die Saiten schwingen daher bis zum völligen Verklingen nach. Im Abstand eines Vierteltones gestimmte Klaviere entwickeln einen eigenen, sehr spezifischen Klang, der durch die Schwebungen der Vierteltöne, gekoppelt mit dem Ausschwingen der Klaviersaiten akustisch bedingt ist. – In der Hommage à György Ligeti werden diese spezifischen Schwebungen durch die Akkordrepetitionen verhindert: Bevor diese Schwebung entstehen kann, schneidet der nächste Fortissimo-Akkord durch den Klang. Dabei bilden sich im Raum (und durch die Resonanzen der Saiten) neue, künstliche Schwebungen und Schwingungen – diese sich an jedem Aufführungsort anders entwickelnden Klangereignisse sind ein wesentlicher Bestandteil der Musik. 124 Die «Etudes» von Claude Debussy Eberhardt Klemm1 Es gibt, von Schönberg abgesehen, keinen Komponisten aus dem Anfang dieses Jahrhunderts, der einen so großen Einfluß auf seine Zeitgenossen und selbst auf die folgende Generation gehabt hat wie Debussy. Seine harmonischen und koloristischen Entdeckungen sind sogar in die Film- und Unterhaltungsmusik eingedrungen, und der Jazz hat jahrzehntelang Debussys Akkord-Bestand nicht überschritten. Aber Debussy ist niemals das Haupt einer Schule geworden. Bereits zu seinen Lebzeiten wurde Debussy mit dem älteren malerischen Impressionismus in Verbindung gebracht. Seitdem gilt er unausrottbar als musikalischer Impressionist. Er selbst hatte gegen dieses Wort die gleiche Allergie wie Schönberg gegen den Begriff «atonal». Impressionist ist Debussy allenfalls in einigen Werken, Stimmungsmusiker – auch ein beliebtes Klischee – jedoch in keinem. Die innermusikalischen Sachverhalte seiner Musik sind freilich meist gegen einen dialektischen Verlauf, gegen eine «Handlung» gerichtet, weshalb es hier keine antagonistischen Gedanken gibt; keine Themen, die durch immanente Entwicklung ein «Schicksal» erleiden; keine Durchführungen im klassischen Sinn. Dennoch sind Debussys Werke – und das trifft besonders auf die Klaviermusik seiner mittleren Schaffenszeit zu – voller rhythmischer Kraft und dynamischer Impulse. Die Freiheit der Form – nicht zu verwechseln mit deren Auflösung – bedeutet bei Debussy nicht etwa ein rhapsodisches Hinweggleiten von einem Takt zum andern, ein laxes Phantasieren über ein paar Klänge und melodische Fetzen. Im Gegenteil: Alles ist sorgfältigst komponiert, jedes Detail minutiös bezeichnet. Auch die Satzstruktur ist von hoher Organisation. So werden auf weite Strecken mehrere «Stimmen», Linien oder Schichten kombiniert, die nur für sich genommen eines tieferen Sinnes entbehren. Sie sind nicht immer ohne weiteres erkennbar, müssen aber stets zu hören sein. Einer richtigen Interpretation hat daher eine genaue Analyse dieser Schichten vorherzugehen. Freilich besitzen sie unterschiedliches Gewicht und unterschiedliche Bedeutung; müssen also so differenziert wie nur irgend möglich gespielt werden, auch dort, wo die Bezeichnung «en dehors» (hervor-, abgehoben; eigentl. «nach außen») fehlt. Oft macht es sich notwendig, sogar die Einzeltöne eines Akkordes in verschiedenen Stärkegraden zu spielen. Welcher Ton hier jeweils stärker als die übrigen zu nehmen ist, geht meist aus der Stimmführung hervor. Lang auszuhaltende Baßtöne oder -akkorde sollten sehr deutlich angeschlagen werden, damit ihre Tragfähigkeit garantiert ist. Keinesfalls dürfen sie sich mit den übrigen «Stimmen» zu einem trüben Klangbrei vermischen. Selbst wenn ein Akkord unmittelbar in den nachfolgenden hineinklingt, muß ein abgestufter Anschlag für eine deutliche, logische Klanghierarchie sorgen. Erst sie macht das spezifisch Atmosphärische des Debussy-Stils aus. Debussys Klaviersatz verlangt oft ein taktelanges Aufheben der Dämpfung, also ein Niederdrücken des rechten Pedals (zuweilen angezeigt durch mehrere, ins Leere greifende kurze Bögen). Das bedeutet nicht, daß die Klänge verschwimmen sollen. So warnt Debussy vor einem Mißbrauch des Pedals, der meist nur ein Mittel sei, «einen technischen Mangel zu verdecken». Freilich fordert eine nuancierte Pedaltechnik größte Fertigkeit. Mancher geschickte Pianist wird stellenweise, wenn er eine Hand freibekommt, durch stummes Niederdrücken der Tasten und kurzen Der vorliegende Text erschien 1970 in der Edition Peters als Nachwort der Urtext-Ausgabe der Klavierwerke Debussys, Bd. V, 12 Etudes (EP 9078e). Wiedergabe (gekürzt) mit Genehmigung der Edition Peters. © C. F. Peters / M. P. Belaieff Musikverlag 1 125 Pedalwechsel das Weiterklingen von störenden Tönen auszuschalten suchen. «Die Kunst, das Pedal zu benutzen, ist eine Art Atmen», schrieb Debussy an Jacques Durand (1. September 1915). «So hatte ich es bei Liszt beobachtet, als er mir während seines Aufenthaltes in Rom erlaubte, ihm zuzuhören.» In Ausnahmefällen schreibt Debussy die Anwendung des linken Pedals (franz. pédale douce, pédale sourde oder sourdine) oder auch beider Pedale (les 2 Ped., les deux pédales) vor. Der Reiz der Verschiebung von Klaviatur und Mechanik, die bei Debussy und mehr noch bei Ravel in allen Stärkegraden (also auch im forte) vorkommt, besteht darin, daß die Klangfarbe verändert wird. Die Etudes, Ende September 1915 fertiggestellt und 1916 in zwei Heften erschienen, sind Debussys letzte Klavierkompositionen. Sie setzen die vor allem von Chopin und Liszt begründete Tradition der Konzertetüde fort, welche pianistische Probleme und einen künstlerischen Anspruch in sich vereint. An seinen Verleger Durand schrieb Debussy (28. August 1915): «Sie werden mit mir einer Meinung sein, daß es nicht nötig ist, der Technik noch mehr aufzuhalsen, nur um einen seriösen Eindruck zu machen, und daß ein wenig Charme niemals schaden kann. Chopin hat es bewiesen…» Diesem Meister sind die Etudes gewidmet. Jede Etüde behandelt ein Spezialproblem der Klaviertechnik; konsequenter wohl als je zuvor, wenn man von Skrjabin absieht. Im ersten Heft werden die Finger trainiert, ihr Mechanismus und ihre Grifftechnik einem instruktiven Studium unterworfen. Das reicht von der Ironisierung einer Czernyschen Fünffingerübung und einer Etüde für die acht Finger bis zur Terzen-, Quarten-, Sexten- und Oktavenetüde. Im zweiten Heft dagegen steht die Beschäftigung mit dem Klang im Vordergrund, wie schon die Titel der einzelnen Stücke (z.B. étude pour les sonorités opposées oder pour les arpèges composès) anzeigen. Hier vor allem liegt das geniale Neuerertum Debussys. So schwierig die Sammlung ist – Debussy nannte sie einmal «über den Gipfeln der Ausführung schwebend» –, so großartig ist ihre Wirkung. Daß das Technische nie Selbstzweck ist, wird in einem Brief an Durand bezeugt (12. August 1915): Die étude pour les agréments mache «bei der Form einer Barkarole (auf einem italienisch getönten Meer) eine Anleihe». So wird die «schwedische Gymnastik» der Finger letztlich nur ein Moment, um «Nie-Gehörtes» darzustellen, wie der Komponist von der Quartenetüde meinte. Die Etudes von Debussy könnte man klassizistisch nennen, sofern man darunter das Zurückdrängen des Bildhaften und Malerischen und eine Verehrung der Meister der Vergangenheit versteht. Mit der leeren Motorik des Neoklassizismus, wie er nach dem ersten Weltkrieg Mode ward, hat Debussys Spätwerk nichts zu tun. Es sind vielmehr höchst poetische Gebilde, in denen die Klangregister, die Farbvaleurs, die Dynamik, das Tempo und die Tondichte einem unaufhörlichen Wechsel unterliegen. Ihr Stil ist diskontinuierlich; sowohl Interpret wie Hörer müssen sich auf jähe Unterbrechungen und Überraschungen einstellen. Obwohl die Etudes viele wichtige Bauelemente der neuen Musik nach 1920 vorweggenommen haben, blieben sie lange Zeit so gut wie unbemerkt. Erst in den letzten beiden Dezennien wurde ihre überragende Bedeutung für die Zukunft erkannt. 126 Franz Schubert Die unvollendete Klaviersonate C-Dur D 840 (1825) Georg Friedrich Haas1 Franz Schuberts Sonate in C-Dur D 840 geht an die Grenzen des Möglichen und überschreitet sie. Das Beobachten, das Wahrnehmen dieser Grenzen war für mich eine aufregende Erfahrung, deren Auswirkungen ich gerne auch andere Menschen vermitteln wollte – nicht als rationale Erkenntnis, sondern als sinnlich-expressives Erleben. Denn diese Grenzen können von uns heute kaum mehr unmittelbar durch bloßes Hören erkannt werden. Ihre Verdeutlichung bedarf zunächst der Analyse und dann der musikalischen Interpretation des Erkannten. Der 3. Satz (er ist wie der 4. Satz unvollendet) ist in tonaler Hinsicht äußerst ungewöhnlich angelegt: Der erste (erweiterte) Achttakter wird variiert wiederholt – aber die Wiederholung dieser As-Dur Periode erfolgt einen Halbton höher, in A-Dur. Dieser Ungeheuerlichkeit gegenüber sind unsere heutigen Ohren stumpf geworden. Ein musikalisches Material einen Halbton höher zu wiederholen ist – heute! – ein billiger Trick der Unterhaltungsmusik. 1825 ist es eine Revolution, die die tonale Welt aus den Angeln hebt. Aber diese Revolution scheitert. Wenn Schubert wieder zu diesem Thema zurückkehrt, geht es nicht mehr weiter. Die Musik bricht ab. Der letzte von Schubert in diesem 3. Satz geschriebene Ton ist ein fis. Als uneingelöstes Versprechen hatte Schubert ein Wiederholungszeichen gesetzt und den Anfang der zu wiederholenden Stelle dadurch markiert. Erstaunlicherweise beginnt diese Stelle in Ges-Dur (deren harmonischen Umdeutung von fis) – hier existiert eine von Schubert geschaffene Brücke. Vor dem Abbruch des Satzes ist ein «accelerando» komponiert – eine Tempoanweisung, die in Schuberts Werk äußerst selten auftritt. Ich kenne nur eine zweite Stelle, wo sie anzutreffen ist: am Ende des Erlkönig, vor dem Tod des Knaben. Hier aber steht das accelerando vor dem Tod des Satzes. Das euphorische Vorwärtsdrängen führt zum vorzeitigen Abbruch. Ins Nichts. Dank Otto Brusatti und der Musiksammlung der Stadt Wien durfte ich das Manuskript dieses Satzes in den Händen halten. Nach dem vorzeitigen Abbruch des Satzes hatte Schubert zunächst noch 4 Notenzeilen frei gelassen. Später dann hatte er mit anderer Tinte in diese Zeilen ein Trio geschrieben – quasi post mortem. Eine leise Musik, verhalten im Pianissimo komponiert, SforzatissimoAkkorde schneiden wie Peitschenhiebe hinein. […] Das Hauptthema des 1. Satzes ist karg: e" – g' – e' – g' – a' – g' ohne harmonische Unterstützung in Oktavverdopplungen. Daran anschließend erklingt eine Akkordfolge, deren Oberstimme nicht mehr bringt als die Wiederholung der Sekundschritte g’ – a’ – g’. Diese Reduktion der Mittel birgt aber eine Fülle von Intervallbeziehungen (z.B. kann der Sextsprung e – g als Fugato in Engführung gesetzt werden oder der Sekundschritt g – a zum «Thema» werden, das sich in g – as verwandelt; – vgl. die tonale Anlage des Anfangs des 3. Satzes). […] Auf dem As bildet Schubert einen Dominantseptakkord, den er dann in den übermäßigen Quintsextakkord as – c – es – fis umdeutet. Dass diese Akkordfolge, die traditionellerweise erst am Höhepunkt der Durchführung eingesetzt wird, hier schon zu Beginn der Exposition aufscheint, ist bei Schubert nicht ungewöhnlich. Der Text entstand 2003 im Zusammenhang mit Georg Friedrich Haas’ Komposition «Torso» nach der unvollendeten Klaviersonate C-Dur D 840 (1825) von Franz Schubert (1999 / 2001) für großes Orchester. Wiedergabe (gekürzt) mit freundlicher Genehmigung des Komponisten und der Universal Edition Wien. 1 127 Erstaunlich ist aber, dass Schubert diesen Akkord dehnt, ihn als auf As gebildeten Klang über 11 Takte lang festhält. Der Dominantseptakkord wird quasi in Zeitlupe betrachtet. In der Notation verzichtet Schubert sogar auf die enharmonische Umdeutung. Es ist ein ges, das zum g führt, nicht ein fis. Der Klang bleibt ein Dominantseptakkord. Dem Schriftbild des Manuskripts ist anzusehen, dass Schubert die Noten in einem Zug hingeschrieben hat. Das Notenbild atmet geradezu Hölderlins Worte «in stiller, ewiger Klarheit.» In Takt 16 des ersten Satzes aber zögerte Schubert. Es gibt Streichungen, Korrekturen – und dann, als Folge dieses Verweilens den ausgedehnten Dominantseptakkord. Dieses «Verweilen auf der Dominante» bewirkt hier nicht ein dynamisches Vorwärtsdrängen, wie es am Ende einer Durchführung der Fall wäre, sondern ein statisches Verharren. Das Crescendo führt wieder zum Pianissimo (ohne Akkordwechsel), und wenn zuletzt dann innerhalb dreier Viertel ein Crescendo zum Quartsextakkord im Forte führt, wirkt es, als würde man ruckartig von einer Welt in eine andere versetzt. Der so lange ausgehaltene Dominantseptakkord verliert seinen Dissonanzcharakter, er wird (so meine ich) zur Konsonanz, zum Obertonakkord. […] Im Mittelpunkt der Durchführung des ersten Satzes steht ein ausgedehntes Verharren auf dem Dominantseptakkord von Fis. Auch hier bin ich der Meinung, dass die lange Dauer des Akkordes die Dissonanz zur Konsonanz macht. Schubert verzichtet darauf, die Dissonanzspannung zu steigern und dann endlich der lang ersehnten Auflösung zuzuführen. Im Gegenteil: Der Akkord wird abgebaut, bis zum Einzelton reduziert, bis zum sanften Verklingen der Dominante. In der Mitte, in den Takten 132 bis 137 des ersten Satzes von Schuberts Klaviersonate kommt es zu harmonischen Rückungen. Unvermittelt nacheinander erklingen die Dominantseptakkorde auf Fis, A, C, Es und wieder Fis, Schubert nimmt hier das Prinzip von Bela Bartóks Achsenharmonik vorweg. In motivischer Hinsicht finden sich Abspaltungen des Anfangsthemas, die aber auch als Teile von Fugati angesehen werden können, Themeneinsätze, die nur angedeutet, nicht aber fortgesetzt sind. […] Knapp nach dem Beginn der Scheinreprise (unmittelbar nach dem […] Tonikaeintritt) lässt Schubert die (dissonante) Septe eines Dominantseptakkordes unaufgelöst liegen und verändert stattdessen den Bass. Mozart hatte diese Methode noch als Musterbeispiel der Arbeiten schlechter Komponisten verspottet (Musikalischer Spaß, 1. Satz, Takt 12 / 139). […] Eine besonders krasse Gestaltung des Verzichts auf Dissonanzauflösung findet sich in der Coda des ersten Satzes. In Takt 396 der Klaviersonate lässt Schubert die None (!) des Dominantseptnonakkordes unverändert stehen und zur Quinte der Subdominantparallele werden. Erstaunlicherweise findet sich in beiden Fällen der Verweigerung einer Dissonanzauflösung der selbe Ton als nicht aufgelöste Dissonanz, ein a. Dieser Ton a spielt auch im Hauptthema des ersten Satzes die zentrale Rolle. Parallel zu dieser strukturellen Begründung der irregulären Dissonanzbehandlung bietet sich noch eine zweite Erklärung an. In beiden Fällen sind diese Dissonanzen in Ausschnitte von Obertonakkorden eingebettet, die demonstrativ als Konsonanz behandelt werden. Die Obertonreihe und deren mathematische Ableitung und Begründung wurde 1822 durch Fourier veröffentlicht (eingeschoben in eine Arbeit über die Wärmelehre, die in Paris veröffentlicht wurde). Diese Thesen wurden vielfach diskutiert, und es ist durchaus wahrscheinlich, dass sie auch 1825 im Kreis Schuberts besprochen wurden. Schubert hat in diesem ersten Satz seiner Sonate die musikalischen Konsequenzen der Fourierschen Entdeckung des Obertonakkordes gefunden: 1. die verlängerte Dauer dieser Akkorde (und auch der gesamten Sonate) 2. neuartige Akkordfolgen 3. fehlende Auflösungen 128 Philharmonie Luxembourg Photo: Jörg Hejkal 129 Portrait Giacinto Scelsi Dimanche / Sonntag / Sunday 27.11.2005 11:30 Espace Découverte United Instruments of Lucilin Jürg Wyttenbach direction & introduction Carin Levine flûte Jean-Marc Foltz clarinette solo Serge Kettenmeyer percussions Philippe Gonzalez cor anglais Marcel Lallemang clarinette basse Heather Graham Ni trompette Patrick Coljon cor Leon Ni trombone Danielle Hennicot alto Vincent Gérin violoncelle Tomoko Kiba, André Pons Valdès violons Giacinto Scelsi: Pwyll pour flûte solo (1957) 4’ Giacinto Scelsi: Arc-en-Ciel pour deux violons (1973) 3’ Giacinto Scelsi: Ko-Lho pour flûte et clarinette (1966) 6’ Giacinto Scelsi: Hyxos pour flûte alto et percussion (1955) 11’ Giacinto Scelsi: Kya pour clarinette solo et sept instruments (1959) 18’ Dimanche / Sonntag / Sunday 27.11.2005 13:00 Foyer Hot soup for rainy days – «Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt» 130 131 Scelsi, dé-compositeur Tristan Murail1 Dans: Tristan Murail: Modèles et artifices / Textes réunis par Pierre Michel. – Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2004, pp. 75–85. Reproduit avec l’autorisation de Tristan Murail et des Presses Universitaires de Strasbourg. 1 En 1983, j’écrivis une pièce pour bande magnétique et ensemble instrumental, que j’intitulai Désintégrations. Le but avoué de la pièce était, par antiphrase, d’intégrer au mieux les sons électroniques, synthétisés par l’ordinateur, et les sons instrumentaux. Mais pour réaliser cet objectif, il fallait d’abord «désintégrer» les sons instrumentaux: les réduire à leurs composantes essentielles, pour ensuite, éventuellement, les recomposer, ou plutôt pour synthétiser à partir de ces éléments des agrégats nouveaux, produisant à volonté du timbre ou de l’harmonie, en fonction des pondérations d’amplitude, ou du type d’écoute induit par le contexte. Cette démarche presque «scientifique» – mais dont le but était en fin de compte de produire un discours musical riche et communiquant – peut paraître bien éloignée des attitudes musicales de Scelsi. Cependant… 2 Guido Castagnoli: «Suono e processo nei ‹Quattro pezzi per orchestra› di G. Scelsi», in: Quaderni di Musica Nuova N° 1, 1987. «Le choix de Scelsi, exprimé de façon radicale, fut de décomposer le son dans son spectre, et non de composer (cum-ponere) les sons entre eux.»2 «Décomposer le son dans son spectre», c’est bien ainsi que l’on définit le point de départ de la méthode de composition maintenant appelée «spectrale». Les musiques «spectrales» sont certes très différentes dans leur sonorité et leur structure de la musique de Scelsi, mais elles en partagent au moins un aspect, que l’on pourra définir comme une attitude semblable en face des phénomènes sonores. C’est ici donc que l’on trouvera quelque parenté entre mon travail et celui des compositeurs «spectraux» d’une part, et celui de Scelsi d’autre part, plus que dans un style ou une esthétique comparables, les techniques d’écriture étant, quant à elles, résolument différentes, si l’on oublie quelques similarités de surface (micro-tons, travail des allures, formes continues). Mais cette attitude, commune à Scelsi, aux musiciens «spectraux», et à de nombreux compositeurs actuels de toutes tendances, constitue un fait fondamental. Il s’agit là d’un changement d’optique complet, d’un grand retournement de la tradition musicale occidentale, depuis longtemps surtout axée sur la combinatoire et la superposition. On ne va plus com-poser (juxtaposer, superposer), mais dé-composer, voire, tout simplement, poser le son. La frontière invisible Poser: c’est le geste sonore primordial, l’aum des yogis, que vont essayer de re-trouver (à mon avis, sans succès, parce qu’avec trop de naïveté), quelques musiciens américains, Terry Riley, et surtout La Monte Young (ami d’ailleurs de Scelsi), ou encore les groupes vocaux s’essayant aux techniques mongoles de diffraction des harmoniques (on connaît l’«Harmonic Choir» de David Hykes, mais cet ensemble avait été précédé par le groupe «Prima Materia», basé à Rome, et dont les membres fréquentaient assidûment Scelsi). 132 C’est parfois ce que tentent de faire aussi la musique concrète, puis la musique électronique, en échouant le plus souvent à cause du caractère trop simple, ou trop artificiel, des objets présentés. C’est encore ce que voudrait faire Cage, lorsqu’il nous invite à contempler le son, comme un japonais imprégné de philosophie zen contemple une pierre, la lune se lever, ou le sillage d’un râteau dans le gravier. Scelsi est trop l’héritier de traditions contradictoires pour tomber dans ces pièges évidents. À la différence de John Cage, qui veut ignorer l’héritage, à la différence des minimalistes, des électroniciens, qui manquent le plus souvent d’un apprentissage classique, Scelsi connaît la musique. Il est familier avec les langages chromatiques, du type Scriabine, avec les tendances néo-classiques, Malipiero et les autres, avec surtout le dodécaphonisme. Il semble qu’il se soit essayé à tous ces styles; en tous cas, les quelques œuvres qui survivent du Scelsi première manière montrent un tel mélange d’influence, sur un substrat dodécaphonique.3 On sait que ces styles musicaux ont fini par lui poser problème, en même temps, probablement, qu’il affrontait un problème existentiel. La technique d’écriture doit impérativement correspondre aux besoins d’expression d’un créateur sincère, faute de quoi on tombe vite dans l’artifice ou l’académisme. Scelsi, cependant, a compris que les réponses à ce problème ne pouvaient être simples. Il lui aurait été facile, lui qui était tout imprégné de l’influence et de l’enseignement de l’Orient, de tenter d’en suivre aussi les voies musicales, d’acclimater les lentes évolutions du raga hindou ou les mélismes abrupts du nô japonais, ou encore les rythmes complexes des Balinais ou les performances vocales des moines tibétains. Voir en particulier le Premier Quatuor. 3 Je ne cite pas ces exemples extra-européens par hasard; on peut trouver, ici et là, chez Scelsi, quelque reflet de ces musiques. Mais, si l’Orient peut aider à trouver la voie, il ne sert à rien d’imiter l’attitude orientale, qui ne vaut que dans le contexte d’une culture précise, encore moins d’en singer les manifestations. Comme il se plaisait à le répéter: Rome est à la frontière entre l’Est et l’Ouest. Autrement dit, l’héritage occidental est pour lui au moins aussi important que l’influence de l’Orient. La solution a donc consisté dans un changement d’optique radical, véritable révolution dans les attitudes. De telles «révolutions culturelles» sont d’ailleurs des phénomènes typiquement occidentaux. Elles ne fonctionnent finalement que dans un contexte de culture occidentale. Ainsi la remise en cause par Scelsi du processus de la composition, mais aussi de l’écoute musicale elle-même, s’inscrit en somme dans la tradition. Elle participe peut-être de la vraie révolution musicale de ce siècle. Schœnberg n’aura finalement rien changé: sa technique compositionnelle n’est qu’une image en négatif de la scolastique traditionnelle. Les vrais révolutionnaires se retrouvent du côté de ceux qui ont modifié notre rapport au son. Et pour qu’une révolution ait des lendemains qui chantent, elle doit être constructive, positive, et ne pas se définir comme une somme d’interdits, même si ces interdits sont pudiquement appelés «contraintes». On pense bien sûr à d’autres «reconstructeurs» de ce siècle, de Varèse à Ligeti, en n’oubliant pas, malgré tout, ce que l’on doit à l’expérience électroacoustique et informatique. Scelsi n’a évidemment aucune prétention scientifique, ce qui ne l’empêche pas de faire appel à des moyens d’avant-garde (en 1950) pour s’aider dans le processus de la composition: un magnétophone aujourd’hui archaïque, deux Ondiolines.4 Mais ce qui importe, c’est qu’une révolution de la pensée musicale s’est produire presque simultanément, à partir de prémisses différentes, pour aboutir à des résultats concordants: d’un côté, l’expérience électroacoustique, précédée par les anticipations varésiennes, menant à la réévaluation de l’orchestre traditionnel par Ligeti (sans oublier les extraordinaires prémonitions de Friedrich Cerha5), de l’autre les intuitions de Scelsi, sans antécédent visible, comme le message d’un au-delà. Cette concordance est en elle-même significative: l’évolution de la musique occidentale en était arrivée à un point de blocage où quelque Sorte de synthétiseur préhistorique tenant de l’orgue électronique et de l’ondes Martenot, créé par le français Jenner. 4 Friedrich Cerha est l’auteur d’une suite de pièces pour orchestre, les Spiegel, où l’orchestre est souvent traité comme un générateur de sonorités complexes à forte connotation électronique. On y trouve un sentiment temporel semblable au «temps lisse» de Ligeti, mais aussi une grande force expressionniste. 5 133 chose de résolument neuf devait surgir, et non un simple replâtrage des procédés traditionnels. Le silence n’est pas d’or Les «Quattro Pezzi», quatre pièces sur une seule note, sont un produit radical de cette évolution. Provocation totale, ou nécessité impérieuse? À peu près dans le même temps, Cage produit ses «4’33» (de silence). Historiquement, ces deux pièces étaient inéluctables: on avait les tableaux monochromes de Klein, ou bicolores de Rothko, on a eu le livre composé de pages blanches. Il fallait la pièce de silence, ou le son unique. Mais dans le cas de Cage, il s’agit en fait d’une démarche essentiellement négative: le point culminant d’une certaine crise de la création musicale, le point final d’un dadaïsme quelque peu dépassé. «Œuvre» inéluctable, je le répète, il fallait bien que quelqu’un «l’écrive»: ce fut Cage… sur le moment cela parut sûrement une bonne idée. Les «Quattro Pezzi» me paraissent, eux, positifs. Ils évitent d’être provocation pure, ils donnent à entendre. Ils sont le point de départ d’une aventure de la composition et de la perception qui portera de nombreux fruits. Les «Quattro Pezzi» sont dé- et re-composés. L’abandon presque total de la dimension harmonique permet à Scelsi de se confronter à d’autres dimensions, et de concentrer l’attention de l’auditeur sur de nouveaux raffinements sonores. On peut rapprocher cette attitude de celle des minimalistes, encore appelés, injustement, répétitifs. Chez Steve Reich, l’abandon des paramètres harmoniques et timbraux oblige l’auditeur à se concentrer sur les évolutions rythmiques, ou plutôt sur l’évolution des figurations combinatoires d’éléments très simples. Cette mutilation volontaire paraît indispensable: lorsque Reich, et surtout ses successeurs, Philip Glass, John Adams, tentent de réintroduire des considérations harmoniques, cela conduit inéluctablement à des couleurs mièvres – modulations à la César Franck, marches harmoniques issues des traités d’harmonie de la Belle Époque. L’objet principal du travail de composition devient alors ce que Scelsi nomme la «profondeur» du son. Il s’agit bien sûr essentiellement de travailler le timbre, la notion étant prise dans son sens le plus large: le timbre de l’orchestre dans sa globalité. Le travail d’écriture porte donc sur les allures, les densités, les registres, le dynamisme interne, les variations et micro-variations du timbre de chaque instrument: attaques, type d’entretien, modifications spectrales, modulation de la fréquence et de l’intensité. Les cordes sont évidemment l’objet de prédilection de ce travail, par leur grande souplesse, et le contrôle fin du timbre qu’elles permettent – sans avoir à se préoccuper de questions de tuyauterie. Par cette obsession du son, Scelsi s’inscrit encore une fois dans un grand mouvement de la musique occidentale, où le timbre, jadis insignifiant au regard de l’écriture, est progressivement pris en compte, reconnu comme phénomène autonome, puis comme catégorie à part entière, jusqu’à presque finir par submerger, ou plutôt phagocyter les autres dimensions du discours musical. C’est ainsi que les micro-fluctuations du son (vibrato, glissés, changements spectraux, trémolos …) passent du statut de l’ornement à celui du texte. Ce phénomène n’est pas cantonné à la musique «savante». On trouve le même développement dans les musiques rock, où le «son» prend le pas sur la substance mélodique, harmonique et rythmique, si tant est qu’il y en ait. C’est que le timbre est l’une des catégories les plus prégnantes de la perception musicale – de la perception auditive tout simplement, puisqu’à la base même du langage. Et nous savons tous immédiatement identifier le son d’une voix connue, même violemment déformée par le filtre du téléphone. 134 Mais l’on rejoint aussi les musiques non-européennes: l’ornement mélodique ou timbral y est souvent considéré comme partie intégrante du discours, voire comme un élément du système modal (comme au Viet-Nam). Dans la tradition classique indienne, on pourrait se hasarder à dire que la substance musicale d’une pièce de musique n’est que l’énorme ornement d’une réalité de base: le raga. Il est certain que Scelsi pense à ces musiques lorsqu’il définit son nouveau style. Il est certain qu’il existe ainsi une certaine parenté avec l’Orient, mais une parenté réassumée, repensée, presque issue de l’imaginaire du compositeur. C’est ainsi que Pierre Ménard réécrivit le Don Quichotte6… La Mongolie Intérieure Les titres des œuvres de Scelsi7 évoquent souvent un Orient mythique, ou plutôt imaginaire, intérieur. Au dire même du compositeur, des titres comme Khoom ou Igghur évoquent quelque Mongolie secrète de l’âme. Salvador Dali8 produisit il y a quelques années un court métrage intitulé «Visions de Haute-Mongolie». On y voyait des images apparemment abstraites, mais d’apparence presque naturelle, géologique, taches de couleurs aux contours délavés, dunes, lacs, roches amorties. Ces formes colorées et brumeuses étaient commentées par l’accent soigneusement catalan de Dali, et parfois légèrement précisées, prolongées, accouchées, par une touche de dessin du peintre. Il y était question de «grand tyran des mongols», de «champignons hallucinogènes», d’une cartographie surréelle. Mais la «Haute-Mongolie» dont il était question était en fait une Mongolie tout intérieure, d’autant que l’on apprenait, in fine, que toutes ces images provenaient de la micro-photographie de la surface d’un stylo dont le métal avait été rongé à l’acide. Le parallèle est saisissant entre cette exploration doublement intérieure – exploration de la matière, exploration de l’imaginaire – du peintre, et l'exploration similaire de la matière sonore jointe à une semblable fascination d’une Asie rêvée. «Pierre Ménard, auteur du Don Quichotte», in: Jorge Luis Borges: Fictions 6 On pourra rapprocher le mot «Khoom» du mot mongol «khôômi» qui désigne la technique du chant diphonique 7 Deux tableaux du peintre, au cadre en forme d’un profil masculin et féminin se faisant face ornaient le salon du petit appartement romain de Scelsi. 8 Cet imaginaire oriental est une composante constante de notre culture occidentale. Dali en joue, consciemment ou non, comme Ravel, lorsqu’il fait voluptueusement chanter ces simples mots: «Asie, Asie» dans son « Schéhérazade». Certains noms de lieu ou de personne sont capables de réveiller tout un imaginaire enfoui: Samarcande, Angkor-Vat, Boroboudour, Téotihuacan…Peut-être vaut-il mieux que ces noms restent des noms, et ignorer la réalité probablement décevante qu’ils recouvrent: il y a en nous tous un ailleurs intérieur, mais que notre culture, ou notre inconscient collectif, relie à l’Orient – peut-être parce que c’est l’endroit où le soleil se lève. L’ Ailleurs des Aztèques était aussi à l’Est, d’où devait revenir Quetzalcoatl; quand l’Est réel se manifesta, sous la forme des conquistadores, ce fut bien la fin d’un rêve, celui de toute une civilisation. Il en est de même dans notre musique: l’Orient réel ne devrait pas s’y introduire, ou sinon… Lorsque des groupes de jazz-rock incluent des violonistes et des joueurs de tabla indiens, ou que Menuhin croit jouer des ragas, ce n’est pas de «métissage» culturel qu’il s’agit, comme on nous le dit souvent, mais plutôt d’une sorte de néo-colonialisme culturel, consistant à dépouiller des civilisations de leur contenu même, ce qui est bien plus grave que leur acheter le cacao à prix dérisoire.9 L’Orient de Scelsi est donc cela: cet ailleurs intérieur, mais aussi ce modèle qui permet de repenser, de reconsidérer la tradition occidentale. Des «reflets» de cet Orient repensé, ou plus généralement de cet «ailleurs» parsèment l’œuvre de Scelsi. Aux titres des œuvres, souvent déjà très évocateurs, Scelsi ajoute parfois des sous-titres explicites: Khoom, 7 épisodes d’une histoire d’amour et de mort non écrite, en un pays lointain. Aiôn, 4 épisodes d’une journée de Brahma 9 Au moins le cacao reste-t-il cacao, tandis que l’exploitation artistique déforme ou même détruit l’objet importé. 135 Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une légende. Les ruines de Uaxuctùn (ceci est la véritable orthographe) existent bien. Mais sa destruction, comme celle de toutes les villes Maya, reste énigmatique. 10 Hurqualia, un Royaume différent Uaxuctum, la légende de la cité Maya qui se détruisit elle-même pour des raisons religieuses, etc.10. On voit dans ce dernier exemple que l’«Orient» imaginaire peut s’étendre jusqu’à l’Extrême Occident, celui des civilisations précolombiennes disparues et de leurs mystères supposés. L’Eldorado s’ajoute au Royaume du Prêtre Jean et aux Merveilles de Marco Polo dans l’imaginaire occidental. Mais il ne faut certes pas s’arrêter aux titres, même s’ils sont révélateurs des intentions et de la démarche du compositeur. Les techniques vocales et instrumentales, le déroulement temporel, l’approche compositionnelle de Scelsi renvoient aussi quelques reflets de cet Orient: nouvelles techniques vocales et instrumentales, sons parasites, éléments incantatoires, formes rituelles, statisme dans le dynamisme… voilà différents étages d’une rhétorique originale. Des fréquences très voisines engendrent des battements ou des effets de «chorus» qui enrichissent les textures sonores; lorsque les fréquences s’écartent un peu, on entre dans une zone de «dissonance»; lorsqu’elles s’écartent encore, on retrouve un sentiment de consonance. La notion de «bande critique» est dans une certaine mesure la justification théorique de l’idée intuitive de «profondeur» du son. 11 Sculpter le temps Dans l’écriture de Scelsi, l’instrument ou la voix n’ont plus pour fonction de «jouer des notes». Une entité sonore, unique pour la perception, peut être représentée par plusieurs symboles musicaux; dans un cas extrême, le son unique constitue toute la partition. Il faut réapprendre à lire la musique. Il faut apprendre à reconnaître comment sont constituées les unités sonores indissociables à l’exécution – les différentes notes, accompagnées de symboles d’intensité, de timbre, etc., ne représentant que les divers moments de l’évolution d’un son. Scelsi fait ainsi preuve d’une remarquable intuition acoustique. Il exploite, probablement inconsciemment, des phénomènes acoustiques tels que les transitoires, les battements, la notion de largeur de bande critique,11 etc. Ceci est particulièrement clair dans l’écriture vocale, où les consonnes font office de transitoires d’attaque, tandis que le timbre est modulé précisément par les voyelles. Dans les pièces pour cordes seules, Scelsi demande fréquemment une scordatura qui permet de jouer le même son, ou des sons de hauteurs très voisines, sur les quatre cordes, dans la même position. Voilà qui permet d’épaissir le son, et de provoquer les battements et micro-fluctuations qui enrichiront le timbre instrumental. On peut en fait distinguer deux types de travail fin du timbre. Le premier consiste à agir directement sur la source sonore: place de l’archet, choix de la corde, description précise des allures et des granulations, sourdines conventionnelles ou inventées, voyelles nasales, etc. Le deuxième consiste en une sorte de synthèse additive des sons. J’emploie à dessein ce terme technique plutôt que de parler d’orchestration, puisque ici la synthèse de timbre est souvent l’acte essentiel de composition, et qu’il s’agit bien, avant tout, de créer des sons nouveaux, et non d’habiller un matériau préexistant. Il en découle évidemment de nouvelles exigences envers les instrumentistes. D’un côté: maîtriser finement le jeu instrumental, avec ses micro-variations dans les allures (trémolos, trémolos rythmés, trémolos sur plusieurs cordes), dans les timbres, dans la modulation des intensités et des fréquences (trilles, trilles rythmés, oscillations de 1 / 4 de ton, petits glissés), et combiner souvent toutes ces techniques entre elles; de l’autre, lorsqu’il s’agit de pièces d’ensemble, arriver à fusionner les entités individuelles dans un son global résultant. On est ici assez proche des techniques exigées par la musique «spectrale», où l’on demande le même contrôle fin du timbre, et où les effets de fusion sont une dominante du langage. Il semblerait que les aspects harmoniques de l’œuvre de Scelsi ne soient qu’une sorte de sous-produit de cette démarche globalisante. L’harmonie au sens classique, est finalement le plus souvent inexistante, et se réduit à l’unisson ou à, l’octave, «épaissis» par les traitements précédemment décrits. Parfois, cependant, 136 on assiste à de soudaines «réfractions» harmoniques: l’unisson se diffracte, se réfléchit en de nouvelles hauteurs. Ce phénomène est très sensible dans des pièces comme Anahit, ou encore le 4e Quatuor. Ces réfractions harmoniques, si l’on veut vraiment les analyser, utilisent souvent des relations de spectres harmoniques, ou de sous-harmoniques (spectre harmonique renversé), relations cependant gauchies par des distorsions de micro-intervalles ou par les micro-évolutions en fréquence des sons. On entend alors des sortes d’accords presque-parfaits à l’effet étrange, nostalgique12, à la fois familiers et inconnus, proches et comme inaccessibles. Plus rarement, la polarisation se produit sur un intervalle, et non une hauteur unique (Pranam II, entièrement bâti sur l’intervalle Do dièse – Mi). Il ne faudrait pas négliger un autre aspect de la musique de Scelsi, que j’appellerai «incantatoire». Les fluctuations mélodiques, l’utilisation du 1/4 de ton, relèvent souvent de techniques incantatoires (retours fréquents sur une hauteur, répétitions et variations de courtes formules), mais plus encore les rythmes, qui s’organisent autour d’une périodicité plus ou moins cachée. Scelsi avoue volontiers son attirance pour l’incantation rythmique, pour les rythmes «surgissant du dynamisme vital». Certaines pièces évoquent quelque cérémonie secrète: Okanagon, pièce entièrement percussive pour harpe, tam-tam, et contrebasse porte la mention suivante: «Okanagon devra être considéré comme un rite, ou, si l’on veut, comme le battement de cœur de la terre». Encore plus explicites, les «Riti», trois pièces dont les titres sont: Les Funérailles d’Achille – Les Funérailles d’Alexandre le Grand – Les Funérailles de Charlemagne. Plus qu’à évoquer, la musique cherche à être la reconstitution rêvée des musiques antiques. L’Ailleurs n’est pas seulement géographique, il est aussi dans le temps. De nombreux titres de pièce semblent en effet se référer à une Antiquité mythique, gréco-égyptienne (Okanagon, Anagamin). Acoustiquement, ces relations micro-tonales produisent des battements, des chocs d’harmoniques qui assombrissent, ou filtrent les timbres, produisant ainsi un effet de lointain (les sons lointains paraissent semblablement filtrés), qui, métaphoriquement, appelle le sentiment de «nostalgie». 12 Cela dit, Scelsi inclut la notion de rythme dans celle, plus globale, de durée, anticipant ainsi la conception du temps de la musique « spectrale». Le rythme est une «manifestation de la durée», qui «relie le temps personnel et relatif de l’artiste créateur à la durée cosmique, au temps absolu». Le rythme ainsi compris peut être un rythme intérieur, qui dynamise l’œuvre, même si celle-ci consiste finalement en un son continu, unique. Le temps devient ambigu: à la fois statique et dynamique. L’enveloppe formelle globale paraît souvent statique, tandis que le détail est très mobile. On ne trouve guère l’idée de «processus» qui dynamise bon nombre de musiques actuelles. Statisme, ou abolition du temps, aperçu de l’Éternité? On pourrait ici penser à Messiaen, qui n’a pas une conception dynamique de la forme, mais plutôt une conception en vitrail, chaque instant étant autonome et presque intemporel. Ainsi pourrait s’expliquer chez Scelsi ce qui pourrait apparaître comme une faiblesse formelle: je pense à toutes ces œuvres en plusieurs mouvements, où les relations entre les parties ne semblent obéir à aucune logique perceptive. Les œuvres les plus fortes néanmoins me semblent obéir à une conception plus rigoureuse de la forme. Ce sont des pièces en un seul mouvement, d’un seul mouvement devrait-on dire, un geste unique et irrésistible, comme la lente et univoque montée du 4e Quatuor, ou la montée semblable, mais en trois épisodes (le second étant une cadence du soliste), d’Anahit où le violon emmène toute la trame orchestrale dans une spirale ascendante éternelle. Ces deux exemples mettent bien en valeur l’approche compositionnelle de Scelsi. Pas de conception de développement, de cellules, d’empilement de structures (pas de structures d’ailleurs), pas de com-position donc, pour reprendre notre introduction, mais une approche globale, circonvenante, où l’on cerne l’objet par cercles concentriques de plus en plus serrés. On retrouve ici l’Orient, et l’approche du calligraphe ou du peintre d’inspiration zen. 137 Mais quel est l’objet, quel est le modèle? Il y a toujours en musique un modèle, formel ou naturel. Même l’art le plus abstrait procède à partir de modèles. Quel est le modèle de Scelsi, comment analyser son œuvre sans se livrer à une simple et inutile description? Les outils traditionnels de l’analyse sont inappropriés, puisqu’il n’y a ni matériau, ni combinatoire, ni forme clairement structurée. Il reste alors à étudier, peut-être avec des outils de type statistique, allures, densités, mouvements de registre, épaississements, leurs évolutions et leurs rapports. On a besoin d’un nouveau type d’analyse, plus général, peut-être applicable à toutes les musiques, une analyse qui irait droit au but, c’est-à-dire à l’intention du compositeur et à l’effet ressenti par l’auditeur. L’analyse traditionnelle ne serait alors qu’une sous-catégorie possible dans un ensemble plus vaste, de même que les techniques d’écriture traditionnelles, et les prétendus «systèmes» – modal, tonal, atonal – n’apparaîtront sans doute dans le futur que comme des aspects, des facettes, d’une réalité plus globale où les relations entre éléments musicaux obéiront à des règles beaucoup plus générales. S’il y a un modèle implicite dans la création de Scelsi, et puisqu’on ne le trouve ni dans les traditions formelles occidentales, ni dans l’observation de la nature, ni dans une construction théorique originale, c’est qu’il est ailleurs… dans «l’Ailleurs». Scelsi aimait se définir comme un simple transmetteur, intermédiaire entre notre monde et une réalité supérieure. Existe-t-il des images, des Idées qui attendent d’être révélées par l’artiste médiateur? Composer, pour Scelsi, c’est «projeter des images dans la matière sonore» – comme si images et matière sonore préexistaient au musicien; dans l’impossibilité où nous sommes de trouver des antécédents à son œuvre, d’en démontrer les mécanismes, il est tentant, même pour les moins mystiques d’entre nous, d’accepter ces définitions. 138 Einige Erinnerungen an Scelsi Jürg Wyttenbach1 1973: Ich höre zum ersten Mal Musik von Scelsi, diesem, wie das Gerücht geht, «in aristokratischer, publicity-scheuer Erhabenheit in Rom, dem Schnittpunkt von Abendland und Orient, still vor sich hinmeditierenden Komponisten» … Carmen Fournier spielt Xnoybis für Geige allein. Ich bin zuerst irritiert: Diese langen, lasziven, in Mikrointervallen sich reibenden Töne, dieses ereignisreiche Kreisen über die ungestimmten Saiten, diese Ein-Stimmigkeit mit heterophonen Umspielungen gehen mir etwas auf die Nerven. (Ich vermisse die klassischen Parameter Polyphonie, Rhythmik, Entwicklung, Form im traditionellen Sinn.) Und doch trifft diese Musik einen Nerv in mir: Ich bin bald fasziniert, eingestimmt und lasse mich von den «Wellen», Vibrationen dieser Musik tragen. 1976: Zum 50. Jubiläum der IGNM Basel möchte ich Scelsi einen Auftrag geben. Er nimmt an, doch dann muß er ziemlich resigniert verzichten. Es fehle ihm die Kraft zu einem neuen Werk, und im übrigen hätte er so viele Stücke geschrieben, die noch nie aufgeführt worden seien … Also engagieren wir Michiko Hirayama. Sie singt uns Taiagarù und andere eigenartige, ja fremdartige Stücke für Stimme allein: Lieder ohne larmoyant-sentimentale Lyrismen, eher «phonetische Gesten»: Rufe, Schreie, Atemstöße, Hecheln, Flüstern, Stöhnen, Silben-Kaskaden, ein Teppich von Klang-Ornamenten, Linien, sich umschlingend und im Kreise wiederholend, einander ähnlich, doch nie gleich. Deshalb das Naturhafte, Bewegte und Bewegende dieser Musik. Trotz oberflächlicher Ähnlichkeiten: welch ein Unterschied zur trockenen, theoretisch-langweiligen, repetitiven und MinimalMusik! Sommer 1977: Dann mein erster Besuch bei Scelsi in Rom. Ankunft am Morgen. Er ist aber erst ab 16 Uhr zu sprechen. Ich beziehe das Appartement seiner geliebten, verstorbenen Schwester im Untergeschoß: kühl und dunkel wie in einer Gruft. Dann spätnachmittags empfängt er mich auf seiner Sonnenterrasse über dem Forum Romanum. Scelsi selbst ein römischer Sonnenkopf mit klaren, lebhaften Augen. Ein Sonnenanbeter; fast nackt; gesunde, braune Haut. Robust für sein Alter. Merke bald, daß er gern schöne Frauen um sich hat, die er zum Sonnenbaden verführt, um ihre Haut und Körperformen ausgiebig bewundern zu können. Die Sinnlichkeit der Haut, ihre Elastizität, Dehnbarkeit; Haut, die atmende Oberfläche, Erregbarkeit, Vibrationen des ganzen Körpers über die Haut. Ich verstehe seine Musik besser: Töne zum Anfassen, eine «Klangmassage» sozusagen. Am Abend in Trastevere im Garten eines Luxus-Restaurants: Scelsi als Patriarch und generöser Gastgeber. Doch er selbst scheint nicht besondere Freude am Essen und Trinken zu haben. Zu animalisch? Er genießt eher das Atmosphärische und eben den Hautkontakt. Später die Erfahrungen beim Einstudieren seiner Werke mit Studenten und Kollegen. Zum Beispiel sein Stück Ko-Tha für Gitarre: Das Instrument wird nicht gezupft, sondern wie die Felle von Tabla und Banya (indische Trommeln) gestreichelt, getätschelt, geschlagen. Wichtig der Puls, der Kreislauf unter der Haut, Wyttenbach, Jürg: «Einige Erinnerungen an Giacinto Scelsi», in: MusikTexte N° 26 (Oktober 1988), S. 31. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von Jürg Wyttenbach. 1 139 das Strömende seiner Musik. Intensität, Konzentration, Wärme wichtiger als Ausdrucks- und Formwille. 1981: Scelsi kommt zur Aufführung von Anahit mit dem Tonhalle-Orchester nach Zürich. Im gleichen Konzert dirigiere ich eine «Londoner» Sinfonie von Haydn. Scelsis Kommentar: Comment peux-tu diriger une telle mômie?! Sein ausschließliches Interesse an seiner Musik. Andere Komponisten, klassische, moderne Musik, Jazz, ignoriert er. Ein Egozentriker. Ich beneide ihn um diese für einen Komponisten gesunde Einstellung … 1986: Uraufführung (20 Jahre, nachdem die Werke geschrieben wurden!) von Pfhat und Konx-om-pax in Frankfurt. Ich bitte ihn, bei den letzten Proben dabei zu sein. Er hat Ausreden … Das Handwerk interessiert ihn nicht besonders. Die Musik, seine Musik immer eine Art der Meditation. (Scelsi sieht sich ja auch nicht als Komponisten, sondern als Vermittler, sozusagen als Relais-Station zwischen der ewigen, göttlichen Klangschöpfung und dem Hörenden.) Nach der erfolgreichen Aufführung kommt Scelsi aufs Podium und bittet das Publikum, Chor und Orchester, mit ihm in einen gemeinsamen Meditationsgesang über die Silbe «Om» einzustimmen. John Cage, im auch sonst illustren Publikum, sagt mir später: «Scelsi in Frankfurt: It was so nice to sing the ‹Om› with him; I felt like in sunday school.» 1988 im Januar zum letzten Mal bei Scelsi in Rom. Wir hören Bänder – natürlich seiner Musik – und diskutieren die vorgesehene Plattenaufnahme von Aiôn, Pfhat und Konx-om-pax. Er stimmt mir zu, daß seine Tempo-Angaben etwas zu langsam sind und daß das Detail immer im Gesamtklang aufgehen muß. Also: mehr Teppich als Zeichnung. Scelsi will etwas aus seinen Gemächern holen. Er fällt hin und ruft mich zu Hilfe. Er kann nicht mehr allein aufstehen. Scelsi erzählt mir von seinen Schmerzen im Bein. Er glaubt, daß sie verursacht wurden durch einen Kampf vor über 3000 Jahren. In dieser früheren Inkarnation sei er ein Krieger gewesen … Im Juni ’88 dann die Aufnahmen seiner drei großen Orchester- und Chorwerke in Krakau. Wir telefonieren. Er denke an uns, meditiere und spende Energien, Vibrationen … «Handwerklich» beunruhigt ihn nur eins: Les 150 petites clochettes à la fin de Pfhat (= Lichtstrahl); Sois sur qu’elles sonnent très «forte». Il faudra que ça sonne lumineux; que le ciel s’ouvre en éclat! In der Kirche, wo die Aufnahmen stattfinden, der überwältigende Eindruck der schöpferischen Kraft des Klangs. Wie brodelndes Magma. Akkumulation von Energie durch Massieren. In-Bewegung-Halten des Klangs. Eine Musik der Vibrationen, das heißt der Sympathie-Klänge, der «gleichen Wellenlängen». Konx-om-pax: drei Emanationen des Wortes «Friede». Friede setzt Sympathie voraus … Anfang August Scelsis Anruf: Er lasse sich ans Meer fahren (Sonne / Haut). Dann die Nachricht von seinem Tod. Tod? Nein: für mich wird Scelsi in dem Moment eins mit seinem vieldeutigen Symbol-Signet [s. S. 131] – Das heißt Untergang und Aufgang, der ewige Zyklus, die ewige Wiederkehr … 140 United Instruments of Lucilin 141 Berceuse Dimanche / Sonntag / Sunday 27.11.2005 14:30 Salle de Musique de Chambre Luxembourg Sinfonietta Marcel Wengler direction Roula Safar mezzo-soprano Maurice Ravel: Trois poèmes de Stéphane Mallarmé (1913) Soupir Placet futile Surgi de la croupe et du bond 13’ Michaël Lévinas: Les «Aragons» (1997) 17’ — Gérard Grisey: Wolf Lieder (1997) (orchestration de quatre Lieder de Hugo Wolf) In der Frühe Um Mitternacht Das verlassene Mägdlein Nun wandre, Maria 10’ Michaël Lévinas: La Romance d’Ariel (1983) (extraite des «Chansons» de Claude Debussy) 5’ Gérard Grisey: Quatre chants pour franchir le seuil. IV. Berceuse (1997 / 1998) (instrumentation de Brice Pauset, 1998 / 1999) 5’ 142 Blick in den blauen Himmel Die «Trois poèmes de Stéphane Mallarmé» von Maurice Ravel (1913) Bernhard Günther Der von Ravel prophezeite Skandal der Uraufführung des Sacre du Printemps am 29. Mai 1913 in Paris läßt die Sprengkraft ahnen, die der Musik noch beigemessen wurde, bevor sich das allgemeine Interesse der Explosivität Europas zuwandte. Auch abseits des Skandalösen tat sich viel in der Musik dieses dichtgedrängten Jahres. Der Widerhall von Schönbergs Pierrot Lunaire aus dem Jahr zuvor lag noch in der Luft: Kurz nachdem Strawinsky in Berlin Schönberg kennengelernt und den Pierrot gehört hatte, beendete er die Drei japanischen Gedichte für Sopran, zwei Flöten, zwei Klarinetten, Klavier und Streichquartett. Das dritte dieser fahl instrumentierten Stücke, die sich wie auch der Sacre auf den Frühling beziehen, ist Ravel gewidmet, der sich gemeinsam mit Strawinsky in Clarens am Genfer See aufhielt. Dort entstand neben einer gemeinsamen Bearbeitung von Mussorgskys Chowanschtschina für Diaghilews Ballett auch das erste – Strawinsky gewidmete – der drei Poèmes de Mallarmé, die ebenfalls die Besetzung des Pierrot aufgriffen. Debussy, der alles mied, was zu feuilletonistischen Vergleichen mit vermeintlichen ‹Debussyisten› führen konnte, komponierte im selben Jahr seine Trois Poèmes de Mallarmé. Nur für das letzte der je drei Stücke hatten Ravel und Debussy unterschiedliche Gedichte ausgewählt, was das distanzierte Verhältnis beider Komponisten zueinander nicht verbesserte. Debussy hatte knapp zwanzig Jahre zuvor mit dem ebenfalls auf Mallarmé basierenden L’après-midi d’un faune einen seiner größten Erfolge gehabt und schrieb jetzt neben seinem letztem Orchesterwerk Jeux die drei Lieder mit schlichter Klavierbegleitung, in denen er auch mit zwei Zitaten Rückschau auf sein eigenes Komponieren hielt. Der um dreizehn Jahre jüngere Ravel hingegen setzte das schönbergsche Solistenensemble ein, um die vielschattigen Worte Mallarmés mit einer großen Klangpalette wiederzugeben, sie, wie er sich ausdrückte, in ihrer bedeutungsvollen Zierlichkeit zu transkribieren. «Die Musik und die Literatur sind einander gegenüberliegende Seiten, hier dem Dunkel zugewandt, dort mit Klarheit funkelnd, eines Phänomens, eines Einzigen, das ich Idee genannt habe», schrieb Mallarmé, oder tatendurstiger: Man müsse der Musik wieder entreißen, was den Dichtern gehöre. So geriet er in seinen Gedichten bis an die Grenze der konkreten Poesie, indem er der Qualität der Sprache von Prosa über strenge Versmaße bis hin zu Buchstabenfiguren auf dem Papier nachspürte. Die Klarheit, die der Sprache mehr als der Musik eigne, nutzte er, um rätselhafte Sprachgebilde fern der Alltagssprache zu formen. «Einen Gegenstand zu benennen, heißt, drei Viertel des Vergnügens am Gedicht zu verhindern, das darin besteht, ihn nach und nach zu erraten»; die Aufgabe des Gedichtes sei, «etwas nach und nach zu evozieren, um einen seelischen Zustand zu zeigen, oder, umgekehrt, etwas zu wählen, um daraus einen seelischen Zustand abzuleiten.» So ist die Suggestion des Unnennbaren sowohl prägend für die Atmosphäre seiner Gedichte als auch ein Grund für die Versuche der Komponisten, für die Musik wieder zu gewinnen, was Mallarmé aus ihr destilliert hatte. Das erste der Poèmes beginnt sehr leise mit einem über eineinhalb Minuten unveränderten Arpeggiengefüge des Streichquartetts, das das Fundament für eine 143 der fraglos ‹schönen Stellen› der Musikgeschichte bildet: In aller Ruhe entfaltet die Singstimme den ersten Atemzug des Gedichts in einem schwelgenden Bogen. Nach dem Blick in das ersehnte Himmelblau löst sich mit der Idylle auch die Statik der Begleitung auf. Diese Verschmelzung der Musik mit dem Rhythmus der Sätze und der Form des Gedichts wird durch Phrasierung, Atempausen und häufige Tempoanpassungen sowie durch die Verstärkung der Textwiederholungen beim zweiten Gedicht besonders deutlich. Das dritte, die Beschreibung der Traurigkeit einer leeren Vase durch den als Deckengemälde herabschauenden Dichter, galt nicht nur Ravel als eines der rätselhaftesten Sonette Mallarmés. Ravel dünnt den Klang den Klang des Ensembles aus, ohne ihn spröde werden zu lassen, indem er die erste Flöte durch eine Piccoloflöte und die zweite Klarinette durch eine Baßklarinette ersetzt. Tonale Bezüge treten in den Hintergrund, die Gesangslinie verwinkelt sich, und die Musik gerät zunehmend in die Stille der Finsternis des Schlussworts. Mit seinen weitgespannten Melodiebögen blieb Ravel Schönbergs Sprechgesang ebenso fern wie die einfachen Strawinskyschen Liedphrasen; das Expressionistische am Pierrot schlug in Frankreich keine Wurzeln. Wie selbstverständlich wird hier der Text zur Melodie, überlagern sich sanft die geschmeidige Harmonik der Begleitung und der flexible Gesang. Die Trois Poèmes de Mallarmé sind ein vollendetes Beispiel einer französischen Gegenkultur zum Schönbergschen Bemühen, Musik zum Sprechen zu bringen. Luxembourg Sinfonietta 144 Soupir Stephane Mallarmé (1866) Seufzer Mon âme vers ton front où rêve, ô calme soeur, Un automne jonché de taches de rousseur, Et vers le ciel errant de ton oeil angélique, Monte, comme dans un jardin mélancolique, Fidèle, un blanc jet d’eau soupire vers l’azur! Mein geist zu deiner stirn • o stille schwester • steigt Auf der verträumt ein herbst in sanfter röte schweigt Und schwingt zum himmel sich • vom blick • dem engelszarten • Sich lösend • so wie in dem traurig späten garten Verzückt der weiße strahl des brunnens seufzt ins Blau! – Ins Blau • Oktoberlich gemildert • rein und lau • Das seine sehnsucht in den großen hecken spiegelt Wo auf dem wasser wenn das laub vom wind gewiegelt In todeszuckungen die kalten furchen zieht Ein goldner sonnenstrahl • ein letzter • leise flieht. Vers l’Azur attendri d’octobre pâle et pur Qui mire aux grands bassins sa langueur infinie Et laisse, sur l’eau morte où la fauve agonie Des feuilles erre au vent et creuse un froid sillon, Se trainer le soleil jaune d’un long rayon. Placet futile Stephane Mallarmé (1862) Kindische Bitte Princesse! à jalouser le destin d’une Hébé Qui point sur cette tasse au baiser de vos lèvres; J’use mes feux mais n’ai rang discret que d’abbé Et ne figurerai même nu sur le Sèvres. Prinzessin! voller neid auf einer Hebe los – Auf dieser tasse darf sie deinen kuß goutieren – Steh ich in glut doch ist mein rang – abbé – nicht groß Und nackt müßt ich mich auf dem Sèvres sehr genieren. Comme je ne suis pas ton bichon embarbé Ni la pastille, ni jeux mièvres Et que sur moi je sens ton regard clos tombé Blonde dont les coiffeurs divins sont des orfèvres! Ich bin natürlich nicht dein hündchen auf dem schoß Kein naschwerk rouge und keins von deinen elixieren So spür ich doch den blick • dein blinzelndes gekos … Du blonde • götter nur • Goldschmiede • dich frisieren! Nommez-nous… toi de qui tant de ris framboisés Se joignent en troupeaux d’agneaux apprivoisés Chez tous broutant les voeux et bêlant aux délires, O laß mich… himbeerrot wie mir dein lachen scheint Gleicht es den lämmern die zur herde zahm vereint Vor wonne bähn wenn sie sich auf die weide machen Nommez-nous… pour qu’Amour ailé d’un éventail M’y peigne flûte aux doigts endormant ce bercail, Princesse, nommez-nous berger de vos sourires. O laß mich… Amor soll mich malen wie ich still Mit meinem flötenspiel die schäfchen schläfern will … 1aß mich dein lachen als sein schäfer treu bewachen. Surgi de la croupe et du bond Stephane Mallarmé (1887) Surgi de la croupe et du bond D’une verrerie éphémère Sans fleurir la veillée amère Le col ignoré s’interrompt. Empor aus dem gewölbten traum Des glases • dieses überschlanken • Und nie erblühend aus den schranken Verliert sich stumm des halses saum. Je crois bien que deux bouches n’ont Bu, ni son amant ni ma mère Jamais à la même chimère Moi, sylphe de ce froid plafond! Die beiden munde tranken kaum Nicht mutter und geliebter tranken je an dem gleichen Trug-gedanken: Ich weiß es • geist im kalten raum! Le pur vase d’aucun breuvage Que l’inexhaustible veuvage Agonise mais ne consent, Die reine vase ohne leben Der tiefsten witwenschaft gegeben Sie bäumt sich auf und wagt ihn nicht Naïf baiser des plus funèbres! A rien explirer annonçant Une rose dans les ténèbres. Den scheuen kuß aus düstrem wissen! Damit ihr atem nicht verspricht Die rose aus den finsternissen. Deutsche Übertragung von Carl Fischer, nach: Stéphane Mallarmé: Sämtliche Gedichte. – Köln: Verlag Jakob Hegner, 1969 145 L’écriture vigilante de Michaël Lévinas Eric Denut1 Les premières œuvres de Michaël Lévinas procèdent d’une prise de position par rapport au répertoire du passé (Arsis et Thésis, Froissement d’ailes), pour suivre ces dernières années le fil d’une abstraction croissante de l’écriture, délimitée au seul espace instrumentalo-vocal (Les Aragons) et consacrée à l’écoute frontale des instruments par excellence d’une notation «fidélisante»: les cordes (Quatuor à cordes N° 1, Les Lettres enlacées II). Métaphores Une relecture de l’œuvre de Messiaen, un de ses maîtres, devait provoquer chez le compositeur un passage scriptural dans les années 1990. […] Alors qu’elle tendait dans les œuvres précédentes à être assumée par la théâtralité de l’écriture (qui s’auto-générait, dans une organicité provoquée par la mise en abîme du son), la forme, désormais happée dans un milieu conjonctif duquel se distinguent certains flux plus plastiques (sans pour autant renouer avec l’esthétique hiérarchique de la figure sur fond), s’identifie avec une prise en main de l’auditeur, un embras(s)ement, un tour de force haptique qui fait de Michaël Lévinas plus qu’un exégète indispensable: un héritier de Beethoven. L’omniprésence d’un conflit esthétique caractérise très fortement le Quatuor à cordes N° 1 (1998). […] Nous aimerions définir le tournant des années 1990 comme un passage-membrane plus qu’un passage-isolant, car il est resté ouvert sur les problématiques compositionnelles du passé: le recours à l’écriture polyphonique abstraite, fondée sur la définition a priori d’un matériau de hauteurs, permet la création de textures dont la «vocalité du timbre» (Michaël Lévinas) rejoint les principes de toujours du compositeur. Comme si la superposition de plusieurs échelles, ces temporalités figées, potentielles, en attente d’actualisation, permettaient une exploration renouvelée d’un au-delà du son: le rapport de force a été translaté d’un espace de «rencontre» à un espace d’«échange». Pièce-laboratoire, mais à maints égards déjà synthèse, Les Lettres enlacées II pour alto solo (2000) développe une technique de jeu à l’instrument destinée à être mise en série dans plusieurs pièces pour différentes formations à cordes. […] Texte de Eric Denut paru dans le livret de l’album Musique de chambre de Michäel Lévinas. Collection Accord una corda – réf. CD 461 7852. Avec l’aimable autorisation du label Accord / Universal et de l’auteur. 1 146 Mascarades Insatisfait de la grammaire relationnelle dont il hérite dans les œuvres instrumentales du répertoire, la mise en abîme du son a longtemps été pour Michaël Lévinas la forme syntaxique essentielle du voyage vers l’inouï. Le croisement d’une résonance avec une autre (qui commence, avec l’instrument comme porte-voix, «masque vocal»), l’interférence d’un spectre dans un autre, remplace le principe de la doublure orchestrale, et crée les conditions mêmes de l’œuvre. Alors que la traditionnelle doublure agglomère des monades indifférentes acoustiquement les unes aux autres, le croisement conglomère les sons nomades, actualise des correspondances sous-jacentes dans l’univers instrumental et propres à la volonté singulière de leur compositeur, renouvelant ainsi l’antique responsabilité mutuelle des sons qui gère depuis sept siècles le contrepoint. Principe d’écriture efficace, la «musique de la musique» (selon l’expression du compositeur) l’est dans le sens où elle enrichit l’esthétique musicale d’une nouvelle approche de sa problématique la plus ancienne: celle de l’identité et de l’altérité, du pur et de l’impur. Arlequinades Les rencontres vibratoires, dont l’horizon d’attente s’est multiplié avec les nouvelles technologies (d’acoustique, elles sont devenues électronique, puis numérique) créent une mise en scène naturelle du son, une écriture de l’espace organiquement liée à l’œuvre (et non anecdotique). Toute œuvre de Michaël Lévinas définit ainsi un espace propre de réverbération, auquel le réceptacle scénique (qu’il soit salle de concert ou espace d’écoute stéréophonique) surimprime son acoustique singulière. La musique, au moment même où elle quitte la seule dimension du sonore pour être transfigurée en œuvre, accomplit ainsi son projet théâtral qui l’habite intrinsèquement, épanouit sa force de représentation d’une réalité qui, sans la vigilance du compositeur, serait condamnée à rester énigmatique. L’ombre d’un instrument parasite devient un corset qui révèle la grâce d’un corps: les mascarades Lévinassiennes sont des arlequinades. Mais un Arlequin aux allures de rocker accro d’Orange mécanique. Pionnier de la prise en considération de l’amplification dans les années 1970, Michaël Lévinas n’hésite pas à «mettre la gomme». Un refus de «l’œuvre molle» qui ose provoquer un contexte d’hyperréalité: couleurs saturées, excès sonores dans lesquels l’horreur du bruit précipite, comme dans une expérience (al)chimique, en splendeur esthétique (de même Fassbinder noyait dans un blanc éclatant les scènes les plus inquiétantes du Secret de Veronika Voss). Peu de musiques parviennent aussi bien que celle de Michaël Lévinas à émanciper le musical de l’ineffable et du désincarné: saisi par une tactilité en prise directe sur son système nerveux, l’auditeur ressent comme jamais la présence d’une main détendueentendue vers lui, halo incandescent d’une utopique vie intense. Faut-il (en suivant Bataille) voir dans cet ultime dérèglement festif une nostalgie de l’état de nature, mis à mal par les artifices de la composition du son? Actualiser les forces sous-jacentes au musical, les capter à défaut de les capturer dans une volonté d’appartenir à ou de faire école, tel est peut-être le projet compositionnel qui unifie la démarche de Michaël Lévinas depuis ses premiers operas. De la reconnaissance par le jeune compositeur du lyrisme consubstantiel à l’idiome instrumental à l’exploration ces dernières années d’un au-delà du son dans une écriture polyphonique renouvelée, les voix / voies de l’assomption compositionnelle convergent vers une vigilance de l’écriture dont la moindre qualité n’est pas de s’inscrire dans la temporalité assumée d’une conscience en mouvement. La romance d‘Ariel Paul Bourget (1852–1935) Au long de ces montagnes douces, Dis! viendras-tu pas à l’appel De ton délicat Ariel Qui velouté à tes pieds les mousses? L’eau du lac lumineux ou sombre, Miroir changeant du ciel d’été, Qui sourit avec sa gaîté Et qui s’attriste avec son ombre; Suave Miranda, je veux Qu’il fasse justes assez de brise Pour que ce souffle tiède frise Les pointes d’or de tes cheveux! Symbole, hélas! du cour aimant, Où le chagrin, où le sourire De l’être trop aimé, se mire Gaîment ou douloureusement. Les clochettes de digitales Sur ton passage tinteront. Les églantines sur ton front Effeuilleront leurs blancs pétales. Au long de ces montagnes douces, Dis! viendras-tu pas à l’appel De ton délicat Ariel Qui velouté à tes pieds les mousses? Sous le feuillage du bouleau Blondira ta tête bouclée; Et dans le creux de la vallée Tu regarderas bleuir l’eau, 147 «Les ‹Aragons›» Eric Denut Dans Les ‹Aragons›, pièce pour mezzo-soprano et ensemble instrumental composée en 1996, l’écriture musicale est au service de la dramaturgie implicite du texte, tendue vers l’expression du sentiment amoureux. Les répétitions, les rimes de la musique, strictes ou translatées dans un espace de prime abord exclusivement vocal, envahissent progressivement dans le premier poème un accompagnement instrumental insistant. Outre la conquête progressive de l’aigu, la progression dramatique est déléguée à de subtils effets d’accélération et de ralenti qui donnent sens à la répétition et appellent des respirations dans la forme. Ces dernières culminent dans les battements de cœur (tabla et grosse caisse), une ponctuation qui s’était imposée au compositeur et s’est révélée depuis conforme aux souhaits du poète. La vocalité emprunte aussi bien au parlando qu’au lyrisme de répertoire et prend en charge une forme globale en arche, colorée par cymbalum, accordéon et piano, traditionnels compagnons de la voix, et les rappels à l’ordre des peaux. L’écriture traduira l’intériorité attristée du poème médian par une réduction poignante des moyens musicaux: une voix attachée à la manie d’une figure mélodique, dernier lambeau d’un amour humilié, est accompagnée par des percussions cristallines et discrètes. Dans ce contexte, le courage de l’aigu, pourtant chanté, se métamorphose en cri, après que, de la saine agressivité du premier poème, il n’est resté qu’un souffle, une suffocation. Une chanson populaire aux arabesques andalousantes qui se transmue en valse (avec ses harmonies authentiques), des mixtures (piano-guitare accordée 1 / 4 de ton au-dessous du diapason) qui font bastringue, des ralentis qui s’entendent comme des rubati d’expression: la «musique de la musique» du dernier poème assume la défiguration d’une référence spatio-temporelle, d’un patrimoine dont elle cristallise à nouveau l’actualité comme un refrain qu’on ne pourrait oublier. La chanson parisienne, modèle déraciné prêt au collage, est transportée en «état d’apesanteur» (Michaël Lévinas) dans une texture musicale surréaliste qu’elle transfigure en beauté convulsive. Les ‹Aragons› Michaël Lévinas Texte de Eric Denut paru dans le livret de l’album Musique de chambre de Michäel Lévinas. Collection Accord una corda – réf. CD 461 7852. Avec l’aimable autorisation du label Accord / Universal et de l’auteur. 1 148 Les ‹Aragons› ont été écrits après la création du premier opéra de Michaël Lévinas (Go-gol) et pendant l’écriture du second opéra Les nègres qui a été crée en 2004 à l’Opéra de Lyon et au Grand Théâtre de Genève. Ce contexte d’écriture peut permettre de relier Les ‹Aragons› à une rencontre spécifique avec la textualité. Il s’agit d’une structure poétique qui porte en elle la phrase mélodique et implique, à la fois l’intelligibilité du texte et le chant de la langue. Les Yeux d’Elsa Louis Aragon De la prairie où vient danser Une éternelle fiancée Tes yeux sont si profonds qu’en me penchant pour boire J’ai vu tous les soleils y venir se mirer S’y jeter à mourir tous les désespérés Tes yeux sont si profonds que j’y perds la mémoire Et j’ai bu comme un lait glacé Le long lai des gloires faussées À l’ombre des oiseaux c’est l’océan troublé Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent L’été taille la nue au tablier des anges Le ciel n’est jamais bleu comme il l’est sur les blés Les vents chassent en vain les chagrins de l’azur Tes yeux plus clairs que lui lorsqu’une larme y luit Tes yeux rendent jaloux le ciel d’après la pluie Le verre n’est jamais si bleu qu’à sa brisure Mère des Sept douleurs ô lumière mouillée Sept glaives ont percé le prisme des couleurs Le jour est plus poignant qui point entre les pleurs L’iris troué de noir plus bleu d’être endeuillé Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche Par où se reproduit le miracle des Rois Lorsque le cœur battant ils virent tous les trois Le manteau de Marie accroché dans la crèche Une bouche suffit au mois de Mai des mots Pour toutes les chansons et pour tous les hélas Trop peu d’un firmament pour des millions d’astres Il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux La Loire emporte mes pensées Avec les voitures versées Et les armes désamorcées Et les larmes mal effacées Ô ma France ô ma délaissée J’ai traversé les ponts de Cé Elsa-Valse Louis Aragon Où t’en vas-tu pensée où t’en vas-tu rebelle Le Sphinx reste à genoux dans les sables brûlants La victoire immobile en est-elle moins belle Dans la pierre qui l’encorbelle Faute de s’envoler de l’antique chaland Quelle valse inconnue entraînante et magique M’emporte malgré moi comme une folle idée Je sens fuir sous mes pieds cette époque tragique Elsa quelle est cette musique Ce n’est plus moi qui parle et mes pas sont guidés L’enfant accaparé par les belles images Écarquille les siens moins démesurément Quand tu fais les grands yeux je ne sais si tu mens On dirait que l’averse ouvre des fleurs sauvages Cette valse est un vin qui ressemble au Saumur Cette valse est le vin que j’ai bu dans tes bras Tes cheveux en sont l’or et mes vers s’en émurent Valsons-la comme on saute un mur Ton nom s’y murmure Elsa valse et valsera Cachent-ils des éclairs dans cette lavande où Des insectes défont leurs amours violentes Je suis pris au filet des étoiles filantes Comme un marin qui meurt en mer en plein mois d’août La jeunesse y pétille où nos jours étant courts A Montmartre on allait oublier qu’on pleura Notre nuit a perdu ce secret du faux-jour Mais a-t-elle oublié l’amour L’amour est si lourd Elsa valse et valsera J’ai retiré ce radium de la pechblende Et j’ai brûlé mes doigts à ce feu défendu Ô paradis cent fois retrouvé reperdu Tes yeux sont mon Pérou ma Golconde mes Indes Puis la vie a tourné sur ses talons de songes Que d’amis j’ai perdus L’un tirait les tarots L’autre en dormant parlait de l’amour des éponges Drôles de gens que l’ombre ronge Fanfarons de l’erreur qui jouaient aux héros Il advint qu’un beau soir l’univers se brisa Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent Moi je voyais briller au-dessus de la mer Les yeux d’Elsa les yeux d’Elsa les yeux d’Elsa Le Pont de C Louis Aragon J’ai traversé les ponts de Cé C’est là que tout a commencé Souviens-toi des chansons que chantait pour nous plaire La négresse au teint clair ce minuit qu’on poudra Avant l’aube en rentrant on prenait un peu l’air Que de nuits ainsi s’envolèrent O temps sans colère Elsa valse et valsera Achetée à crédit la machine à écrire Nous mettait tous les mois dans un bel embarras On n’avait pas le sous Qu’il est cher de chérir Mes soucis étaient tes sourires Car je pouvais dire Elsa valse et valsera Une chanson des temps passés Parle d’un chevalier blessé D’une rose sur la chaussée Et d’un corsage délacé Du château d’un duc insensé Et des cygnes dans les fossés 149 Wolf Lieder Gérard Grisey d‘après Hugo Wolf In der Frühe Eduard Mörike Das verlassene Mägdlein Eduard Mörike Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir, Dort gehet schon der Tag herfür An meinem Kammerfenster. Es wühlet mein verstörter Sinn Noch zwischen Zweifeln her und hin Und schaffet Nachtgespenster. Ängste, quäle dich nicht länger, meine Seele! Freu’ dich! Schon sind da und dorten Morgenglocken wach geworden. Früh, wann die Hähne kräh’n, Eh’ die Sternlein [ver]schwinden, Muß ich am Herde stehn, Muß Feuer zünden. Um Mitternacht Eduard Mörike Bedächtig stieg die Nacht an’s Land, lehnt träumend an der Berge Wand, ihr Auge sieht die goldne Wage nun der Zeit in gleichen Schalen stille ruhn; und kecker rauschen die Quellen hervor, sie singen der Mutter, der Nacht, in’s Ohr vom Tage, vom heute gewesenen Tage. Das uralt alte Schlummerlied, sie achtet’s nicht, sie ist es müd’; ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch, der flüchtgen Stunden gleichgeschwung’nes Joch. Doch immer behalten die Quellen das Wort, es singen die Wasser im Schlafe noch fort vom Tage, vom heute gewesenen Tage. Schön ist der Flammen Schein, Es springen die Funken. Ich schaue so d[a]rein, in Leid versunken. Plötzlich, da kommt es mir, Treuloser Knabe, Daß ich die Nacht von dir Geträumet habe. Träne auf Träne dann Stürzet hernieder; So kommt der Tag heran O ging er wieder! Nun wandre, Maria Paul Heyse (1830–1914) basierend auf «Camino a Belén» (Ocaña, um 1600) Nun wandre, Maria, nun wandre nur fort. Schon krähen die Hähne, und nah ist der Ort. Nun wandre, Geliebte, du Kleinod mein, Und balde wir werden in Bethlehem sein. Dann ruhest du fein und schlummerst dort. Schon krähen die Hähne und nah ist der Ort. Wohl seh ich, Herrin, die Kraft dir schwinden; Kann deine Schmerzen, ach, kaum verwinden. Getrost! Wohl finden wir Herberg dort. Schon krähen die Hähne und nah ist der Ort. Wär erst bestanden dein Stündlein, Marie, Die gute Botschaft, gut lohnt ich sie. Das Eselein hie gäb ich drum fort! Schon krähen die Hähne und nah ist der Ort. 150 Transkription als Erinnerung Zur Bearbeitung der «Berceuse» aus den «Quatre chants pour franchir le seuil» von Gérard Grisey Brice Pauset Einige Zeit nachdem ich Schüler von Gérard Grisey geworden war, habe ich ihm bei der Komposition zweier neuer Stücke zur Seite gestanden (Icône paradoxale und Vortex temporum). Meine direkte Einsichtnahme in sein technisches Handwerk hat mir später, im begrenzteren Rahmen dieses Wiegenliedes, erlaubt, bestimmte irrationale Eingebungen, die bei einer Transkription unvermeidbar sind, bewusst zu beherrschen. Zudem hat mir die neuerliche Erfahrung Gérards in seiner Instrumentation der Wolf Lieder einen sehr konkreten methodologischen Fluchtpunkt in seiner «lecture de l’histoire» geboten, als Einladung zur Subjektivierung eines Werks, einer Technik, einer Expressivität. Schließlich sind es die Erinnerungen an den verlorenen Freund, die mir zweifellos vor allem anderen in dieser so schwierigen Aufgabe eine Hilfe waren: die Erinnerung an sein Zögern, seine Entscheidungen, seine Beobachtungen, die stets offen waren für die fruchtbarsten Einwände, für das Komponierbare. 151 Grenz-Gesänge Notizen zu Gérard Grisey «Quatre chants pour franchir le seuil» Peter Niklas Wilson Als der französische Komponist Claude Vivier 1983 ums Leben kam, widmete ihm sein Kollege Gérard Grisey ein Diptychon für ein tiefes Holzblasinstrument. Anubis – Nout heißt das Stück, benannt nach zwei Göttern der altägyptischen Mythologie, die zugleich die Polarität der Weltsicht dieser Kultur aufspannen: Anubis, der schakalköpfige Beschützer der Toten, Nout, die den Horizont umspannende Gottheit der Tagwelt, die jeden Abend die Sonne verzehrt, um sie am nächsten Morgen neu zu gebären. Es war nicht das erste Mal, dass Grisey, der 1946 geborene Vordenker des sogenannten spektralen Komponierens, auf das Weltbild der Ägypter rekurrierte. Bereits Jour, contre jour, ein Ensemblestück aus dem Jahr 1979, spiegelte den Dualismus von Sonnen- und Schattenreich, von den Sphären der Lebenden und der Toten musikalisch wider, in einem Spiel mit strahlenden Klangspektren und düsteren Klangschatten. Auch wenn sich der Theoretiker Gérard Grisey gegen eine Befrachtung der Musik mit Geschichten, gegen außermusikalische Programme aussprach, so war die Musik des Komponisten Gérard Grisey doch keineswegs frei von einer semantischen Schicht von metaphysischer Tragweite. Nirgends tritt dies deutlicher zutage als in den Quatre chants pour franchir le seuil, den «Vier Gesängen, um die Schwelle zu überschreiten», der letzten Partitur, die Grisey vor seinem plötzlichen Tod am 11. November 1998 vollendete. Es fällt schwer, von bloßer Koinzidenz zu sprechen, wenn das letzte Werk eines Komponisten, ein vierzigminütiges Stück für Sopran und 15 Instrumentalisten, ausgerechnet eines ist, das den Tod thematisiert. Denn die Schwelle, von deren Überschreiten im Titel die Rede ist, ist die zwischen Leben und Tod. Vier Gesänge auf der Grundlage von vier poetischen Versuchen, das Ungreifbare des Nichtmehr-Lebens in Worte zu fassen: Reflexionen über das Sterben des Engels aus den «Les heures à la nuit» des 1989 verstorbenen französischen Lyrikers Christian Guez Ricord, den Grisey 1972 in der Villa Medici in Rom kenengelernt hatte (Grisey: «Der Tod des Engels ist in der Tat der schrecklichste von allen, denn ihm sind unsere Träume anvertraut»). Worte aus den nur bruchstückhaft entzifferbaren Inschriften ägyptischer Sarkophage des mittleren Reichs. Zeilen über die Stille im Reich der Toten der altgriechischen Dichterin Erinna aus Telos. Und schließlich Verse aus dem altbabylonischen Gilgamesch-Epos, die die Ruhe und Schönheit der Welt nach der Sintflut schildern. Vier Gesänge vom Überschreiten der Schwelle: vier Reflexionen über den Tod aus vier Zeiten, vier Kulturen, der christlichen, der ägyptischen, der griechischen, der mesopotamischen, und doch ist ihnen eines gemein: ein Fehlen des Aufbegehrens, der Verzweiflung, stattdessen Abgeklärtheit, ein ruhiges Annehmen einer neuen, anderen Daseinsform. Eben jene Ruhe im Angesicht des unfaßlich Anderen strahlen auch die meisten Klänge aus, die Gérard Grisey in den Monaten vor seinem Tod für diese Texte fand. «In der Unterwelt verhallt das Echo ungehört. Und es verstummt bei den Toten. Die Stimme verliert sich im Schattenreich.» So die Worte der griechischen Dichterin Erinna aus Telos, die um 350 vor unserer Zeitrechnung lebte und im Alter von nur 19 Jahren starb, eine verbale Folie für die instrumentalen Klangschatten der Gesangsstimme, wie sie Gérard Grisey im dritten der Quatre 152 chants pour franchir le seuil skizziert hat. Es ist kein Zufall, dass Grisey sich immer wieder zu akustischen Reflexionen über Werden und Vergehen, über Licht und Schatten hingezogen fühlte, betrachtete er doch selbst den Klang als ein Lebewesen, einen Organismus. Und da der Klang ein Zeit-Wesen ist, bedeutet Komponieren zugleich Reflexion über Werden und Vergehen. In Griseys Metapher: «Mit einer Geburt, einem Leben und einem Tod ähnelt der Klang einem Lebewesen. Die Zeit ist seine Atmosphäre und sein Territorium.» Der Klang als Kreatur, die Komposition als Biographie der Klänge: ein biologistisches Verständnis des Akustischen, und gemäß diesem Credo entdecken wir in Griseys Quatre Chants pour franchir le seuil einmal mehr all jene ästhetischen Qualitäten, die Griseys spektrales, aus den Eigenheiten der Obertonreihe abgeleitetes Komponieren zu mehr machen als zu Etüden über Themen aus dem AkustikLehrbuch (um einen häufigen und nicht immer unbegründeten Vorwurf gegen die Schule des spektralen Komponierens zu benennen). «Biomorphes» Komponieren, das bedeutet: Klang nicht als starres, parametrisch rubrizierbares Objekt, sondern als lebendiger Mikro-Organismus, dessen Eigendynamik zum Modell musikalischer Gestaltung in allen Dimensionen wird, biomorphes Komponieren, das heißt: ‹natürlicher› Wechsel von Spannung und Entspannung, Verdichtung und Verdünnung, Aktivität und Ruhe nach dem Modell des Atmens, das heißt auch: die ‹weiche›, unscharfe Periodizität des Herzschlags anstelle des starren Rasters von Puls und Takt, allmählicher Übergang statt schroffer Kontrast, Vermittlung zwischen extremen Zuständen des Klangs, und das heißt: eine Vorliebe für das Niemandsland, in dem die Grenzen zwischen Einzelton und Akkord, zwischen Akkord und Klangfarbe, zwischen reinem Ton und Geräusch auf verführerische Weise verschwimmen. Biomorphes Komponieren ist gleichbedeutend mit prozessualem Komponieren. In Griseys Worten: «Das Klangobjekt ist ein zusammengezogener Prozeß, der Prozeß ist ein ausgedehntes Klangobjekt. Die Zeit ist gleichsam die Atmosphäre, welche diese beiden lebendigen Organismen in verschiedenen Höhenlagen atmen.» Wie wenige andere Komponisten war Gérard Grisey ein Meister der Arbeit in diesen verschiedenen «Höhenlagen», einer, der virtuos zwischen Mikro- und Makrozeit hin- und herzoomte, oder, in Griseys schönem Bild, zwischen der Zeit der Menschen, der gedehnten Zeit der Wale und der extrem komprimierten Zeit der Insekten. Und jene Verfügung über Zeit, über die Hör-Perspektive gibt – Grisey wußte es wohl – der Musik eine Macht, die ebenso an Metaphysisches rührt wie die Texte der Quatre chants dies tun. «Mit Zeit befruchtet, ist die Musik mit jener Gewalt des Heiligen ausgestattet, von der Georges Bataille spricht, stumme und sprachlose Gewalten, welche der Klang und sein Werden – vielleicht und nur für einen Augenblick – beschwören und austreiben können.» In seinen letzten Jahren suchte Gérard Grisey eine neue Beziehung zur abendländischen Musiktradition. Nicht im Sinne von Nostalgie oder Stilkopie, sondern im Sinne einer neuen Perspektive auf das Alte, im Sinne der Kommunikationsfähigkeit der eigenen kompositorischen Ideen mit der Musik früherer Generationen. Im Quintett Vortex temporum hatte er eine Flötenfigur aus Ravels Daphnis et Chloé in einen Wirbel von Zeit- und Spektral-Transformationen gesteckt. In den Quatre chants gibt es, ungeachtet aller Grisey-typischen Spektral- und Zeit-Dehnungen und -stauchungen, subkutane Beziehungen zu traditionellen abendländischen Topoi des musikalischen Umgangs mit dem Thema Tod – so die absteigende, in den Bereich der Mikrotöne verfeinerte Chromatik des ersten Gesangs, so das demonstrativ dunkle Kolorit des Ensembles mit Baß- und Kontrabaßklarinette, mit tiefem Schlagwerk, mit zwei Tuben und Kontrabaß. Ungewöhnlich manifest wird der Konnex zu traditionellen Todes-Chiffren im letzten Gesang, jenem Auszug aus dem Gilgamesch-Epos, der eine weltverwüstende Katastrophe und die schöne Stille nach der Apokalypse schildert, eine Stille, in der alle Menschen wieder zu Erde geworden sind. Mächtige tiefe Trommeln und das vierfache Fortissimo zweier Tuben: Dies sind Register des akustischen Infernos, die 153 unwillkürlich an Berlioz oder Mahler denken lassen. Mit dem musikalischen Armageddon, dem der lyrische Abgesang folgt, reiht sich Grisey, vielleicht ungewollt, in die großen Todes- und Abschiedsszenarien von Mahler und Strauss ein, werden die Quatre chants pour franchir le seuil zu einem Nachtrag zu den bewegenden Abgesängen der Musik des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Grisey selbst hat diese Musik freilich anders gehört: «Die zarte Berceuse, die fast wie ein fünfter […] Gesang den Zyklus beendet, ist nicht für das Einschlafen, sondern für das Erwachen gedacht. Es ist Musik der Morgendämmerung einer Menschheit, die endlich vom Alptraum befreit ist. Ich wage zu hoffen, dass dieses Wiegenlied nicht zu jenen gehören wird, die wir eines Tages für die ersten menschlichen Klone singen werden – wenn man ihnen die genetische und psychologische Gewalt bewußt machen wir, die ihnen eine verzweifelt nach Grundtabus suchende Menschheit zugefügt hat.» Hier sind andere Grenzen menschlichen Lebens angesprochen, solche, von denen die VerfasserInnen der Texte der Quatre chants pour franchir le seuil noch nichts ahnten. Als die «Quatre chants» am 3. Februar 1999 in London uraufgeführt wurden, hatte Gérard Grisey bereits selbst die letzte Schwelle überschritten. Berceuse (d’après L’Epopee de Gilgamesh) J’ouvris une fenêtre Et le jour tomba sur ma joue. Je tombai à genoux, immobile, Et pleurai … Je regardai l’horizon de la mer, le monde … Berceuse (nach dem Gilgamesch-Epos) Ich öffnete ein Fenster und das Sonnenlicht fiel auf meine Wangen Ich fiel auf die Knie, regungslos, und weinte … Ich betrachtete den Horizont des Meeres, die Welt … 154 Gérard Grisey Photo: Guy Vivien 155 156 SERVICE 157 Interprètes & ensembles Index & Biographies Alain Billard clarinette basse p. 66 Born in 1971, Alain Billard began studying the clarinet at the age of five with Nino Chiarelli at the École de Musique de Chartres. Very early on, he joined the ensemble run by his parents. The extremely varied group of musicians that he frequented inspired his career – he not only plays clarinet and bass clarinet, but also tuba, saxophone and bass guitar. He continued his studies at the Conservatoire de Paris with Richard Vieille. He obtained the Médaille d’or in 1990 then the prix d’Excellence in 1992. In 1996, at the Conservatoire de Lyon, he obtained the Diplôme d’Études Supérieures in Jacques Di Donato’s class. In parallel, he had joined the Nocturne Wind Quintet, with which he obtained his premier Prix in Chamber Music at the Conservatoire de Lyon and the second prize at the ARD International Competition in Munich. Alain Billard joined the Ensemble intercontemporain in 1995. In parallel to his solo career, he takes part in the Ensemble’s educational activities for young people and future music professionals. Fabrice Bollon direction p. 46 Fabrice Bollon ist ein sehr vielseitiger französischer Dirigent, der sowohl im Opernbereich wie im sinfonischen Bereich international geschätzt wird. Sein Repertoire umfasst nicht nur die viel gespielte Standardliteratur, sondern auch weniger bekannte Werke. Von der Presse hoch gelobt wurde beispielsweise die von ihm 2003 geleitete deutsche Erstaufführung der Oper Pénélope von Gabriel Fauré. Neugier und stilistische Unbestechlichkeit, verbunden mit einer persönlichen Sicht charakterisieren seine künstlerische Arbeit. Nach seinem Dirigierstudium am Mozarteum Salzburg in den Meisterklassen von Michael Gielen und Nikolaus Harnoncourt debütierte er bei den Salzburger Festspielen mit der Oper Satyrikon von Maderna. Noch in seiner Zeit als stellvertretender GMD der Oper Chemnitz und Chef des Symphonie Orchester von Flandern in Brügge springt Fabrice Bollon für den erkrankten Gary Bertini mit dem WDR Orchester in der Kölner Philharmonie ein. In weiterer Folge gastiert er bei den großen Orchestern Deutschlands, wie dem SWR-Stuttgart – das er u.a. in Paris beim Herbstfestival dirigiert und mit dem er eine CD mit Werken von Rihm aufnimmt –, dem SWR Baden Baden, dem RSO Frankfurt, dem BSO Berlin, dem RSB Berlin, dem MDR Leipzig, dem NDR Hamburg, sowie außerhalb Deutschlands auch beim Residentie Orchester den Haag, Orchestre National de Lyon, u.v.a. Ausgewählte Höhepunkte der Spielzeit 05 / 06 sind Wiedereinladungen beim RSO Frankfurt zu den Kasseler Musiktagen, beim SWR Sinfonieorchester für das Konzert in der Philharmonie Luxembourg, beim Orchestre Philharmonique de Radio France, beim Orchestre de Strasbourg und dem Orchestre von Monte Carlo, sowie die Produktion der Perlenfischer bei der Oper Maastricht sein. Einladungen in Frankreich, Norwegen, Schweiz, Spanien, sowie zahlreiche 158 CD- und Rundfunkaufnahmen machen ihn zu einen der meist gefragten französischen Dirigenten seiner Generation. Gérard Caussé alto p. 84 Gérard Caussés einzigartige musikalische Begabung, seine gründliche Kenntnis der Musik des 20. Jahrhunderts sowie seine aussergewöhnliche Beherrschung der Bratsche verliehen dieser eine neue Dimension als Soloinstrument. Die Komponisten Masson, Nuñes, Grisey, Lenot, Hersant, Jolas, Reverdy und Louvier wurden von Gérard Caussé inspiriert und widmeten ihm zahlreiche Werke. Sein ständiges Bemühen als Solist und Kammermusiker, das Bratschen-Repertoire zu erweitern, aber auch seine mustergültigen Interpretationen des klassischen Repertoires wurden mit gewichtigen Preisen ausgezeichnet: Fondation de la vocation, Prix Sacem, Grand Prix du Disque, Prix Gabriel Fauré, Prix Académie Charles Cros usw. Neben seinen Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des klassischen Repertoires hat er weltweit als Solist mit Dirigenten wie zum Beispiel John Eliot Gardiner, Charles Dutoit, Kent Nagano, Emmanuel Krivine und Rudolf Barshai zusammengearbeitet; zu seinen ständigen Kammermusikpartnern zählen Gidon Kremer, Paul Meyer, François-René Duchâble, Augustin Dumay, Misha Maisky, Maria João Pires, Maria Graf, Irena Grafenauer, das Hagen Quartett u.v.a. Als Professor lehrt Gérard Caussé am Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris und an der namhaften Escuela Superior de Musica Reina Sofia in Madrid. Aufnahmen mit Gérard Caussé erschienen bei EMI, Erato, Philips und DGG. Gérard Caussé spielt eine Bratsche von Gasparo da Salvo aus dem Jahre 1560. Jeanne-Marie Conquer violon p. 66 In 1980, Jeanne-Marie Conquer obtained the Premier Prix in violin at the Conservatoire de Paris. After continuing her studies (postgraduate cycle known as Perfectionnement), she joined the Ensemble intercontemporain in 1985. She has recorded Sequenza VIII by Luciano Berio, Pierrot Lunaire and Ode to Napoleon by Arnold Schönberg conducted by Pierre Boulez (Deutsche Grammophon). She also belongs to the Ensemble intercontemporain String Quartet. Eric-Maria Couturier violoncelle p. 66 Eric-Maria Couturier, who was born in Danang (Vietnam) in 1972, studied at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, where he was awarded first prize for cello in the class taught by Roland Pidoux, and first prize for chamber music in that taught by Jean Mouillère; both prizes were awarded by unanimous decisions. He has also taken master-classes with Janos Starker, Igor Gavritch and Etienne Péclard, and given chamber music performances alongside Roland Pidoux, Christian Ivaldi, Gérard Caussé, Régis Pasquier, Jean-Claude Pennetier, Tabea Zimmermann, JeanGuihen Queyras and Pierre-Laurent Aimard. In 1996, he was selected to attend advanced classes taught by Christian Ivaldi and Ami Flammer at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. In 1997, he reached the semi-finals in the Concours Rostropovitch cello competition. He has been distinguished in international competitions at such places as Trapani, Trieste and Florence. In 2000, he was appointed soloist at the Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, and took part in a great many festivals, among them La Roque d’Anthéron and Jeunes Solistes d’Antibes. He joined the Ensemble intercontemporain in June 2002. 159 Christophe Desjardins alto p. 66 Christophe Desjardins studied under Serge Collot and Jean Dupouy at the Paris Music Conservatory, and Bruno Giuranna at the Berlin Hochschule der Künste. Winner of the international «Maurice Vieux» competition, He joined the Orchestre de La Monnaie in Brussels in 1986 as violasoloist where he stayed until 1990 when he moved to the Ensemble intercontemporain. This marked a turning point in his career with a movement towards contemporary repertoire. Some of the works written for him include: Surfing by Philippe Boesmans (1990), L’orrizonte di Elettra by Ivan Fedele (1995), Mémoire de vague by Denis Cohen (1996), Isthar by Felix Ibarrondo (1998) and, of course, Alternatim by Luciano Berio, for viola, clarinet and orchestra, presented at the Amsterdam Concertgebouw in 1997 and then toured to Salzburg, Carnegie Hall in New York and Cité de la Musique in Paris. Recent work (2000), includes More Leaves written by Michael Jarrell, and Lettres enlacées II by Michaël Lévinas, commissioned for the Rencontres Internationales d’Alto. As part of the Aix-en-Provence festival which he directed, he gave a world premier of a version for 7 violas of Messagesquisse by Pierre Boulez, Portraits by Pierre Strauch and Paroles by Ivan Fedele. At the same time, Christophe Desjardins has performed as soloist with some leading international names (SüdwestfunkSinfonieorchester, ORF-Sinfonieorchester, Orchestre national de Lyon), and recorded several works: Diadèmes by Marc-André Dalbavie, conducted by Pierre Boulez, Assonance IV by Michael Jarrell, Sequenza VI by Luciano Berio. Christophe Desjardins plays a viola by Capicchioni. Ensemble intercontemporain p. 6, 66, 77 In 1976, Pierre Boulez set up the Ensemble intercontemporain with the support of Michel Guy, Minister of Culture at the time. The Ensemble’s 31 soloists are all deeply committed to contemporary music. They are employed on permanent contract, enabling them to fulfill the major aims of the Ensemble: performance, creation and music education for young musicians and the general public. The musicians work in close collaboration with composers, exploring instrumental techniques and developing projects, some of which interweave music, theater, film, dance and video. New pieces are commissioned and performed on a regular basis. These works enrich the Ensemble’s repertory and add to the corpus of 20th century masterworks. The Ensemble is renown for its strong emphasis on music education: concerts for kids, creative workshops for students, training programs for future performers, conductors, composers, etc. Since 1995, the Ensemble has been based at the Cité de la musique in Paris. Performing over 70 concerts a year in France and abroad, it also takes part in major festivals worldwide. The principal guest conductor is Jonathan Nott. The Ensemble is mainly financed by the Ministry of Culture and Communication, and receives financial support from the Paris City Council. Additional grants for educational activities are provided by Fonds d’Action SACEM. Samuel Favre percussion p. 66 Samuel Favre was born in Lyon in 1979. He started learning percussion at the age of eight with Alain Londeix at the Conservatoire National de Région de Lyon, where he obtained his Médaille d’or in 1996. In 1996, he entered the Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon and studied with Georges Van Gucht then Jean Geoffroy. In June 2000 he obtained a DNESM (national diploma for higher musical studies) with distinction by unanimous vote. In parallel, he was a trainee at the Académie of the Aix-en-Provence Festival and the Centre Acanthes, and played with the Orchestre national de Lyon and the Orchestre du Capitole de Toulouse, which awarded him 160 a scholarship in 1999. He concentrates on working with contemporary composers, and actively takes part in the «Atelier Instrumental du XXe siècle» linked to the Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, directed by Fabrice Pierre, and in the «Ensemble Transparences», conducted by Sylvain Blassel, with whom he has made a recording devoted to Jacques Lenot («Charmes» under the Etoile Productions label). Since October 2000, Samuel Favre has been a member of the Arcosm company, with whom he explores the interactions between music and dance. He joined the Ensemble intercontemporain in April 2001. Jean-Marc Foltz clarinette p. 130 Soliste reconnu de la musique contemporaine écrite, Jean-Marc Foltz travaille avec les compositeurs les plus marquants de la scène européenne. Il a collaboré longtemps notamment avec Accroche Note et l’Ensemble intercontemporain. Il fonde avec Guy Frisch et Sylvie Brucker l’atelier Quiproquo et soutient les jeunes compositeurs. Actuellement, il se produit en récital solo et est invité pour des masterclasses en France, en Italie, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, en République Tchèque… En musique contemporaine improvisée, il est membre du Jazztet de Bernard Struber et de Lousadzak de Claude Tchamitchian. Il est complice de Raymond Boni, Latif Chaarani, Bruno Chevillon, Ramon Lopez, Gaguik Mouradian, Stephan Oliva et Claude Tchamitchian avec lesquels il joue en petites formations. Sa discographie compte une dizaine d’enregistrements. Jean-Marc Foltz enseigne au Conservatoire National de Région et à l’École Supérieure d’Art Dramatique de Strasbourg. Nicolas Hodges piano p. 102, 104 Nicolas Hodges was born in London in 1970. One of the most exciting performers of his generation, Hodges is equally active in several fields: nineteenth century, early twentieth century and contemporary music. His substantial repertoire prior to 1900 includes works by Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt and Brahms, while his twentieth century repertoire includes works by Debussy, Schoenberg, Berg, Webern, Bartók, Stravinsky and Busoni. In the field of contemporary music he plays both the classics of the Avant-Garde (such as Barraqué, Cage, Feldman, Nono and Stockhausen) and works from the last decades. He has close working relationships with many composers including Adams, Birtwistle, Carter, Ferneyhough, Harvey, Kagel, Knussen, Lachenmann, Neuwirth, and Stockhausen. Most notable among his many premieres are Bill Hopkins’ Etudes en Série (1965–72) as well as works written especially for him by Ablinger, Boehmer, di Bari, Cappelli, Clarke, Dillon, Finnissy, Furrer, Pauset, Alwynne Pritchard, Sciarrino and Wuorinen. Several composers are currently writing works for him, including concerti by Furrer, Alwynne Pritchard, Rebecca Saunders and Pauset, and solo works by Aperghis, Pauset, Rolf Riehm and Sciarrino. Elliott Carter recently wrote for Hodges his concerto Dialogues, commissioned by the BBC (2004). Hodges’ career has taken him around the world, to continental European festivals such as Witten, Darmstadt, Berlin, Luzern, Paris (Festival d’Automne), Innsbruck (Klangspuren), Brussels (Ars Musica), and Zurich (Tage für Neue Musik); to all the major UK festivals; and to Scandinavia and the US. His concerto engagements have included performances with the BBC Symphony Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Bamberger Symphoniker, Philharmonia Orchestra, London Sinfonietta, Basel Sinfonietta, Athelas Sinfonietta (Copenhagen) and Endymion Ensemble, under conductors such as Barenboim, Brabbins,Knussen, Masson, Nott, Rophé, Rundel, Saraste, Slatkin, Otaka and Valade. He performs as actor and pianist in Brian Ferneyhough’s opera Shadowtime in Paris, New York and London. 161 Danielle Hennicot alto p. 46, 130 Danielle Hennicot est née à Luxembourg. Elle a reçu sa formation musicale au Conservatoire de Luxembourg et au Koninklijk Muziekkonservatorium de Bruxelles (Premier Prix d’alto avec distinction, lauréate du Prix Claude Jadot en 1992, Premier Prix de musique de chambre en 1992, Diplôme Supérieur en 1995). Elle est également lauréate de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth où elle a travaillé avec Ervin Schiffer durant la session 1992 / 1995. Elle s’est produite en tant que soliste avec l’Orchestre National de Belgique, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Les Musiciens et les Solistes Européens; en tant que chambriste, elle fait partie du trio à cordes Vivace et du trio Albason (clarinette, alto et piano). Dévouée également à la musique contemporaine, elle est membre-fondateur de United Instruments of Lucilin. Elle a enseigné l’alto au Conservatoire Royal de Bruxelles de 1995 à 1997 et enseigne depuis au Conservatoire de la Ville de Luxembourg. Ictus Ensemble p. 6, 78, 81 Ictus est un ensemble de musique contemporaine installé depuis 1994 à Bruxelles, dans les locaux de la compagnie de danse Rosas. Sa programmation recouvre un très large spectre stylistique (d’Aperghis à Reich, de Murail à Tom Waits) mais chacun de ses concerts propose une aventure d’écoute cohérente: concerts thématiques (la transcription, le temps feuilleté, le nocturne, l’ironie, musique et cinéma, Loops…), concertsportraits (Jonathan Harvey, Fausto Romitelli, Toshio Hosokawa…), concerts commentés, productions scéniques (opéras, ballets…). Ictus propose chaque année, en collaboration avec le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et le Kaaitheater, une série de concerts appréciée par un public large et varié. Depuis 2003, l’ensemble est parallèlement en résidence à l’Opéra de Lille. Ictus a organisé quatre séminaires pour jeunes compositeurs et développé une collection de disques, riche déjà d’une quinzaine de titres. La plupart des grandes salles et les meilleurs festivals l’ont déjà accueilli (Musica Strasbourg, Witten, Brooklyn Academy of Music, le Festival d’Automne à Paris, Ars Musica, Royaumont, Villeneuve-lez-Avignon, Wien modern, …) Anne La Berge flûte p. 54 Anne La Berge grew up in Minnesota, USA and has lived since 1989 in Amsterdam. She currently performs with David Dramm, Cor Fuhler, Gert Jan Prins, Anna McMichael and in numerous improvisation and chamber music projects in Europe and the US. In the fall of 2000 she toured the US with Gert-Jan Prins with their duo «United Noise Toys». She can be heard in a range of settings from modern ballet music in the music theatres of Holland to improvised electronic music in the local squat buildings. In October 1999 she co-founded the series kraakgeluiden in de binnenstad for weekly electro-acoustic improvisation sessions in Amsterdam. This series has received national recognition for it’s adventuresome programming. It has also received financial support for it’s third year from the Dutch government for the 2001 / 2002 season. In the 2001 season she commissioned Anne Wellmer and Alison Isadora to compose solo works for her with interactive / improvised music and video. These works, travelling barefoot and Native Tongue have toured Holland and will continue to receive performances in the next season. She commissioned and performed the Flute Concerto #1 by Hanna Kulenty with the Dutch ensemble, The Ereprijs, and performed her own works, The Freaks went to sea and Cross at festivals in Holland, Austria and the US. In November 2001 the city of Groningen, Holland is dedicating a week long festival called Anne around to her recent projects, most of which involve interactive technology including 162 powerbooks running Max / Msp, LiSa, Imagine and the Clavia MicroModular. She is adviser for Brannen and Kingma flute companies, specifically for the development of extended-system flutes. Her repertoire is composed for these instruments. Her works and CD blow are published by Frog Peak Music. She has received regular funding for her projects from the Dutch Funds for the Performing Arts. Michaël Lévinas pianiste, compositeur p. 11, 22, 25 29-30, 32-33, 72, 102, 104, 117-118, 142, 146-148, 160 Pianiste, concertiste et compositeur, Michaël Lévinas occupe un espace original dans la vie musicale d’aujourd’hui. Ce double profil détermine son interprétation et son écriture. Né à Paris, il a eu pour maîtres notamment, Vlado Perlemuter, Yvonne Loriod et Olivier Messiaen. Il a été pensionnaire à la Villa Médicis, dirigée alors par le peintre Balthus. Souvent relié au courant spectral et à la fondation de l’Ensemble l’Itinéraire, le parcours de compositeur de Michaël Lévinas s’identifie avec la création d’œuvres très remarquées. Citons parmi celles-ci, Appels (1974), Ouverture pour une fête étrange (1979), la Conférence des oiseaux (1985) et plus récemment Par delà (commande du festival de Donaueschingen, créée par l’Orchestre de la Südwestfunk sous la direction de Michaël Guielen) ou son opéra Go-gol (crée par le Festival Musica de Strasbourg, l’Ircam et l’opéra de Montpellier dans une mise en scène de Daniel Mesguich). Son opéra Les Nègres, d’après la pièce de Jean Genet, commande des Opéras de Lyon et de Genève, a été créé en janvier 2004. Michaël Lévinas est en résidence au Conservatoire National de Région de Caen pour la saison 2005 / 2006. Il animera différents ateliers instrumentaux et d’analyse. Deux œuvres du compositeur seront crées en 2006 dans le cadre de cette résidence. Carin Levine flûte p. 130 Carin Levine stammt aus Cincinnati, Ohio (USA). Sie studierte am College Conservatory of Music, University of Cincinnati bei Jack Wellbaum (Flöte) und Peter Kamnitzer von LaSalle Quartett (Kammermusik) und war Soloflötistin im dortigen Ensemble für Neue Musik. Danach setzte sie ihre Ausbildung bei Aurèle Nicolet an der Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg im Breisgau fort. Schon in frühen Jahren mit verschiedene Preisen geehrt (Ohio State Music Prize u.a.), errang Carin Levine später den begehrten Kranichsteiner Musikpreis für die Interpretation Neuer Musik bei den Darmstädter Ferienkursen. Seit 1996 ist sie regelmäßig Dozentin bei den Darmstädter Ferienkursen. Darüber hinaus unterrichtete sie viele Jahre an der Musikhochschulen, u.a. Detmold, Bremen und Lübeck. Carin Levine gibt regelmäßig Meisterkurse im In-und Ausland zur Interpretation von Flötenliteratur. Sie ist Herausgeberin der Reihe Zeitgenössische Musik für Flöte beim Bärenreiter Verlag, bei dem auch ihr Buch The Techniques of Flute Playing erschienen ist. In enger Zusammenarbeit mit Brian Ferneyhough, Toshio Hosokawa, Mauricio Kagel, Younghi Pagh-Paan, Robert HP Platz, Josef Anton Riedl, Giacinto Scelsi, Dieter Schnebel u.a. entstanden zahlreiche ihr gewidmete Werke, die sie bei vielen internationalen Festivals zur Uraufführung brachte. Besonders viel Wert legt Carin Levine auf die Zusammenarbeit mit jungen Komponistinnen und Komponisten. Bei Ensemble-und Orchesterwerken hat Carin Levine mit Dirigenten wie u.a. Ernest Bour, Peter Eötvös, Johannes Kalitzke, und Lothar Zagrosek zusammengearbeitet. Seit 1995 bildet Sie zusammen mit der Geiger David Alberman ein Duo. 1980 bis 2000 war Carin Levine Flötistin beim damaligen Ensemble Köln. Zahlreiche Rundfunkund Fernsehaufnahmen sowie CDs dokumentieren ihr umfangreiches Repertoire. 163 Luxembourg Sinfonietta p. 6, 142, 144 L’ensemble Luxembourg Sinfonietta, créé en 1999 en vue des World Music Days 2000, est un orchestre à géométrie variable voué à la création de la musique de notre temps et à la diffusion des créations récentes des compositeurs luxembourgeois. Les activités visent notamment à sensibiliser un public de plus en plus large à la création contemporaine, ainsi qu’à faire connaître les œuvres luxembourgeoises au-delà des frontières du Grand-Duché. La qualité et le dynamisme de ce jeune ensemble en ont fait en peu de temps une des formations incontournables de la vie culturelle et musicale du Luxembourg. Dans le but de promouvoir le Luxembourg en tant que centre européen d’innovation musicale, la Société Luxembourgeoise de Musique Contemporaine organise annuellement le «Luxembourg International Composition Prize», à l’occasion duquel les compositeurs du monde entier sont invités à écrire des œuvres pour le Luxembourg Sinfonietta. Les œuvres primées par un jury international sont publiées sur CD. La participation de quelque 200 compositeurs corrobore chaque année le retentissement international de ce concours de composition et lui assure une place privilégiée parmi les plus prestigieux du genre. Mad Fred DJ p. 78, 82-83 Ivo Nilsson trombone p. 54, 109 Ivo Nilsson (born 1966) is educated at the Royal College of Music in Stockholm and at IRCAM in Paris. In 1989 his Octet was premiered by the Ensemble L’Itinéraire at Radio France. Since then, his music has been performed by ensembles such as Cantus, Ensemble Son, Ensemble Recherche, KammarensembleN, Nouvel Ensemble Moderne, Orchestre de Flûtes Français, Slowind at festivals like Biennale di Venezia, Gaudeamus Music Days (Amsterdam), Huddersfield Contemporary Music festival, Ilhom (Tashkent), Musica (Strasbourg), Roaring Hoofs (Mongolia), 2 Days and 2 Nights (Odessa), Sonorities (Belfast), Spazio Musica (Cagliari), Spectra (Tirana), Time of music (Viitasaari), Ultima (Oslo), Warsaw Automn and the World Music Days in Zagreb. His music has also been recorded by the radio companies BBC, DR, RNE, SR and YLE and by the record labels Ariadne, Phono Suecia and SFZ Records. Ivo Nilsson was the artistic director of the Stockholm New Music festival in 2003 and 2005. Emmanuelle Ophèle flûte p. 66 Born in 1967, Emmanuelle Ophèle-Gaubert began her musical studies at the École de musique d’Angoulême. By the age of thirteen, she was studying with Patrick Gallois and Ida Ribera. She then obtained a Premier Prix in flute at the Conservatoire de Paris in Michel Debost’s class. She holds the Certificat d’aptitude, and teaches at the Conservatoire de Montreuil-sousBois, near Paris. She joined the Ensemble intercontemporain at the age of twenty, and rapidly began taking part in premières that require the use of the most recent technologies, for example the Partition du ciel et de l’enfer for Midi flute and Midi piano by Philippe Manoury recorded in the Adès / Musidisc «Compositeurs d’aujourd’hui» collection, and Explosante fixe for Midi flute, two flutes and instrumental ensemble by Pierre Boulez, recorded on the Deutsche Grammophon label. United Instruments of Lucilin p. 6, 46, 130, 141 Créé au printemps 2000 par un groupe de jeunes musiciens luxembourgeois passionnés, Lucilin est la première formation de chambre 164 luxembourgeoise se vouant exclusivement à la diffusion et la création d’œuvres du XXe et du XXIe siècle. Les musiciens de Lucilin se sont produits avec l’Ensemble Modern, Accroche Note, Cattrall, Alter Ego ou Klangforum Wien. Ensemble à géométrie variable, le noyau de musiciens luxembourgeois (quatuor à cordes, piano, percussion, saxophone) est rejoint à l’occasion par des musiciens invités locaux ou étrangers dans un répertoire allant de Bartók à Berio, de Denisov à Cage, en passant par Dusapin, Feldmann, López-López, Takemitsu… Lucilin intervient également dans la création et le travail direct avec les compositeurs lors d’expériences que permettent les effectifs réduits, créant ainsi son propre répertoire lié aux commandes aux compositeurs dont l’esthétique lui est proche (En 2002, Lettre Soufie: D pour clarinette, Trio à cordes, piano et percussion de Jean-Luc Fafchamps et Autour d’un centre raturé III de Marcel Reuter). Ayant déjà à son actif un double CD chez Fuga Libera des premiers enregistrements mondiaux d’œuvres de Francesconi, Maresz, Lenners, Fafchamps, Vinao et Zinsstag sous la direction de Mark Foster, l’Ensemble sortira début 2006, un CD consacré à Zappa et projette d’enregistrer cette année, un CD consacré à la musique de chambre d’Emanuele Casale et à la musique japonaise de la jeune génération. Georges-Elie Octors direction p. 78 Der 1947 geborene Dirigent Georges-Elie Octors, der an der Musikakademie in Brüssel ausgebildet wurde, begann seine berufliche Laufbahn mit solistischen Verpflichtungen beim Orchestre National de Belgique und wirkte fünfzehn Jahre lang, von 1976 bis 1991, als Musikalischer Leiter des Ensembles Musiques Nouvelles in Liège. Von 1980 bis 1996 stand er überdies dem Centre de Recherches Musicales de Wallonie vor; 1992 wurde er Präsident der Sektion Brabant /Wallonien der Jeunesses Musicales, deren Orchesterformationen er regelmäßig leitet. Seit 1993 ist Georges-Elie Octors als Musikalischer Direktor des Ictus Ensembles tätig, mit dem er zahlreiche Werke uraufführte: von Komponisten wie Henri Pousseur, Philippe Boesmans, Kaija Saariaho, Toshio Hosokawa, Michael Jarrell, Luca Francesconi und Thierry de Mey. Als Berater der Ballettsparte am Brüsseler Théâtre Royal de La Monnaie betreute Octors mehrere Tanztheaterproduktionen, darunter Anne-Teresa de Keersmakers Amor Constante (1995). Als Gastdirigent leitete er das Orchestre Philharmonique de Liège, das Orchestre Symphonique de la RTBF, das Orchestre de Bretagne, die Beethoven Académie und das Ensemble Musique Vivante. Georges-Elie Octors wird regelmäßig zu führenden internationalen Festivals eingeladen: zum Pariser IRCAM, nach Avignon, zum Holland Festival, zu Wien Modern, zur Münchener Biennale, in die Vereinigten Staaten, nach Kanada und Japan. Orchestre Philharmonique du Luxembourg p. 6, 84, 85 Créé en 1933, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg est aujourd’hui un orchestre internationalement reconnu. Il joue un très important rôle dans la vie musicale luxembourgeoise et connaît, avec son directeur musical Bramwell Tovey et son Premier chef invité Emmanuel Krivine, d’éclatants succès lors de ses tournées à l’étranger qui l’ont mené en Asie, en Allemagne, Autriche, France, Italie, Belgique et aux Pays-Bas. En 2004, il a fait sa première tournée aux Etats-Unis avec un concert à l’Avery Fisher Hall à New York. Au Luxembourg, il interprète ses propres séries de concerts, ainsi que des concerts pour les jeunes et pour les familles. De nombreux chefs d’orchestre et des solistes de renommée internationale participent aux concerts de l’Orchestre à Luxembourg, ainsi qu’à l’étranger. En 2004 et 2005 se produisirent ainsi, Barbara Bonney, Evelyn Glennie, Hilary Hahn, James Galway, Dmitri Hvorostovsky, Julian Rachlin, Jukka-Pekka 165 Saraste et Fazil Say. La production discographique est considérable et a été récompensée par plus de 70 prix internationaux, dont le ‹Best Record of the Year› des ‹Cannes Classical Awards› au Midem pour Cydalise et le ChèvrePied de Gabriel Pierné et un Orphée d’Or de l’Académie du disque Lyrique à Paris pour le premier enregistrement de l’opéra Polyphème de Jean Cras. Roula Safar mezzo-soprano p. 142 Roula Safar, après des études musicales à Beyrouth et Paris, se produit en récitals de mélodies, Lieder et en oratorio. A la scène, elle incarne Ramiro (Finta Giardiniera), Siebel (Faust), La Messagère (Orfeo), Didon (Didon et Enée),... sous la direction de Calmelet, Malgoire, Parmentier... Roula Safar a créé à la Bibliothèque de l’Arsenal, des spectacles littéraires et musicaux autour de George Sand et de Julie de Lespinasse. Elle se produit au Théâtre du Châtelet et en tournée, avec l’Orchestre pour la Paix, sous la direction de Nassim Abassi (œuvres de Manuel de Falla et Léo Delibes). En musique contemporaine, elle est Céleste, dans Temboctou, de François-Bernard Mâche et la Femme du tailleur, dans Go-gol, de Michaël Lévinas (mis en scène par Daniel Mesguich) au Festival Musica et à l’Opéra de Montpellier; La voix de la Cantatrice, dans Euphonia, de Michaël Lévinas, avec les solistes de l’Orchestre de Paris, à la Comédie-Française. Roula Safar interprète des œuvres de Aperghis, Berio, Jolas, et Mâche. Elle crée Les Aragons, de Lévinas, Femmes et Piranhas, de Baschet, Salam-Shalom, de Larbi, en tournée européenne. Elle enregistre en mars 2004, Circles, de Berio, pour FR3, avec l’ensemble Itinéraire et se produit sous la direction de Davin, Rophé, Valade, Larbi..., et les ensembles Itinéraire, Musiques Nouvelles, Fa, 2e2m et l’Orchestre pour la Paix. En musique sacrée, elle enregistre entre autres, la cantate Jésus là es-tu, de M. Landowski, Elias, de Mendelssohn, Der rose Pilgerfahrt, de Schumann, et Les Aragons, de Lévinas, récompensé d’un «Choc de la musique 2001». À la croisée des cultures d’Orient et d’Occident, des répertoire de musique ancienne et contemporaine, Roula Safar s’accompagnent parfois à la guitare romantique et aux percussions dans des récitals d’œuvres spécifiquement écrites pour ces instruments. Volker Staub direction, composition p. 6, 54-56, 60, 62-65 Volker Staub, geboren 1961 in Frankfurt am Main, studierte von 1981 bis 1985 Klavier bei Friederike Richter und von 1982 bis 1990 Komposition bei Johannes Fritsch in Darmstadt und Köln. Während seiner Studienjahre beschäftigte er sich intensiv mit dem Werk der Komponisten John Cage und Morton Feldman; darüber hinaus mit den Arbeiten von Josef Beuys. Seit 1981 wird Staubs kompositorische Arbeit durch den Bau von Musikinstrumenten begleitet. Es entstanden Schlaginstrumente aus Holz, Fell, Metall, Stein und Glas sowie Saiteninstrumente und elektroakustische Instrumente mit diskreten oder kontinuierlichen Klangeigenschaften. Diese werden in seinen Kompositionen – teils ausschließlich, teils zusammen mit traditionellen Instrumenten verwendet. Er konstruierte Klanginstallationen, z. B. die Witterungsinstrumente, und schrieb zahlreiche Stücke für traditionelle Instrumente vom Solo- bis zum Orchesterwerk. Staubs Instrumentenbau ist untrennbar mit seinen kompositorischen Gedanken verknüpft. Der Bogen seiner Arbeit spannt sich von Experimenten an den Grundlagen der Klangerzeugung und dem Instrumentebau, über die Findung verschiedenster Tonsysteme und die Entwicklung adäquater Notationsformen bis hin zur Komposition, Einstudierung und Aufführung der eigenen Werke. Volker Staub gab Konzerte und Rundfunkauftritte in zahlreichen europäischen Ländern, in Israel, den USA und Ekuador. Er war Teilnehmer zahlreicher internationaler Festivals. Seine Arbeit wurde Gegenstand zweier 166 Fernsehporträts und ist auf vier bisher erschienenen CDs dokumentiert. Er veröffentlichte ein Buch über Morton Feldmans Untitled Composition und arbeitet an einer größeren Publikation zum experimentellen Instrumentenbau. Volker Staub lebt als freischaffender Komponist bei Frankfurt am Main. SWR Sinfonieorchester Freiburg und Baden-Baden p. 6, 46 Am 1. Februar 1946 schlug die Geburtsstunde des heutigen SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg. Heinrich Strobel, der legendäre erste Musikchef des neuen Senders in der französischen Besatzungszone, hatte die Fäden gezogen und sorgte dafür, dass das Musikleben des SWF besonders schnell und besonders effektiv in Gang kam. Strobel gelang es auch, Hans Rosbaud nach Baden-Baden zu holen. Mit ihm begannen Aufschwung und internationaler Ruhm des, wie es nun hieß, «Südwestfunkorchesters», das nun die ersten Tourneen ins benachbarte Ausland – Basel, Aix-en-Provence, Paris – machte und sich besonders die damals zeitgenössische Musik angelegen sein ließ. Rosbaud und sein französischer Nachfolger Ernest Bour – von beider Repertoirebreite, Fleiß, Aufgeschlossenheit und unbestechlichen Ohren ist noch heute bewundernd die Rede – verstanden den Rundfunk-Kulturauftrag vor allem als Einsatz fürs Neue, noch Unerprobte. Dazu kam das Bündnis mit dem Residenzstädtchen Donaueschingen, das längst Synonym für «Neue Musik» ist. Die Zahl der dort seit 1950 vom SWF-Sinfonieorchester uraufgeführten Stücke tendiert gegen 400, und mit seinem Einsatz für die von Henze und Fortner, Zimmermann und Ligeti, Penderecki und Stockhausen, Berio und Messiaen, Rihm und Lachenmann komponierten Werke hat das Orchester Musikgeschichte geschrieben. Der große Igor Strawinsky hat es in den fünfziger Jahren mit eigenen Kompositionen mehrfach dirigiert (und bei dieser Gelegenheit seine Vorurteile gegen deutsche Orchester revidieren müssen); und Pierre Boulez begann seine Weltkarriere als Dirigent in Baden-Baden. Dass die im jahrzehntelangen Umgang mit ‹unspielbaren› neuen Partituren gewonnene instrumentale Souveränität auch dem traditionellen Repertoire zugute kommt, ist unüberhörbar. Denn das Orchester lässt sich nicht auf die Rolle eines Spezialensembles für Neue Musik festlegen: es gibt eine bemerkenswerte Haydn-Mozart-Tradition etwa, und man bemühte sich um Schreker und Mahler schon, als an eine «Renaissance» dieser Komponisten noch nicht zu denken war. Michael Gielen, Orchesterchef von 1986 bis 1999, knüpfte an die Tradition von Rosbaud / Bour an, verstand sich als Musiker, der Kunst keinesfalls «als Palliativum, als Beruhigungsmittel» zu verabreichen habe, sondern als Angebot an eine wache Hörerschaft ansah, «der Wahrheit zu begegnen. Und die ist nicht immer angenehm.» Unroutinierter Umgang mit der Tradition, Aufgeschlossenheit für das Neue und Ungewöhnliche: Tugenden, über die auch Chefdirigent Sylvain Cambreling in ungewöhnlichem Maße verfügt. Er bildet, zusammen mit seinem Vorgänger Michael Gielen und Hans Zender als ständigen Gastdirigenten, ein Triumvirat, wie es in der internationalen Orchesterlandschaft beispiellos ist. Dass man mit hohen Ansprüchen Erfolg haben kann, beweist das Orchester bis heute. Mehr als 300 von ihm eingespielte Kompositionen sind auf CD erschienen, und es reist seit 1949 als musikalischer Botschafter durch die Welt. 1999 spielte das Orchester in der New Yorker Carnegie Hall u.a. die amerikanische Erstaufführung von Bernd Alois Zimmermanns Requiem für einen jungen Dichter. Ab 2000 machte es in drei Folgejahren bei den Salzburger Festspielen von sich reden: mit Werken von Kaija Saariaho, Hans Zender und Helmut Lachenmann. Bei der 1. RUHRtriennale hatten die Musiker den Status eines «orchestra in residence»: zu europäischen 167 Ereignissen wurden die Aufführungen von Messiaens monumentaler «Franziskus»-Oper, des Berlioz-Requiems und der Faust-Vertonungen von Berlioz und Schumann. In der vergangenen Spielzeit wurde der MahlerZyklus unter der Leitung von Michael Gielen mit der Zehnten vollendet. Ungewöhnliche Konzert-Konzepte – etwa die Verschränkung von Haydns Sieben letzten Worten in einer den Raum einbeziehenden Bearbeitung von Sylvain Cambreling mit Messiaens Et exspecto resurrectionem mortuorum und literarisch-theologischen Betrachtungen von Martin Mosebach oder die Aufführung von Debussys Mysterium Le martyre de Saint-Sébastien mit neuen Zwischentexten – unterstreichen das besondere Profil des Orchesters. Pierre André Valade direction p. 84 Directeur musical de l’Ensemble Court-circuit depuis 1991, Pierre-André Valade fait ses débuts symphoniques en 1996 avec la Turangalîla Symphonie d’Olivier Messiaen au Festival of Perth (Australie), à la tête du West Australian Symphony Orchestra. Il dirige le London Sinfonietta au Bath International Music Festival, avec lequel il commence une collaboration régulière. Avec cet ensemble, il participe à l’hommage à Pierre Boulez du South Bank Centre en 2000 pour le 75ème anniversaire du compositeur, puis, au Festival de Sydney en 2003. Il donne en création mondiale en novembre Theseus Game de Harrison Birtwistle en novembre 2003 à Duisburg avec Martyn Brabbyns avec l’Ensemble Modern de Francfort. Pierre-André Valade dirige également des œuvres majeures du répertoire symphonique avec le Philharmonia Orchestra (50ème anniversaire du Royal Festival Hall à Londres en 2001), ou en 2004 pour le festival Omaggio, a celebration of Luciano Berio au Royal Festival Hall. Il a également dirigé le B.B.C. Symphony Orchestra, les solistes de la Philharmonie de Berlin à l’Osterfestspiele Salzburg, l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, l’Orchestre Symphonique de Montréal, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (2004) et l’Orchestre de la Tonhalle de Zürich (2003) Dimitri Vassilakis piano p. 66 Born in 1967, Dimitri Vassilakis began studying music in his native city of Athens at the age of seven, and continued his studies at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris with Gérard Frémy. He obtained a premier Prix in piano by unanimous vote of the jury as well as prix for chamber music and accompaniment. He also followed advice by Gyorgy Sebok and Monique Deschaussées. Dimitri Vassilakis has given solo performances in Europe (Salzburg Festival, Maggio Musicale Fiorentino), North Africa, the Far East and America. He joined the Ensemble intercontemporain in 1992. His repertoire includes the Piano concerto by György Ligeti, Oiseaux exotiques and Un vitrail et des oiseaux by Olivier Messiaen, Third Sonata by Pierre Boulez, Eonta, for piano and brass, and Evryali by Iannis Xenakis, Klavierstuck IX by Karlheinz Stockhausen and Petrouchka by Igor Stravinsky. He premiered Incises by Pierre Boulez in 1995 and took part in the recording of Répons and of Incises by Pierre Boulez for Deutsche Grammophon. Michael Wendeberg piano p. 102, 104, 112 Michael Wendeberg, Dirigent und Pianist, wurde 1974 in Ebingen in einen Musikerhaushalt hineingeboren. Er erhielt mit fünf ersten Klavierunterricht. Von 1988–1991 war er Schüler von Prof. Jürgen Uhde und wurde in der Folge erster Bundespreisträger bei Jugend musiziert in den Sparten Klavier solo (1990), Klavierkammermusik (1993) und Klavierbegleitung (1993). Er studierte ab 1993 bei Prof. Bernd Glemser, ab 1999 bei Prof. 168 Benedetto Lupo in Italien. Das Jahr 2000 brachte entscheidende Schritte in seiner Karriere, er erhielt einen 2. Preis (der 1. wurde nicht vergeben) beim internationalen Wettbewerb «Schubert und die Moderne» in Graz, gewann den Wettbewerb der europäischen Rundfunkanstalten in Lissabon und bekam die Stelle als Solopianist beim renommierten Ensemble intercontemporain in Paris. Er arbeitet eng mit Komponisten zusammen, u.a. mit Klaus Huber, Jonathan Harvey, György Ligeti, Pierre Boulez und György Kurtàg, und trat mit dem Ensemble intercontemporain regelmässig als Solist auf. Daneben begann er in den letzten Jahren, sich als Dirigent auszubilden und arbeitet seit dieser Saison am Opernhaus Wuppertal. Michael Wendeberg spielte in den letzten Jahren außerhalb des Ensembles als Solist u.a. mit den Bamberger Sinfonikern, den Rundfu nksinfonieorchestern von Baden-Baden, Frankfurt und Köln sowie mit den Berliner Philharmonikern. 2003 gab er sein Debut-Klavierrécital bei den Salzburger Festspielen, im Mai 2005 mit dem Ensemble intercontemporain unter Jonathan Nott sein New Yorker Debut im Lincoln Center mit dem Klavierkonzert von György Ligeti. Marcel Wengler direction p. 86, 142 Marcel Wengler a étudié au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles avant de devenir assistant de Hans Werner Henze à la Musikhochschule de Cologne. Il s’est perfectionné en direction d’orchestre auprès d’Igor Markevitch et Sergiu Celibidache qui l’a particulièrement marqué. En 1978, Marcel Wengler a remporté le Premier Prix du Concours International de Direction à Rio de Janeiro. Il a enregistré de nombreuses œuvres en tant que chef d’orchestre, dont certaines créations mondiales, et une série de CD de compositeurs luxembourgeois avec l’Orchestre Symphonique de Radio-Télé-Luxembourg. Marcel Wengler a dirigé en Angleterre, France, Espagne, Roumanie et en Allemagne, ainsi qu’à Lisbonne, Moscou, Léningrad, Kazan et Rio de Janeiro. Egalement compositeur, son œuvre jouée dans le monde entier englobe le théâtre, le ballet et la musique de chambre. Rex Léo a été présenté à l’Opéra de Graz et en 1983, sa première musique de film pour Un amour de Swann de Volker Schlöndorff, est enregistrée avec le pupitre des cordes de l’Orchestre Philharmonique de Munich. Marcel Wengler a composé de nombreuses musiques de film et dirigé à Lisbonne la création mondiale de son Concerto pour violoncelle avec l’Orchestre National Portugais et Françoise Groben. Président de la Société Luxembourgeoise de Musique Contemporaine fondée en 1983, il a été le directeur artistique des World Music Days (Luxembourg, 2000). Depuis 1999 il est directeur artistique de l’ensemble Luxembourg Sinfonietta, avec lequel il organise annuellement le Luxembourg International Composition Prize. Jürg Wyttenbach direction p. 130, 139 Né à Berne, Jürg Wyttenbach étudie le piano avec Kurt von Fischer et la composition avec Sándor Veress à Berne, avant de poursuivre ses études au Conservatoire de Paris. Il enseigne à la Musikschule de Biel et au Conservatoire de Berne. Depuis 1967, il est nommé en classe de piano. Depuis 1970, il enseigne l’interprétation de la musique contemporaine au conservatoire de l’Académie musicale de Basel, et parallèlement, se produit en tant que pianiste et chef d’orchestre dans de nombreuses œuvres de musique contemporaine, à la radio et en enregistrement. Il remporte en 1993 le Kunstpreis de la ville de Basel où il est résident. 169 Compositeurs & Œuvres Index Boulez, Pierre (1925) Sonate III (1955 / 19…) Formant III / 2 Constellation – Miroir 26.11.2005 p. 102, 110, 111 Coleman, David Robert (1969) Fleuve (1997) 26.11.2005 p. 102, 113 Couperin, François (1668–1733) Pièces de Clavecin, Sixième Ordre (1717) Les baricades mistérieuses 26.11.2005 p. 102 Debussy, Claude (1862–1918) p. 7; Lévinas, Michaël Etudes, 2ème cahier (1915) 11. Pour les arpèges composés 12. Pour les accords 26.11.2005 p. 102, 125–126 Dufourt, Hugues (1943) p. 30–33, 31, 34–37 Le Cyprès blanc (2004) 25.11.2005 p. 84, 93–95 Grisey, Gérard (1946–1998) p. 11–13, 14, 15–19, 155 Les Espaces Acoustiques (1974–1985) «Prologue» pour alto seul (1976) «Périodes» pour sept musiciens (1974) «Partiels» pour seize ou dix-huit musiciens (1975) «Modulations» pour trente-trois musiciens (1976/1977) «Transitoires» pour grand orchestre (1980/1981) «Epilogue» pour quatre cors soli et grand orchestre (1980) 19.11.2005 p. 46, 47–48, 49, 50–53 «Vortex Temporum» I–III pour piano et 5 instruments (1994–1996) 22.11.2005 p. 66, 69–70, 71–74, 75–76 170 Wolf Lieder (1997, orchestration de quatre Lieder de Hugo Wolf) In der Frühe Um Mitternacht Das verlassene Mägdlein Nun wandre, Maria 27.11.2005 p. 142, 150, 151 Quatre chants pour franchir le seuil (1997 / 1998) IV. Berceuse (instrumentation de Brice Pauset, 1998/1999) 27.11.2005 p. 142, 151, 152–154 Haas, Georg Friedrich (1953) Hommage à György Ligeti für einen Pianisten an zwei um einen Viertelton verstimmten Klavieren (1983–1985) 26.11.2005 p. 102, 124 Hurel, Philippe (1955) p. 38–41, 42–43 «Tombeau» pour percussions et piano – in memoriam Gérard Grisey 22.11.2005 p. 66, 68 Lévinas, Michaël (1949) p. 26–28, 29, 146–147 Anaglyphe (1995) 26.11.2005 p. 102–117 Les «Aragons» (1997) 27.11.2005 p. 142, 148–149 La Romance d’Ariel (1983, extraite des «Chansons» de Claude Debussy) 27.11.2005 p. 142) Ligeti, György (1923) Etudes pour piano, 1er livre (1985) II.Cordes à vide V. Arc-en-ciel 26.11.2005 p. 102, 120, 121 Liszt, Franz (1811–1886) Années de Pèlerinage (ca. 1870). Les Jeux d’eau à la Villa d’Este 26.11.2005 p. 102, 118–119 Nuages gris (1881) 26.11.2005 p. 102 Mad Fred 25.11.2005 p. 78, 82, 83 171 Mertzig, René (1911–1986) Poèmes (1945 / 1946) I Cerisiers en fleurs III Vendanges mosellanes IV Flocons de neige vers la Noël 25.11.2005 p. 84, 87–89 Messiaen, Olivier (1908–1992) Catalogue d’oiseaux (1956–1958) VII / 3 Le courlis cendré [Der Große Brachvogel / Numenus arquata]) 26.11.2005 p. 102, 106 Murail, Tristan (1947) «La barque mystique» pour ensemble instrumental (1993) 22.11.2005 p. 66, 67 Gondwana (1980) 25.11.2005 p. 84, 90–92 Territoires de l’oubli (1977) 26.11.2005 p. 102, 123 Parra, Hèctor (1976) Impromptu (2005, création / Uraufführung) 26.11.2005 p. 102, 112 Pauset, Brice (1965) Grisey, Gérard Rameau, Jean-Philippe (1683–1764) Pièces de clavecin avec une méthode pour la mécanique des doigts. 5. Le rappel des oiseaux) (1724) 26.11.2005 p. 102, 105 Ravel, Maurice (1875–1937) Miroirs (1904/1905) 1. Noctuelles 2. Les oiseaux tristes 4. Alborada del gracioso 26.11.2005 p. 102, 114–116 Trois poèmes de Stéphane Mallarmé (1913) Soupir Placet futile Surgi de la croupe et du bond 27.11.2005 p. 142, 143–145 172 Romitelli, Fausto (1963–2004) Professor Bad Trip (1998–2000) 23.11.2005 p. 78, 79–80 Scelsi, Giacinto (1905–1988) p. 130, 132–138, 139–140 Pwyll pour flûte solo (1957) 27.11.2005 Arc-en-Ciel pour deux violons (1973) 27.11.2005 Ko-Lho pour flûte et clarinette (1966) 27.11.2005 Hyxos pour flûte alto et percussion (1955) 27.11.2005 Kya pour clarinette solo et sept instruments (1959) 27.11.2005 Schubert, Franz (1797–1828) Sonate für Klavier Nr. 15 in C-Dur (do majeur) D 840 (1825) 26.11.2005 p. 102, 127–128 Scriabine, Aleksandr [Alexander Skriabin] (1872–1915) Trois Etudes op. 65 (1911 / 1912) 26.11.2005 p. 102, 122 Staub, Volker (1961) p. 54, 55, 56–59 Mikroskopische Musik (2005, Uraufführung / création) 20.11.2005 p. 56–59 Vianden für Flöten, Posaune, Stahlsaiten und Schlaginstrumente (1994–19999; Uraufführung der überarbeiteten Fassung ) 20.11.2005 p. 63–65 Solo für Motorsirenen N° 33 (1994–1997) 20.11.2005 p. 54, 60–62 Stockhausen, Karlheinz (1928) Klavierstück VII (1954 / 1955)’ 26.11.2005 p. 102, 107, 108–109 Wagner, Richard (1813–1883) Götterdämmerung (1876). Siegfrieds Rheinfahrt 25.11.2005 p. 84, 96, 97, 98–101 Wolf, Hugo (1860–1903) Grisey, Gérard 173