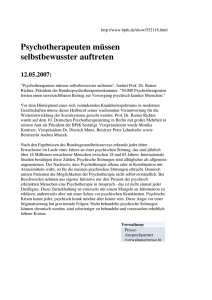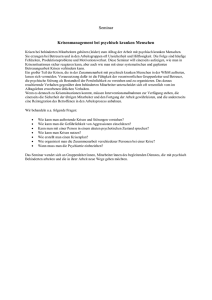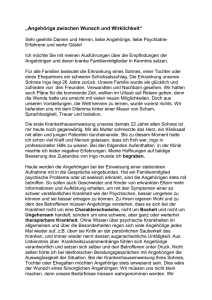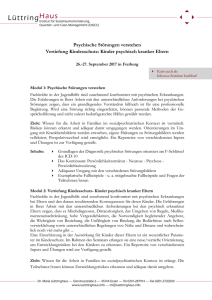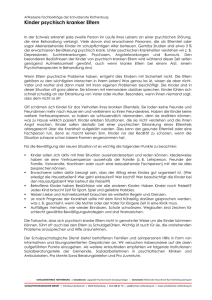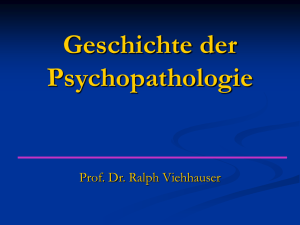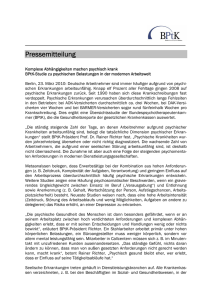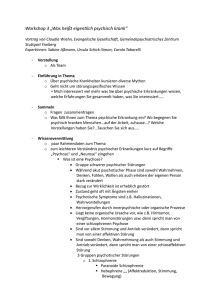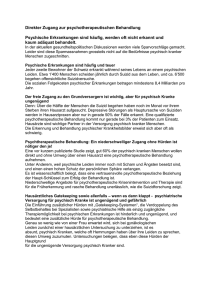Familie und psychiatrische Pflege – klinische
Werbung

Familie und psychiatrische Pflege – klinische und familiendynamische Dimensionen Studienbrief Autorinnen: Prof. Dr. Katharina Gröning Heike Friesel-Wark Sonja Bergenthal © Universität Bielefeld 2013 2 Inhaltsverzeichnis 1. Einführung – Eine Krankengeschichte als Fallbeispiel s 2. Verschiedene Formen psychischer Störung s 2.1 Schizophrenies 2.1.1 Erscheinungsbilder der Schizophrenie s 2.1.2 Der Umgang des Kranken mit seinen Symptomen s 2.1.3 Formen der Schizophrenie s 2.1.4 Verlauf von Schizophrenie s 2.2 Affektive Störungen s 2.2.1 Manies 2.2.2 Depressions 2.2.3 Depression und Alter s 2.2.4 Suizidalität im höheren Lebensalter s 2.3 Suchts 2.3.1 Psychoanalytische Suchttheorien s 2.3.2 Sucht in systemischer Perspektive s 2.3.3 Lerntheoretische Erklärungsmodelle zur Sucht s 2.3.4 Co-Abhängigkeit – Entstehungsgeschichte und s Hintergründe 2.4 Persönlichkeitsstörungen s 2.4.1 Narzissmuss 2.4.2 Operationalisierte psychodynamische Diagnostik: s OPD 2.5 Traumas 3. Ursachen psychischer Krankheiten: verschiedene Ansätze 3.1 Rückblick auf das historische Verständnis psychischer Störungen 3.2 Heutiger Stand der Erkenntnisse über Zusammenhänge psychischer Störungen 3.2.1 Mögliche Ursachen psychischer Störungen 3.2.2 Die Bedeutung psychosozialer Bedingungen 3.3 Psychodynamische Modelle in der Psychiatrie 3.3.1 Das Frankfurter Psychoseprojekt 3.3.2 Stavros Mentzos‘ Psychodynamisches Modell 3.4 Stigmatisierungsprozesse und die soziale Isolation psychisch kranker Menschen 3.4.1 Stigmatisierungsprozesse 3.4.2 Stigma und Etikettierung 3.4.3 Die Notwendigkeit sozialer Netzwerke 05 08 09 09 12 12 13 14 15 16 20 21 23 24 29 32 33 36 37 38 40 s s 43 43 s 45 s s s s s s 45 46 48 48 49 51 s s s 51 55 58 3 4. Die Behandlung psychischer Störungen s 4.1 Psychotherapie generell s 4.2 Die klassische psychoanalytische Therapie s 4.3 Verhaltenstherapies 4.4 Schematherapies 4.5 Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) s 4.6 Soziotherapies 60 60 61 61 62 63 63 5. Angehörige im Umgang mit psychisch kranken oder belasteten Menschen s 64 6. Familiendynamiks 6.1 Familiendiagnostiks 6.2 Paar- und Familiendynamik: Einige ausgewählte Ansätze s 6.2.1 Thea Bauriedl s 6.2.2 Jürg Willis 6.2.3 Horst Eberhard Richter s 6.2.4 Helm Stierlins 6.2.5 Michael Buchholz s 6.2.6 Boszormenyi-Nagy und Geraldine Spark s 65 67 69 69 70 72 74 75 76 7. Vom Umgang mit psychisch kranken oder belasteten Menschen 7.1 Familienmitglieder und Bekannte 7.2 Kinder als Angehörige 7.3 Pflegende Angehörige: Ihre Aufgaben, ihre Erlebnisse, ihre Unterstützung 7.3.1 Bedingungen der psychiatrischen Pflege 7.3.2 Gefühle im Umgang mit psychiatrisch erkrankten Menschen 7.3.3 Vier wichtige Themen: Scham, Schuld und Verantwortung, Passivität, Vernachlässigung 7.3.3.1 Scham 7.3.3.2 Schuld und Verantwortung 7.3.3.3 Passivität und Eigenaktivität 7.3.3.4 Selbst-Vernachlässigung s s s s 78 78 80 81 s s 81 85 s 88 s s s s 88 90 91 95 s s 97 97 s 100 Literaturverzeichniss 102 8. Pflege der Pflegenden: Aufgaben der Fachkräfte 8.1 Ansätze der Angehörigenbegleitung psychisch kranker Menschen 8.2 Ausblick: Was Angehörige beschäftigt, was sie tun und lassen sollten 4 1. Einführung – Eine Krankengeschichte als Fallbeispiel Ulrich Z. ist 64 Jahre alt und zum vierten Mal wegen starker Depressionen stationär aufgenommen. Vor etwa vier Jahren war er zum ersten Mal als Patient hier und in der Zwischenzeit noch zweimal. Sein Sohn hat ihn gebracht und mitgeteilt, dass sein Vater das Bett so gut wie nicht mehr verließe, suizidale Gedanken äußere und wieder zurücknehme. Er zeige keinerlei Interesse, setze seine Medikamente „wieder einmal“ ab, trinke phasenweise viel Alkohol und sei ausgesprochen mürrisch. Bei der Erstaufnahme vor vier Jahren ergab die Anamnese folgende Lebensumstände: Ulrich Z. sei Lehrer an einem Gymnasium und habe bis vor zwei Jahren mit seiner Frau und drei Kindern zusammen im eigenen Haus gelebt. Er sei ein aktiver Vater gewesen, schätze seine Kinder über alles und habe mit ihnen viel unternommen. Kunst und Reisen haben ihn interessiert, seine Kinder seien ausgezeichnete Schüler und Studenten – er sei zufrieden gewesen. Seine Frau habe sich dann von ihm getrennt, sei ausgezogen und habe ihn mit der jüngsten Tochter alleingelassen. Die anderen Kinder waren bereits zum Studium aus dem Haus. Das ist bei der jetzigen stationären Aufnahme mittlerweile sechs Jahre her. Er versteht und akzeptiert die Trennung von seiner Frau bis heute nicht. Es gebe keinen Grund, er sei ein fürsorglicher Mann, häuslich und ohne Nebenbeziehungen. Seine Frau sei mehrfach psychotisch gewesen und ebenfalls stationär zur Behandlung aufgenommen worden. Sie habe die Wahnvorstellung entwickelt, er würde die Kinder und sie ermorden wollen. Einmal habe sie einen Liebeswahn mit ihrem Arzt gehabt. Beim dritten Mal sei sie völlig verrückt angezogen mit ihm in die Klinik gegangen, nachdem sie wahnhafte Vorstellungen hatte und unverständliche Dinge gesprochen habe. Damals habe seine Frau bereits Trennungswünsche geäußert, die er aber zurückgewiesen habe: Er fühle sich verantwortlich für seine Frau, müsse sie beschützen, damit sie nicht mehr psychotisch werde. Seine Erklärungsmuster für die Dekompensationen seiner Frau beziehen sich auf ihre Herkunftsfamilie: ein liebloses Elternhaus mit einer sehr jungen Mutter und einem schweigsamen, trinkenden Vater. 5 Nach dem Auszug der beiden größeren Kinder hatte die Ehefrau die Trennung vollzogen, was Herrn Z. erschütterte. Er verfiel in eine Depression, konnte nicht mehr arbeiten, bewegte sich nicht aus dem Haus, fing an zu verwahrlosen und trank gehörige Mengen Alkohol. Nach dem ersten Klinikaufenthalt nahm sein 20-jähriger Sohn Kontakt mit dem Bruder des Vaters auf. Er bat ihn und seine Frau, sich um den Vater zu kümmern, weil alle drei Kinder an einem anderen Ort lebten und nicht für den Vater sorgen könnten. Der Bruder versprach es und nahm Herrn Z. vor etwa drei Jahren zunächst in sein Haus auf und suchte dann in erreichbarer Umgebung eine Wohnung. Der Unterhalt zwischen den Familienmitgliedern wurde geregelt. Die Scheidung und der Verkauf des Hauses konnten einvernehmlich geregelt werden, aber das Paar spricht nicht miteinander. Herr Z. spielte mit, hatte aber Phasen tiefgehender Depression mit den oben geschilderten Verhaltensweisen. Seine von ihm getrennt lebende Ehefrau arbeitet in der Pflege, es geht ihr nicht gut, aber deutlich besser. Die Kinder reduzieren den Kontakt, gehen ins Ausland, „studienbedingt“. Der Bruder und seine Frau kümmern sich um Herrn Z., sie erwarten aber mehr Aktivität von ihm und werden ungeduldig. Sein Zustand verschlechtert sich immer mal wieder, dann gibt es hellere Phasen, in denen er offenbar seine Medikamente absetzt; er hat eine Psychotherapie begonnen, aber der Bruder und seine Frau sehen keine Veränderungen. Die Klagen sind gleich: Herr Z. versteht nicht, warum sich seine Frau von ihm getrennt hat und er sieht in ihrer Psychose die Ursache aller folgenden Entwicklungen. Durch die Intervention des Bruders kam der Patient vor vier Jahren bereits in eine andere Klinik als in den früheren Jahren seine Ehefrau. Man hatte also keinen Zugriff auf ihre Akten und suchte auch beim jetzigen Aufenthalt nicht danach. Die Mitarbeiterinnen der Station beschreiben Herrn Z. als einen ruhigen Mann, der anpassungsbereit sei und alles mitmache, was man von ihm fordere. Die Ärztin spricht von einer selbstunsicheren Persönlichkeit, Gründe für diese weiß sie nicht und erfragt sie nicht. Herr Z. nimmt bereitwillig die Medikamente, bespricht die Nebenwirklungen und probiert andere Medikamente in Zusammenarbeit mit der Ärztin aus. 6 Er sagt, er weiß was ihm fehle: Sobald er unter Menschen sei, z. B. auf der Station, gehe es ihm besser. Eine Änderung der Lebensform kann er sich aber nicht vorstellen. Er habe die Trennung von seiner Frau nie gewollt und eine andere Lebensform sei nichts als eine Notlösung; außerdem wisse er nicht, was er tun könne: er arbeite nicht mehr, beziehe Rente, habe keine praktikablen Hobbies. Beim ersten Klinikaufenthalt werden die Kinder eingeladen und kommen. Die Tochter konfrontiert den Vater mit der Aussage, er habe die Mutter unterdrückt. Herr Z. weist das von sich, er habe ihr Stabilität gegeben. Dass seine Ex-Frau seit nun mehr als sechs Jahren aktiv und ohne Einbrüche lebe, nimmt er achselzuckend zu Kenntnis: sie sei psychotisch. In der Gegenübertragung nehmen die MitarbeiterInnen auf der Station wenig Trauer wahr, aber viel Trotz. Die Anpassungsbereitschaft „geht ihnen auf den Wecker“, macht sie ärgerlich. Suizidalität schließen die meisten aus. Lassen wir die Geschichte zunächst einmal so stehen und bearbeiten die dazu gehörende Theorie. 7 2. Verschiedene Formen psychischer Störung Als „psychische Störung“ werden erhebliche Abweichungen vom Erleben oder Verhalten psychisch gesunder Menschen bezeichnet. Es können sowohl das Denken und Fühlen, Erleben und Verhalten verändert und/oder beeinträchtigt sein. Als weiteres Kriterium für die Diagnose einer psychischen Störung wird auch das psychische Leid auf Seiten der Betroffenen einbezogen. Insgesamt werden die verschiedenen psychischen Erkrankungen im Internationalen Klassifikationssystem für Krankheiten (ICD-10) definiert, die in verschiedene Gruppen unterteilt sind: • Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen • Affektive Störungen • Neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen • Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren • Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen • Intelligenzminderung • Psychische Störungen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen • Entwicklungsstörungen: Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend Die Palette psychischer Krankheiten reicht von leichten bis chronisch depressiven Zuständen über Zwangsvorstellungen bis zu Störungen, die einen vollständigen Rückzug aus der Realität in eine Welt beinhalten, die nicht der Wirklichkeit entspricht, welche die meisten von uns wahrnehmen, die Psychosen. Für diesen Studienbrief konzentrieren wir uns auf vier Störungsbilder: • Psychosen bzw. Schizophrenien, • affektive Störungen bzw. Depressionen, • Sucht • Persönlichkeitsstörungen • „Trauma“, weil es in vielen psychischen Krankheiten eine Rolle spielt. 8 2.1Schizophrenie Zur Beschreibung der Schizophrenie wird gern der Vergleich mit einem Traum herangezogen. Im Traum kommen Gefühle, Hoffnungen, Ängste und Wünsche nach „oben“, d. h. dem Träumer selbst sind sie keine fremden oder aus der Außenwelt stammenden Inhalte. Die Grenzen zur Wirklichkeit werden überschritten und eine Welt von Phantasie und früheren Erlebnissen tut sich auf. Die Gesetze der Logik und der bisherigen Lebensregeln verlieren ihre Gültigkeit. Im Unterschied zum Schizophrenen wird der Träumer aufwachen und kann den Traum von seiner äußeren Umgebung abtrennen. 2.1.1 Erscheinungsbilder der Schizophrenie Grob gesprochen setzt sich Schizophrenie aus erblichen Anlagen, den Charaktereigenschaften des Betroffenen, der Lebensgeschichte bis zum Krankheitsausbruch und der augenblicklichen Lebenssituation zusammen, die sich miteinander verbinden. Die krankheitsspezifischen Symptome nennt man Plussymptome und Minussymptome. Die Plussymptome Als Plussymptome werden diejenigen Krankheitserscheinungen bezeichnet, die über das hinausgehen, was im Erleben eines Gesunden möglich ist. Diese Plussymptome können im geistigen, gefühlsmäßigen, vegetativen und motorischen Bereich liegen. Dazu gehören Einfälle, Gedanken- und Ideenreichtum, unangenehmes Drängen von Einfällen, die den Menschen nicht zur Ruhe kommen lassen, auch Wahn und Halluzinationen (Sinnestäuschungen) gehören dazu. Im Gefühlsbereich können Angst und vermehrte Reizbarkeit auftreten, die zu Gefühlen von Überforderung führen, zu dem Wunsch nach Ruhe. Im vegetativen Bereich, der die Körperfunktionen umfasst, kommen häufig Schlaflosigkeit, Herzrasen und Schweißausbrüche dazu. Die Motorik vermittelt wichtige Bestandteile bewusster und unbewusster Kommunikation: Der Schizophrene hat einen gesteigerten Antrieb, der sich z. B. in körperlicher Unruhe oder angespanntem und ziellosem Herumlaufen äußert. Als Halluzinationen werden Sinnestäuschungen genannt, die ohne äußeren Reiz auftreten. Der Betroffene hört, sieht, schmeckt, fühlt oder riecht etwas, was tatsächlich 9 nicht vorhanden ist. Am häufigstem kommen die akustischen Halluzinationen vor, die von einfachen Lauten wie z. B. Knallen bis zu „Stimmen“ führen. Darunter versteht man das Hören in Rede und Gegenrede, die dem Schizophrenen auch Befehle geben können, die er dann ausführt. Diese Stimmen sind eigentlich die eigenen Gedanken, die als von außen kommend erlebt werden. Es gibt aber auch Leibhalluzinationen, d. h. Empfindungen am eigenen Körper wie Berührung und Bestrahlung. Beim sogenannten Wahn handelt es sich um eine falsche Überzeugung krankhafter Ursache, die trotz eindeutiger und vernünftiger Gegengründe beibehalten wird. Der Kranke ist in seinem Glauben unkorrigierbar, gegenüber jeglicher Beeinflussung verschlossen. Sein Kontakt zur Realität ist für den Bereich des Wahns stark eingeschränkt bis ganz aufgehoben und die kritische Prüfung seines Erlebens gelingt nicht mehr. Die Folge davon ist eine lebensbestimmende Überzeugung, die auch „Wahngewissheit“ genannt wird. Der Wahn ist für viele Kranke oft die einzig gültige Wirklichkeit. Wenn sich beim Kranken ein Wahn zu entwickeln beginnt, so ist dies bereits an seiner angstvolle Erwartung erkennbar. Der Kranke ist in dieser Phase sehr verunsichert und bedrückt und erlebt seine Situation als ausweglos. Die Hilflosigkeit, Verzweiflung und der Wunsch des Kranken, dass der momentane Zustand aufhören und endlich Ruhe einkehren möge, kann dabei so groß sein, dass die Gefahr des Selbstmords besteht. Im wahnhaften Erleben des Kranken geht es immer um ihn selbst: Die Umgebung wird als verändert wahrgenommen, der Kranke steht im Mittelpunkt aller Geschehnisse um sich herum und meint, es gebe für ihn kein Entrinnen. Es kann auch vorkommen, dass der Kranke wirklichen Wahrnehmungen der Umgebung eine abnorme Bedeutung zumisst und sie auf sich bezieht, d. h. Ereignisse und Zusammenhänge bekommen für den Kranken eine sonderbare und unheimliche Bedeutung. Er fühlt sich bedroht und ausgeliefert. Durch die Ausarbeitung seines Wahns kämpft der Kranke gegen die Bedrohung an. Der Wahn ist demnach auch ein sehr kreativer Versuch, die vielen unverständlichen Dinge zu erklären und damit die Angst vor ihnen zu bewältigen. Das Thema des Wahns ist meist von der persönlichen Lebensgeschichte und der momentanen Lebenssituation abhängig. Früher waren Wahninhalte mit religiösen Inhalten häufiger, heute spielen Themen wie Röntgenstrahlen oder Radarstrahlen eine größere Rolle. 10 Bei einem Beziehungswahn bezieht der Kranke belanglose Ereignisse direkt auf sich. Im Verfolgungswahn fühlt sich der Kranke als Spielball geheimnisvoller Mächte, im Größenwahn versucht der Kranke sich durch die Gedanken der eigenen Größe von der Bedrohung zu befreien, was häufig einhergeht mit dem Gefühl der Erlösung und heiteren Stimmung. Der dritte Bereich der Plussymptome, neben Halluzinationen und Wahn, sind Denkstörungen, die von außen am besten über die Sprache zu erkennen sind. Der Schizophrene kann häufig seine Gedanken nicht mehr selbst steuern, diese werden von außen „gelenkt“. Dies kann auch Gedankenentzug sein: Andere Menschen ziehen die Gedanken ab. Es kann auch Gedankeneingebung sein: Es sind nicht die Gedanken des Kranken, sondern diese werden von außen eingegeben. Die Gedanken des Kranken brechen auch oft ab, als wären sie nicht mehr verfügbar; dem Außenstehenden fällt auf, dass der Kranke plötzlich stockt, eine Pause macht und mit einem ganz anderen Thema fortführt. Die Denkzerfahrenheit beschreibt eine zusammenhanglose und verworrene Sprache, die nur noch aus einzelnen Bruchstücken besteht. Die akute Phase der Schizophrenie – auch die „produktive“ Phase genannt – wird von der Plussymptomatik beherrscht. Die Minussymptome Die Minussymptome sind bei genauer Beobachtung oft schon zu sehen, ehe Halluzinationen und Wahn auftreten und an das Vorliegen einer Schizophrenie denken lassen. Deutlich werden sie aber auch nach dem Abklingen der Plussymptomatik. Dann kann man feststellen, dass eine Reihe von psychischen Behinderungen geblieben ist, die den Betroffenen im Alltag häufig mehr beeinträchtigen als die zunächst wesentlich deutlicher auffallende Plussystematik. Dies nennt man Residualsymptome. Zu den Minussymptomen gehören: Störungen der Aufmerksamkeit durch „Reizoffenheit“, Störungen im Denken und Handeln, z. B. Störungen der Rangfolge bei Gedanken und Tätigkeiten, Störungen üblicher Denkzusammenhänge und Störungen automatischer Handlungsabläufe. Antriebsarmut, Müdigkeit, Verlangsamung, körperliche und geistige Erschöpfung sowie eine große Lustlosigkeit gehören dazu. Es gehören aber auch die Verringerung der Empfindungsfähigkeit und eine Armut des gefühlsmäßigen Ausdrucks dazu. Häufig tritt Albernheit auf und ein Rückzug von sozialen Kontakten. Von daher wird verständlich, dass Schizophrene deutlich weniger belastbar sind und zu einer durchschnittlichen Arbeitsleistung in der Regel nicht mehr in der Lage sind. Der Kranke kann Gefühle nicht mehr so intensiv empfinden und deshalb auch nicht mehr so zeigen. Schöne Erlebnisse sind gedämpft, traurige 11 Ereignisse machen nur wenig betroffen; ernste Situationen werden gleichgültig oder albern aufgenommen. Dies führt in der Regel zu Störungen im sozialen Kontakt bis zum sozialen Rückzug. 2.1.2 Der Umgang des Kranken mit seinen Symptomen Sehr häufig erlebt sich ein Betroffener gar nicht als krank. Er hat zwar oft Halluzinationen oder Wahnvorstellungen, die er aber für wirklich hält. Er kann deshalb oft nicht glauben, dass er aus Krankheitsgründen die Welt um sich herum anders erleben soll, als sie eigentlich ist. Sein Misstrauen gegenüber der Außenwelt wächst, vor allem, wenn diese versucht, ihm seine Wirklichkeitsverzerrung logisch deutlich zu machen. Die verringerte Belastbarkeit führt der Kranke häufig auf die Medikamente zurück, die er bekommt. Dies ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Wichtig ist, dass schizophrene Menschen in der Regel eine mangelnde Krankheitseinsicht haben. Das führt dazu, dass sie keine Hilfe annehmen können und eine schlechte Compliance haben. Trotz der Medikamente bleiben Halluzinationen und Beziehungsideen häufig bestehen. Wenn diese Halluzinationen sehr drängend sind, versuchen viele Kranke, sich durch Alkohol zu helfen. Man vermutet, dass Alkoholismus eine häufige Sekundärerkrankung der Schizophrenie ist. 2.1.3 Formen der Schizophrenie Die paranoid-halluzinatorische Form: Sie ist die mit Abstand häufigste Form und tritt meist im dritten bis vierten Lebensjahrzehnt auf und hat eine vergleichsweise gute Prognose. Wegen der bis dahin fortgeschrittenen Persönlichkeitsentwicklung und des eher akuten und späten Krankheitsbeginns bleibt das Wesen des Kranken häufig gut erhalten. Die reine katatone Form: In dieser seltenen motorischen Form stehen ausgeprägte motorische Störungen im Vordergrund, die bei voller Ausprägung als völlige Erstarrung erscheinen. Fachleute sprechen dann von einem katatonen Stupor: Trotz wachem Bewusstsein reagiert der Kranke nicht mehr auf Versuche, mit ihm in Beziehung 12 zu treten. Sein Gesicht bleibt starr und ausdruckslos, es ist keine innere Regung wahrzunehmen und selbst auf starke Schmerzreize erfolgt oft keine Reaktion mehr. Im Inneren des Patienten aber können Gefühlsstürme vor sich gehen, die sich häufig nur in einer gesteigerten Pulsfrequenz messen lassen. Patienten können in diesem Zustand sehr lange verharren und keinerlei Nahrung und Flüssigkeit mehr zu sich nehmen, wodurch eine lebensbedrohliche Situation entstehen kann. 2.1.4 Verlauf von Schizophrenie Das Leben des Menschen vor dem Ausbruch der Erkrankung gilt als erste Phase. Häufig kann erst rückblickend festgestellt werden, dass die Patienten schon eine ganze Weile anders waren als andere Menschen. Oft waren sie Einzelgänger mit wenig Kontakten, oft weniger leistungsfähig und belastbar. Bei anderen kann die Erkrankung mit einem regelrechten Knick in der Lebensentwicklung entstehen. Die zweite Phase markiert das Ausbrechen der Krankheit, was ganz plötzlich oder schleichend geschehen kann. In den plötzlichen Ausbrüchen stehen die Plussymptome im Vordergrund und werden relativ gut erkennbar. Der schleichende Verlauf ist wesentlich schwerer zu erkennen und kann sich über Wochen und Monate hinziehen, bis die Außenwelt eine Sicherheit für die Diagnose bekommt. Die dritte Phase ist die Langzeitentwicklung der schizophrenen Erkrankung. In günstigen Fällen klingen die akuten Krankheitssymptome ab und treten nicht wieder auf. Oft bleibt eine mehr oder weniger starke Minussymptomatik zurück, was aber nicht der Fall sein muss. Es kann zu weiteren Schüben kommen, auch wenn diese viele Jahre später auftreten. Die Dauer der Krankheitsschübe ist sehr unterschiedlich und kann von wenigen Wochen bis zu etwa einem Jahr dauern. Bei ein- und demselben Kranken sind die Krankheitsschübe meist ähnlich lang. Manchmal entsteht der Eindruck, dass die Krankheit sich im Verlauf verschlimmert und der Kranke immer häufiger und schwerer krank ist, was meistens an der Minussymptomatik liegt, die im Lauf der Zeit zugenommen hat. Die Diagnose Schizophrenie ist schwierig zu stellen. Es gibt noch kein Untersuchungsverfahren, das die Krankheit eindeutig nachweist. Die Diagnose wird anhand der Plus- und Minussymptome gestellt, d. h. man muss sich sehr viel Zeit nehmen, um den Patienten differenziert kennenzulernen. 13 Man spricht von einer sogenannten „Drittelregel“: Ein Drittel der an einer Schizophrenie erkrankten Menschen können ohne größere Einschränkungen voll in ihr Leben zurückkehren. Ein weiteres Drittel behält nach einzelnen Krankheitsschüben leichtere Einschränkungen zurück. Das letzte Drittel der an einer Schizophrenie Erkrankten kann nicht mehr selbständig leben, sondern braucht Betreuung in einem Heim oder einer Wohngemeinschaft. Der Krankheitsverlauf ist schwer vorauszusagen, aber es gibt einige Anzeichen, die auf einen günstigen Verlauf hoffen lassen: Je weniger sozial auffällig ein Betroffener vor der Krankheit war, umso besser sind die Aussichten auf eine weitgehende Genesung. Je plötzlicher die Krankheit ausgebrochen ist, je stärker die Plussymptomatik ist und je dramatischer die Umstände der Klinikeinweisung waren, umso besser sind die Chancen auf eine rasche Besserung des Krankheitsbildes. Je deutlicher Schübe und andere Zeiten voneinander abzugrenzen sind, umso günstiger ist die Prognose. Ein später Krankheitsbeginn ist ebenfalls günstig. Günstig ist auch die gute Compliance des Patienten. 2.2 Affektive Störungen Die zweite große Gruppe der psychischen Krankheiten sind die sogenannten affektiven Störungen, die vor allem durch klinisch bedeutsame Veränderungen der Stimmungslage gekennzeichnet sind. Grundsätzlich sind die Depression und die Manie zu unterscheiden. In einigen Fällen kommen auch beide Symptome in einem Krankheitsbild vor, wenn der Patient zwischen depressiven und manischen Phasen schwankt und möglicherweise dazwischen auch symptomfreie Phasen hat. Von daher wird die Zyklothymie auch als bipolare Störung bezeichnet, die den Wechsel von manischen zu depressiven Phasen und umgekehrt beschreibt. Dieser Wechsel kann teilweise ganz abrupt geschehen und ist nicht ohne Gefährlichkeit, denn der Austritt aus der Depression ist mit einer erhöhten Suizidalität verbunden. 14 2.2.1Manie Unter Manie versteht man eine übermäßig und einer Situation unangemessene freudige Erregung, eine gehobene Stimmung, die kombiniert sein kann mit einem übersteigerten Aktivitätsniveau. Die Manie kann sanft sein, im Sinne einer Hochgestimmtheit, die andere Menschen nicht nachvollziehen können, sie kann aber auch mit psychotischen Symptomen auftreten und kann von daher auch in den Formenkreis der Psychosen fallen. Man darf von Manie eigentlich erst sprechen, wenn man weit über dem Normalniveau liegt. Manchmal sind die Patienten stark erregt und getrieben, rastlos und unruhig, manchmal sind sie nur hochgestimmt und affektiv „gut drauf“. Je stärker die Manie ausgeprägt ist, umso mehr geht sie einher mit anderen Auffälligkeiten wie unkritischem Verhalten, hemmungsloser Kontaktaufnahme, weitschweifigen Ideen oder Ideenflucht, starkem Rededrang, aber auch Realitätsverlust, Größenwahn und unkontrollierter Selbstinszenierungen wie z. B. Kauflust. In der Manie sind Patienten manchmal unangepasst und distanzlos. Manchmal überrennen sie gesellschaftliche Konventionen und brüskieren damit andere Menschen, vor allem, wenn es zu wahllosen Kontakten kommt, die auch sexueller Natur sein können. Oft geht mit manischen Phasen ein reduziertes Schlafbedürfnis einher, so dass Angehörige erheblich gestresst sind, weil der Patient ständig in Aktion ist und es kaum Phasen der Entspannung im Zusammenleben gibt. Besonders anstrengend für die Angehörigen ist die mangelnde Krankheitseinsicht manisch erkrankter Menschen. Sie fühlen sich sehr wohl, verweigern daher die Medikamente und tragen so zur Anstrengung der Angehörigen immer weiter bei. 15 2.2.2Depression Der weitaus häufigere Teil der affektiven Störung allerdings ist die Depression, deren Leitsymptom Niedergeschlagenheit und Traurigkeit sind. Dabei wirkt diese Traurigkeit oft nicht wie Traurigkeit – im Gegenteil: oft ist die Fähigkeit zu Emotionen wie Trauer so gestört, dass nur noch eine Reduktion aller Affekte wahrzunehmen ist. Weitere Symptome sind Antriebshemmung und Hoffnungslosigkeit, oft verbunden mit Gefühlen der Minderwertigkeit und der Hilflosigkeit, mit Gefühlen der Isolation und der Unattraktivität für andere Menschen einschließlich ihrer selbst. Ängstlichkeiten tauchen auf, aber auch gereizte Stimmungen, weil der Mensch sich in seiner Situation selber nicht mehr zurechtfindet und sich selber kaum ertragen kann. Das gesamte Gefühlsleben reduziert sich und das Interesse an der Umwelt wird vermindert. Der Schlaf kann gestört, die sexuellen Interessen vermindert und der TagNacht-Rhythmus erheblich gestört sein. Die Depression ist ganz sicher die am häufigsten auftretende psychische Erkrankung, was aber daran liegen kann, dass genaue Parameter kaum festzulegen sind. Von der Alltagsaussage „Ich fühle mich depressiv“ bis zu einer echten und dauerhaften Depression ist die Varianz sehr groß. Daneben gibt es eine hohe Dunkelziffer, denn viele Depressionen werden als solche nicht erkannt. Sie werden als körperliche Beschwerden behandelt, die durch die Behandlung aber nicht gemildert werden können. Frauen und Männer gehen sehr unterschiedlich mit der Krankheit um. Frauen können eher zu einer Depression stehen, während Männer sich eher für ihre depressiven Episoden und herabgestimmten Emotionen schämen und sich zurückziehen. Ältere Menschen scheinen wesentlich häufiger an Depressionen zu erkranken als jüngere. Es gibt aber auch Lebensereignisse, die in eine Depression führen können. Bekannt ist die postnatale Depression, die nach einer Geburt auftreten kann, und vermutlich durch die massive Hormonumstellung verursacht ist. Diese Form ist häufig sehr gut behandelbar. Depressionen können auch im Kontext mit Schizophrenie auftauchen und sie können im Alter mit Demenz kombiniert sein. Von daher ist das Bild sehr vielfältig und schwierig zu diagnostizieren, aber das ist ja nicht der Hauptpunkt dieses Studienbriefes. 16 Folgende Symptome rechtfertigen die Diagnose „Depression“: • Die Stimmung des Menschen ist depressiv, d. h. gleichgültig und hoffnungslos, leer und ausgebrannt, selbst Schmerz und Trauer können nicht mehr empfunden werden. • Der Antrieb ist gehemmt, es gibt keine Initiative; anstelle des Denkens tritt das Grübeln. Der Patient bleibt auf der Stelle stehen, entwickelt sich nicht fort in eine Zukunft. Die Gehemmtheit ist eine Selbstblockierung, die durchaus mit quälender Unruhe und trotzdem Untätigkeit verbunden sein kann. • Das Denken und Fühlen ist eingefärbt, d. h. es ist bestimmt worden von Angst vor Verarmung oder Versagen, von Wertlosigkeit oder Schuld, die sich bis zu einem Wahn steigern können. • Die Vitalgefühle liegen danieder, der ganze Körper wird nicht mehr wahrgenommen oder genossen, man fühlt sich schlaff und schlapp, niedergeschlagen und ständig müde. Von daher wird verständlich, dass der Tag vom Morgen aus als unendlich lang und nicht bewältigbar angesehen wird, während abends die Lebensstimmung durchaus etwas steigen kann. Man unterscheidet endogene und exogene Depressionen. Der Begriff „exogen“ wird dann verwendet, wenn es einen äußeren Anlass gibt, der auch für andere nachvollziehbar ist. Tellenbach (1974) ersetzt den Begriff „endogene Depression“ durch Melancholie, wenn die Depression nicht reaktiv ist, sondern wie Psychose arbeitet und organisch wirkt. Insofern gibt es zwei sehr unterschiedliche Depressionsbegriffe, der eine ist die depressive Episode bzw. Phase oder das depressive Erleben im Sinne einer nicht aufhörenden Trauer. Der andere kann mit Melancholie oder als endogen gekennzeichnet werden und impliziert eine Veränderung der Persönlichkeit. Klaus Dörner und Ursula Plog schreiben: „[…] man kann also ein Leiden […] psychotisch nennen, wenn der letzte private Rest, die Kränkung des Selbst mit dem organischen Eigenanteil, mit der Eigenart, besonders beeindruckt. Wenn die Depression wie eine Krankheit schicksalhaft kommt und zu gehen scheint, der Patient vielleicht eine hypomanische Nachschwankung und depressive Verwandte hat, das Leben wahnhafte Intensität hat und wenn die depressiven bzw. manischen Zeichen wie Phasen verlaufen […] während der Patient in den anderen Zeiten lebt, als ob nichts wäre,“ (1996, S. 199). 17 Dörner und Plog empfehlen einen besonderen Umgang mit depressiven Menschen. Ihre Grundhaltung ist nicht die Behandlung, sondern die Begegnung. Das gilt sowohl für die Angehörigen, die ihrem betroffenen Angehörigen begegnen sollten, als auch dem psychiatrischen Personal, das sowohl dem Patienten als auch den Angehörigen begegnen sollte. Begegnen heißt in diesem Kontext, dass man sich den Gefühlen der Patienten und der Angehörigen zuwendet und sie versucht zu teilen. Dörner und Plog behaupten, dass ein Dreiergespräch diesem Teilen der Erfahrungen und Gefühlen immer dienlicher ist als ein Zweiergespräch, weil die Vielfalt der Reaktionen von zwei Beratern oder zwei Menschen, die, die dem Patienten gegenüber – und damit außerhalb – stehen, deutlich angebotsreicher ist als ein Zweiergespräch. Mit einer zweiten Grundhaltung zeigen Dörner und Plog, dass es nicht darum geht, wie Angehörige oder psychiatrisch Tätige den Patienten verstehen, sondern dass sie ihm als Medium zur Verfügung stehen, sich selbst besser zu verstehen. Eine dritte Technik ist, nicht auf die Symptome, sondern auf die Varianz der Symptome zu achten. Es gilt festzustellen, wann der Patient seiner Depression ausgeliefert ist oder wann er seine Depression lebt, selbst herstellt und damit nicht nur Opfer, sondern auch Täter ist (ebd. 1996, S. 203). Dies kann durch differenzierte Wahrnehmung eruiert werden. Weiterhin ist die Depression als Problemlösungsversuch wahrzunehmen, der anstrengend und kraftraubend ist. Dieses Bemühen um eine Problemlösung muss anerkannt werden als Versuch. Gleichzeitig muss daran gearbeitet werden, dass diese Problemlösung ungeeignet ist, da sie mit der Abwehr der Lebensprobleme einher geht und nicht mit der Akzeptanz der Lebensprobleme. Dörner und Plog (1996) fragen auch danach, wie man Beziehungen und Begegnungen so gestalten kann, dass man ein normales Maß an Unabhängigkeit behalten kann: Über die Frage nach der Wirkung des Patienten auf mich selbst und über die Frage, was ich spontan gerne für ihn täte, komme ich auf die Spur, was die Falle des Helfens ist und was die Möglichkeit einer Hilfe durch Gegnerschaft ist. Im schlimmsten Fall kann aus dem Helfen naiver Art ein Machtkampf entspringen, der den Patienten auffordert, seine Symptome dem Helfer gegenüber zu verteidigen. Dem gemeinsamen Untergang in trostlose Gefühle entflieht der Helfer am besten, wenn er sich auf die andere Seite stellt und eine Distanz zwischen dem Patienten und sich selber 18 herstellt. Dazu gehört, dass dem Patienten die Gefühle zurück gemeldet werden, die er in der anderen Person auslöst, also auch die entstehende Hilflosigkeit oder den Ärger bis Wut, der durch diese Depression entstehen kann. Gleichzeitig bedarf der Patient des Respekts für seine Lösungsbemühungen, auch wenn diese bereits in einer Sackgasse der Depression gelandet sind. Es ist also wichtig, folgende Fragen thematisch zu beantworten: • Gibt es einen Beziehungsaspekt des Problems? • Gibt es einen Entwicklungsaspekt des Problems? • Stehen zwei Menschen miteinander im Clinch? • Kann die Spaltung zwischen Opfern und Tätern aufgelöst werden, indem man die Opferseite und Täterseite der jeweiligen Beziehungspartner herausfindet? • Kann man den Angstabwehraspekt des Problemlösungsversuches herausarbeiten? • Kann ich den Machtaspekt des Problemlösungsversuches herausarbeiten? 19 2.2.3 Depression und Alter Aufgrund der demografischen Entwicklung steigt die Zahl der alten Menschen. Es lässt sich daraus ableiten, dass damit auch die Zahl der psychisch kranken alten Menschen ansteigen wird. Nach statistischen Angaben geht man davon aus, dass ca. 23 % der Menschen krank sein werden, die älter als 65 Jahre alt sind. Im Vergleich der Krankheiten jedoch sind die psychischen Krankheiten auch bei 70-Jährigen im Bereich bei ca. 30 % anzusiedeln. Diese Zahlen stammen von Andreas Kruse aus dem Jahre 2002 (in Wolfersdorf u. Schüler 2004, S. 3). Neben den demenziellen Erkrankungen sind die depressiven Störungen die häufigsten psychischen Erkrankungen des höheren und hohen Lebensalters. Die Depression im Alter wird als eine affektive Störung mit typischen Symptomatiken und typischem Verhalten definiert, wie affektive Herabgestimmtheit und Freudlosigkeit, Formen des Grübelns und der Denkhemmung als kognitive Störung, wie Lustlosigkeit und Antriebslosigkeit als motivationale Störung, wie Hemmungen im psychomotorischen Bereich und wie rasche Erschöpfungszustände, Schlafappetit und Libidostörung im vegetativ-somatischen Bereich. Die depressiven Episoden von jüngeren Erwachsenen und älteren Erwachsenen gleichen sich durchaus. Bei älteren Menschen kommen allerdings zu den psychischen Beeinträchtigungen oft noch körperliche Beeinträchtigungen hinzu, was auch in wechselnder Abhängigkeit voneinander geschehen kann. Die affektive Symptomatik kann ganz verschiedene Außendarstellungen haben. Manchmal ist sie verbunden mit anderen Körpersymptomen, manchmal ist sie verbunden mit einer Klagsamkeit, manchmal ist sie laviert und nur schwer zu erkennen. Manchmal ist die Depression im höheren Lebensalter auch mit Wahn verbunden. Dieser Wahn wird befördert durch Themen aus dem Bereich von Verarmung und Schuld, die eindeutig etwas mit der Auseinandersetzung mit dem bevorstehenden Lebensende zu tun haben, auch wenn dieses noch Jahre hinweg sein kann. Von einer chronischen Krankheit spricht man bei einer Krankheitsdauer von mehr als zwei Jahren. 20 2.2.4 Suizidalität im höheren Lebensalter Die Bewertung von Suiziden und suizidalem Verhalten hat sich im Laufe der Geschichte häufig verändert. Wenn auf der einen Seite des Einschätzungskontinuums die Freiheit steht, steht auf der anderen Seite der Vorwurf der Schuld, der Feigheit und der Flucht. Für alte Menschen bedeutet dies, dass auf der einen Seite des Kontinuums stehen könnte: Die Alten sollen den Weg frei machen für die jungen Generationen, und auf der anderen Seite würden dann Vernachlässigung und Depression stehen. Der Suizid ist eine ureigene menschliche Verhaltens- und Entscheidungsmöglichkeit und ist von daher nicht als eine Krankheit zu betrachten. Unter Suizid wird eine selbst verursachte, die eigene Person schädigende Handlung verstanden, die dem Ziel folgt, tot zu sein, nicht mehr leben zu müssen oder zu wollen. D. h. wir haben bei jedem Suizid einen Todeswunsch, der eine bessere Zukunft sozusagen verspricht, auch wenn das Leben damit beendet wird. Dem Suizid und erst recht dem Suizidversuch wohnt ein paradoxes Bedürfnis inne, nämlich etwas verändern zu wollen, was beim Suizidversuch ja noch geschehen kann, beim gelungenen Suizid aber definitiv nicht mehr. Insofern liegt vermutlich auch im gelungenen Suizid eine Restambivalenz, die aber besonders deutlich im Suizidversuch einzukalkulieren ist. Auch bei Suizid im Alter muss davon ausgegangen werden, dass die Selbsttötung Ausdruck einer narzisstischen Krise sein kann, wie Henseler dies 1974 schon in seinem Buch „Narzisstische Krisen“ heraus gearbeitet hat. Im Suizid wird die Rettung des Selbstwertgefühles versucht. Andere Modelle sprechen von der Richtung der Aggression: Die eigentlich nach außen gerichtete Aggression wird gegen sich selbst gerichtet und kann so im Suizid münden. Ein dritter Ansatz, der sogenannte objektbeziehungstheoretische Ansatz geht davon aus, dass Suizidalität und auch Suizid eingesetzt werden können, um Beziehungen zu halten, auch dies hat bei dem gelungenen Suizid durchaus einen paradoxen Anteil. Wolfersdorf unterscheidet ein Krisenmodell von einem Krankheitsmodell (vgl. Wolfersdorf u. Schüler 2004, S. 177). Das Krisenmodell setzt psychische Gesundheit voraus und betrachtet Suizid als eine Entscheidung, keine anderen Bewältigungsmöglichkeiten mehr zur Verfügung zu haben, um eine bestehende Krise zu lösen. Im Alter kann diese Krise bedeuten, dass neue Abhängigkeiten entstanden sind, die 21 schwer erträglich sind, dass der Radius des Lebens eingeschränkt wird und damit die Genussfähigkeit am Leben als reduziert oder beendet erlebt wird. Zu den Zahlen: In Deutschland gibt es etwa 14.000 vollzogene Suizide pro Jahr, die Zahl ist höher als die Zahl der Verkehrstoten. In allen Altersgruppen, einschließlich des hohen Alters, sind Männer doppelt so häufig gefährdet wie Frauen. Dabei gibt es eine hohe Dunkelziffer, man geht in etwa davon aus, dass es zehnmal so viel Suizidversuche wie gelungene Suizide gibt. Von daher ist dem Thema eine hohe Aufmerksamkeit zu widmen. Die narzisstischen Kränkungen des Alters sind verstehbar. Da sind die körperlichen Veränderungen, die sozusagen jeden Tag das Selbstbild und die Selbstwahrnehmung kränken. Der Körper verändert sich ein Leben lang, aber mit zunehmendem Alter sind die Veränderungen eher defizitär oder werden nicht als bereichernd erlebt und die Integration in das Selbstbild wird mit einem größeren Widerstand angegangen. Aber auch die Schwächung der Sinne kann als Kränkung wahrgenommen werden, ebenso natürlich die Einschränkungen in den Bewegungen und der Flexibilität. Gereon Heuft (1991 in Wolfersdorf u. Schüler 2004, S. 179) geht davon aus, dass im Alter die narzisstischen Kränkungen überhand nehmen und über den Verlust von Funktionen von Anerkennung von Partnern, von Kindern und Perspektiven, die Kränkung so groß ist, dass es zu einem lauten oder stillen Suizid kommen kann. Nicht zu unterschätzen ist die stille Form des Suizids im Alter, die häufig durch eine nicht vorhandene Compliance – z. B. bei der Einnahme von Medikamenten – verdeckt wird. Mit der Idee des Suizids wird ein Konfliktlösungsversuch verbunden, ein regressiver und ein endgültiger, aber einer, der der permanenten Kränkung endlich ein Ende setzen kann. Zur narzisstischen Kränkung gehört auch das Bewusstsein zeitlicher Begrenztheit. Begrenzt in der Zeit zu sein heißt, damit zu rechnen, eines Tages nicht mehr dabei zu sein, nicht mehr mitspielen zu dürfen. Dies kann über Neid- und Eifersuchtsgefühle Bestandteil von Depression sein und auch Bestandteil von Suizidalität werden. 22 Diese selbst-destruktiven Verhaltensweisen im Alter verlangen besondere Aufmerksamkeit, weil vor allem ältere Männer, diese insbesondere nach dem Tod der Ehefrau, ein deutlich höheres Risiko nicht nur an Trauer und Depression, sondern auch an Suizidalität tragen. Das Krankheitsmodell des suizidalen Verhaltens geht demgegenüber von einer psychischen Krankheit als Ursache aus. Eine psychische Krankheit wie Schizophrenie, Sucht oder Depression kann in Hoffnungslosigkeit enden, weil keine Änderung mehr erwartet und abgesehen wird, und schließlich von dort in den Suizid führen, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. 2.3Sucht In der Praxis der Psychiatrie und Sozialpsychiatrie spielen Suchterkrankungen eine große Rolle. Die Erklärungsansätze sind vielfältig und reichen von soziokulturellen, sozialpolitischen, soziologischen, lernpsychologischen, psychoanalytisch orientierten Modellen hin zu systemischen Ansätzen. Die einzelnen Erklärungsansätze bilden jeweils nur einen Teilaspekt der Suchtdynamik ab und können keinen Allgemeingültigkeitsanspruch erheben. Im Folgenden sollen diejenigen Erklärungsmodelle dargestellt werden, auf deren theoretischen Grundlagen heute die gängigsten Suchttherapien fußen. Im Weiteren soll auf das Thema „Co-Abhängigkeit“, also paar- und familiendynamische Prozesse, die für die Praxis mit Angehörigen ebenfalls hohe Relevanz haben, eingegangen werden. 23 2.3.1 Psychoanalytische Suchttheorien Seit ihren Anfängen beschäftigt sich die Psychoanalyse mit der Sucht. Der wissenschaftlichen Diskussion ihrer Zeit folgend, erfuhren die psychoanalytischen Erklärungsansätze zum Erscheinungsbild, zur Genese und zur Behandlung der Sucht Erweiterungen und unterschiedliche Akzentuierungen. Dabei lassen sich im Wesentlichen drei Grundformen unterscheiden. Am Beginn der psychoanalytischen Auseinandersetzung mit der Sucht steht das Konfliktmodell des triebpsychologischen Ansatzes, demzufolge der Suchtmittelgebrauch den Versuch darstellt, einen Triebkonflikt zu lösen. Es folgen die ich-psychologischen oder strukturellen Suchttheorien, denen die These des Selbstheilungsversuches mit Hilfe von Suchtmitteln zugrunde liegt. Schließlich betont das objektpsychologische Modell den selbstdestruktiven Charakter des Suchtmittelkonsums und den Aspekt der Wiederholung frühkindlicher zerstörerischer Beziehungsmuster des Kindes mit seiner Umwelt. In Bezug auf den Erklärungswert dieser drei Modelle herrscht in der gängigen Fachliteratur dahingehend Einigkeit, dass die ausschließliche Heranziehung des triebpsychologischen Modells zur Erklärung des Sucht nur einen Teilaspekt des Suchtgeschehens erfasst und zu sehr den lustbetonten Charakter und das Konzept von Oralität in den Vordergrund stellt (vgl. Rost 1992). Da das triebtheoretische Modell jedoch den Grundstein der Weiterentwicklung psychoanalytischer Suchttheorien markierte, soll es im Folgenden, neben der Darstellung ich-psychologischer und objektpsychologischer Ansätze, in Bezug auf seine zentralen Aussagen kurz erläutert werden. Im triebpsychologischen Modell der Sucht – nach Sigmund Freud – wird die Sucht, wie alle psychischen Symptome im Verständnis dieses Modells auch, als Lösungsversuche für Triebkonflikte angesehen: Sucht als „missglückte Lösung eines Triebkonflikts und als Ersatzbildung […]. Urform der Sucht ist für Freud dabei die Masturbation“ (zitiert nach Rost 1992, S. 30). Sucht dient gewissermaßen als Ersatz und Ablösung für die Masturbation. Einige Jahre später betonte Freud in seinen Schriften „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ nicht mehr die genitale Fixierung, sondern postulierte bei der Sucht eine orale Fixierung, womit er den ontogenetischen Ursprung der Sucht zurückverlegte. Im kindlichen Vorgang des „Lutschens“ oder „Wonnesaugens“ sah Freud eine oralerotische Aktivität, welche bei Männern die 24 Entwicklung von Trinkmotiven begünstige (vgl. Rost 1992). Alkohol dient der Durchsetzung des Lustprinzips: „Durch eine grundlegende Veränderung der ‚Stimmungslage‘ und die daraus resultierende Beseitigung von Hemmungen und Sublimierungen gestattet Alkohol eine allgemeine regressive Wunscherfüllung“ (Freud 1905, zitiert nach Wurmser 1997, S. 59). Freud stellte weiterhin eine Verbindung zwischen Alkoholismus und Homosexualität her. Und er stellte eine Verbindung zwischen der Manie und dem Alkoholrausch dahingehend fest, dass beide der Verleugnung und Aufhebung von Verdrängung dienen und der Alkoholrausch gewissermaßen eine toxisch erreichte Manie darstellt. In seiner Schrift „Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens“ erwähnt Freud (Freud 1910 in Rost 1992) die Bedeutung des Suchtmittels als „Liebesobjekt“, als idealer Ersatz des Sexualobjekts. Zwanzig Jahre später wiederum nimmt Freud in seiner Schrift „Unbehagen in der Kultur“ (1930 in Rost 1992) eine weitere Akzentverschiebung vor und betont den Nutzen des Suchtmittels nicht bloß als Mittel zum Lustgewinn, sondern als Möglichkeit vor der Realität zu flüchten. Im Mittelpunkt steht hier die Unlustvermeidung, ein Aspekt, der den zum Scheitern verurteilten Selbstheilungsversuch des Suchtmittelkonsums betont und damit dem zentralen Gedanken des ich-psychologischen Modells der Sucht bereits nahekommt. Die Arbeiten des ungarischen Psychoanalytikers Sándor Radó von 1926 bis 1934 beeinflussten über Jahrzehnte maßgeblich den psychoanalytischen Diskurs zur Sucht. Im Mittelpunkt von Radós Schriften stand zunächst die Betonung des triebpsychologischen Ansatzes, so prägte Radó (1926 in Wurmser 1997) den Begriff des „pharmakogenen Orgasmus“ und hob damit den orgastischen Effekt von Rauschmitteln hervor. In den späteren Schriften Radós erfolgte, wie bei Freud auch, eine Akzentverschiebung zugunsten der Betonung von Sucht als Abwehr von Unlust. Die Annahme einer erotischen, hedonistischen bzw. orgastischen Befriedigung beim Konsum des Suchtstoffs, wie sie der frühen triebpsychologischen Suchttheorie zugrunde liegt, bedarf einer Erweiterung. In ihnen wird zu sehr von den „normalen“ Trinkmotiven wie Enthemmung oder Genusssteigerung ausgegangen, sie liefern jedoch wenig Anhaltspunkte für das Phänomen süchtiger Entgleisung. In der Beratungs- und Therapiepraxis fallen, in Kontrastierung zum triebpsychologischen Modell, die ausgesprochene Genussunfähigkeit und die Unmäßigkeit von Süchtigen auf, der die „Tendenz zum Exzessiven“ (Kuntz 2009, S. 21) eigen ist. 25 Das ich-(struktur)psychologische Modell betrachtet Sucht als Folge einer IchSchwäche bzw. nicht hinreichend entwickelter Ich-Funktionen wie Frustrationstoleranz, Belohnungsaufschub, Impulskontrolle, Fähigkeit zur differenzierten Wahrnehmung von Affekten etc. Das aus dem Ich-Defekt resultierende Leid bzw. die innere Not sollen mit Hilfe des Suchtmittels in Schach gehalten bzw. ausgelöscht werden. Der entscheidende Unterschied zum triebpsychologischen Modell besteht darin, dass der Alkoholmissbrauch nicht mehr als Ausdruck eines Konflikts etwa zwischen miteinander konkurrierenden Triebregungen oder zwischen Triebimpulsen und Anforderungen der Umwelt bzw. gesellschaftlichen Erwartungen gewertet wird, sondern vielmehr als Ergebnis eines Defekts in der Struktur der Persönlichkeit. Die Ich-Psychologie geht dabei, sehr viel stärker als die Triebpsychologie, von einer idealtypischen Persönlichkeitsentwicklung aus. Die Grundlage hierfür bildet das Modell der drei Instanzen nach Freud, wobei das Es, also der Bereich des Unbewussten und der Triebe, in der Ich-Psychologie stärker in den Hintergrund tritt. Einig sind sich alle Autoren, die sich mit der Sucht beschäftigen, dass das Ich des Süchtigen in seinen regulierenden und stabilisierenden Funktionen nicht hinreichend entwickelt ist: sowohl gegenüber der Außenwelt als auch nach innen gerichtet, gegenüber dem Es und seinen Triebwünschen. Unter ungünstigen frühkindlichen Entwicklungsbedingungen, wie sie häufig in der Biografie von Süchtigen auftreten, ist das Heranwachsen einer stabilen Gesamtpersönlichkeit sehr erschwert. Besonders betroffen ist dabei der Bereich der Affekte. Andere Autoren untersuchten, ob das Auftreten bestimmter Faktoren zu einem bestimmten Zeitpunkt das Auftreten eines erneuten Alkoholkonsums beschleunigt. Studien zur Erhebung von Rückfallursachen (vgl. Körkel 2003) ähneln sich im Ergebnis sehr in Bezug auf die Bedeutung unangenehmer Gefühle als „Rückfallanheizer“. Diese treten in unterschiedlichster Form auf z. B. als Angst oder depressive Zustände, Stimmungsschwankungen oder Gefühle von innerer Leere und fragiler Identität. Bei der erschwerten Verarbeitung und Bewältigung von Affekten spielt der Begriff bzw. das Phänomen des Uraffekts eine zentrale Rolle. Dieser Terminus, der maßgeblich von Heigl-Evers (1977, 1980 in Rost 1992) und von Krystal und Raskin (1970 in Rost 1992) geprägt wurde, bezieht sich auf das Entwicklungsstadium beim Säugling, in dem die ersten sich ausdifferenzierenden Gefühle wie Schmerz und Angst noch eng assoziiert sind mit dem Bedürfnis „Hunger“ und im Grunde eine psychosomatische Erlebniseinheit bilden, d. h. unangenehme Gefühle wie Angst und Schmerz werden 26 unmittelbar auch als körperlicher Schmerz wahrgenommen. Affekte werden in körperliche Symptome bis hin zum psychogenen Schock umgeformt: „Das Kind ist leicht in Todesangst versetzbar, in eine enorme, überwältigende, tödliche Angst, aufgefressen, verschlungen zu werden. Diese Todesangst ist verbunden mit einem Gefühl der Hilflosigkeit, der Immobilität, der Erstickung (vgl. Heigl-Evers 1977 in Rost 1992). Diese Angst bzw. der Uraffekt spielt für die Theorie der Sucht eine wichtige Rolle. Kohut (1966 in Rost 1992) prägte den Begriff der Selbstpsychologie. Er verstand das Selbst als den konstituierenden Teil, den Kern der Persönlichkeit. In der Suchtdiskussion legte er das Hauptaugenmerk auf die Grandiositätsfantasien und den Selbstheilungscharakter der Droge, womit er an ich-psychologische Annahmen anknüpfte und diese weiter ausbaute. So sieht er als prädisponierenden Faktor der Suchtentwicklung eine narzisstische Störung, also eine Störung des Selbstwertgefühls, in Folge einer misslungenen Beziehungsgestaltung zwischen dem Kind und seinen primären Bezugspersonen. Wesentlich sind für ihn dabei nicht die ungelösten Konflikte des süchtigen Menschen, „sondern das Vorhandensein struktureller Defekte, die das Drogenerlebnis ausfüllen sollen“ (Kuntz 2009, S. 25ff.). Kohut bezieht sich auf ein Entwicklungsstadium des Kindes, in dem es zur Aufrechterhaltung seines Selbst auf die unbedingte Anwesenheit und empathische Zuwendung seiner primären Bezugspersonen (Selbst-Objekte) angewiesen ist. Bleibt diese aus oder fehlt sie sogar gänzlich, ist das Kind mit dem Verlust seiner psychischen Struktur konfrontiert. Um diesen Selbst-Verlust und damit die drohende Auflösung des Selbst zu verhindern, greift das Kind auf orale, anale und phallische Masturbation zurück oder es benutzt Fantasien. Damit versucht es, das abwesende Selbst-Objekt gewissermaßen zu ersetzen und damit die eigene psychische Struktur aufrecht zu erhalten. Nach Kohut stellt der Drogenkonsum vor diesem Hintergrund den kindlichen Versuch dar, das empathische Objekt bzw. die nicht hinreichend ausgebildete psychische Struktur zu ersetzen. Der objektpsychologische Ansatz stellt besonders den selbstzerstörerischen Charakter der Sucht in den Vordergrund und beschreibt am besten das autodestruktive Geschehen, welches in seiner Gesamtpathologie zwar nicht bei allen Süchtigen, jedoch in der Tendenz bei einer Vielzahl von Betroffenen vorhanden ist. Im objektpsychologischen Konzept ist eine Richtung der Psychoanalyse vertreten, die das „interaktionistische Prinzip“, also die Umweltbezogenheit des Kindes in den Vordergrund stellt. Die Identitätsentwicklung des Kindes, also der Übergang von der Ein- zur ZweiPersonen-Welt, in Abhängigkeit von der primären Mutter-Kind Beziehung, steht dabei 27 im Betrachtungsfokus, demgegenüber steht der ödipale Konflikt in der Psychoanalyse, der die Entwicklung von der Zwei- zur Drei-Personen-Welt beschreibt. Der nachgeburtliche Zustand des Kindes ist gekennzeichnet durch eine primäre Symbiose, eine Mutter-Kind-Verbindung, die eine Fortsetzung des intrauterinen Zustandes darstellt, in dem die Mutter in ihrer „primären Mütterlichkeit“ (vgl. Winnicott in Rost 1992) Nahrung, Schutz und Geborgenheit bereit hält. Der Säugling erlebt die Mutter und sich nicht als voneinander getrennt, sondern als Einheit, er sieht sich als den „Schöpfer aller Dinge“ („primärer Narzissmus“). Die objektpsychologische Theorie geht dabei von zwangsläufig eintretenden frustrierenden Erfahrungen aus, die den paradiesischen Zustand des Kindes beenden und Mechanismen psychischer Kompensation in Gang setzen. Diese sind im Wesentlichen die Identifikation mit dem frustrierenden Objekt (dem Aggressor) und dessen Internalisierung, um es besser beherrschbar zu machen bzw. magische Kontrolle darüber zu erlangen. Über die Errichtung eines guten Objekts, das alle positiven Erfahrungen verkörpert und bewahrt, wird das innere Gleichgewicht wiederhergestellt. Das gute und das böse Objekt können jedoch, zum Schutz der guten Brust, nicht als ein- und dieselbe Person gesehen werden und werden voneinander ferngehalten. Entscheidend für die gesunde, stabile Entwicklung der Persönlichkeit ist die Internalisierung des guten Objekts. Der innere Ambivalenzkonflikt durch das Nebeneinander guter und böser Teilobjekte kann durch die feste Verbindung mit einer vorwiegend liebevoll, haltenden, zärtlichen erlebten Mutter sicher gehalten werden und bildet so die Basis für ein stabiles Ich (vgl. von Minden 1978 in Rost 1992). Durch hinreichend positive Erfahrungen mit der Mutter kann eine Identifikation mit dem Idealobjekt stattfinden, auf deren Grundlage das Kind lernt, die „gute und die böse Brust“ als Bestandteile ein- und derselben Person anzusehen bzw. zu akzeptieren. Eine frühzeitige Störung dieser Entwicklung durch Vernachlässigung, mangelndes Eingehen auf kindliche Primärbedürfnisse, frühe Gewalt- und Missbrauchserfahrungen und permanentes Erleben des Abgelehntseins verhindern die Ausbildung einer stabilen Selbstwertschätzung. Winnicott spricht in diesem Zusammenhang von der Ausbildung eines „falschen Selbst“: „Das Kind wird dann in eine falsche Existenz gezwungen, zum Sichfügen verführt; es reagiert auf die Anforderungen der Umwelt und baut sich ein falsches System von Beziehungen auf. Das falsche Selbst ist dann von Gefühlen der Unwirklichkeit und der Nichtigkeit gekennzeichnet, vermag nicht zu seinen wirklichen Bedürfnissen zu finden, während das ‚wahre Selbst‘ sich kreativ und real fühlen kann“ (Winnicott in Rost 1992, S. 82). 28 2.3.2 Sucht in systemischer Perspektive Nach systemischem Verständnis entwickelt sich eine Sucht im Zusammenspiel bzw. im Gefüge von Beziehungs- und Kommunikationsstrukturen. Somit stellen systemische Ansätze eine wichtige Grundlage für ein Verständnis der Komplexität und Interdependenz von Rollen- und Strukturmerkmale in Suchtsystemen dar. Die Familie gilt in systemischer Perspektive als Sozialsystem, das in einem Austauschprozess und in Wechselwirkung mit anderen Sozialsystemen steht (Arbeitswelt, öffentliches Leben etc.). Nicht nur die Kernfamilie (Vater, Mutter, Kind), sondern auch die Herkunftsfamilie der Eltern, frühere Ehepartner oder eheähnliche Beziehungen und Kinder aus diesen Verbindungen gelten als Teil der Familie, der Einfluss auf das Geschehen in der Kernfamilie nimmt. Der Suchtpatient wird in systemischer Sicht als Indexpatient (I. P.) bezeichnet, d. h. er ist derjenige, auf den die Etikettierung weist bzw. der die Störung austrägt, er ist jedoch gleichzeitig Repräsentant eines dysfunktionalen Familien- oder Beziehungssystems und folglich Symptomträger einer häufig, bereits vor Ausbildung des problematischen Suchtmittelkonsums, bestehenden familiären Problematik. Gemäß den Prämissen systemischer Grundsätze stehen nicht die Absichten des Symptomträgers im Fokus, sondern die Auswirkungen, die das Symptom in Beziehungen auslöst. Im Mittelpunkt steht also nicht die Beschäftigung mit der Frage, was der Abhängige mit seinem Suchtverhalten beabsichtigt, sondern welche Bedeutung das Symptom im Beziehungskontext erhält. Weiterhin gehen die Systemtheoretiker von der Prämisse aus, dass ein längere Zeit stabil auftretendes Symptom bewirkt, dass die Handlungen der Beteiligten im Beziehungsfeld des Indexpatienten sich so um das Symptomverhalten gruppieren bzw. sich darauf eingestellt haben, dass sie wiederum in der Rückkoppelung ebenfalls stabilisierend darauf wirken. Der systemischen Sichtweise geht es dabei keinesfalls um die Bagatellisierung bzw. Verleugnung des Leids und der destruktiven Begleiterscheinungen von Suchtverhalten. Das verzweifelte Bemühen der Betroffenen, den Kreislauf zu durchbrechen, wird gewürdigt und anerkannt. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass häufig gerade diese Versuche einer Lösung das Problem verstärken (vgl. Watzlawick et al. 1974 in Körkel 1988, S. 176). In systemischer Perspektive verfügt die Familie über zwei Grundstrebungen, die ihren Erhalt bzw. ihren Fortbestand sichern sollen. Da ist zum einen die Fähigkeit, umweltbedingten Anforderungen konstanzerhaltende Strukturen entgegenzusetzen. Dieser 29 Vorgang wird als Morphostase bezeichnet. Im Gegenzug geht es um die Fähigkeit des Familiensystems, sich den alltäglichen Anforderungen sowie den Entwicklungsaufgaben des Lebenszyklus (wie Geburt, Heranwachsen der Kinder etc.) anzupassen. Diese Flexibilität einer Familie, ihre Grundstrukturen dahingehend zu verändern, dass eine Anpassung an neue Bedingungen und Beziehungen erfolgen kann und damit das Gesamtsystem seine Stabilität wiedererlangt, wird als Morphogenese bezeichnet. Ein flexibles Gleichgewicht zwischen morphostatischen und morphogenetischen Kräften gilt dabei als „optimal“ und wird als Homöostase bezeichnet. Ein vorübergehendes Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Kräften stellt zunächst einmal nichts Ungewöhnliches dar, insbesondere wenn die Familie mit einschneidenden Lebensereignissen wie beispielsweise dem Auszug eines Kindes aus der elterlichen Umgebung konfrontiert ist. Ist jedoch das Ungleichgewicht massiv und von längerer Dauer, ist die Wahrscheinlichkeit einer Symptomentwicklung groß. In sogenannten Alkoholikerfamilien kommt es zu einer dauerhaften Verschiebung des beschriebenen Kräftegleichgewichts. Ein Übergewicht an morphostatischen Kräften, also ein geringes Maß an Wandlungsfähigkeit und Flexibilität mit starren und undurchlässigen Grenzen zur Außenwelt, welche zur Isolation führen kann, ist im systemischen Verständnis kennzeichnend für Alkoholikerfamilien. Die Starrheit und Undurchlässigkeit nach außen hin sind zu einem wesentlichen Teil der Binnenstruktur der Familie geschuldet, für die wiederum ein hohes Maß an Vermischung, Bündnissen und Koalitionen (sogenannte „intergenerationale Bündnisse“, Parentifizierung der Kinder) kennzeichnend ist. Im Zentrum steht der Suchtmittelabhängige, der, neben dem elterlichen und dem kindlichen Subsystem, durch seine Beziehung zum Suchtmittel ein weiteres Teilsystem etabliert: „Der Alkoholiker rotiert um die Flasche und die Familie dreht sich um ihn herum. Je mehr der Alkoholiker sich in seinem symmetrischen Kampf mit der Flasche verstrickt, desto weniger Verantwortung übernimmt er im Familiensystem, die nun von den übrigen Familienmitgliedern übernommen wird“ (Albrecht 1997, S. 124ff.). Die daraus resultierende Verschiebung des Mächte- bzw. Kräftegleichgewichts in der Familie fordert dem Einzelnen ein hohes Maß an Flexibilität ab. Von dem Bedürfnis bzw. der inneren Notwendigkeit geleitet, ein Mindestmaß an Orientierung, Sicherheit und Vorhersehbarkeit in diesem „Chaos“ wieder zu erlangen, wird versucht die Homöostase über die Etablierung von typischen Rollen und starren Funktionalitäten wiederherzustellen. Durch Einflüsse von außen kann das mühsam erkämpfte dysfunktionale Gleichgewicht potenziell immer wieder in Frage gestellt werden. Die Außenwelt wird daher unbewusst als dieses Gleichgewicht 30 störend, irritierend und bedrohend wahrgenommen, weshalb sich das Familiensystem nach außen hin vor „Fremdem“ schützt. Dies bindet letztlich so viel Energie, dass die Anpassungs- und Veränderungsfähigkeit des Systems erheblich beeinträchtigt sind: „Es ist ja gerade ein Charakteristikum der Alkoholikerfamilie, dass ihre kohäsiven (Bindungs-)Kräfte extrem stark, die Fähigkeiten zur Veränderung (Adaptabilität) aber nur schwach ausgeprägt sind“ (Albrecht 1997, S. 125). Auch Veränderungen innerhalb des Familiensystems z. B. durch die Abstinenz des Suchtmittelabhängigen, bedrohen den morphostatischen Zustand. Um den Status quo aufrecht zu erhalten, kann der für Außenstehende häufig schwer nachzuvollziehende Umstand eintreten, dass trotz bestehender Abstinenz des Suchmittelabhängigen, weiterhin in dysfunktionalen Strukturen verharrt wird. 31 2.3.3 Lerntheoretische Erklärungsmodelle zur Sucht Lerntheoretische Modelle erklären die Entstehung und Aufrechterhaltung von Sucht vor dem Hintergrund lerntheoretischer Gesetzmäßigkeiten. Einen zentralen Bereich bilden dabei die verhaltenstherapeutischen Modelle klassischer und operanter Konditionierung, die den Automatismus der Suchtspirale abbilden. Das operante Konditionieren gründet auf dem Prinzip „Lernen am Erfolg“: Verhalten mit unmittelbar positiven Effekten wird wiederholt, Verhalten mit negativen Folgen wird vermieden. Die Grundlage bildet dabei das von Kanfer und Saslow (1965) entwickelte Modell der Verhaltensanalyse. Süchtiges Verhalten wird hiernach in einem Bedingungsgefüge von situativen Merkmalen, Organismusvariablen und positiven bzw. negativen Konsequenzen (die als positive oder negative Verstärker wirken) begriffen. Eine sozial gehemmte Person macht beispielsweise die Erfahrung, dass sie unter Alkoholeinfluss entspannter und folglich leichter mit Menschen in Kontakt treten kann. Die erzielte positive Verhaltenskonsequenz infolge des Trinkens erhöht die Wahrscheinlichkeit für die Wiederholung des Trinkens. Die klassische Konditionierung beschreibt das Prinzip des „Signallernens“, womit die Kontextbezogenheit des Drogenkonsums durch konstante situative Faktoren verdeutlicht werden soll. Das Auftreten eines mit dem Suchtstoff assoziierten, konditionierten Auslösereizes („cues“) kann z. B. das süchtige Verlangen reaktivieren. So besteht auch nach jahrelanger Abstinenz die beobachtbare Tendenz, dass mit dem Suchtverhalten gekoppelte Reize, wie z. B. eine Spritze bei Heroinabhängigen, Entzugssymptomatik auslöst. Suchtverhalten wird im Sinne der lerntheoretischen Ansätze auch durch das „Lernen am Modell“, in Folge der Nachahmung und Identifikation mit Modell-Personen, gefördert. So beschrieb Bandura (1979), dass die ersten Alkoholerfahrungen meist im familiären Kontext oder in Peergroups gemacht werden und 1 % der männlichen Bevölkerung bereits vor dem 6. Lebensjahr Erfahrungen mit Alkohol, also mit einem „Modell“, gemacht haben. 32 2.3.4 Co-Abhängigkeit – Entstehungsgeschichte und Hintergründe Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Co-Abhängigkeit“? Die Begriffserläuterungen bzw. Definitionen sind zahlreich, mit unterschiedlichen Akzentuierungen aber auch vielen Überschneidungspunkten. Dabei fließen die individuellen Prägungen, Erfahrungs- und beruflichen Hintergründe der Autoren ebenso ein, wie gesellschaftliche Strömungen und Tendenzen der jeweiligen Zeit. Das Konzept der Co-Abhängigkeit unterlag im Laufe der Zeit starken Wandlungen und wurde von Betroffenen und Fachkreisen immer wieder neu definiert. Die Beschäftigung der Fachwelt mit dem Begriff der Co-Abhängigkeit hat leider wenig zu einer echten Annährung an die Situation Betroffener beigetragen, als vielmehr zu deren Stigmatisierung und Pathologisierung. Bereits Goffman (siehe auch Kapitel 3.4) beschrieb das Stigma der Angehörigen als sog. „assoziiertes Stigma“ oder „Courtesy Stigma“: „Darunter versteht er die Situation von Menschen, die durch die Sozialstruktur mit einer stigmatisierten Person verbunden sind. Damit sind sie als Angehöriger selber auch der Diskreditierung der mit ihnen verwandten oder anderweitig verbundenen Personen ausgesetzt: das Stigma färbt sich gleichsam auf die Angehörigen ab“ (Nieuwenboom in SuchtMagazin 01/2012, S. 19). In den 1960er und 1970er Jahren dominierte im Bereich psychodynamisch orientierter Konzepte eine defizitäre, entwertende Sicht auf die Familie von Süchtigen, insbesondere die Situation der Ehefrauen von Alkoholabhängigen wurde stark pathologisiert. Die 1953 von Wahlen (vgl. Kläusler-Senn u. Stohler in SuchtMagazin 01/2012) beschriebene Typen-Einteilung von Ehefrauen alkoholabhängiger Männer – „Suffering Susan“, „Controlling Katherine“, „Wavering Winifred“ und „Punitive Polly“ – veranschaulicht dies eindrücklich: „Psychodynamisch orientierte Studien bis in die 60er und 70er Jahre suchten nach Störungen innerhalb der Persönlichkeit der Alkoholiker Ehefrauen als Erklärung für ihre unbewusste, neurotische Wahl eines Problemtrinkers als Ehemann“ (Kläusler-Senn und Stohler in SuchtMagazin 01/2012). Der in den 1950er Jahren aufkommenden Familientherapie kommt der Verdienst zu, den Blickwinkel vom Individuum auf die Familie als zentrales Bedingungsgefüge von Störungen erweitert zu haben. Im Vordergrund stand jedoch nach wie vor eine pathologie-zentrierte Sichtweise: „Auch Eltern drogenabhängiger Jugendlicher wurde lange Zeit generell misstraut. Verdeckte Paarkonflikte oder verstrickte Beziehungen galten als suchtauslösend und -verstärkend. Diese Aussagen besitzen zwar heute noch eine gewisse Gültigkeit, jedoch nicht in der damals angenommenen monokausalen 33 Verknüpfung zwischen pathogenem familiärem Interaktionsmuster und Symptom“ (Kläusler-Senn und Stohler in SuchtMagazin 01/2012, S. 5). Die Autoren betonen in diesem Zusammenhang, dass die in den 1980er und 1990er Jahren in stationären Drogentherapien verbreiteten strikten Kontaktsperren der Patienten zu ihren Herkunftsfamilien vor dem Hintergrund zu verstehen sind, dass nunmehr die Familien der Süchtigen zu den „eigentlichen Patienten“ deklariert wurden. Der Terminus Co-Abhängigkeit ist ein recht „neuer“ Begriff und stammt ursprünglich aus den USA („co-dependency“). Er ist eng verbunden mit der Selbsthilfebewegung der Al-Anon, der Angehörigen suchtmittelabhängiger Menschen, die den Begriff in den 1970er Jahren prägten, verbunden mit dem Wunsch die Weiterentwicklung der Thematik voranzutreiben. Der eigenen Mitbetroffenheit sollte Ausdruck verliehen werden und neben dem persönlichen Leid stand im Vordergrund, die Initiative für das eigene Leben wieder in die Hand zu nehmen, um sich der Sucht der alkoholkranken Person gegenüber weniger hilflos bzw. ausgeliefert zu fühlen. Die ersten Veröffentlichungen in der Fachliteratur zu dem Thema stammten entsprechend von Betroffenen, von erwachsenen Kindern alkoholabhängiger Eltern, die selbst in die professionelle Suchtkrankenhilfe gegangen sind. Die Angehörigen Suchtkranker bezeichneten sich häufig selbst als krank, was eine paradoxe Entwicklung pauschaler und einseitiger Schuldzuweisung gegenüber Angehörigen nach sich zog: „Begriffe wie Enabler wurden verwendet, um vordergründig als Unterstützung motiviertes Verhalten von Angehörigen als co-abhängig zu klassifizieren“ (Ruckstuhl in SuchtMagazin 01/2012, S. 16). Cermak ging 1986 sogar so weit, von einer co-abhängigen Persönlichkeitsstörung in Anlehnung an die Kriterien des DSM-III R, zu sprechen. Die Existenz einer coabhängigen Persönlichkeitsstörung konnte jedoch in wissenschaftlichen Studien nicht nachgewiesen werden (vgl. Rennert in Thomasius u. Küstner 2005, S. 46) In der weiteren Entwicklung des Begriffs Co-Abhängigkeit wurde dieser immer häufiger, ohne weitere Differenzierung, als Bezeichnung für abhängige Beziehungen verwandt. Begriffe wie „Liebessucht“, „Beziehungssucht“ oder „der Sucht gebraucht zu werden“ wurden zunehmend populärwissenschaftlich undifferenziert verwendet: „Die völlig undifferenzierte Verwendung des Begriffs legt schließlich die Vermutung nahe, damit sei nichts anderes benannt, als eine extrem ausgeprägte Folge von typisch weiblicher Sozialisation. Dies hat mit Co-Abhängigkeit im ursprünglichen Sinne nichts mehr zu tun“ (Rennert in Thomasius u. Küstner 2005, S. 46). Allmählich erregte die Thematik auch die Aufmerksamkeit der deutschsprachigen Fachöffentlichkeit, jedoch bedauerlicher Weise nicht in der Form wissenschaftlicher 34 Erforschung der Angehörigenproblematik bzw. der Etablierung alltagspraktischer und niedrigschwelliger Angebote für die Gruppe der Betroffenen. Der wenig systematisch und unzureichend differenziert geführte öffentliche Diskurs reduziert sich laut Flassbeck (2010) treffend auf „wohlfeile Forderungen von Fachmenschen, Verbänden und Politik“ sowie auf die Erweiterung der Angebotspalette von Suchtberatungsstellen um den Begriff der Angehörigen: „Manche Suchtberatungsstelle nahm den Begriff der Angehörigen als Anhängsel in ihren Einrichtungstitel auf“, (ebd., S. 21). De facto reduziert sich die Beratung von Angehörigen in Suchtberatungsstellen in der Praxis erfahrungsgemäß auf die Weitervermittlung bzw. den Hinweis auf Selbsthilfegruppen für Angehörige wie beispielsweise Al-Anon. Die Gründe hierfür sind vielfältig und zumindest auf der Ebene der praktischen Arbeit mit Süchtigen auch Ergebnis unzureichender finanzieller Spielräume und knapper zeitlicher Ressourcen, die eine intensivere Hinwendung bzw. Beschäftigung in dem notwendigen Umfang nicht zulassen. In seinem Buch „Co-Abhängigkeit – Diagnosen, Ursache und Therapie für Angehörige von Suchtkranken“ liefert der Autor Jens Flassbeck eine differenzierte Betrachtung des Phänomens Co-Abhängigkeit (ebd. 2010). Eine zentrale These Flassbecks betrifft die in Fachkreisen und in der Suchtbehandlung im Wesentlichen suchtzentrierte Sichtweise, die das Verhalten von Angehörigen größtenteils in seinen Auswirkungen auf den süchtigen Symptomträger fokussiert: „Eine solche auf den Suchtkranken zentrierte Sichtweise degradiert die Angehörigen zum sozialen Anhängsel der Süchtigen. Die Angehörigen werden als Mittel zum Zweck funktionalisiert, indem sie allein deswegen (mit-) behandelt werden, um den Therapieerfolg der süchtigen Klientel zu erhöhen“ (Flassbeck 2010, S. 19). Dabei geht es dem Autor nicht darum, die Wirksamkeit der Einbeziehung von Angehörigen in die Suchttherapie in Frage zu stellen, sondern, im Sinne einer stärker angehörigenzentrierten Sichtweise, dafür zu sensibilisieren, dass das Leiden und der Unterstützungsbedarf der Angehörigen als eigenständige Größe überhaupt wahrgenommen und anerkannt werden. Ebenfalls zentral ist die These Flassbecks, dass Angehörige durch ihr Verhalten zwar unbeabsichtigt zu einer Stabilisierung der Suchtproblematik beitragen können. Der Autor distanziert sich jedoch von der darin enthaltenen Pauschalisierung und Verurteilung. Oder anders ausgedrückt: Beim Umgang der Angehörigen mit der Suchtproblematik handelt es sich zunächst um eine „normale“ Reaktion auf ein „un-normales“ Verhalten. Wechselnde Gefühlszustände zwischen Ohnmacht, Wut, Hilflosigkeit, Scham, Hoffnung und Trauer sind kein Ausdruck von psychischer Labilität oder gar Krankheit, sondern es handelt sich um „die gesunde Reaktion eines psychisch intakten Menschen, der mit einer überfordernden, irrationalen, labilen, nahegehenden 35 Problematik konfrontiert ist.“ (Flassbeck 2010, S. 35). Diese Sichtweise Flassbecks deckt sich mit neueren Ansätzen zur Suchtforschung, die die Pathologisierung und Stigmatisierung von Angehörigen kritisch in den Fokus nehmen: „Dabei sollte eines nicht außer Acht gelassen werden: Was häufig als co-abhängig bezeichnet wird oder wurde, ist in erster Linie eine normale Verhaltensweise, die jeder gesunde Mensch, der einen anderen liebt, an den Tag legen würde. Auch der verstärkte Fokus auf die suchtkranke Person und der unbedingte Wunsch helfen zu wollen sind verständliche, normale Reaktionen, können aber eine problematische Entwicklung nehmen“ (Ruckstuhl in SuchtMagazin 01/2012, S. 18). 2.4 Persönlichkeitsstörungen Persönlichkeitsstörungen sind gekennzeichnet durch Verhaltensauffälligkeiten, die gesellschafts- und normabhängig sind. Mit dem gesellschaftlichen Wandel verändert sich auch das Bild von Persönlichkeitsstörungen. Man unterscheidet drei Gruppen: Cluster A: sonderbare und exzentrische Persönlichkeiten; Cluster B: antisoziale, narzisstische und histrionische Persönlichkeiten;. Cluster C: ängstlich-vermeidende und selbstunsichere Persönlichkeiten. Die Begriffe „Symptom“ und „Persönlichkeitsstörung“ sind deutlich voneinander abzugrenzen. Ein Symptom kommt wie von außen und bricht in die Persönlichkeit ein. Merkmale einer Persönlichkeitsstörung kommen schleichend, etablieren sich, ohne dass die Person es selbst merkt. Die anderen sind irritiert, stellen Fragen oder setzen sich zur Wehr. Persönlichkeitsstörungen sind vor allem an anhaltenden Beziehungsstörungen und konstanten Beziehungsmustern zu erkennen: • Das schizoide Beziehungsmuster: mit dem Ziel, sich aus allen emotionalen Ansprüchen und Verwicklungen herauszuhalten; • Das anankastische Beziehungsmuster: mit dem Ziel, die Beziehungen nach den eigenen Regeln zu formen und zu ordnen; • Das dissoziale Beziehungsmuster: mit dem Ziel, Rechte anderer außer Kraft zu setzen, z. B.: in Gewaltbeziehungen. 36 2.4.1Narzissmus Die Literatur zum Thema Narzissmus ist sehr umfangreich. Hier werden in knapper Form sechs Bereiche psychischen Lebens vorgestellt werden, an denen eine narzisstische Persönlichkeit beschrieben werden kann: Das Selbstkonzept ist getragen von Grandiosität. Die interpersonellen Beziehungen sind oft oberflächlich, es gibt ein intensives Bedürfnis nach Zuwendung von einer Seite und Verachtung der anderen, die meisten Beziehungen sind gekennzeichnet durch einen Mangel an Empathie. Die soziale Anpassung ist einseitig, die Menschen sind oftmals erfolgreich, tun aber viel, um bewundert zu werden. Sie achten besonders auf ihre äußere Erscheinung. Die ethischen Auffassungen sind oft durch eine karikierte Bescheidenheit gekennzeichnet und zur Schau getragene Moralvorstellung. Liebe und Sexualität sind gekennzeichnet durch kalte und gierige Verführungen, bis hin zur Promiskuität. Ehekrisen sind an der Tagesordnung. Der kognitive Stil beeindruckt durch Kenntnisse, die Person artikuliert auffällig und hat eine exzentrische Wahrnehmung der Realität. Im alltagssprachlichen Umgang sind Persönlichkeitsstörungen oft gleichgesetzt mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen oder mit Borderline-Störungen. Narzisstische Persönlichkeitsstörungen müssen jedoch abgegrenzt werden von Borderline-Persönlichkeiten. Ein Unterschied besteht in der Kohäsion: Bei einer narzisstischen Störung ist das Selbst deutlich kohäsiver und läuft weniger Gefahr, regressiv zu fragmentieren, wie das bei der Borderline-Persönlichkeit der Fall ist. Hier ist das Selbst wenig integriert und immer wieder bedroht, sich in einer Psychose ähnlichem Zustand aufzulösen und zu zerfallen. Die diffuse Identität ist bei Borderline-Persönlichkeiten wesentlich größer als bei narzisstischen Persönlichkeiten, obwohl sie auch bei diesen verdeckt vorhanden sein kann. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zeigen darüber hinaus größere Impulskontrolle, wozu Aggression und Angst zu zählen sind. Unter narzisstischer Persönlichkeitsstörung wird in der Regel folgendes verstanden: • ein übertriebenes Gefühl des Selbstwertes und der Einmaligkeit; • eine Beschäftigung mit Phantasien von grenzenlosem Erfolg und Macht, Glanz, Schönheit und Liebe; 37 • Exhibitionismus, verstanden wird ein Verlangen nach Aufmerksamkeit und Bewunderung; • Kühle Gleichgültigkeit oder massive Gefühle von Zorn, Minderwertigkeit und Scham. 2.4.2 Operationalisierte psychodynamische Diagnostik: OPD Gerd Rudolf und seine Forschergruppe haben das OPD entwickelt, die Operationalisierte psychodynamische Diagnostik und das dazu gehörende Manual (zuerst erschienen 1996). Sie sehen in den Persönlichkeitsstörungen strukturelle Folgen früher, sehr früher Beziehungskonflikte. Im Fokus stehen das Selbst und seine Beziehungen zu anderen Menschen. Dieser neue Ansatz bietet einen psychodynamischen Zugang mit dem Anspruch zu verstehen, warum und mit welchem Ziel der Patient diese Muster entwickelt hat. Persönlichkeitsstörungen werden auf einem Kontinuum angesiedelt: auf der einen Seite gibt es neurose-nahe, auf der anderen Seite psychose-nahe Störungsbilder. Die neurose-nahe Persönlichkeitsstörung hat chronifizierte, im Charakter verankerte Abwehrformen, wobei die neurotische Dynamik die ganze Person ergriffen hat, sie ist z. B: selbstunsicher, passiv-aggressiv. Die psychose-nahe Persönlichkeitsstörung weist vulnerable oder defizitäre Entwicklungen zentraler Persönlichkeitsfunktionen auf und daraus folgen – in der Regel dysfunktionale – Stabilisierungsversuche. Das Beziehungsmuster ist stabil, dennoch sind die Beziehungen und Stimmungen schwankend, oft sind die Emotionen unkontrollierbar und es können tiefgreifende Identitätsstörungen dabei sein. Dem Modell liegen folgende Beobachtungen zugrunde: • In der Therapie wurden große emotionale Probleme festgestellt bei gleichzeitiger fehlender Compliance; • Krisen sind allgegenwärtig und können immer wieder bis zur Suizidalität gehen; • Viele Symptome sind therapieresistent; • Behandlungsabbrüche kommen deutlich oft vor. 38 Zur Diagnostik werden fünf Achsen unterschieden: 1. Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzung: Schwere und Dauer des Symptoms im Verhalten, Erleben durch den Patienten, eigene Konzepte und Krankheitstheorien des Patienten, Veränderungsressourcen und -hemmnisse. 2. Beziehungsmuster: Wie erlebt der Patient sich selbst, wie andere? Wie erleben andere – auch der Therapeut – den Patienten? Welches Beziehungsangebot geht von ihm aus, welche Beziehungsantworten legt er nahe? Welche Steuerung übernimmt er? 3. Das Leben des Patienten bestimmende Konflikte: bewusste wie unbewusste, akute oder strukturelle oder chronische Konflikte, Selbstwertkonflikte, Schuldkonflikte, Identitätskonflikte, ödipale Konflikte. Welches ist der Hauptkonflikt und welches ist die bevorzugte Bearbeitung? 4. Strukturniveau: die Fähigkeiten des psychischen Funktionierens. Die Bezüge zum Selbst und zu den Objekten werden anhand folgender Kriterien überprüft: • Selbstwahrnehmung: Wie vertraut ist eine Person mit ihrem Selbstbild? Kennt sie unterschiedliche Affekte, z. B. einen Grundaffekt? • Selbststeuerung: Wie geht sie mit Handlungsimpulsen um? Wie regulierbar und steuerbar sind Affekte? • Abwehr: Unreife Mechanismen. Mehr interpersonelle als intrapsychische Abwehr? • Kommunikation: Können Emotionen ausgedrückt und entsprechend symbolisiert werden? Werden kommunikative Signale anderer verstanden? Kann der Patient abwesende Menschen psychisch präsent halten? • Bindung: Gibt es (Mangel an) internalisierten Objekten? Können die Objekte losgelassen werden? Können sie auch bei Abwesenheit psychisch präsent gehalten werden? 5. Psychische und psychosomatische Störungen. Hierbei orientiert man sich am ICD 10 (International Classification of Diseases). 39 2.5Trauma Unter Trauma versteht man ein Erlebnis besonderer Intensität, dass die psychischen Verarbeitungsmöglichkeiten der Person überschritten werden. Das können kurze Ereignisse ebenso sein wie lang andauernde Situationen, z. B. Unfälle, Vernachlässigung und Gewalt, Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit durch eine lebensbedrohliche Krankheit, kriminelle Gewalttaten. In der Regel lösen starke Ereignisse Fluchttendenzen oder Kampfbereitschaft aus – bei einem Trauma sind beide Möglichkeiten nicht mehr gegeben. Mit dieser Definition ist klar, dass es nicht so sehr die objektiven Bedingungen als die subjektiven Erlebnisweisen sind, die aus einem Ereignis ein traumatisierendes Ereignis machen. Angst, Schrecken und Hilflosigkeit, das Gefühl des Überwältigtwerdens führen zum Zusammenbruch der zentralen Ich-Funktionen und damit zu einer Erschütterung des psychischen Apparates. Die exogene Energie kann ungehindert in die psychische Struktur eindringen. Die Instanzen und die Bindungsfähigkeit des Ich werden aufgehoben und damit die Abwehr lahmgelegt. Bei starken Erschütterungen aber hat die Abwehr eine überlebenswichtige Funktion. Was disponiert äußere Gefahren dazu, traumatisch zu sein oder traumatisierend zu wirken? • Die mangelnde Antizipation: die Person kann sich nicht darauf einstellen. • „Sprachverwirrung“: z. B. das Kind spricht die Sprache der Eltern bei Zärtlichkeit und kann nicht einschätzen, wann aus Zärtlichkeit Trieb, Sexualität oder Macht wird. • Gewalt und Aggression sprengen den Erfahrungsrahmen. • Dehumanisierung: Ein Mensch wird in seinem Selbstwert erniedrigt. Geschehnisse sind dann kein Trauma, wenn die Eigenständigkeit des Menschen erhalten bleibt. Wenn der Einfluss durch Rohheit und Gewalt geprägt ist, kommt es in der Regel zu Vernichtungsangst. 40 Bei diesen Überlegungen wird der strukturelle Aspekt der Psyche deutlich: Je stabiler und ausgereifter eine Persönlichkeit ist, umso größer sind die Möglichkeiten, Erfahrungen psychisch zu repräsentieren, d. h. innerseelisch zu verarbeiten z. B. durch Sprache, Bilder, Bewegungen. Repräsentation heißt: Erfahrungen, die im Gedächtnis niedergelegt sind, können erinnert werden, ohne dass sie gleich wiederholt werden müssen. Man kann sie mit Affekten besetzen und kann diese ausdrücken, ohne sie inszenieren zu müssen. Das ist gleichbedeutend mit psychischer Stabilität. Psychische Stabilität entsteht durch: • Kognitive Fähigkeiten • Gute und stabile Bindungsfiguren, weil diese helfen, die unlustvollen Erfahrungen auf der Hintergrundsicherheit zu bewältigen. Fehlen diese Bindungsfiguren, so gibt es möglicherweise trotz kognitiver Fähigkeiten keine Absorptionsmöglichkeiten für Emotionen (siehe Borderline-Struktur). • Wichtig sind „geschützte Mangelerfahrungen“. Kein Mensch kann bewahrt werden vor traumatisierenden Ereignissen, aber wie sie von den Bezugspersonen abgefedert werden oder nicht: das macht den Unterschied. • Symbolisierungen und Symbolisierungsfähigkeiten helfen dabei: Man kann unterscheiden zwischen dem Wort und dem Ding, zwischen dem Repräsentierten und der Repräsentation. Die Stärke der Belastung und die Kapazitäten der Verarbeitung stehen also in Wechselwirkung. Auf diesem Hintergrund wird deutlich, dass der Mensch immer versuchen wird, nachträglich Formen der Bewältigung zu finden, da es um die Wiedererrichtung eben des psychischen Apparates geht. Diese Restitutionsversuche des Ich sind für die posttraumatischen Symptome verantwortlich, die nichts anderes sind als die zwanghafte Wiederholung des traumatischen Erlebens z. B. in Form von Träumen, unwillkürlichen Flashbacks oder auch Interessenverarmung zugunsten von grübelndem Suchen oder auch für Re-Inszenierungen, die besonders schwer zu verstehen sind. Bewältigungsversuche von Traumatisierungen können z. B. sein, durch eine Unterwerfung unter den Angreifer die prätraumatische Situation wieder herzustellen. Das geschieht u. U. durch die Übernahme der Affekte des Täters und die Introjektion des Angreifers oder die Identifizierung mit dem Angreifer. 41 Schocktraumata werden wesentlich seltener diagnostiziert, sie sind weniger gravierend als die langen subtraumatischen Überforderungen des Ich, z. B. bei Misshandlung oder Verwahrlosung. Dazu kommt in der Regel, zumindest bei Kindern, das Versagen der elterlichen oder einer externen Schutzfunktion. Wenn bei einem Kleinkind die Abwesenheit der Mutter bereits dazu führt, sich mit ihr zu identifizieren und ihr Bild zu introjizieren, ein notwendiger und gelingender Bindungsschritt, der aus der behutsamen traumatisierenden Situation einen Lernschritt und Lernerfolg macht – umso einleuchtender ist eine wirkungsvolle Traumatisierungen bei massiven Einwirkungen. Die Forschung über Menschen, die im Konzentrationslager waren oder in anderer Weise unter dem Faschismus gelitten haben, die sog. KZ-Forschung, hat viel an Traumaforschung geleistet: Extremtraumatisierungen führen zur „Armierung“ des Ich, das bedeutet zu Handlungsweisen, das nicht von Affekten begleitet wird. Es kommt zum Verlust der narzisstischen Besetzung des eigenen Selbst und der Identifizierung mit dem Narzissmus der Machthabenden oder der Täter. So kann sich das Feindbild im Ich-Ideal festsetzen, was durch Regression, die fast immer bei Verlassenheits- und Schmerzerlebnissen einsetzt, gefördert wird. Grundsätzlich wird beobachtet, dass eine akute Belastung in der Regel ca. 4-6 Wochen dauert. Wenn ein Akuttrauma auf ein verdrängtes Trauma stößt, wird dieses in der Regel wieder geweckt: wenn eine Erinnerung kommt, verschwindet die neue Realität und die alte Geschichte ist wie heute. So kommt es zu Neuinszenierungen von Traumata mit anderen Personen: Es handelt sich um Bewältigungsversuche, für die es nicht reicht zu symbolisieren, also z. B. in Sprache zu fassen, sondern es muss neu in Szene gesetzt werden. Diese Neuinszenierung kann allerdings, wenn die anderen nichts davon verstehen, zu Re-Traumatisierungen führen. Der durch Introjektion in die Persönlichkeit eingedrungene Fremdkörper stellt eine Gefährdung des Ich dar, weil er nur eine Scheinlösung ist und gleichzeitig zur Quelle von Schuld- und Schamgefühlen wird. Eine weitere Lösung ist die Abspaltung: Der „befallene“ (!) Teil des Ich wird vom „nicht infizierten“ Teil abgespalten. Diese Abspaltung führt in der Regel dazu, die Persönlichkeit abrupt oder langsam zu zerstören, weil das Ich immer mehr Kraft aufwendet, die Traumatisierungen zu besänftigen oder zu bewältigen. 42 3. 3.1 Ursachen psychischer Krankheiten: verschiedene Ansätze Rückblick auf das historische Verständnis psychischer Störungen Platon behandelte als erster den Komplex des Wahnsinns. Er unterschied zwei nach Ursachen unterteilte Formen: den durch menschliche Krankheit und den durch göttliche Gabe verursachten Wahnsinn. Die Griechen sahen den Wahnsinn als eine Art von Besessenheit oder Beeinträchtigung des nüchternen Verstandes durch überwältigende Gefühle. Im Mittelalter wurde dem Wahnsinn eine teuflische Herkunft und die Besessenheit oder Verwünschung durch Hexen zugeschrieben. Am Ende des Mittelalters verbreitete sich die Vorstellung eines Kampfes zwischen göttlicher und teuflischer Macht um die Seele, die zur Verwirrtheit führe. Es gab auch immer wieder Vermutungen, dass der „Wahnsinn“ etwas mit dem Gehirn zu tun haben könnte, z. B. sehr früh bei Wilhelm von Conches (etwa 1080-1154 n. Chr.). Ab dem 13. Jahrhundert – nach Michel Foucault – wurde der Wahnsinn als Folge von Laster und Unmoral angesehen. Nun wurden nicht mehr andere Größen wie Gott oder der Teufel, sondern der „Irre“ selbst als Schuldiger und schwacher Mensch für sein Verhalten gesehen. In der Aufklärung herrschte die Deutung einer fehlgeleiteten ursprünglich gesund angelegten Vernunft vor. (vgl. Foucault 1984) Es gab auch Spekulationen, Annahmen und Erkenntnisse über die Ursachen psychischer Störungen auf körperlicher Ebene: zunächst war es die schwarze Galle. Dann wurden aber auch unterschiedliche Teile des Gehirns, die Milz oder das Herz als Krankheitsverursacher oder -ort propagiert. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Bemühungen, den Wahnsinn zu heilen, stärker. Man ging davon aus, dass der Geist und die Seele dem Hirn vollends unterlägen. Man könnte diese Position als erste Vorläuferin moderner Hirnforschung ansehen. Ganz sicher entstand aber über diesen Weg das psychiatrische Paradigma: Krankheiten des Geistes sind Krankheiten des Gehirns, der korrekte Begriff der „Geisteskrankheit“ etablierte sich. Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurden dann mehr Frauen mit dem Phänomen Geisteskrankheit in Beziehung gebracht. Ihnen wurde das Triebhafte zugeschrieben, 43 während Männer (offenbar) weniger triebhaft waren – die Beziehung zwischen Wahnsinn und Sexualität ist hergestellt. Dieser Verbindung wird sich in der Diskussion um die Hysterie verdeutlichen, die vor allem durch Sigmund Freud und seine Kollegen beflügelt wurde. Sie machten scheinbar „die Rolle rückwärts“: Gerade hatte sich das biologische Weltbild, auch in Bezug auf die Geisteskrankheiten, etabliert, da formulierte Freud den Zusammenhang zwischen Traumata und psychischen Krankheiten. Er wandte sich nicht dem biologischen Modell zu, sondern blieb bei der psychischen Erklärung, aber ohne diese These zu vertiefen. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden auf der Suche nach der „reinen, gesunden Rasse“ weniger Untersuchungen zu den Ursachen von Geisteskrankheiten durchgeführt. Es wurden vielmehr Anstrengungen unternommen, die Gesellschaft von den Kranken zu befreien und damit Euthanasie zu ermöglichen und zu rechtfertigen. In den 1950er Jahren wurde verstärkt die Hypothese der biologischen oder medizinischen Ursachen dieser Krankheiten verfolgt, auch Medikamente ermöglichten neue Wege. Am Elend der Lebensbedingungen psychisch kranker Menschen änderte sich aber nichts. 1970 wurde von der Bundesregierung eine Kommission mit der Untersuchung der Lage der psychiatrischen Versorgung in Deutschland beauftragt. Es entstand die Psychiatrie-Enquête, die gravierende Mängel in der Versorgung psychisch kranker Menschen aufdeckte. Ein Umstrukturierungsprozess von den wenigen großen, überfüllten und teilweise menschenunwürdigen Landeskrankenhäusern hin zu mehreren kleineren Einrichtungen begann. Dort sollte das Leben der psychisch Kranken wieder in das normale Leben integriert werden, es entstanden die Versorgungsketten der Sozialpsychiatrie, wie wir sie heute ausdifferenziert kennen. Ein Umdenken vom Ausschluss „Wahnsinniger“ hin zur Integration und Anerkennung psychisch erkrankter Personen hatte – zumindest auf dem Papier – stattgefunden. Ein Prozess, der heute nicht mehr eindeutig weiterverfolgt wird, sondern in der Realität durchaus auch Rückschritte oder zumindest Stagnation in der Versorgung psychisch kranker Menschen und ihrer Angehörigen aufweist. Die Erkenntnis, dass das psychische Wohlbefinden auch von der Umwelt beeinflusst wird, trug wohl zu dieser Veränderung der psychiatrischen Versorgung bei. 44 3.2 Heutiger Stand der Erkenntnisse über Zusammenhänge psychischer Störungen 3.2.1 Mögliche Ursachen psychischer Störungen Nach wie vor sind die Ursachen psychischer Erkrankungen teilweise unklar. Viele Annahmen, Befunde und Theorien zu den unterschiedlichen Erkrankungen beschäftigen die Wissenschaft. Eine monokausale Erklärung wird heute ausgeschlossen und stattdessen die Hypothese verfolgt, dass viele mögliche Einflussfaktoren für die Entstehung einer psychischen Erkrankung verantwortlich sind. Die moderne Psychiatrie geht in der Regel von einem Faktorenbündel aus. Selten ist eine Ursache allein verantwortlich für ein gravierendes Geschehen wie Schizophrenie, Depression oder Sucht. In der Literatur werden mehrere Gruppen von möglichen Ursachen für psychische Störungen unterschieden: 1. Exogene Ursachen, also von außen auf das Zentralnervensystem einwirkende Schädigungen, wie z. B. ein Hirntrauma. 2. Somatogene Ursachen, z. B. als Folge einer Infektionskrankheit. 3. Endogene Ursachen, also Ursachen, die in der Person selbst liegen: bei der Psychose vermutet man z. B. eine Störung des Stoffwechsels im Gehirn. Diese Stoffwechselstörung ist erstaunlich häufig nachweisbar, aber sie führt dann zur Krankheit, wenn schwierige Lebensbedingungen hinzukommen. Die Kausalität ist oft unklar: Gab es eine Stoffwechselstörung und dann eine psychische Veränderung, oder gab es eine psychische Veränderung, z. B. über Traumatisierungen, die zu Stoffwechselveränderungen im Hirn führte. Beides ist denkbar. 4. Psychogene Ursachen, die zwar ebenfalls in der erkrankten Person selbst liegen, aber von seiner Umwelt oder den Lebensereignissen mitbedingt sind. 5. Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell: Dieses Modell geht davon aus, dass es eine psychische Verletzlichkeit gibt, für die bestimmte Erbanlagen verantwortlich sind. Aber diese vermutlich ererbten Anlagen müssen durch die Umwelt – vor allem durch schwierige Lebensbedingungen – verstärkt werden, um zu einem Krankheitsausbruch zu führen. Das bedeutet, es gibt eine Anlage, der Ausbruch der Krankheit ist aber vermutlich doch eher abhängig von Lebenssituationen und Lebensereignissen. Besonders durch eine Dauerbelastung kann ein verletzlicher Mensch überfordert werden. 45 3.2.2 Die Bedeutung psychosozialer Bedingungen Die Zwillingsforschung zeigt, dass von eineiigen Zwillingen trotz des gleichen Erbgutes oft nur einer an einer Schizophrenie erkrankt. In der Folge wurden Lebensereignisse erforscht, die einem Krankheitsausbruch vorangehen. Dies sind in der Regel Ereignisse, die einen plötzlichen tiefen Eingriff in die tägliche Routine darstellen. Von daher ist der Ansatz der sogenannten „frühen Störungen“ von großer Bedeutung. Diese frühen Störungen, also fehlende Bezugspersonen und schwere Lebensumstände in den ersten Tagen und Monaten, aber auch Jahren des Lebens, führen zu sogenannten Ich-Defekten, die langfristig in verschiedenste Krankheitsbilder münden können. Die Psychoanalyse hat besonders für die Schizophrenie Erklärungsmodelle und Theorien entwickelt, die den Ursprung der Erkrankungen in den Selbstbildern („Selbstrepräsentanzen“) und Fremdbildern („Objektrepräsentanzen“) sehen, welche die Patienten/Klienten von sich und ihren Bezugspersonen haben bzw. in der (frühen) Kindheit hatten. So können etwa unklare Verhältnisse oder uneindeutige Kommunikation, widersprüchliche Gefühlsäußerungen und chaotische Beziehungen zu einer dauerhaften Verunsicherung der Identitätsentwicklung führen. Double-Binds innerhalb einer Familie, aber auch chaotische, für das Kind schwer berechenbare Familienverhältnisse können zu Unsicherheiten führen, die später eine psychische Krankheit verursachen können. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass nicht nur die Ereignisse der Umwelt und der Bezugspersonen verantwortlich sind, sondern auch die psychische Stärke des Einzelnen, der von diesen Ereignisse und Umwelten betroffen ist. Der Begriff der Vulnerabilität ist ins Zentrum neuerer Überlegungen gerückt: psychisch starke Menschen können mehr verkraften und eine stabilere Identität entwickeln als psychisch schwächere Menschen. Daraus lässt sich die entwicklungspsychologische Regel ableiten: Je früher in der Entwicklung eines Menschen schwere Störungen von außen, in wichtigen Beziehungen, 46 aber auch durch Lebensereignisse auftreten, umso vulnerabler wird ein Mensch und umso weniger kann er Lebensereignissen seines zukünftigen Leben resilient begegnen. Das besagt das „Verletzlichkeits-Stress-Modell“. Studien zeigten, dass Ausbruch und Verlauf schizophrener Psychosen von psychosozialen Bedingungen mitbestimmt werden: Belastende Lebenssituationen – „life events“ – sind vor dem Entstehen schizophrener Erkrankungen auffallend häufig. Wir wissen, dass verschiedene Ereignisse von unterschiedlichen Menschen unbewusst unterschiedlich stark gewichtet und bewertet werden. Außerdem gibt es Wechselwirkungen zwischen biologischen und psychosozialen Faktoren; so kann eine Kompensation oder eine Kumulation vorliegen. In diesem Modell spielt also die gesamte Zeit vor dem Krankheitsausbruch eine große Rolle, da bereits hier „Weichen“ gestellt werden, die die Krankheit begünstigen bzw. verhindern oder verzögern. Außerdem gilt sowohl für das Empfinden von Stress als auch für die Beschaffenheit der Verletzlichkeit (Zusammensetzung von biologisch und psychosozial bedingten Faktoren), dass diese Einflussgrößen stets individuell zu betrachten sind. 47 3.3 Psychodynamische Modelle in der Psychiatrie Im Folgenden werden das Frankfurter Psychoseprojekt und Stavros Mentzos´ Psychodynamisches Modell vorgestellt. 3.3.1 Das Frankfurter Psychoseprojekt Das Frankfurter Psychoseprojekt (FPP) entstand in den 1980er und 1990er Jahren und versteht Psychose als aktiven psychischen Vorgang mit dem Ziel, einen inneren Konflikt abzuwehren, der eine unerträgliche Spannung verursacht. Dieser Konflikt ist die Ursache der Psychose, nicht die persönliche Ich-Schwäche eines Menschen; diese wird im Gegenteil als Folge des unlösbaren Konflikts verstanden. In der Konsequenz wären psychotisch kranke Menschen nicht psychisch defizitäre Menschen, sondern in Widersprüchen verfangene Menschen. Sie wissen sich nicht anders zu helfen, als in gespaltenen, wahnhaften Welten zu leben oder Minussymptome zu entwickeln. Als Grundkonflikt wird vermutet, dass die Angst vor einem zugleich anziehenden wie ängstigenden Objekt abgewehrt wird. Es gibt also eine wichtige Person, die gleichzeitig ängstigt und anziehend ist. Das Dilemma heißt also: Entweder droht der Person der Selbstverlust oder ein Objektverlust. Die Lösung aus dem Dilemma ist dann die Psychose. Der psychotisch kranke Mensch nimmt also eher die Verzerrung der Realität in Kauf, weil er das Dilemma Selbstverlust oder Objektverlust nicht lösen kann. Sein Lösungsversuch ist die Fehlanpassung und damit kollidiert er weiterhin mit der gemeinsam geteilten Realität. Es muss also eine ungeheuer große Angst vor dem Objekt und Aggression gegen das Objekt geben. Klassischerweise erklärt man den Wahn dann auch als Projektion der eigenen mörderischen Impulse als Projektion nach außen. 48 3.3.2 Stavros Mentzos‘ Psychodynamisches Modell Mentzos vertritt eine andere These. Er hat aus seinen Untersuchungen an 300 akut psychotischen Patienten abgeleitet, dass deren diffuse psychotische Angst in dem Maße nachließ, wo die Patienten Wahnideen oder sogar ein paranoides System entwickeln konnten. Wahnbildungen und ähnliche Symptome würden dann als Schutz gegen die schreckliche Angst vor psychischer Desintegration und Kontrollverlust eingesetzt werden. Die Zwillingsforschung verweist zwar auf eine genetische Disposition, aber psychosoziale Umstände und Lebensereignisse können den Ausbruch einer Psychose verursachen oder verhindern. Wenn wir annehmen, dass psychosoziale Faktoren ebenso für das Entstehen der Krankheit entscheidend sind wie genetische Anlagen, so kann man auch von antipsychotischer wie auch von psychotischer Wirkung des psychosozialen Milieus sprechen. Mentzos entwickelt seine eigene These: es gibt eine vorgegebene und wahrscheinlich angeborene relativ geringfügige Störung, die unter den Bedingungen eines bestimmten Milieus zu Störungen und Schädigungen führt. Sein Modell hat drei Kriterien: eine biologische Grundausstattung und psychogenetische Faktoren beeinflussen die Psychodynamik des Verarbeitens von Belastungen und Konflikten. Bei der Betrachtung einer Psychose ist vor allem die Mikrodynamik wichtig. Oft ist das Auftauchen psychotischer Syndrome an bestimmte äußere oder intrapsychische Veränderungen gebunden. So eine Veränderung kann z. B. eine Trennung sein oder auch ein Verlieben sein: zu große, gefährliche Nähe oder zu große, gefährliche Distanz erschüttern das Gleichgewicht und es kommt zu desintegrativen Phänomenen. Wie sind in dem Kontext aber kognitive Störungen wie Wahnvorstellungen oder Halluzinationen zu verstehen? Mentzos nimmt an, dass nicht die Schwäche der Psyche eines Menschen für diese Defekte verantwortlich ist, sondern dass es sich um Kompensationsversuche handelt. Dann ist das Dilemma perfekt: Der Kompensationsversuch selber verursacht die Dekompensation. Mentzos (2001, S. 403) führt die oft auftauchende „doppelte Buchführung“ an: Ein psychotischer Patient kann durchaus in der „normalen“ Welt der anderen Personen mitargumentieren und gleichzeitig in seiner eigenen Welt sein, einer Welt, die ihn entlastet, indem sie ihm z. B.: Platz für die diffusen, unbewussten Ängste gibt. Sogar die 49 Privatsprache, die ein schizophrener Mensch wählt oder produziert, wird von Mentzos als Schutzmechanismus begriffen. Er selbst geht noch weiter und wendet sein Modell auf affektive und schizo-affektive Psychosen an, also auf Depressionen: Das Dilemma spielt sich hier zwischen einem unabhängigen und einem von einem Objekt völlig abhängigen Selbstwert ab. Ein Objektverlust, der das narzisstische Gleichgewicht aus den Fugen bringt, führt nicht in die Trauer, sondern in die Depression (oder in die Manie!). Der Verlust eines stark ambivalent besetzten Objekts kann in die Zyklothomie führen. Wenn man diese These anerkennt, dann ist die Schwere des Krankheitsbildes nicht die Ausprägung eines genetischen Faktors, sondern die Qualität der Antwort der psychischen Organisation. Das bedeutet: die Ausprägung des klinischen Bildes, z. B. der Grad der Regression, die primitive Abwehr in Form von Wahnbildern und Projektionen, resultiert nicht aus dem Ausmaß der biologischen Störung, sondern aus einer strukturellen Gebrechlichkeit und Instabilität, die Zuflucht zur Regression und Abwehr erzwingt. Die psychodynamische Depressionstheorie, die Stavros Mentzos vorlegt, erklärt seine Theorie mit einem Bankkonten-Modell. „Jeder Mensch hat zwei seelische Bankkonten, ein normales Giro-Konto und ein Grundkapital-Konto. Auf dem ersten Konto sammeln sich die Erträge aus der Entlohnung für Arbeit, andere Leistungen sowie die Entschädigung für Erlittenes. Aus dem gleichen Konto werden aber auch alle Lebenskosten, die vielfachen Verpflichtungen und Entschädigungen an andere bezahlt, die Strafzettel sozusagen.“ (Mentzos 1995, S. 36). Von diesem Giro-Konto geht das Laufende rein und raus: Also die Anerkennung anderer, die Selbstachtung usw. bestimmen, was in Beziehungen für die Person ein- und ausgeht. Das zweite Konto, das Mentzos erwähnt, ist das Grundkapital-Konto. Dieses Kapital-Konto ist abhängig von der Herkunft, also von den Eltern oder dem Schicksal. „Dadurch verfügt man auf diesem Konto über einen Fundus von selbstverständlich vorhandener Sicherheit, Selbstvertrauen, Urvertrauen, gesundem Narzissmus. Das Ursprungskapital wird durch narzisstische Zufuhr und zusätzlich durch Einnahmen aus dem ersten Konto sowie durch Zinsen und Zinseszinsen vermehrt. Wenn die „Decke“ auf dem Konto dick ist, dann kann einem im Leben wenig passieren. Man ist dann auch in der Lage, mit dem anderen, dem Über-Ich-Konto locker „umzugehen“ (ebd. 1995, S. 36). 50 Je größer das Grundkapital-Konto ist, umso turbulenter kann es auf dem Giro-Konto zugehen. D. h. die psychische Ausstattung des Menschen ist auch in diesem Modell die entscheidende Größe, um mit den Wechselfällen des Lebens klar zu kommen. Das gute Polster eines guten Grundkapital-Kontos entsteht in den Beziehungen der frühen Kindheit. In Phasen der Rezession, also in Zeiten von Lebenskrisen, können auf einem Giro-Konto durchaus rote Zahlen entstehen, die aber dann keine Katastrophe sind, wenn das Grundkapital-Konto gut gefüllt ist. Mentzos erweitert sein Modell dann um eine dritte Säule, für die keine Entsprechung in der Bankkonto-Metapher existiert: Er sagt, die dritte Säule der Stabilität sind die internalisierten Bilder guter Eltern: das Selbstwertgefühl eines Menschen basiert auch auf diesen internalisierten frühen Repräsentanzen von guten Bezugspersonen. In der Depression, so Mentzos, sind diese internalisierten Bilder schwach, von daher gibt es auch kein stabiles Grundkapital-Konto und selbst wenn auf dem Giro-Konto einiges angesammelt werden kann, ist dieses immer in Gefahr, rote Zahlen zu schreiben. 3.4 Stigmatisierungsprozesse und die soziale Isolation psychisch kranker Menschen 3.4.1 Stigmatisierungsprozesse Stigmatisierung bezeichnet den Prozess, bei dem ein Mensch aufgrund einer einzelnen Eigenschaft oder eines einzelnen Verhaltens von anderen zunächst als verschieden wahrgenommen wird. Dieser Unterschied wird mit weiteren unerwünschten Eigenschaften verbunden und in der Folge wird derjenige von der sozialen Gruppe oder den Gruppen, in denen er lebt, abgelehnt und gemieden. Das Phänomen des Stigmas ist, dass der einzelne Mensch auf einen Stereotyp reduziert wird. Bei „psychisch Kranken“ ist dieser Stereotyp die Unterscheidung zum „Gesunden“. Die Zuschreibung „psychisch krank“ bleibt an den betroffenen Menschen hängen und wird konnotiert mit Unberechenbarkeit, Gewalttätigkeit, Skurrilität, Sonderbarkeit etc. Der Mensch wir also zu einer Gruppe dazu addiert und bekommt das generelle Bild dieser Gruppe aufgemalt. Die Übertragung eines einzelnen Merkmals mit allen negativen Attributen, die auf die gesamte Person des Menschen gerichtet werden, hat eine hohe Wirksamkeit. Dazu 51 kommt die Bewertung der Normabweichung: Wenn ein Mensch durch sein Verhalten gegen allgemein gültige Normen verstößt, die einen hohen Verbindlichkeitsgrad haben, wird die Kritik besonders laut und die Suche nach Sanktionsinstanzen beginnt. Dies alles bedeutet nichts anderes, als dass Macht auf Seiten der Stigmatisierenden vorhanden sein muss, um Stigmatisierungsprozesse überhaupt in Gang setzen zu können. Das heißt, wir haben es mit einem hohen Ungleichgewicht und einem hohen Gefälle zwischen Stigmatisierten und Stigmatisierenden zu tun. Psychisch kranke Menschen verlieren ihre sozialen Rollen, wozu vorwiegend die Berufsrolle, aber auch die Rolle als Partner und als Eltern zu zählen ist. Eine internationale Studie der WHO berechnet im Jahre 2000, dass 90 % der Menschen mit einer schweren psychiatrischen Krankheit beschäftigungslos sind. Sie sind aber nicht nur beschäftigungslos im Sinne des Einkommens, sondern sie sind auch beschäftigungslos im Sinne der Verortung in einer zentralen sozialen Rolle. Nach einer langen Diskussion in den 1960er bis 1980er Jahren, ob psychische Krankheiten, allen voran die Schizophrenie, allein durch soziale Umstände entstehen könnte, kann heute als weitgehend widerlegt angesehen werden. Heute wissen wir, dass sich schizophrene Patienten vor Einsetzen der ersten Krankheitssymptome hinsichtlich ihres sozialen Status nicht wesentlich unterscheiden von anderen Menschen. Aber der Unterschied, der sich aufdrängt, ist sozialer Abstieg als Folge einer dauerhaften oder längeren Erkrankung. Diese „social-drift“-Hypothese beschreibt den Krankheitsbeginn auch als Beginn eines bedingten sozialen Abstiegs oder zumindest einer krankheitsbedingten Stagnation (vgl. Häfner 1995 und 1999). Der Begriff „psychosoziale Beeinträchtigung“ wird verstanden als Abweichen des individuellen Verhaltensmusters von den sozialen Erwartungen seiner normgebenden Bezugsgruppe. Wir müssen davon ausgehen, dass Verhalten und soziale Interaktionen durch vorgegebene Normen einer Gesellschaft oder einer gesellschaftlichen Subgruppe bestimmt sind und somit Erwartungshaltungen an den Menschen festsetzen. Dabei ist ein Circulus vitiosus in den Interaktionsprozessen zu erkennen: Die veränderten Verhaltensweisen stoßen auf Stigmatisierungen und führen zu Erwartungshaltung, die ihrerseits wieder die Ausübung sozialer Rollen erheblich beeinträchtigen. Insofern handelt es sich um einen geschlossenen Kreislauf von tatsächlich psychischer Veränderung, weiterer Isolation, Stigmatisierung und Diskriminierung. Daraus müssten sich folgende Ableitungen ergeben: Es muss zu einem Abbau von Vorurteilen 52 gegenüber psychisch kranken Menschen kommen, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Betroffene müssten durch eine verbesserte psychosoziale Situation in die Lage versetzt werden können, ihre Beziehungen anders zu gestalten. Menschen, die aufgrund von Fehlverhalten irgendwann und irgendwie mit der Psychiatrie oder mit psychiatrischen Krankheiten in Verbindung gebracht wurden, müssen nicht immer krank sein: Viele ihrer Verhaltensweisen können durchaus gesund, adäquat und angepasst sein. Aber die Tatsache, dass sie mit Psychiatrie oder mit psychiatrischer Krankheit zu tun hatten oder haben, verstärkt die Zuschreibung, sie seien ja doch (möglicherweise) psychisch krank. Wie verlaufen Stigmatisierungsprozesse? Stigma bedeutet Zeichen oder Brandmal (vgl. Goffman 1967, S. 9); bereits die Griechen haben auf körperliche Zeichen verwiesen, die etwas Ungewöhnliches oder Schlechtes über den Zustand des Zeichenträgers offenbaren. Diese Zeichen waren körperlich sichtbar und brandmarkten eine Person, die gemieden werden sollte oder gemieden wurde. Stigmatisierung und Diskriminierung haben viel miteinander zu tun, wobei Diskriminierung für Ungleichbehandlung und die herabsetzende Behandlung von Menschen steht, entweder aufgrund von Wertvorstellungen oder aufgrund von unbewusster und unreflektierter Voreinstellungen. Nun sind Unterschiede in den Vorstellungen und in der Wirklichkeit immer wieder real, aber es kann vorkommen, dass die Diskrepanzen so groß sind, dass wir diese anderen Personen als gefährlich oder böse bezeichnen und als solche auch behandeln. Je weniger wir verstehen, umso größer ist die Gefahr, dass wir fremdartiges Verhalten ängstlich anschauen, aggressiv darauf reagieren oder mit Abgrenzung und Diskriminierung bestrafen. Ein stigmatisierter Mensch ist auf eine unerwünschte Weise anders als wir es uns vorstellen: Sein Verhalten ist nicht akzeptabel und sprengt die Bandbreite möglicher menschlicher Verhaltensformen. Es geht aber nicht um das Merkmal selbst, dass kann objektiv gesehen durchaus klein sein, sondern es geht um die negative Definition des Merkmals und dessen Zuschreibung. Das eigentlich Bedeutende ist, dass es eine negative Übertragung von einem Merkmal auf die gesamte Person gibt. Einzelne Verhaltenszüge werden generalisiert und auch generalisierend bewertet, so dass die Person, die sich in vielen Bereichen durchaus adäquat verhalten kann, dennoch stigmatisiert wird, weil ein Verhaltensbereich ein besonders sensibler ist und bewertet wird. 53 Goffman unterscheidet drei Typen von Stigmata: • Die physische Deformation, die z. B. Körperbehinderte aufweisen; er nennt sie „Abscheulichkeit des Körpers“; • Individuelle Charakterfehler wie z. B. Sucht oder Kriminalität; • „Phylogenetisches Stigma“ wie Rasse oder eine fremde Religion. Menschen mit einer sichtbaren Behinderung sind oft bereits von Kindheit an mit ihrer besonderen Situation konfrontiert. Sie haben bereits gelernt, zwischen dem Normalen und dem Besonderen zu unterscheiden. Die Anforderungen, sich mit einer neuen veränderten Situation auseinandersetzen zu müssen, um damit die eigene Identität neu zu bestimmen, ist aber mit größeren Problemen behaftet. Menschen mit einer psychischen Behinderung oder Krankheit haben in der Regel keine sichtbare physische Deformation, sondern sie sind in die zweite Form der Stigmata einzuordnen, in die individuellen Charakterfehler. Wenn Menschen plötzlich oder schleichend psychisch erkranken, sind sie selbst mit den Voreinstellungen oder auch Vorbehalten gegenüber anderen psychisch Kranken aufgewachsen. Sie entwickeln folglich – wie die Angehörigen oft auch – einen kritischen Blick auf sich selber und sind möglicherweise noch viel strenger mit sich, als die gesellschaftlichen Vorurteile es vorgeben. Auf diese Weise wird die Selbststigmatisierung „Ich bin psychisch krank“ eine zweite Krankheit, die ebenso belastend sein kann wie die erste Veränderung. Das Stigma der Minderheitszugehörigkeit kann an dieser Stelle vernachlässigt werden. Wir kennen es hinsichtlich von Rasse und Religionszugehörigkeit aus dem Alltag. Wir unterscheiden also ein Stigma, das einer Person anhaftet, und Stigmatisierungsprozessen, die dieser Person von außen angetragen werden. Diese Stigmatisierungsprozesse konfrontieren eine Person mit sozialen Vorurteilen und bedeuten mehr als ein kognitiver Prozess: Sie gehen mit einem Verhaltensprozess einher. Die Betreiber von Stigmatisierungsprozessen wissen oft wenig über das Stigma selbst. Gerade im Kontext von psychischer Krankheit fließen Nichtwissen, Alltagswissen, ideologisches Wissen und mythische und emotionale Vorstellungen zusammen und lassen sich deuten als Stigmatisierungsprozesse, die aus der Angst mit der Konfrontation eines unheimlichen Verhaltens herrühren, erkennen. 54 3.4.2 Stigma und Etikettierung Die Stigmatisierenden befinden sich auf der Seite der Normalität. Sie sind gesund, sie sind unauffällig und leben ihr Leben in angepassten Bahnen. Aus psychoanalytischem Blickwinkel könnte man Stigmatisierungsprozesse auch verstehen als eine Verortung von Aggressionen: Endlich bietet ein anderer Mensch einen legitimen Anlass, ihm gegenüber aggressiv zu sein und ihn auszugrenzen. Dieses Verhalten kennen wir sowohl im individuellen als auch im politischen Bereich. Die eigenen Wünsche, sich anders zu verhalten, nicht mehr angepasst zu sein, werden so lange verleugnet, bis der Außenstehende, der Fremde, stigmatisiert werden kann. Insofern könnten Stigmatisierungsprozesse auch Entlastungsprozesse für die normal lebenden Menschen bedeuten. Wir gehen also davon aus, dass Stigmatisierungen für beide Gruppen, also für die Stigmatisierten wie auch für die Stigmatisierenden, eine Bedeutung haben. Dieser Bedeutung geht auch der sogenannte „Labeling Approach“ voraus, der 1966 von Scheff formuliert wurde. Während sich Goffman damit befasste, wie Stigmatisierte versuchen, ihre Identität aufrechtzuerhalten und ihre neue Situation zu bewältigen, so greift Scheff die Frage auf, wie Etikettierungen verlaufen und welchen Nutzen sie für die Etikettierenden darstellen. Scheff vertritt die Meinung, dass psychisch kranke Menschen mit ihren veränderten Verhaltensweisen Regeln übertreten, die dann mit dem Etikett „psychisch krank“ versehen werden. Die Bereitschaft, Verhaltensweisen schnell als psychisch krank zu identifizieren, sei sehr groß und sei verbunden mit dem Wunsch nach Ausgrenzung dieser Menschen. Und auch auf diesem Wege verfestigen sich die Interaktionsmuster zwischen dem Verhalten, der Bewertung und der Verstärkung des Verhaltens. Die Etikettierungstheorie besagt, dass psychisches Verhalten erst produziert und nicht allein reproduziert wird. Das Interessante an der Etikettierungstheorie ist die radikale Annahme, dass aufgrund der gesellschaftlichen Reaktionen und der stigmatisierenden Interaktionen sich psychische Krankheiten chronifizieren können. 55 Einer Arbeitsgruppe um B. G. Link (1989) modifiziert die durchaus kritikwürdige Theorie von Scheff durch folgende Phasen: • Die Diagnose „psychisch krank“ ist mit bestimmten Wahrnehmungen und Abwertungen verbunden. • Die zweite Phase erfolgt durch eine offizielle Etikettierung. • Im dritten Schritt werden die allgemeinen stereotypen Vorstellungen über psychisch kranke Menschen mit der jeweiligen Person neu verknüpft, und diese Person reagiert auf die stigmatisierenden Prozesse. • In einer vierten Phase kann die Person sich durch sozialen Rückzug in vermeintliche Sicherheit bringen, was zur Reduktion von Lebensfeldern und Lebensprozessen führt: Der Stigmatisierte schützt sich vor weiteren Zuschreibungen, indem er sich isoliert. • In der fünften Phase kann es dazu kommen, dass die stigmatisierende Umwelt in ihren Reaktionen sanfter wird, erreicht wird aber doch, dass die stigmatisierte Person Ressourcen verliert und sich immer mehr isoliert. • Die Folge ist die Verminderung der Sozialkontakte, die Verunsicherung in Familienbeziehungen und am Arbeitsplatz. Mit diesem Modell wird klar gemacht, dass sich die Isolation von psychisch kranken Menschen nicht aus der Krankheit ergibt, sondern ein Resultat der Interaktionen, der Zuschreibung, der Bewertungen und der abwehreigenen Ängste beinhaltet. Kurz zusammengefasst bedeutet der Prozess der Stigmatisierung Folgendes: • Ein Verhalten wird wahrgenommen, das sich von normalen Verhaltensweisen wesentlich unterscheidet; allerdings benötigt man eine Diagnose oder eine vermutete Diagnose, um Stigmatisierungsprozesse in Gang zu setzen. • In einem zweiten Schritt wird dieses Verhalten mit Stereotypen in Verbindung gebracht, so dass das Verhalten generalisiert und zum Etikett der Person wird. • In der dritten Phase passiert eine Unterscheidung zwischen „Die“ und „Wir“ – also die Abgrenzung bzw. Ausgrenzung der Kranken oder vermeintlich Kranken aus der Definitionsmacht der sogenannten Gesunden. 56 Es ist nicht zu leugnen und wird auch von den Stigmatisierungsforschern nicht geleugnet, dass es psychische und soziale Veränderungen durch die Krankheit gibt; die verschiedenen Ansätze, die hier referiert wurden, betonen aber, dass es einen interaktiven Prozess gibt, der die Veränderungen der Person durch Krankheit erheblich vergrößern und erheblich größere Probleme produzieren, als das allein von diesem Verhalten her abzuleiten wäre. Dazu kommt noch der negative Stellenwert psychischer Krankheit überhaupt: Wir müssen beobachten, dass Stigmatisierung sich nicht nur gegen Menschen richtet, sondern auch die Qualität psychiatrischer Versorgung beeinträchtigt. Noch mehr als für andere Krankheiten ist bei psychischen Krankheiten oder bei Störungsbildern die Diskussion besonders schwierig um das, was normal ist, d. h., der Norm entsprechend. Für die Beurteilung von psychischen Auffälligkeiten müssen wir von einem Normbegriff ausgehen, der höchst subjektiv sein kann, historisch und kulturell variabel ist und sich in z. B. spezifischen Milieus noch einmal sehr unterschiedlich abbildet. Die scheinbar objektiven Befunde sind häufig nicht gut objektivierbar und nicht gut herauszuarbeiten, weshalb die Psychiatrie auch nicht als exakte Wissenschaft gilt. Von daher muss man davon ausgehen, dass Menschen, die eine solche Diagnose bekommen, in einem anderen Kontext diese Diagnose unter Umständen nicht bekommen würden. Das berührt ein Thema medizinischer und psychiatrischer Ethik, es berührt aber auch das Thema der Gerechtigkeit im Umgang mit psychisch beeinträchtigten oder belasteten Menschen. Selbst wenn man charakteristische Symptome feststellen kann, die Krankheitsbilder zuzuordnen sind, darf man nicht vergessen, dass diese Symptome einer massiven gesellschaftlich gesteuerten Bewertung unterliegen, einer Bewertung, die man sich auch durchaus anders vorstellen könnte. Dies ist vielleicht weniger im Bereich von Wahn und Halluzinationen der Fall, aber im Bereich von Persönlichkeitsstörungen und Sucht ist die Einschätzung im hohen Maße gesellschaftlich abhängig. Was lässt sich aus diesen Überlegungen um Stigma und Etikettierung folgern? 1. Es wäre wichtig, sich um Biografie und Identität Betroffener zu kümmern. Diese Menschen müssen im Sinne des Stigma-Managements eine neue Identität entwickeln, um mit den Zuschreibungen irgendwie fertig zu werden, auch wenn diese neue Identität mit Rückzug und Isolation einhergeht. 57 2. Wenn es zu diesem Rückzug kommt, ist die Interaktion der anderen eine unabdingbare Aufgabe, nämlich die Isolation nicht weiter zu betreiben oder zuzulassen, sondern sie aufzuhalten und die Menschen in Beziehung zurück zu holen. 3. Unter dem Aspekt der „Teilhabe in der Gesellschaft“ sollten die anderen, also die Familie, die Helfer etc., versuchen, die Zugänge zu gesellschaftlichen Ressourcen wach zu halten. Es sollte ermöglicht werden, die Lebensqualität und die Lebenschancen nicht weiter zu reduzieren. Dies ist ganz konkret damit zu erreichen, dass man diesen Menschen die Möglichkeit zu Handlungen, zu Kontakten, zum Arbeiten und zum Wohnen genauso zugesteht wie anderen Personen auch und sie nicht in Anstalten, in betreutem Wohnen etc. weiter isoliert. 4. Andererseits kann man nicht ein naives Gegenbild entwickeln, nach dem Motto, es gebe ja keine psychisch Kranken: Es gibt Menschen mit psychischen Auffälligkeiten, die aufgrund von psychischen Krankheiten der verschiedenen Formkreise entstehen. Sie bedürfen neben der Teilhabe an der Gesellschaft adäquater klinischer und außerklinischer Möglichkeiten, die sie in vorübergehenden psychosozialen Krisen auf gute Weise begleiten und wieder zurückführen können in gesellschaftliche Kontexte. 3.4.3 Die Notwendigkeit sozialer Netzwerke Stigmatisierungsprozesse finden auf der Ebene sozialer Netzwerke statt. Die sozialen Netzwerke psychisch kranker Menschen – vor allem chronisch psychisch kranker Menschen – sind häufig sehr klein und instabil. Beziehungen sind häufig auf Familienangehörige zentriert und es gibt wenig Kontakte außerhalb der Familie. Häufig sind diese Beziehungen asymmetrisch, d. h. es gibt eine große Abhängigkeit des psychisch Kranken von den anderen. Die wenigen Kontakte außerhalb des primären sozialen Netzwerks sind meist wenig unterstützend oder sehr instabil und kurzlebig. Die Belastung der Angehörigen produziert ein häufig emotional stark aufgeladenes Klima, das zudem manchmal noch schwankt zwischen Überfürsorglichkeit und Feindseligkeit. Wenn große emotionale Spannung entsteht, kann dies durchaus dazu führen, dass psychisch kranke Menschen einen erneuten Schub bekommen und dekompensieren. 58 Wenn das soziale Netzwerk dazu noch klein ist und sich nur auf die Familien bezieht, muss man damit rechnen, dass diese Familie schnell überlastet ist. Letztendlich wird sie dann selbst sozial behindert, weil sie in den Sog der Erkrankung hereingezogen wird. Wenn wir die Lebensqualität eines natürlichen familiären Netzwerkes deutlich verbessern wollen, müssen wir nach der subjektiven Lebensqualität fragen und sollten versuchen, Netzwerke maßgeschneidert zu erweitern, um damit die subjektive Lebensqualität zu erhöhen. Ein neu aufgebautes tragfähiges soziales Netzwerk ist eine Ressource und damit ein protektiver Faktor für die Patienten und ihre Angehörigen. Interaktionen von außen sollten bei psychisch kranken Menschen sowohl durch Empowerment, als auch durch Pflege und Erweiterung der Netzwerke ansetzen. Interventionen können bei den Individuen, bei den Angehörigen und bei den Netzwerken ansetzen. Es gibt eigentlich nur drei Wege, wie man politische Einstellungen zu psychisch kranken Menschen ändern kann: • durch Proteste und Protestaktionen, • durch Bildung und Information und • durch den direkten Kontakt. 59 4. Die Behandlung psychischer Störungen Psychische Störungen werden, je nach dem Verständnis der jeweiligen Ursachen, unterschiedlich behandelt. Es gibt die medikamentöse Behandlung und die Psychotherapie in unterschiedlichen Ausrichtungen. Einige psychotherapeutische Ansätze werden im Folgenden aus der Vielfalt der Angebote skizziert, aber sicher nicht alle Behandlungsmöglichkeiten erwähnt. Daneben gibt es viele Therapieformen, auch nicht sprachlicher Art wie Kunst- und Tanztherapie, die über ihre Medien versuchen, in die innere Welt von psychisch belasteten Menschen vorzudringen und ihnen zu ermöglichen, andere, neue und bessere Erfahrungen zu machen. 4.1 Psychotherapie generell Psychotherapie stellt eine spezielle Art einer interpersonellen Beziehung dar, in der Klienten oder Patienten eine professionelle psychologische Hilfe bei der Bewältigung ihrer psychischen Störungen oder psychischen Aspekte körperlicher Erkrankungen erhalten. Es geht um erwünschte Veränderungen im Erleben, Verhalten und in den Beziehungen zur sozialen Umwelt, die auf verschiedenen Wegen erreicht werden können. Immer geht es um die Gestaltung der Beziehung, um die Geduld bei Beziehungsschwankungen und/oder -abbrüchen. Zu suchen ist eine gemeinsame Sprache, die es ermöglicht, schwierige Themen anzusprechen, den Respekt zu wahren und dennoch vorsichtige und zugewandte Konfrontationen zu riskieren. Menschen haben dann die Fähigkeit und den Mut zu Veränderungen, wenn ihnen Akzeptanz signalisiert und mit Respekt und Empathie begegnet wird. Das zentrale Mittel der Verständigung in der Psychotherapie ist die Sprache und die verbale Kommunikation. Dazu muss der Patient aber sowohl kognitiv als auch von seiner psychischen Differenziertheit her fähig sein. 60 4.2 Die klassische psychoanalytische Therapie Die tiefenpsychologisch orientierten Therapeuten versuchen über die Aufarbeitung früherer Erlebnisse und Beziehungen – zu den frühen Bindungspersonen – Veränderung herzustellen. Durch die Patient-Therapeut-Beziehung sollen unbewusste Konflikte der Kindheit z. B. durch die Übertragung, also in der Wiederholung mit dem Therapeuten aufgearbeitet werden. So sollen verdrängte Erinnerungen bewusst werden, die eine große Macht über das Leben und Erleben haben können. Dadurch werden neue Handlungskompetenzen und neue Möglichkeiten, sich in Beziehungen zu verhalten, erwartet. Die klassische psychoanalytische Therapie hilft bei psychischen Krankheiten eher wenig oder kann sogar völlig falsch sein. Therapie in diesem Kontext muss: • Regressionen vermeiden, • die Person stützen und dennoch klar konfrontieren, • Alltagsprobleme in den Vordergrund stellen, • mit der starken Beteiligung des Therapeuten arbeiten, • die Beziehung zwischen Therapeut und Patient immer wieder thematisieren, • sich als Muster für andere Beziehungen verstehen, • Absprachen treffen und kontrollieren. Das nennt Rudolf (2004) in Anlehnung an Heigl und Heigl-Evers: „Das Prinzip Antwort“ statt Deutung. 4.3Verhaltenstherapie Die Verhaltenstherapie setzt an dem erlernten Verhalten des Menschen an. Dieses Verhalten wird gesteuert von den Verstärkern – Belohnung und Bestrafung – und den daraus folgenden Konditionierungen. Die Verhaltenstherapie geht dabei auch von erlerntem Fehlverhalten aus und bietet dem Patienten in Übungen, Trainings und Rollenspielen an, Situationen anders und erfolgreich zu bewältigen und dieses wertzuschätzen. 61 4.4Schematherapie Die Schematherapie ist ein relativ neuer Ansatz, der sich von dem Schemabegriff Jean Piagets ableitet. Mit dem Begriff „Schema“ sind innere Strukturen gemeint, mit denen man vertrauten, aber auch fremden Ereignissen begegnet. Über diese Schemata versuchen wir, neue Informationen und Situationen über den Weg der Assimilation zu sortieren: Das Neue wird mit dem vorhandenen Schema bearbeitet. Stößt man aber auf Ereignisse, für die man kein Schema hat, reagiert man mit Hilflosigkeit und muss neue Schemata suchen. Die Akkommodation verändert das eigene Schema und hilft zu einer Neuanpassung an die Umwelt: Die Person verändert sich. Aber es kann auch fehlangepasste Schemata geben. Sucht wird z. B. in diesem Kontext als ein solches fehlangepasstes Schema verstanden. (vgl. Roediger 2009). Diese maladaptiven Schemata werden von Roediger als Folge nicht ausreichend gedeckter Grundbedürfnisse in der Kindheit verstanden. Der Mensch übernimmt die maladaptiven Schemata als seine Muster, nach denen er neue Situationen und Beziehungen interpretiert – ebenfalls maladaptiv. Roediger unterscheidet fünf Schemadomänen: • Beziehungsmuster von Trennung und Ablehnung in der frühen und späteren Kindheit: Bindungsschwierigkeiten; • Beeinträchtigung von Autonomie und Leistung mit dem Gefühl, ein Versager zu ein: Kontrolle nach außen; • Beeinträchtigung im Umgang mit Grenzen, mit dem Gefühl, besser zu sein als andere: Kontrolle nach innen; • Fremdbezogenheit und übermäßige Außenorientierung, mit dem Gefühl, nicht in sich zu ruhen, keine klare Identität zu haben: Selbstwerterhöhung; • Starke Wachsamkeit und Hemmung der eigenen Person, mit dem Gefühl, perfekt sein zu müssen, aber nicht perfekt zu sein: Lust/Unlust-Vermeidung. Ziel der Schematherapie ist es, die beherrschenden Schemata zu finden und sie zu modifizieren. Das kann durch kognitive Methoden, Verhaltens- und Imaginationsübungen geschehen. 62 4.5 Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) Die DBT ist ein junges Therapieverfahren und wird vor allem im Kontext von Persönlichkeitsstörungen angewendet. Marsha Linehan hat diese Therapie entwickelt und trägt Anteile aus der Verhaltenstherapie, der dialektischen Gesprächsführung und des Zen-Buddhismus zusammen. Man geht bei der DBT von einem bio-psycho-sozialen Entstehungsmodell aus, das heute eigentlich allen Ansätzen zugrunde liegt. Dialektik will in diesem Zusammenhang sagen, dass die Gegensätze aufgelöst werden sollen, in denen eine Borderline-Persönlichkeit gern denkt. Man möchte von dem Schwarz-Weiß-Denken des Betroffenen wegkommen in ein farbigeres Denken: es gibt zu vielen Dingen viele Überlegungen, Positionen, Standpunkte und Wahrnehmungen – eben Alternativen. Das Behaviorale in dieser Therapie ist verknüpft mit den sog. Skills. Die Trainings werden sowohl in Einzelsitzungen als auch in Skill-Gruppen erarbeitet und trainiert. Der Mensch soll über kognitive, emotionale, sinnes- und handlungsbezogene, zwischenmenschliche und stresstolerierende Fertigkeiten lernen, sein Repertoire an Reaktionen zu erweitern und sich selbst vielfältiger zu steuern. 4.6Soziotherapie Der Begriff Soziotherapie umfasst alle Vorsorge-, Fürsorge- und Nachsorgemaßnahmen im stationären, teilstationären und ambulanten Bereich der psychiatrischen Versorgung. Um neue psychische Zusammenbrüche oder Rückfälle zu verhindern, soll der Patient zu Aktivitäten angeregt und seine Lebensräume strukturiert werden. Hierbei ist die Zusammenarbeit mehrerer Einrichtungen und Dienste besonders wichtig, da ungünstige oder nicht aufeinander abgestimmte Strukturen den kranken Menschen unnötig destabilisieren können. Dieses Netz der Hilfe ist besonders für Suchtkranke, chronisch psychisch Kranke und Menschen mit desintegrierten Persönlichkeitsstörungen notwendig und sinnvoll. 63 5. Angehörige im Umgang mit psychisch kranken oder belasteten Menschen Kein Außenstehender kann wissen, was genau in einem anderen Menschen vorgeht; oft wissen es die Personen selbst nicht. Nicht umsonst ist das Konzept des Unbewussten von tragender Bedeutung bei allen Menschen, bei allen Gruppen, Paaren, Familien und Gesellschaften. Psychisch beeinträchtigte Menschen erleben durch die Konfrontation mit der Umwelt, durch die Zuschreibung, „psychisch krank“ zu sein, ausgrenzende Situationen. Sie haben dann das Gefühl, nicht in die Welt zu passen, unpassend zu sein, nicht alltagstauglich und nicht belastungsfähig. Was für andere Menschen normal und alltäglich ist, stellt für sie oft eine Herausforderung dar. Sie sehen ihre Umwelt oft anders, als die Umwelt sich sieht, woraus sie das Gefühl entwickeln können, anders zu sein, unverstanden zu sein. Was andere denken und fühlen und wie sie handeln, kann im Widerspruch zu sich selbst stehen. Was sie selbst denken und tun, wird von anderen als „fremd“ angesehen, als unpassend, als störend. Sie können die anderen sogar befremden. Deshalb reagieren sie verunsichert, ängstlich oder übervorsichtig im Umgang mit anderen Menschen; ihre Reaktionen können aber auch aggressiv und anklagend sein. Ihr Anders-Sein kann viele Gesichter haben: Depressive Menschen sehen oft keinen Sinn mehr im Leben und glauben, nichts mehr wert zu sein. Sie fühlen eine Traurigkeit und emotionale Leere, die das Leben für sie unerträglich macht. Personen, die unter einer schizophrenen Psychose leiden, können das Gefühl haben, verfolgt zu werden, hören Stimmen oder glauben ihre Gedanken werden auf widernatürliche Weise beeinflusst. Die normale Umwelt reagiert auf solche Gefühle mit Vorurteilen und Angst. Oft sind psychisch belastete Menschen sensibler und weniger belastbar als gesunde Menschen. Sie stehen bereits unsicher im Leben und werden durch irritierte Rückmeldungen und Reaktionen weiter verunsichert. In einer Gesellschaft, in der Erfolg und Anerkennung wichtig sind, in der Konkurrenz und Kampf zur Tagesordnung gehören, ist wenig Platz für hochsensible, belastete, angeschlagene Menschen. Aus den Konfrontationen mit der Umwelt entsteht schnell ein Circulus vitiosus, ein Kreislauf der Verstärkung der Fremdheitsgefühle; von daher ist die Einstellung der 64 Angehörigen zu ihren kranken Familienmitgliedern von großer Bedeutung. Man kann von den belasteten Menschen nicht verlangen, dass sie nicht irritieren. Doch man kann von den gesunden Menschen, vor allem denen, die sich für gesund und robust halten, verlangen, dass sie ihre Haltung andersartigen Menschen gegenüber kontrollieren, reflektieren und modifizieren. 6. Familiendynamik Familie begegnet uns in den unterschiedlichsten Kontexten und Institutionen; in den Gesundheitsberufen haben fast alle Bereiche über die Patienten mit Familie zu tun. Familie und Paare sind als zentrale Themen der Sozialwissenschaften nicht neu. Sie haben Vorläufer z. B. in der Familiensoziologie, aber das Forschungsinteresse an den internen Dynamiken von Familie ist erst in den vergangenen dreißig Jahren entstanden und hält weiterhin an. Familiäre Beziehungskonstellationen sind aus systemischer Perspektive als lebenslange Prozesse zu verstehen, die sich über viele Jahre als Familien- und Beziehungsmuster entwickelt haben. Familienbeziehungen sind Lebensgeschichten über Generationen hinweg, sie sind ein wichtiges Band zwischen den Generationen. Familiäre Strukturen und Dynamiken sind komplex. In der Dynamik geht neben der Sachebene immer auch um die Beziehungsebene. In der Familie stoßen Individuen aufeinander, die immer ihre Geschichte aus ihrer Herkunftsfamilie haben und mit in die neue Familie bringen. Ein Paar muss, wenn es sich zusammen tut, • die Rollen, • die Interaktionen, • den Grad der Bindung, • den Grad der Nähe und damit • den Grad der Autonomie, • die Regeln, die man sich für die Familie gibt, • die Wünsche, die man äußern kann oder nicht äußern kann, • die Muster der Interaktion, • die Ideale von Partnerschaft und • die Ideale von Eltern-Kind-Beziehung (er-)finden und aushandeln. 65 In Krisensituationen, wenn z. B. ein Familienmitglied an einer psychischen Krankheit erkrankt, ist nichts mehr so wie vorher: Die schwere Krankheit eines Familienmitglieds bringt das Gleichgewicht, das gesucht und oft gefunden wurde, aus den Fugen. Alles steht erneut zur Disposition. Die moderne Familie ist gekennzeichnet durch folgende Merkmale: • Die Trennung der Erwerbstätigkeit von der Familienarbeit, und damit die Entstehung geschlechtsspezifischer Arbeitseinsätze und unterschiedlicher Familienbezogenheit von Männern und Frauen. • Die Emotionalisierung der Paarbeziehungen: man heiratet aus Sympathie und Liebe, was dann auch dazu führt, dass die Ehe in Frage steht, wenn die Liebe verschwindet: Scheidungen basieren auf der Liebeszentriertheit. • Die Kindzentrierung: Kinder werden meistens geboren, weil das Paar sich nach Kindern sehnt: Kinder sind Emotionsträger und erfüllen emotionale Bedürfnisse; andere Rollen sind in den westlichen Gesellschaften eher marginal. • Die vertikalen Linien sind stabiler und überdauern meist die horizontalen Linien, d. h. die Beziehungen zwischen den Generationen sind bindender und verlässlicher als die Paar- und Ehebeziehungen. • Die Phasen der Eltern-Kind-Beziehungen halten lebenslang, auch wenn Eltern und Kinder sich trennen und eigene Wege gehen: sie wissen voneinander und tun viel füreinander, nicht nur Eltern für ihre Kinder, sondern auch Kinder, zumal die erwachsenen Kinder, für ihre alten Eltern. 66 6.1 Familiendiagnostik Die Familiendiagnostik untersucht und beschreibt die Interaktionen, ihre Veränderungen zwischen den Familienmitgliedern, den Subsystemen und analysiert die Dynamik der Familie als systemisches Ganzes. Sie untersucht die unbewussten Phantasien, Wünsche und Ängste der Familie auf dem Hintergrund der Familiengeschichte, um so ein Verständnis über bedeutsame Interaktionssequenzen zu bekommen“ (vgl. Cierpka 1988, S. 2). Der Blick des Beobachters einer Familie changiert immer zwischen mehreren Ebenen: • Er unterscheidet die strukturelle von der prozessorientierten Ebene, also den Familienaufbau und die Familieninteraktion; • Er unterscheidet die individuelle von der systembezogenen Ebene, wobei der Blick auf die individuelle Familie sich schnell auf die Ereignisse einer Familie begrenzen kann, während der systembezogene Blick möglicherweise zu grob und groß ist: Beide Blicke sind wichtig; • Er wird die drei Ebenen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft unterscheiden und nach Themen suchen, die sich wie ein roter Faden durch die Generationen ziehen; • Er wird die Geschichten, die Familienmitglieder erzählen, als objektiv, subjektiv und kontextbezogen interpretativ unterscheiden. Das Modell „Familienzyklus“ versucht, die Familie als zusammenhängendes Gebilde in immer neuen Phasen zu erfassen. Es unterscheidet die frühe Phase der Paarbildung und Heirat, die folgende Phase der dazukommenden Kinder, die späteren Phasen, die nach der Ablösung der Kinder und der Zurückführung des Paares auf sich selbst ergeben und die Phasen des Alterns. Die strukturdiagnostische Ebene, also ein systemischer Blick, beobachtet die immer wiederkehrenden Interaktionsmuster einer Familie, z. B. unter den Fragestellungen: Wer steuert die Interaktionsmuster, was sorgt dafür, dass sie immer wieder kommen, was ändert sich, wenn sich bestimmte Interaktionsmuster als dysfunktional erweisen? Es geht um die Regeln, die diese Interaktionsprozesse steuern und gestalten, die sowohl bewusst als auch unbewusst sein können, verdeckt oder offen. Diese Regeln sind der eigentliche Inhalt des systemischen Blicks auf die Familie. 67 Strukturelle Differenzierungen beinhalten Grenzziehungen: • Grenzen der Familie nach außen; • Grenzen zwischen den einzelnen Subsystemen, also z. B. die Grenzen zwischen Eltern und Kindern; aber auch die Grenzen zwischen den Geschlechtern; • Grenzen zwischen den Individuen. Die wichtigsten Variablen zur Familienkohäsion sind: • Grad der Gestaltung. Inwieweit ist eine Familie in der Lage, verborgene oder zugrundeliegende Muster einer Situation zu erkennen und sich darauf einzustellen. • Koordination. Damit ist die Fähigkeit einzelner Familienmitglieder gemeint, die Problemlösung gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern zu koordinieren. Ein wichtiges Ziel hierbei ist Solidarität. • Beschlussfassung. Wie schnell sind Familien in der Lage, gemeinsame Entscheidungen zu treffen oder diese immer wieder hinaus zu schieben. • Gegenseitige Verpflichtungen. Wer sorgt für wen? Steht eine Familie unter Stress, wie das im Falle der psychischen Erkrankung eines Familienmitglieds sein muss, so gibt es bestimmte Diagnosemerkmale, die darauf hindeuten, ob der Stress zu bewältigen sein wird oder nicht. • Machtverteilung. Jedes Paar muss aushandeln, wer welche Entscheidungen trifft und wie mit Konflikten umgegangen wird. Im Falle einer (psychischen) Krankheit ist oft die Krankheit bzw. ihr Träger ein wichtiger Machtfaktor. • Balance zwischen Selbständigkeit/Autonomie und Bindung. Das Gleichgewicht muss in einer Paar- und Familienbeziehung immer neu ausgelotet werden. Vor allem in Stresssituationen gerät eine Balance in Unordnung und kann entweder neu ausgehandelt werden oder eben nicht. Wenn sie nicht erneut ausgehandelt werden kann, wird die Phase als sehr destruktiv erlebt. 68 6.2 Paar- und Familiendynamik: Einige ausgewählte Ansätze Die Liste der familiendynamischen Schulen und Ansätze ist lang: wir wählen hier einige aus, die wir für besonders erklärend im Kontext des Themas halten. 6.2.1 Thea Bauriedl Thea Bauriedl (1998) betrachtet eine Paarbeziehung unter dem Aspekt ihrer Dialektik, worunter sie den wechselseitigen Interaktionsprozess durch mitgebrachte Übertragungsmuster versteht. Jedes Verhalten eines Paares ist im Rahmen der Beziehung zu sehen und nimmt damit den Partner als Bezugssystem auf. Jeder Partner muss sowohl als Subjekt als auch als Objekt betrachtet werden. Das ist ein Versuch, die Wechselhaftigkeit der Beziehungen zu betrachten. In ihrem Ansatz der Paarbeziehung sind vor allem drei Begriffe interessant und wichtig: • Abwehr: Abwehr bedeutet Selektion. Nur ein Teil der Wahrnehmung wird zugelassen, ein anderer – das kann auch ein wichtiger Teil sein – wird ausgeschlossen. Daraus entsteht eine Normbildung innerhalb der Paarbeziehung, die skizziert, was gut und was böse ist, was sein darf und was nicht sein darf. Diese Normbildung führt zu Einschränkung oder Verzicht einerseits und andererseits zur Beschränkung. Das kann letztendlich Ausdifferenzierung und Entwicklung der einzelnen Menschen in der Paarbeziehung verhindern. Manchmal kann es zur Rebellion kommen. • Ambivalenz: In einer Paarbeziehung tauchen immer Gegensätze auf, immer muss entschieden werden, immer wieder geht es um wichtige Themen. Ambivalenzen in wichtigen Themen sind schwierig auszuhalten und Paare tendieren dazu, dann eine Ambivalenz-Spaltung vorzunehmen. Das bedeutet, dass einer der Partner vollkommen auf die eine Seite und der andere Partner vollkommen auf die andere Seite setzt. Damit wird die Ambivalenz aufgehoben, aber die Spaltung in das Paar transportiert. • Spannungstoleranz: Spannungen müssen ausgehalten und toleriert werden; sollten die Spannungen zu groß oder die Toleranz kleiner werden, setzen Versuche ein, sich durch Flucht oder Ausweichen zu entziehen. 69 In Belastungssituationen von Familien kann man typische Phasen erkennen: Zunächst rückt man zusammen und versucht, das Problem gemeinsam zu tragen und einander loyal zu sein. Wenn es zu Überforderungen kommt, werden die Anteile, die die einzelnen Familienmitglieder tragen müssen, abgewogen. Man sucht nach Umverteilungen, entweder durch Hilfe von außen oder durch Belastung anderer Familienmitglieder. Von daher ist es verständlich, dass es in Belastungssituationen relativ häufig zu Trennungen kommt. Wenn der Außendruck zu stark wird, und die Kräfte innerhalb des Systems nicht mehr ausreichen, eine Situation zu ertragen, ist Trennung ein Versuch, dem Druck auszuweichen. 6.2.2 Jürg Willi Das Modell der Paarbeziehung von Jürg Willi (2001) ist in der Literatur als das Kollusions-Modell bekannt. Es geht um das Zusammenspiel der beiden Partner. Er benennt drei Funktionsprinzipien, die für das Gelingen einer Paarbeziehung wichtig sind: • Das Abgrenzungsprinzip: Eine Dyade muss sich gegen Außen und Innen klar definieren. Es gilt, eine Balance zu finden zwischen der Individualität und der Gemeinsamkeit. Willi spricht von einem Kontinuum zwischen Verschmelzung und rigider Abgrenzung. Nach außen hin muss ein Paar definieren, wie durchlässig die Grenzen sein dürfen. Auch hier gibt es ein Kontinuum zwischen völliger Durchlässigkeit und Starre. Die intra-dyadischen und extra-dyadischen Grenzen sind in der Regel sichtbar, geraten aber in einer Krisensituation aus der Balance. • Das Funktionsprinzip geht von regressiven und progressiven, d. h. von kindlichen oder erwachsenen Verhaltensweisen aus. Jeder der Erwachsenen sollte sowohl regressive als auch progressive Verhaltensweisen haben dürfen und ausleben können, da eine Polarisierung der Rollen eine Verengung des Individuums bedeutet und damit ein Austausch schwierig wird. 70 In einer gesunden Paarbeziehung, sagt Willi, profitieren die Partner von der Möglichkeit, mal die eine, mal die andere Seite ausleben zu dürfen. Eine Polarisierung in dem Sinne, dass einer der Partner die regressiven Seiten und der andere die progressiven Seiten lebt, führt nicht nur zu einer Reduzierung der individuellen Lebensmöglichkeiten, sondern tendiert auch dazu, immer weiter auseinander zu driften und die partiellen Rollen immer starrer zu leben. • Das Prinzip des Gleichgewichts des Selbstwertgefühls. In einer gelingenden Paarbeziehung stehen die Partner zueinander im Gefühl der Gleichwertigkeit, womit mehr gemeint ist als die Gleichberechtigung. Es geht um die Ebenbürtigkeit der Partner im Selbstwertgefühl. Die Regel muss nicht verletzt werden, auch wenn einer der Partner sichtbar die äußere Führung des Paares bzw. der Familie hat, während der andere eher im Hintergrund arbeitet und die Familie von innen heraus steuert und führt. Im Zusammenspiel, eben der Kollusion der beiden Partner, geht es um unbewusste Angst- und Konfliktbewältigung. Bei der Partnerwahl entdecken die Partner im jeweils anderen einige unterdrückte oder verloren gegangene Anteile der eigenen Person. Die Anziehungskraft des Partners beruht zu einem Teil darauf, dass der andere etwas hat und ausleben darf, was man sich selbst verweigert oder abwehren muss. Eigene Wünsche werden an den Partner delegiert, wo sie aber im Laufe der Zeit dann doch bedrohlich werden und bekämpft werden müssen. Zum Problem wird die Kollision dann, wenn der eine Partner nur noch einen Teil lebt, z. B. den mächtigen Part, der andere Partner den dazu gehörenden Part der Hilflosigkeit. Beide Seiten tendieren dazu, sich zu verstärken: Je hilfloser ich bin, umso mächtiger darfst/musst du sein; je mächtiger du bist, umso hilfloser werde ich, muss/darf ich sein. 71 6.2.3 Horst Eberhard Richter Horst Eberhard Richter hat in seiner bereits 1962 erschienenen Schrift über „Eltern, Kind und Neurose“ einen Versuch gestartet, die psychodynamischen Austauschprozesse zwischen Eltern und Kindern darzustellen und hat dies in das Konzept der Rolle gefasst. Dabei geht er von der These aus, dass das Kind in den Phasen seiner Entwicklung jeweils unbewusste Konflikte der Eltern aufstöbert bzw. auslöst, was zur Folge hat, dass jeder Elternteil mit seiner eigenen Geschichte und seiner eigenen Persönlichkeit mit diesen entwicklungsbezogenen Ereignissen des Kindes fertig werden muss. Die Elternteile treffen also im Kind auf ihr eigenes Kind in sich selbst und treffen in ihrer Elternrolle auf die eigenen Eltern und wie sie sie wahrgenommen haben in der Interaktion ihnen gegenüber. Es handelt sich also um eine doppelte Wiederholung: Das Kind im Erwachsenen und die internalisierten Eltern im Erwachsenen fügen sich mit anderen Ansätzen, z. B. erlerntem Wissen, Reflexionen und Selbstreflexionen, in das pädagogische Tun als Eltern hinein. Genau darüber wird deutlich, dass das Bild des Kindes aus dem Blickwinkel der Eltern in der Regel verzerrt sein muss. Die modernen Theorien des Konstruktivismus lehren genau dieses: Beziehungen geschehen in den Köpfen der Menschen. Bei der Eltern-Kind-Beziehung kommt noch der Machtfaktor hinzu: Die Eltern haben für längere Zeit mehr Macht, die Rolle des Kindes zu bestimmen, als das Kind selber. Auch die Fähigkeit des Kindes, seinerseits die Rollen der Eltern zu bestimmen, wird relativ spät ausgeprägt. Von der These ausgehend, dass das Kind Aspekte des eigenen Selbst repräsentiert, dass das Kind aber auch Aspekte früherer Bezugspersonen repräsentieren kann, kommt Horst Eberhard Richter zu dem Begriff des Substituts: das Kind ersetzt Anteile der eigenen Person oder Anteile wichtiger Bezugspersonen – im positiven wie im negativen Sinn. Bei dem erst genannten Vorgang handelt es sich um Projektionen, bei dem zweiten Vorgang handelt es sich um Übertragungen. Die elterlichen Phantasien, die dem Kinde gewidmet sind, enthalten einerseits positive Erwartungsvorstellungen (z. B das Kind soll so sein, wie man selbst war), sie können aber auch negative Erwartungen enthalten, nämlich dass das Kind genau die negativen Aspekte verkörpert, die man an sich selbst nicht mag bzw. die die frühen Bezugspersonen einem als negative Aspekte angetragen haben. 72 Im Prozess der Übertragung werden dem Kind Erwartungen angetragen und Merkmale zugeschrieben, die einer anderen Person in wesentlich früherer Zeit zugehörten. Es handelt sich also sozusagen um eine Verwechslung der Personen. Diese Eigenschaft und Rollenzuweisung kann sowohl negativer als auch positiver Art sein. Das geläufigste Beispiel ist die Rolle des Sündenbocks, die dem Kind zugeschrieben werden kann. In der These von der Nähe zwischen dem „äußeren Kind und dem inneren Kind“ greifen Familientherapeuten die Nähe und Identifizierung zwischen Eltern und Kind auf: Das Kind vor uns weckt das Kind in uns. Das gefährdete, z. B. das verletzliche, das bedrohte Kind vor uns weckt die Gefühle, die man als Kind in vergleichbaren Situationen hatte. Die beiden Kinder gemeinsam drängen zu einer Wiederholung der Gefühle und Erlebnisse. Sie drängen vor allem dann zu einer Wiederholung, wenn das innere Kind unbewusst ist und bleibt oder gar bleiben muss, damit es den Erwachsenen nicht mit Gefühlen überschwemmt. Aber das verdrängte Kind meldet sich und zeigt sich in Verhaltensweisen des Erwachsenen dem „äußeren Kind gegenüber: wie er dieses behandelt, wie er mit ihm umgeht, was er ihm erlaubt, ermöglicht, verweigert [...], wie er mit ihm verschmilzt oder sich von ihm abgrenzt“ (Richter 1962). Aber die Eltern begegnen nicht nur dem verdrängten Kind in sich selbst, sondern auch den oft unbewussten Bildern von Eltern: Sie sind in ihrem Verhalten als Erwachsene gegenüber Kindern von ihrem Vater- und Mutterbild beeinflusst, wie sie es in ihrer Kindheit aus der Kinderperspektive entwickelt und seitdem beibehalten haben. Kindliche Gefühle und Phantasien in uns werden ebenso reaktiviert wie elterliche Gefühle und Phantasien. 73 6.2.4 Helm Stierlin Helm Stierlin (1978) kritisiert das Konzept der Rolle von Horst Eberhard Richter: Es ist ihm zu statisch. Er entwickelt dagegen das Konzept des Auftrags bzw. das der Delegation. Er geht davon aus, dass es oft einen Widerspruch zwischen manifesten und verdeckten Rollen gibt, z. B. wenn Kinder wie Eltern handeln oder Eltern wie Kinder behandelt werden, was aber weitgehend dem Rollenkonzept von Horst Eberhard Richter, der von unbewussten Dynamiken ausgeht, entspricht. Für Stierlin handelt es sich dennoch dabei um Rollenstrukturen, die er gerne um das Konzept der Mission bzw. der Beauftragung oder der Delegation ergänzt haben möchte. Delegation bedeutet: Ein Kind oder auch ein Jugendlicher wird delegiert und erhält damit die Erlaubnis und die Ermutigung, aus dem elterlichen Umkreis herauszutreten, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Er bleibt sozusagen an der langen Leine und wird ausgesandt, etwas für die aussendenden Erwachsenen zu erledigen. Der Delegierte wird zwar fortgeschickt oder auch entlassen, bleibt aber dem Aussendenden gegenüber in einer gewissen Loyalität verpflichtet, den Auftrag zu erfüllen. Diese Aufträge, die an die Kinder gegeben werden, können Aufträge auf der Ebene von Gefühlen und Affekten sein, sie können aber auch Aufträge auf der Ebene von Normen und Regeln sein oder auf der Ich-Ebene, also z. B. etwas zu leisten, was die Erwachsenen nicht leisten konnten. Bei den Delegationen geht es darum, entweder Aufgaben, die die Erwachsenen nicht leisten konnten, zu erfüllen oder Aufgaben zu wiederholen, die die Erwachsenen leisten konnten und können. Es geht also darum, das ungelebte Leben zu leben oder das Leben der Erwachsenen zu wiederholen. Es handelt sich um unbewusste Bindungen und das ist mehr als die Beschreibung einer Rolle. Der übernehmende Part, also in der Regel die Kinder, erhalten einen Teil ihrer Lebensaufgaben durch diese Delegationen und bleiben verhaftet in einer manchmal förderlichen und manchmal beklemmenden Treuebeziehung. Zu Stierlins Modell gehört außerdem das Muster der Ausstoßung: Kinder werden, wenn sie Probleme machen, ausgestoßen oder sie werden eng an die Familie gebunden und erhalten keine eigene Lebenschancen. 74 6.2.5 Michael Buchholz Michael Buchholz nennt sein Konzept „Familien-dynamische Konfliktmuster“ (vgl. Buchholz 2000). Er unterscheidet drei Perspektiven der institutionellen, der ideologischen und der unbewussten Familie. Damit meint er Strukturen, Ideen und ideologische Konzepte und unbewusste Dynamiken wie Delegationen, Zuschreibungen, Emotionen etc. Buchholz geht davon aus, dass familiäre Beziehungen durch eine unsichtbare Buchhaltung beeinflusst werden. Bei einschneidenden familiären Ereignissen oder Entscheidungen kann das von Bedeutung werden. Michael Buchholz bezieht sein Modell vor allem auf die späte Familie: Älter werdende Eltern haben ihren Kindern gegenüber Wiedergutmachungs-Aufgaben. Da vermutlich alle Eltern Fehler in der Erziehung machen, z. B. durch die Weitergabe von Traumatisierungen oder durch Delegationen und Zuweisungen, sind und bleiben sie ihren Kindern mehr oder weniger etwas schuldig. Eltern, die eigentlich gar nicht anders können als zunächst über das Leben der Kinder zu bestimmen, bleiben diesen Kindern immer etwas schuldig. Aus dieser Verpflichtung, nämlich als Eltern zu handeln, erwächst nun Schuld und es erwächst der Anspruch auf „Wiedergutmachung und Entschädigung“ (Buchholz 2000). Diese Wiedergutmachung kann manchmal monetär ausgeglichen werden, manchmal bleiben Eltern aber diese Wiedergutmachung schuldig und binden das erwachsene Kind auf negative Weise an sich, indem sie genau über diese Schuld Macht ausüben: Die erwachsenen Kinder haben das Gefühl, noch etwas zu erwarten von den alten Eltern, die es ihnen aber schuldig bleiben. Aber die Kinder wollen es noch unbedingt bekommen. 75 6.2.6 Boszormenyi-Nagy und Geraldine Spark Die Familientherapeuten Ivan Boszormenyi-Nagy und Geraldine Spark haben schon 1973 ein imponierendes Werk zur Thematik der Intergenerationenbeziehungen vorgelegt, das aber keinen Eingang in die Diskussion um die höheren Lebensalter gefunden hat. Sie vertreten die Annahme, dass es zwischen den Generationen eine Art unsichtbare Buchhaltung gibt, in der über Schulden und Verdienste der Familienmitglieder genauestens Buch geführt wird. Daraus werden später Berechtigungen und Ansprüche abgeleitet. Unter „Schulden“ werden sowohl Schuld als auch Schuldgefühle verstanden. Boszormenyi-Nagy und Spark beschreiben die Dynamik unsichtbarer Treuebindungen zwischen Familienmitgliedern unterschiedlicher Generationen. Danach prägen in der Kindheit entstandene Loyalitätskonflikte nicht nur das gesamte Leben des Kindes, sondern auch die Beziehungsdynamik innerhalb des Systems Familie über die Generationen hinweg. Die Bilanzen von Gegebenem und Empfangenem sind Inhalt der Buchführung. Es gibt offenbar ein menschliches Grundbedürfnis nach Geben und Schenken, ebenso eine Erwartung nach angemessenem Gegengeschenk, d. h. das Gegebene müsse in einer adäquaten Form oder einer adäquat erlebten Leistung wieder „zurückgezahlt“ werden. Parallel dazu gibt es aber auch den Wunsch, für Geschenktes, für Bekommenes Gegenleistungen zu erbringen, damit man „nichts schuldig“ bleibt. Nicht ausgeglichene Konten von Geben und Nehmen, von Bekommen und Rückzahlen führen auf den jeweiligen Seiten zu Abhängigkeiten oder Dominanz. Eine Familienhomöostase ist nur dann gewährleistet, wenn die Familienmitglieder Gelegenheit hatten, die Konten ihrer gegenseitigen Schuldigkeiten auszugleichen. Hält die Eltern-Kind-Beziehung die Möglichkeit der Balance von Geben und Nehmen nicht offen, so kann dies eine destruktive Dynamik induzieren. Während sich die Verdienstbilanz des einen stetig erhöht, steigt die „Verschuldung“ des anderen ebenso an. Die Balance ist das entscheidende und von ihr ist es schließlich abhängig, ob Beziehungen vertrauensvoll sind oder überhaupt aufrechterhalten werden können. Durch die Hilflosigkeit des Kindes und seinem Bedarf nach Elterlichkeit entsteht automatisch ein strukturelles Ungleichgewicht der Kinder zugunsten der fürsorgenden Eltern. 76 Die Eltern sind also in der Vorleistung, erwirtschaften ein Plus auf ihrem Verdienstkonto, was die nachfolgenden Generationen an die Eltern bindet. Im Laufe des Lebens wird es immer wieder Phasen des Ungleichgewichts geben, die immer wieder nach Ausgleich streben oder als Ungerechtigkeit erlebt werden. Das ist die Grundlage für die Intergenerationenbeziehungen im hohen Lebensalter: Hier erwarten und bekommen Eltern sozusagen den Austausch für die früheren Investitionen. Alter und Pflegebedürftigkeit derjenigen Eltern, die ihrem Kind ein Gefühl von hohem Verschuldetsein vermittelten, kann somit zu einem kritischen Ereignis im Familienzyklus werden, wenn das „Kind“ unter Druck gerät, die Rückzahlungen leisten zu müssen und anderweitig gebunden ist. Oder die andere Seite: Vergebliche Versuche etwas zurückzugeben, lassen solche Phänomene verstehbar erscheinen wie Überengagement in der Betreuung der Eltern im Falle ihrer Hilfsbedürftigkeit oder Unvermögen, Hilfe von außen für die Pflege in Anspruch zu nehmen. Wird das Bedürfnis der Kinder zu geben von den Eltern gewürdigt, so korrespondiert dies mit einer Anerkennung ihres Selbstwertes durch die Erwachsenen. Anders in der Parentifizierung: Hier wird das kindliche Geben angenommen, aber die elterliche Anerkennung fehlt (vgl. Boszormenyi-Nagy und Spark, 1973). 77 7. 7.1 Vom Umgang mit psychisch kranken oder belasteten Menschen Familienmitglieder und Bekannte Jede seelische Krankheit und Belastung eines Familienmitgliedes betrifft auch die Angehörigen und fordert sie in einer bestimmten Weise. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Angehörige gewonnen werden sollen, sich um ihre psychisch belasteten Familienmitglieder oder Bekannte zu kümmern, um deren Hospitalisierung zu reduzieren oder zu verhindern. Selbstverständlich sind die Herausforderungen durch die verschiedenen Krankheitsbilder uneinheitlich. Mit bestimmten Kriterien werden Angehörige in der Regel zu tun haben: • Betroffenheit, bis hin zur Trauer, manchmal auch Mitleid Die Angehörigen sind über das Ausmaß der Störung und des beeinträchtigten Lebens ihres Familienmitglieds betroffen und erschrocken. Sie werden Stück für Stück wahrnehmen, dass Vieles anders sein wird, als sie das in der Vergangenheit kannten und möglicherweise auch schätzten. Damit wird sich ihr Alltag verändern und auch darüber dürfen sie mit Fug und Recht traurig sein und sich selber ebenfalls bemitleiden. Manchmal sind die Auswirkungen so gravierend, so dass jemand seinen Arbeitsplatz verliert oder aufgibt. Manchmal ist die Familie auch finanziell betroffen. Manchmal geht jemand nicht mehr aus dem Haus. Viele Themen der Familie kreisen dann um die Krankheit des betroffenen Familienmitgliedes und das normale Leben ist erheblich eingeschränkt. • Verunsicherung und Angst Diese Gefühle kann jeder selbst nachvollziehen. Sie bleiben in vielen Fällen den Angehörigen über lange Zeit nicht erspart. Wenn sie bemerken, dass es keine Verbesserung gibt, droht im schlimmsten Falle sogar eine Verschlimmerung. • Hilflosigkeit Manche psychisch belasteten Familienmitglieder schaffen es, die Anstrengungen ihrer Angehörigen immer wieder so zu forcieren, dass diese in Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit landen. 78 • Enttäuschung und Wut Die Verhaltensauffälligkeiten, die emotionalen Gestimmtheiten, die Perspektivlosigkeit und die ausbleibenden positiven Veränderungen, die oft mit psychischer Krankheit einhergehen, können bei Angehörigen nach einer Weile in Enttäuschung und Wut umschlagen. Der Ton wird aggressiver, der Kontakt auf ein Minimum verkürzt, möglicherweise kommt Verachtung hinzu. Diese Merkmale erschweren und vergiften den Umgang der beiden Parteien. • Schuldgefühle Angehörige wissen oft, aber nicht immer, viel über ihre psychisch belasteten Familienmitglieder und entwickeln selber Thesen und Hypothesen zu den Ursachen der aufgetretenen Krankheiten, die die Schuldfrage stellen. Familienangehörige können sich selber, aber auch andere Familienmitglieder, beschuldigen, dazu beigetragen zu haben, dass ein Familienmitglied krank, auffällig und psychisch belastet ist. 79 7.2 Kinder als Angehörige Kinder psychisch kranker Eltern haben lange ein Schattendasein gefristet. Erst seit einiger Zeit sieht man ihre Not und wendet sich ihnen mit besonderen Hilfen zu. Im Prozess der Parentifizierung werden Kinder von ihren bedürftigen Eltern in die Rolle der Fürsorgenden für die Eltern gebracht, also zu Eltern der Eltern. Diese Kinder können, wenn sie jung sind und der Parentifizierungsprozess zu früh verläuft und eine Überforderung darstellt, ihr Bedürfnis nach Abhängigkeit und Unterstützung durch die Eltern nicht befriedigen, sondern werden von diesen zur Kompensation der eigenen Bedürftigkeit instrumentalisiert. Kinder, die sich in dieser Rolle aufopfern und von ihren Eltern nichts zurückerstattet bekommen, müssen das, was ihnen vorenthalten wurde, in anderen Beziehungen suchen. Wenn sie sehr belastet oder sogar misstrauisch geworden sind, können sie sich auch aus anderen Beziehungen zurückziehen. Sollten diese Eltern im Alter abhängig von der Hilfe ihrer Kinder werden, besteht kaum die Bereitschaft, freundschaftlich, liebevoll und helfend mit den Eltern umzugehen. Vielmehr kann sich der Wunsch nach Rache für die Versagungen und Ausbeutungen in missbilligendem, spottendem oder vernachlässigendem Verhalten äußern. In der Regel haben sich bei einer guten Eltern-Kind-Beziehung Guthaben auf Seiten der Eltern angesammelt, ob sich bei psychisch kranken Eltern „Guthaben“ sammeln können, ist fraglich. Wenn es Guthaben aus guten Zeiten gibt, sind Kinder bereit und fähig, für eine bestimmte Zeit „zurückzuzahlen“. Erwachsene Kinder können dies, während kleine, junge Kinder noch gar kein Konto haben, das eingesetzt werden kann. Sie können vor allem, weil sie jung sind und eigentlich diejenigen sind, die noch „zu bekommen haben“, schnell erschöpft werden. Frühe und starke Parentifizierung ist rasch mit einem Minuskonto des Kindes verbunden, wie in Kap. 3 bereits beschrieben. Hilfe für Kinder und Jugendliche ist ein besonders sensibles Thema: Sie sind, wenn sie klein sind, oft unterversorgt, unregelmäßig oder ungleichmäßig versorgt. Wenn sie älter sind, sollten sie eigentlich das Recht haben, sich abzulösen, eigene Wege zu entwerfen und zu gehen und können dann (an-)gebunden bleiben, obwohl ihre Lebensphase eine dringend andere wäre. 80 7.3 Pflegende Angehörige: Ihre Aufgaben, ihre Erlebnisse, ihre Unterstützung „Psychiatrische Pflege muss insofern von der somatischen Pflege unterschieden werden, als sie nicht allein bedeutet, bei den Alltagsverrichtungen unmittelbar helfend in den Handlungsbedarf einzugreifen oder ärztlich verordnete abgrenzbare Einzelleistungen wie Medikamentenvergabe oder Verbandswechsel durchzuführen. Sie muss vielmehr bedeuten, dem psychisch Kranken Hilfe zu geben, dass er die Regeln der Sorge des Menschen für sich selbst und des mit menschlichen Umgangs als Element des eigenen Handlungsrepertoires wahrnimmt und umsetzt.“ (Expertenkommission d. Bundesregierung, 1988) 7.3.1 Bedingungen der psychiatrischen Pflege Die psychiatrische Versorgung in Deutschland war lange auf reine Krankenhausbehandlung beschränkt und stand zudem im Schatten der somatisch orientierten Krankenpflege. Sie war eng verbunden mit der Vorstellung von Sicherheitsverwahrung und Gewalt, mit Medikamentenvergabe und Zwangsbehandlungen hinter verschlossenen Türen und mit „verrückten“ und deshalb unberechenbaren Patienten. Diese Vorurteile wurden auch auf die Menschen, die sie pflegten, übertragen. Die Psychiatrie-Enquête von 1975, ein umfassender Bericht über die desolate psychiatrische Versorgung in Deutschland, leitet einen grundlegenden Wechsel ein. Als Kernforderungen wurden Dezentralisierung der Versorgung und der Vorrang von ambulanten Angeboten vor stationären Maßnahmen herausgestellt. Hiermit wurden Ziele formuliert, die in anderen europäischen Ländern insbesondere Italien, Frankreich und England bereits Prinzipien der Psychiatriereformen waren. Im Zuge der deutschen Psychiatriereform wurden in erster Linie komplementäre, die Krankenhausversorgung ergänzende, rehabilitative Angebote aufgebaut. Sie trugen dazu bei, dass Krankenhausbetten vor allem im Langzeitbereich abgebaut werden konnten. Neue Projekte arbeiten weiter daran, ambulante Versorgung auch in Krisenzeiten der Patienten zu gewährleisten und damit die Aufenthalte in Kliniken nicht nur wegen der Kosten, sondern auch wegen der häufigen Re-Traumatisierung der Patienten weiter zu 81 reduzieren. Das erste Modellprojekt für ambulante psychiatrische Pflege wurde 1980 in Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen. Durch die Forderungen der Psychiatrie-Enquête im Jahr 1975 und die folgenden Reformen veränderte und professionalisierte sich die Pflege. Sowie die psychiatrischen Kliniken zunehmend ihren Anstaltscharakter verloren und zu therapeutischen Zentren wurden, entwickelte sich die Pflege zu einem eigenständigen Bereich und eroberte einen wichtigen Platz im therapeutischen Team. In der psychiatrischen Pflege steht der Mensch im Mittelpunkt. Psychiatrische Erkrankungen gehen immer mit einer Beziehungsstörung einher. Dies bewirkt, dass viele psychisch erkrankte Menschen in großer Isolation leben und nicht mehr in der Lage sind, für sie lebensnotwendige Kontakte zu knüpfen. Deshalb kommt in der psychiatrischen Pflege dem Beziehungsprozess, als notwendige Basis und als Methode der psychiatrischen Pflege, eine besondere Bedeutung zu. Aufgabe der modernen psychiatrischen Pflege ist es, • fremdartiges Verhalten der Patienten zu verstehen, zu akzeptieren, einfühlend und menschlich darauf zu reagieren; • den ihr anvertrauten Menschen in seinem Anpassungsprozess zu begleiten und zu unterstützen in einem psychisch, physisch und sozialen Gleichgewicht zu bleiben und/oder ein neues zu finden (wenn er mit der Behinderung leben muss); • die oft verschütteten Ressourcen eines psychisch kranken Menschen wieder zu finden, zu installieren und zu erweitern; • die Ansatzpunkte bei den gesunden Anteilen des Patienten zu suchen, um diese zu entfalten. Pflegende sollen als Experten des Alltags für die Patienten ein Modell sein und sie bei der Bewältigung von Aufgaben des alltäglichen Lebens unterstützen; sie sollen mit den Patienten Bewältigungsstrategien entwickeln und sie mit ihnen einüben – ohne zu belehren, zu deuten, zu pädagogisieren oder zu analysieren. Dies impliziert ein modernes Pflegeverständnis und verlangt eine sehr andere Haltung, als das in der „alten“ Psychiatrie gelebt wurde: Respekt, Wertschätzung, Verstehen – darauf werden wir noch eingehen. Dies impliziert aber auch andere Strukturen, 82 die in sozialpsychiatrischen Institutionen und Formen der Versorgung und Begleitung ihren Niederschlag finden. Von daher ist die ambulante psychiatrische Pflege (APP) ein gemeindeorientiertes Versorgungsangebot. Sie soll dazu beitragen, dass psychisch kranke Menschen ein würdiges, eigenständiges Leben in ihrem gewohnten Lebenszusammenhang führen können. Durch die Pflege vor Ort soll das Umfeld beteiligt und die soziale Integration gewährleistet werden. Besonders wichtig dabei ist der Bezug auf die Familie, die das Lebensumfeld der meisten Menschen ist. Die Arbeit mit den Angehörigen, die in die Behandlung einbezogen werden sollen und oft wollen, wird zu einer wichtigen Aufgabe; gleichzeitig müssen diese Angehörigen ausgebildet und in die Dynamiken des Umgangs mit einer psychisch kranken Person eingewiesen werden, um den Verbleib in der häuslichen Umgebung zu ermöglichen. Fortbildungen und die Kooperation mit sozialpsychiatrischen Einrichtungen und Beratungen sollen die Angehörigen gleichzeitig entlasten wie vorbereiten und begleiten. Ziele sind: • wiederkehrende Klinikaufenthalte, die von den Betroffenen und dem sozialen Umfeld häufig als stigmatisierend empfunden werden, zu vermeiden; mit ihren flexiblen, aufsuchenden Angeboten Behandlungsabbrüchen vorzubeugen; • den für Patienten belastenden Wechsel von psychiatrischen Diensten je nach Behandlungsbedarf durch das integrierte Angebot der ambulanten • psychiatrischen Pflege zu vermeiden. Daraus lassen sich folgende Tätigkeiten ableiten, sowohl für die professionellen sozialpsychiatrischen Betreuer als auch für pflegende Angehörige: • Eine professionelle, tragfähige Beziehung aufbauen, • gesunde Anteile fördern, • Krankheitszustände und Veränderungen wahrnehmen und beobachten, • Medikamenten verabreichen oder die selbständige Medikamenteneinnahme beobachten bis kontrollieren, 83 • Wirkung und Nebenwirkungen der Medikamente erkennen, • den eigenverantwortlichen Umgang mit Medikamenten und die Compliance fördern, • Gespräche über Alltagsfragen, Lebensprobleme und Emotionen führen, • häusliche Tätigkeiten und Hygiene anleiten und unterstützen, • Absprachen zu treffen und Absprachefähigkeit trainieren, • Kontaktaufnahme zu Angehörigen gestalten, bei Konflikten vermitteln, • Freizeitaktivitäten und soziale Kontakte fördern und ermöglichen, • stützende (Tages-) Strukturen schaffen, • Krisensituationen erkennen und frühzeitig intervenieren, • einen bewussten, aktiven Umgang mit der Krankheit/Beeinträchtigung durch Information und Beratung fördern und • den Hilfebedarf feststellen, beobachten und evtl. variieren. Das ambulante Arbeitsfeld stellt erhöhte Anforderungen an die Pflegekräfte, die sich im Gegensatz zur stationären Arbeit in sehr komplexen Strukturen behaupten müssen: • Sie sind Gast im direkten Lebensumfeld des Patienten und sind dadurch unmittelbar mit seiner Lebensführung konfrontiert; • Sie bewegen sich in der Regel allein und ohne den sonst üblichen institutionellen Hintergrund; • Sie müssen die manchmal sehr ungewöhnlichen Lebensumstände und Lebensentwürfe aushalten, ohne zu diskriminieren und zu bevormunden, ohne Veränderungen zu erzwingen (jedenfalls bis zu einem Grad, der die Sicherheit des Patienten nicht gefährdet); • sie müssen fähig sein, differenziert die Situation der Patienten einschätzen zu können; • sie müssen evtl. sogar Entscheidungen treffen; • sie müssen ermessen, ob die geleisteten Angebote angemessen und hilfreich sind, ob der Patient ausreichend versorgt ist und ob weitere Dienste einbezogen werden müssen. Pflegekräfte sind ebenso wie Angehörige darauf angewiesen, dass ihnen bei ihren Besuchen die Tür geöffnet wird und die Betroffenen sich an den Interventionen beteiligen. Diese Gastrolle der Pflegekräfte führt gegenüber der stationären Behandlung, bei der das Personal das Hausrecht hat, zu einer Veränderung der Beziehungen. Optimal 84 ist es, wenn Patienten und Pflegekräfte gemeinsam handeln und aushandeln, welche Angebote geeignet sind und wie sie durchgeführt werden sollen. In der Begleitung von Angehörigen spielt Sensibilität ebenfalls eine große Rolle: Kooperation ist notwendig, Koalition z. B. gegen den Patienten schädlich: Auch hier muss eine Balance gehalten werden, die nicht immer leicht ist. 7.3.2 Gefühle im Umgang mit psychiatrisch erkrankten Menschen Die Aufgabe des Modellprojekts „Familiale Pflege“ besteht darin, Angehörige zu befähigen, mit ihren psychisch kranken Familienmitgliedern förderlich umzugehen. Was erleben Angehörige im Umgang mit ihren psychisch erkrankten Familienmitgliedern? Oft erleben sie, dass die Krankheit in ihr Leben einbricht und es dominiert, dass sie von einem Schicksal eingeholt werden, dass sie nicht wollen, nicht gewollt haben und nichts dazu beigetragen haben. Sie erleben sich als Opfer. Das Leben verändert sich stark, der Alltag wird von der Krankheit dominiert, die Beziehung wandelt sich, die Zukunft ist unsicher und unklar. Sei es, dass ein Mensch in einer Psychose merkwürdige Dinge tut, dass er nicht mehr erreichbar ist, sei es, dass ein Mensch mit einer Depression sich aus der Beziehung verabschiedet und in totalem Rückzug ebenfalls nicht mehr erreichbar ist. Sei es, dass ein Mensch mit einer Persönlichkeitsstörung Beziehungen und Affekte nicht mehr regulieren kann, die Beziehungen materialisiert oder funktionalisiert und damit die Menschen in seiner Umgebung verletzen kann. Die Anklage des Schicksals ist eine mögliche Folge, die Frage nach der Schuld eine andere, Angst schwingt immer mit bzw. Verzweiflung über ein Leben, das mit dem geplanten nichts mehr zu tun hat. Dabei verändert sich der Patient evtl. immer weiter. Folgende Veränderungen sind u. a. möglich: • Manche Patienten verändern sich körperlich, weil die Medikamente als Nebenwirkung eine Gewichtszunahme bewirken können; • Manche Patienten entwickelt sich rückwärts, regredieren oder werden infantil; • Manche werden entdifferenziert in den Affektlagen oder lassen sich von ihren Affekten, z. B. Depression, dominieren; 85 • Manche Patienten beginnen, sich zu vernachlässigen und ihren Körper nicht mehr zu pflegen; • Manche Patienten „nutzen“ ihre Krankheit und entwickeln einen sekundären Krankheitsgewinn bzw. werden ausbeuterisch; • Manche entwickeln schwere Verhaltensstörungen und geraten in Konflikt mit dem Gesetz. Ebenso wie der Betroffene erleben Angehörige ganz unterschiedliche Gefühlsreaktionen im Verlauf der Erkrankung. Es ist für die meisten Angehörigen ein sehr schmerzhafter und manchmal ein langer Prozess zu erkennen und anzuerkennen, dass ihr Angehöriger erkrankt ist. Um diesen Schmerz zu vermeiden, neigen Menschen dazu zu verleugnen oder zu beschuldigen: Alles sei halb so schlimm, oder der kranke Angehörige sei verhaltensauffällig und benehme sich nur daneben. Die Angst vor einer Diagnose bedient diese Verleugnung oder Beschuldigung, oft weil auch gedacht wird, eine psychische Erkrankung sei eine Erkrankung für immer und verschlimmere sich ständig – was manchmal der Fall ist, oft aber auch nicht. Die Anerkenntnis einer psychischen Krankheit macht traurig, manchmal verzweifelt: Vieles ändert sich und die Angst, der Alltag werde vollkommen verändert, greift um sich. Oft entwickeln Menschen in einer psychischen Krise oder mit einer psychischen Erkrankung problematische Verhaltensweisen: Es kann sein, dass der Erkrankte nicht mehr aus dem Haus geht, nur noch im Bett liegt, evtl. seine Arbeit verliert, es kein Lachen und keine Unbeschwertheit mehr gibt und die Perspektiven für die Beziehung z. B. zwischen Partnern oder zwischen Eltern und Kindern schwinden. Hilflosigkeit und Gefühle der Hoffnungslosigkeit entstehen, wenn das kranke Familienmitglied keine Hilfe annimmt. Aus Hilflosigkeit und Angst werden schnell Enttäuschung und Wut, z. B. wenn der Patient die gut gemeinten Ratschläge und Unterstützungsversuche der pflegenden Angehörigen nicht annimmt. Fehlende Krankheitseinsicht und fehlende Compliance lähmen die Beziehung, machen mutlos und aggressiv und führen in seelische Erschöpfung und Kraftlosigkeit oft mit den Folgen körperlicher Erschöpfung und körperliche Beschwerden. Die Frage nach Ursachen der psychischen Veränderung und Krankheit geht oft einher mit der Schuldfrage und produziert viele Schuldgefühle; das Andauernde und Langwierige vieler psychischer Erkrankungen führt bei pflegenden Angehörigen dazu, sich der Ungeduld zu bezichtigen, nicht den richtigen Weg gefunden zu haben, versagt zu haben. 86 Scham taucht auf, wenn die Umwelt irritiert oder abweisend reagiert, weil „merkwürdige“ Dinge geschehen. Dies kann zur Abneigung führen, auch wenn man auf der bewussten Ebene die Beziehung bestehen lassen und für die Pflege verantwortlich sein will. Und es taucht auf die Frage nach der Beteiligung im Sinne der Übernahme von Verantwortung oder Hilfestellung auf: Wie weit will ein Angehöriger in die Pflegebeziehung gehen, wie weit will er sich engagieren? Die Implikationen einer solchen Frage sind häufig Befürchtungen, • das Leben nicht mehr im Griff haben zu können, • es nicht mehr genießen zu können, • angebunden zu sein, • anderen Beziehungen und Verantwortungen nicht mehr nachkommen zu können, beruflich oder familiär, • in Isolation oder Einsamkeit zu geraten, • von anderen Menschen (ebenfalls) gemieden zu werden, • Gefühlsschwankungen ausgesetzt zu sein und nicht mehr „gerecht“ sein zu können etc. 87 7.3.3 Vier wichtige Themen: Scham, Schuld und Verantwortung, Passivität, Vernachlässigung 7.3.3.1 Scham Fallbeispiel: Eine Betroffene berichtet: „Als mir vor zwei Jahren die Diagnose Schizophrenie gestellt wurde, entwickelte ich wohl so etwas wie eine Art Selbststigmatisierung. Durch das Etikett der Schizophrenie fühlte ich mich beschmutzt. Geprägt durch meine Erziehung waren psychische Krankheiten für mich tatsächlich so etwas wie Krankheiten zweiter Klasse. Sie sind etwas, das andere betrifft, aber nicht einen selbst. Wie fehlgeleitet die Vorstellungen meiner Mutter in Bezug darauf sind, sieht man zum Beispiel daran, dass sie seit dem Klinikaufenthalt den Kontakt zu mir abgebrochen hat. Durch die Diagnose fühlte ich mich abgewertet und völlig verunsichert. Es ist fast unmöglich die Tragweite der Aussage ‚Sie sind schizophren‘ zu erfassen. Erst intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, die Suche nach alternativen Krankheitsdefinitionen und Behandlungsmethoden und die Zeit haben mir geholfen, mich selbst neu zu sortieren.“ (Knuf 2006, S. 66). In unserer Gesellschaft gibt es zahlreiche Vorurteile und Stereotype gegenüber psychisch kranken Menschen. Diese treffen nicht nur die erkrankten Menschen, sondern auch die Angehörigen. Ideen über die schizophrenogene Mutter und die erbliche Weitergabe von psychischen Erkrankungen sind in das Alltagswissen der Menschen eingegangen und führen zu Vorurteilen. Wenn Vorurteile auch bestimmte Handlungsweisen nach sich ziehen, spricht man von Diskriminierung. Zwar werden oftmals psychisch Kranke in unserer Gesellschaft diskriminiert, zum Beispiel in Hinblick auf Arbeitsplätze, gleichwohl kommt es aber auch zu Selbststigmatisierungen. Eine häufige Folge von diesen Selbststigmatisierungen sind Schamgefühle. Um diese Schamgefühle zu vermeiden, ziehen sich psychisch kranke Menschen und deren Angehörige oft sozial zurück. Scham, sagt der Soziologe Sighard Neckel (1991), sei eine Empfindung von großer Profanität. Das sich Schämen sei eine existenzielle Grunderfahrung: Wir wollen in den Boden versinken oder wir erröten vor Scham, wir suchen wie die Maus das Loch und schlagen die Augen nieder. Wer sich schämt, der verachtet sich und ist sich selbst fremd geworden. Scham ist nach Lynd (1961, S. 49, zitiert nach Wurmser 1993, S. 79) 88 eine Erfahrung, die das ganze Selbst erfasst und mit dem ganzen Selbst erfasst wird. Schamerfahrungen werfen so ein helles Licht auf uns, auf das was und wer wir sind und in welcher Welt wir leben. Damit ist Scham etwas Objektives. Sie entsteht nicht in Konflikten mit einzelnen, sondern mit dem Teil eines einzelnen, der das Gesellschaftliche repräsentiert. Wir schämen uns, wenn unser aktuelles Selbst von unserem Selbstbild abweicht und das Über-Ich diese Diskrepanz signalisiert. Scham tritt regelmäßig dann auf, wenn ein Ich-Ideal nicht erreicht wird, d. h. wenn Ich-Ideal und Selbstwahrnehmung in Spannung zueinander geraten. Wird der Schamaffekt differenziert, so teilt er sich zunächst in die Angst vor Bloßstellung und vor Erniedrigung, die in ein depressives Gefühl übergeht, welches das Bewusstsein über die Bloßstellung begleitet. Dieses depressive Gefühl, das eigentlich Unerträgliche der Scham, entsteht in der Angst vor der Verachtung durch andere oder auch in der Wahrnehmung der Verachtung der anderen, die gleichzeitig Selbstverachtung ist. Scham ist gleichzeitig die Hüterin der Würde, sie ist eine innere Grenze, an der „unser besseres Selbst beginnt“ (Wurmser 1993, S. 74). In jeder Kultur gelten bestimmte Charakterzüge und soziale Tatsachen als unehrenhaft und als beschämend. Insbesondere gehört alles, was mit mangelnder Umweltkontrolle und mangelnder Körperkontrolle einhergeht, dazu. Scham ist so verbunden mit Schwäche und mangelnder Autonomie, was nach sich zieht, dass sowohl Probleme bei der Kontrolle des Körpers als auch Probleme bei der Kontrolle der Umwelt als beschämend empfunden werden. Das Eigenleben des Körpers, die mangelnde Kontrolle über ihn, zeigt sich insbesondere im sexuellen Akt, weshalb Sexualität in besonderer Weise mit Scham assoziiert wird. Nach Wurmser (1993) hat jede Kultur ihre besonderen Arten der Scham und der schamauslösenden Situationen und Momente, die sich alle auf Kontrolle beziehen: Kontrolle der Affekte wie Angst, Wut, sexuelle Erregung, Kontrolle über Körperlichkeit und Bewegung im Allgemeinen und über Ausdrucksbewegung und Gestik im Besonderen und schließlich über Triebimpulse. Mit Max Scheler (vgl. Neckel 1991) lässt sich noch einmal sagen, dass Scham überall dort entsteht, wo Menschen ihrer Naturhaftigkeit bewusst bzw. mit ihrer Naturhaftigkeit konfrontiert werden. Diese Konfrontation des Menschen mit sich selbst im Zusammenhang mit der (Wieder-) Entdeckung des Tierischen ist mit George H. Mead gesprochen zunächst ein heftiger Zusammenprall zwischen Ich („I“) und Mich („me“). Dieser Zusammenprall gefährdet den gesellschaftlichen Status und als Unterpfand dieses Status die Selbstachtung. 89 7.3.3.2 Schuld und Verantwortung Über Scham haben wir ausführlich gesprochen, das Thema der Schuld und Verantwortung soll hier kurz betrachtet werden. Es ist klar, dass Familienmitglieder Schuld empfinden und Schuldgefühle bekommen, wenn ein Mensch ihrer Umgebung derartig schwer erkrankt. Die Fragen nach dem „Warum“ führen immer zu Themen und Ereignissen einer Familie, die problematisch waren, nicht besprechbar sind, die bei einem Familienmitglied mehr ausgelöst haben als bei anderen. Eine psychische Erkrankung weckt also das schlechte familiäre Gewissen. Niemand aber weiß, was alles hinter einer psychischen Erkrankung steckt und warum ein Mensch auf familiäre Ereignisse so anders reagiert als viele andere Familienmitglieder. Man wird es nicht klären können und selbst wenn man meint, Spuren zu haben, so sind deren vermutete Folgen letztendlich nicht überprüfbar. Verantwortung dagegen ist etwas anderes: Wenn die Situation nun eingetreten oder als außergewöhnlich wahrgenommen wird, werden Familienangehörige gern oder weniger gern in die Rolle der Verantwortungsträger gehen. Vorsicht: Da psychisch kranke Menschen oft sehr sensible Menschen sind, ist für die Verantwortungsübernahme ein sensibler Aushandlungsprozess notwendig. Zwischen Vernachlässigung von außen und Bevormundung von außen muss ein Weg gefunden werden, der für diese Personen in dem derzeitigen Zustand passend und hilfreich ist. Dabei dürfen Angehörige auch ihre eigenen Grenzen mit in die Überlegungen einbeziehen und sich schützen: Kein Familiensystem bedarf psychisch kranker Mitglieder und ausgebrannter Helfer! 90 7.3.3.3 Passivität und Eigenaktivität Kaum ein anderes Krankheitsbild greift so tief in das Zwischenmenschliche ein wie eine psychische Erkrankung. Durch den Umgang mit einem psychisch Kranken wird mithin fast jeder Mensch verunsichert, da die Kommunikation durch eine depressive Blockade nicht in gewohnter Form stattfinden kann. Freunde und Angehörige erfahren, dass sie mit dem Erkrankten nicht zurechtkommen, da sie ihn nicht erreichen können. Er reagiert nicht auf deren Ansprache und es erfolgt auch keine Reaktion, welche man von einem gesunden Menschen erwarten würde. Angehörige und Freunde berichten oft, dass sie meinen, der Passivität aktiv begegnen zu müssen und sich nicht vorstellen können, wie es im Inneren des Erkrankten aussieht. Durch die Reaktionen des Erkrankten werden viele erst einmal ärgerlich und fühlen sich anschließend dafür schuldig. So kommt es für das soziale Umfeld des Erkrankten zu komplizierten inneren Verwicklungen, welche durchaus eine Ähnlichkeit (allerdings nicht so schwerwiegend) mit den inneren Zuständen des Depressiven selbst haben. Die klassische Psychiatrie hielt Passivität lange für einen endogenen (inneren) Prozess, welcher auch als Negativ- oder Minussymptomatik beschrieben wird. Natürlich gibt es krankheitsbedingte Faktoren, welche Antriebslosigkeit und Passivität beeinflussen, daneben spielen jedoch auch Lerngeschichte, soziale Faktoren und persönlichkeitsbedingte Prozesse bei der Bereitschaft aktiv zu werden eine große Rolle. Menschen sind nicht grundlos untätig. Vielmehr gibt es verschiedene Ursachen, warum sie ihre Eigenaktivität nicht entwickeln wollen oder können. Antriebslosigkeit ist für den erkrankten Menschen unter den Umständen eine sinnvolle Strategie, ansonsten würde er sie nicht beibehalten. Wenn wir dieses Verhalten jedoch nicht verstehen können, nehmen wir aus Unwissenheit oftmals eine negative Grundeinstellung ein („Der will sich einfach nicht ändern.“). Wir erklären uns die fehlende Eigenaktivität mit einem mangelnden Wollen und stellen meist frustriert jede Bemühung zur Aktivierung des psychisch kranken Menschen ein. Deshalb ist das Verständnis dieser Faktoren, welche unter den herrschenden Umständen zur Passivität bewegen von großer Bedeutung (vgl. Knuf 2006). Die Auffassungen von Pflege waren nie einheitlich, vielmehr liegt eine Pluralität von psychiatrischer Pflege vor mit nationalen, regionalen, betriebsspezifischen, fachgebietsbezogenen und individuellen Ausprägungen (vgl. Abderhalden, Needham, Wolff, Sauter 2011). 91 Im Nachfolgenden soll das Bild des psychiatrisch Pflegenden in Bezug auf Passivität und Eigenaktivität gezeichnet werden, um einerseits den speziellen Bedürfnissen psychisch kranker Menschen in Abgrenzung zu somatisch erkrankten und andererseits der ressourcenorientierten Arbeit gerecht zu werden. Das Wissen darüber, was in uns, mit uns und um uns herum geschieht, ist für jeden Menschen außerordentlich wichtig. Umso wichtiger wird dies allerdings, wenn etwas Unerwartbares oder auch schwer zu Verstehendes geschieht. Das Wissen eines Menschen entscheidet in einer solchen Situation, wie und ob das unerwartete neue Ereignis in unsere bisherigen Erfahrungen integriert werden kann oder nicht. Kann ein Ereignis nicht integriert werden, fühlen wir uns der Situation nicht gewachsen, sind passiv oder resignieren. Informationen und Wissen stellen somit eines der wichtigsten Säulen des selbstbefähigten Handelns dar (vgl. Knuf 2006). Angehörige psychisch erkrankter Menschen sehen sich oft einer neuen und bedrohlichen Situation gegenüber. Psychische Erkrankungen gehen häufig mit Verhaltensänderungen einher, welche die bisherigen Rollenverteilungen in Frage stellen. Die Vermittlung von Wissen und Informationen ist für sie von enormer Bedeutung und garantieren erst ein aktives Handeln. Deshalb ist es von Wichtigkeit, Angehörige über mögliche Ursachen von Passivität auf zu klären. Hierzu sollen im Folgenden einige Modelle vorgestellt werden. „Erlernte Hilflosigkeit“ (Seligmann 1979) Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit besagt, dass Menschen immer wieder die Erfahrung machen, durch eigenes Handeln die Situation kaum oder gar nicht beeinflussen zu können. Dadurch trauen sich diese Menschen nichts mehr zu. Sie ziehen sich zurück und geben jede Hoffnung auf Veränderung durch eigenes aktives Handeln auf. Selbstwirksamkeitsgefühl (Bandura) Das Selbstwirksamkeitsgefühl besagt, dass man die persönliche Überzeugung besitzt, über bestimmte Fähigkeiten zu verfügen um Ziele zu erreichen. Zu diesem Gefühl kommen Menschen durch: • Direkte positive Erfahrung: „Ja, das kann ich!“ • Beobachtungen: „Was der kann, kann ich doch bestimmt auch!“ • Ermutigung: „Ich kann das, die anderen trauen mir das zu.“ • Körperliches Befinden: „Ich spüre mich der Aufgabe körperlich gewachsen. Ich habe die Energie, das zu tun.“ 92 Fehlende Notwendigkeit Kranken Menschen wird oftmals viel abgenommen. Dies ist vor allem in akuten Krankheitsphasen und Krisen auch sehr sinnvoll. Manchmal wird diese Hilfe von Umfeld aber auch auf gesunde Phasen ausgedehnt, so dass Angelegenheiten für sie erledigt werden („Wenn ich es nicht mache, machen es eh andere Menschen für mich“), wodurch Eigenaktivität und eigene Fähigkeiten reduziert werden. Angst vor Veränderung Menschen sind „Gewohnheitstiere“. Sie behalten gerne bekannte Verhaltensweisen bei, da sie ihnen vertraut sind. Das gilt auch, wenn diese selbstschädigender Natur sind. Dabei spielt Angst vor Veränderung und vor dem Ungewohnten eine große Rolle. Paternalistisches Beziehungsmodell „Ich weiß auch nicht, was die Ärzte mit mir vorhaben. Ich muss einfach abwarten, wie es weitergeht.“ (Aussage eines Betroffenen Knuf 2006: S. 87). Insbesondere langjährige psychiatrische Patienten sind in einem Beziehungsmodell gefangen, in welchem sie gelernt haben, dass ihre eigenen Wünsche und Erfahrungen nichts zählen. Sie empfinden andere als ihnen gegenüber entscheidungsbefugt. Passivität als Selbsthilfestrategie Dies kann bei Menschen der Fall sein, die in ihrem Leben sehr viele Misserfolge erlebt haben. Jeder Misserfolg destabilisiert das Selbstwertgefühl. Passivität kann hier eine sinnvolle Bewältigungsstrategie sein, um sich vor einem weiteren Selbstwertverlust zu schützen. Psychiatrische Pflege bedeutet in diesem Kontext, nicht nur das Handeln zu reflektieren, anzuregen und negative Effekte auszugleichen, sondern es bedeutet für Angehörige auch gemeinsam mit jemanden einen Weg oder einen Teil des Lebensweges gehen. Dabei kann Begleitung bedeuten, eine Stütze in schweren Zeiten zu sein, aber auch in die positiven Aspekte mitzugehen. Ein wichtiger, positiver Aspekt, bei dem pflegerisch Handelnde den Erkrankten begleiten und sogar eine Stellvertreterfunktion einnehmen können, ist die Hoffnung. Hoffnung und die Förderung von Hoffnung ist für den Genesungsprozess von Menschen enorm wichtig. Hoffnung ist ebenso wichtig bei Passivität und für Eigenverantwortlichkeit. Jemand handelt erst dann, wenn er Hoffnung auf Veränderung hat. Um Hoffnung zu zulassen benötigt es jedoch einen 93 Paradigmenwechsel. Sowohl die Psychiatrie als auch die westliche Welt sind defizitorientiert. So werden die kranken Aspekte eines Menschen in den Vordergrund gestellt, um eine Diagnose stellen zu können. Das vorherrschende biomedizinische Modell richtet den Blick auf die Pathogenese, was den Fokus auf die krankmachenden Aspekte und deren Behandlung legt. Hier liegt ein dichotomer Krankheitsbegriff zugrunde, welcher Krankheit als Abwesenheit von Gesundheit definiert (vgl. Huck 2004). Und auch in der Kommunikation, also in Teamgesprächen, Gesprächen mit Ärzten etc. wird der Blick eher auf die Defizite gerichtet. Hinzukommend galt jahrelang die Idee von der Chronifizierung psychischer Erkrankungen, wie sie von Kraepelin und Bleuler geprägt wurde. Dies obgleich bereits in den 1980er Jahren verschiedene Forscher herausfanden, dass ca. 50 % der Menschen, welche unter einer psychischen Erkrankung leiden, genesen (vgl. Eisold, Schulz, Bredthauer 2010). Um einen Genesungsweg antreten zu können, gilt Hoffnung sowohl für Betroffene als auch für Angehörige als wichtigste interne Voraussetzung. Es existieren viele Ansätze zum Thema Hoffnung, sei es im Bereich der Märchen, Mythen und Sagen oder im wissenschaftlichen Bereich der Philosophie, Theologie, der Erziehungswissenschaft und Psychologie. Im Sprachgebrauch wird Hoffnung oftmals mit Optimismus, Zuversicht und Vertrauen gleichgesetzt und ist auch im pflegerischen Kontext keine unbekannte Größe. Im 20. Jahrhundert beschäftigte sich der Philosoph Gabriel Marcel mit der Hoffnung. Seiner Ansicht nach folgt Hoffnung der Einschätzung der Erfüllung von Möglichkeiten und dem Willen zur Veränderung (vgl. Eisold 2011). Der Psychoanalytiker Erich Fromm vertrat die Meinung, dass Hoffnung in jedem Menschen von Geburt angelegt sei und die die Umwelt negativ sowie positiv beeinflusst werden könne. Nach Fromm verschließen Menschen, welche immer wieder in ihrer Hoffnung enttäuscht wurden, ihr Herz und können sich so von ihrer Umgebung zurückziehen. Hoffnungserhaltung ist somit wichtig, da Hoffnung und Rückzug eng verknüpft sein können (vgl. Eisold 2011). Insgesamt lässt sich sagen, dass Hoffnung eine essenzielle menschliche Erfahrung darstellt und sich im Fühlen, Denken, Verhalten und im Umgang mit sich selber und der Umwelt äußert. Hoffnung bedeutet Zukunftsorientierung, sowie positive Erfahrungen Aktivität und Verbundenheit. Hoffnung kann in Krisen für eine höhere Lebensqualität sorgen und die Genesung erheblich beeinflussen. Hoffnung lässt sich erwecken durch den Blick auf die Ressourcen, die gesunden Anteile und die Fähigkeiten, die ein Mensch besitzt, seinen Alltag selbständig zu gestalten. Ein Konzept, welches diese Faktoren in den Blick nimmt, ist das der Salutogenese. 94 Geistiger Vater dieses Konzepts ist Aaron Antonovsky, welcher erstmals aufgrund der Erforschung der Gesundheit ehemaliger KZ-Insassen die Frage stellte, welche Faktoren Gesundheit fördern. Das Konzept geht von der Grundthese aus, dass Gesundheit und Krankheit zwei Pole einer Lebenswirklichkeit darstellen, zwischen denen sich ein Mensch hin- und herbewegt. Gesunde und kranke Anteile schließen sich nicht aus, sondern treten bei jedem Menschen nebeneinander auf. Antonovsky schreibt entsprechend: „Wir alle sind terminale Fälle. Aber solange wir einen Atemzug Leben in uns haben, sind wir alle bis zu einem gewissen Grad gesund.“ (Antonovsky 1989: S. 53) Eine solche Definition von Gesundheit bietet einen positiven Grundaspekt an und lässt Patienten bis zum letzten hoffnungsvolle Momente. Effektive Krankheitsbewältigung heißt somit nicht eine Beseitigung von Krankheit, sondern vielmehr eine Anpassung und eine Aktivierung on Gesundheit. Im Modell der Salutogenese steht das Kohärenzgefühl im Zentrum. Dieses Gefühl lässt sich am besten als Überzeugung eines Menschen, Schwierigkeiten im Leben zu meistern, beschreiben und kommt somit dem Gefühl der Hoffnung sehr nahe. Das Kohärenzgefühl beinhaltet die Teilaspekte der Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit. Die Verstehbarkeit bezeichnet, dass Ereignisse im Leben nachvollziehbar und auch verständlich sind. Die Bewältigbarkeit meint die Hoffnung darauf, Lebensaufgaben entweder aus eigener Kraft oder mit Hilfe sozialer Unterstützung zu meistern, und Sinnhaftigkeit bezeichnet die Freude am Leben und das Gefühl der eigenen Bedeutsamkeit. Insgesamt haben Forschungen ergeben, dass ein hoher Zusammenhang zwischen dem Kohärenzgefühl und psychischer Gesundheit besteht (vgl. Huck 2004). 7.3.3.4 Selbst-Vernachlässigung Manche psychisch kranken Menschen beginnen sich selbst zu vernachlässigen. Diese Vernachlässigung bezieht sich auf die Körperpflege, oft aber auch auf die Ernährung, was ausreichende Menge oder Qualität betrifft. Wir wissen, dass bei chronisch psychisch Kranken, z. B. bei Psychotikern, Sucht oft eine Folge ist, weil die Patienten offenbar versuchen, den inneren Druck mit Alkohol oder Drogen zu reduzieren. Körperliche Vernachlässigung kann im häuslichen Kontext zu einem echten Problem werden, vor allem dann, wenn sie eine Person nicht mehr wäscht oder sich nicht mehr 95 helfen lassen will. Das kann sehr ärgerlich sein, ist aber als Ausdruck unterschiedlicher Gefühle zu verstehen: • Die Körper wird nicht mehr als Träger der Aktivitäten wahrgenommen oder quält, ist also nicht pflegenswert; • Man nimmt sich selbst nicht mehr wahr und braucht den Körper nicht zum Vollzug des Lebens im Alltag. • Man schätzt sich nicht mehr, hat keine Achtsamkeit für sich, und die eigene Person, die von Menschen zunächst einmal über den Körper wahrgenommen wird, wird unwichtig. • Auch hier gilt die Regel: das Symptom steht für eine Aussage über die Befindlichkeit, mehr noch: die Identität des Menschen. Da helfen nur Geduld und wohltuende Angebote: Zwar gibt es Kliniken, die auch einen schwer akuten Patienten, der psychotisch völlig in sich eingesponnen ist, zur Körperreinigung zwingen, aber auch sie warten erst einmal und versuchen, den Kokon, in dem ein Mensch verfangen ist, durch Beziehungsaufnahme und fürsorgliche Kommunikation zu erweitern, um einen Zugang zur Person zu bekommen. Ein Beispiel aus einem gerontopsychiatrischen Heim: Eine sehr alte Frau wäscht sich nicht mehr. Ihre Begründung: Wenn ein Mädchen sich wäscht, ist es eine Hure, so ihre Eltern. Die schwere Psychose, die sie zeit ihres Lebens hat, hat vermutlich etwas mit dieser Symbolik zu tun – da das Heim im ländlichen Bereich liegt, wissen manche Schwestern mehr, zumindest aus den im Dorf tradierten Erzählungen. Sie finden folgende Lösung: Die Frau wird gebeten, mal wieder mit den inneren Stimmen zu verhandeln, was dazu führt, dass sie nach einiger Zeit mit der Erlaubnis „zurückkommt“ und gebadet werden darf. Ist das Kapitulation vor der Krankheit, Verstärkung der Krankheit oder eine sensible Lösung? 96 8. Pflege der Pflegenden: Aufgaben der Fachkräfte Fachkräfte sollen es Familienangehörigen ermöglichen, für psychisch erkrankte Mitglieder in adäquater Form Verantwortung zu übernehmen und ihnen beim Vollzug eines weitgehend „normalen“ Lebens behilflich zu sein, ohne sich selbst zu schaden, zu schädigen oder auszubrennen. Dazu kann es wichtig sein, bestimmte Prinzipien anzuwenden, die die Angehörigen ihrerseits dann im Umgang mit den Familienmitgliedern ebenfalls anwenden können. 8.1 Ansätze der Angehörigenbegleitung psychisch kranker Menschen Wir unterscheiden u. a. folgende Zugänge, die wir aus der Literatur zur psychiatrischen Fallbearbeitung ableiten (Bosshard, Ebert, Lazarus 1999, S. 282ff), ohne auf die speziell sozialpädagogischen oder sozialarbeiterischen Details einzugehen. Verstehende Zugänge Darunter verstehen wir, dass die Angehörigen lernen sollen, die Krankheiten und ihre Symptome nicht nur in ein psychiatrisches Raster einzuordnen, sondern auch auf der Folie des Lebens den Menschen zu verstehen (auch wenn es manchmal nicht leicht verständlich ist). Damit soll nicht gesagt werden, dass die Lebensgeschichte die Ursache für eine Erkrankung sei, aber es soll betont werden, dass die Lebensgeschichte in einer Fülle von Variablen eine Rolle spielt – wie groß auch sie immer im Einzelfall sein mag. Wir berufen uns einerseits auf die Entwicklungspsychologie, die nicht mit der Kindheit oder Jugend abgeschlossen ist, sondern den ganzen Lebenslauf betrifft, weil immer neue Ereignisse und Veränderungen der Person in die Identität integriert werden müssen, andererseits auf die Life-event-Forschung, die sich mit Ereignissen im Lebenslauf beschäftigt, wobei traumatische Ereignissen eine besondere Beachtung gewidmet werden sollte: Übergriffen, Verlusten, Versagungen. Ziel des biografischen Zugangs ist es, die Ganzheit des Lebens und seine Bewertung aus dem Blickwinkel des kranken Menschen heraus zu verstehen: Er interpretiert sein Leben nach seinen Regeln, woran man mit Gegenregeln, Überredungen, Negierungen, Umdeutungen 97 etc. allenfalls vorsichtig umgehen sollte. Festgefahrene Sichtweisen, Sichtweisen, die oft mit fatalen und unumstößlichen Kausalitäten verbunden sind, dürfen thematisiert werden, man kann dem kranken Menschen andere Sichtweisen anbieten, aber man kann (und darf) sie ihm nicht überstülpen: Er wird sie dann sowieso nicht annehmen können. Für die Schulung der Angehörigen kann es hilfreich sein, die Selbstdefinitionen des Lebens seitens des kranken Familienmitgliedes mit der Interpretation durch die Angehörigen zu kontrastieren, nicht aber um das kranke Familienmitglied umzustimmen, sondern um die pflegenden Angehörigen zu motivieren, die Selbstdefinition des Patienten anzuerkennen und neben die eigene Definition zu stellen. Für die pflegenden Angehörigen kann es ertragreich sein, durch die Rekonstruktion der Geschichte des kranken Familienmitgliedes zu einer Mehrdeutigkeit des Lebens zu kommen, die es ermöglicht, Kontakt zu halten und „gerecht“ mit der Deutung durch den Patienten selbst umzugehen. Beziehungsgestaltung Auch hier sprechen wir von zwei Beziehungen: die zwischen der Pflegekraft und dem pflegenden Angehörigen und die zwischen dem pflegenden und dem kranken Angehörigen. Eine gute Arbeits- oder Betreuungsbeziehung ist unabdingbar für das dauerhafte Gelingen der Angehörigenpflege, damit sie sich nicht verheddert in Streit, Rechthaberei und letztendlich Verstärkung der Symptome. Eine gute Arbeitsbeziehung beruht auf folgenden Merkmalen: • Der „andere“ Mensch soll sich verstanden fühlen in seiner Krankheit und seiner Selbstdefinition; • Die Lebensqualität des kranken Menschen sollte unter dem Aspekt der Verbesserung im Blickfeld sein; • Das Vertrauen zwischen dem kranken und dem betreuenden Familienmitglied sollte gepflegt werden; • Seine Eigenwilligkeiten und Bedürfnisse sollten beachtet und wenn möglich erfüllt werden; • Die Selbstfürsorge der Pflegenden kommt letztendlich dem Patienten zugute und darf bzw. muss beachtet und gepflegt werden – dazu kann ebenso Abgrenzung und Immer-Wieder-Kontaktaufnahme gehören. 98 Formen des Arbeitsbündnisses „Arbeitsbündnis“ bedeutet, eine dauerhafte und vertrauensvolle Beziehung herzustellen, • die über die Zeit hinweg tragfähig bleibt, • Krisen hinnimmt und bewältigt, • ohne Bewertungen, Idealisierungen und Abwertungen, ohne Grenzüberschreitungen und Vernachlässigungen auskommt, • statt Restriktionen positive Verstärkungen einsetzt und • die Beziehung seitens des Betreuers immer wieder reflektiert und bei Bedarf flexibel und förderlich anpasst. Diese sind Merkmale einer (Arbeits-) Beziehung, die von grundsätzlicher Wertschätzung getragen ist und deshalb auch zwischen erwachsenen Menschen in unterschiedlichen Rollen möglich und wünschenswert sind. Das Begegnungsmodell von Dörner und Plog: „Irren ist menschlich“ Dörner und Plog betonen in ihrem Lehrbuch über psychische Krankheiten (1996) weniger das medizinische Modell als das Beziehungsmodell in seiner Bedeutung für den kranken Menschen. • Die Begegnung ist gekennzeichnet durch die Subjekt-Objekt-Trennung zwischen Helfer und Patient: die Grenzziehung ist wichtig und deutlich zu machen. • Dennoch entsteht eine Wechsel- und Austauschbeziehung, die nicht nur Hilfestellungen sondern auch Wahrnehmungen, Einschätzungen und (Selbst-) Definitionen umfasst: d.h. der Kranke wird nicht verstärkt in seinen problematischen Verhaltensweisen und Selbst- und Fremddeutungen, aber er bekommt sie auch nicht abgesprochen oder abtrainiert. Die Gefühle des Patienten werden aufgenommen, ernstgenommen und kommuniziert, auch und gerade dann, wenn der Patient das selbst nicht gut kann; • Nach jeder schwierigen Situation (und die kommen!!) nimmt der Helfer wieder den Kontakt auf und stellt im besten Fall ein kommunikatives Verstehen über die schwierige Situation her. 99 Ethische Sensibilität Die Beziehungsgestaltung beider Settings: Pflegekraft/pflegende Angehörige wie auch pflegende Angehörige/Patient kommt nicht ohne ethische Reflexionen aus. Diese betreffen • Die Balance von Nähe und Abgrenzung, • die Anerkenntnis unterschiedlicher Modelle, was ein gutes Leben sei, • die Aushandlungsprozesse, gerade in der Familienpflege, was von innen heraus möglich und leistbar und was von außen geholt und „eingekauft“ werden muss. 8.2 Ausblick: Was Angehörige beschäftigt, was sie tun und lassen sollten Es ist unmöglich, Regeln aufzustellen, die für alle gelten. Dennoch: Wenn es zum Einbezug der Angehörigen kommt, hat man es oft mit schwer kranken Patienten zu tun, nicht mit gespielten Symptomen oder allein schwierigen Verhaltensweisen. Wenn Verhaltensweisen schwierig sind, so sollten sie verstanden werden als Ausdruck z. B. einer Depression, als Bestandteil einer Psychose oder einer Persönlichkeitsstörung. Die großen Zirkel von Erschrecken, Schuld- und Schamgefühlen, Wut und Aggression, Sich-Vergraben und Isolation sollten verhindert werden, u. a. auch dadurch, dass Angehörige sich selbst Hilfe holen. Es gilt anzuerkennen, dass der Mensch sich verändert hat und dass dies oft nicht rückgängig gemacht werden kann, sowohl was das Privatleben als auch den Beruf betrifft. Die Frage: kann der Patient nicht anders oder will er nicht anders, wird Angehörige immer begleiten. Sie ist unumgänglich, doch in vielen Fällen letztendlich nicht zu beantworten. Angehörige sollten grundsätzlich eine Entscheidung treffen – und dabei brauchen sie möglicherweise Hilfe von außen, ob sie Verantwortung übernehmen und wenn ja, wie weit diese gehen soll. Dabei sind Veränderungen beim kranken Menschen Rechnung zu tragen. Nur so geben sie dem Patienten ein Stück Sicherheit und Verlässlichkeit. 100 Angehörige müssen und dürfen aber auch Grenzen ihrer Verantwortung wahrnehmen und entschieden, wann sie Hilfe von außen oder von einer Klinik in Anspruch nehmen müssen: Krankenhausaufenthalte der Patienten sind manchmal unumgänglich, ja sogar notwendig, um den Kranken vor sich selbst zu schützen. Andererseits gibt es auch eine dritte Position, eine durchaus problematische Position: Wenn Verantwortungsübernahme und Hilfe eine Option, Abgrenzung die andere Option ist, dann gibt es auch eine dritte: unterlassene Hilfestellung. Im Kontext schleichender psychischer Krankheiten kann die „unterlassene Hilfe“ unbemerkt eintreten. Von daher ist es sinnvoll, wenn mehrere Personen, auch nicht involvierte Personen wie z. B. Fachpersonal Einblick in die Situation bekommen und beraten oder mit entscheiden können, wie eine mögliche Hilfestellung aussieht. Es sind nicht zwingend die Angehörigen, die die Hilfe leisten müssen. Das Austarieren zwischen Hilfe für den kranken Angehörigen und Bedrängen oder Bevormundung des Patienten ist notwendig und muss immer wieder neu geschehen. Nicht nur Patienten, auch Angehörige werden sich damit auseinandersetzen müssen, dass eine Krankheit, wenn sie chronisch wird, sie es vermutlich auch bleiben wird. Die Frage nach dem eigenen Leben darf gestellt werden – und: Verzicht auf das eigene Leben macht den anderen nicht gesund! Psychisch kranke Menschen in Familien sind oft Lebensaufgaben und haben, wie alle Lebensaufgaben, schöne wie schwierige Seiten. An allen kann man wachsen. 101 Literaturverzeichnis Abderhalden, C.; Needham, I.; Wolff, S.; Sauter, D. (2011): Auffassung von Pflege. In. Abderhalden, Needham, Wolff, Sauter (Hrg.): Lehrbuch psychiatrische Pflege. Bern, Huber. S. 43-55. Albrecht, K. P. (1997): Familien“krankheit“ Alkoholismus. Oldenburg, Bibliotheksund Informationssystem der Universität Oldenburg. Antonovsky, Aron (1989): Die salutogenetische Perspektive: Zu einer neuen Sicht von Gesundheit und Krankheit. Meducs, 2, S. 51-57 Antonovsky, Aron (1997): Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Deutsche erweiterte Ausgabe von A. Franke. Tübingen, Dgvt-Verlag. Bandura, Albert (1977): Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84 (2), S. 191-215. Bandura, Albert (1979): Sozialkognitive Lerntheorie. Stuttgart, Klett-Cotta. Bauriedl, Thea (1998): Beziehungsanalyse. Berlin, Suhrkamp. Bleuler, Eugen (1916): Lehrbuch der Psychiatrie. Berlin, J. Springer. Bosshard, M; Ebert, U; Lazarus, H. (1999): Soziale Arbeit in der Psychiatrie. Köln, Psychiatrie-Verlag. Boszormenyi-Nagy, Ivan; Spark, Geraldine (1973): Unsichtbare Bindungen. Stuttgart, Klett-Cotta. Buchholz, Michael. B. (2000): Dreiecksgeschichten. Eine klinische Theorie psychoanalytischer Fami-lientherapie. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. Cierpka, Manfred (Hrsg.) (1988): Familiendiagnostik. Berlin, Springer. Dörner, Klaus; Plog, Ursula (1996): Irren ist menschlich. Bonn, Psychiatrie-Verlag. 102 Eisold, Anna (2011): Hoffnung. In: Abderhalden, Needham, Wolff, Sauter (Hrg.): Lehrbuch psychiatrische Pflege. Bern, Huber. S. 755-767. Eisold, A., Schulz, M., Bredthauer, D. (2010): Hoffnung aus Sicht Psychiatrieerfahrener. Psychiatrische Pflege heute (1), S. 10-16. Flassbeck, Jens (2010): Co-Abhängigkeit. Diagnose, Ursache und Therapie für Angehörige von Suchtkranken. Stuttgart, Klett-Cotta. Foucault, Michel (1984): Was ist Kritik. Berlin, Merve. Goffman, Irving (1967): Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt a.M., Suhrkamp. Häfner, Heinz (1995): Psychische Erkrankungen im Erwachsenenalter. Stuttgart, G. Fischer. Häfner, Heinz (1999): Gesundheit – unser höchstes Gut? Berlin, Springer. Henseler, Heinz (1974): Narzisstische Krisen: zur Psychodynamik des Selbstmords. 11. Neuauflage. Reinbek, Rowohlt. Huck, G. (2004): Krankheit bekämpfen oder Gesundheit aktivieren? Die Bedeutung der Salutogenese für die psychiatrische Pflege. In: Psych Pflege 10. S. 2-12. Kanfer, F. H.; Saslow, G. H. (1965): Behavioral Analysis. An Alternative to Diagnostic Classification. Arch Gen Psychiatry, S. 529-538. Kläusler-Senn, Charlotte; Stohler, Rudolf (2012): Angehörige und Sucht: Zeit für einen Perspektivenwechsel. In: Zeitschrift „SuchtMagazin“ 01/2012. Knuf, Andreas (2006): Basiswissen: Empowerment in der psychiatrischen Pflege. Bonn, Psychiatrie- Verlag. Körkel, Joachim (Hrsg.) (1988): Der Rückfall des Suchtkranken. Flucht in die Sucht? Berlin, Heidelberg, Springer. 103 Körkel, Joachim; Schindler, Christine (2003): Rückfallprävention mit Alkoholabhängigen. Berlin, Heidelberg, Springer. Kraepelin, Emil (1899): Psychiatrie: ein Lehrbuch für Studierende und Aerzte. Leipzig, J. A. Barth. Kruse, Gunther; Körkel, Joachim; Schmalz, Ulla (2000): Alkoholabhängigkeit erkennen und behandeln. Bonn, Psychiatrie-Verlag. Kuntz, Helmut (2009): Der rote Faden in der Sucht. Abhängigkeit überwinden und verstehen. Weinheim und Basel, Beltz. Link, B. G. et al. (1989): A modified labeling theory approach in the area of mental disorders. Ameri-can Sociological Review 54, S. 100-123. Mentzos, Stavros (1995): Depression und Manie. Psychodynamik und Therapie affektiver Störungen. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. Neckel, Sighard (1991): Status und Scham: zur symbolischen Reproduktion sozialer Ungleichheit. Frankfurt. a. M., Campus. Nieuwenboom, Wim (2012): Die Stigmatisierung Angehöriger von SuchtpatientInnen. In: Zeitschrift „SuchtMagazin“ 01/2012. Richter, Horst-Eberhard (1962): Eltern, Kind und Neurose. Reinbek, Rowohlt. Roediger, Eckhard (2009): Praxis der Schematherapie: Grundlagen – Anwendung – Perspektiven. Stuttgart, Schattauer. Rost, Wolf-Detlef (1992): Psychoanalyse des Alkoholismus. Stuttgart, Klett-Cotta. Ruckstuhl, Lea (2012): Angehörigen-Selbsthilfe und Co-Abhängigkeit. In: Zeitschrift „SuchtMagazin“ 01/2012. Rudolf, Gerd (2004): Strukturbezogene Psychotherapie. Stuttgart, Schattauer. 104 Scheff, T. J. (1966): Being Mentally Ill: A Sociological Theory. Chicago, de Gruyter. Seligman, Martin E. P. (1979): Erlernte Hilflosigkeit. München, Wien, Baltimore: Urban und Schwarzenberg. Stierlin, Helm (1978): „Rolle“ und „Auftrag“ in der Familientheorie und -therapie. In: Stierlin, Helm: Delegation und Familie. Frankfurt a. M., Suhrkamp, S. 11-36. Tellenbach, Hubertus (1974): Melancholie. Berlin, Springer. Thomasius, Rainer; Küstner, Udo J. (2005): Familie und Sucht. Stuttgart, Schattauer. Willi, Jürg (2001): Die Zweierbeziehung. Reinbek, Rowohlt. Wolfersdorf, Manfred; Schüler, Michael (2004): Depressionen im Alter. Stuttgart, Kohlhammer. Wurmser, Léon (1997): Die verborgene Dimension. Psychodynamik des Drogenzwangs. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. Wurmer, Léon (1993): Die Maske der Scham. Magdeburg, Verlag Klotz. 105