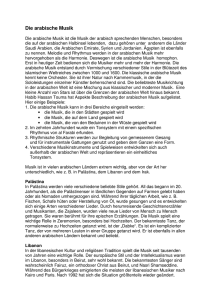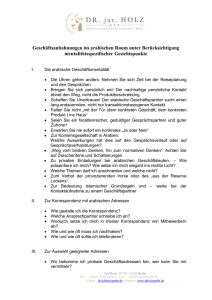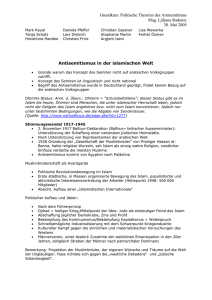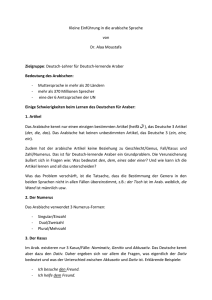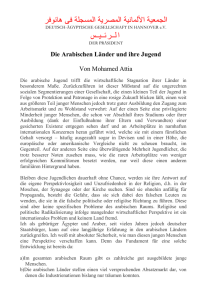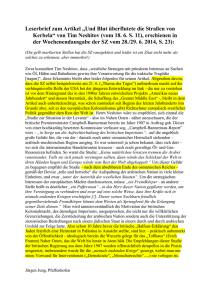Der SounDtrack Der revolte - Goethe
Werbung

GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 1 GoetHe-InStItut GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 2 Der Soundtrack der Revolte Die Volksaufstände in der arabischen Welt werden von vielen Künstlern der Region musikalisch begleitet und in ihren Songtexten reflektiert. Ihre rebellischen und politischen Klänge sind ein Sprachrohr für die ausgegrenzte urbane Jugend. Doch diese Protestkultur ist kein neuartiges Phänomen. Von Arian Fariborz Mohammed El Deeb. Foto: Mohammed El Deeb © Goethe-Institut Wenn sich in den vergangenen Monaten des „arabischen Frühlings“ viele politische Beobachter im Westen ungläubig die Augen gerieben haben über die Wucht und Intensität der Volksaufstände gegen die Despotien in der arabischen Welt, wirft dies ein Schlaglicht darauf, wie wenig man von der weit verbreiteten Unzufriedenheit der arabischen Zivilgesellschaften wahrhaben wollte. Das gilt besonders für die jüngere Generation, die sich vehement gegen die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung, der künstlerischen Freiheit und der sozialen Misere in ihren Ländern auflehnt. Und das nicht erst seit gestern. Junge Menschen, die heute das Gros der Bevölkerungen in den arabischen Staaten stellen, sind bereits seit Jahrzehnten – wie in Ägypten – die Hauptleidtragenden von „Mubaraks Kriegen im eigenen Haus“, wie es der ägyptische Soziologe Saad Edin Ibrahim formulierte. Sie sind die Opfer von Notstandsgesetzen, Medienzensur, Polizeifolter und juristischer Willkür. Diese Wut einer jahrzehntelang unterdrückten Jugend hat nun das Fass zum Überlaufen gebracht. Karim Kandeel, Frontmann und Gitarrist der Punkband Brain Candy aus Kairo ist einer von jenen Verzweifelten, die schon zu lange unter dem System Mubarak gelitten haben. „Wir waren hirntot. Wir krepierten hier – langsam, aber sicher“, sagt der 23-Jährige rückblickend auf die bleierne Ära der ägypti- schen Kulturpolitik unter Mubarak. „Die Hälfte unserer Lieder handelte denn auch von all den negativen Erlebnissen, die wir in den letzten Jahren hatten, von dem Frust und dem Gefühl, auf immer hier gefangen zu sein.“ Gefangen im System Mubarak, ohne Chance, ihre Musik einem größeren Publikum vorzustellen, da ihre rebellischen Klänge zu sehr bei den politischen Obrigkeiten am Nil anecken und angeblich auch die religiösen Gefühle der Menschen verletzen könnten. Doch mit dem unerwartet schnellen Fall des Pharao schöpft er neue Hoffnung: „Eigentlich haben wir alle nicht mehr daran geglaubt, dass so etwas jemals passieren könnte. Wir atmen zum ersten Mal nach einer halben Ewigkeit die Luft der Freiheit.“ Die Jungs vom Tahrir-Platz Genau wie Kandeel geht es vielen unangepassten Rock- und Popmusikern, die vom Staat jahrzehntelang drangsaliert und schikaniert wurden. Und die während des 18-tägigen Aufstandes zum Kairoer Tahrir-Platz strömten, um ihrem Unmut über das Regime Luft zu machen. Mit Tablas, Tambourinen, Gitarren und Flöten unterstützten sie lautstark die Anti-Mubarak-Chöre der Demonstranten auf dem zentralen Platz der Befreiung. GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Unter ihnen war auch der 27-jährige Mohammed El Deeb aus Kairo, einer der gegenwärtig populärsten Hip-Hop-Künstler Ägyptens. Mit dem Mikrofon in der Hand und sarkastischbissigen Wortspielen gegen das Regime zog der junge Shooting-Star der ägyptischen Rap-Szene all jene Jugendliche auf dem Tahrir-Platz in den Bann, die bereits seit langem die Nase voll haben von den gesellschaftlichen Zwängen und der autoritären Gängelung in der Mubarak-Ära. Bereits seit dem ersten Tag der Protestveranstaltungen auf dem Tahrir-Platz war Deeb mit von der Partie und verlieh mit seiner Stimme der revoltierenden Jugend Wort und Klang. In seinem Song „Übergangsphase“ (fatra enteqaleyya ) lässt der Poet und MC die euphorische, revolutionäre Stimmung während der Proteste auf dem Tahrir-Platz in Kairo und im ganzen Land bildhaft Revue passieren: Wir haben den verhassten Diktator, den verdammten Pharao vertrieben/Dank Twitter und Facebook haben junge Revolutionäre in Ägypten die Sprache der Wahrheit gefunden/Sie sagen uns: Nein, kein Stein wird sich bewegen, Inshallah, bis die Erde untergeht/Unsere Revolution kommt aus dem Volk, friedlich und patriotisch!/Wir wollen Freiheit, Würde und Gerechtigkeit/Das Volk steckte in der Umklammerung einer eisernen Faust/Benutzt und ausgenommen von persönlichen Interessen/Sie haben uns mit aller Gewalt misshandelt/Aber am 11. Februar haben wir ein Fest mit Millionen gefeiert/ Hoch sollst du leben, tapferes Ägypten, wir haben die Freiheit erkämpft!/Übergangszeit, Werbepause, Tee und Cleopatra-Zigaretten!/Gelbe Gesichter schwärmen von diesen Nachrichten!/Strafstoß – und das Publikum wartet auf den Treffer/ Jeden Tag lesen wir in der Zeitung über einen neuen Typen, der das Land beraubt hat/Schau in den Spiegel, gib das Gold zurück, bist du nicht auch verantwortlich für die Lage im Land?/Muss man sich über all die falschen Versprechen etwa wundern?/Von Problemen infiziert wurde Geschichte geschrieben/Und denkt bloß nicht, das Volk sei müde!/Das Volk jubelt, 50 Jahre war es unterdrückt/Der wahre ägyptische Revolutionär hat schon vor seiner Befreiung über den Mann hinter Omar Suleiman gelacht/Der wahre ägyptische Revolutionär hat nach der Befreiung, nach dem Feiern die Straßen und Plätze sauber gemacht. Seit Beginn des Aufstands gegen das Mubarak-Regime fiel die bleierne Last der vergangenen Jahrzehnte schlagartig vor allem jungen Popmusikern und Bands von den Schultern – Gruppen, die sich durch das politische Erdbeben ermutigt fühlten, zum ersten Mal offen ihren Protest gegen das Regime in ihren Songs zu formulieren. 3 Neben Deeb thematisierten auch andere Hip-Hop-Bands wie die Arabian Knightz aus Kairo den Aufstand gegen das Mubarak-Regime. In ihrem Song „Not your prisoner!“ geht es um die Brutalität der ägyptischen Polizeikräfte bei der versuchten Niederschlagung des Aufstandes. Als die Proteste gegen Mubarak ihrem Höhepunkt entgegensteuerten, rief die auf Arabisch und Englisch rappende Crew in ihrem Song „Rebel!“ unverblümt zum Sturz des Regimes auf. Das Kairoer HipHop-Trio beschreibt das Stück als „emotional aufbauenden Song, der das Herz, den Mut und den Geist des ägyptischen Volkes ausdrückt, das gegenwärtig in einer Revolution gegen ein unterdrückerisches Regime kämpft“. Die Rapper von The Narcicyst etwa (feat. Amir Sulaiman, Ayah, Freeway, Omar Offendum) lassen in ihrem Musikvideo „25. Januar”, dem Beginn des Aufstandes gegen Mubarak, im Stil US-amerikanischer Vorbilder den blutigen Verlauf der Revolution Revue passieren. „Herr Präsident, Ihr Volk stirbt!“ Die Zeiten, als unangepasste Rock- und Popmusiker in Ägypten, wie etwa die Heavy Metal-Musiker in Kairo, noch von der Staatssicherheit beschattet, inhaftiert, gefoltert und öffentlich als Satanisten und Junkies diffamiert wurden, scheinen nunmehr endlich vorbei zu sein. Doch während Ägyptens geschasste Undergroundmusiker und Bandformationen ihren Protest aus Furcht gegen das Mubarak-Regime bis zum Ausbruch des Aufstandes nie wirklich offen artikulierten, war die Entwicklung in den benachbarten Maghrebstaaten eine völlig andere. In Algerien – und seit jüngster Zeit auch in Tunesien – hat sich eine Generation junger Musiker mit politischem Bewusstsein etablieren können, die mit Hilfe des Rap und des Mikrofons die herrschenden Missstände, die Korruption und Vetternwirtschaft der politischen Eliten in ihren Ländern konsequent anprangert. So avancierte in Tunesien im Verlauf der Jasminrevolution der Protestsong „Herr Präsident, Ihr Volk stirbt!“ (Rais Lebled ) des Rappers Hamada Ben Amor (auch „El Général“ genannt) auf einen Schlag zum Revolutionssong und begeisterte die tunesische Jugend. Darin kritisiert der 22-jährige Hip-Hop-Youngster aus der tunesischen Hafenstadt Sfax aufs Schärfste die Verschwendungssucht und Selbstbereicherung der Präsidentenfamilie Ben Ali und dessen Entourage sowie die grassierende Armut in seinem Land. Via Facebook, Youtube und Twitter erlangte GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 „El Général“ rasch Popularität bei vielen jungen Tunesiern, die genauso dachten wie er. Mit „Rais Lebled“ schaffte es Ben Amor vor kurzem gar ins Time Magazine auf die Liste der 100 einflussreichsten Personen der Welt. Die Resonanz auf den Song in Tunesien war jedoch schon vor dem Ausbruch des Aufstands gegen Ben Ali gewaltig – zu gewaltig, weshalb ihn die tunesische Geheimpolizei am 6. Januar flugs zum Verhör aufs Revier zerrte und vorübergehend inhaftierte. „Ich habe einfach erzählt, was sich in Tunesien abspielt“, erzählt Ben Amor. „Ich habe alles in einen gerappten Brief an den Präsidenten gepackt. Dafür bin ich im Knast gelandet. Sie haben mich drei Tage verhört. Gefoltert haben sie mich nicht – der Präsident wollte keine Märtyrer schaffen. Er wusste, dass wir Rapper das Sprachrohr der tunesischen Jugend sind.“ Und auch der tunesische Rapper Balti – alias Dragonbalti – gilt wegen seiner sozialkritischen lyrics als Ikone der jugendlichen Hip-Hop-Subkultur. Auch er war Ben Alis Polizeistaat lange ein Dorn im Auge. „Sprich und stirb!“ Das große Vorbild für Tunesiens Rapper ist zweifellos die seit Langem präsente Hip-Hop-Kultur in Algerien, von wo sich das Virus bereits Ende der 1990er Jahre in die gesamte arabische Welt ausbreitete. Algerien gilt als die Wiege des arabischen Hip-Hop. Dort lief der Rap dem bis dahin bei der algerischen Jugend so populären Rai-Pop den Rang ab und entwickelte sich während des sogenannten „schwarzen Jahrzehnts“, wie die Algerier den langjährigen Bürgerkrieg in ihrem Land nennen, zum politischen Sprachrohr der Jugendlichen in den Metropolen von Algier, Annaba und Oran. „Während des schwarzen Jahrzehnts spielte es in Algerien keine Rolle, ob man Künstler oder Polizist war. Alle hatte Angst vor den Extremisten oder den Aktionen der Armee“, erinnert sich Touat M’Hand, Musiker der Hip-Hop-Gruppe Le Micro brise le Silence („Das Mikrofon bricht das Schweigen“), eine der populärsten Pionierbands der algerischen Rap-Szene. „Der große algerische Schriftsteller Tahar Djaout, der während des Bürgerkriegs 1993 ermordet wurde, hatte einmal gesagt: ‚Wenn du schweigst, dann stirbst du, wenn du sprichst, stirbst du auch; also sprich und stirb!‘ Dieser Satz ist für uns zum Lebensmotto geworden: Zu sagen was ist, das Schweigen zu brechen und das Unrecht zu benennen – trotz der Bomben, des Terrors und der Gefahr für das eigene Leben“, berichtet M’Hand. 4 „Glokalisierung“ und Hip-Hop Was an Hip-Hop fasziniert, sind die Bilder und Sounds der amerikanischen Musikindustrie und die Adaptionen lokaler Akteure und Themen gleichermaßen. Trotz, oder gerade wegen der äußerst widrigen Bedingungen, die im Algerien der letzten 20 Jahre herrschten, hat sich Hip-Hop überwiegend als Ausdrucksform der Jugend durchgesetzt. Wie an vielen Orten weltweit bietet Hip-Hop in Algerien den Beleg für ein Phänomen, das die Cultural Studies mit dem Begriff „Glokalisierung“ beschreiben – globale und lokale Erscheinungen sind hier nicht einander gegenübergestellt, sondern werden kombiniert, beeinflussen sich gegenseitig und bilden Synthesen. Scheint die Hip-Hop-Kultur gerade im Ursprungsland nur noch für hemmungslosen Hedonismus, für Illusionen von Sex und Gewalt zu stehen, wird in Ländern wie Algerien – aber heute auch in Ägypten, Tunesien und Palästina – ein schon beinahe vergessenes Potenzial des HipHops hörbar: Rap heißt hier Sprechen über die Realität, über den oftmals deprimierenden Alltag, über politisches Unrecht, Terror und Krieg. Mehr denn je trifft Hip-Hop heute das Lebensgefühl der algerischen Jugend, die heute wieder gegen das Regime Bouteflika aufbegehrt. Denn auch Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs haben sich ihre Lebensbedingungen nicht wesentlich gebessert. Vom Rohstoffreichtum des algerischen Rentierstaats, den hohen Einnahmen aus dem Erdöl- und Erdgasgeschäft, profitiert vor allem nur die kleine wirtschaftliche und politische Elite des Landes. Der Großteil der Bevölkerung geht leer aus, allen voran die algerische Jugend. Armut, Arbeitslosigkeit, Wohnungsmangel, Bildungsmisere und generelle Perspektivlosigkeit bestimmen ihren Alltag, wie Nabil Bouaiche von der algerischen Hip-Hop-Formation Intik berichtet: „75 Prozent der algerischen Bevölkerung sind jung – eigentlich wären das genug Jugendliche, um ein wunderbares Land aufzubauen. Aber das Gegenteil ist der Fall! Die Jugend rackert sich ab und kämpft ums tägliche Überleben. Es gibt junge Leute mit Hochschulabschlüssen, die sich als Kellner durchschlagen müssen.“ Auch fehlen den meisten jungen Musikern die finanziellen Mittel, um Musikaufnahmen machen zu können. „Wir waren zum Beispiel gezwungen, ständig unser eigenes Geld aufzuwenden, um produzieren zu können“, so Nabil Bouaiche. „Ein Bandmitglied musste sogar einmal seine Schuhe verkaufen, um das Studio zu bezahlen!“ GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Die Fortsetzung der algerischen Tragödie Und die soziale Misere der Jugend hält an. Sie droht auch in Algerien in einen Aufstand der Entmündigten gegen das ancien régime umzuschlagen. Während der Brotunruhen 1988 standen sie auf, um gegen die Diktatur der FLN-Einheitspartei unter Chadli Benjedid zu demonstrieren. Und schon damals galt das verarmte Arbeiterviertel Bab El-Oued als Zentrum des Widerstands. In Bab El-Oued war es dann auch, wo sich zum ersten Mal in der arabischen Welt in den 1990er Jahren eine vitale politisierte Hip-Hop-Bewegung zu formieren begann. Heute stehen die demonstrierenden Jugendlichen aus Bab El-Oued erneut im Fokus der Weltöffentlichkeit, um mit dem Mikrofon oder dem Stein in der Hand gegen dieselben sozialen Missstände aufzubegehren wie schon vor über 20 Jahren. Nichts hat sich geändert. Und so bewahrt 5 sich auch heute, was Le Micro Brise le Silence (MBS) bereits vor Jahren in ihrem Kult-Song „Monsieur le Président“ beklagten, nämlich die Fortsetzung der „algerischen Tragödie“: Monsieur le Président hat gesagt: Algerien ist ein Haus aus Glas!/Kommt, schaut her: Alles klar, wir sind doch Freunde!/ Von der Terrasse bis zur Garderobe alles voller Leichen!/Die ganze Welt weiß es! Wozu noch darüber im Fernsehen reden!/Diese Leute töten nicht mehr, also lasst sie doch!/Unsere Generäle haben sich die Taschen vollgestopft, na und?/ Wem nützen schon die Namen und die Nummern der Schweizer Konten?/Man ist auf den Kaimaninseln/Unsere Emigranten gehen ein bisschen in Urlaub, voran mit ihrem Schwarzgeld/Den Dorfbewohnern kann’s ja egal sein, die werden gar nicht erst gefragt/Im schlimmsten Fall heißt es nur: ‘Ihren Rücktritt, Herr Präsident, Danke schön!‘ Arian Fariborz ist Politik- und Islamwissenschaftler. Zuletzt erschien 2010 im Palmyra-Verlag Rock the Kasbah – Popmusik und Moderne im Orient. Copyright: Goethe-Institut e. V., Fikrun wa Fann November 2011 El Deebs Website: http://deeb.bandcamp.com/album/cairofornia-ep de, en, ar, fa Masrah Deeb Video: http://www.youtube.com/watch?v=iuMpRv2cako de, en, ar, fa Interview mit Deeb: http://grungecake.com/archives/195 de, en GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 6 Interview mit Mohammed El Deeb Der ägyptische Hip-Hop-Künstler Mohammed El Deeb machte 2005 mit der Hip-Hop-Gruppe Asfalt seinen ersten Schritt in die Szene. Arian Fariborz sprach mit ihm über seine Musik. Von Arian Fariborz Mohammed El Deeb. Foto: Halim El Sharani Deeb ist ein ägyptischer Hip-Hop-Künstler, Poet und Berichterstatter, der 2005 mit der ägyptischen Hip-Hop-Gruppe Asfalt seinen ersten Schritt in die Szene gemacht hat. Deeb, 1984 in Kairo geboren, verließ Asfalt im Jahr 2007, um zusammen mit Mohamed Yasser Wighit Nazar („Betrachtungsweise“, „Perspektive“) zu gründen. Das erfolgreiche Musikprojekt, das in puncto arabischem Hip-Hop mit positivsarkastischem Wortwitz überraschte, dauerte bis 2010 an. Mit dem dezidiert positiven Ansatz hat das Musikprojekt versucht, der gesellschaftlichen Stimmung etwas entgegenzustellen: Während der Regierungszeit Mubaraks herrschte ein Regime der Negativität über die Menschen. In politischen Diskussionen wurde einem das Gefühl vermittelt, es gebe keinen Ausweg aus der Repression, was viele frustrierte und zu einer allgemeinen negativen Stimmung und Haltung beitrug. Die Enttäuschungen und die Traurigkeit waren in die Gesichter der Menschen eingeschrieben. Seit kurzem arbeitet Deeb verstärkt an seiner Solo-Karriere, „Cairofornia” ist seine erste Solo-EP. In seinen Texten, geschrieben im umgangssprachlichen Arabisch, adressiert der Künstler soziale, persönliche und kulturelle Angelegenheiten des ägyptischen Alltags. Deeb ist ein nostalgischer Verfasser, inspiriert durch den Puls der Stadt und der Popkultur – und mit einem Blick für die künstlerische Vielfalt Ägyptens vor 1952. Mit Bezug auf seine Texte beschreibt sich Deeb selbst als „soziales Gewissen“ seiner Zuhörer, süchtig nach popkulturellen Elementen, was auch in seinen dichterischen Werken zu spüren ist. Popkultur ist für ihn Teil seiner Identität und auch Teil der ägyptischen Identität. Das Themenfeld, in dem er sich bewegt, nimmt den Puls der Stadt auf, inspiriert von den Worten in den Straßen, und so sind es auch die Menschen in den Straßen, die sein Zielpublikum sind: Vom Taxifahrer über den Zeitungsverkäufer bis hin zum Kioskbesitzer. Deeb beschreibt Auseinandersetzungen mit Korruption und Depression, mit sozialer Ungleichheit, der Unterdrückung der Frauen und dem Kampf auf den Straßen in Bezug auf alltägliche Belästigungen. Da bis vor kurzem noch staatlich kontrollierte Medien und Zensur eine große Rolle spielten und stark kontrolliert wurde, was gesagt werden durfte, sind die Menschen gegenwärtig hungrig nach kritischen, neuen Künsten und Ausdrucksformen. GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Auf dem Poesiefestival möchte der Künstler seine Darstellung der Revolution dem westlichen Publikum näherbringen und in dichterischer Form erzählen, wie es war und ist, in der prä- und post-Mubarak-Phase Ägyptens zu leben, welche Kämpfe noch anstehen und noch auszufechten sind. Besonders in der Phase der Revolutionen und Proteste in der arabischen Welt wird die Identität der Menschen wieder zueinandergeführt und gefühlt – gerade auch vermittelt durch die lyrische Sprache: In diesen Zeiten als Poet oder MC Sprachrohr der jungen Generation in Ägypten zu sein und über soziales Bewusstsein und Verantwortung sprechen zu können, ist etwas Besonderes. Mit ihm sprach Arian Fariborz. Arian Fariborz: Bitte beschreiben Sie den Beginn Ihres Musikprojektes und die ersten Schritte, die Sie mit Asfalt und später mit Wighit Nazar machten. Welches war die Hauptidee, die dahintersteckte, diese Art der Musik zu schaffen, und welche Botschaft wollten Sie damit an die ägyptische Öffentlichkeit richten? Deeb: Wie ich zum Hip-Hop kam, ist eine lustige Geschichte. In der Schule hatte ich schon immer Gefallen daran, Gedichte zu schreiben. Als ich in der Oberstufe war, sollten wir als Hausaufgabe für die Französischstunde einen französischen Rapsong schreiben. Alle meine Klassenkameraden reichten die Hausaufgabe schriftlich ein, ich war der Einzige, der seinen Rap mit einem Beat im Hintergrund auf Kassette aufnahm. Dies war der Zeitpunkt, als der Hip-Hop mich gepackt hatte. Als der Lehrer meinen Song vor der Klasse abspielte, lobten meine Klassenkameraden und Freunde mich. Ich hatte meinen ersten Rapsong auf Französisch geschrieben! Da dachte ich mir: Wenn ich einen Rapsong auf Französisch schreiben kann, also in einer Sprache, die nicht meine Muttersprache ist, dann kann ich es ebenso auch auf Englisch. Im Jahre 2005 kehrte ich aus der Golfregion, wo ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht hatte, zurück nach Ägypten. Ich stellte fest, dass ich vorwiegend auf Arabisch sprach und dachte, und entdeckte dadurch mich selbst und meine Kultur zum ersten Mal. Im Jahre 2006 kam ich zu Asfalt, die eine der ersten ägyptischen Hip-Hop-Crews war, die in umgangssprachlichem Arabisch rappte. Später gründete ich dann Wighit Nazar („Blickwinkel“), ein Musikprojekt, bestehend aus dem Asfalt -Mitglied Mohamed Yasser und mir. Die Chemie stimmte einfach und wir bekamen es hin, uns einen respektierten Namen in der Untergrundszene zu schaffen. Schließlich verließ ich Wighit Nazar in 2010, um meine Solo-Karriere zu starten, und weil es kreative Differenzen zwischen uns gab. Die Haupt-Botschaften, die in meinen Songs transportiert werden, handeln von Identitätsfragen, kultureller Wachsamkeit, sexueller Belästigung sowie sozialer 7 und politischer Unterdrückung. Außerdem will ich mein Volk an die guten alten Tage erinnern, als Ägypten ein Zentrum der Kultur und Künste im Nahen Osten war. Beurteilen Sie das kulturelle Klima des Mubarak-Regimes. Hat es Beschränkungen für unabhängige Künstler wie Sie gegeben, und wie hat dies ggf. Ihre Musik beeinflusst? Deeb: Hip-Hop-Musik ist eine Sprache, die sich zu Kämpfen und Unterdrückung äußert. Sie basiert auf einer Selbstdarstellung und darauf, die eigene Ansicht zu vermitteln, egal ob die Menschen dieser Sicht beistimmen oder nicht. Das machte es schwieriger für mich, während des Mubarak-Regimes Songs zu schreiben. Es gab eine große Wahrscheinlichkeit, eingesperrt zu werden, wenn man die Wahrheit sprach. Ich musste viele meiner Texte zensieren. Ich konnte niemals Worte wie „Regierung“ oder „Präsident“ benutzen. Deshalb wies ich anders auf sie hin, z. B. mit Umschreibungen wie „die großen Kerle“ oder „die korrupten Leute“. Anstelle von namentlichen Nennungen verwendete ich Metaphern. Ich erinnere mich an ein Fernsehinterview, das ich noch mit Asfalt gab, als der Fernsehmoderator uns stoppen musste, weil wir einen Song namens „El Ebara Fel Abbara“ sangen, in dem es um die „Salam“-Fähre ging, die 2005 gesunken war und 1000 Menschen in den Tod riss. Nachforschungen ergaben, dass die Besitzer der „Salam“-Fähre korrupt waren und enge Verbindungen zum Mubarak-Regime unterhielten. Sie sagten einmal, dass Ihre Musik irgendwie „das soziale Gewissen“ Ihres Publikums widerspiegelt. Was genau meinen Sie damit? Deeb: Wenn ich meine Musik schreibe, versuche ich, den durchschnittlichen Ägypter auf der Straße damit zu repräsentieren. Mit dem „durchschnittlichen Ägypter“ meine ich jeden vom Taxifahrer über Straßenverkäufer bis hin zum Intellektuellen. Der Puls der Straße inspiriert mich und ich thematisiere alltägliche Belange, die die Menschen etwas angehen, weshalb ich sehr viel Wert darauf lege, in meinen Songs oft auf Pop-Kultur zu verweisen. Inwiefern nahmen Sie mit Ihrem Musikprojekt an den Aufständen des 25. Januar in Ägypten teil und wie reagierte das Publikum auf dem Tahrir-Platz? Deeb: Vom ersten bis zum letzten Tag nahm ich an den Aufständen des 25. Januar teil. Außerdem verfügte ich über das Privileg, meine Gedichte und Songs einige Male in Tahrir aufzuführen, und darauf bin ich sehr stolz. Ich war sehr glücklich und fühlte mich geehrt, als ich sah, dass die Protestierenden auf meine Musik reagierten und mir sagten, dies sei die Art von Musik, die sie im neuen Ägypten hören wollen. Ich glaube, dass Hip-Hop von der Gesellschaft sehr respektiert wird und die Menschen die Ehrlichkeit und die Themen, GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 die in den Songs angesprochen werden, schätzen. Die Menschen habe die Nase voll von oberflächlichen Pop-Liebesliedern, da sie versagt haben, die soziale und politische Realität zu repräsentieren. Mein erstes Video, „Masrah Deeb“ („Deebs Bühne“) wurde zwei Wochen vor der Revolution ganz in der Nähe des Tahrir-Platzes im Stadtzentrum Kairos aufgenommen. Ich entschloss mich dazu, das Video am 2. Februar zu veröffentlichen, als die Revolution sich noch auf ihrem Höhepunkt befand, um die Menschen an die sozialen Belange und die politische Unterdrückung zu erinnern, die wir während des Mubarak-Regimes erfahren mussten. Außerdem wollte ich die Moral der Menschen in diesen angespannten Zeiten stärken, und ihnen Hoffnung darauf geben, dass wir uns wieder erheben werden, sobald unsere Revolution vollendet ist. Welche Rolle könnte Hip-Hop als Sprachrohr für soziale und politische Proteste im Nahen Osten, besonders in Ägypten, spielen? Deeb: Hip-Hop wird von den Ägyptern zunehmend anerkannt, denn diese Art von Musik thematisiert die Kämpfe der 8 Menschen und unterstützt die Idee der Meinungsfreiheit. Hip-Hop ist nicht bloß eine Erfindung aus dem Westen, sondern er demonstriert die Kraft der Poesie, auf die Araber sehr viel Wert legen. Nach der Revolution kamen viele Ägypter mit dem Hip-Hop in Berührung, weil sie die Künstler auf der Bühne in Tahrir auftreten sahen und Songs hörten, die in Sozialen Medien kursierten. Ich erinnere mich, dass nach einer meiner Aufführungen in Tahrir ein Mann aus der Menge auf mich zukam und mir erzählte, dass er einige Salafiten (Islamisten) aufgehalten hatte, die mich von der Bühne holen wollten, weil ich sang und sie dies als unangemessen erachteten. Er hatte die Salafiten gestoppt, weil die Protestierenden meine Songs hören wollten, da sie sie als motivierend betrachteten und als etwas, mit dem sie sich identifizieren konnten. Man kann protestieren, indem man andere Mittel und Sprachen verwendet, man kann Schilder hochhalten, Sprechchöre veranstalten – doch meine Art des Protestes sind Musik und Dichtung. Indem der Mann aus der Menge die Salafiten aufhielt, habe ich etwas erreicht: Ich habe eine Erklärung abgegeben, dass Freiheit Sprache ist und etwas, für das wir auch nach dem 25. Januar noch kämpfen werden. Arian Fariborz ist Politik- und Islamwissenschaftler. Zuletzt erschien 2010 im Palmyra-Verlag Rock the Kasbah – Popmusik und Moderne im Orient. Übersetzung: Simone Falk Copyright: Goethe-Institut e. V., Fikrun wa Fann November 2011 El Deebs Website: http://deeb.bandcamp.com/album/cairofornia-ep de, en, ar, fa Masrah Deeb Video: http://www.youtube.com/watch?v=iuMpRv2cako de, en, ar, fa Interview mit Deeb: http://grungecake.com/archives/195 de, en GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 9 Weltmusik 2.0 Musikerinnen und Musiker aus Afrika, Asien und Lateinamerika verarbeiten Klänge und Klangformen mit den Prinzipien von Avantgarde, Pop-Avantgarde und jamaikanischer „Bass-Kultur“. Von Thomas Burkhalter Knaan, Somalia. Foto: Thomas Burkhalter © Goethe-Institut Musikerinnen und Musiker aus Afrika, Asien und Lateinamerika verarbeiten Klänge und Klangformen mit den Prinzipien von Avantgarde, Pop-Avantgarde und jamaikanischer „BassKultur“. Sie interagieren in Netzwerken mit Musikern weltweit und formulieren selbstbewusste nach-koloniale Positionen. Die vielen Parodien auf Exotika und der thematische Fokus auf Gewalt und Krieg deuten jedoch auch darauf hin, dass alte Abhängigkeiten im realen Markt weiterhin Bestand haben. Der folgende Artikel ist der Versuch einer Standortbestimmung, mit empirischen Daten aus dem Libanon und Höreindrücken aus anderen Ländern. Utopisches? Zur Einführung Es ist abstruser denn je, das alte Modell von Zentrum und Peripherie. Wir leben in einer Welt der multiplen, verwobenen Modernen. Die Sozial- und Kulturwissenschaften verkünden das Ende der eurozentrischen Meistererzählung und erklären die einseitigen Modernisierungstheorien der 1950er und 1960er Jahre als ungültig. Dasselbe suggerieren auch neue Tracks, Lieder, Klang-Montagen und Krach-Gewitter aus Asien, Afrika und Lateinamerika: Moderne und Zeitgeist entstehen heute polyzentrisch im Austausch zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden. Die beschleunigten Prozesse der Globalisierung und Digitalisierung haben das Musizieren auf vielen Ebenen revolutioniert. Weltweit finden heute Musiker neue Möglichkeiten, ihre Musik billig zu produzieren und global zu bewerben. M.I.A., die tamilische Künstlerin aus London, ist vielleicht die Speerspitze dieser Entwicklung. Ihr Soundtrack „Paper Planes“ zum internationalen Erfolgsfilm „Slumdog Millionaire“ verkörpert vieles, wofür diese Musik steht. In ihrer mehr-modernen Welt werden viele alte Gegensätze immer wieder aufgehoben: Gegenkultur versus Mehrheitskultur, Aktivismus versus Spaß – und auch Erste Welt versus Dritte Welt. Im Video „Born Free“ – von der 2010 erschienenen CD „Maya“ – inszeniert M.I.A. als Aktivistin radikalste Gewalt. Sie lässt rothaarige Männer exekutieren – stellvertretend für Gefangene im Bürgerkrieg von Sri Lanka, wie sie behauptet. Der akustische Horror-Trip mischt Sirenen, Explosionen, Panikschreie, Krach und die als fiese Diktatorin inszenierte Stimme von GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 M.I.A. Weltmusik 2.0 lässt sich in kein Korsett mehr zwängen, sie ist widersprüchlich und mehrdeutig. Es klingt das Chaos der Welt, die Hektik des Alltags, die Wut über Weltpolitik und Wirtschaft, und die Hoffnung, sich via Musik eine Existenz zu sichern. Utopische Metaphern und reale Musikstile Weltmusik 2.0 ist das Produkt von raumzeitlich entgrenzter Kommunikation jenseits territorialer Grenzen. Sie stellt überkommene Vorstellungen von Kultur, Identität und Gemeinschaft in Frage und lässt sich auch als eine dem Realismus verpflichtete Musique Concrète lesen – oder als ein akustischer (und visueller) Seismograph der Zeit: Sie ist die Musik der weltweiten Urbanisierung. Die Slums wachsen heute schneller als die Innenstädte – und genauso wächst auch die neue Variante der Weltmusik schneller als die Weltmusik 1.0, die immer für ein westliches Mittelklasse-Ohr gestylt war. Die Weltmusik 2.0 recycelt alles und besticht in ihren besten Momenten durch ihre Direktheit, Dringlichkeit und Kreativität. Weltmusik 2.0 ist damit genauso bunt wie der virtuelle Zeitgeist, der heute medial über Blogs, Netzwerkgemeinschaften, Musik- und Videoplattformen vermittelt wird. Und sie ist so flüchtig, unberechenbar und flexibel wie das Leben im Zeitalter des digitalen Kapitalismus. Dieses ist immer stärker auf kurzfristiges und elastisches Wirtschaften ausgerichtet. Der vielen Unterschiede zum Trotz, lassen sich zwischen diesen weltweit verstreuten Musikern und Musikstilen aber doch deutlich Gemeinsamkeiten erkennen. Dazu zwei Hypothesen: 1. Die Musiker arbeiten mit den experimentellen Herangehensweisen von Avantgarde, Pop-Avantgarde und jamaikanischer „Bass Culture“. Sie formen damit (endlich und deutlich) eine weltumspannende multi-lokale Avantgarde des 21. Jahrhunderts. 2. Sie konstruieren einerseits selbstbewusste nach-koloniale Positionen, zeigen sich andererseits aber auch immer wieder gefangen in den alten post-kolonialen Strukturen. Das zeigt sich besonders gut in ihrem dialektischen Umgang mit Exotika, Gewalt und Krieg. Eine multi-lokale Pop-Avantgarde Der Begriff der Avantgarde wird in der heutigen europäischen Musikdiskussion gerne mit Neuer Musik gleichgesetzt – mit seriellen Verfahrensweisen von Komponisten wie Stockhausen und Boulez, aber auch mit aleatorischen Richtungen um John Cage in den USA. Auf die Musiker der Weltmusik 2.0 passt nun der Avantgarde-Begriff in einer älteren und breiteren Definition. Laut dieser suchen Avantgarde-Künstler den Bruch mit dem jeweils dominanten musikalischen Kanon; sie 10 wollen Musik (und Kunst) neu in der Gesellschaft positionieren; und sie re-definieren die Rolle von Musik zyklisch neu – mal ist Musik Abbild des realen Lebens, mal eine Form von Protest, dann setzt sie entweder auf Schocktherapie oder Ironie, und schließlich dient sie als Flucht in imaginäre Welten. Avantgardismen entstehen dabei an verschiedenen Orten nicht zeitgleich, sondern sie sind immer relativ, an einen bestimmten Ort und eine Jetztzeit gebunden. Eine lineare Abfolge zum Beispiel von Futurismus, zu Musique Concrète und Freier Improvisation ist deshalb nicht möglich. Weltmusik 2.0 ist heute zunächst eine multi-lokale Avantgarde aus der euro-amerikanischen Sicht: Sie mischt unsere Musikszenen neu auf und transportiert zudem neue nicht-musikalische Positionen. Avantgarde schließt die Pop-Avantgarde nicht aus. Im engeren Sinn sind das Kunst-Popper wie John Lennon, Pete Townsend oder Brian Ferry – Abgänger von Kunsthochschulen statt von Konservatorien. Im weiteren Sinne gehören auch „nicht-akademische“ Pop-Musiker dazu: Rock’n’Roll, Psychedelischer Rock, Punk oder Krautrock – vor allem in den jeweils ersten Experimentierphasen. Weitgehend unberücksichtigt blieb – und bleibt – jedoch der „Black Sound“ – so die These von Dieter Lesage und Ina Wudtke in ihrem Essay Black Sound – White Cube. „Black Sound“, ob nun gespielt von schwarzen oder von weißen Musikern, fokussiert stärker auf Rhythmen als auf Harmonik. Er beinhaltet Stile wie Blues, Reggae, Calypso, Hip-Hop, House, Dubstep und Grime und tut sich bis heute schwer, neben Konzerten und Club-Nächten auch in der Kunstwelt Platz zu finden – oder als Pop-Avantgarde wahrgenommen zu werden. Weltmusik 2.0 könnte auch hier für Veränderungen sorgen: Der südafrikanische Rapper JR fordert in seinem Kunst-Pop-Video offensiv „Make The Circle Bigger“; und den lesbischen, trans- und homosexuellen Bounce-Rapperinnen aus New Orleans wurde 2010 in ihrer Heimatstadt eine ganze Ausstellung gewidmet. Libanon Viele der Musiker der Weltmusik 2.0 arbeiten mit musikalischen Gestaltungsprinzipien, die wir aus diesen euro-amerikanischen Avantgarden und Pop-Avantgarden kennen. Sie greifen nach allen nur denkbaren klanglichen Angeboten und verarbeiten sie mal mit digitaler Sampler-Software (dem Instrument der Postmoderne), dann mit alten Reel-to-Reel-Tonbandgeräten, oder sie imitieren sie schließlich mit akustischen Instrumenten. Sie etablieren eine Kunst des Alltags: Diese beinhaltet die Geräusche ihrer lokalen Umgebung und der technologisierten, post-industriellen Medienwelt. Der Beiruter Trompeter Mazen Kerbaj imitiert auf seiner Trompete die Geräusche des Krieges – lange tat er das unbewusst, GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 dann bemerkte der österreichische Trompeter Frantz Hautzinger nach einem Konzert: „Deine Sounds klingen wie Helikopter und Bomben“. Kerbaj kennt den italienischen Futuristen Luigi Russolo und sein Manifest The Art of Noises von 1913 – beeinflusst ist er aber stärker von den Pionieren des Free Jazz und der Frei Improvisierten Musik, etwa von Peter Brötzmann und seinem Album „Machine Gun – automatic gun for fast, continuous firing“. Ähnlich wie Russolo und die futuristischen Schriftsteller um Filippo Tommaso Marinetti zeigen aber auch Kerbaj und viele seiner Kollegen eine gewisse Faszination für den Krieg. Genährt ist diese allerdings durch nostalgische Erinnerungen an ihre ersten 15 Lebensjahre im Bürgerkrieg – und nicht unbedingt, weil sie den Krieg wie die Futuristen als ein faszinierendes ästhetisches und mythisches Phänomen betrachten. In der libanesischen Stadt Tripoli experimentiert Osman Arabi in den Fußstapfen des Bruitismus (Lärmmusik) mit radikalem Krach – und mit psychedelischen Sounds. Raed Yassin arbeitet – anders als Kerbaj – mit dem akustischen Material aus dem libanesischen Bürgerkrieg. Er mischt Feldaufnahmen, Medienfiles mit Geräuschen von Kontrabass und Stimme zu Klangkollagen – Stichwort Montage oder „Bricolage“ im europäischen Avantgarde-Jargon. Yassin organisiert politisch konnotierte Klangereignisse (Propaganda-Lieder, politische Reden, Popmusik etc.) neu. Nur von nicht-libanesischen Hörern kann diese Montage als eine rein akustische, akusmatische Musique Concrète gehört werden; für Libanesinnen und Libanesen ist sie eine Form von Protest – ob vom Künstler so intendiert oder nicht. Ägypten Auf den CDs des ägyptischen Labels 100copies experimentieren Klangkünstler mit den Geräuschen Kairos und elektroakustischer Musik (Mahmoud Refat, Hassan Khan, Ramsi Lehner, Adham Hafez), und in Palästina mischen Rapper politische Texte mit Feldaufnahmen von Checkpoints (z. B. „Checkpoint 303“). Die Musikbeispiele aus Kairo scheinen dabei näher an einer akusmatischen Musique Concrète, während die Künstler in Palästina einen direkteren, aktivistischeren Anspruch deutlich machen – und somit vielleicht dem Bereich Soundscape-Komposition näher sind. Grundsätzlich zelebrieren die meisten dieser Musiker das, was Wissenschaftler als postmoderne Ästhetik bezeichnen. Sie springen hin und her zwischen Materialien aus so verschiedenen Genres wie Rap und Musique Concrète. Einige Musiker setzen dabei deutlich auf das Prinzip des Zufalls (Aleatorik): Charbel Haber von der Post-Punk-Gruppe produziert seine Aufnahmen in endlosen Verfahren zwischen Computermusik und Tape-Music. Die Band schickt Live-Aufnahmen von Jam-Ses- 11 sions, manipulierte Gitarrensounds und Effekte der Software Reaktor bis zu fünf Mal zwischen Computer und einem Reelto-Reel Tonbandgerät hin und her, um am Schluss „diese wirklich tiefen und schmutzigen Klangtexturen zu erhalten, die wir so sehr lieben“. Das Projekt „The Untuned Piano Concerto“ von der Pianistin Cynthia Zaven basiert auf einer Performance aus Neu Delhi, für die sie ein altes, verstimmtes Klavier auf einen Lastwagen montieren und sich damit durch die Stadt fahren ließ. Daraus resultiert eine akustische Interaktion zwischen improvisierten Klavier-Passagen, dem Hupen der Autos und anderen Straßengeräuschen. Auch in diesem Projekt reagiert der Zufall mit. Das Projekt entstand in einem Kunst-Kontext – auch das ist nicht ungewöhnlich für die Beiruter Szene. Viele dieser Künstler arbeiten inter-disziplinär über die verschiedenen Kunstsparten hinweg (Stichwort: Fluxus): Tashweesh mischen Rap und elektronische Musik mit akustischen und visuellen Archivaufnahmen aus Palästina zu audio-visuellen Kurzfilmen. Hassan Khan aus Ägypten hat seine multimedialen Arbeiten zu Klang, Bild und Text an zahlreichen Ausstellungen und Festivals im Nahen Osten, Europa und den USA präsentiert. Tarek Atoui schließlich arbeitet zwischen LiveElektronik und Computermusik. Er kreiert auf seinem Laptop akustische Landschaften voller Brüche und Kontraste: Ein Mix von Glitch-Sounds, Samples von Politiker-Reden, chinesischen und arabischen Stimmen, Kriegsgeräuschen, Pop und vielem mehr. Dabei ist seine Musik keine Kopfgeburt, sie pendelt flink hin und her zwischen den alten Welten der Eund der U-Musik. In seinen Performances kontrolliert Atoui seinen Laptop, wie ein Rockstar seine Gitarre – dieses „hedonistische Copy and Paste“ sieht Werner Jauk in seiner Schrift pop/music + medien/kunst: Der musikalisierte Alltag der digital culture als typisch für die Pop-Avantgarde. Afrika Diese Beispiele von Musikern aus dem Nahen Osten ließen sich durch Musikerinnen und Musiker aus Indonesien, Indien, Mexiko und anderen Ländern des Globalen Südens ergänzen. Besonders in afrikanischen und lateinamerikanischen Städten pendeln Musiker unbeirrt hin und her zwischen Gegenkultur und Mehrheitskultur – sie tun das stärker als die Musiker in der arabischen Welt, in der sich eine „alternative“ Popszene neben der extrem kommerziellen panarabischen Popmusik bis heute schwertut. Diese Musiker scheinen mit geprägt von der Dringlichkeit und Aggressivität verschiedener US-amerikanischer und britischer Clubstile: von Detroit Ghettotech, Baltimore Club bis zu Dubstep und Grime – sie prägen diese Stile aber direkt oder indirekt auch selber mit. Der Kwaito aus den Townships Südafrikas, der nach dem Ende der Apart- GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 heid in den neunziger Jahren das Lebensgefühl junger schwarzer Südafrikaner mit verlangsamten House Beats, Andeutungen von lokalen Stilen (Mbaqanga, Kwela, „Bubblegum“) und aggressiv klingendem Sprechgesang (in Zulu, Sotho und im Township-Slang Tsotsitaal) so sehr auf den Punkt brachte, ist heute – von der südafrikanischen Musik- und Werbeindustrie vereinnahmt – zu einer geschliffenen Kommerzmusik verkommen. Abgelöst wurde der Trend aber von südafrikanischem Rap und House, oder von Shangaan Electro aus den Townships von Südafrika. Shangaan sampelt verzwickte Marimba- und Orgel-Melodien, kurze, repetitive Gesangspassagen und organisiert sie über zurückhaltende, aber rasend schnelle Rhythmen zu einem sich ständig verändernden akustischen Organismus. Die Musik klingt eigenständig und neu. Auch die Jagwa-Musik aus Dar es Salam klingt experimentell, aber sehr wohl lokal. Hier klingen wirre und verstimmte Melodien auf, von einem billigen Casio-Keyboard über Poly-Rhythmen. Künstler oder Musiker? Viele der Musiker der Weltmusik 2.0 bekommen immer wieder dieselben Vorwürfe zu hören: Sie seien Künstler, keine Musiker; sie seien elitäre Kosmopoliten, die ihren Herkunftskontext bloß aus einer privilegierten Perspektive kennen würden; und sie kopierten bloß musikalische Stile und Formen aus dem Globalen Norden. All diese Musik als Kopien abzutun, würde dieser Musik – und den Musikern – nicht gerecht. Christopher Miller betonte in einem Panel mit dem Titel Local Experiments: Decentering the Global AvantGarde an der jährlichen Konferenz der Society of Ethnomusicology in Middletown 2008, dass Musiker in Indonesien zwar John Cage nicht kennen würden, aber dennoch mit ähnlichen Gestaltungsprinzipien arbeiteten. Andrew Mc Graw kritisierte am selben Panel, dass wir experimentelle Ästhetiken gerne vorschnell auf unseren euro-amerikanischen Kanon münzen. Die Musiker in Beirut sind zwar bestens über die euro-amerikanische Avantgarde und Pop-Avantgarde informiert, ihr musikalischer Ausdruck ist aber auch geprägt durch ihre unmittelbare akustische Umgebung: die akustische Sozialisation im Krieg, die lokale psychedelische Rockmusik-Szene der 1960er Jahre und vieles mehr. Die standardisierte klassische arabische Kunstmusik und die „nationale“ libanesische Musik (eine Aufarbeitung von lokaler Folklore für den großen Konzertsaal) dienen diesen Musikern gleichzeitig oft als negative Vorbilder, von denen sie sich aus verschiedenen Gründen abgrenzen. Diese Musiker kopieren also nicht bloß, sondern musizieren aus ihrer persönlichen Perspektive und Position. Neben dem transnationalen Zeitgeist in ihren spezifischen Musik-Nischen, sind sie zudem beeinflusst von der postmo- 12 dernen Ästhetik anderer Kunstdisziplinen und von nicht-musikalischen Phänomenen der Jetztzeit. Und: Diesen transnationalen Zeitgeist in Musik und Kunst nur als „westlich“ zu definieren, ist nicht legitim. Gerade Avantgarde und PopAvantgarde waren immer entscheidend mitgeprägt von Diaspora-Künstlern aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Selbstbewusste nach-koloniale Positionen Johannes Ismaiel-Wendt definiert Populäre Musik in seiner spannenden Dissertation per se als postkoloniale Musik. Er beobachtet ein Fortwähren von Repräsentations-„Rasse“ und „Kultur“-Diskursen in der Popmusik und wertet diese als eine Form von Rassismus und Post-Kolonialismus. „Verweise auf Orte, Regionen, Länder beziehungsweise Nationen oder Kontinente bilden ein zentrales Ordnungssystem populärer Musik“, schreibt er. Ein großer Teil der Weltmusik 2.0 Musiker würde ihm recht geben. Ein anderer Teil nicht: Diese Musiker decken „exotische“ Fremddarstellungen ihrer Heimatländer aktiv auf und inszenieren sie als „farbenfrohes“ Spiel. Die meisten Weltmusik 2.0 Musiker gehören dem ersten Lager an. Sie wenden sich ab vom anhaltenden euro-zentristischen Fokus auf das „Traditionelle“ in ihren nicht-westlichen Heimatländern. Diese Musiker wollen die Vorliebe für „kulturelle Differenz“ von uns Europäern, Musikethnologen und Musikliebhabern nicht befriedigen – wenigstens nicht auf den ersten Höreindruck. Sie wollen persönliche musikalische Identitäten schaffen, jenseits von Selbst-Exotisierung, Kommerzialisierung und Propaganda. „Audio-Viren“ aus der Weltmusik 2.0 infiltrieren den euroamerikanischen Mainstream, ohne sich mit Exotismen oder Orientalismen anzubiedern. Die Videos und Texte von K’Naan wirken so, als wollte dieser somalisch-kanadische Rapper unsere Seh- und Hörnerven überreizen: Da stehen somalische Piraten plötzlich neben den Klischee-Piraten von Walt Disney, Löwen und Elefanten neben somalischen Kriegern und Bürgerkriegsaufnahmen, die Beatles neben Stars der afrikanischen und afro-amerikanischen Musikgeschichte – Bob Marley oder Fela Kuti. Dass K’Naan für die Fußball-WM von Südafrika den offiziellen Coca-Cola-Clip „Waving Flag“ produziert hat, zeigt nur, wie erfolgreich und unverkrampft diese neue Generation zwischen Gegenkultur und Mehrheitskultur agiert. Exotismus? Aus der Sicht von post-kolonialen Theoretikern – und auch von vielen Weltmusik 2.0 Musikern – mag das Zelebrieren von Exotika erstaunlich wirken, wenn nicht sogar ernüchternd. Denn für viele bleibt die lange Tradition der Suche GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 nach anderen exotischen Klängen und Rhythmen im westlichen Musikschaffen negativ konnotiert: In den USA des 19. Jahrhunderts wurde die schwarze Bevölkerung in den sogenannten Minstrel Shows von weißen Sängern und Schauspielern parodiert; in der europäischen Musik experimentierten Komponisten wie Claude Debussy (in Java), Béla Bartok (in Ungarn) Leos Janacek (in Tschechien) und viele andere mit Volksmusik-Traditionen; und im Genre Weltmusik (1.0), einer Repertoire-Kategorie ab Mitte der 1980er Jahre, ließen sich Pop-Produzenten und Musiker wie Peter Gabriel und Ry Cooder von der lokalen Musik „anderer“ Kulturen inspirieren. Spätestens seit Mitte der 1980er Jahre vermischten indische und pakistanische Musiker zweiter Einwanderergeneration dann in London Sitar-Melodien und Tabla-Rhythmen mit Club-Beats. Sie gaben an, ihre Heimatländer nicht folkloristisch, sondern modern darzustellen. Oft reproduzierten sie dabei aber alte Stereotypen und zelebrierten eine essentialistische, multi-kulturelle Hybridität: hier Europa als „moderner“ elektronischer Grundbeat (und Basis), dort Asien als (pseudo-)traditionelles Ornament. Beirut und Ägypten im 20. Jahrhundert Weltmusik (1.0) will unversehrte musikalische Formen und Idiome hochleben lassen, mischt dann aber Sounds der vollständig kommerzialisierten Gegenwart mit der pseudohistorischen „Patina anderer Zeiten und Orte“ wie Veit Erlmann schreibt. Er definiert den interkulturellen Ansatz der Weltmusik 1.0 über den Begriff „Pastiche“ und meint dabei eine spezielle Art der Parodie, bei der der polemische oder satirische Akzent völlig fehlt. Diejenigen Weltmusik 2.0-Musiker, die neu mit Exotika arbeiten, haben nun „Pastiche“ durch Parodie ersetzt – sie agieren dabei ähnlich wie Musiker aus der Pop-Avantgarde, die sich immer begeistert zeigten für die sogenannten „primitiven“ Völker (Primitivismus) und ihrer Fetische. Die Beiruter Musiker äußern sich sowohl fasziniert von den Beatniks der 1950er und 60er Jahre und der psychedelischen Rockmusik der 1960er und 70er Jahre als auch von der Schlagermusik der 1950er Jahre. Die Beatniks und einige ihrer Vorväter (Paul Bowles, Alan Hovhaness, Jack Kerouac, William S. Burroughs, Allen Ginsberg etc.) und viele psychedelische Rockmusiker waren fasziniert von literarischen und musikalischen Visionen von Fernost-Asien, Nordafrika und dem Nahen Osten. Die Musik entstand dabei immer im Austausch zwischen Musikern aus Ost und West: Der ägyptische Komponist Halim al-Daph (*1921) stand mit der Beat-Generation in losem Kontakt. Er gilt heute als einer der ersten Avantgarde-Komponisten der arabischen Welt. Und The Freak Scene ist eine von vielen US-amerikanischen Gruppen, die mit Exilarabern zusammenarbeitete. 1967 nahm sie das Album „Hard Rock from the Middle East“ auf. In Beirut 13 kämpften zur selben Zeit rund 200 psychedelische Rockbands um die Gunst des Publikums – sie formierten sich zu einem Netzwerk von Musikern, Clubs und Fans und schufen so den Boden, auf dem arabische Nischenmusiker heute an ihren Karrieren arbeiten. Die Musiker blicken heute auch auf die Tourismus-Industrie der 1950er Jahre zurück – mit ihren arabischen Nachtclubs in New York, Paris, Beirut und Kairo. Die Musik in den Nachtclubs „violated every boundary of authenticity”, schreibt Anne Rasmussen. Es ist die Offensichtlichkeit und Leichtigkeit dieser künstlerischen Karikaturen auf den Orient, die einigen der heutigen Musiker als Vorlage dient. Der Ägypter Omar Khorshid vertonte in den Nachtclubs von Beirut und Kairo Hits wie „La Cumparasito“ und „La Paloma“. Kritiker nennen Khorshid den James Last der arabischen Welt. Für viele Musiker hingegen gilt er als Genie: wegen seinem Surf-GitarrenStil und seinen virtuos vorgetragenen Tremoli. Syrien Psychedelisch klingt heute die syrische Szene des „New Wave Dabké“ – oder auch die Shaabi-Musik in Ägypten. Die Dabké-Musiker steuern ihre Synthesizer mit kleinen Midi-Boxen. Sie erzeugen die typischen arabischen Vierteltonhöhen und imitieren den schrillen Klang der Doppelrohr-Oboe Mijwiz, dem traditionellen Dabké-Instrument schlechthin. Die Szene hat jetzt auch außerhalb ihres eigentlich informellen Kassetten- und MP3-Marktes eine Fangemeinde gefunden – in erster Linie dank einer Welttournee des syrischen Sängers Omar Souleyman, organisiert 2009 vom US-amerikanischen Indie-Label Sublime Frequences . Der verstorbene BBC-Weltmusik-Pionier Charlie Gillett äußerte sich kurz vor seinem Tod fast schon empört über ein Londoner Konzert dieses Sängers. Das sei der schlechteste Hochzeitssänger, den er je gesehen habe. Man kann nüchtern festhalten: Die alte, saubere und sanfte Weltmusik wird attackiert und ersetzt durch neue, unbequemere Sounds. Omar Souleyman wird auf dem neuen Album von Björk singen. Bald werden also vieleicht auch andere lokale Popstile von der internationalen Weltmusik 2.0-Gemeinde entdeckt: Arabesk aus der Türkei, jil aus Nordafrika, oder turbo folk aus Ex-Jugoslawien – ob als exotische Eintagsfliegen oder mehr, wird sich zeigen. Alte Machtstrukturen und Problemfelder Damit sei es bereits angedeutet. Die Vision einer Welt der multiplen Modernen hat weiterhin ihre Risse. Weltmusik 2.0 entsteht noch immer im Austausch zwischen den Metropolen des Südens und den Zentren des Nordens – und kaum jemals zwischen den verschiedenen Zentren Afrikas, Asiens und La- GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 teinamerikas. Auch heute bleiben DJs und Produzenten (DJ Rupture, Ghislain Poirier, Diplo, Richard Russell etc.), Labels (Mad Decent, Man Recordings, Dubsided, XL Recordings, Outhere Records), Veranstalter (Secousse, Favela Chic, Beat Research etc.), Kulturförderer und Medienschaffende aus den USA und Europa ihre wichtigsten Förderer. Das Thema wirtschaftliche Ausbeutung ist nicht vom Tisch. Diplo, einer der Produzenten von M.I.A., hat den lauten, auf DrumcomputerRhythmen basierten Baile Funk aus den Favelas von Rio de Janeiro für die Welt mit entdeckt. Auf seinen CDs, Mixtapes und Dokumentarfilmen („Favela on Blast“, „Favela Strikes Back“) fehlt aber manchmal eine Auflistung der Künstler. Das Musizieren ohne Copyright-Beschränkungen fördere Austausch und Kreativität: Dieses oft gehörte Argument stimmt nur, wenn sich die Künstler des Nordens und Südens auf Augenhöhe treffen – wenn etwa Schlachthofbronx aus München, Spoek Mathambo und Gnucci Banana aus Südafrika und ihr Label Man Recordings ihren Track „Ayoba“ offiziell freigegeben: Jetzt finden wir auf der Plattform Soundcloud über 100 Remixe des Tracks. Eine zeitgemäße Erfolgsstrategie. Ironie oder Spaßkultur? Zu Beginn des neuen Jahrhunderts ist kaum mehr auszumachen, was als kulturelle Widerstandsstrategie verstanden werden soll und was als kommerzielles Kalkül in Marketingabteilungen der Unterhaltungsbranche konzipiert wurde“, schreibt Susanne Binas. Im Fall der Weltmusik 2.0 sind das oft nicht zwingend Marketingabteilungen, sondern Musiker, die versuchen, mittels Strategien ihre eigenen Karrieren voranzutreiben. Der neue Fokus auf Exotika kann aus dieser Perspektive auch als ein strategischer Essentialismus verstanden werden: Denn Obskures, Ironisches und Exotisches profitiert überproportional vom Lawineneffekt der virtuellen Mund-zu-Mund-Propaganda auf Plattformen wie Facebook. Das südafrikanische Kunst-Pop-Kollektiv Die Antwoord spielt mit dem Stereotyp des primitiven, Bier trinkenden weißen Südafrikaners. Was die Band damit aussagen will, bleibt offen – zumal sie es tunlichst vermeidet, öffentlich und ernsthaft über ihre Motivation zu sprechen. Das Problem mit Ironie und Parodie: Sie wird bloß von Insidern verstanden, im freien Markt hingegen mutiert sie schnell zur skurrilen Spaßkultur. Die Exotik des Krieges Der Trend zur Inszenierung von Krieg und Gewalt provoziert ähnliche Fragen. M.I.A. und Mazen Kerbaj sind zwei von vielen Beispielen: Die jamaikanische Sängerin Terry Lynn zum Beispiel inszeniert sich auf ihrer CD „Kingstonlogic 2.0“ als 14 stolze Slum-Bewohnerin mit Pistole in der Hand. Sie rappt über tiefe Subbässe, Gewehrschüsse und abstrakte Beats. In den mit Handys aufgenommenen Kuduro-Videoclips aus Luanda tanzen leicht bekleidete Frauen mit jungen Männern, die im angolanischen Bürgerkrieg ein Bein verloren haben. Der Kuduro, der aus einem geparkten Minibus hinaus scheppert, gilt als die erste, rein elektronisch produzierte Musik Afrikas überhaupt. Diese billig produzierte Musik tut sich allerdings schwer, den ästhetischen und produktionstechnischen Geschmack des transnationalen Weltmarkts zu treffen – so demokratisch also ist sie auch nicht, die Weltmusik 2.0. Die Glaubwürdigkeit von M.I.A. wird inzwischen angezweifelt: Die Schwiegertochter des Warner-Music-CEO Edgar Bronfman soll Provokation bloß als Mittel zum Zweck nutzen, um sich endgültig im Mainstream festzusetzen. Mazen Kerbaj gibt es in Interviews zu: Von seiner Vermutung, dass seine Kriegserinnerungen seine heutige Musik prägen, hat er zum ersten Mal einem deutschen Journalisten erzählt. Wollte er sich damit all der ständigen Fragen entledigen, wo denn das lokale Element in seiner Musik versteckt sei? War es einfach ein geschickter Schachzug, sich als einzigartige Stimme im weltweiten Feld der Frei Improvisierten Musik festzusetzen? Oder war das mehr? Ein Urteil ist schwierig. Aus der internationalen Perspektive haben Musiker wie Kerbaj das exotische Element der Weltmusik 1.0 (die orientalische Musik) durch ein neues exotisches Element ersetzt, den Krieg. Im Libanon hingegen bricht Kerbaj mit einem Tabu, indem er öffentlich über den libanesischen Bürgerkrieg diskutiert. Und er verarbeitet traumatische Erfahrungen. Theoretische Verortungen Weltmusik 2.0 ist ein theoretisches Konstrukt. Der Begriff weist auf zwei Dinge hin: Weltmusik 2.0 nutzt zum einen die Möglichkeiten des zunehmenden digitalisierten Musikmarktes zu einer freieren und vielfältigeren Produktion von Musik, zum anderen ist Weltmusik 2.0 noch immer eine Variante von Weltmusik 1.0. Sie hat sich noch nicht ganz von eurozentristischen Anspruchshaltungen emanzipiert – auch weil die Geldgeber oft aus Europa stammen. Die Musik verkauft sich entweder an kuratierte Events (Weltmusik-Festivals, thematische Ausstellungen), vermittelt über Exotika, Spaß und Krieg. Oder sie agiert in ihren jeweiligen transnationalen Nischenkulturen und bleibt dort Freie Improvisation, Elektroakustische Musik oder Post-Punk. Beide Märkte zu bedienen, ist das Ziel nicht weniger dieser Musiker. In der Tendenz ist der Schritt von Weltmusik 1.0 zu Weltmusik 2.0 jedoch ein Sprung von inter-kulturellen zu trans-kulturellen oder gar hyper-kulturellen und super-kulturellen Mu- GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 sikformen. Im Modus der Interkulturalität werden zwei Musiktraditionen (oder Stile) verschiedener geographischer Herkunft so fusioniert, dass die betreffenden Traditionen (oder ihre klischierten Vorstellungen davon) weitestgehend unverändert bleiben (Beispiel Asian Underground). In den anderen Modi wird Kultur nicht mehr als abgeschlossenes System gesehen. Je nach Modi bleiben kulturelle Referenzen und Prinzipien dabei stärker (trans-kultureller Modus), weniger stark (hyper-kultureller Modus) oder gar nicht mehr hörbar (superkultureller Modus) (Lull 2000, 2002). Oft überschneiden sich die verschiedenen Modi dabei innerhalb eines einzelnen Musikstücks. Veit Erlmann schlägt vor, Weltmusik (1.0) nach der Art und Weise zu untersuchen, in der die Geschichte eines kulturellen, sozial-politischen Kontexts in die Musik (oder in das Produkt) selber eingeschrieben ist. Dieser Ansatz macht auch für Weltmusik 2.0 Sinn – allerdings darf ein bestimmter kultureller Modus nicht über den anderen gewertet werden. Wichtig ist zudem, genau hinzuschauen, in welchen sozialen, ökonomischen und politischen Realitäten ein Musiker lebt und aufgewachsen ist – und wer letztlich von der Weltmusik 2.0 pro- 15 fitiert: der Musiker, der DJ, der Blogschreiber, der Labelbesitzer oder der Kurator. Reale Grenzen des Nationalstaates Jeweils am ersten Freitag im Monat wird im Exil Club in Zürich ein Einbürgerungsbüro aufgebaut. Im einfachen Holzkasten sitzt eine Schauspielerin. Sie tippt die Anträge der Gesuchsteller für eine Bürgerschaft in der fiktiven Demokratischen Republik Tam Tam im Zweifingersystem auf einer alten Schreibmaschine ein. Was die Club-Reihe Motherland hier inszeniert, ist zwar ein Spiel, und doch ein ernst gemeinter Hinweis auf die zentrale Größe der Gegenwart: auf die Grenze zwischen dem Nationalstaat und dem globalen Feld. Klänge und Klangformen mögen weltweit schweifen, aber für die Musiker ist noch immer die nationale und politische Grenze bindend. Im Visa- und Passbüro entscheidet sich, ob ein Künstler aus Afrika, Asien oder Lateinamerika auch physisch in der weltweit vernetzten Szene der Weltmusik 2.0 mitmachen kann – oder ob er bloß ein Lieferant von Sound-Samples bleibt. Thomas Burkhalter ist Schweizer Musikjournalist mit einem Arbeitsschwerpunkt auf arabischer Welt und Weltmusik. Er ist Mitbetreiber der Webseite www.norient.com – independent network for local and global soundscapes. Copyright: Goethe-Isntitut e. V., Fikrun wa Fann November 2011 Thomas Burkhalters Website http://www.norient.com de, en, ar, fa „Zur Ästhetik der World Music“: http://www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst03/pst03010.htm de, en „On Musical Cosmopolitanism“: http://digitalcommons.macalester.edu/intlrdtable/3 de, en, ar, fa GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 16 Die Entwicklung der arabischen Musik Die arabische Musik lässt sich grob in zwei Arten unterteilen, die sich klar voneinander abgrenzen lassen: die Volksmusik und die sogenannte klassische Musik. Der vorliegende Beitrag ist eine leichtverständliche Einführung in die Grundlagen der arabischen Musik. Von Suleman Taufiq Musiker spielen Musik in einem traditionellen Haus, Marrakesch, Marokko. Foto: Markus Kirchgessner © Goethe-Institut Die arabische Musik lässt sich grob in zwei Arten unterteilen, die sich klar voneinander abgrenzen lassen: die Volksmusik und die sogenannte klassische Musik. Die Volksmusik ist von Ort zu Ort und von Land zu Land sehr unterschiedlich und bleibt an die jeweilige Region gebunden. Die klassische Musik wird wiederum in zwei große Bereiche aufgeteilt, in die religiöse und weltliche Musik; dabei ist die weltliche Kunstmusik sehr umfangreich und trotz der unterschiedlichen ästhetischen Ausdrucksformen in den verschiedenen arabischen Regionen insgesamt sehr homogen. Schon im neunten Jahrhundert war die arabische Musik weit entwickelt. Zur damaligen Zeit besaßen die Araber bereits ein umfangreiches Musikrepertoire, eine schriftlich notierte Musikgeschichte und gut ausgebildete Musiker und Sänger, die das Musikleben an den Höfen belebten. In der arabischen Musik setzt sich die Tonleiter wie die westliche aus Tönen und Halbtönen zusammen, kann sich aber auch in Vierteltonschritten bewegen. Während in der europäischen Musik der Halbtonschritt das kleinste Intervall darstellt, sind in der arabischen Musik also noch wesentlich kleinere Tonschritte möglich. Das ist es, was den typischen Klang arabischer Musik ausmacht: Töne werden immer wieder auf leicht variierte Art umspielt, ohne dass dadurch der Grundton aus dem Blickfeld des Musikers gerät. Zwei der wichtigsten Gemeinsamkeiten der arabischen Musik insgesamt sind ihre Lust an der Improvisation und das Überwiegen melodischer Formen. Eine Melodie wird meist von einer Solostimme vorgetragen, die auch von einem Chor begleitet werden kann. Polyphonie, wie man sie von westlichen Orchestern gewöhnt ist, gibt es in der arabischen klassischen Musik nicht. Grundlage der arabischen Musik ist der „Maqam“ oder Modus. Der Begriff „Maqam“ bedeutet ursprünglich „Podest“, „Stufe“ oder einfach „Standort“. Er wurde auch als Bezeichnung für eine Versammlung verwendet, in der man Gedichte rezitierte, GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 später nannte man auch die musikalische Veranstaltung Maqam. In der Theorie der klassischen arabischen Musik bezeichnet der Maqam die Stimmung einer arabischen Tonleiter, vergleichbar den alten Kirchentonarten oder den beiden Modi Dur und Moll in der europäischen Musik, wobei die einzelnen Tonschritte – wie schon erwähnt – in kleineren als Halbtonschritten verlaufen können. Die arabische Musik kennt allerdings mehr als zehn Modi. Was den Maqam als vollständiges Musikstück außerdem von einem europäischen unterscheidet, ist die Möglichkeit, ihn rhythmisch völlig frei zu gestalten und zu variieren. Das ist in der europäischen Musik kaum möglich. Hier ist ein bestimmter Takt vorgegeben, dessen Melodie jedoch frei variiert werden kann. Die Maqamat Viele Musiker und Musiktheoretiker der arabischen Welt ordnen bestimmte Maqamat spezifischen Gefühlslagen zu: So wird beispielsweise Trauer häufig durch die Maqamat Hidjaz und Saba zum Ausdruck gebracht. Die faszinierende Schönheit der Geliebten und all ihre Vorzüge umspielt meist der Maqam Bayati. Die arabische Musik misst sich nicht an technischer Perfektion, sondern daran, wie intensiv und emotional aufgeladen der Ton, das Gefühl, die Verzierungen, das Spiel und der Gesang vorgetragen werden. Der westliche Musiker übt sein ihm in Noten vorliegendes Stück so oft, bis er es perfekt spielen und interpretieren kann. Der klassische arabische Musiker dagegen findet den Zugang zur Musik nur durch ihre „Seele“ und durch das, was sie in ihm anregt. Wenn er diese „Seele“ erreicht, bewältigt er alle Schwierigkeiten. Hier bedarf es also sehr viel eigener Initiative des Interpreten. Er improvisiert und bleibt nicht bei der Grundform seines Musikstücks, sondern variiert es, je nach Tageszeit oder Anlass; denn das gleiche Stück kann sich, mittags oder nachts gespielt, ganz anders anhören, weil es dann in einer ganz anderen Stimmung vorgetragen wird. Das hat weitgehende Konsequenzen: Die klassische europäische Musik wurde in Noten geschrieben, was in der klassischen arabischen Musik bis heute nicht der Fall ist. Denn ein und derselbe Maqam wird immer wieder auf die eine oder andere Art und Weise improvisiert. Eine der wichtigsten Formen der klassischen Musik im Osten der arabischen Welt ist die Waslat. Sie besteht aus einer Reihe von Kompositionen und improvisierten Instrumental- und Vokalstücken, die alle in ein- und derselben Maqamreihe gespielt werden. Die Waslat beginnt immer mit einem Instru- 17 mentalstück, das eine Sama‘i oder ein Baschraf sein kann. Beide Formen werden vom gesamten Orchester gespielt, ähneln sich formal, unterscheiden sich jedoch rhythmisch. Man könnte sie mit einer Ouvertüre in der europäischen Suite vergleichen. Zwischen den einzelnen Liedern der Waslat werden Taqsim gespielt, Solostücke für nur ein Instrument, bei denen die einzelnen Solisten ihr ganzes Improvisationstalent darstellen können. Danach folgt eine Gruppe von bis zu acht Vokalstücken, die von Instrumenten begleitet werden. Die Texte der Lieder sind meistens alte Gedichte, zumeist aus dem Mittelalter, die zu einer vorgegebenen Melodie geschrieben wurden. In den nordafrikanischen Ländern hat sich eine andere Form der klassischen Musik etabliert: die Nouba. Sie ist eine spezielle, groß angelegte musikalische Form der arabisch-andalusischen Musik. In den Städten der Maghreb-Länder Marokko, Tunesien, Algerien und Libyen hat sich die Nouba bis heute in ihrer charakteristischen Form erhalten. Die Nouba ist eine bedeutende musikalische Großform, vergleichbar der europäischen Suite. Sie besteht im Allgemeinen aus fünf Teilen, Mizan genannt, die jeweils durch eine spezielle rhythmische Grundformel charakterisiert sind. Die einzelnen Teile tragen den Namen dieser rhythmischen Formeln. Die Nouba setzt sich aus verschiedenen musikalischen Themen zusammen, die nicht miteinander verarbeitet werden, wie es in der europäischen Musik häufig der Fall ist; sie bilden aber stilistisch und melodisch, ähnlich wie in der europäischen Suite, eine Einheit. Gesang und Poesie Zentraler Ausgangspunkt der arabischen Musik ist der Gesang. Die arabische Musiktradition kennt kaum Musik ohne Gesang. Musik und Poesie sind so eng miteinander verwoben, dass es bis heute schwer fällt, die Komponisten in der arabischen klassischen Musik ausfindig zu machen. Wir kennen oft nur die Namen der Sänger und Dichter. Wenn überhaupt reine Instrumentalstücke gespielt werden, so meistens als Einleitung zum Gesang. So haben sich polyphone Elemente, die typisch für die europäische Musik sind, kaum durchsetzen können. Die Person der Sängerin oder des Sängers steht ganz im Mittelpunkt der Musikgruppe und hat eine enorme Aufgabe zu bewältigen. Sie muss nicht nur sängerisches Talent besitzen, sondern auch eine kräftige, schöne Stimme, die in der Lage ist, einen Gegenpart zum Orchester darzustellen. Das musikalische Erlebnis, das eine Sängerin oder ein Sänger mit ihrem Ensemble den Zuhörern vermittelt, wird in der arabischen GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Welt als „Tarab“ bezeichnet. Der Begriff bedeutet Erheiterung, Ekstase oder auch Rausch. Er ist eine Stimmung, die durch den Gesang und die Musik entsteht und in ein fast rauschhaftes Glücksgefühl mündet. Der Tarab kann das gesamte Publikum mitreißen, manchmal weinen oder stöhnen die Zuhörer vor Schmerz, wenn die Sängerin gerade ihre verlorene Liebe besingt. Andere Zuhörer springen auf und jubeln den Künstlern lautstark zu. Der Intensitätsgrad des Tarab hängt in erster Linie von der Stimme und der Vortragsweise der Sängerin oder des Sängers ab. Je nach Temperament, Stimmung und Anlass nimmt der Sänger oder die Sängerin sich nicht nur die Freiheit der künstlerisch schöpferischen Interpretation, sondern improvisiert tatsächlich. Der Werdegang eines Gesangskünstlers ist in der Regel durch eine gründliche Ausbildung in Koranrezitation nach den traditionellen Regeln des Gesangs geprägt. Es gibt kaum einen Sänger, der es später zu Ruhm gebracht hat, der nicht durch die harte Schule der Koranrezitation gegangen wäre, denn der musikalisch modulierte Vortrag der Suren gehört zum kulturellen Erbe der klassischen arabischen Musik. So wie viele europäische Sänger, die sich auf die Barockmusik konzentrieren wollen, sich ausführlich mit den Kirchengesängen der Renaissance und des Barock beschäftigen, so wählen auch viele arabische Sängerinnen und Sänger der klassischen arabischen Musik den Weg über die Koranrezitation. Deshalb trugen fast alle bekannten Sänger und Musiker bis in die fünfziger Jahre hinein den Titel „Scheich“, der in diesem Fall einen geistlichen Würdenträger bezeichnet. Das traditionelle Orchester für klassische Musik, „Al Tacht“ genannt, besteht aus den drei Hauptinstrumenten, Oud, Qanoun und Nay, die später durch die arabische Violine, die Kamanija, ergänzt wurden. Die Oud, die arabische Kurzhalslaute, liefert in der arabischen Musik sowohl den Rhythmus als auch die Melodie. Sie wurde von vielen arabischen Dichtern gefeiert und ist die Grundlage der arabischen Musiktheorie. Dazu kommt das Qanoun. Es ähnelt einer Zither, verfügt jedoch über verschiebbare Stege, die es erlauben, zahlreiche Mikrointervalle zu erzeugen. Es besitzt 78 Saiten, sein Name bedeutet soviel wie „das Gesetz“ – ein Ausdruck des pythagoreischen Denkens –, der eine Verbindung zwischen den Intervallverhältnissen allgemein, insbesondere in der Musik, und der Beschaffenheit des Kosmos herstellt. Die Nay ist das einzige Blasinstrument, das in der klassischen arabischen Musik eingesetzt wird. Ihr Klang erinnert das europäische Ohr an den einer Panflöte. Die Nay ist ursprünglich ein Holzrohr mit insgesamt sieben Löchern. So ist sie in der Lage, die reine orientalische Tonfolge zu spielen, anders als zum Beispiel das Klavier und die Orgel, auf denen man keine 18 Vierteltöne spielen kann. Zusätzlich besteht das Ensemble aus verschiedenen Rhythmusinstrumenten wie Daf, Darbouka und Riq. Die Begegnung mit westlicher Musik Die klassische arabische Musik wurde in der persischen Kultur und in den islamischen Reichen der Araber und Osmanen über Jahrhunderte gepflegt und überliefert. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie – vorwiegend durch die englische Kolonialpolitik – mit westlicher Musik konfrontiert und absorbierte dabei zunehmend neue Elemente. Zur Zeit des Ersten Weltkrieges mit seinem aufkommenden Nationalismus besann man sich jedoch wieder stärker auf die eigenen Wurzeln der Musik. Vor allem die Ägypter nutzten die Chance, aus der klassischen arabischen Tradition eine neue Musik zu entwickeln. 1932 wurde das erste internationale Treffen arabischer Musik in Kairo abgehalten. Die arabische Musik erlebte eine Art der Wiedergeburt. Dieser Kongress wird bis heute als eine der wichtigsten Stationen in der Entwicklung der jüngsten arabischen Musikgeschichte angesehen. Zahlreiche Musiker und Musikwissenschaftler aus der gesamten arabischen Welt, aus der Türkei, Persien und aus Westeuropa trafen sich hier zum ersten Mal, um sich ausführlich mit der arabischen Musik zu beschäftigen und sich im interkulturellen Dialog auszutauschen. Wichtige Persönlichkeiten aus aller Welt waren eingeladen: bekannte Musikkritiker und Komponisten wie Bela Bartok, Paul Hindemith oder Henri Rabaud; Musikologen wie Erich Moritz von Hornbostel, Robert Lachmann oder Curt Sachs, Orientalisten wie Henry George Farmer oder Alexis Chottin. Erschienen waren auch namhafte Musiker der arabischen Kunstmusik, wie zum Beispiel Sami Shawwa aus Aleppo oder Muhammad Abd al-Wahhab aus Ägypten. Berühmte Dichter waren ebenfalls zu Gast. Und natürlich traten auch die damals bekanntesten Musikgruppen der klassischen arabischen Musik auf, die aus Syrien, dem Irak, dem Libanon und Ägypten sowie aus Marokko und Tunesien angereist waren. Der Kongress machte den Weg frei für einen neuen Typus von arabischer Musik: Sie war sicher verankert in ihren einheimischen Traditionen und hatte ihren eigenen Ausgangspunkt wiederentdeckt. Gleichzeitig hatten arabische Musiker und Komponisten viel Bewegungsfreiheit hinzugewonnen. Ihre auf die Moderne gerichtete Orientierung, die neue Methoden und Techniken sehr bald integrierte, wurde von vielen als Erweiterung der musikalischen Möglichkeiten angese- GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 hen. Umgekehrt wurde in der modernen europäischen Musik nicht nur die alte Kunst der Vierteltöne aus dem Orient übernommen, sondern auch die Vielfalt der Rhythmen und Klangfarben. Wichtigstes Thema auf dem Kongress war die Einführung westlicher Instrumente in die arabische Musik. Das Thema hat für viele Diskussionen gesorgt, denn es bedeutete, dass man die arabische Tonleiter hätte verändern müssen. Es gab Befürworter, die darin eine Chance sahen, die arabische Musik zu erneuern, mehr Harmonie und die Polyphonie einzuführen, aber auch das Orchester zu erweitern. Es gab aber auch Gegner. Sie befürchteten, die Identität der arabischen Musik ginge dadurch verloren. Sie argumentierten, dass die westlichen Instrumente nicht dazu geeignet seien, den für die arabische Musik typischen Viertelton wiederzugeben. Mit der Zeit hat sich dennoch gezeigt, dass eine Fusion dieser Instrumente möglich war. Es gab sogar Musiker, die ein besonderes Klavier bauten, das in der Lage war, einen Viertelton erklingen zu lassen. Die Befürworter argumentierten, dass viele inzwischen in Europa ausgearbeitete Ideen und Instrumente ursprünglich aus dem Orient stammten. Vor Jahrhunderten waren sie nach Europa gekommen und kehrten nun wieder in veränderter Form in die arabische Kultur zurück. Die Rabab zum Beispiel, eine Vorform der Violine, war aus dem arabischen Kulturraum nach Europa gekommen, wo man sie im Tonumfang und in der Klangqualität erheblich verbesserte. Bereits im 17. Jahrhundert begannen einige arabische Musiker und Komponisten, die europäische Violine in das arabische Musikensemble einzuführen, um die Rabab zu begleiten. Im 19. Jahrhundert war die Rabab weitgehend ersetzt durch die Violine, die einen hörbar schöneren Ton hervorbrachte. Moderne arabische Musiker benutzten sie im 20. Jahrhundert bereits ganz selbstverständlich. Dadurch wurde die Violine als erstes europäisches Instrument in die arabische Kunstmusik eingeführt. Dennoch nahmen die Komponisten gerne auch westliche Instrumente, wie zum Beispiel die Violine, das Cello und den Kontrabass, und westliche Harmonien in ihr Repertoire auf. So entstanden die Anfänge der heutigen modernen arabischen Musik. 19 man sich an die türkische Musik an, und auch in die Liedtexte gingen türkische Elemente ein. Darwisch dagegen benutzte kein einziges türkisches Wort in seinen Liedern. Er wird überall als Vater der quasi-klassischen modernen Musik angesehen. Die meisten Lieder, die er damals sang, waren Taktuka, vorwiegend kurze Lieder, die zur Erheiterung und Unterhaltung des Publikums gespielt wurden. Mit ihm begann die arabische Musik, sich darauf zu konzentrieren, etwas Inhaltliches zum Ausdruck zu bringen. Sein Verdienst ist es, die arabische Musik zu Anfang des vergangenen Jahrhunderts revolutioniert zu haben. Insbesondere veränderte er die tradierten musikalischen Formen. Denn vor ihm klang die arabische Musik sehr weich und eintönig und hatte kaum erkennbare rhythmische Strukturen. Dagegen zeigen seine Lieder eine klare Tonführung und eine prägnante Rhythmik. So verwundert es nicht, dass seine Melodien bis heute bei einem breiten Publikum bekannt und beliebt sind. In dieser Zeit entwickelten sich auch neue Liedformen, die teilweise unter dem Einfluss des europäischen Musiktheaters und des Films entstanden. Eine dialogisch vorgetragene Liedform war in den dreißiger und vierziger Jahren sehr beliebt. Eine eher monologische Liedform entwickelte sich durch den Einfluss der Opernarie, die den Ägyptern durch die italienische Oper im Kairoer Opernhaus nahe gebracht worden war. Eine weitere Musikform, die immer noch gerne gespielt wird und schon im 19. Jahrhundert entwickelt wurde, ist der Dor. Der Dor wird von einem Sänger und einem Chor getragen und ist stets im ägyptischen Dialekt gehalten. Einer der berühmten Komponisten des Dor in Ägypten zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Zakaria Ahmed. Er schrieb viele Dors, unter anderem auch für Umm Kalthoum, die Grande Dame des arabischen Liedes. Man nannte sie in der arabischen Welt „Kaukab ash-Sharq“, strahlender Stern des Orients. Seit den vierziger Jahren zog Kairo mit seiner riesigen Filmund Musikindustrie wie ein Magnet Künstler, Musiker und Komponisten der gesamten arabischen Welt an. Neue, wichtige musikalische Impulse kamen seitdem aus der Hauptstadt der Musik, wie Kairo auch genannt wurde. Einflussreiche Sängerinnen und Sänger Ein Musiker, der viel für die Erneuerung der arabischen Musik getan hat, ist der Ägypter Sayyed Darwisch. Er wurde 1892 in Alexandria geboren und war der erste ägyptische Musiker, der die Nähe zu den politischen Machthabern nach Möglichkeit mied. Damals stellten in Ägypten noch die osmanischen Paschas die herrschende Schicht; demzufolge lehnte Bereits in früheren Jahren waren die Größen der arabischen Musik wie Mohammad Abdel Wahab, Umm Kalthoum, Abdel Halim Hafez und viele andere aus Ägypten gekommen. Ihre Namen und ihre Musik prägten die Musikszene von Kairo bis weit in die siebziger Jahre hinein. Parallel dazu gab es seit den fünfziger Jahren die sogenannte Beiruter Schule. Die exponierte Lage der Stadt schuf ein besonders liberales Klima, GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 das sie zum kulturellen Treffpunkt vieler Intellektueller und Künstler machte. Auch für die Musik war das natürlich eine ungewöhnlich positive Ausgangslage, und tatsächlich spiegelt sich in der Musik des Libanon bis heute die kulturelle Vielfalt des Landes wider; das libanesische Lied ist insgesamt schneller und kürzer und zeichnet sich durch seine Klangvielfalt aus. Die Beiruter Schule galt als diejenige, die durch ihre reiche Tradition an libanesischer Volksmusik besticht. In den fünfziger Jahren setzte dann die Phase der Aneignung europäischer Melodien und Traditionen ein. So wurden europäische Harmonien und Melodien aus Konzerten und Opern in arabische Kompositionen integriert. Man begann, eine neue Musik zu entwickeln, nachdem einige Musiker im Ausland Harmonielehre und westliche Instrumente studiert hatten. Das geschah wieder vor allem in Ägypten, aber auch in Syrien und im Libanon. Das große Orchester eröffnete ihnen die Möglichkeit, ihr musikalisches Repertoire zu erweitern. Statt des kleinen Ensembles, das die arabische klassische 20 Musik bis dahin kannte, gründeten sie nun Symphonieorchester. Statt melodischer Elemente verwendeten sie harmonische Idiome. Manchmal erweiterten sie das Ensemble mit traditionellen orientalischen Instrumenten wie Rabab, Laute und Flöte. Das erzeugte einen neuen, ungewohnten Ton. Denn die westlichen Instrumente haben ihre eigenen Klangfarben. Die Kombination der verschiedenen Elemente aus dem Orient und dem Okzident prägte auch diese Musik. Das arabische Ohr gewöhnte sich relativ schnell an die neue Musik. Die Musiker begriffen die neu gewonnene Freiheit west-östlicher Kreativität als Chance. Sie orientierten sich an dieser modernen künstlerischen Entwicklung. In ihren Werken haben sie eine musikalische Synthese geschaffen, die europäische Kompositionsstile mit den traditionellen Musikwelten ihrer Länder verbindet. Ihre Arbeit ist schon heute richtungweisend für die nachfolgende Generation arabischer Musiker und Komponisten. Suleman Taufiq stammt aus Syrien und lebt seit Ende der sechziger Jahre in Deutschland. Er ist freier Schriftsteller und stellt im Westdeutschen Rundfunk den Hörern in Deutschland regelmäßig orientalische Musik vor. Copyright: Goethe-Institut e. V., Fikrun wa Fann November 2011 Suleman Taufiqs Radiobeitrag über die Musik der Jasminrevolution http://www.wdr3.de/musikfeature/details/artikel/klaenge-aus-dem-land-der-jasmin-revolution.html de, en GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 21 Ein Poet unter den Musikern Abed Azrié ist mit einer unvergesslichen Stimme gesegnet worden. Sein Bariton ist expressiv und emotionsreich und weist eine eindringliche Stärke auf. Suleman Taufiq sprach mit ihm über Musik und Poesie. Von Suleman Taufiq Abed Azrié. Foto: Doumtak © Goethe-Institut Der syrische Sänger und Komponist Abed Azrié wurde 1945 in Aleppo geboren. „Ich wollte Poesie und Musik vermischen. Im Buch waren die Worte gefangen. Ich wollte sie durch die Musik befreien.“ So begründete er seinen Entschluss, 1967 nach Paris zu gehen, um Musik zu studieren, wo er bis heute geblieben ist. Bei seiner Beschäftigung mit den Ursprüngen arabischer Kultur fand er dichterische Schätze, zum Teil jahrtausendealt. Es gelang ihm, antike, aber auch neue Texte auf eine Art zu vertonen, die in der arabischen Musik ohne Vorbild ist. Inzwischen umfasst sein Oeuvre eine Vielzahl an Vertonungen von Texten aus dem alten wie dem neuen Orient: angefangen beim Gilgamesch-Epos bis hin zu zeitgenössischer arabischer Poesie. Er selbst, von der Musikalität des Nahen Ostens geradezu magisch angezogen, sieht sich als Mensch der Freiheit, der visionären Texten des Orients durch seine Melodien zu einer modernen Existenz verhilft. Die französische Zeitung L’Express schrieb einmal: „Fragen Sie ihn nicht nach seiner Nationalität. Abed Azrié hat sein ganzes Leben damit verbracht, sich von solchen Festlegungen zu befreien. Er ist Musiker. Seine Partituren sind seine einzige Identität; die Texte, die er singt, sind Instrumente seiner eigenen Suche.“ Abed Azrié ist mit einer unvergesslichen Stimme gesegnet worden. Sein Bariton ist expressiv und emotionsreich und weist eine eindringliche Stärke auf. Diese emotionale Intensität ist wie geschaffen für seine Vorliebe für die Musik und Poesie und deren ausgeprägte mystische Lehre. Mit ihm sprach Suleman Taufiq. Suleman Taufiq: Es gibt eine fast organische Verbindung zwischen Poesie und Ihrem melodischen Ausdruck. Sind Sie von der Poesie besessen? Abed Azrié: Ich liebe die Lyrik. Ich wuchs in einer Atmosphäre auf, in der ich unbewusst das Gefühl hatte, die arabische Sprache ausdehnen zu wollen. Seit meiner Kindheit bevorzuge ich die Lyrik, weil ich die Poesie und vor allem die poetische Sprache als ein Sammelbecken für das menschliche Gedächtnis betrachte. Es ist ein ästhetischer Resonanzraum und es enthält etwas Melodisches. Ich habe immer an einem Material gearbeitet, das dieses Sammelbecken durch die verschiedenen Epochen hindurch zusammenfasst. Das heißt, Sie arbeiten nicht direkt an einem Text, sondern an einem Thema? Abed Azrié: Ja, denn das Thema umreißt eine zeitliche Epoche, die hundert Jahre, manchmal zweitausend Jahre umfasst. Die Erfahrung der Menschheit kann man nicht in einem Tag oder in einer journalistischen Arbeit bewältigen. Sie braucht viel Zeit, bis sie umfassend zum Ausdruck kommt. Ich arbeite nicht an dem musikalischen Erbe oder an dem, GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 was man die traditionelle Musik nennt, sondern ich arbeite am kulturellen Gedächtnis. Das Gedächtnis ist zeitlos. Es ist nicht gebunden an eine bestimmte historische Phase. Es ist der Ausdruck einer Region. Dieser Ausdruck repräsentiert immer die Seele dieser Region. Ich glaube, dass alle Regionen der Welt sich in ihrem Ausdruck ähneln, aber durch ihre Methoden unterscheiden sie sich voneinander. Sie sind nicht nur ein Sänger der Lyrik, sondern auch der Sprache. Kann man sagen, dass Sie der arabischen Sprache verfallen sind? Abed Azrié: Die Sprache ist sozusagen das Becken des Gedächtnisses, des Bewusstseins und des Unterbewusstseins. Die Poesie verdichtet diese Teile zu einem Ganzen. Sie versetzt die Sprache am ehesten in Leidenschaft. Ein Dichter drückt manchmal seine große menschliche Erfahrung in nur zehn Zeilen aus. Sie haben einmal gesagt, dass die arabische Sprache für Sie einen heiligen Tempel darstellt. Was meinen Sie damit? Abed Azrié: Die Sprache umfasst alle menschlichen Erfahrungen. Deswegen ist sie wie ein Tempel. Aber sie ist kein Ort für die Angst, sondern ein Ort der Freude, der Konzentration, der Ruhe und Begegnung mit anderen, ein Ort zum Tanzen und zum Feiern. Obwohl Sie schon lange in Europa leben, haben Sie sich von der arabischen Sprache überhaupt nicht entfernt. Das merkt man vor allem in Ihrem perfekten Gesang. Abed Azrié: Ich habe die arabische Sprache nie verlassen. Als ich nach Frankreich kam, kannte ich kein Wort Französisch. Ich beschloss, die französische Sprache genauso wie die arabische zu beherrschen. Ich sagte mir: Wenn du in einem Land lebst, musst du dich an dieses Land anpassen und ein Bürger dieses Landes werden. Aber dein eigenes inneres und geistiges Leben kannst du natürlich weiterleben. Man muss die Regeln der Gesellschaft befolgen, und eine Regel ist die Sprache. Ich habe die Schönheit der Sprache durch die Poesie kennengelernt, im Französischen wie auch im Arabischen. Was unterscheidet Ihre Art zu komponieren von derjenigen der anderen arabischen Musiker? Abed Azrié: Heute gibt es ein Missverständnis beim Komponieren in der arabischen Sprache: Die Komponisten tun alle das Gleiche. Für mich muss der Komponist viel über die Sprache wissen, und er muss den Text, den er komponiert, genau verstehen, weil die sprachlichen, menschlichen und atmosphärischen Erfahrungen sich voneinander unterscheiden. Für mich ist die Poesie immer aktuell in ihrer Zeit, weil sie eine menschliche Erfahrung zum Ausdruck bringt. Die Probleme der Menschheit sind immer gleich. Nehmen wir beispielsweise die Erfahrungen von Gilgamesch, seine Rebellion gegen den Tod und die Götter. Das ist ein Problem, das wir noch heute haben. Liebe, Hass, Schwäche, das sind großartige menschliche Themen. Jeder Dichter kommt zu seiner Zeit 22 und versucht auf seine Art diese Themen zu behandeln. Jeder Musiker versucht auf seine Art, sie zum Ausdruck zu bringen. Die Renaissance-Musiker in Europa schrieben ihre Kompositionen anders als die Musiker aus dem 19. Jahrhundert. Bei uns Arabern komponieren wir immer noch auf die gleiche Art und Weise. Ist die Rebellion für Sie etwas Ästhetisches? Sprechen Sie deswegen solche Texte an? Abed Azrié: Eines Tages sah ich in Paris ein Theaterstück von Racine. Racine war ein Hofdichter, gleichzeitig hatte er jedoch auch eigene Ideen. Er notierte diese Ideen am Rande seines Arbeitsblattes, konnte sie aber nicht veröffentlichen. Der Regisseur sammelte alle diese Notizen, die Racine aus Angst vor dem König nicht veröffentlicht hatte, und machte daraus ein Theaterstück. Diese Art der Texte in der arabischen Sprache liebe ich. Ich mag Texte, die in der Schule nicht behandelt wurden und verboten waren, weil sie offen über die Freiheit des Menschen, über die Freiheit des Glaubens und seiner Existenz in dieser Welt sprechen. Diese große Freiheit bedeutet, dass der Mensch als Individuum denkt und sich nicht nur als Teil einer Gesellschaft oder Sippe begreift. Der deutsche Lyriker Jean Paul sagte einst „Musik ist die Poesie der Luft.“ Gilt das auch für Sie? Wollen Sie auch mit Musik Poesie schreiben? Abed Azrié: Im Johannes-Evangelium heißt es „Am Anfang war das Wort.“ In anderen Kulturen heißt das „Am Anfang war der Ton.“ Jedem Wort in einer Sprache kann man durch die Musik eine große Bedeutung zukommen lassen. Beim Komponieren versuche ich dem Text zu folgen, wohin er auch immer geht. Ich versuche hinter den Worten, den Vokalen und Konsonanten Melodien zu finden. Ein musikalisches Werk zu komponieren bedeutet nichts anderes als neue Formen zu erschaffen. Manchmal kann man auch verschiedene Formen miteinander verbinden, damit man sie an das Gedicht, das ein alter oder neuer Dichter erschaffen hat, anpasst. Das Wort hat immer eine Bedeutung und einen symbolischen Gehalt. Ein Ton hat eine allegorische Bedeutung. Wenn wir Musik mit dem Wort verbinden, erschaffen wir eine bestimmte Atmosphäre, die zeitlos ist und keine unmittelbar zu begreifende Bedeutung hat. Bevor Sie nach Paris kamen, waren Sie in Beirut. Dort knüpften Sie Kontakte zu der poetischen Avantgarde-Bewegung, zur Gruppe um die legendäre Zeitschrift Schiir, „Poesie“. Sie waren auch der erste Musiker, der diese Texte vertonte und vortrug. Warum wagten Sie sich an solche Texte? Hatten Sie keine Bedenken? Abed Azrié: Ich kam mit dieser Dichtung schon in Aleppo in Berührung. Es war damals nicht einfach, diese Zeitschrift zu finden, weil sie schon fast ins Antiquariat gehörte. Wenn ich in Beirut war, wartete ich Anfang des Monats immer auf ihr Erscheinen. Meine Altersgenossen lasen damals Fußballzeitschriften, Abenteuergeschichten oder etwas über Spiele, und GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 wir, ein paar verstreute Leute, waren von dieser Zeitschrift fasziniert. Wir fanden darin Schätze: Gespräche über Poesie, Philosophie und andere intellektuelle Themen. Für mich waren die Texte schon damals als Jugendlicher etwas Neues. Sie suchten nach einer offenen, universalen und intellektuellen Welt. Ihr jüngstes Werk widmeten Sie der Poesie von Adonis. Mitte Mai dieses Jahres erlebten Ihre Vertonungen die Premiere im Pariser Institut du Monde Arabe. Abed Azrié: Der Name von Adonis war ständig anwesend in dieser Zeitschrift Schiir. Er gehörte zu den Gründern und schrieb auch öfter Gedichte und Artikel dafür. Später kam dann seine Zeitschrift Mawakif heraus. 1968 habe ich ihn dann persönlich kennengelernt. Das war ganz am Anfang meiner musikalischen Entwicklung. Ich vertonte vier Gedichte von ihm, nahm Kontakt zu ihm auf und besuchte ihn im Libanon. Es war eine schöne Begegnung. Ich war positiv überrascht von seiner Bescheidenheit und Wärme, die er ausstrahlte. So begann unsere Freundschaft. Fühlten Sie sich von der Wärme, aber besonders auch vom rebellischen Geist der Texte von Adonis angezogen? Abed Azrié: Seine Gedichte kennen keine festgelegten Grenzen. Adonis lehnt alle Einschränkungen, die man vorher in der arabischen Literatur kannte, ab. Seine Gedichte waren nicht formal, wie wir die arabische Dichtung in der Schule kennengelernt hatten. Die Araber bevorzugten vorher eine festgelegte Form, einen Reim und einen festen Rhythmus. Bei Adonis war der Rhythmus etwas Neues. Es war ein freier Rhythmus. Dann war auch die Atmosphäre in seiner Lyrik anders. Seine humane Haltung hat mich sehr fasziniert. In einem Werk gibt es immer eine Ästhetik, aber es muss auch ein humanes Ziel haben. Adonis’ Gedichte sind etwas Neues in der modernen arabischen Poesie. Sie gehören nicht zur Tradition, sind kurz und für mich wie eine Wolke, die vorüberzieht. Dieses poetische Moment in den Gedichten interessiert mich. Jedes Kunstwerk ist ein Kampf gegen die Zeit, gegen die Begrenzung, gegen die Aktualität. Diese Gedichte erzählen von diesem Kampf. Man spürt die Zeit, die Bestandteil seiner Dichtung ist. Diese kurzen Gedichte sind der Versuch, über die Zeit zu philosophieren. 1970 entdeckten Sie für sich das Gilgamesch-Epos. Sie sagten, dass Sie darin etwas gefunden haben, wonach Sie schon lange gesucht hatten. Schließlich schrieben Sie Ihre Fassung auf Arabisch und schufen eine eigene Musik für das GilgameschEpos. Was hat Sie an diesem Text begeistert? Abed Azrié: Als ich das Gilgamesch-Epos komponierte, lebte ich bereits in Paris. In Frankreich war es zu dieser Zeit sehr schwer für mich, poetische Texte auf Arabisch zu finden. Dann stieß ich auf einige Zeilen aus diesem Epos. Da ich nicht wusste, wer der Verfasser war, habe ich gedacht, dass es aus der Feder eines modernen Dichters stammte. Die Verse waren so aktuell, als wären sie heute geschrieben. Dann aber 23 entdeckte ich, dass diese Verse mehr als vier Jahrtausende alt waren. Das interessierte mich, und ich besorgte mir den ganzen Text in verschiedenen Sprachen. Ich war von diesem Text sehr ergriffen. Er war sicherlich auch eine Wende in meinem Leben. Durch diesen Text entdeckte ich, dass die Geschichte der Menschheit nicht mit der Entstehung der monotheistischen Religionen beginnt. Es gab schon vorher wichtige Ideen in den sumerischen, babylonischen und pharaonischen Kulturen. Alle diese Ideen sind an den Ufern dreier Flüsse entstanden, am Nil, am Euphrat und am Tigris. Ich begann, mich mit dieser vergangenen Zeit intensiv zu beschäftigen. Das Gilgamesch-Epos ist die bedeutendste literarische Schöpfung und das erste niedergeschriebene, literarische Werk der Menschheit überhaupt. Es erzählt vom Schicksal des Menschen und nicht der Götter, wie es in den religiösen Texten sonst immer der Fall war. Es erzählt von einem Menschen aus Fleisch und Blut, wie er lebt und dann stirbt. Wie in allen Ihren Arbeiten setzen Sie die Schönheit der arabischen Poesie in mitreißende Melodien um. In Ihrer der Mystik gewidmeten CD gehen Sie auf eine Reise durch mehrere Jahrhunderte mittelalterlicher arabischer Sufi-Poesie. Was fasziniert Sie an der arabischen Mystik? Abed Azrié: Die Gedichte stammen von verschiedenen Dichtern. Sie ergänzen einander und sprechen alle von existenziellen Fragen: von der Leidenschaft der Liebe, von der Einheit der Religionen, von der Einheit der Existenz und davon, dass Gott in allen drei Religionen, im Judentum, Christentum und im Islam, anwesend ist. Für die Sufis ist die Beziehung zwischen Mensch und Gott eine Liebesbeziehung und keine Unterwerfung. Gott ist sowohl in den spirituellen als auch in den weltlichen Fragen anwesend. Diese intensive Beziehung zwischen Gott und Mensch spiegelt sich auch in den Beziehungen der Menschen untereinander wider. Diese Idee der sufischen Dichter ist wunderbar, denn dadurch kann der Mensch einen anderen Menschen lieben, wenn er Gott liebt und keine Angst vor ihm hat. Alle Gedichte, die Sie vertont haben, sind Beispiele für etwas, was man nicht berühren kann. Dennoch haben sie die Menschen beschäftigt. Sie auch? Abed Azrié: Ich glaube, dass der Mensch von Beginn seiner Existenz an den Glauben, die Religion und die Philosophie erfunden hat, weil er bestimmte Dinge nicht erreichen konnte. Die Kunst, die Musik und die Poesie sind entstanden, um etwas auszudrücken, was man nicht berühren kann. So sagt der Dichter Quais zu seiner Geliebten Laila: Deine Liebe ist wie Wasser in meinen Händen, das zwischen den Fingern zerrinnt. Die Kunst ist wie die Liebe zu Laila: Sie existiert und spielt in deinem Leben eine Rolle, aber du kannst sie nicht berühren, sondern nur fühlen. Eine CD widmeten Sie dem großen persischen Dichter Omar Khayyam. Was motiviert Sie, immer wieder solche umfangreichen lyrischen Projekte in die Welt zu setzen? GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Abed Azrié: Als Kind wurde Omar Khayyam Zeuge einer Invasion, die seine Stadt zerstörte. Vielleicht entdeckte er durch diese frühen Erfahrungen die Bedeutung des Hier und Jetzt und die Vergänglichkeit der Dinge. Im Alter von dreißig Jahren war Omar Khayyam ein vielseitig gebildeter Wissenschaftler: Er war sowohl Spezialist für Geometrie als auch Physiker, Mathematiker, Philosoph und Mediziner. Im Jahr 1074 reformierte er den Kalender, etwa fünf Jahrhunderte bevor der Gregorianische Kalender in Europa eingeführt wurde. Er war Autor zahlreicher wissenschaftlicher Werke. Für ihn gab es nur diese eine Welt, die er in all ihren Facetten erfahren wollte, an der er sich betrinken wollte. In Zeiten, in denen die Orthodoxie herrschte, waren Weinstuben die Orte, in denen Freigeister und unabhängige Männer wie er ihre Zuflucht fanden. Khayyams Wein ist ein Wein der Revolte, eine Revolte gegen die Institutionen, die Bigotterie und die Unterwerfung der Natur. Sein Wein ist wahrhaftig und berauschend, er erzeugt eine Trunkenheit, die einen Traum entstehen lässt, der die Welt noch einmal erschafft. Für Sie ist die Zusammenarbeit und das Verschmelzen verschiedener Musiken aus unterschiedlichen Kulturen eine wichtige Erfahrung. Ihre CD „Suerte“ (Schicksal) realisierten Sie mit spanischen, arabischen und französischen Musikern. Ist das Ihre persönliche Annäherung an die arabo-andalusischen Zivilisationen? Abed Azrié: Die Texte sind neunhundert Jahre alt und könnten ein Beispiel für heutige Fusionen und Berührungen verschiedener Musiken und Kulturen sein. Die andalusische Dichtung, die andalusische Kunst überhaupt, dieses größte Experiment in der Geschichte der Völker, wo Religionen, Musiken und Kulturen sich miteinander verbanden, ist beispielhaft für mich, denn ich liebe die Vermischung und die Berührung der Kulturen. Wenn man andere Kulturen liebt – und Liebe heißt hier das Wissen, die Poesie, die Musik und die Kultur der anderen kennenzulernen –, dann ist eine echte Verbindung möglich. Diese Arbeit komponierten Sie für die arabische und die spanische Sprache. Wollten Sie die beiden Sprachen vermischen? Abed Azrié: Zwischen beiden Sprachen ist im Laufe der Geschichte etwas Einmaliges geschehen. Jede Sprache akzeptierte die jeweils andere. Auch die Menschen der jeweils anderen Sprache akzeptierten sich gegenseitig. Sie haben mit- 24 einander etwas Neues geschaffen. Für mich ist die arabischandalusische Zeit wie ein kurzer Traum, der schnell vorüberging. Aber dieser Traum ist möglich geworden, und man könnte ihn jederzeit wieder verwirklichen. Deshalb nenne ich jeden Moment, in dem die Menschen zusammenkommen und sich in Toleranz begegnen, einen andalusischen Moment. Deshalb musste ich zwei Sprachen benutzen und drei verschiedene Ensembles. Wofür drei Ensembles? Die arabische Sprache braucht arabische Instrumente, die spanische die Gitarre und das rhythmische Klatschen. Gleichzeitig leben wir aber alle in Frankreich, in Europa. So brauchte ich auch noch die Instrumente eines Kammermusikensembles. Denn ich liebe die Kammermusik sehr. Zwei Sprachen, zwei Sänger und drei Ensembles bilden für mich ein kleines Andalusien, das nur in der Musik existiert. Ein großes Projekt war die Vertonung des Johannes-Evangeliums auf Arabisch. Sie haben dieses Oratorium mit dem Chor und einem Ensemble für traditionelle Musik aus Damaskus sowie mit dem Orchester des Jeunes de la Méditerranée aus Frankreich durchgeführt. Die Uraufführung fand im Mai 2009 im Opernhaus von Damaskus statt; es folgten Aufführungen in Fez, Marseille und Nizza. Warum haben Sie dieses Werk in arabischer Sprache vertont? Abed Azrié: Ich wollte diese Geschichte erzählen, die Geschichte eines Menschen, der im Orient geboren ist und heute im Westen lebt. Er erinnert sich an seine Kindheit. Ich gehe mit dieser Arbeit zurück in meine Kindheit, aber ich reise auch in Richtung Westen. Ich arbeite an Texten, die die Kultur des Vorderen Orients bestimmt haben. Auch das Johannes-Evangelium gehört dazu. Jesus, zugleich Mensch und Gott, ist hervorgegangen aus dem Fruchtbarkeitsglauben der Sumerer, der Babylonier, der Kanaanäer und der Phönizier. Mit seinem Leben, seinem Tod und seiner Auferstehung nimmt er ein sehr altes Thema wieder auf und verknüpft damit eine jahrtausendealte Mythologie, die im gesamten Mittelmeerraum zu Hause ist. Sie stellt damit einen Teil des gemeinsamen Fundaments dieses kulturellen Raumes dar. Ich selbst bin nicht gläubig. Aber ich hatte das Bedürfnis, diesen Text auf die Bühne zu bringen. Für mich sind die Figuren in diesem Evangelium normale Menschen. Ich sehe sie auch heute in den Gesichtern der Menschen im Orient vor mir. Ich habe moderne Musik geschrieben, als ob die Geschichte und die Menschen aus dem Evangelium heute lebten. Suleman Taufiq stammt aus Syrien und lebt seit Ende der sechziger Jahre in Deutschland. Er ist freier Schriftsteller und stellt im Westdeutschen Rundfunk den Hörern in Deutschland regelmäßig orientalische Musik vor. Copyright: Goethe-Institut e. V., Fikrun wa Fann November 2011 Abed Azriés Website: http://www.abedazrie.com de, en, ar, fa GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 25 Drei Musikerporträts Von Suleman Taufiq Rabih Abou-Khalil. Foto Klaus Mümpfer Der Musiker Marwan Abado „Kunst hat die Aufgabe, das Leben zu verlangsamen“, sagt Marwan Abado. Bereits in Beirut hatte er angefangen, sich für Musik zu interessieren. Dort wurde er 1967 als palästinensischer Flüchtling geboren. Er erhielt Musikunterricht und kam so mit neuen musikalischen Formen, mit Theater und Sprechgesang in Berührung. Von seinen Ersparnissen kaufte er sich die erste arabische Laute, einen Oud, und wurde 1983 Mitglied in einer Gruppe, mit der er zwei Jahre lang gemeinsam auftrat. In Beirut konnte er nicht länger bleiben. Im Libanon tobte der Bürgerkrieg und es wurde dort vor allem für die Palästinenser immer gefährlicher. Abado beschloss 1985, nach Europa zu gehen, und landete in Wien. Er fühlte sich dort sofort wohl. Er fand eine multikulturelle Atmosphäre vor, die seine Musik später entscheidend prägte. Als er in Wien ankam, konnte er kein Wort Deutsch. Aber er hatte viele Pläne. Als er erfuhr, dass vor allem klassische Musik in dieser Stadt eine große Rolle spielte, entschloss er sich, hier Musik zu studieren. Zwar hatte er noch keine genaue Vorstellung davon, wie sich ein Studium mit seinen beruflichen Plänen verbinden könnte. Aber er schrieb sich am Konservatorium ein und wollte Oud studieren, was in Wien damals aber nicht möglich war. So meldete er sich für Gitarre an. „Hier habe ich das Glück gehabt, dass ich den irakischen Oudmeister Assim Al Schalabi getroffen habe. Er war für mich ein wichtiger Lehrer. Von ihm habe ich viel gelernt, tech- nisch und auch die irakische Art und Denkweise beim Oudspiel.“ Schon bald nach seiner Ankunft gründete er seine Band Abado & Co. Das Ensemble vermischt orientalische und abendländische Musikelemente, aus Fremdem und Eigenem entsteht Neues. Wien war für ihn das „Tor zur Welt“, der ideale Ort, sich musikalisch weiterzuentwickeln. Sein erstes Album „Kreise“, zeigt deutlich, dass er von der westlichen Musik inspiriert wurde. „Kreise“ ist hauptsächlich Instrumentalmusik für Oud, Kontrabass, Sopransaxophon und Schlagzeug. Neben solchen instrumentalen Alben kehrt Marwan Abado immer wieder zu seiner großen Liebe, der Lyrik, zurück. Texte moderner arabischer Autoren sowie eigene Gedichte stehen zum Beispiel in seinem Programm „Kabila“ im Zentrum. Zusätzlich zu der musikalischen Zusammenarbeit im Ensemble strebt Abado weiterhin solistische Programme an. Auf der Solo-CD „Sohn des Südens“, veröffentlichte er eigene Lieder, die er im Laufe der Jahre komponiert hatte. Sie wollte er nicht in einer großen Formation darbieten. Marwan Abado ist zum Grenzgänger zwischen den Kulturen geworden. Aus dem Geist der Improvisation schafft er mit seiner Gruppe eine rhythmisch dominierte Musik vor dem Hintergrund traditioneller arabischer Melodien. „Meine Musik ist ein Teil meines Lebens, besteht aus einem Ursprung, aus einer bestimmten Biografie, und sie besteht auch aus einem Leben im schönsten Exil, in Wien. Für mich ist Exil ein Ort der Begegnung, der Entwicklung. Diese Begegnungen sind auch Teil dieser Kompositionen.“ GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 26 Zu einem wichtigen Einfluss in seiner Musik wurde auch der Jazz. Improvisation heißt das Zauberwort, das beide Musikstile, den Jazz und die orientalische Musik, gemeinsam verbindet. Denn auch für die orientalische Musik gilt ihr Reichtum an Improvisationen als typisches Charakteristikum. Dem heute in Zeiten der „World Music“ oft gängigen Trend zur musikalischen Vermischung, zu einem bunten Klangbrei, setzt Abado eine Musik entgegen, in der die ein zelnen Klangwelten hörbar bleiben und noch zu unterschei- den sind. Abado wurde für seine interkulturelle Arbeit mit dem Bundesehrenzeichen für Interkulturellen Dialog vom österreichischen Ministerium für Unterricht, Kunst und Kultur geehrt. Der libanesische Musiker Rabih Abou-Khalil trieb er seine Platten noch von zu Hause aus, packte sie eigenhändig in Tüten und fuhr mit dem Zug zu den Plattenläden, um sie einzeln zu verkaufen. Als die Plattenfirmen bemerkten, dass sich „Between dusk and dawn“ zu einem Bestseller entwickelte, boten sie ihm einen Vertrag an. Anfang der neunziger kam plötzlich ein Anruf von Matthias Winckelmann, Produzent des Jazzlabels Enja, und nahm ihn unter Vertrag. Bis jetzt ist er Enja treu geblieben. Mit seinen originellen, neuen Klangwelten hat Rabih Abou-Khalil sich inzwischen einen Namen auf dem internationalen Jazzmarkt gemacht. Sein musikalisches Gemisch aus traditioneller arabischer Musik, europäischer Klassik und Jazz setzte neue Maßstäbe in der zeitgenössischen improvisierenden Musik. Seine Vielfältigkeit öffnete ihm offensichtlich überall auf der Welt die Türen der Konzertsäle. Mehr als eine halbe Million verkaufter CDs und Konzerte in der ganzen Welt zeigen auch, dass er und seine Ensembles eine Musik spielen, die nicht mehr nur einer kleinen Gruppe von Jazzbegeisterten gefällt. Allein im Jahr 1999 erhielt er von der Deutschen Phono-Akademie insgesamt fünf JazzAwards. 2002 wurde er mit der Ehrenurkunde des Preises der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Bei der Auswahl der Musiker, mit denen er zusammen auftrat, scheint er ein glückliches Händchen gehabt zu haben. Zu seinen Mitspielern zählten u. a. die klassischen Ensembles Kronos Quartett und Balanescu Quartett ebenso wie die Jazzgrößen Charlie Mariano auf dem Saxophon, der Trompeter Kenny Wheeler und der Weltmusiker Glen Velez. In seinen Aufnahmen mischen sich orientalische Instrumente wie die Laute Oud und die Rahmentrommel Riq mühelos unter die bekannte Palette typisch europäischer Instrumente wie Cello, Violine, Saxophon und Tuba. Verschiedene Stile existieren in seiner Musik gleichberechtigt nebeneinander. Abou-Khalil gelingt es, eine musikalische Fusion aus progressiver, euro-amerikanisch geprägter Rhythmik und orientalisch geprägter Instrumentalarbeit zu schaffen. Die Musik von Rabih Abou-Khalil enthält ein ganzes Spektrum von Klangfarben und Musikwelten. Als Solist auf dem Oud, der arabischen Knickhals-Laute, sowie als Komponist ist es ihm gelungen, eine ganz eigenständige Musik zu schaffen. Außerdem faszinierte ihn mehr und mehr der amerikanische Jazz. Die Wurzeln seiner arabischen musikalischen Herkunft behielt er dabei immer im Blick. Sich mit diesen Musikwelten gleichzeitig auseinanderzusetzen, befruchtete seine musikalische Arbeit nachhaltig. Sie war und ist für ihn eine Quelle der Inspiration und eröffnete ihm neue Möglichkeiten der Komposition. Rabih Abou-Khalil wurde 1957 in Beirut geboren und wuchs dort im politisch unruhigen, aber dennoch kulturell anregenden Klima der sechziger und siebziger Jahre auf. Hier lernte er in jungen Jahren, auf dem Oud zu spielen. 1978 trieb der Bürgerkrieg ihn ins europäische Ausland. In Beirut hatte er bereits in der Schule Deutsch als Fremdsprache gelernt. Er ließ sich in München nieder, weil dort bereits ein Schulfreund lebte. Hier begann er, klassische europäische Musik zu studieren. Neben der Gitarre war die Querflöte sein Hauptinstrument. In den Jahren des Studiums setzte er sich ausgiebig mit der Musiktheorie der europäischen Klassik und der Moderne auseinander. Das Studium in München bei Professor Walther Theurer bedeutete für ihn eine wichtige Herausforderung, wie er sagte: „Es wird von einem natürlich schon wesentlich mehr Perfektion verlangt. Das war schon eine schwere Schule. Heute bin ich natürlich sehr froh, oder kurze Zeit später war ich froh.“ Nach dem Studium spielte Rabih Abou-Khalil als Flötist in einem Ensemble. Dennoch blieb es sein Wunsch, wieder seine arabische Laute spielen zu können. Aber Ende der siebziger Jahre klang sie den europäischen Ohren noch zu fremd. Hinzu kam, dass der Begriff der Weltmusik noch nicht verbreitet war. Und so spielte er auf seiner ersten Schallplatte weiterhin die Querflöte. 1987 brachte er seine dritte Platte „Between dusk and dawn“ heraus – sein erster größerer Erfolg, der sich auch in der Anzahl der verkauften Platten zeigte. Zu jener Zeit ver- Marwan Abados Website http://marwan-abado.net de, en, ar, fa Musik von Rabih Abou-Khalil http://www.myspace.com/rabihaboukhalil de, en, ar, fa GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Das Ensemble Sarband Sarband vereint Musiktraditionen aus dem Orient und dem Okzident aus Gegenwart und Vergangenheit, vermittelt zwischen mittelalterlicher Musik und noch heute lebendigen Traditionen. Das Ensemble ist aus einer kontinuierlichen Zusammenarbeit unterschiedlicher Musiker und Sänger zusammengewachsen. Seine Originalität schöpft es aus dem respektvollen interkulturellen Dialog der Musiker untereinander wie auch aus der Vielseitigkeit seiner internationalen Besetzung. Alte Instrumente, originelle Spielweisen, verschiedene Gesangstechniken und Improvisationspraktiken, wie sie im Mittelmeerraum noch lebendig sind, ergänzen sich zu einer mitreißenden und authentischen Musik. Je nach Projekt kommt es zur Zusammenarbeit mit anderen Musikern, Ensembles und Orchestern. Gegründet und geleitet wird Sarband seit 1986 von dem in Bulgarien geborenen Musikwissenschaftler und Musiker Vladimir Ivanoff. Ihm geht es vor allem um die Verwandtschaften zwischen den Musikkulturen des europäischen Mittelalters und des Orients. Ihm und allen Mitwirkenden ist wichtig, die Möglichkeit eines friedlichen Zusammenlebens von Menschen aus verschiedenen Kulturen darzustellen und sinnlich erfahrbar zu machen. Vladimir Ivanoff studierte Musikwissenschaft in München, Renaissancelaute und historische Aufführungspraxis an der Musikhochschule Karlsruhe und an der Scola Cantorum in Basel. Dann studierte er Oud, die arabische Laute, und Trommeln bei verschiedenen traditionellen Musikern. Später lehrte er Musikwissenschaft an der Universität in München. Der Name des Ensembles ist programmatisch gedacht. „Sarband“ ist ein persisches Wort, das in fast allen orientalischen Sprachen in Abwandlungen vorkommt, wie zum Beispiel im Türkischen und Arabischen, und ein verbindendes Element meint. In der Musiktheorie stellt es ein improvisiertes Stück dar, das zwischen zwei Sätzen einer Suite gespielt wird. 1990 erschien das erste Album „Cantico“. Damit begann Sarband seine musikalische Reise zwischen den Kulturen mit einer Gegenüberstellung der Musik der italienischen LaudesiBrüderschaften und des islamischen Sufi-Ordens. „Cantico“ war Musik der türkischen Sufis aus dem 12. und 13. Jahrhundert und Musik aus dem Kreis von San Francesco, der zweimal im Nahen Osten war, und sehr stark von diesem sufischen Gedankengut beeinflusst war. 27 Die nächste Arbeit, die im gleichen Jahr erschien, war eine CD mit dem Titel „Music of the Emperors“. Mit dem Vergleich der musikalischen Traditionen von Orient und Okzident wollte Sarband nicht nur die musikalischen Gemeinsamkeiten, sondern auch die wesentlichen Unterschiede zeigen. Denn die beiden Kulturen hatten sich ausgetauscht und befruchtet. „Das ist höfische Musik, einerseits vom Hof Friedrichs II. in Palermo, dem berühmten Stauferkaiser, andererseits vom Hof von Taimur in Samarkand. Dies sind zwei Herrscher, die einen Anspruch hatten auf die Weltherrschaft und deswegen auch so eine Art Weltmusik an ihren Höfen veranstaltet haben. Friedrich hatte sehr viele nahöstliche, arabische Musiker da. Er interessierte sich im Allgemeinen ja bekanntermaßen sehr stark für arabische Kultur. Und Taimur hatte sozusagen ein Orchester mit Musikern aus allen Gebieten, die er praktischerweise erobert hatte, also es geht in diesem Fall sozusagen um Weltmusik als Zeichen der Macht.“ Sarband beschäftigt sich hauptsächlich mit den mystischen Musiken der beiden Kulturen und vor allem mit der Zeit des 19. Jahrhunderts. Denn im frühen 19. Jahrhundert gab es eine große Walzer-Mode in Europa, die auch ins Osmanische Reich überschwappte. „Dort gab es dann Komponisten, denen gefielen die Walzer, aber in der nahöstlichen Tradition. Zu ihnen gehört beispielsweise Dede Efendi, der europäische Walzer in seiner Komposition aufgenommen hat und dann diese Walzer-Elemente zu mystischen, zu religiösen Walzern werden ließ. Sarband hat in diesem Projekt versucht, Beethoven-Orchesterwalzer mit den religiösen Sema-Walzern von Dede Efendi zu verbinden.“ Das aktuelle Projekt von Sarband heißt „Eine Arabische Passion: Johann Sebastian Bachs Passionsmusiken in heutiger und arabischer Metamorphose“. Mit einer arabisch-europäischen Besetzung hat das Ensemble Melodien ins Arabische verwandelt. Die Bach-Melodien wurden nicht verändert. Die Libanesin Fadia El-Haj singt die Alt-Arien auf Arabisch. Die Texte wurden ins Arabische übersetzt. Das Ergebnis ist eine Mischung aus alten Musikinstrumentalisten, arabischen klassischen und Jazz-Musikern, die eine ebenso vielfältige Mischung aus unterschiedlichen Musiktraditionen spielen. Website des Ensemble Sarband http://www.sarband.de de, en, ar, fa Suleman Taufiq stammt aus Syrien und lebt seit Ende der sechziger Jahre in Deutschland. Er ist freier Schriftsteller und stellt im Westdeutschen Rundfunk den Hörern in Deutschland regelmäßig orientalische Musik vor. Copyright: Goethe-Institut e. V., Fikrun wa Fann November 2011 GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 28 Sufi-Musik in Pakistan Meine eigentliche Initiation in die traditionelle Musikkultur des indischen Subkontinents erlebte ich am 11. November 1996 vor einem Hotelzimmer in Lahore, der Kulturmetropole Pakistans. Von Jürgen Wasim Frembgen Polo-Turnier auf dem höchstgelegenen Polofeld der Welt, Pakistan. Früh morgens wecken Musiker die Besucher für das Turnier. Foto: Markus Kirchgessner © Goethe-Institut Meine eigentliche Initiation in die traditionelle Musikkultur des indischen Subkontinents erlebte ich am 11. November 1996 vor einem Hotelzimmer in Lahore, der Kulturmetropole Pakistans. Zwar hatte ich bereits als junger Mann seit Mitte der siebziger Jahre indische, afghanische und iranische Musik, die regelmäßig im Westdeutschen Rundfunk gesendet wurde, auf einem alten Grundig-Tonbandgerät aufgenommen und kaum ein Live-Konzert dieser fremden Klangwelten im heimatlichen Bonn-Kölner-Raum versäumt, doch zweifellos fehlte mir noch etwas: das wirklich tiefe Erleben, das völlige Ergriffensein und die Erfahrung jener Sogwirkung, die gerade durch die klassische Raga-Musik mit ihrem Reichtum an Obertönen ausgelöst werden kann. Damals faszinierte mich eher die exotische Farbigkeit und Fülle dieser östlichen Klänge. Wenig konnte ich dagegen anfangen mit der sorgfältig komponierten und orchestrierten westlichen Klassik und ihrer Harmonielehre, die auf die griechische Antike zurückgeht. In Indien und Pakistan wird die Kunstmusik der Ragas mit dem ganzen Körper erfahren! Einem solchen ganzheitlichen Hören steht die eher steife Atmosphäre westlicher Konzertsäle gegenüber: Hier sitzen die Musiker in Licht getaucht auf der Bühne, abgetrennt von den in Stuhlreihen gezwängten Zuhörern. Während indische und pakistanische Musikliebhaber in ihrem traditionellen Ambiente auf Teppichen am Boden sitzen und ihr Ergriffensein durch Gesten und Zurufe lebendig äußern, verharren westliche Hörer still und andächtig, schließen ihre Augen, um nur am Ende eines Konzerts Beifall zu klatschen. Hörgewohnheiten und Verhaltensweisen könnten unterschiedlicher nicht sein! Daher bedurfte es eines Zufalls, der mich erst im Jahre 1996 zu einem musikalischen Erlebnis führte, das sich schließlich als Wendepunkt in meinem Verständnis von Kunst überhaupt herausstellen sollte. Es waren Klänge, die mein Leben neu bestimmen sollten. Musikalische Erfahrungen sind ja immer auch Schritte hin zur eigenen Selbstverwirklichung. Erlebnis in Lahore Ich befand mich damals auf einer Forschungsreise nach Indien und machte Station im pakistanischen Lahore, wo ich die Nacht in einem kleinen Hotel in Anarkali verbrachte. Anarkali, wörtlich „Granatapfelblüte“, ist der berühmteste Basar von Lahore, unweit der befestigten Altstadt – benannt nach der Haremsdame Anarkali, die von Moghulkaiser Akbar lebendig GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 begraben wurde, da sie ein Lächeln seines Sohnes erwidert hatte. Dieser hatte Anarkali leidenschaftlich geliebt und ließ nach ihrem Tode ein exquisit verziertes Grabmal für sie errichten. Am Abend schlenderte ich an den Läden des Viertels vorbei, das in den zwanziger und dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts im Ruf stand, der größte und schönste Basar ganz Nordindiens zu sein. Damals verkauften hier fast ausschließlich Hindus ihre Waren – bis auf eine Handvoll Geschäfte, die von Muslimen geführt wurden. Am Eingangstor des alten Delhi-Muslim-Hotels lockten mich die raspelnden Klänge einer Tabla in den Garten des Innenhofes. Der Trommler spielte ein paar Rhythmen und regulierte dann die Fellbespannung seiner Tabla, dem Hauptinstrument zu seiner Rechten, indem er mit einem kleinen Hammer auf die unter den Lederriemen sitzenden Holzpflöcke schlug. Die schmalen Riemen sind an der geflochtenen Lederschnur befestigt, die das Schlagfell umsäumt. Die kleine Pauke zu seiner Linken stimmte er durch das Verstellen einiger Kupferringe. Meine Frage, ob ein mehfil – ein Konzert – zu erwarten sei, bejahte er und wies mich beiläufig zur Tür des nächsten Bungalow-Hotelzimmers, dort wohne der berühmte Maharadsch Kathak. Von diesem außergewöhnlichen Mann hatte ich bereits gehört und gelesen, galt er doch als bedeutendster lebender Meister des nordindischen Kathak-Tanzes; schon nach seinem ersten Auftritt 1936 in Benares wurde er mit stehenden Ovationen gefeiert. Zwei Jahre später erhielt er den Ehrentitel Maharadsch Kathak – „Großer Fürst des Kathak“. Der würdevolle alte Herr mit den schütteren weißen, bis in den Nacken fallenden Haaren, weichen Gesichtszügen und einer lebendigen Mimik empfing mich beim Essen im Kreis seiner Freunde, ließ mir ohne Umschweife einen Teller mit vegetarischen Köstlichkeiten bringen und lud mich ein, sein Gast zu sein. Zuerst Nahrung für den Körper, anschließend Nahrung für die Seele! Maharadsch Ghulam Hussein Kathak, 1905 in Kalkutta geboren, verspürte mit Anfang zwanzig seine Hinwendung zu dieser verfeinerten Form des Tanzes, die an den muslimischen Fürstenhöfen Nordindiens gepflegt wurde. Kathak ist eine Form des Geschichtenerzählens mit Tanzbewegungen, Mimik und Gesang, die auf frühe Hindu-Traditionen zurückgeht. Vertikale Körperhaltung, Pirouetten und Fußarbeit kennzeichnen den Tanz, der Gesänge im Stil des Thumri – dies bedeutet wörtlich „verzückter Schritt“ – begleitet. Gegen den Willen seiner konservativen Familie – sein Vater war ein Geistlicher – gab sich der junge Tänzer ganz dieser Leidenschaft hin und vervollkommnete seine Künste bei einem berühmten Meister der legendären Kathak-Schule von Lucknow, in der ein besonders anmutiger und eleganter Stil gepflegt wurde. Zusätzlich studierte er Malerei sowie Ghasal- und 29 Thumri-Gesang. Nach der Teilung Indiens im Jahre 1947 kam Baba-dschi, wie Maharadsch Kathak respektvoll von den Liebhabern seiner Tanzkunst genannt wird, nach Lahore. Etwa zehn Jahre später, so erzählte er mir, beendete er wegen seines fortgeschrittenen Alters seine aktive Zeit als Tänzer, um fortan als Lehrmeister tätig zu sein. Nicht ohne Stolz wies er darauf hin, dass so prominente Tanzkünstler wie Nahid Siddiqi und Fasih ur-Rehman zu seinen Schülern zählen. Aber auch Tänzerinnen aus Hira Mandi, dem „Diamantenmarkt“ und Rotlichtbezirk in der Altstadt von Lahore, ließen sich vom ihm ausbilden. Als Maharadsch Kathak schließlich aus seinem Zimmer trat und seinen Platz in der vordersten Reihe der Wartenden einnahm, die in einem Halbkreis um die Musiker gruppiert waren, stellte einer seiner Freunde flugs eine Silberschale mit paan, Betel, sowie einen großen Messingspucknapf vor ihn hin: Nun konnte die Musiknacht mit dem Sänger Hamid Ali Chan beginnen! Der vielseitige, in sämtlichen klassischen Stilen versierte Künstler, der zu einer berühmten Schule von Musikern gehört, beschränkte sich – dem Wunsch seines Gastgebers entsprechend – ganz auf das Genre des Ghasal und begleitete sich dabei auf dem Harmonium. Einige Lieder homoerotischen Inhalts, deren Urdu-Verse er so klar und prononciert, im Ausdruck voller Hingabe, ja Wehmut und mit einem bemerkenswert warmen Timbre vortrug, sind mir noch in Erinnerung: Darunter „tark-e muhabbat kar baithe ham – Wie konnte ich nur die Liebe aufgeben?“ und vor allem: „sirf ahsas ki aankhon se nasar aunga – Nur durch die Augen der Gefühle sichtbar“. Diese Nacht wurde für mich jedoch nicht nur wegen der einzelnen Ghasals zu einem Ereignis, sondern mehr noch wegen ihrer besonderen Atmosphäre, ihres authentisch-lebendigen Kontextes, in den sich die Musikconnaisseure völlig eingebunden fühlten. Diese zeigten ihre Bewunderung für den Dichter und den musikalischen Ausdruck – aber auch ihre eigene Verzückung – durch Gesten ihrer Hände und durch lobende Zurufe wie „wah, wah – Bravo!, fantastisch“, „subhanallah – Ehre sei Gott!“, „kya kehna – Was soll man sagen?“ oder „kya baat hai – Was für poetische Worte!“. Ergriffene Liebhaber des Ghasal wechselten eilig Hundert-Rupien-Scheine gegen Bündel mit Zwei-Rupien-Scheinen und ließen diese auf Maharadsch Kathak und den Sänger herabregnen – in einer traditionellen Geste, die vel genannt wird und die ich hier zum ersten Mal erlebte. Unter den Anwesenden entstand ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Vertrautheit – Ethnologen sprechen in solchen Fällen von Communitas. Auch ich wurde in das lyrisch-musikalische Geschehen miteinbezogen, fühlte mich als ein Teil von ihm, berührt von der Zartheit der Ghasal-Lieder, Blicke wechselnd mit den neben mir sitzenden Hörern: So teilten wir unsere Sinneseindrücke miteinander. Immer wieder wurden paan und Wasser und später auch Tee GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 unter den Anwesenden herumgereicht. Immer wieder auch anrührende Gesten der Ehrerbietung gegenüber dem über neunzigjährigen Maharadsch Kathak, die mir unvergesslich geblieben sind: Geldscheine, die seine Bewunderer über seinem Kopf kreisen ließen, um sie zu weihen, Ankommende, die respektvoll seine Füße berührten, Freunde, die duftende Rosenblüten auch über uns herabstreuten. Als ein Diener schließlich frisches, in Silberfolie gewickeltes paan unter den Musikliebhabern verteilte, dirigierte mich der Meister zu sich, schob mir eigenhändig einen Pfriem mit süßem Betel in den Mund und meinte scherzhaft, dass seine Freundesrunde eigentlich eine paandaan-chaandaan sei – eine Familie, die sich um die Beteldose zusammenfinde. Ob ich nicht die Geschichte eines Fürsten aus Lahore kennen würde, der in seinem Palast jeden Abend ausgiebig paan kaute und dies von seinem Balkon aus einfach auf die Straße hinunterzuspucken pflegte. Eines unglücklichen Tages verwechselte er jedoch die Prozedur, spuckte in sein Zimmer und sprang vom Balkon aus in die Tiefe. Paan -Genuss sei eben eine schlechte Angewohnheit! Feinde der Musik Strenggläubige Muslime – ob der sunnitischen oder der schiitischen Glaubensrichtung angehörend – begegnen Musik mit Argwohn; je fundamentalistischer sie den Islam auslegen, desto mehr lehnen sie Musik in Bausch und Bogen ab. Die Musikfeindlichkeit des Gesetzesislam ist jedoch nicht im Koran begründet, sondern in angeblichen Überlieferungen des Propheten, in denen von den „verbotenen Freuden“ der Musik die Rede ist. Dem widersprechen jedoch Traditionen, nach denen Muhammad nicht nur Musik hörte, sondern sie sogar befürwortete. Nichtsdestoweniger berufen sich Sunniten auf den ultraorthodoxen Theologen und Juristen Ibn Taimiyya, der Ende des dreizehnten und Anfang des vierzehnten Jahrhunderts im mamlukischen Ägypten die Ausdrucksformen der volkstümlichen Kultur mit ihren berauschenden Festen, erotischen Dichtungen und ekstatischen musikalischen Rhythmen heftig kritisierte und als ungesetzliche, ja perverse Neuerungen verurteilte. Das Hören mystischer Musik ziehe Dämonen an, behauptete er. So zog der Anti-Sufi Ibn Taimiyya tiefe Gräben um das Normengefüge des Islam, um den populären, gelebten Islam als heidnisch auszugrenzen. Heute sind die puritanischen Wahhabiten Saudi-Arabiens und die sunnitischen Salafi-Islamisten zwischen Nordafrika, Südasien und Indonesien die Erben dieser Ideologie, die von vielen strenggläubigen Muslimen – auch von konservativeren Sufis – mitgetragen wird. In Pakistan versuchen die Kleriker der Deobandi-Schule, ihre Taliban-Zöglinge und die radikal-religiöse Partei der Dschamaa-t-e Islami der Gesellschaft ihren harten Stempel aufzudrücken. Mit ihrer calvinistisch anmutenden Tyrannei der Tu- 30 gend bekämpfen sie die mystisch geprägte Alltagspraxis des Islam und damit auch die religiösen Räume, in denen Frauen sich frei entfalten und äußern können. Die intoleranten Taliban, die in einer Welt fast ohne Frauen aufwachsen und gedrillt werden und denen Dimensionen von Weichheit und Schönheit völlig abhanden gekommen zu sein scheinen, versuchen die Anhänger des Sufi-Islam massiv einzuschüchtern, insbesondere Musiker und Tänzer. Schabana, die berühmteste Tänzerin aus dem Swat-Tal, wurde Anfang 2009 nach einer Darbietung in ihrem Haus getötet; ihren von Kugeln durchsiebten Körper bedeckten ihre Mörder mit Geldscheinen und CDs ihrer Tanz-Performances und stellten ihn zur Abschreckung vor „unmoralischen Shows“ auf dem Hauptplatz der Stadt Mingora aus. Auf diese Weise vergiften und zerstören die militanten sunnitischen Taliban ihre eigene paschtunische Kultur in Pakistan und Afghanistan, die neben einem Kult der Männlichkeit gerade auch Romantik und Schönheitssinn pflegte. Allerdings stehen die schiitischen Theologen im Iran der Musik mindestens genauso feindselig gegenüber; die einzige Emotionsäußerung, die sie erlauben, ist das Weinen um die Märtyrer! Nach Überzeugung all dieser Hardliner und Puritaner lenkt Musik vom Glauben an Gott ab, vor allem Melodien und Rhythmen, die zum Weintrinken und zu erotischen Vergnügungen verführen. Diese Musik sei vom Satan geschickt und habe den Verlust der Kontrolle von Körper und Seele zur Folge, predigen Sie. Beim Jüngsten Gericht werde jedem, der verbotener Musik gelauscht habe, geschmolzenes, heißes Blei in die Ohren gegossen. Musik und mystischer Islam Spirituelle Musik, wie sie Mystiker mit dem Herzen und der Seele hören, wird in einigen weniger strengen Strömungen des Sufismus geradezu als „Gegengift“ gegen Gesetz, Dogma und Ratio angesehen. Sufis und Derwische haben daher Überlieferungen gesammelt, in denen die Praxis des mystischen „Hörens“ – samaa – direkt oder indirekt befürwortet wird. Sie handeln von den Klangwelten des Paradieses, wo himmlische Töne von Bäumen ausgehen und sphärische Klänge den Thron Gottes umwehen, und von den schönen Tönen in der Natur – etwa den Vogelstimmen. Auch der Prophet soll subtile, von Steinen und Pflanzen ausgehende Stimmen gehört haben, die ihn grüßten. Hier liegen die eigentlichen Ursprünge und Vorbilder der Sufi-Musik, die sich zuerst im iranischen Kulturraum entwickelte und von dort verbreitet hat. Bereits seit frühislamischer Zeit gehören Musikveranstaltungen zum religiösen Leben der Mystiker. Kaafii-Gesänge und Trance-Rhythmen, wie wir sie beim urs von Imam Gul gehört hatten, die Lieder der Wanderderwische und vor allem die ekstatischen Liebesverse der Qawwali-Sänger sind GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 überall auf dem Subkontinent genuiner Bestandteil der Feste muslimischer Heiliger. Doch welche Rolle spielt die klassische nordindische RagaMusik heute, wie wird sie wahrgenommen, wie wird sie körperlich erlebt, in welchen Qualitäten wird sie geschätzt, welche Emotionen füllen ihre Klangräume? Antworten auf diese Fragen bekam ich in den Gesprächen mit meinem Freund Aschfaq. Gespräch über die Schulen der Meister Als ich Dr. Aschfaq Chan im Oktober 1998 zum ersten Mal bei einer privaten mehfil in Lahore traf, sprachen wir anschließend über Musik, und er verglich die verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen des Islam – Dichtung, Kalligrafie, Buchmalerei, Keramik, Metallarbeiten, Teppiche, feine Gewebe, Holz- und Elfenbeinschnitzereien und viele andere – mit den Perlen einer Gebetskette. Die Stimme und der Klang jedoch, die ersten ursprünglichen Äußerungen Gottes, seien wie die minarettförmige Abschlussperle, die Krone der Künste, betonte er. „Wenn du die klassische Musik bei uns verstehen willst“, erklärte Aschfaq mir bei einem unserer nächtlichen Gespräche in seinem Musikzimmer, „so musst du mehr über die Institution der Takias und Baithaks in Lahore erfahren. In den Baithaks haben früher die Meister unterrichtet, es gab solche für Musik, Kalligrafie, Miniaturmalerei oder auch für Arabisch-Unterricht.“ „Gebraucht man dieses Wort in Urdu nicht einfach für einen Platz, an dem jemand sitzt?“, warf ich ein. „Mir ist der Begriff vor allem bekannt für die Audienzräume lebender ‚Gottesfreunde’ und der Nachkommen verstorbener Heiliger.“ „Ja, dort residieren die Meister der Gottesliebe und die Seelenführer. Du hast doch vor Kurzem den alten Kalligrafen Ustad Salim besucht, der noch immer im Baithak seines Vaters arbeitet.“ „Baithak Katiban, genau, das ‚Zimmer der Schreiber’ wird es genannt, es liegt in der Walled City kurz hinter dem LohariTor, auf der linken Seite im ersten Stock eines Hauses. Mir hat die alte Architektur so gut gefallen mit ihren zur Gasse hin geöffneten hohen Fensterflügeln und dem niedrigen Schreibpult, an dem der Schriftkünstler arbeitete.“ „Wenn der Ustad einmal stirbt, dann wird dies wohl auch das Ende seines Baithak bedeuten“, bedauerte Aschfaq, „meistens folgen die Söhne nicht mehr ihren Vätern nach, sondern ergreifen andere Berufe. So wird ein Baithak nach dem anderen abgerissen und in ein hässliches Shopping Plaza verwandelt. Unser kulturelles Erbe stirbt seit Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts in rasender Geschwindigkeit aus. Nur wenige 31 Meister der klassischen Musik versammeln heute noch einen Kreis von Schülern um sich in der Art, wie es früher üblich war; solche Refugien sind selten geworden.“ „Immerhin gibt es noch ein paar Baithaks in Hira Mandi“, gebe ich zu bedenken. „Letztes Jahr irgendwann im Februar ging ich die Gasse beim Grab des ‚Grünen Heiligen’ entlang, und plötzlich hörte ich einen Ghasal-Sänger! Als ich lauschend stehen blieb, trat eine Frau auf einen Balkon hinaus und wies mich mit einer Geste zur nächsten Tür.“ Aschfaq schmunzelte. „Denke nicht, ich sei dort auf der Suche nach einem hira – einem ‚Diamanten’ – in Gestalt eines Mädchens gewesen“, beeilte ich mich richtigzustellen, denn schließlich handelt es sich bei dem besagten Altstadtviertel um den „Markt der Schönheit“, in dem die Tänzerinnen, Prostituierten und Musiker leben. Nach dem Sikh-Fürsten Hira Singh wird er auch „Hira Mandi“ genannt. „Eine ganz schmale Tür, hinter der einige steile Stufen mitten in ein kleines Zimmer hochführten, das nur für wenige Leute Platz bot. Der Sänger wurde von einem Tabla- und einem Harmonium-Spieler begleitet, und um die drei herum saßen ein paar Männer, die zuhörten. Ich bin dann eine ganze Weile geblieben, bevor ich in der Nähe einen Bekannten besuchte.“ „Diese Musiker, die Mädchen zu nächtlichen Tanzdarbietungen begleiten, hat es schon immer gegeben, früher wurden sie von gebildeten Kurtisanen gefördert. Doch die großen Meister des Ragas haben an anderen Orten gespielt, in den Takias, die vor den Toren der befestigten Altstadt lagen oder auch weiter abseits in Gärten. Leider sind diese Plätze der Musik alle verschwunden.“ „Wie sahen diese Takias denn aus?“, erkundigte ich mich. „Dieses Wort bedeutet doch eigentlich nur ‚Kissen’ oder ‚Rückenpolster’.“ „Es waren Orte der Entspannung und traditionellen Geselligkeit, schattig natürlich, umsäumt von Bäumen, mit einem Brunnen, mit Matten auf dem Boden, wo Kissen ausgebreitet wurden; in der Nacht von Öllampen beleuchtet. Manchmal gab es auch noch einen Raum für die kühlere Jahreszeit.“ „Also eine Art Musikzimmer im Freien?“ „Ja, so ungefähr. Die Männer kamen zusammen, um sich zu unterhalten, um Schach, Patschisi, Luddo oder Karten zu spielen, Poesie vorzutragen, Musik zu hören oder athletische und gymnastische Übungen zu treiben. Reisende kampierten hier nachts, wenn nach der Dunkelheit die Stadttore geschlossen waren, sodass sie erst am Morgen ihren Geschäften in der Walled City nachgehen konnten. Es gab eine ganze Reihe solcher Takia-Karawanseraien – vor allem in der Nähe des Bhatti-Tores – von denen einige nach Heiligen benannt sind; in der Regel kümmerte sich ein Fakir, der von wohlha- GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 benden Gönnern aus der Umgebung unterstützt wurde, um den Unterhalt eines Takia. Doch es gab ein ganz besonderes Takia, in der britischen Kolonialzeit in ganz Nordindien bekannt – Takia Miraassian –, in dem fast täglich Konzerte klassischer Musik stattfanden, eine Art improvisierte, offene Konzerthalle. Einmalig! Nach jedem Konzert wurden schwere Kessel mit köstlichen Speisen herbeigeschafft.“ „Für viele Musiker war es sicher eine Ehre, dort ihre Kunst zu zeigen“, bemerkte ich und nahm gerne noch etwas mit Kardamom aromatisierten Milchtee, den Aschfaqs älteste Tochter uns nachschenkte. 32 Als wir auf die Terrasse hinaustraten, umfing uns der berauschende Duft der „Königin der Nacht“, des Nacht-Jasmins, dessen zart-weiße Blüten sich nur in der Dunkelheit öffnen und ihr starkes Aroma verströmen. Der Chayaal-Gesang Am nächsten Abend setzten wir uns nach dem Essen auf die Terrasse vor dem Musikzimmer und beobachteten die Tauben, die von ihren Ausflügen heimkehrten und sich gurrend in ihrem hoch aufragenden Drahtkäfig niederließen. Die Luft war lau, doch ganz sanft bewegt von einer feinen Brise. Ich lenkte unser Gespräch wieder auf die berühmte Takia-Karawanserai und auf die traditionelle Musikkultur von Lahore. Aschfaq blickte in den Sternenhimmel hinauf. „Natürlich! Weniger bekannte Musiker konnten sich dort vor einem Publikum von Kennern entweder auszeichnen oder so blamieren, dass man Schuhe nach ihnen warf. Wer hier jedoch mit seiner Kunst glänzte, wurde als Chan Sahib anerkannt. Häufig traten große Meister auf, manche von ihnen kamen aus Kalkutta, Delhi, Bombay oder Kabul: Sänger wie Ustad Bade Ghulam Ali Chan Sahib, Umrao Bundu Chan Sahib, Roschan Ara Begum, Ustad Umid Ali Chan Sahib und Ustad Sarahang Sahib.“ „Weißt du, in den dreißiger und vierziger Jahren prägten Sänger wie Ustad Aschiq Ali Chan Sahib das Musikleben in unserer Stadt. Er gehörte zur Schule von Patiala. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er im Takia Miraassian, und als er 1949 starb, ließ ihm seine Schülerin Farida Chanum dort im Hof sein Grab errichten.“ „Leider kennt diese Namen im Westen niemand, höchstens Musikethnologen können dort etwas damit anfangen“, warf ich ein. „Die große Ghasal-Sängerin! Ich dachte, die Musikerdynastie von Patiala habe ausschließlich Chayaal-Sänger hervorgebracht?“ „Das fürchte ich auch, aber es gibt in Europa oder in Deutschland doch sicher auch bekannte Sänger und Instrumentalisten der Klassik und des Jazz, deren Namen den meisten Menschen geläufig sind?“ „Nun, diese Künstler waren in sämtlichen klassischen Stilen bewandert. Farida Chanums Stimme war weich und zart und daher ein idealer Ausdruck im Genre des Ghasal. Hamid Ali Chan, den du bei dem Konzert im Delhi-Muslim-Hotel gehört hast, singt in allen Stilen, von Chayaal bis Ghasal. Auch Bade Ghulam Ali Chan hat herrliche Thumris gesungen. Warte, ich suche eine alte Aufnahme von ihm heraus, da singt er Raga Darbaari Kanaada in Chayaal.“ Aschfaq stand auf und ging in sein Musikarchiv. Während wir uns in die majestätisch-melancholische Stimmung dieses Ragas versenkten, dessen Klänge aus den weit geöffneten Fenstern des Musikzimmers herausdrangen, vergaßen wir ganz den grünen Tee und die Ingwer-Plätzchen … „Mir fallen spontan Klassikvirtuosen ein wie Anne-Sophie Mutter, Anna Netrebko, Andrea Boccelli, Lang Lang. Aber keine Ahnung, ob die bei uns jeder auf der Straße kennt. Jedenfalls verdienen sie sehr gut und gehören zu den internationalen Stars des Musikbetriebs. Jazzmusiker sind leider viel weniger bekannt.“ „Auch unsere Meister der klassischen Musiktradition sind häufig verarmt gestorben und konnten nicht in großen Konzerthallen auftreten.“ Mir fielen die Bilder eines Kataloges über „Meister des Ragas“ ein, den das Berliner Haus der Kulturen der Welt vor einigen Jahren veröffentlicht hatte: Eine einzigartige Galerie seltener Schwarz-weiß-Porträts und ein Who is Who der renommierten Musiker des Subkontinents. Einige von ihnen waren früher sicher in der Takia Miraassian aufgetreten. „Lass uns dieses Gespräch morgen Abend fortsetzen“, schlug Aschfaq vor, dem meine Müdigkeit nach einem langen Tag, den ich in der Altstadt verbracht hatte, nicht entgangen war. Das Genre des Chayaal-Gesangs stellt eine ganz entscheidende Bereicherung des klassischen Ragas durch Muslime dar. Muslimische Sänger vermochten persische Einflüsse mit den Vokalformen des altindischen Dhrupad und dem Qawwali-Gesang zu verschmelzen. Musikhistoriker gehen davon aus, dass sich dieser Stil im Mittelalter in Nordindien entwickelte und seinen vollkommensten Ausdruck in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts unter den Hofmusikern der Moghulherrscher erreichte. Chayaal bedeutet so viel wie eine Idee oder Imagination, ausgedrückt in einem warmen, gefühlvollen Stil durch taans, also Melodieverzierungen, durch Wiederholungen poetischer Verse, durch Dehnungen der Stimme, GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 33 die meend genannt werden, vor allem aber durch Vokalkoloraturen, die als gamak entweder in mittlerem Tempo oder kaskadenartig, ja rasant bis zur Ekstase vorgetragen werden. Eine wahre Stimmakrobatik! Ghulam Ali Chan nach der Teilung Indiens finanziell schlechter, da viele wohlhabende Hindus, die begeisterte Musikmäzene gewesen waren, über Nacht Lahore verlassen und fliehen mussten.“ „Die Stimme ist doch das herrlichste aller Instrumente. Hörst du diese fantastischen Ornamentierungen, die Meister Bade Ghu-lam Ali Chan singt?“ Aschfaq tauchte aus seiner Verzückung auf. „Welche Sängerschulen sind denn heute in Pakistan noch lebendig?“ „Wie Arabesken auf einem Teppich oder einem Fliesenfeld!“, fiel mir ein. „Dhrupad-Gesang ist dagegen reduzierter und einfacher. Schönheit, Hingabe und Spiritualität spürst du aber in beiden Formen des musikalischen Ausdrucks“, sinnierte Aschfaq. „Chayaal ist eine köstliche Frucht des Dhrupad und des SufiIslam!“ „Und Chayaal wurde besonders in der Musiktradition von Patiala gepflegt?“ „Nicht nur von Musikern am Hof von Patiala, die – soweit ich mich erinnere – bei der Teilung Indiens 1947 aus diesem kleinen Fürstentum im indischen Teil des Pandschabs nach Lahore herüberkamen, sondern früher schon von Meistern der Gwalior-Schule. Aber der Stil des Gesangs in Chayaal war bei den Patiala-Sängern besonders vibrierend, funkelnd. Solche bole-taans hörst du sonst kaum.“ „Wörtlich bedeutet das ‚Wort-Verzierungen’ oder nicht? Haben sie also die poetischen Texte besonders hervorgehoben, die um die Gottesliebe kreisen?“ „Ja, das ist eines ihrer Merkmale“, setzte Aschfaq geduldig fort. „Bei der letzten National Pakistan Music Conference hast du doch den Auftritt Ustad Fateh Ali Chans miterlebt, aber du hättest ihn erst früher gemeinsam mit seinem älteren Bruder hören sollen. Unvergleichlich! In der Schule von Patiala haben die Meister immer viel Wert auf die tägliche Übung und Praxis gelegt, auf riyaas . Mein Vater erzählte mir, dass manche Sänger täglich nach dem Morgengebet mindestens eine Stunde lang sangen. Als Letzter kümmerte sich Tschote Ghulam Ali Chan um die Takia Miraas-sian. Übrigens war er ein guter Freund von Maharadsch Kathak.“ „Nannte er sich Tschote – also ‚Jüngerer’, ‚Kleiner’ – aus Respekt für Bade Ghulam Ali Chan, den ‚Älteren’, ‚Großen’?“, fragte ich. „So ist es, beide stammten ja aus der gleichen Stadt, aus Kasur, aber sie sangen vor allem in den Musikzimmern von Lahore. Wie vielen anderen Musikern so ging es auch Tschote „Nun, neben der Schule von Kasur, einer Stadt, die in unserem Teil des Pandschabs liegt, gibt es auf dem Subkontinent mindestens noch zwölf, dreizehn weitere berühmte gharaanas, ‚Häuser’. Ihre Namen stammen entweder von den Fürstenhöfen, an denen die wichtigsten Musiker dienten, oder von den Orten, an denen sie lebten.“ „Manche Musiker zogen doch nach der Teilung Indiens 1947 hier nach Lahore oder Karatschi?“, fragte ich. „Nur manche? Nein, viele Meister emigrierten mit ihren Familien. So wurde das Musikleben bei uns von mindestens acht oder neun indischen gharaanas befruchtet. Einige sehr berühmte Sänger der klassischen Musik Pakistans gehören zum Beispiel zur Gwalior-gharaana , wie übrigens auch Sadiq Ali Chan, der Meis-ter der Klarinette, der mit seiner Brass Band beim Heiligenfest spielte.“ „Aha, also gehören manchmal auch Instrumentalisten zu Schulen, die von Sängern dominiert werden“, stellte ich fest. „Wann spricht man eigentlich von einer gharaana ? Es gibt doch viele Familien von Musikern, in denen dieser Beruf weitervererbt wird – eigentlich sind es wohl Kasten wie etwa die Mirasi.“ Aschfaq lehnte sich zurück, stützte sein Kinn mit der rechten Hand ab und bat seine Tochter, noch etwas Tee einzuschenken. „Es dauert mindestens sechs bis sieben Generationen, bevor einer Musikerfamilie der Ruf einer gharaana zugebilligt wird. Die Meister achten sehr darauf, dass ihr Blut rein bleibt, sie akzeptieren nur Mädchen als Ehefrauen ihrer Söhne, die aus einer anderen ruhmreichen Musikerfamilie stammen. Sie versuchen so die Fähigkeiten ihrer Familie noch zu erhöhen. Musiker, die in eine Schule hineingeboren werden, haben etwas Besonderes – einen eigenen Lebenssaft. Verstehst du, was ich sagen will?“ „Ein Talent, mit dem sie schon geboren werden, meinst du das?“, fragte ich. „Ja, für Außenseiter, die nicht zu diesen Kasten gehören, ist es ungleich schwieriger, sich einen Namen als Musiker zu machen. Von einem bekannten Sänger aus Lahore wird denn auch erzählt, dass er von einer Dienerin gestillt wurde, nachdem seine Mutter bei der Geburt verstarb. Durch ihre Milch GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 erbte er musikalisches Talent, denn sie gehörte zu einer zigeunerähnlichen Kaste, deren Frauen singen und sich dabei rhythmisch auf einen Metalltopf schlagend begleiten.“ Abschied Während unseres Gesprächs war die Abenddämmerung hereingebrochen. Nun läutete es an der Tür, die Hunde bellten. Der Diener führte Arif Sain herein, den Wanderderwisch. Vor einigen Jahren war er beim Fest des roten Sufi in Sehwan Scharif mein treuer Gastgeber gewesen. Immer noch so gekleidet, wie ich ihn seit jeher kannte: mit einer Flickenkappe auf dem Kopf, um den bloßen Oberkörper locker eine leichte braune Decke geschlungen, die vor der Kühle des Winters schützte, und mit einem gestreiften Hüfttuch nach Art bäuerlicher Pandschabis; von seiner Schulter hingen ein Stoffbeutel und sein Derwischblashorn, das aus dem Horn eines Büffels geschnitzt war. Sain-dschi wirkte angestrengter als sonst und müde, schwer zuckerkrank kam er, um sich von Dr. Aschfaq den Blutzuckerspiegel kontrollieren und eine InsulinSpritze geben zu lassen. 34 Er erzählte uns von seinen jüngsten Erlebnissen. Im vergangenen Winter, als er sich wie gewöhnlich an einem Heiligenschrein in Karatschi aufgehalten hatte, waren die Schmerzen an seinem großen Zeh immer unerträglicher geworden. Eine alte offene Wunde, die nicht verheilte; der Zeh war schwarz verfärbt und eiterte. Weit weg von seinem Lahorer Freund und Helfer, hatte Arif Sain keinen anderen Ausweg gewusst, als sich selbst zu operieren. Wer hätte schon einen armen Wanderderwisch im Krankenhaus aufgenommen? So betäubte er seine Schmerzen mit etwas Opium und schnitt sich den Zeh eigenhändig mit einer Schere ab … Ob ich am kommenden Donnerstagabend zum Schrein von Schah Dschamal käme, fragte Sain-dschi bei der Verabschiedung, die Trommler und Derwische würden dort dem SufiHeiligen huldigen. Dabei lächelte er und deutete auf sein Blashorn, mit dem er die Trancerhythmen begleiten würde. Ich sagte ihm mein Kommen zu. Viel zu lange schon war ich nicht mehr eingetaucht in das wilde Treiben der Trancetänzer am Schrein von Schah Dschamal! Ich freute mich auf eine magische Nacht inmitten der Fakire. Auszug aus: Jürgen Wasim Frembgen, Nachtmusik im Land der Sufis, © Waldgut Verlag 2010. Jürgen Wasim Frembgen, geb. 1955, ist Ethnologe und Islamwissenschaftler und leitet die Orient-Abteilung des Museums für Völkerkunde in München. Er hat zahlreiche Bücher über Pakistan publiziert. Copyright: Goethe-Institut e. V., Fikrun wa Fann November 2011 Mehr pakistanische Musik http://www.esnips.com/web/holisticsStuff de, en, ar, fa http://www.mediafire.com/?p07ax2woa7w3z de, en, ar, fa GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 35 Die Musik des Südsahararaums Die Musik der Tuareg ist ein sehr altes Phänomen, das unter den Vorzeichen der Globalisierung aber eine ganz neue Entwicklung genommen hat. Auch von westlichen Musikern und Weltmusik-Touristen ist sie inzwischen entdeckt worden. Von Peter Pannke Ein junger Musiker in Niafunké, Mali. Foto: Horst Friedrichs © Goethe-Institut Wenn man Timbuktu in Richtung Nordwesten verlässt, passiert man am Stadtrand, wo die Wüste beginnt, eine riesige Betonsäule. Steil ragen ihre Arme in den Himmel, in den Sockel sind verrostete, ausgebrannte Gerippe von Maschinengewehren eingegossen. Fiamme de la Paix heißt dieses Denkmal, das an die Flamme erinnern soll, die an dieser Stelle im März 1996 entzündet wurde, als die Tuareg mit dem Staat Mali einen fragilen Frieden schlossen und vor den Augen von Präsident Alpha Oumar Konaré und den versammelten Stammesführern dreitausend Gewehre verbrannten. „Die malische Armee hat ihre Waffen damals nicht mit ins Feuer geworfen“, murmelte der Tuareg-Fahrer, der mich zum Festival au Desert in der Oase Essakane mitnahm, zwischen den Zähnen hervor. Der Friedensschluss hatte einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Als in den Dürrekatastrophen der siebziger und achtziger Jahre der größte Teil ihrer Viehherden verdurstete, waren die Tuareg plötzlich mit der modernen Welt konfrontiert worden. Ihr über viele Jahrhunderte erprobter Lebensstil brach zusammen; Männer, die seit vielen Generationen ihre Herden gehütet hatten, waren zum ersten Mal gezwungen, nach Lohnarbeiten zu suchen. Zusammen mit ihren Kamelen und Ziegen verschwand die Lebensgrundlage der nomadischen Bevölkerung, die in den Touristenprospekten als „blaue Ritter der Wüste“ verklärt werden. Sie selbst bezeichnen sich weder als „blaue Ritter“ noch als Tuareg – das Wort ist ein arabisches Schimpfwort und bedeutet so viel wie „von Gott Verdammte“. Man schätzt, dass sich etwa eine Million Tuareg über ein riesiges Gebiet verteilen, das fünfmal so groß wie Deutschland ist und sich über Marokko, Mauretanien, Algerien, Libyen, Mali, Burkina Faso und Niger erstreckt. Als verbindendes Element dient den äußerst heterogenen Gruppen einzig ihre gemeinsame Sprache, das Tamashek, und so nennen sie sich Kel Tamashek, „Sprecher des Tamashek“, oder Imazighen, „freie Menschen“. Schon 1960, kurz nach der Unabhängigkeit des Vielvölkerstaats Mali, war es zu ersten Aufständen gekommen. Der malische Präsident Moussa Traoré, der 1968 die Macht übernommen hatte, wurde 1991 in einem Militärputsch gestürzt, der durch die Auseinandersetzungen mit den Tuareg ausgelöst wurde. Die internationalen Hilfsgelder, die die Not der GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Tuareg lindern sollten, waren in den Taschen korrupter Politiker versickert, und so hatten die Tuareg begonnen, Militärund Polizeiposten im Nordosten des Landes anzugreifen, um sich von einer Nation zu lösen, die sie zur Aufgabe ihres nomadischen Lebensstils zwingen wollte. Moussa Traoré reagierte hart, es kam zu einer Hinrichtungswelle. Als in Léré fünfzig führende Persönlichkeiten der Stadt standrechtlich erschossen wurden und die Armee im Bazar von Timbuktu die Geschäfte verwüstete, regte sich Widerstand. Die aus dem Untergrund heraus operierenden Oppositionsparteien verlangten nach Demokratie. Nach Unruhen, die mindestens zweitausend Tuareg das Leben kosteten, wurde Moussa Traoré entmachtet, vor Gericht gestellt und zusammen mit einigen seiner Minister und dem Generalstabschef zum Tode verurteilt. 1992 fanden Parlamentswahlen statt, seitdem existiert in Mali eine fragile Demokratie, der immer noch ATT vorsteht, Amadou Toumani Traoré, der General, der den vorherigen Staatschef gestürzt hatte. Poètes guerriers Zehntausende von Tuareg, vor allem junge Leute, wechselten über Grenzen, die sie nie anerkannt hatten, nach Algerien und Libyen. Ishumaren wurden sie genannt, nach dem französischen „chômeur“, „die Arbeitslosen“. Fern von ihren Familien vertrieben sich die Ishumaren die Zeit in den Flüchtlingslagern mit ihren traditionellen Gesängen. Oft erzählten sie von den legendären Kriegern der Vergangenheit, von Kaocen, Firhoun und Chokbo, die einst die von dem Kommandanten Bonnier geführte französische Kompanie an der Oase Takumbawt besiegten. Meist drehten sich die Auseinandersetzungen um die Kontrolle über Wasserresourcen und Brunnen. Die Tuareg, die von der fortschreitenden Versteppung der Sahel-Zone immer weiter nach Süden gedrängt wurden, trafen dort auf die Herden der Peul oder anderer Gruppen, die ihre angestammten Wasserrechte verteidigten. Von den arabischen Beni Hillal waren sie zwar islamisiert, aber nie unterworfen worden. Die Sharia – das Wort bezeichnet ursprünglich einen Pfad durch die Wüste – brauchten sie nicht, denn die Sterne zeigten ihnen den Weg. Sie seien göttlicher Herkunft, erzählen sie, ihr Stammvater sei aus der Verbindung eines Dschinn mit einer menschlichen Frau hervorgegangen. Die Araber, mit denen sie über Jahrhunderte hinweg immer wieder Krieg geführt hatten, misstrauten ihnen und warfen ihnen vor, sie hätten das Kamel des Propheten getötet. Ihre Leidenschaft für den Krieg und das Wasser drückten die Tuareg seit je in visionären Versen und Legenden von großer poetischer Kraft aus. Den Franzosen Charles de Foucauld begeisterten diese so sehr, dass er sie übersetzte – ein Mann, dessen Schicksal so bemerkenswert ist, dass ich es kurz skizzieren möchte. Der Sprössling einer der reichsten Familien 36 Frankreichs wurde nach dem frühen Tod seiner frommen Eltern wegen Faulheit und asozialen Benehmens vom Jesuitengymnasium relegiert, sein Abitur legte er 1876 auf einer staatlichen Schule ab. Innerhalb weniger Jahre brachte er die 840 000 Goldfranken, die er von seinem Großvater geerbt hatte, mit Prostituierten und Fressgelagen durch. Auf der Militärschule Saint-Cyr erhielt er wegen Ungehorsams und Nachlässigkeit 45 Verweise. 1879 wurde das Husarenregiment, in das er anschließend eintrat, nach Algerien verlegt. Seine Geliebte Mimi, die er schon in Frankreich in die Kaserne eingeschmuggelt hatte, nahm er mit. Nachdem er wegen seines ausschweifenden Lebenswandels aus der Armee entlassen wurde, begab er sich auf Forschungsreise durch Nordafrika. Da Marokko für Christen verboten war, reiste Foucauld zusammen mit dem Rabbiner Mardochi Abi Serur, der eine ähnlich bewegte Vergangenheit hatte, in der Verkleidung eines russischen Rabbi namens Joseph Aleman ein. Nur mit Sextant und Kompass ausgerüstet kartografierte er das AtlasGebirge, das bis dahin ein weißer Fleck auf europäischen Landkarten gewesen war. Nach seiner Rückkehr nach Paris schrieb er seine Erlebnisse in dem zweibändigen Werk Reconnaissance du Maroc nieder, veröffentlichte das zweitausend Seiten umfassende Dictionnaire touareg-francais und zwei Anthologien von Liedern und Legenden der Tuareg, die achthundert Seiten stark waren. Er wurde berühmt, die Geologische Gesellschaft verlieh ihm eine Goldmedaille. Der Anblick tiefgläubiger Muslime, die sich fünfmal am Tag zur Erde beugten, hatte in Foucauld den Glauben an Gott wieder erweckt, den er mit fünfzehn Jahren verloren hatte. Als er in den Trappistenorden eintrat, machte seine Familie die Entmündigung, die sie 1882 gerichtlich durchgesetzt hatte, wieder rückgängig, doch Foucauld widmete sich dem religiösen Leben mit der gleichen Inbrunst, mit der er früher gesündigt hatte. Nach kurzem Aufenthalt in den syrischen und algerischen Klöstern des Ordens trat er wieder aus, weil ihm das Klosterleben nicht streng genug erschien. Briefe, in denen er den Vatikan um die Genehmigung ersuchte, einen Mönchsorden ohne Klöster zu gründen, blieben unbeantwortet. Nachdem er einige Zeit unter ärmlichsten Verhältnissen als Hausknecht im Ordenshaus der Klarisser in Nazareth verbrachte, errichtete er sich auf einem Gipfel des Ahaggar-Gebirges, etwa siebzig Kilometer außerhalb von Tamanrasset, in 2.700 Metern Höhe eine Einsiedelei. Der Tuaregführer Moussa Ag Amestan war einer seiner engsten Freunde. Französische Soldaten pilgerten zu ihm ebenso wie Tuareg, in deren Streitigkeiten er zu vermitteln versuchte. Am 1. Dezember 1916 wurde seine Klause von aufständischen Senussi besetzt, die vermuteten, er gebe Informationen an die französische Armee weiter. Als eine Gruppe von Soldaten erschien, die sie GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 irrtümlich für Méharistan hielten, arabische Soldaten in französischen Diensten, wurde er im Handgemenge erschossen. Am 26. April 1929 wurde sein Leichnam, der in einem Graben neben seiner Hütte verscharrt worden war, in einem Grab in der Oase El Golea beigesetzt, das einem islamischen Schrein gleicht. Siebzehn Jahre nach seinem Tod entstand in Algerien eine Gemeinschaft, die sich an seinen Ideen orientierte. 1936 gründete die Französin Magdaleine Hutin nach seinem Vorbild in der Sahara den Orden der Kleinen Schwestern Jesu. Am 13. November 2005 wurde der Mann, der auf allen klösterlichen Komfort verzichtet hatte und als „lebendige Hostie“ unter den Menschen lebte, die er nicht durch Predigten, sondern durch sein vorbildliches Leben von seinem Glauben überzeugen wollte, von Papst Benedikt selig gesprochen. Außer einem Kleinkind und einer blinden alten Frau waren ihm nach eigenem Bekunden in der Sahara keine Bekehrungen gelungen, aber die Bewunderung, die er für die Tuareg empfand, lebte weiter. Sein Wörterbuch und seine Übersetzungen zählen heute zu den wertvollsten Arbeiten aus der Frühzeit der Afrikanistik. Es war nicht nur der Durst ihrer Körper, den die Tuareg besangen, sondern auch der Durst ihrer Seelen, der in der Unendlichkeit der Wüste erwachte und den sie in eleganten Metaphern feierten. Asouf, „Einsamkeit“, „Melancholie“, lautet das Codewort. Die Ishumaren führten ein neues Thema in den alten poetischen Kodex ein. Die Wüste drohte sich nun auch im Inneren auszubreiten und die Menschen auszuhöhlen. „Ich bin der Sohn der mütterlichen Erde“, schrieb Issa Rhossey, ein Tuareg-Dichter aus der Region Aïr, „ich bin das Kind ewigen Schmerzes. Ich bin nicht der Herr der Wüste, sondern der Sklave nackter Horizonte“ in seinem Gedicht „Pas de Nom“. Die Rolling Stones der Sahara Ibrahim Ag Alhabib wurde 1960 in einer Oase im Norden Malis geboren. Sein Vater, der seine Familie als Viehzüchter und Maurer ernährte, wurde beim ersten Tuareg-Aufstand 1963 von der Armee aus seinem Haus in Tessalit geholt und in der Kaserne von Kidal erschossen, weil er die Rebellen mit Nachschub versorgt hatte. Anschließend trieben die Soldaten die Kamele, Kühe, Schafe und Ziegen der Familie in dem Dorf Aguelhoc zusammen und metzelten sie nieder; eine einzige Kuh überlebte. Zusammen mit seiner Großmutter floh Ibrahim, der damals erst vier Jahre alt war und erst viel später erfuhr, was wirklich vorgegangen war, in die Region Adrar des Iforas im Nordosten Malis und von dort aus nach Algerien. Die Kuh verdurstete auf dem Weg. 37 Ibrahim war einer von Zehntausenden von jungen Tuareg, die aus der Stille der Oasen in den Lärm der Städte geschleudert wurden. Er ließ sich durch Algerien und Libyen treiben und verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsarbeiten. Einige Zeit lang machte er eine Tischlerlehre in Oran, mehrmals kam er in den Knast – die Akademie der Arbeitslosen, die hier entweder das Überleben lernten oder umkamen. 1979 begegnete Ibrahim in der Oase Tamanrasset im südlichen Algerien, die viele junge Tuareg anzog, zwei Maliern, die aus seiner Region stammten: Hassan Touhami und Inteyeden Ag Ableline. „L‘amitié autour d‘une cigarette“ – „Zigarettenfreundschaften“, nannten sie solche Begegnungen. Seit seiner Kindheit hatte sich Ibrahim aus Ölkanistern, einem Stock und Bowdenzügen von Fahrrädern Instrumente gebastelt, auf denen er traditionelle Lieder der Tuareg zupfte. Manchmal fügte er eigene Worte hinzu oder imitierte den Bluesstil, der im Norden Malis von Ali Farka Touré und Boubacar Traoré populär gemacht worden war. Der Klang des mit Fell bespannten, archaischen Zupfinstruments, das die Songhai Ngoni nannten und die Tuareg Teherdent, lag ihm im Blut. Sein Vagabundenleben machte ihn mit weiteren Musikstilen vertraut: In Oran hörte er algerischen Rai und den radikal neuen, großstädtischen Chaabi, den Gruppen wie Nass El Ghiwan in Nordafrika machten, Popstars wie Boney M., aber auch Jimi Hendrix und John Lee Hooker, in dessen beschwörenden Rezitationen er seine eigene Hoffnungslosigkeit und die Klage über den totalen Zusammenbruch seiner Welt gespiegelt sah. In Tamanrasset erblickte er zum ersten Mal eine akustische Gitarre; er überredete den Besitzer, sie ihm zu vermachen. Das Konzept einer Band war den Ishumaren nicht geläufig – wer immer sich an einem ihrer Lagerfeuer niederließ, stimmte in die Lieder ein, wie es sich gerade ergab, die Frauen trommelten dazu und stießen die spitzen, trillernden Rufe aus, die von Musikethnologen als Ululieren bezeichnet werden. Taghreft Tinariwen nannte Ibrahim die Gruppe, die er zusammen mit Hassan und Inteyeden formte. Das Wort Taghreft bezeichnet eine Gang, eine Baumannschaft, Tinariwen ist der Plural von Ténéré, was so viel bedeutet wie Wüste oder „leerer Ort“. Sie spielten auf Hochzeiten, bei Partys, an Lagerfeuern, wurden schließlich sogar zu einem Festival in Algier eingeladen. Das Equipment lieh ihnen eine in Tamanrasset ansässige Combo namens Sawt El Hoggar, und zum ersten Mal krümmte Ibrahim seine Finger um den Hals einer elektrischen Gitarre. Die sei schließlich der einzige positive Effekt der Globalisierung, merkte der Sohn des großen algerischen Dichters Kateb Yassin an, der von seinem Vater den Vornamen Amazigh GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 bekam. Mit seiner Band Gnawa Diffusion machte er seinen Tamashek-Namen berühmt. Musikalisch ging die Band, die zwischen dem französischen Exil, in dem Amazigh Kateb aufwuchs, und Algerien pendelte, weiter. In frechen Texten und treibenden Rhythmen fusionierte sie Gnawa – die Trancemusik der schwarzen Sklaven, die arabische Händler in Jutesäcken aus Guinea und anderen Ländern südlich der Sahara nach Marokko gebracht hatten – mit Rock und Chaabi. „Bush est Mort“ lautet Amazighs aktueller Glückwunsch zur Abwahl des Präsidenten, den man in dem Youtube -Clip mit gezogenem Schwert Arm in Arm mit dem saudischen König tanzen und Angela Merkel stilles Wasser einschenken sehen kann. Als Tinariwen die Geschichte ihrer Entstehung beim Festival au désert in der Nähe von Kidal zum ersten Mal einem westlichen Journalisten erzählten, kam es zu heftigen Diskussionen – die Gruppe hatte Schwierigkeiten, ihre Erinnerungen unter einen Hut zu bringen. Mittlerweile gehörten ihr außer Ibrahim, Hassan Touhami und Inteyeden Ag Ableline auch Kheddou Ag Hossad an, Mohammad, der wegen seines an einen Samurai aus einem Film von Kurosawa gemahnenden Aussehens „Japonais“ genannt wurde, Abdallah „Catastrophe“, die Trommlerin und Sängerin Mina und ihre Kollegin Wounou sowie einige weitere Crew-Mitglieder. Hassan stellte sich als der „Löwe der Wüste“ vor, Ibrahims Spitzname „Abaraybone“, so erfuhr der Journalist, bedeutet so viel wie „raggamuffin kid“ oder „the scruffy tearaway who‘s always playing in the dirt“. Einer der Schauplätze ihrer Geschichten waren die libyschen Trainingslager, in die Muammar Ghaddafi junge Tuareg eingeladen hatte, um sie für seine revolutionären Pläne in Afrika auszubilden. Sie folgten dem Versprechen, dass er sie bei ihrem Kampf für ein autonomes Land der Tuareg in der Sahara unterstützen würde, aber als sich herausstellte, dass er hinter ihrem Rücken mit der Regierung von Niger über ihre Rückführung verhandelte, kehrten sie zurück in die Wüste. Iyad Ag Ghali, der Kopf des MPA, des Mouvement Popoulaire de l’Awazad, das für die Emanzipation der nördlichen Gebiete Malis kämpfte, erkannte in den Songs von Tinariwen, die von Hoffnung, Schmerz und Sehnsucht nach einem eigenen Land erfüllt waren, eine Möglichkeit, die Kel Tamashek zu erreichen, die weder über eine Rundfunkstation noch über Zeitungen verfügten. Er stellte einen Übungsraum zur Verfügung und finanzierte der Band ihre Gitarren. Die Kassetten, die sie aufnahmen, rotierten bald auf den Ghetto-Blastern der Sahara. Einige Mitglieder von Tinariwen gehörten zu der Gruppe, die am 30. Juni 1990 den Militärposten von Menaka in der Nähe der Grenze zu Niger überfiel und damit den zweiten Aufstand der Tuareg auslöste. Dass sie mit der Kalashnikov in 38 der einen und der E-Gitarre in der anderen Hand kämpften, wurde bald zur Legende. Die europäischen Pressetexte für „The Radio Tisdas Sessions“, ihre erste CD, die sie nach dem Friedensschluss in ihrer Heimatstadt Kidal aufnahmen, konzentrierten sich auf diese kriegerische Legende – für Tinariwen aber stand nicht der Aufstand, den sie mit traumatischen Erinnerungen verbanden, im Mittelpunkt, sondern die Reflexion über ihr Leben, das zwischen archaischem Erbe und desolater Moderne pendelte. Traditionelle Nomadentreffen, auf denen getanzt und gesungen wurde, Temakannit genannt, hatten – vor allem in der Regenzeit – in der Sahara stattgefunden, solange die Bewohner zurückdenken konnten, aber die Idee, diese Zusammenkünfte auch für Nicht-Tuaregs zu öffnen und Musikerinnen und Musiker aus dem merklich unterschiedlichen Süden des Landes dazu einzuladen, war neu. Die Inspiration, dass sich das zu einem regelrechten Weltmusikfestival auswachsen könnte, stammte von der in Angers im idyllischen Tal der Loire beheimateten Musiker- und Theaterkommune Lo’Jo, musikalischen Globetrottern, die Tinariwen 1999 in der Hauptstadt Bamako trafen. Sie luden sie zu einer kurzen Tour nach Frankreich ein, anschließend taten sie sich mit der Tuaregorganisation EFES zusammen, die auf die bedrohte Lebenssituation ihres Volkes aufmerksam machen wollte. 2001 fand das erste Festival au désert in der Region von Kidal statt. Der Präsident von Mali erschien an der Spitze eines Konvois von vierundzwanzig schneeweißen Landrovern, um dem Festival seinen Segen zu geben. Gerade einmal dreißig Westler waren anwesend, aber die waren begeistert von den wilden Männern mit Turban und E-Gitarre, die den Sandhügel erklommen, der als improvisiertes Podium diente. Doch in die Ausläufer des nahe gelegenen Adrar des Iforas-Gebirges, die immer noch bewaffneten Rebellen Schutz boten, traute sich selbst das Militär kaum, und so wurde das nächste Event auf die weißen Dünen von Essakane verlegt, weil man dort eher westliche Weltmusiktouristen anlocken konnte. Tinariwen waren auch hier die Stars, schnell machte die Kunde von den „Rolling Stones der Sahara“ in Musikerkreisen die Runde. 2003 gesellte sich Robert Plant, der Sänger der Rocklegende Led Zeppelin, zu Tinariwen auf die Bühne. „Als ob man einem Tropfen lauscht, der in einen tiefen Brunnen fällt“, umschrieb er das Gefühl, das ihre Musik in ihm auslöste. Die CD mit dem Mitschnitt des Festival au désert gelangte in die World Music Charts und katapultierte Tinariwen zu internationalem Ruhm. „Ammassakoul“, ihr nächstes Album, nahmen sie im Studio Bogolan in der Hauptstadt Bamako auf. „Aman Iman” – „Wasser des Lebens“ – hieß das dritte. Achtzigtausend CDs haben Tinariwen bisher verkauft. Seitdem ist die Gruppe durch die meisten großen Städte Europas und die USA getourt. Keddhou ist nach Algerien gegangen, Enteyeden starb an Lun- GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 genkrebs, der exzentrische Dichter „Japonais“ geht seine eigenen Wege. Ibrahim, immer noch spindeldürr und mit wilden Afro-Locken, hat neue Mitstreiter gefunden. Tinariwen ist keine Band, sondern ein Klan, eine Familie. Den Tribut, den sie für ihre internationale Vermarktung zahlen muss, kann man im Internet verfolgen. „Die romantischen Rocker aus der Wüste betören immer wieder, auch wenn sie diesmal etwas sehr produziert daherkommen“, wurde ihre letzte CD kritisiert. Aber Carlos Santana holte sie 2007 zum Jazz-Festival von Montreux und versicherte ihnen, sie säßen an der Quelle, aus der Muddy Waters, Jeff Beck und Buddy Guy getrunken hätten. Desert Blues Im Januar 2004 zog „das entlegenste Festival der Welt“ – so lautete die Schlagzeile – schon einige Hundert westliche Besucher an. Wir beeilten uns, die knapp siebzig Kilometer nach Essakane möglichst schnell hinter uns zu bringen, um rechtzeitig zur Eröffnung zur Stelle zu sein. Das stellte sich als unnötig heraus – erst in den Abendstunden fanden sich die Zuhörer nach und nach vor der auf einer Düne errichteten Bühne ein, und auch dann dauerte es noch Stunden, bis – herbeigeeilt „auf nackten Fußsohlen über den heißen Wüstensand”, wie der Conferencier versicherte – der malische Kulturminister eintrudelte, der Filmemacher Cheikh Oumar Sissoko, um das Festival zu eröffnen. Der Wind hatte die Dünen während der Aufbauphase verschoben, so dass der abgesperrte VIP-Bereich vor der Bühne, in dem wieder Platz für neue Würdenträger gemacht werden musste, immer mehr zusammenschrumpfte, bis die übrigen Zuschauer gezwungen waren, auf der nächsten, hundert Meter entfernten Düne Platz zu nehmen und das Geschehen auf der Bühne nur über die Köpfe der Kamera-Crew der BBC hinweg zu erspähen. Die Zeit bis zur Ankunft des Ministers wurde mit einem Sketch überbrückt, der vor Aids warnte, und es blieb auch noch genug Zeit, Miss Mali im trägerlosen roten Abendkleid auf die Bühne zu bitten. Der Tag war heiß, die Januarnacht kalt. Der Weg war anstrengend gewesen, selbstverständlich gab es keine Duschen. Wasser war knapp, die Toilettenhäuschen, die eine ausländische Hilfsorganisation errichtet hatte, waren innerhalb weniger Stunden unbrauchbar. Mühsam stolperten die Besucher durch den Sand, um eine geschützte Stelle hinter einer Düne zu finden, an der sie ihre Notdurft verrichten konnten. Vor allem machte einem der Staub zu schaffen, so fein, dass er durch die kleinsten Ritzen drang – ein kleiner Einblick in die Härte des Nomadenlebens. Schnell stellte sich heraus, dass der Tagoulmoust, der Schleier, mit dem die Tuareg ihr Gesicht verhüllen, kein dekoratives Schmuckstück ist, sondern zur 39 Überlebensausrüstung gehört, wenn man sich durch die Wüste bewegen möchte. Tamnana hieß die Tuareggruppe aus Faguibine in der Nähe von Timbuktu, die das Festival eröffnete. Aus Timbuktu stammte auch Haira Arby, die „Taube des Nordens“, die – begleitet vom Regionalorchester auf elektrischen Gitarren, Trommeln und Kalebassen – in Tamashek, Arabisch und Peul sang. Als Statussymbol hatte sie ihre roten Stöckelschuhe mitgebracht, die zum Gehen im Wüstensand denkbar ungeeignet waren. Kein Problem – ein kleiner schwarzer Page trug sie ihr auf dem sandigen Weg zur Bühne nach, wie einer Königin aus Tausendundeiner Nacht. „Un grand coucou!“, forderten die beiden Conferenciérs in flatternden Boubous, bitte noch einmal einen großen Applaus! Blackfire, ein Familienensemble der Navajo aus Arizona, hatte keine Mühe gescheut, um seine Brüder in der afrikanischen Wüste zu besuchen; die ausländischen Gruppen reisten auf eigene Kosten an. Großvater Benally führte einen traditionellen Tanz vor. „Merci dafür, dass wir die tiefe Spiritualität Arizonas entdecken durften!”, rief der Moderator dem Familienvater nach. Die Verbrüderung der jungen Generation der Navajos und der Tuaregs erfolgte am nächsten Tag, als sich das Familienensemble in eine Punkband verwandelte. Schwester Jeleda am Bass, Bruder Klee als Leadsänger und Bruder Clayson am Schlagzeug stimmten Woody Guthries Hymne „Mean Things Happenin’ In This World“ an – sie schafften es, als einzige Band des Festivals, dass die malischen Würdenträger in den vorderen Rängen von tanzenden Jugendlichen überrollt wurden. Ihre eigenen Exoten hatten die Tuareg mit den Wodaabe eingeladen – einer Gruppe sorgfältig herausgeputzter, fantasievoll geschminkter feingliedriger Männer in zierlichen Röckchen, die aus dem Nachbarstaat Niger angereist waren. Sie klatschten in die Hände, trippelten auf der Stelle und schwenkten ihre Arme mit eigenartig wippenden Bewegungen, die den Anschein machten, als wollten sie sich, Vögeln gleich, in die Luft erheben. Die Straußenfedern auf ihren Köpfen zitterten im Wüstenwind, aber von den „Weißnasen“ im Publikum ahnte kaum jemand, dass sie nicht nur aus folkloristischen Gründen zum Festival au désert eingeladen wurden. Während die Tuareg rund eine Millionen Menschen zählen, stellen die Wodaabe im Nachbarstaat Niger eine winzige Minderheit von gerade einmal 100 000 Menschen dar, die nur zwei Prozent der Bevölkerung ausmacht. Im Gegensatz zu den kampflustigen Tuareg sind sie äußerst friedliebend, ernähren sich von Milch und Pflanzenkost und entziehen sich dem Militärdienst ebenso wie der Islamisierung. Ihr Leben kreist um ihre Zebu-Rinder. Sie zu schlachten oder zu ver- GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 kaufen ist ihnen ein Gräuel, aber in den Dürreperioden der letzten Jahre gerieten auch sie in Bedrängnis. Von sesshaften Haussa-Bauern wurden sie immer mehr in die Sahara abgedrängt, wo sie auf die Kamelnomaden der Tuareg stießen, die Gebühren für die Nutzung ihrer Brunnen verlangten. Die Situation verschlimmerte sich, als sie zwischen die Fronten der Tuareg und der Regierungssoldaten von Mali und Niger gerieten, die sich quer über die Grenzen hinweg bekämpften. Zwar wurde auch in Niger 1995 ein Friedensabkommen getroffen, aber die Umsetzung lässt auf sich warten. Niger, so sagt die Gesellschaft für Bedrohte Völker, ist ein von Korruption und Militärherrschaft gezeichneter Staat. Frankreich und die USA zahlen für die Uranvorkommen und das Erdöl im Norden des Landes, aber die dort lebenden Nomaden sind schutzlos marodierenden Soldaten und Banditen ausgeliefert, die sie fast täglich ihres Viehs berauben und ihre Frauen vergewaltigen. Auch von den Hilfsorganisationen der Sahel-Zone werden sie benachteiligt: Nahrungsmittel zur Überbrückung der Trockenzeit werden ausschließlich an sesshafte Bauern verteilt, von den Wodaabe wird verlangt, dass sie ihre Rinderherden verkleinern und ebenfalls sesshaft werden. Genau wie die amerikanischen Indianer fordern die Woodabe von der UNO die Anerkennung ihrer Rechte als indigenes Volk. Ein wenig hatte es den Anschein, als ob den in meterlange Stoffbahnen gehüllten Tuareg das Erscheinen dieser prächtig herausgeputzten männlichen Schönheiten peinlich war; sie delegierten sie auf eine Nebenbühne, auf der die Verstärkeranlage nicht funktionierte. Munter unterhielt sich das Publikum, während auf der Hauptbühne schon der Auftritt der nächsten elektrischen Tuareg-Gitarrenband vorbereitet wurde. Die Wodaabe ließen sich nicht beirren; auch ihnen ging es darum, die Touristen auf sich aufmerksam zu machen. Es lohnte sich: In Essakane begegneten sie einigen Tuareg-Musikern, mit denen sie auf „Desert Crossroads“ – so der Name ihrer 2005 erschienenen CD – zusammentrafen. Inzwischen touren auch Etran Finatawa, die „Sterne der Tradition“, durch Europa. Mit Baba Djiré ließ sich die nächste Tuareggruppe auf der Hauptbühne nieder. Die Hymne der Lokalmatadoren auf die Oase von Essakane wurde begeistert beklatscht. Die Tuareg stellten den Löwenanteil an Bands: Auch Nabi, „Prophet“, stammt aus Timbuktu, „Fiamme de la Paix“ nannten sie ihre letzte CD nach dem Friedensdenkmal am Wüstenrand. Super Khoumaissa, die nächste Gruppe, tanzte den Takamba, den in Essakane allgegenwärtigen Rhythmus der Kamele. Die Bühne wurde bei ihrem Auftritt von einem ersten Stromausfall ins Dunkel getaucht. Mit Taschenlampen wurde im Wüstensand nach Kabeln geforscht, bis die Scheinwerfer wieder genauso hell strahlten wie die Gesichter der Fans. 40 Eigentlich waren es zwei Festivals, die in der Oase von Essakane parallel stattfanden: Das erste wurde von den Tuareg dominiert, die die Gelegenheit ergriffen, die angereisten Gäste mit ihrer Kultur bekannt zu machen, das zweite, weitaus kleinere, war dem pan-malischen Geist der Versöhnung der nördlichen und südlichen Landesteile und weltmusikalischen Zuläufern gewidmet. Wer nach den Koraklängen der Griots von Mali suchte, war fehl am Platz. Der angekündigte Salif Keita ließ sich nicht blicken, aber der Gitarrist und Sänger Amadou Bagayogo, der in den siebziger Jahren mit ihm zusammen in den legendären Ambassadeurs du Motel spielte, beherrschte die Gesetze des internationalen Showbusiness genauso gut wie er, unterstützt von Manu Chao und Cheikh Tidiane Seck, der zu den Veteranen der Super Rail Band, der zweiten legendären Band aus der Hauptstadt Bamako, zählt. Gemeinsam brachten sie die Oase von Essakane bis weit nach Mitternacht zum Tanzen. Das Jazz-Projekt Don Cherry’s Gift, das vom französischen Mopti -Quartett zusammen mit der Gangbe Brassband aus Benin entwickelt wurde, war ein weiteres erfreuliches musikalisches Erlebnis, das die Besucher im Januar 2004 in Essakane genießen konnten. Bei Ali Farka Tourés Konzert blieb nicht nur das Licht weg, sondern auch der Ton. Geduldig harrte das Publikum unter dem funkelnden Sternenhimmel aus, bis sich herausstellte, dass man schlicht vergessen hatte, den Kühler des Stromgenerators mit Wasser zu füllen. Bei der Pressekonferenz am nächsten Morgen wiederholte Ali Farka die Litanei, die er schon vielen westlichen Journalisten vorgetragen hatte: Seine Musik sei in erster Linie den Traditionen der Songhai und der Tuareg geschuldet, nicht dem nordamerikanischen Blues. Oumou Sangaré, der zweite internationale Superstar des Festivals, die die Wassoulou-Musik der Jäger des Südens in einen zeitgemäßen Sound kleidete und mit frauenkämpferischen Texten populär machte, tauchte am letzten Abend auf, beschränkte sich aber auf ein einziges Lied im Playbackverfahren, weil ihr Orchester zuhause geblieben war. Immerhin, Ali Farka Touré ließ es sich nicht nehmen, mit ihr gemeinsam auf der Bühne auf der Düne zu tanzen. Feststimmung kam auf, als Amadou & Mariam auf die Bühne kamen – das blinde Ehepaar, das sich in der Blindenschule von Bamako kennenlernte und seitdem gemeinsam auf den musikalischen Spuren von James Brown wandelt, hat in Mali viele begeisterte Fans. Im Ausland waren sie 2004 noch wenig bekannt, drei Jahre später holte sie Herbert Grönemeier nach Berlin, um gemeinsam mit ihnen die Fußballweltmeisterschaft zu eröffnen. Unter einem Zeltdach weitab vom Bühnengeschehen wurde über Ökotourismus und über die Situation der Tuareg disku- GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 tiert – eine der wenigen Gelegenheiten, sie einmal nicht als Musiker oder Andenkenverkäufer kennenzulernen. Die intellektuelle Elite der Tuareg schien hier versammelt zu sein, hochrangige Soziologen, Wirtschafts- und Erziehungswissenschaftler, die in akzentfreiem Französisch monierten, dass es Mali an einem Konzept zur Alphabetisierung ihres Volkes mangele. Die Regierung versuche, sie sesshaft zu machen, um ihre Kinder in Schulen schicken zu können, erzählten sie, aber es war undenkbar für sie, ihre nomadische Lebensweise aufzugeben – es würde das Ende ihrer Identität bedeuten. Aus unseren Schlafsäcken mussten wir in der Oase von Essakane erst einmal die Skorpione herausschütteln, bevor wir hineinschlüpfen konnten; am Morgen trieb der Wind den Staub durch die Zeltplanen, die als Lager dienten. Kurz vor Aufbruch wurde einer von uns von einem Skorpion erwischt. Wir brachten ihn zum Sanitätszelt, aber die malische Krankenschwester lachte nur. Ein Skorpionstich? So etwas gehörte hier zur Tagesordnung. Sie gab ihm eine Beruhigungsspritze. 41 Wurzeln und den Stamm. Ich weiß selber, was ich spiele, niemand braucht mir das zu erzählen”, antwortete Ali Farka den weißen Journalisten, die ihn darauf ansprachen. In der Tat gibt es Verwandtschaften zwischen den schleppenden Beats, die im Mississippi-Delta und am Lauf des Niger gespielt werden, doch Ali Farka transportierte mit seiner Musik etwas anderes: Keine Klageschreie über die Sklavenarbeit auf den Baumwollplantagen, kein Stöhnen über „Whisky and Women“ – Ali Farka Touré und sein Eleve Afel Bocoum, der ihn in Essakane begleitete, geben jungen Leuten Ratschläge fürs Leben und singen, im ruhigen Puls des Flusses, Hymnen auf ihr Land, ihren Fluss und ihre Stadt Niafunké, die Ali Farka Touré zu ihrem Bürgermeister wählte. Er war kein Underdog, sondern ein Grundbesitzer, der auf sein Land stolz war. Auch Afel Bocoum entspricht nicht der Vorstellung, die man sich von einem Bluessänger macht: Ein schmächtiger Mann mit einem feingeschnittenen Gesicht mit goldgerandeter Brille, der ein weißes Gewand über die Schulter geschlungen hatte und von seiner Sorge um die Zukunft der jungen Leute sprach. Er spiele lieber unter dem freien Himmel Malis als in der Enge westlicher Studios oder Konzertsäle, erzählte er. Das Mekka der Weltmusik Alle sind sie hier gewesen: Der amerikanische Gitarrist Ry Cooder, um seinen Freund Ali Farka Touré zu besuchen, mit dem zusammen er für Talking Timbuktu einen Grammy Award gewonnen hatte. Nick Gold, der in einem notdürftig errichteten Studio das Folgealbum Niafunké aufnahm, das den Namen dieser verschlafenen Kleinstadt, die sich kaum von benachbarten Orten am Ufer des Niger unterscheidet, auf die Weltmusik-Karte setzte. Andere folgten ihnen, Journalisten, Musiker, Weltmusik-Touristen, die den Geruch des Ortes schnuppern möchten, an dem das alles passiert ist. Auch Martin Scorsese suchte hier nach den Spuren des Blues. In seinem Dokumentarfilm Feel Like Going Home begrüßt Ali Farka Touré überschwänglich seinen aus Kalifornien eingeflogenen farbigen Kollegen Craig Harris. „Tausende von Menschen sind nach Niafunké gekommen, aber über keinen Besuch habe ich mich so gefreut wie über deinen“, sagt Touré zu Harris, als sie sich durch den Pulverdampf der Vorderlader gekämpft haben, die die Schützengilde der lokalen Jäger zur Begrüßung abfeuerten. Später sitzen sie zusammen unter einem Baum und tauschen Songs aus. „Du bist kein Amerikaner!“, erklärt Ali Farka seinem Gast. „Es gibt keine schwarzen Amerikaner, es gibt nur Afrikaner. Du bist hier zuhause, dies ist dein Land.“ Das „Mekka des Mali-Blues“ wird Niafunké in internationalen Musikzeitschriften genannt. Doch was verbirgt sich hinter diesem Titel? „Ihr kennt die Zweige, wir in Mali haben die Vielleicht war es nur Höflichkeit, die Ali Farka dazu brachte, die Frage nach dem Blues, die ihm auch auf der Pressekonferenz auf dem Festival von Essakane 2004 wieder gestellt wurde, noch einmal zu beantworten. Der Blues? Was sollte das sein? Er hielt es für einen schlechten Witz, wenn er gefragt wurde, ob er sein Gitarrenspiel bei John Lee Hooker gelernt habe. Gewiss, er hatte ihn 1968 zum ersten Mal gehört und war tief beeindruckt – aber nicht, weil er seinen Meister gefunden hatte, sondern weil ihm schien, dass der amerikanische Bluessänger etwas spielte, was eigentlich aus Afrika stammte, vom Ufer des Niger, an dem Touré aufwuchs. Ali Farka Touré kam aus dem wenige Kilometer entfernten Dorf Kanau. Sein Name weist ihn als Nachkommen von Mohamed Touré aus, dem Begründer der Dynastie der Askia, dessen Grab im Osten Malis, in Gao, bis heute verehrt wird. Für seine Eltern war es unvorstellbar, dass ihr Sohn Musiker werden wollte. Dass er als einziger von zehn Söhnen überlebt hatte, trug ihm den Spitznamen Farka ein, „Esel“, – so würden ihn die Geister nicht so schnell finden. „Ich bin zwar ein Esel, aber keiner kann sich auf meinen Rücken setzen“, wehrte Ali ab, wenn er darauf angesprochen wurde. Die Geister fanden ihn trotzdem. Tief unter seiner leuchtenden Oberfläche birgt der Niger Geheimnisse, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Krokodile und die geheimnisvollen Manatins, bis zu dreieinhalb Meter lange Seekühe, sind selten geworden, aber dem Flusspferd, dem Totemtier Malis, kann man in bestimmten Abschnitten immer noch begegnen. GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Doch nicht nur Tiere bevölkern die Tiefe, sondern auch Geister. Von Flussgeistern und riesigen Kapitänsfischen wird in Mali nur im Flüsterton erzählt, denn die Geister darf man nicht stören. Auch wenn der Niger meist behäbig dahinfließt, ist er alles andere als ungefährlich. Plötzliche Windböen können ein kleines Fischerboot schnell zum Kentern bringen, leicht kann man sich im Gestrüpp des Bourgou-Grases verirren, das die Ufer über weite Strecken hin kaum erkennbar macht, Flusspferde können ein Boot angreifen. In der Tiefe lauert der leicht erzürnbare Flussgott. Auch wenn der Islam, der seit vielen Jahrhunderten die Herrschaft über den Tag angetreten hat, die alten Riten ablehnt, regieren in der Nacht immer noch die Geister. Es sind Geschichten von Tod, Trance und Traum, die in den Nächten an den Ufern des Niger erzählt werden. Wenn sich die Grenzen zwischen den Welten verwischen und das Dya, das Doppel des Menschen, im Traum den Körper verlässt, begegnet es den Geistern der Ahnen. Ihre Namen werden nur selten genannt, denn in diesem magischen Universum verleiht ein Name Macht. Die Klänge, die Ali Farka am Ufer bei den Zeremonien für die Flussgeister hörte, zogen ihn magisch an. Mit zwölf Jahren bastelte er sich seine erste Njurkel, das einsaitige Zupfinstrument, das von den Songhai gespielt wird. „Meine Familie waren keine Griots, deshalb erhielt ich keinerlei Unterricht“, erklärte er. „Es war eine Gabe. Nicht jedem schenkt Gott die Fähigkeit, ein Instrument zu spielen. Musik ist etwas Spiritu 42 elles – die Kraft des Klangs kommt von den Geistern.“ Mit dreizehn begegnete er ihnen zum ersten Mal, als er, weit nach Mitternacht, die Njurkel spielte – in Gestalt dreier Mädchen, die ihn stundenlang an den Platz bannten, an dem er gerade stand. Am nächsten Tag traf er am Rand eines Feldes auf eine schwarz-weiß gefleckte Schlange, die sich um seinen Kopf wickelte. Wenig später begannen die Anfälle, die ihn in die Welt der Geister transportierten. „Kinder des Flusses“ werden am Niger die Menschen genannt, die von den Ghimbalas erwählt werden. Man betrachtet sie mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Scheu. Ali wurde zum magischen Berg von Hombori geschickt, der ihm Heilung bringen sollte. Niemand erfuhr jemals, was ihm dort widerfuhr, aber als er nach einem Jahr zurückkehrte, war er ein vollendeter Musiker. Schon seine Großmutter war eine Priesterin der Ghimbala gewesen. Ali wollte ihr folgen, aber die Leute hielten ihn davon ab. Seine Verbindung zu den Flussgeistern war eine Seite seines Lebens, über die er nur ungern sprach. „Wegen des Islam beschäftigen wir uns lieber nicht allzu sehr mit diesen Dingen... Die Geister können gut sein, aber auch böse, und deshalb beschränke ich mich darauf, über sie zu singen. Aber weil sie Teil unserer Kultur sind, kann man sie nicht einfach ignorieren.“ Lieber hörte er dem Niger zu. „Wenn ich auf den Rhythmus des Flusses lausche, spüre ich, dass mir die Wellen etwas erzählen“, sagte Ali Farka Touré. Peter Pannke ist freischaffender Autor, Journalist und Musiker. Er hat zahlreiche Bücher zur afrikanischen und orientalischen Musik publiziert, u. a. Troubadoure Allahs – Sufimusik im Industal. Copyright: Goethe-Institut e. V., Fikrun wa Fann November 2011 Die Musik von Peter Pannke http://www.youtube.com/watch?v=EBOEPg84bD8&feature=related de, en, ar, fa http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=RMT0eXr5KO0 de, en, ar, fa GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 43 Islam und europäische Kunstmusik Wo die Geschichte der musikalischen Durchdringung von Orient und Okzident ihren Anfang nimmt, lässt sich nicht genau bestimmen, aber eines ist sicher: Komponisten wie Mozart, Beethoven, Schubert und andere konnten sich der Faszination des Ostens nicht entziehen und so gelangten Elemente türkischer Musik, persischer Dichtung und arabischer Erzählungen direkt ins Herzstück der europäischen Kultur, in ihre Musik. Von Nadja Kayali Eine Szene aus der Mozart-Oper „Entführung aus dem Serail“, Staatsoper München. Foto: Wilfried Hösl © Goethe-Institut Gleich die erste große Oper ist eine Geschichte wie aus Tausendundeiner Nacht. Wir schreiben das Jahr 1670. Der osmanische Gesandte findet sich in Paris ein, das zu jener Zeit im Glanz der Regentschaft König Ludwigs XIV. erstrahlt. Stolz führt man den Osmanen umher. Der aber zeigt sich unbeeindruckt und meint, dass das Pferd seines Sultans mehr Juwelen trüge, als die Krone des französischen Herrschers. Oper gegen die Türken, dank der Türken Ludwig XIV. schäumt vor Wut. Wie sich rächen, fragt er sich und ersinnt einen Plan: Eingeweiht werden zwei Männer des Hofes, zwei Künstler. Der eine, Jean Baptiste Molière, der Dichter, der andere, Jean Baptiste Lully, der Komponist. Sie arbeiten gerade an ihrer neuen Oper „Le bourgeois gentilhomme“, als der König von ihnen verlangt, eine bitterböse komische Szene in ihr Werk einzubauen. Er will über die Türken recht ordentlich lachen. Um dies aber glaubwürdig tun zu können, brauchte man gute Kenntnisse der Sachlage. Da kam gerade gelegen, dass der französische Reisende Chevalier Laurent d´Arvieux von einem längeren Aufenthalt aus der Türkei nach Paris zurückgekehrt war. Besonders beeindruckt war er von Konya, wo er unter anderem an den Sufi-Zeremonien des Mewlewi-Ordens teilgenommen hat. Nun berichtet er Molière und Lully detailgenau und voller Begeisterung von den Dhikrs, von den sich drehenden Derwischen und ihren langen Gewändern, von den Rufen und Gebeten. Und wie er so erzählt, entzündet er die Fantasie von Molière und Lully. So entstand die „Cerémonie turque“, die erste Türkenszene in einer Oper. In die Handlung wird eine orientalische Verkleidungsszene eingebaut und mit der Liebesgeschichte von Lucille und Cléonte verknüpft. Die beiden wollen nämlich heiraten. Das allerdings missfällt Lucilles Vater, der lieber einen Adeligen als Schwiegersohn sehen würde. Cléonte denkt sich nun eine List aus und lässt sich als reisender osmanischer Prinz ankündigen, zieht mit großem Pomp ein und bittet um die Hand von Lucille, nicht ohne vorher Vater Jourdain zu adeln und ihn mit dem (natürlich erfundenen) Ehrentitel „Mammamutschi“ zu bedenken. GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Erstaunlichstes Merkmal der Türkenszene bei Molière und Lully sind die Elemente des Dhkirs, beispielsweise unzählige Wortwiederholungen, die zur Trance führen sollen. Gleich der erste Gesangseinsatz ist eine zehnmalige, einstimmige Wiederholung von „Allah“, a-capella. Es folgen stilisierte Dialoge des Mufti mit den Derwischen mit türkischen und arabischen (oder arabisch anmutenden) Worten wie „Hu“ oder „ey walla“. Gesungen wird aber auch in einer lingua franca, die im Mittelmeerraum als Verkehrssprache diente und Elemente verschiedenster Sprachen in sich birgt. So fragt der Mufti, ob der zu adelnde Franzose Jourdain ein guter Türke sei: „Star bon Turca Giourdina?” Und die Derwische antworten: „Hi valla“ (eyvalla). Und in einer Variante fragte der Mufti nach dem Glaubensbekenntnis von Jourdain, wobei von Lutheraner über Paganer (Heide) bis hin zu Bramine und Syrer alles aufgezählt wird, worauf die Derwische jeweils mit „jok“ (türkisch für nein) antworten. Schließlich stellt sich zur Zufriedenheit des Muftis heraus, dass Jourdain „Mahametana“, also Moslem, sei. Für die Aufführung dieser Opernszene hat man in Frankreich keine Kosten und Mühen gescheut und prachtvolle Kostüme, Turbane und Schuhe in aufwendigem orientalischen Stil herstellen lassen. Der König hat also seine Rache bekommen! 44 wir nur die drei berühmtesten, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven) darum, den „Lärm“ aus dem Schlachtfeld in den Konzertsaal zu verlegen. Dafür bediente man sich der Trommel, der Triangel, dem Becken – also Instrumenten, die eines gemeinsam haben: Sie werden nicht gestimmt, können also ihre Tonhöhe nicht verändern. Besonders die Trommel ist dafür ein gutes Beispiel, gibt es doch im Orchester mit der Pauke auch ein gestimmtes Pendant. Der Einsatz der Schlaginstrumente war verbunden mit einer Anhebung der Lautstärke des gesamten Orchesters, sodass gerade diese Lautstärkekontraste sich zu einem Merkmal des „alla-turca“-Stils entwickelten. Dass dieser Effekt für die zeitgenössischen Hörer zunächst höchst überraschend war, berichtet Leopold Mozart 1777 in einem Brief. So berichtet er seinem Sohn Wolfgang von einer Aufführung von Voltaires „Zayre oder die rasende Eifersucht eines Türken“, zu der Michael Haydn die Zwischenaktmusik geschrieben hatte: „Die Zwischenmusiken vom Haydn sind wirklich schön. Unter einem Akt war ein Arioso mit Variationen, Violonzell, Flauten, Oboen etc. und ungefähr, da eben eine piano Variation vorausging, trat eine Variation mit der Türkischen Musik ein, welche so jähe und unvermutet kam, dass alle Frauenzimmer erschraken und ein Gelächter entstand.“ Mozarts Türkenoper Arien à la Turca, orientalische Instrumente Sogenannte „Türkenszenen“ als Teil einer Oper gab es auch später immer wieder. So beispielsweise in der Oper „Lo Speziale“ („Der Apotheker“) von Joseph Haydn. Besonders charmant ist die kleine Arie „Salamelica“, in der es darum geht, dass in „Constantinopula“ immer gesungen und getanzt werde. Musikalisch ausgeschmückt wird die Arie im „alla turca“-Stil, der im 18. Jahrhundert – besonders in Wien – groß in Mode war. Spricht man von der sogenannten „türkischen Musik“ (wobei damit der „alla turca“-Stil in der klassischen europäischen Musik gemeint war), so ist auch immer von den Janitscharen die Rede. Gerade in Wien waren die Osmanen keine Unbekannten. Mit dem Nachbarstaat kam es des Öfteren zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Dabei wurden von türkischer Seite Janitscharenkapellen eingesetzt, die mit Trommeln, hohen Flöten und Schellenbäumen einen großen Lärm produzieren konnten und so enorm einschüchternd gewirkt haben müssen. Nach geschlagenen Schlachten haben die Österreicher dann so manches liegengebliebene Instrument aufgesammelt, untersucht und natürlich sofort verwertet. Der Einbezug dieser Instrumente ins klassische Orchester brachte eine Veränderung mit weitreichenden Konsequenzen. Denn tatsächlich ging es auch den Komponisten der klassischen Ära (nennen Wenig später schrieb Wolfgang Amadeus Mozart die bekannteste „Türkenoper“, „Die Entführung aus dem Serail“. Und auch dafür bediente er sich des Stilelements der Lautstärkekontraste der „türkischen Musik“, wie er 1781 heiter seinem Vater berichtet: „Von der Ouverture haben sie nichts als 14 Täckt. – die ist ganz kurz – wechselt immerzu mit forte und piano ab, wobei beim Forte allzeit die türkische Musik einfällt. Moduliert so durch die Töne fort. Und ich glaube, man wird dabei nicht schlafen können, und sollte man eine ganze Nacht nichts geschlafen haben.“ Die Wiener waren begeistert von dieser Mode. In einer Zeit, in der praktisch in jedem Wiener Haus ein Klavier zu finden war und Kompositionen wie Opern oder Sinfonien immer auch in einer Klavierfassung für den Hausgebrauch vorlagen, wollte man den „alla turca“-Stil natürlich auch übertragen. Das herausragende Beispiel stammt wiederum von Mozart, es ist der dritte Satz seiner Sonate KV 331. Dabei gelingt es ihm, den „Lärm“ der Schlaginstrumente auf dem Klavier nachzuahmen. Zu Mozarts Zeit, als die Wiener die Furcht vor den Türken künstlerisch sublimierten und Komponisten „alla turca“ komponierten, hat man sogar Klaviere mit einem sogenannten Janitscharenzug hergestellt. Das „türkische“ Schlagwerk war also sogar im Wiener Wohnzimmer zu finden. GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Denn zur damaligen Zeit standen Perkussionsinstrumente nicht immer zur Verfügung und so musste man kreativ sein, wenn man „Türkische Musik“ komponieren wollte. In seinem fünften Violinkonzert KV 219 lässt Mozart die Cellisten mit dem Bogen gegen die Seiten ihres Instrumentes schlagen (der musikalische Terminus dafür ist „col legno-Technik“), wodurch er das Geräusch einer Trommel nachahmt, die mit einem Besen geschlagen wird. 45 sche zu ziehen, und hat sogar im Keller Alkohol versteckt. Er lässt es sich gut gehen und gibt nur vor, in Armut zu leben. Das kann man als Anspielung auf die damals aktuelle Situation verstehen, als im Zuge der Josephinischen Klosterreformen die Orden einer Nützlichkeitsprüfung unterzogen wurden. Mittels islamischem Derwisch wurden die katholischen Mönche kritisiert. Derwische in der Oper Ein Umstand ist im Zusammenhang mit seiner Oper „Die Entführung aus dem Serail“ besonders bemerkenswert. Mozarts Singspiel wurde 1782 in Wien uraufgeführt. Sechs Jahre zuvor war Deutsch zur Einheitssprache des Habsburgerreiches erklärt worden und in diesem Zusammenhang wurde das Theater neben der Burg in „Deutsches Nationaltheater“ umbenannt. Ein Jahr später veranlasste Kaiser Joseph II. die Gründung eines Deutschen Nationalsingspiels. Oper sollte erstmals auf Deutsch aufgeführt werden, denn das Bestreben des Kaisers war es, das Theater einer breiteren Schicht der Bevölkerung zugänglich zu machen. So erging an Mozart der Auftrag für die Eröffnungspremiere. Und er vertonte einen türkischen Stoff. Das deutsche Nationalsingspiel wurde also mit einer Türkenoper eröffnet. Ob das heute auch möglich wäre? Mozart war übrigens keineswegs der erste, der von den orientalischen Sujets fasziniert war. Eine der wichtigsten Vorgängeropern zur „Entführung“ stammt aus der Feder von Christoph Willibald Gluck. Er hat – ebenfalls in Wien, allerdings am französischen Theater – zwei orientalisierende Opern herausgebracht: 1761 „Le cadi dupé“ („Der betrogene Kadi“) und drei Jahre später „La rencontre imprévue ou les pèlerins de la Mecque“ („Die unvermutete Zusammenkunft oder die Pilger von Mekka“). Darin ist Prinz Ali aus Balsora auf der Suche nach seiner Verlobten Rezia, die entführt wurde und sich nun im Harem des Sultans von Kairo befindet. Von dort gelingt den beiden die Flucht, und durch Bestechung eines Bettelmönches, des Calender, werden sie in eine Karawane von Mekkapilgern eingeschleust. Aber dieser Calender treibt ein doppeltes Spiel und verrät sie beim Sultan. Der jedoch begnadigt das Liebespaar. Wie auch später bei Mozarts „Entführung aus dem Serail“ begegnet uns hier das Motiv des gerechten muslimischen Herrschers, der Gnade walten lässt und somit ein Vorbild an Humanität und Gerechtigkeitsliebe darstellt. Eine Geisteshaltung, die der Freimaurer Mozart im vollen Bewusstsein (und verstanden als Huldigung an Kaiser Joseph II.) so dargestellt hat. Dem „guten“ Protagonisten muss aber in einem interessanten Stück auch ein „böser“ zur Seite gestellt werden, und das ist hier Calender. Er hat in seinem Wanderderwischleben noch keine besondere Frömmigkeit entwickelt. Er hält sich an keine Regeln, ist darauf aus, den Leuten das Geld aus der Ta- Interessant ist aber auch zu sehen, welche Kenntnisse man im 18. Jahrhundert über den Islam hatte. Christoph Willibald Gluck lässt seinen Derwisch nämlich ein Lied trällern, dessen Text „Castagno, castagna“ zwar keinen Sinn ergibt, von dem er aber kurioserweise sagt: „Es ist ein alter, geheimer Gesang von Mahomet, aus dem Koran.“ Im 18. Jahrhundert war es üblich, dasselbe Libretto mehrfach zu vertonen und so existiert auch eine Oper von Joseph Haydn mit dem gleichen Sujet. Während Glucks Libretto auf Französisch ist, entstand in Esterháza eine italienische Oper mit Rezitativen. Aber auch dort begegnen wir dem listigen Calender. Er ist gerade dabei, einem jungen Mann namens Osmin das Derwischleben schmackhaft zu machen. Osmin möchte in die Bruderschaft der Derwische aufgenommen werden. Er hat nämlich gesehen, dass das Singen des – ihm etwas seltsam erscheinenden – Liedes „Castagno, castagna“ dazu geführt hat, dass man reichlich Almosen erhält. Bevor er dieses Lied lernt, muss er aber noch „Illah, illaha“ nachsingen, das ist nichts anderes als eine ungenaue Wiedergabe von „La illaha il Allah“ – „Es gibt keinen Gott außer Gott“. Das ist der Beginn des islamischen Glaubensbekenntnisses, durch dessen Nachsprechen man Muslim wird. So lässt Haydn – bewusst oder unbewusst – seine Opernfigur konvertieren. Das Nachahmen der orientalischen Sprachen stellte eine Besonderheit der exotistischen Opern dar. Zum einen entwickelte sich der sogenannte „Plapperstil“. Beispielsweise wurden arabische Worte klanglich nachgeahmt. Eng in Verbindung damit stand das schnelle, beinahe atemlose Sprechen, das die Europäer mit Arabern assoziierten. Eine weitere Technik bestand darin, bekannte Wörter wie „Allah“, „Mohammed“ (meist als „Mahomet“) oder „Kaaba“ in den Text zu integrieren. In seiner Schauspielmusik „Die Ruinen von Athen“ lässt Ludwig van Beethoven den Chor der Derwische immer wieder „Kaaba“ rufen. Darüber hinaus ist aber der gesamte Text bemerkenswert, spielt er doch auf Mohammeds Himmelfahrt an: Du hast in deines Ärmels Falten Den Mond getragen, ihn gespalten. Kaaba! Mahomet! Du hast den strahlenden Borak bestiegen Zum siebenten Himmel aufzufliegen, Großer Prophet! Kaaba! GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Insgesamt muss man allerdings sagen, dass sich profundere Kenntnisse der Kultur und Sprache erst entwickeln mussten und eher Techniken der sprachlichen Orientalisierung genutzt wurden als richtige Wörter und Sätze. Dennoch soll nicht unerwähnt bleiben, dass bereits im Jahre 1754 von Kaiserin Maria Theresia in Wien die erste „k. & k. Orientalische Akademie“ gegründet wurde, in der man Arabisch, Persisch und Türkisch lernen konnte. Einer ihrer berühmtesten Absolventen war Joseph von Hammer-Purgstall. Durch seine Übersetzung des Divans des persischen Dichters Hafis wurde Johann Wolfgang von Goethe zu seinem „West-östlichen Divan“ inspiriert. Hafis und Goethes „West-östlicher Divan“ Als Goethe 1814 die Gedichte von Hafis liest, gerät er in einen Schaffensrausch und musste sich – wie er selbst sagte – dem persischen Dichter gegenüber „produktiv“ verhalten. Diese Produktion wurde aber auch durch eine Liebesgeschichte angefeuert. Denn Goethe verliebt sich in die österreichische Schauspielerin Marianne von Willemer und die beiden schreiben einander verschlüsselte Liebesbotschaften. Oftmals nur Zahlen, die auf bestimmte Verse der HammerPurgstallschen Ausgabe von Hafis’ Divan verweisen. Goethe beschäftigt sich intensiv mit allen vorhandenen Quellen und beginnt selbst einen Divan zu schreiben. Marianne antwortet. Im Kleid von Hatem und Suleika wird diese Liebe, die in der Realität keinen Platz gefunden hat, in der Literatur gelebt. Es hat nicht lange gedauert, bis die ersten Komponisten diese Gedichte vertont haben. So beispielsweise Franz Schubert, dem es gelang, den Inhalt dieser Lieder auf unvergleichliche Weise in Musik zu setzen. Er lässt den Liebenden in den Locken der Geliebten versinken („Versunken“ D 715), sendet mittels Ost- und Westwind Liebesgrüße („Suleika“ I und II D 720 und 717) oder besingt die Äuglein der Geliebten („Geheimes“ D 719). Die Reihe jener Komponisten, die sich angezogen fühlen vom Hauch des Orients, der diese Gedichte durchströmt, lässt sich problemlos fortsetzen bis in die heutige Zeit. So entstanden Suleika-Lieder von Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy und seiner Schwester Fanny Hensel, aber auch im 20. Jahrhundert von Anton Webern und Luigi Dallapiccola. Ganze Liederzyklen aus dem „West-östlichen Divan“ finden sich u. a. bei Hugo Wolf, Richard Strauss oder Gottfried von Einem. Nicht nur die Gedichte von Goethe, die durch Hafis inspiriert wurden, waren eine beliebte Quelle für Komponisten, auch Hafis’ eigene Verse erhielten ein musikalisches Gewand, so von Johannes Brahms, Otmar Schoeck oder Karol Szymanowski. Bei Brahms findet sich eine Besonderheit, die mit der Nachdichtung von Georg Friedrich Daumer zusammenhängt. Er 46 hat nämlich nicht nur den Inhalt übertragen, sondern auch die Form, das Ghasel, beibehalten. So heißt es: Wie bist du, meine Königin, Durch sanfte Güte wonnevoll! Du lächle nur, Lenzdüfte wehn Durch mein Gemüte, wonnevoll! Ghaselen sind gereimte Gedichte (hier: „Güte“, „Gemüte“), die außerdem noch einen weiteren Reim haben, einen Radif (hier: „wonnevoll“). Brahms hat dem auch in seiner Komposition Rechnung getragen, in dem er „wonnevoll“ durch ein kurzes instrumentales Intermezzo abgesetzt hat, durch Beibehaltung der Harmonie aber die Verbindung unterstrichen hat. Eine Besonderheit des persischen Dichters Hafis ist, dass bis heute aus seinem Divan Orakel gelesen wird. 2002 hat der österreichische Komponist Andreas Wykydal ein solches Fal-e Hafez, ein „Hafis-Orakel für Klavier (bzw. Flöte) und Sopran“ komponiert. Nun ist es nicht möglich, den gesamten Divan des Hafis zu vertonen, um dann daraus Orakel zu lesen, aber im Iran werden auf der Straße Kuverts mit einzelnen Versen verkauft – diese Idee hat Wykydal in Musik transformiert. Er hat ein Hafis-Gedicht so vertont, dass jeder Vers dem nächsten folgen könnte. Das Publikum zieht die Reihenfolge, und es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis alle 5040 Erscheinungsformen des Stückes erklungen sein werden. Das deutschsprachige Lied ist also durchströmt von Motiven persischer Dichtung, und manchmal sogar inspiriert von seiner Form. Joseph von Hammer-Purgstall und Friedrich Rückert, beide gleichermaßen Dichter (Nachdichter) wie Gelehrte, verdanken wir die Übersetzung besonderer Werke aus dem Arabischen, Persischen und Türkischen, die sich dann in der Musik wiederfinden. Ein Beispiel aus dem Arabischen wäre Rückerts Übertragung der Makamen des Hariri, die dann in vierhändigen Klavierstücken „Bilder aus Osten“ op. 66 von Robert Schumann Niederschlag fand. Aber das war eher die Ausnahme. Blickt man nämlich in andere Genres, so finden sich einige recht kuriose Dinge. 1831 begibt sich der französische Komponist Félicien David auf eine Reise in den Orient. Das Bemerkenswerte daran ist sein Gepäck, ein Klavier, und mit diesem durchquert er die Wüste. Später wird er davon inspiriert seine sinfonische Ode „Le désert“ komponieren, und der darin enthaltene „Gesang der Wüste“ ist gleichzeitig eine „Glorifikation Allahs“. Im Laufe seines Lebens schreibt David mehrere orientalisierende Stücke und wird damit zum Hauptvertreter des Exotismus. Unter anderem komponiert er eine Oper, „Lalla Roukh“. Die Vorlage dafür, das von dem irischen Dichter Thomas Moore stammende Buch, ist auch in Deutschland bekannt, wohin die Welle der Orientbegeisterung ebenfalls schwappt. GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Einer, den sie erfasst, ist Robert Schumann. Er lässt sich von jenem Roman zu einem weltlichen Oratorium anregen, „Das Paradies und die Peri“. Darin gibt es einen Chor der Huris, der Paradiesjungfrauen. Während sie laut Koran im Paradies auf die gläubigen Muslime warten, lässt Robert Schumann sie die Stufen zu Allahs Thron mit Blumen schmücken. Auch der Muezzin singt Eine besonders inspirierende Wirkung auf europäische Komponisten hatte von jeher der Muezzin inne. Da es im Islam kein Zölibat gibt und Geistliche heiraten dürfen, kann es auch vorkommen, dass man es mit einem verliebten Muezzin zu tun hat. So auch bei Karol Szymanowski in seinen „Liedern des verliebten Muezzin“. Der Gebetsrufer schwärmt darin zwar von seiner Geliebten, er wird aber dennoch von einer Sopranistin gesungen. Das Charakteristische des Gebetsrufs ist, dass die Muezzine der verschiedenen Moscheen niemals gleichzeitig, sondern versetzt einsetzen, wodurch in gewisser Weise auch ein un 47 glaublich chaotischer Eindruck entsteht, weil alle durcheinander singen. Man hört dennoch die Muezzine in unterschiedlicher Lautstärke, je nachdem wie weit die Moschee vom eigenen Standort entfernt ist. In der deutschen Oper „Der Barbier von Bagdad“ von Peter Cornelius gibt es eine Muezzinszene, die in dieser Hinsicht höchst erstaunlich ist. Drei Muezzine werden auf und hinter der Bühne postiert und rufen – tatsächlich versetzt einsetzend – „Allah ist groß“. Spannend ist allerdings, dass danach wieder Frauenstimmen einsetzen mit demselben Ruf. Das wäre im wirklichen Leben nicht möglich. Komponisten haben manchmal ganz seltsame Vermischungen vorgenommen. Während man musikalisch ausgiebig in orientalisierenden Melodien gebadet hat, hat es textlich einige Kuriositäten gegeben. Beispielsweise hat bereits erwähnter Félicien David einen besonders „höflichen“ Muezzin komponiert, den er von der Moschee aus das Volk grüßen lässt: „As-salam-u-aleikum“ tönt es vom Minarett, und er gibt sich auch gleich selbst Antwort auf seinen Gruß: „Wa-aleikum-ussalam.“ Nadja Kayali lebt als Komponistin und Musikjournalistin in Wien. 2010 wurde von ihr in Osnabrück die Oper Neda aufgeführt, die von dem mittelalterlichen persischen Dichter Nizami inspiriert ist, aber auch Bezug auf die iranische Protestbewegung nimmt. Copyright: Goethe-Institut e. V., Fikrun wa Fann November 2011 GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 48 Saudi-arabischer Rap In Jeddah, der Hauptstadt der Immigranten, hört man inmitten der saudi-arabischen Musikerstimmen vor allem eine heraus: die rebellische Stimme des jungen Rappers Klash. Von Ahmed Al-Wasel Klash. Foto: Klash „Die Kommission zur Ermittlung und strafrechtlichen Verfolgung klagt die berühmte Band Klash einer Reihe von Vergehen an. Sie schreibt und führt Lieder auf, deren Texte Schimpfwörter, Flüche und Beleidigungen beinhalten, die auf bestimmte soziale Schichten (Schwarze und urbanisierte Stadtbewohner) abzielen. Das Gericht hegt die Absicht, in zwei Wochen mit der Strafverfolgung zu beginnen …“ Einige saudi-arabische Leser bemerkten diese Nachricht in der lokalen Zeitung Ukaz, doch vielleicht nahm zu dieser Zeit noch niemand wahr, dass es sich bei diesem Aufruf zu einem feindseligen Prozess um den jungen Rapper Klash (Mohammed al-Ghambi, geboren 1986) handelte. Klash ist ein Gründungsmitglied der Rap-Band Boys of the West. Er wurde wegen seines beliebten dreiteiligen Rap-Songs „The Goal“ und wegen des Liedes „Dogs of Jeddah“ zur Zielscheibe. Hinzu kamen noch andere Songs, für die er sich verantworten sollte, die allerdings nicht von ihm geschrieben wurden. Von 2007 bis 2008 war er drei Monate lang inhaftiert. Dieser Vorfall zeigt, dass die Saudis zu Beginn des 21. Jahrhunderts feststellen mussten, dass ihre Kinder sie mitten in eine Konfrontation mit sich selbst und ihrer eigenen Gesellschaft befördert hatten. Eine Konfrontation, die in einem Kontrast zu der internationalen Meinung über Saudi-Arabien steht, die dieses Land nur als Nukleus und Produzenten von Terrorismus, ideologischem Extremismus, Jihad-Islam und der Feindseligkeit gegenüber Fremden par excellence betrachtet. Der Erfolg von Klash wetteiferte mit demjenigen Osama Bin Ladens, der inmitten der arabischen Revolutionen 2011 ermordet wurde. Der junge Rapper Klash wurde zu einem „gekrönten König“ im World Wide Web, und darüber hinaus entwickelte er sich zu einem der einflussreichsten und regelmäßig angeklickten jungen Leute auf Youtube im Jahre 2010. Er schaffte es, sich selbst in ein Symbol zu verwandeln. Sein Name inspirierte Webseiten und Foren, und Satellitenkanäle schickten ihm begierige Einladungen für die Teilnahme an Diskussionsveranstaltungen und Interviews. Seine Teilnahme wirkte sich positiv für die Kanäle aus und erhöhte die Anzahl der Fernsehzuschauer. Die Meerjungfrau und ihr Volk Die Stadt Jeddah erhielt ihren Spitznamen „Meerjungfrau“ (Huriyyah) durch ihre Lage am Roten Meer. Dieser Name lässt die kulturelle Bedeutung der Stadt erkennen, die es ihr ermöglichte, ein bestimmtes Image ihrer selbst in das kollektive Gedächtnis ihres Volkes einzuprägen. Jeddah kann auf keine lange Geschichte zurückgreifen, denn sie wurde aus einer ökonomischen Notwendigkeit heraus auf den Randgebieten älterer Städte gegründet. GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Jeddah ist eine Immigrantenstadt par excellence. Vielleicht sind alle großen Städte Immigrantenstädte und verwandeln sich dann später in Städte der Stabilität und des transformativen Wachstums. Dennoch ist Jeddah eher ein Hafen zwischen zwei heiligen Städten: Mekka und Medina. Die erste ist die Stadt Gottes, die zweite die Stadt des Propheten. Jeddah ist außerdem das zweite Gesicht für beide heiligen Städte. Sie ist die Stadt mit dem entweihten Gesicht. Diese Entweihung ist ein Spiegelbild von Verboten, Geheimhaltungen und Repressionen, die durch die Hintertür dieser beiden Städte nach Jeddah durchsickern, besonders aus Mekka. Anfangs war Jeddah eine Stadt der Entweihung, bevor sie schließlich zu einer Stadt der Immigranten wurde. Sie ist auch eine Stadt des Schocks und der Krise. So ist sie in der Lage, ihren Immigranten die Möglichkeit zu bieten, ihr Leben neu zu ordnen, indem sie diese Unordnung hinter sich lassen und auf eine „Wiedergeburt“ zustreben. Außerdem hilft sie ihnen dabei, ihre produktiven Fähigkeiten zu entwickeln. Jeder, der Jeddah kennt, oder vielleicht besser: der es sorgfältig beobachtet hat, – darunter Historiker und Reisende wie der Richter Najm al-Din al-Maliki (1388 gestorben), der Perser Nassir Khasru Qabadiani (1004-1088), der Schweizer JeanLouis Burckhardt (1784-1817) und gegenwärtige Wissenschaftler der Soziologie, Politikwissenschaft und Wirtschaft – betont, dass sie eine Stadt der Immigration und des Handels ist. Die Stadt ist zu einem globalen Menschenmagneten geworden – daher überrascht es nicht, dass Jeddah gegenwärtig die Hochburg ökonomischer und diplomatischer Aktivitäten in der Hedschas-Region ist. Eine der wohl wichtigsten ökonomischen Wandlungen, die neue Bewohner nach Jeddah zogen, war der Öl-Boom aus dem Jahre 1974, als sich in der Stadt wirtschaftliche Unternehmungen entwickelten und Forderungen nach einem neuen Lebensstil weitere Migrationen aus dem Inneren SaudiArabiens zur Folge hatten. Ebenfalls wurden vermehrt asiatische Arbeitskräfte (organisierte Migration) rekrutiert, um eine Reihe an Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbereich, u. a. in der Medizin, im Tourismus und im Bankwesen, zu besetzen. Dennoch waren auch die unkontrollierten oder willkürlichen Migrationen offenkundig, obwohl sie in der Mitte des 20. Jahrhunderts begannen, als Jeddah einen gewissen Wohlstand erreichte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Jeddah sich bereits in eine große Stadt mit abgelegenen Vororten verwandelt, die von Migrationswellen aus Asien (Indien, Pakistan und Indonesien) und Afrika (Äthiopien, Somalia und Nigeria) geschaffen worden waren. Diese ethnischen Gruppen bildeten untergeordnete Kulturen und verwandelten sich in isolierte Inseln, die sich nicht an die Mainstream-Gesellschaft Jeddahs anpassten. Öffentliche und private Institutionen waren ebenfalls nicht in der Lage, diese Gruppen zu integrieren oder ihnen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Dadurch wurden sie immer weiter in die verschiedenen Formen 49 der Armut und Ignoranz getrieben, die typisch für die subalterne Gesellschaft Jeddahs sind. Daher hat Jeddah heute verschiedene Gesichter: Ein asiatisch-indonesisches, ein asiatisch-türkisches, ein afrikanisches, ein arabisch-syrisches und ein arabisch-ägyptisches. Als Resultat daraus entwickelte sich eine Kultur, in der entweder alles als „völlig egal“ angesehen wurde, oder in der man so tat, als wüsste man nicht, was vor sich ging, oder in der das, was vor sich ging, keinerlei Aufmerksamkeit wert war. Diese Kultur ähnelt stark der Kultur der Apathie mit ihrer Konzeption der „Coolness“, die während der Sklavenzeit unter jungen schwarzen Männern in den Vereinigten Staaten gang und gäbe war. Diese Kultur der Apathie ist das Spiegelbild sozialer Unruhen. Sie ist ein negatives Verhalten, das ein mangelndes Pflichtgefühl gegenüber sozialen und rechtlichen Belangen hervorruft. Gleichzeitig verursacht sie die Intensivierung von Mechanismen zwanghafter Kontrolle, z. B. eine Verschärfung von Gesetzen und Methoden der Sozialisierung. Ebenso intensiviert diese Kultur die maskierten Formen von Kontrolle, z. B. Bräuche und Traditionen, die die Nicht-Zugehörigkeit und Instabilität dieser Menschen widerspiegeln. Es gibt vielfache Arten der Entfremdung in der Kultur Saudi-Arabiens. Diese Entfremdungen sind untergeordnete Seinszustände, die auf die Wandlung von einer traditionellen, kooperativen Gesellschaft in eine vertragsgemäße globalisierte Gesellschaft zurückzuführen sind. Die erste Art und Weise der Entfremdung wurde von Talal Maddah (1942–2000) in dem Lied „Strangers“ (1975) ausgedrückt. Interessanterweise stammt der Songschreiber aus Jeddah. Er ist der Dichter Muhammad al-Abdullah al-Faisal, der außerdem ein Prinz ist. Der Komponist der Musik zu diesem Song ist Sarraj Umar, der jemenitisch-hadramitischer Abstammung ist, und der Sänger selbst ist ägyptisch-hadramitischer Herkunft. Erst nach langen Phasen ernsthafter Versuche, eine Identität aufzubauen, die mit der unvertrauten Realität vereinbar ist, schaffte es diese Generation im Laufe des letzten Drittels des 20. Jahrhunderts ihre Talente zu festigen und gemeinsam ihre Werke zu produzieren. Diese kollektive künstlerische Identität strebte danach, ihr Umfeld mittels verschiedener Kunstformen zu begreifen, die sie entwickelte, um „eine Art der Kommunikation und des Dialogs zwischen einander“ auszudrücken. Das oben Genannte offenbart das kämpferische Gesicht dieser Stadt. Sie präsentiert ein Schlachtfeld, das gleichzeitig Lernmethoden der Verteidigung und des Angriffs erforderlich macht, am besten unter Zuhilfenahme von Witzen, Aphorismen, Wortspielen, Ironie und Insider-Sarkasmus. Die verschiedenen Formen dieser Künste hintergehen einander. Während es beispielsweise die dominante Kultur schafft, GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 dem Rap ihre Sprache, ihre Syntax und ihren poetischen Stil aufzuerlegen, haben der musikalische Stil, der Rhythmus und dessen Variationen nicht denselben kulturellen Ursprung wie die Texte. Multikulturelle Städte bieten die Möglichkeit, isolierte Identitätskomponenten zu bilden, aber ebenso schaffen sie eine neue Identität einer globalen Gesellschaft. Protest und Ablehnung Innerhalb der Kunst des literarischen Schreibens entstand eine Vielzahl von Genres, die über die literarische Herkunft der maqamas und die traditionelle Form des Gedichts mit seinen festen Themen wie Romantik, Lobpreisung und Klage hinausgehen und sich modernen Formen der Kurzgeschichte, des Romans und den freien Versen zuwenden. Es tauchten neue literarische Schulen auf, darunter die romantische, die symbolische, die realistische, die modernistische und die postmodernistische Schule. Gleichermaßen erhob sich die Kunst des Singens über ihre traditionellen Formen des mawwal und muwashshah, und wandte sich dem neuen Song mit seinen romantischen und dramatischen Prägungen zu. Dennoch hat der Pop-Song, der die Antithese des traditionellen, des modernen und des Volksliedes ist, eine kommerzielle Qualität erlangt, die auf eine politische Kontrolle hindeutet. Daher beschränkte er sich schließlich auf einen einzigen repetitiven Stil, der nur wertlose und einfache Ideen beinhaltete, und entfremdete sich vom Erbe der traditionellen Kultur. Außerdem hat der Pop-Song den Geschmack der Alten untergraben und den Geschmack der Kinder und Jugendlichen deformiert. Er entkräftete die soziale Struktur der Menschen, so dass sie es nicht mehr schaffen, erfolgreich miteinander zu interagieren. Die Menschen werden zunehmend isoliert, finden nur noch auf der Ebene totalitärer offizieller Ideologie, politisierten Mainstream-Medien und Quacksalber-Intellektualität zueinander. Die Kunst der arabischen Rap-Musik tauchte zuerst als marginale, alternative Kunst auf, die einen Bruch mit der Vergangenheit durchmachte. Einige Rap-Künstler verfolgen die Ursprünge des Rap bis zur Kunst der arabischen Poesie und zur so genannten antithetischen Poesie (18. Jahrhundert) zurück, die sich auf die Mittel der Spottreden, der Beleidigung und Erniedrigung des Feindes stützt, indem sie seine Schwächen und Fehler offenlegt. Gleichzeitig wird der Stolz auf die noble Herkunft, auf heroische Taten und tugendhafte Verhaltensweisen, wie Gastfreundschaft gegenüber Fremden und das Beschützen der Schwachen, ausgedrückt. Der antithetischen Poesie im klassischen Arabisch könnte man die Qilta-Poesie in der Umgangssprache hinzufügen. Sie ist ein Produkt der Volkskultur und ihre Ursprünge reichen mindestens zurück bis ins 16. Jahrhundert. Sie ist mit der umgangssprachlichen Nabati-Poesie verwandt, denn sie bildete einen der poetisch-musikalischen Stile, die gemeinsam von zwei Dichtern in musikalischer Begleitung aufgeführt 50 wurden. Sie besteht aus einem Rhythmus und einer simplen Tanzform (Füßestampfen und Händeklatschen). Diese beiden Ansichtsweisen stellen eine Perspektive dar, die die Rolle von Rhythmus und Musik auf die zeitgenössischen Formen der Kommunikation mit der Welt durch ein gemeinsames Kunstmedium reduziert, wie sie bereits von den Afrikanern praktiziert wurde. Diese Afrikaner waren keine authentischen Afrikaner, als sie in den Vereinigten Staaten mit verschiedenen Künstlern unterschiedlicher Herkunft zusammenkamen und diese Kunst heraufbeschworen. Der bekannteste von denen, die Rap in eine Form des Singens verwandeln wollten, war der Jamaikaner Kool Herc (1955 geboren). Die Entwicklung des Rap verlief zweifach: Einerseits entstand eine Richtung afrikanischer Volksdichter, die soziale und politische Belange thematisierten, beispielsweise die Diskriminierung gegenüber Schwarzen, die Schwangerschaft Minderjähriger und die Brutalität der Polizei. Andererseits entstand eine Gruppe von Rappern, die die Verbrecherszene und das Leben von Gangstern thematisierten. Das Bemerkenswerteste am Rap, egal ob er afro-amerikanisch oder arabisch ist, ist die Tatsache, dass er sich sowohl mit menschlichen Themen beschäftigt, die das Leben ausgegrenzter Menschen betreffen, als auch mit Themen wie Verbrechen, Gewalt, Diskriminierung und Rassismus. Dennoch sollte man den Rap – so wie man es zuvor mit dem Jazz und Blues getan hat – als eine Form der Kunst verstehen, die aufgrund des Zusammenspiels verschiedener Faktoren entstanden ist. Einer davon ist der afrikanische Faktor. Die Afrikaner, die nach Amerika immigrierten oder die gewaltsam dorthin transportiert wurden, waren einst Sklaven der Araber Andalusiens (711-1492) und vielleicht auch Sklaven der Stämme Bani Hilal und Bani Salim, die sich während der Fatimiden-Herrschaft (969-1171) in Nordafrika ausgebreitet haben. Sie gaben die Kultur ihrer „Master“ weiter, darunter war auch die arabische Komponente von Melodien und traditionellen poetischen Bräuchen der Beduinen-Dichtung (auch bekannt als Nabataean ). Diese umfasst auch die zuvor erwähnte Qilta-Dichtung, die eine Kunst des poetischen Dialogs ist. Es war fast so, als hätte der Tod zweier legendärer Rapper, Tupac (gestorben 1996) und B.I.G. (gestorben 1997), dem weißen amerikanischen Rapper Eminem (1972) den Weg bereitet, um die „schwarze“ Kunst der Rap-Musik anzuführen. Dieses Phänomen brachte der weißen Welt ein Geschenk: Sie entdeckte die Schätze der „schwarzen“ Kultur, die darin versteckt waren. Vielleicht ist dies auch eine Erinnerung daran, dass Jazz, Blues und Rock’n Roll von den Schwarzen an die Weißen überliefert wurden. Laut dem algerischen Rapper Rabah Ourrad ist die Rap-Musik die Nachfolgerin der rai-Musik, die langsam ausstirbt. Der politische Grund für die Verbreitung der Rap-Musik in Algerien als Ausdruck von Protest und Ablehnung sind die Ereig- GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 nisse von 1988, als eines Tages Tausende von Studenten und arbeitslosen Jugendlichen auf die Straße gingen, um gegen die hohen Lebensmittelpreise und das zerfallene Bildungssystem während der Präsidentschaft von Chadli Bindjedid (Regierungszeit von 1979-1992) zu protestieren. Die algerische Armee tötete fünfhundert der Demonstranten. Die Globalisierung der neuen Sklaven Die arabische Rap-Musik unterstreicht die Persönlichkeit junger arabischer Künstler, die Migration, Exil, Kritik, soziale und politische Zurückweisung sowie nichtprofessionelle künstlerische Randgruppen repräsentieren. Daher entwickelte sich die arabische Rap-Musik in einem Rahmen immerwährender Gewaltakte und diskriminierender Ausgrenzung im Bezug auf Alter oder Geschlecht. Wir sind Zeugen junger Palästinenser (oft in Flüchtlingscamps im Libanon und den besetzten palästinensischen Gebieten), die Verfolgung, inneres Exil und die Unerreichbarkeit einer Heimat erfahren. Folgende Künstler gehören dazu: al-Trash band, Battalion 5, I-Voice, MC Walled und DAM. Dieselben Erfahrungen sind auch unter arabischen Immigranten (Tunesiern, Algeriern und Marokkanern) in Europa (in Frankreich, Belgien und Holland) im Bezug auf ihre chronische Entfremdung, ihre mangelnde Integration und ihre soziale, politische und juristische Ausgrenzung zu beobachten. Deutlich ist dies in den Werken des holländischen Rappers Salah Edin (morakkanisch-algerischer Herkunft) zu erkennen, der mit den amerikanischen Rappern des Wu-Tang Clans auf Welttournee gegangen ist. Die palästinensische Band DAM veröffentlichte ihren ersten Song „Stop selling Drugs“ (1998), gefolgt von ihrem zweiten Werk „Who’s Terrorist?“ (2001). Die bekannte Sängerin Samira Said trat mit dem Rap-Song „May God Help, How Do I Love“ auf, der einer der Songs auf ihrem beliebten Album „Day After Day“ (2002) war. Der saudische Rapper Qusai Kheder produzierte in den USA „The Life of a Lost Soul“ (2002). Urban Legacy produzierte „Rebirth of Kamelion: AmericanMade“ (2005). Nach DAM erschien die ägyptische Band MTM im Jahre 2003 mit einem Musik-Album, das einen sarkastischen Song namens „My Mom Is Away“ und einen bekannten Videoclip enthielt. Kurz darauf folgte der beliebte Song „My Phone Is Ringing“ (2004). Plötzlich und sukzessive tauchte der ägyptische Rapper MC Amin in mehr als einem Album auf, darunter „Black Attack“ (2006), „Arab Rap Soldiers“ (2007), „Desert Saga“ (2008) und „Hiroshima“ (2009). Der Sänger Mohamed Hamaki lud den holländischen Rapper Berry Mystic zu seinem Song „The Nicest Thing About You“ aus dem Album „We Are Done Talking“ (2006) ein. Die Band Arabian Knights wirkte bei Songs mit, die für ägyptische Filme geschrieben wurden, darunter „Life Is If“ (für den Film „Fish Garden“, 2008). Die Band trat außerdem mit dem Schauspieler Ahmad Fishawi in einem Song für den Film „Code Pa- 51 per“ (2008) auf. Samira Said arbeitete mit der marokkanischen Band Fnaire zusammen, und nahm den Song „Be a Winner“ (2010) auf. Die Band Y-Crew nahm an den Dreharbeiten zum Film „Microphone“ (2011) mit ihrem Song „We’re Too Many“ teil. Die Band Battalion-5 produzierte ihr erstes Album „Welcome to the Refugee Camps“ (2008) und anschließend ihr zweites Album „One Decreed Road“ (2011). Die libanesische Band Fareeq al-Atrash produzierte ihr namenloses erstes Album im Jahre 2011. Qusai Kheder produzierte zwei weitere Werke, „Don Legend the Kamelion“ (2008) und „Experimental Edutainment“ (2010). Für sein letztes Album arbeitete er mit dem Sänger Abdul Fattah Jraini und der Sängerin Muna Amrsha in dem Song „Any Given Day“ (2010) zusammen. Es gibt arabische Rapper und Rap-Bands, die bekannt werden, ohne Alben zu produzieren. Einer dieser bekannten Rapper ist der Tunesier Hamada bin Amr (bekannt als „El General“), der seinen Song „President, Your People Are Dying“ wenige Tage nach dem Beginn der Jasmin-Revolution veröffentlichte. Darin kritisiert er die Flucht des Präsidenten Zine el-Abidine Ben Ali, der das Land kurz nach den Ereignissen des 14. Januar 2011 verließ. Auch die ägyptische Band Arabian Knights veröffentlichte ihren Song „Rebel“ als eine aggressive Antwort, als die ägyptischen Rebellen vom 25. bis 27. Januar ihrer medialen Kommunikationsmöglichkeiten beraubt wurden. Auch der Protagonist dieser Betrachtung, Klash, hatte seit 2004 die Gelegenheit, seine Talente und Fähigkeiten in Rap-Wettkämpfen unter Beweis zu stellen. Einige Jugendliche seiner Generation nahmen ebenfalls an diesen Wettkämpfen teil, darunter auch Abbadi, der Klash 2002 besiegte, Klashs eigene Band Boys of the West und einige junge arabische Männer aus Ägypten und Jordanien. Sein Erfolg blühte im Jahre 2007 auf, als er die Clubs hinter sich lassen konnte und seine Songs auf Youtube und über Bluetooth zu hören waren. Seine Songs prägten seinen legendären Namen in das Gedächtnis einer ganzen Generation saudi-arabischer Jugendlicher ein. Klash, dessen Name die Abkürzung seines Künstlernamens „Kalashnikov“ ist, schaffte es aus mehreren Gründen, sich eine breite Basis zu errichten. Sein Erfolg lag nur bedingt daran, dass er Obszönitäten und Erniedrigungen in seine gewalttätigen und rebellierenden Songs wie „Goal“, „Dogs of Jeddah“ und „Jeddah’s Crisis“ einarbeitete. Auch die feierliche und unterwürfige Bedeutung in Songs wie „Mother“ und „Union“ trug nur teilweise dazu bei. Vielmehr sind die tieferen Gründe für seinen Erfolg erst zu verstehen, wenn man sich aufmerksam die Songs von anderen Bands und anderen Rappern anhört, und folgende Vergleiche vornimmt: - Klash verfügt über eine eigene Art der Performance und Variation von poetischen Formulierungen, Dialogen und Kommentaren. Außerdem beherrscht er die Imitation verschiedener Stimmen und Dialekte, die sich an den sozialen und eth- GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 nischen Klassen der Menschen ausrichten, um die es in den Songs geht. - Seine Texte sind einzigartig, da sie nicht die konventionellen poetischen Formeln wiederholen oder von anderen „borgen“. Außerdem fiel mir auf, dass seine Texte über eine große Vielfalt von Rhythmen und Endreimen verfügen. - Klash erreicht sein Ziel, indem er seine Gegner mit niederschmetternden Treffern in Form von Hakenschlägen wie beim Boxen erwischt, beinahe so, als wäre Rap eine Art verbales Boxen. - Die verbesserte Soundtechnik sowie die musikalische und rhythmische Wiedergabe machen die Produktion der RapSongs von Klash zu einem besonderen Prozess. Seit Anfang 2003 kann man seine Leistungen und seine Teilnahme an Wettkämpfen, gemeinsam mit Rappern aus dem arabischen Golf, auf den Seiten von Qatar Rap und UAE Rap verfolgen. Die Gründung der association of Saudi Arabian rap von dem Rapper 2 MAM könnte der früheste Beginn der Geschichte des saudischen Rap sein. Sie wurde KSA Connection genannt, und unter ihrer Fahne traten die Rapper Abbadi (der wahre Begründer des saudischen Rap), Satam, Mooony und die Bands Boys of the West und Boys of Mecca auf. All diese Rapper haben an Wettkämpfen mit Rappern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und aus Kuwait teilgenommen, und ihre Namen sind im Internet veröffentlicht worden. Klash und seine Band arbeiteten mit Abbadi gegen dessen Gegner zusammen (der später die Band Hell Committee gründete). Manchmal legt eine solche Opposition eine Unvereinbarkeit von Persönlichkeiten offen, welche die bestehenden Unterschiede der sozialen und ökonomischen Klassen enthüllt. In der Regel sind es diese ökonomischen, sozialen und kulturellen Differenzen, die die Motive hinter den elektronischen Battles sind. Mooony beispielsweise arbeitete mit der Band Sparrow’s Lair zusammen, die von Hashim Qazzaz (der aus einer bekannten Handelsfamilie aus dem Hedschas stammt) angeführt wird. Klash hingegen arbeitete mit Abbadi zusammen, um diesen Krieg zu führen. Mooony und Sparrow’s Lair haben Songs gemacht, in denen sie die „Surub“ attackieren und beleidigen. „Surub“ ist eine neue pejorative Bezeichnung, die dem alten Ausdruck „Shrouq“ ähnlich ist, der ebenso pejorativ auf die Beduinen Bezug nimmt, wohingegen die Menschen aus dem Hedschas (Jeddah, Mekka und Taif) – da sie die Küstenstreifen bewohnen und die Nachfahren der Pilger sind – als Eindringlinge und Neulinge auf der arabischen Halbinsel angesehen werden. Die Bewohner der südlichen Region werden „07“ genannt – in Anlehnung an die Telefonvorwahl dieser Region. Die Angriffe gegen Klash waren ausgelöst durch den Neid seiner Rivalen auf seinen Erfolg und seine Beliebtheit. Obwohl er voll und ganz in seine Wettkämpfe eingetaucht war, bekam Klash mit, was über ihn gesagt wurde. In diesen Songs beschrieben sie ihn mit abwertenden Bezeichnungen wie „der Diener“ oder „das gegrillte Hühnchen“, in Anspielung 52 auf seine Herkunft außerhalb von Jeddah und dem Hedschas und seine erniedrigende soziale Stellung als Diener. Er schlug zurück, indem er ihnen sein künstlerisches Können präsentierte. Dennoch beunruhigten ihn diese Konfrontationen nicht sehr, deshalb überließ er sie Abbadi und den Mitgliedern seiner Band Boys of the West. Coolness und Reue Klash geht mit seiner Kunst ernst um, und er arbeitet stets daran, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ebenso wie Qusai Kheder, der ihm etwas voraus hat im Bezug auf die Anzahl der Jahre, die er schon in der Welt des UntergrundRap mit seiner Band Legends of Jeddah verbracht hat, sehe ich in ihm jemanden, der mit seiner Kunst und seinem Business sehr verantwortungsbewusst umgeht. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis bekam Klash die Gelegenheit, öffentlich in den Medien aufzutreten: 2008 im Programm „Red in Bold Font“ auf dem libanesischen Satellitenkanal LBC und 2010 auf dem Kulturkanal des saudischen Fernsehens. Er nahm als saudischer Künstler eine Vorbildfunktion ein, da er sich stark von seinen Zeitgenossen unterscheidet, die die traditionelle Volkskultur repräsentieren. Was auch immer die Gründe und Absichten hinter seinen Debütsongs der „Goal“-Trilogie waren: Durch sie wurde er zum König des saudischen Rap. Und obwohl er als eine der Legenden des arabischen Rap angesehen ist, repräsentiert er dennoch eine „schwarze“ Kultur, die in der arabisch-islamischen Gesellschaft unterdrückt wird. Klash unternahm keine Versuche, dagegen Position zu beziehen – denn Rap ist eine Kunst „schwarzen“ Ursprungs. Abgesehen von der Tatsache, dass er das „schwarze“ Image repräsentiert, gibt Klash in seinen Texten auch zu, dass er ein Sohn des Ghamid-Stammes (‘Asir-Region) ist, und dass er den einheimischen Ausdruck „07“ benutzt. Indem er dies tut, stellt er das Image einer unterdrückten Kultur dar, die durch die Kunst des Rap transportiert wurde – jener „schwarzen“ Kunst, die aus den Erfahrungen von Rassismus und einem Gangsterleben entstand. Er fügte diesem Image dasjenige der unterdrückten saudischen Kultur hinzu: Das Image des Sohnes aus dem Süden, der von der Mainstream-Kultur SaudiArabiens verachtet wird, und das Image des Außenseiters mit der aufsässigen Persönlichkeit, der einfach nicht zu der Gesellschaft des Hedschas gehören kann. Die drei Teile der „Goal“-Trilogie beinhalten grundlegende Ideen, die persönliche und gesellschaftlich-moralische Situationen über die Coolness-Kultur der Stadt offenbaren, ausgedrückt durch Schimpfwörter und verachtenden Hohn. In den Songs werden sexuelle Begriffe genannt; außerdem verachtet Klash darin das unzivilisierte Verhalten der zivilisierten männlichen und weiblichen Jugendlichen in Jeddah. Diese Trilogie machte Klash berühmt. Seine Songs verbreiteten sich GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 und lösten Medienberichte in Saudi-Arabien aus, nachdem sie über die Handys der Jugendlichen an den Schulen und Universitäten ausgetauscht wurden. Diese Songs provozierten andere Rapper, die eine Klash entgegengesetzte Kultur verkörperten. Es gingen Gerüchte um, dass Klash zusammengeschlagen oder ermordet wurde. Andere versuchten, ihn nachzuahmen, und produzierten schlechte Songs in seinem Namen. Klash antwortete darauf gemeinsam mit seinem Freund Abbadi, der Klashs Anhängern und Fans bald besser bekannt wurde. Diese Antwort erschien in Form des Songs „Dogs of Jeddah“. Darin wurde das Recht auf Verteidigung betont, selbst wenn dazu sexuelle Rache gegen den Feind erforderlich wäre. Der Song beinhaltete eine extra Portion „Machismo“, viel unterdrückte Homosexualität und einige defensive Rechtfertigungen von seinem Freund. Dieser Song erschien im Rahmen von Wettkämpfen als ein Angriff gegen seine Kontrahenten, die nicht aufhörten, ihn noch mehr gegen sie aufzuhetzen. Die Band Sparrow’s Lair brachte Songs heraus, die gegen Klash gerichtet waren, darunter „Klash’s Family, the Return of the Surub“. Der Rapper Mooony tat es ihnen gleich. Dennoch veranlassten Klash seine unendliche Zuversicht und seine Beschäftigung mit anderen Wettkämpfen dazu, eine Antwort zu vermeiden. Diese Strategie verschleierte sein Überlegenheitsgefühl und seinen Triumph, bis er „Klash al-‘amm ysakkir al-famm“ veröffentlichte und erneut mit Abbadi für den Song „Only a Warm-up“ zusammenkam. Nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, versprach Klash, sich dem zielgerichteteren, „kultivierten“ Rap zuzuwenden. Er führte seinen Song „Mother“ in seinem ersten Videoclip anlässlich des Muttertages am 21. März auf, der in der saudischen Gesellschaft nicht generell anerkannt ist, ebenso wenig wie jede andere Feier, abgesehen von den zwei offiziellen religiösen Festen Eid al-Fitr und Eid al-Adhha. Dies erweckte den Eindruck, als bereue er seinen vorherigen Stil der Rebellion und der Beleidigung. Im Winter 2009 wurden viele Gebiete von Jeddah überflutet. Der Grund dafür war die seit 1980 anhaltende Veruntreuung von Geldern, die für die Sanierung der Kanalisation beabsichtigt waren. Dieses Ereignis war die Gelegenheit für Klash, sein Ansehen wiederzuerlangen und seine Stellung als der alleinige Rap-Sänger, der solche Geschehnisse in seinen Songs behandeln kann, zu bestätigen. Er reichte bei Vertretern der Regierung eine Petition ein, aber sein Anliegen wurde nicht ernst genommen. Im nächsten Jahr wiederholte sich dieselbe Katastrophe. Trotzdem bleibt sein Song „Jeddah’s Crisis“ Zeuge der Korruption innerhalb der Regierung in Saudi-Arabien. Nachdem er das Gefängnis verlassen hatte, nahm Klash an dem berühmten Ramadan-Programm „Between You and Me“ teil. Er führte einen Song auf, der die expansionistische Rolle der Vereinigten Staaten verurteilte. Er tat sich mit zwei Stars aus seiner Region zusammen: Den Schauspielern Faez al-Maliki und Hasan al-‘Asiri. Wiederholt kündigte er sein erstes Al- 53 bum an, das noch immer nicht erschienen war. Diese Tatsache schreckte ihn aber nicht davon ab, weiterhin neue Songs zu veröffentlichen, nachdem er damit begann, in Park-Konzerten und bei einigen Privatpartys aufzutreten, deren Gastgeber den Rap als moderne Kunst in einem zeitgenössischen kulturellen Lebensstil ansehen und unterstützen. In seinem neuen Song, „Life Goes On“ (2011), geht es um einen existentialistischen Zustand, in dem er sich an die Tage seiner Kindheit erinnert. Der Song berichtet über seinen Eintritt in die Welt der Jugend und die unterschiedlichen Verantwortungen, die dies mit sich brachte. Er erinnert sich an seine Kindheitsliebe zurück, an seine Klassenkameraden und an seine Freunde aus der Nachbarschaft. Mit einer überströmenden religiösen Empfindsamkeit denkt er über seine Zukunft nach. Diese Religiosität erinnert an die transformativen Phasen der Rap-Musik in den Vereinigten Staaten gegen Ende der Neunziger, als einige Rapper zum Islam übertraten und eine Gegenkultur in den Vereinigten Staaten schufen, die sich von der „schwarzen“ Komponente und der Nonchalance hin zu einer Konversion zum Islam wandelte. Dadurch wurde eine kulturelle Waffe gegen das Christentum und das Judentum geschaffen, also gegen die zwei Religionen, die die amerikanische Kultur dominieren und kontrollieren. Offenbar kümmert sich Klash nicht um die Frage, ob das Singen im Islam erlaubt ist oder nicht; eine Frage, die normalerweise in einigen extremistischen religiösen Milieus in Saudi-Arabien aufkommt. Gemeinsam mit Qusai Kheder und den meisten anderen arabischen Rappern, repräsentiert er weiterhin eine ausgegrenzte Kultur, die noch nicht vollständig anerkannt wurde, wenn auch manche von ihnen die Gelegenheit hatten, mit hingebungsvollen traditionellen Sängern zusammenzuarbeiten, die Musikalben und Videoclips produziert haben. Die folgenden Sätze zeigen eine Art der Versöhnung zwischen Klash und seinem Rapper-Dasein: Als Klash in einem Fernsehinterview nach seiner künstlerischen Zukunft gefragt wurde, sagte er, dass er eventuell mehr Songs schreiben und produzieren und dafür sein Rapper-Dasein etwas zurückstellen werde. Diese Antwort ähnelt der Antwort des Gründers der saudischen Rap-Band 2 MAM, der mit dem Interviewer folgenden Dialog führte: Petro B: OK, wo siehst du dich selbst in zehn Jahren? 2MAM: Verheiratet. Ich werde diese Tage in der größten Toilette im Nahen Osten herunterspülen. Sehen sie für die Rap-Musik keine Zukunft? Entsteht diese Ansicht aus einem Bedürfnis heraus, zu rechtfertigen, dass das, was in der Jugend machbar ist, in fortgeschrittenen Jahren nicht mehr möglich ist? Es scheint so, als sei dies eine strategische, aber unbewusste Verteidigung, ein Bereuen von begangenen Fehlern, das trotz der Verlockungen von Ruhm und Heldentum einsetzt. Erwarten sie den Tod durch Rache, wie ihre Vorbilder The Notorious B.I.G. (1972-1997) und Tupac Amaru Shakur (1971-1997)? Jeder von ihnen weiß, dass es GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 zahlreiche Gegner gibt, die von Neid und Eifersucht getrieben sein könnten, und andere, die sich vielleicht zu einer Rache provoziert fühlen, wenn ihr Stolz verletzt ist. In einem Videoclip, der aufgenommen wurde, um auf Klashs offizieller Website übertragen zu werden, jagt die Kamera Klash, der gerade in dem Studio eintrifft, wo das RamadanProgramm „Between You and Me“ gedreht werden soll. Einige Jugendliche und junge Männer, die sich offenbar über seine Gegenwart freuen, sammeln sich um ihn und grüßen ihn. Er winkt ihnen mit der typischen Geste der Rap-Sänger zu. Er 54 trägt sein Baggy-Shirt und Blue Jeans und dreht sich zur Kamera um, um zu zeigen, dass er die Früchte seiner harten Arbeit erntet. Trotz seines großen Erfolges, ist der Ertrag sehr begrenzt; aber er ist ausreichend für Ruhm und Selbstzufriedenheit. Seine Freude daran, die anderen Rapper besiegt und auf ihre Plätze verwiesen zu haben, ist klar erkennbar. Obwohl seine Augen vor Freude und Eitelkeit nur so strahlen, gibt es Anzeichen für ein schlechtes Ende. Wie der Landstreicher und Dichter Tarfa bin al-‘Abd, der Rap-Mann des Zeitalters der Ignoranz, sagte: Die Zeit ist die Wächterin über die Zukunft! Ahmed Al-Wasel ist ein saudi-arabischer Dichter, Romanautor und Kritiker. Er wurde 1976 geboren. Er hat bisher fünf Gedichtbände, zwei Romane und zwei Studien über Musik in Saudi-Arabien veröffentlicht. Copyright: Goethe-Institut e. V., Fikrun wa Fann November 2011 Klash. Foto: Klash © Goethe-Institut Musikvideo von Klash http://www.youtube.com/watch?v=DMRAq0xWoj8 de, en, ar, fa Website von Klash http://klash7.yoo7.com/t2472-topic ar GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 55 Das Epochenjahr 2011 Drei der am längsten regierenden arabischen Despoten, der Tunesier Ben Ali, der Ägypter Hosni Mubarak und der Libyer Gaddafi sind von ihren Völkern vertrieben worden. Was bedeuten diese Veränderungen für das Verhältnis von islamischer Welt und Westen? Von Stefan Weidner Fußballcamp für Mädchen in Sakarya. Foto: Claudia Wiens © Goethe-Institut Der revolutionäre Wasserstand Um die Veränderungen in der Region zu begrüßen, muss man nicht davon ausgehen, dass die arabische Welt eine ähnliche Entwicklung nehmen wird wie Osteuropa nach dem Fall der Mauer. Dies ist schon aus wirtschaftlichen Gründen eher unwahrscheinlich – es fehlen wohlwollende, an Demokratie und Rechtsstaat interessierte und zugleich finanzkräftige Nachbarstaaten, wie sie die Osteuropäer in Gestalt der EU vorfanden. Die Araber finden unter ihren Nachbarn nur ebenfalls arme Länder oder überaus reiche, die die Demokratie jedoch als Teufelszeug erachten und ihre Reichtümer bereits jetzt dazu einsetzen, um sie nach Kräften zu untergraben. In zehn Jahren wird die arabische Welt vermutlich eher so aussehen wie Lateinamerika als wie Europa heute. Aber alles ist besser als die repressive, deprimierende und verdummende Stagnation, die die arabische Welt bis zum magischen Jahr 2011 im Bann hielt und aus dem sie nicht einmal die Terroranschläge vom 11. September 2001 und die darauf folgende militärische Eskalation in Afghanistan und Irak zu wecken vermochte. Eher dürfte es umgekehrt gewesen sein. Der 11. September und die westliche Reaktion darauf verlängerte die Stagnation, weil die westliche Unterstützung der repressiven, aber eben prowestlichen und islamistenfeindlichen arabischen Diktatu- ren mit einem Mal deutlich als das bessere Übel erschien. Tatsächlich waren es jedoch ausgerechnet diese Regimes, die die Bevölkerung in die Arme der Islamisten trieben, der einzigen Opposition, die über nennenswerte Mittel, die nötige Infrastruktur und eine Verankerung in der Bevölkerung verfügte. In dieser Konstellation rührten die Erfolge des Islamismus vor allem daher, dass es ihm gelungen ist, die ohnehin unscharfen Grenzen zwischen politischer Religion und traditioneller Gläubigkeit im eigenen Sinn zu unterwandern – ein Phänomen, dass nicht mit der mangelnden Trennung von Staat und Religion im Islam zusammenhängt, sondern schlicht damit, dass in repressiven Staaten der im sonstigen öffentlichen Raum unterdrückte politische Diskurs nirgendwohin anders als in die religiöse Sphäre ausweichen kann. Der in weiten Teilen schon abgewirtschaftete politische Islamismus fand aus Trotz gegen die westliche Eskalationsstrategie neuen Zulauf, und in der Folge griff die anti-westliche Propaganda auch auf säkulare Kreise über. Geschürt durch die nach dem 11.9.2001 in breiteren Kreisen rezipierte Islamkritik pflegte der Westen die bis heute grassierende Paranoia, dass die arabische Zivilgesellschaft und Demokratiebewegung am Ende nur das Feigenblatt, ja der Steigbügelhalter der Islamisten sind. GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Schließlich wurden in dieser Atmosphäre viele Israelis zu dem Glauben verführt, Kompromisse mit den Palästinensern schiebe man am besten so lange wie möglich auf und stärke die zukünftige Verhandlungsposition, indem man die Siedlungstätigkeit im Westjordanland weiter vorantreibt. Die 2006 durchaus demokratisch gewählte palästinensische Regierung unter Führung der Hamas wurde boykottiert und schließlich im Gazastreifen unter Quarantäne gesetzt, was nach dem Muster einer self fulfilling prophecy genau zu jener Radikalisierung der Hamas führte, die der Westen durch ihre Einbindung in eine demokratisch gewählte Regierung zu verhindern versucht hatte. Ohne 9/11 und den Einmarsch im Irak, so dürfen wir vermuten, hätte 2011 einige Jahre früher stattgefunden, und selbst Saddam Hussain wäre womöglich auf ähnliche Weise gegangen worden wie gegenwärtig Gaddafi – sicher nicht unblutig, aber nicht mit einem Nachspiel, das bis heute den Irak in Blut taucht. Dort sterben nach wie vor mehr Menschen durch Gewalt als selbst in den Ländern, die sich im hellsten revolutionären Aufruhr befinden. Perspektiven für Israel Die arabischen Revolutionen haben den Tod Bin Ladens zu einer Fußnote gemacht und den israelisch-palästinensischen Konflikt aus der Stagnation befreit. Vordergründig ist dies Israel vorerst zum Nachteil gereicht, da Ägypten entgegen israelischem Wunsch die Grenze zum Gazastreifen geöffnet hat und die Hamas wieder in eine gesamtpalästinensische Regierung eingebunden worden ist. Es dürfte viele in Israel geben, die es mittlerweile bereuen, in den letzten Jahren und aus einer Position der Stärke heraus keinen Friedensvertrag mit den Palästinensern geschlossen zu haben. Jetzt wächst das Selbstbewusstsein der Araber, und es ist nicht mehr anzunehmen, dass sich ihre Regierungen dem westlichen Diktat ähnlich bereitwillig unterwerfen, wie es die autokratischen Regimes vor den Revolutionen taten. Wenn es trotz alledem in absehbarer Zeit zu einem israelisch-palästinensischen Frieden kommt, darf sich Israel indessen Hoffnung machen, dass dieser verlässlicher und weniger kalt sein wird als jeder Frieden, der mit oder im Umfeld von Despoten geschlossen worden ist. Langfristig könnte damit auch Israel von den Entwicklungen profitieren, so turbulent diese in nächster Zeit verlaufen mögen. Im Endeffekt wäre Israel im Nahen Osten dann nur eine Demokratie unter vielen. Es hätte keine Sonderstellung mehr inne, weder in den Augen des Westens noch auch, so ist zu hoffen, in den Augen der Araber. Die „Normalisierung“ (tatbî’), derzeit im Arabischen noch als Synonym zu „Verrat“ gebraucht, wäre vollzogen. Diese Vision ist kein frommer Wunsch. Für beide Seiten sind die objektiven Anreize für eine solche Normalisierung groß, so mächtig die subjektive Stimmung aktuell dagegen spricht. Wir im Westen würden ebenfalls davon profitieren, da unse- 56 re Solidarität mit Israel und die vorschnelle Gleichsetzung Israels mit dem Westen die Normalisierung unseres eigenen Verhältnisses zur arabischen Welt behindert. Wenn aber der arabische Nahe Osten demokratische Formen annimmt, verdienen vor allem die Kräfte in Israel unsere Unterstützung, die ihren Staat nicht für alle Ewigkeit als Ausnahme und Sonderfall in der Region erachten, sondern als integralen und integrierten Teil des östlichen Mittelmeers, des Nahen Ostens, des ‚Orients’. Bliebe Israel permanent ein Fremdkörper dort, stünden seine Überlebenschancen auf lange Sicht sehr schlecht. Wie wenig das Land aber auf die Veränderung vorbereitet ist, zeigte sich ausgerechnet in dem Moment, da die Araber aufbrachen. Noch Mitte Januar 2011, als Ben Ali in Tunesien bereits gestürzt war, pflegten nach übereinstimmenden Medienberichten die israelischen Geheimdienste die Überzeugung, Mubaraks Stellung sei ungefährdet. Will man nicht annehmen, die besten Geheimdienste der Welt hätten über zu wenig oder über fundamental falsche Informationen verfügt, liegt der Schluss nah, dass es eine irreführende Wahrnehmungsschablone war, die das Erkennen der Realität unmöglich machte. Man wird sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, wenn man diese Wahrnehmungsschablone als Überbleibsel einer kolonialen Mentalität identifiziert, einer Mentalität, die in fast allen Beobachtern wirksam war, selbst solchen, die mit der arabischen Welt sympathisierten. Im Klartext läuft diese Mentalität auf eine zumindest unbewusste Unterschätzung von Arabern und Muslimen hinaus. Man hält sie für unterentwickelt, rückschrittlich, weniger kultiviert, unselbstständig, unaufgeklärt und aufgrund all dessen auch nicht zu selbstbestimmter und zielorientierter politischer Aktion fähig. Und hat die arabische Geschichte seit dem Fall der Berliner Mauer diese Vorurteile nicht bestätigt? Man hätte den Verdacht hegen können, diese Mentalität habe auch die Araber selbst infiziert. Nach Art eines kollektiven Stockholmsyndroms schienen sie – zumindest vor den Kameras – all zu oft denjenigen Kräften zuzujubeln, die sie in Geiselhaft nahmen: den eigenen Diktatoren und den Islamisten. Die Araber, dürfen wir schließen, haben sich auch selbst überrascht. Abschied von einer Mentalität Daraus folgt: 2011 ist in noch einem größeren Ausmaß ein Epochenjahr, als offensichtlich ist. Dieses Jahr zieht nicht nur – auch dank dem Tod, ja man darf sagen der Erlegung Bin Ladens – einen dicken Schlussstrich unter die zehn Jahre nach 9/11; es markiert den Anfang vom Ende einer historischen „longue durée“, einer Großepoche, die mehr als zweihundert Jahre lang wirksam gewesen ist. Gemeint ist die Geschichte des abendländischen Imperialismus und der von ihm etablierten, bis in jüngste Zeit wirksamen kolonialen Strukturen. Die gestürzten und in nächster Zeit wahrscheinlich stürzen- GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 den arabischen Regimes haben diese Strukturen im Inneren ihrer Länder oft bruchlos weitergeführt oder sie, meist inspiriert durch sozialistische Vorbilder wie in Ägypten, Libyen, Syrien und Algerien, durch solche ersetzt, die für die Bevölkerung ähnlich entmündigende, ähnlich katastrophale Ergebnisse zeitigten. Eine zentralistische Einparteienherrschaft mit einem Präsidenten an der Spitze, der nicht rechenschaftspflichtig ist, jedoch Wirtschaft, Militär, Rechtssystem, Parlament und Medien eines Landes kontrolliert, und ein König oder Fürst, der ähnliche Befugnisse hat (wie in Marokko, Saudi-Arabien, Jordanien, den Golfemiraten), unterscheidet sich nicht fundamental von einem Kolonialregime, das mit Hilfe von Marionettenregierungen die eigenen Interessen durchsetzt, das Land ausraubt und die einheimische Bevölkerung verachtet. Dass sie ihre Würde zurückerhalten und endlich wie Menschen behandelt werden möchten, ist ein viel zitiertes Motiv in den Parolen der arabischen Demonstranten gewesen. Aber war dies nicht schon die Losung der antikolonialen Befreiungsbewegungen? Sachlich durchaus korrekt sind nahezu alle Regimes in der arabischen Welt von der Bevölkerung als Ausführungsgehilfen und verlängerter Arm des Westens wahrgenommen worden. Zum Teil konnten sie sich überhaupt nur dank der Unterstützung durch den Westen so lange an der Macht halten. Die erwähnte Öffnung der Grenze zum Gazastreifen durch die ägyptischen Behörden nach dem Sturz Mubaraks erscheint vor diesem Hintergrund weniger ein Akt der Solidarität mit den Palästinensern als ein Akt eigener wiedergewonnener Souveränität: Die Ägypter wollen sich ihr außenpolitisches Handeln nicht mehr von westlichen Prioritäten bestimmen lassen. Aber nicht nur die arabischen Revolutionen deuten an, dass die Epoche des Imperialismus sich ihrem Ende zuneigt. Es ist vielmehr auch die sich in einflussreichen Kreisen im Westen durchsetzende Einsicht, die Entwicklungen in der islamischen Welt nicht mehr auf direkte Weise und mit Hilfe simpler Mechanismen steuern zu können. Wenn, wie in diesem Jahr vom amerikanischen Präsidenten groß verkündet, von 2014 an die westlichen Truppen nach dreizehn Jahren „Aufbauarbeit“ und „Antiterrorkampf“ aus Afghanistan abziehen, und zwar gleich allen ihren Vorgängern voraussichtlich als gescheiterte, wenn nicht geschlagene, dürfte sich sobald kein Bündnis und keine westliche Regierung mehr zu einer ähnlichen Operation im Orient verleiten lassen. Auch in Iran sitzt ein Regime, dessen Zeit eigentlich abgelaufen ist und das beim städtischen und gebildeten Teil der Bevölkerung seit langem diskreditiert ist. In Gestalt der Proteste nach der vermutlich gefälschten Präsidentenwahl im Sommer 2009 fand in Iran gleichsam die Generalprobe zu den arabischen Aufständen von 2011 statt. Sie scheiterte 57 zwar, aber gab das Muster für spontan mittels Mobiltelefonen und Internet koordinierte Protestbewegungen vor, wie sie in der arabischen Welt erfolgreich gewesen sind. Warum der Aufstand in Iran vorläufig gescheitert ist, lässt sich nach den arabischen Erfahrungen zumindest ein Stück weit erklären. Zum einen ist Iran, anders als die arabischen Staaten mit ihrer gemeinsamen Sprache, ihren transnationalen Medien und ihrem intensiven sozialen und intellektuellen Austausch untereinander, weitgehend isoliert, ja schlimmer noch, es hat mit Irak und Afghanistan zwei Nachbarstaaten im Bürgerkrieg und unter amerikanischer Besatzung. Der äußere Druck auf das Land ist damit viel größer und ein revolutionärer Dominoeffekt, wie er sich in der arabischen Welt ergeben hat, kann sich von außen nicht unterstützend einstellen. Der revolutionäre Impetus muss allein im Land selbst erzeugt und aufrechterhalten werden. Zum anderen leidet die Protestbewegung in Iran unter der mangelnden Einbindung der ärmeren, weniger gebildeten und strenggläubigeren Bevölkerungsteile, als deren Fürsprecher und Wohltäter die Regierung unter Präsident Ahmadinedschad und die konservativeren Elemente des herrschenden Klerus sich seit jeher stilisieren. Auch in dieser Hinsicht steht aber zu erwarten, dass sich das Machtgefüge allmählich zugunsten der Opposition verschiebt, wenn einesteils der äußere Druck mit dem Abzug westlicher Truppen aus Irak und Afghanistan nachlässt, andernteils die demokratischen Veränderungen in der arabischen Welt an Nachhaltigkeit gewinnen und auch das syrische Assad-Regime stürzt, Irans einziger echter arabischer Verbündeter. Die These vom Jahr 2011 als Wendejahr für die Epoche des Imperialismus wird im Übrigen ausgerechnet durch den Blick auf die Schwierigkeiten der revolutionären Bewegung in Iran bestätigt. Falls es nämlich zutrifft, dass mit den arabischen Autokraten, wie 1979 mit dem iranischen Schah, Regimes gestürzt wurden, die wenig anderes als die autochthone, allenfalls mit einer neuen, etwa sozialistischen Ideologie versehene Fortsetzung von Kolonialsystemen waren, so hat die Islamische Republik, trotz vieler menschenverachtender Gemeinsamkeiten mit den gestürzten arabischen Diktaturen, doch zumindest mit der Hörigkeit gegenüber dem Westen und der Verachtung der eigenen Traditionen Schluss gemacht. Der latente Widerstand gegen das Regime kann sich daher in Iran auf bestimmte Elemente, die in der arabischen Welt mit entscheidend waren, nicht stützen: den konservativen Islam und die Teile der Bevölkerung, die, obzwar eigentlich verarmt und perspektivlos, vom Regime mittels aufwendiger Umverteilungen bei Laune gehalten werden. Sieg der westlichen Werte? Wenn das Jahr 2011 aber unbestreitbar eine weltpolitische Epochenwende markiert, dürfte es mehr als angezeigt sein, GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 aus diesem Anlass auch eine geistige Wende zu vollziehen und die mentalen Versehrungen aufzuarbeiten, die sich seit 2001, wenn nicht schon lange vorher, in der Begegnung mit der arabisch-islamischen Welt akkumuliert haben. Und so sehr sie lange schon ein Desiderat gewesen ist, zeichnen sich ihre Konturen vor dem Hintergrund der Situation von 2011 nur umso stärker ab. Diese Versehrungen haben sich naturgemäß auf beiden Seiten niedergeschlagen, im Westen ebenso wie in der islamischen Welt. Ihre offensichtlichste Gestalt ist ein permanentes gegenseitiges Misstrauen, begleitet von Anschuldigungen und Vorwürfen. Dieses Misstrauen, das 2001 und in den Jahren danach seinen Höhepunkt erreicht hatte, wird – auf beiden Seiten – befeuert durch Unkenntnis, Ignoranz, Vorurteile und teils gezielte Desinformation. Überzogene Erwartungen und ideologische Verblendungen treten hinzu und schaukeln sich wechselseitig hoch. Unverhofft bieten nun die arabischen Revolutionen die Gelegenheit, dieses Misstrauen zu überwinden. Und doch beobachten wir vielfach dieselbe Verunsicherung und Angst wie früher. Was könnte jetzt nicht alles auf uns zukommen an Flüchtlingsströmen und unerlässlicher Wirtschaftshilfe, an Ölkrisen, radikalislamischen Regierungen und Bürgerkriegen, in die wir womöglich hineingezogen werden? Doch auch wenn die Angst immer eine vor der Zukunft ist, steht sie im Bann der Vergangenheit und ist das Resultat vieler Jahrzehnte entfremdeter Politik, sei es in der arabischen Welt selbst, sei es, von Seiten des Westens, im Umgang mit ihr. Um den Blick frei zu bekommen, bräuchte man eine transkulturelle Psychoanalyse. Für die meisten, besonders die islamkritischen Beobachter, überraschend, bekunden die arabischen Revolutionäre jedoch Werte, die nahezu vollständig aus dem westlichen, beziehungsweise, halten wir die westlichen Werte für universal, dem universalen Wertekanon stammen und die sich auch in unseren Breiten ein jeder auf die Fahnen schreiben könnte, ja auf die Fahnen schreiben sollte. Eines der beeindruckendsten Beispiele dafür bot die vom Satellitenkanal al-Jazeera live übertragene Freitagspredigt des jungen libyschen Religionsgelehrten Wanis al Mabruk vor mehreren Zehntausend Gläubigen in Benghazi am 25.3.2011. Dies ist das erfreuliche Indiz für eine trotz allen Misstrauens erfolgreiche westliche Vermittlung dieser Werte, oder aber (und das wäre noch besser!) dafür, dass es sich dabei tatsächlich um universelle, zumindest problemlos universalisierbare Werte handelt. Vor diesem Hintergrund fällt rückblickend auf, dass das arabische Misstrauen gegenüber Europa und den USA ohnedies weniger islamisch oder sonst wie kulturspezifisch begründet worden ist, sondern der wiederholten Erfahrung westlicher Doppelzüngigkeit entsprang: Die Werte, die der Westen verkündete, missachtete er häufig selbst, und zwar gerade in 58 der Auseinandersetzung mit Muslimen und mit der islamischen Welt, sei es direkt, etwa in Guantanamo, in Abu Ghraib oder im Umgang mit Flüchtlingen; oder indem der Westen mit Machthabern kooperierte und diese stützte, welche die westlichen Werte unübersehbar mit Füßen traten, wie die jetzt gestürzten arabischen Diktatorenpräsidenten. Die Janusköpfigkeit (Doppeldeutigkeit) im Umgang mit der arabisch-islamischen Welt zieht sich jedoch – und an diesem Punkt versehren wir uns selbst – mitten durch unsere eigene Gesellschaft. Gemeint ist die Diskrepanz zwischen Regierungspolitik und Zivilgesellschaft, zwischen offiziellem Handeln in der hohen Politik und dem Credo der flach profilierten soft-power regierungsunabhängiger, aber in aller Regel vom Staat mitgetragener Institutionen. In Ägypten arbeiteten unsere Stiftungen, unsere Kultur- und Austauschinstitute, unsere mit viel staatlichem Geld geförderten NGOs für die Stärkung von Demokratie und Zivilgesellschaft, während die hohe Politik das autokratische Regime Mubarak in Wort und Tat (vor allem durch wirtschaftliche Zusammenarbeit) stützte. Ähnliches gilt für zahlreiche andere Staaten, sogar für Syrien. Bei dieser Janusköpfigkeit vertritt die offizielle Regierungsebene den politischen Realismus und den unmittelbaren Nutzen; die meist im kulturellen und sozialen Bereich tätige softpower halbstaatlicher Organisationen und NGOs ist hingegen für die Moral zuständig. Die Unglaubwürdigkeit einer solchen Aufspaltung von politischer Moral und politischem Handeln liegt auf der Hand und ist natürlich auch arabischen Beobachtern nicht entgangen. Andernfalls hätte man schon annehmen müssen, dass sich das Goethe-Institut in Kairo, wenn es, wie im Mai 2009, dem regierungskritischen Schriftsteller Alaa Al-Aswani ein Forum bietet, gegen seinen wichtigsten Geldgeber, das Auswärtige Amt, verschworen haben muss, dessen Chef den ägyptischen Präsidenten im Mai 2010 einen „Mann mit enormer Erfahrung, großer Weisheit und die Zukunft fest im Blick“ genannt hat. Die Komplexität unseres internationalen politischen Handelns, das dank demokratischer Gewaltenteilung in selbstreferentielle Systeme fast Luhmann’ scher Art aufgesplittert und zu keiner einheitlichen Zielsetzung mehr fähig ist, ist wohl unaufhebbar geworden. Eine große Schwäche, ein empörend wunder Punkt im westlichen Selbstbild ist sie nichtsdestoweniger. Auf die damit einhergehende Korrumpierung antwortet aus einem im Prinzip richtigen moralischen Impetus heraus nicht zuletzt die Islamkritik. Sie führt Politik und Moral wieder zu einer einzigen Weltanschauung und Zielsetzung zusammen – freilich um den Preis eines arg verzerrten Blicks auf die Welt. Während sich das westliche Misstrauen auf die Frage nach der Demokratietauglichkeit der arabischen Gesellschaften beruft, spielt (von Randgruppen abgesehen, die in unseren Medien leider oft als repräsentativ dargestellt werden) für die arabischen Bürger der Islam offenbar keine prominente Rolle bei der Kritik am Westen – eine Asymmetrie, die zumindest zum Teil dadurch erklärt werden kann, dass die GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Wahrnehmung des Islams als Gegner unseren Blick dafür getrübt hat, dass selbst der islamisch eingefärbte Widerstand, sei es gegen die despotischen Staatsapparate in der arabischen Welt, sei es gegen Israel oder gegen die westliche Intervention in Afghanistan und im Irak, für Ziele einzutreten vorgibt, mit denen wir uns ebenfalls identifizieren könnten: die Achtung der Menschenwürde, politische, wirtschaftliche und kulturelle Teilhabe, Rechtssicherheit, Mitbestimmung, Autonomie, Demokratie, gute Regierungsführung und freie Meinungsäußerung. Selbst traditionell und orthodox gesinnte Muslime fordern dies, und das ist ein gutes Zeichen selbst dann, wenn die begründete Befürchtung besteht, dass diese Kräfte, einmal an der Macht, die vordem geforderten Rechte ihren politischen Gegnern nicht zugestehen. Für diese Art von Doppelzüngigkeit braucht es nicht den Islam, wir kennen sie ebenso von 59 anderen einstmals revolutionären Bewegungen unterschiedlichster ideologischer Couleur. Die Chancen, die für den Westen und vor allem die Europäer in einer weitgehend demokratisierten und mit rechtsstaatlichen Strukturen versehenen arabischen Welt liegen, sind zu viel groß, um sie aufgrund eines wohlfeilen, islamkritisch befeuerten Skeptizismus oder kurzsichtiger Ängste um den Ölpreis zu verspielen. Nutzen wir diese Chancen nicht und zaudern, den arabischen Aufbruch in die Vernunft ideell und materiell zu fördern, riskieren wir das Scheitern oder Abdriften der Revolutionen, bevor der Wandel unumkehrbar ist. Weitere Jahrzehnte weltpolitischer Depression und ideologischer Verhärtung wären die Folge. Und das kann niemand wollen, so unterschiedlich die Meinungen auch sind und bleiben werden. Stefan Weidner ist Chefredakteur von Fikrun wa Fann / Art & Thought. Copyright: Goethe-Institut e. V., Fikrun wa Fann November 2011 Fotos von Claudia Wiens http://www.claudiawiens.com/ en, ar, de, fa GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 60 Die Anfänge des Islams Was genau können wir über den frühen Islam und die ersten islamischen Sekten und Glaubensrichtungen wissen? Das Lebenswerk des Islamwissenschaftlers Josef van Ess ist diesen Fragen gewidmet. Der Journalist und Nachwuchsislamwissenschaftler Christian Meier hat ihn interviewt. Von Christian Meier und Josef van Ess Josef van Ess. Foto: Christian Meier © Goethe-Institut Christian Meier: Herr van Ess, seit wann gibt es den Islam? Josef van Ess: Diese Frage ist überhaupt nicht zu beantworten. Zumal man ja schon unterschiedlicher Meinung darüber ist, seit wann es den Koran gibt. Eines aber ist klar: Als es den Koran gab, gab es noch lange nicht den Islam. Wie ist das zu verstehen? Josef van Ess: Eine Religion braucht Generationen, bis sie weiß, warum sie da ist. Ich habe dafür einmal den Begriff „Optionen“ eingeführt. Als Offenbarungsreligion hat der Islam genau wie das Christentum bestimmte Grundvoraussetzungen: einerseits ein Gottesbild – überhaupt die Existenz eines Gottes, das ist ja nicht selbstverständlich – und andererseits einen Stifter. Wie Letzterer diese Rolle ausfüllt, ob als Prophet oder als Gottes Sohn, ist letztendlich egal. Aus diesen Voraussetzungen folgen „Optionen“. Jede Religion hat zu Anfang zahlreiche Optionen – aber nicht unendlich viele. Im Gegenteil, dadurch, dass es sich um eine Offenbarungsreligion handelt, ist die Zahl schon einmal begrenzt. Dennoch: Es müssen Entscheidungen gefällt werden. Und das braucht Zeit – man hat zum Beispiel Jahrhunderte ge- braucht, bis man sich dazu entschlossen hatte, von der stilistischen Unnachahmlichkeit des Koran zu sprechen. Heute tut man so, als sei das im Koran schon vorgegeben – das stimmt aber gar nicht. Durch diese Entscheidungen wird der Entscheidungsspielraum immer weiter eingegrenzt – bis man beim modernen Fundamentalismus landet, wo alles eigentlich von vornherein festgelegt zu sein scheint und kaum noch Bewegungsfähigkeit vorhanden ist. So sehr natürlich auch der Fundamentalismus in sich variabel ist. Häufig heißt es im Westen, der Islam brauche eine Reformation – einen „islamischen Luther“, um die Erstarrung aufzuhalten. Josef van Ess: Ach, das ist doch ein alter Hut. Der Gedanke taucht schon im späten 19. Jahrhundert bei den Muslimen auf, und man hört ihn auch jetzt immer wieder. Dahinter steht der etwas amorphe Wunsch nach Reform, weil man mit der Gegenwart unzufrieden ist. Das gilt aber wohl für jede Gegenwart. Dass dann der Name Luther auftaucht, hängt natürlich mit dem protestantischen Geschichtsbild zusammen, das nicht nur in Deutschland lange Zeit sehr ausgeprägt war. GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Stimmt es überhaupt, dass es im Islam nie eine Reformation gab? JJosef van Ess: Ich halte schon den Koran für eine reformatorische Schrift: Ich sehe im Koran eine reformatorische Intention insofern, als die älteren Religionen als Irrwege abgetan werden und man im Grunde nur zurückkehren will zu den Anfängen. Was natürlich eine Illusion ist: Der Koran ist nie zu den Anfängen zurückgekehrt, die ganze Geschichte mit dem Abraham ist ein Konstrukt. Aber dahinter steht vermutlich die historische Erfahrung, dass das Christentum abgewirtschaftet hat. Denn die Zeitgenossen des Propheten und die ersten Generationen nach ihm erlebten das Christentum nicht als einheitliche Religion, sondern als drei verschiedene „Kirchen“, die sich wüst beschimpften. Im Übrigen ist die Devise des Koran ja sehr einfach mit seinem Monotheismus. Auch das ist ein Versuch, Überflüssiges abzustreifen. Und man darf nicht vergessen, dass auch im Koran der Begriff des „Bundes“ mit Gott eine Rolle spielt. Und so wie das Christentum sich als „neuer Bund“ gegenüber dem „alten Bund“ des Alten Testaments verstand, versteht der Koran sich im Grunde als „dritter Bund“. Und als was sahen die frühen Muslime sich selbst? Wie ist der Islam zum Islam geworden? Josef van Ess: Der Frühislamforscher Fred Donner geht in seinem neuen Buch Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam davon aus, dass der Islam von Muhammad oder im Koran noch gar nicht intendiert war. Da wird bloß eine Gemeinde gebildet, die sich eines besonders sittlichen oder frommen Lebenswandels befleißigen soll und die sich als „die Gläubigen“ bezeichnet: al-muʾminūn. Für ihn ist mu’minūn die eigentliche Selbstbezeichnung der Muslime. Die Bezeichnung „Muslim“ kommt erst viel später in Gebrauch ... Josef van Ess: Ja, in der Tat. Der Begriff muslimūn steht zwar schon im Koran, meint aber nur ganz bestimmte Leute: die alten heidnischen Kaaba-Verehrer aus Mekka, die sich dem Islam „unterwerfen“ oder „hingeben“. Während unter den mu’minūn, der Urgemeinde, auch Juden und Christen sind. Die werden dann später ausgesondert – für Donner vollzieht sich das in der Zeit des Kalifen ’Abd al-Malik. Und so wird Ende des 1. Jahrhunderts nach der Hidschra der Islam zum Islam. Die Frage ist natürlich nicht ausdiskutiert, und ich selbst stelle es mir ein ganz klein wenig anders vor ... Aber dass das eine Zeit dauerte, das halte ich für selbstverständlich. 61 Wäre vor diesem Hintergrund nicht eine engere Zusammenarbeit zwischen Spätantike- und Frühislamforschern erwünscht? Josef van Ess: Das ist sogar ein Desiderat, gerade Deutschland befindet sich da etwas im Rückstand. Was die Zeit der Entstehung des Islams angeht und die Jahrhunderte vorher, so ist die Perspektive, unter der man das sieht, etwa in der englischsprachigen Welt etwas anders. Charakteristisch dafür ist der Begriff „Late Antiquity“. Dort wird spekuliert mit Bezug auf die Chronologie, die Epochengrenzen. Der Begriff „Spätantike“ ist eigentlich von den Deutschen oder besser gesagt: einem Kunsthistoriker aus Österreich, erfunden worden, der Objekte aus dem ersten Jahrtausend der christlichen Zeitrechnung – also nach der Antike – in einen gemeinsamen Begriff einspannen wollte, so dass etwa auch koptische Kunstwerke und orientalische Produkte anderer Art eine Rolle spielen konnten. Mich hat das deswegen schon immer interessiert, weil ich aus Aachen stamme und mir das Geld für mein Studium als Fremdenführer verdient habe. Dort gibt es im Dom die so genannte Heinrichskanzel, die kurz nach dem Jahr 1000 von Heinrich II. gestiftet worden ist, auf der sich koptische Plastiken befinden, die ganz antikisch sind: Elfenbeinschnitzereien von nackten Körpern. Für Heinrich II. war das wohl vor allem etwas exotisch Schönes. Man fragt sich aber natürlich, wo das herstammt. Und offenbar sind diese Dinge in frühislamischer Zeit in Ägypten entstanden und dort von Kopten angefertigt worden. Da hilft der Begriff „Late Antiquity“ ein bisschen weiter. Die Ausläufer der Antike reichen also bis in die islamische Zeit hinein ... Josef van Ess: Die Epochengrenzen werden verschoben. Wann die Spätantike anfängt, ist immer schon umstritten gewesen. Viel wichtiger ist aber, wann sie denn aufhört. Lange Zeit hat man gesagt: Irgendwann im 6. oder 7. Jahrhundert – jedenfalls vor dem Islam – geht ihr auch im Orient die Luft aus. Die Leute, die jetzt mit diesem Begriff arbeiten, meinen dagegen: Nein, es geht weiter bis zum Ende der Dynastie der Umayyaden-Kalifen. Das Aufkommen des Islams ohnehin, aber auch noch das so genannte „Arabische Reich“ der Umayyaden ist in seinen Strukturen noch Spätantike. Der Bruch kommt mit der abbasidischen Revolution. Die ist gleichzeitig auch eine geographische Gewichtsverschiebung: hin zum Irak, der ja das Zentrum des alten persischen Sassanidenreiches war. GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Lassen Sie uns zur Entstehung des Islams zurückkehren. Sie sagten, Sie haben eine eigene Vorstellung davon, wie sich die neue Religion entwickelt hat. Josef van Ess: Wenn wir von „dem Islam“ sprechen, dann stimmt das natürlich für den heutigen Islam nicht. Es stimmt aber genauso wenig für die Anfänge des Islams. Wir stellen uns immer so vor: Da ist eine Gruppe von Leuten, die denken sich etwas aus und machen eine neue Religion auf. Aber so war das ja nie. Natürlich hat es die „Gläubigen“ gegeben. Aber die wurden durch die Eroberungskriege in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Die Folge war ein Konglomerat verschiedener Nuklei. Vor allem in den neuen Garnisonsstädten – Basra und Kufa, Fustat in Ägypten, Hims in Syrien. Da sitzen dann ein paar so genannte Prophetengenossen, die später auch verehrt werden und um die herum sich eine Sorte Islam gruppiert. Aber ich bin überzeugt, dass das in Kufa ganz anders aussah als in Hims oder in Fustat. Aus welchem Grund? Waren diese Gebiete voneinander isoliert? Josef van Ess: Die Kommunikation zwischen den Zentren war schwach. Natürlich sind die Leute gereist, und natürlich hatten sie irgendeinen Koran-Text, an den sie sich hielten – soweit es den schon gab. Aber das Entscheidende ist ja die Exegese, die Frage, wie man den Text versteht. Die Frage ist überhaupt, ob der Koran schon im Mittelpunkt stand. Aus meiner Sicht: Nein. Was die Gemeinde einte, war vielmehr die Art des gemeinschaftlichen Gebets. Diese merkwürdige Gymnastik, die man dabei treibt, die Proskynese oder arabisch suǧūd – das ist ja singulär. Und das fiel jedem anderen auf. Gleichzeitig bezeugte man mit diesem performativen Akt seine Unterwerfung unter den einen Gott. Auch dieser Ritus brauchte natürlich seine Zeit, um sich zu entwickeln. Aber das hatten diese einzelnen Nuklei gemeinsam. Bezeichnenderweise wurde das Gebet ja geleitet von dem Statthalter oder dem gerade anwesenden General – sozusagen in militärischer Disziplin. Was da an Überbau hinzukam, also was wir heute unter Islam verstehen – das weiß der Himmel. Das kann man vielleicht mit viel Liebe herausfinden, aber es dauert lange, bis man definieren kann, was beispielsweise in Kufa überhaupt los war. Heißt das, in den Städten haben sich jeweils eigene IslamRichtungen entwickelt? Josef van Ess: Ja. Selbst an Orten wie Kufa oder später Bagdad würde ich nicht von einem einheitlichen Islam ausgehen. Bagdad war dafür ja auch viel zu groß, es hatte unter Umständen eine Million Einwohner. Dass man da in jeder Moschee den Islam gleich verstanden hätte, halte ich für völlig unmöglich. Was Kufa angeht, so haben wir ja Berichte von 62 diesen verrückten Gnostikern aus der frühislamischen Zeit. Dort gerieten offenbar vor allem schiitische Gedanken in Blüte und haben die merkwürdigsten Fantasien erzeugt. Die müssen ja irgendwo ausgesprochen worden sein, und es müssen sich auch Anhänger gefunden haben. Ansonsten hätte man das gar nicht schriftlich niedergelegt. Jedenfalls stelle ich mir das so vor, dass in vielen Moscheen der Islam jeweils anders aussah – wenn auch nicht unbedingt in jeder Moschee und natürlich gewiss nicht in der Hauptmoschee, wo man freitags hinging und wo einem der Gouverneur sagte, wo es langgeht. Das ist natürlich bloß ein persönliches Bild, das ich mir mache, aber ich halte das für eine Möglichkeit, die Sache ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Denn damit lässt sich die ganze Frage nach dem Ursprung des Islams etwas entzerren, weil man sie überall separat neu stellen muss. Sie zeichnen ein fast schon atomistisches Bild vom Islam. Josef van Ess: Oder ich stelle das gängige Bild auf den Kopf. Die Pluralität steht am Anfang, die Einheit kommt später. Ein Fundamentalist würde es genau umgekehrt sehen. Und auch im Studium läuft es natürlich andersherum: Zuerst ist der Koran da, damit wird der Islam definiert, und dann kann man mal gucken, was daraus wird. #Was war das einigende Band all dieser lokalen Gruppen und Islam-Varianten – jenseits der Gebetsgymnastik? Josef van Ess: Auf Dauer war das natürlich der Koran: Überall wo man den Koran als Grundlage akzeptierte, war man Muslim. Es brauchte etwas Zeit, bis er zusammengestellt und den Leuten zu Bewusstsein gekommen war. Aber in dem Augenblick, wo man den Koran als verbindliche Grundlage herausstellte, da gab es Islam. Vermutlich begann das mit ’Abd al-Malik und den Inschriften am Felsendom in Jerusalem, wo der Koran zitiert wird – nicht ganz wörtlich, übrigens. Ab diesem Zeitpunkt hatte man etwas, woran man sich festhalten konnte. Später kam dann das islamische Recht hinzu. Wenn das Gebet den Muslimen also ihre soziale oder rituelle Identität gab, dann gab der Koran ihnen die spirituelle? Josef van Ess: Die Muslime verstehen den Koran ja nicht als „heilige Schrift“, sondern als Lebensordnung, als „Verfassung“. So wie die Amerikaner an die „Constitution“ glauben, glauben die Muslime an den Koran, weil sie aus ihm herauszulesen meinen, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten soll, wie man leben soll – ethisch und meinetwegen auch juristisch. Ich glaube, das ist den Leuten sehr wichtig gewesen, obwohl sie es nie so richtig ausgesprochen haben. Wenn es innerhalb des Islams Widerstand gegen die Religion gab, von den „Ketzern“ oder arabisch mulhidūn, dann fällt auf, dass GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 der Widerstand sich nie gegen das islamische Gesetz richtete. Wir würden es genau umgekehrt erwarten: Denn wenn uns etwas widerlich am Islam ist, dann ist es doch das islamische Gesetz, dass man bei Diebstahl gleich die Hand abhackt und so. Aber das wird nie zum Problem gemacht. Wenn Ketzer oder so genannte „Zweifler“ auftreten, dann stellen sie Muhammads Prophetie oder seine Person in Frage – ähnlich wie Salman Rushdie es in den Satanischen Versen beschrieben hat. Ich würde daraus gerne schließen, dass der Koran sein Ansehen dadurch gewann, dass er den Leuten eine feste Lebensgrundlage gab. Das ist im Grunde auch der Anlass für zahlreiche Konversionen, die sich heutzutage vollziehen. Das Neue Testament ist da ganz anders: Dort finden Sie Gleichnisse, die im Stil viel schöner sind als die im Koran. Aber Sie müssen erst einmal lange heruminterpretieren, bis Sie herausgefunden haben, was gemeint ist. Das heißt, der Islam hat sich auch deshalb erfolgreich ausgebreitet, weil er konkrete Regeln in Form des Koran besitzt? Josef van Ess: Häufig bringt man als Erklärung für die Verbreitung des Islams nur die Eroberungskriege. Das ist mir ein bisschen wenig. Denn eigentlich ist der Islam keine missionarische Bewegung gewesen – das ist er erst heute, und selbst heute haben viele Muslime Bedenken dabei. Die Araber, die damals in Kufa oder anderswo saßen, hatten jedoch vermutlich gar keine Lust, Leute in ihre Gemeinde aufzunehmen, die dann zwar fromme Muslime wurden, aber keine Steuern mehr zahlten – und unter Umständen Spione waren. Auch in den Garnisonsstädten hielten sie sich von allen anderen fern, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Da waren Konvertiten erst einmal gar nicht so erwünscht. Konvertiten und Spione sind das eine – das andere sind Ketzer. In Ihrem nächsten Buch Der Eine und das Andere beschäftigen Sie sich mit islamischen Sekten und dem Umstand, dass man über die meisten von ihnen vor allem durch die Schriften ihrer Gegner Bescheid weiß. Josef van Ess: Das Buch ist zuerst einmal eine Geschichte eines literarischen Genus, nämlich dessen, was wir als „Häresiographie“ bezeichnen. Es gibt massenhaft Texte dieses Genus im Islam, in denen die so genannten Sekten aufgezählt werden. Dieses Genus ist sehr lebenskräftig gewesen, es hat über ein Jahrtausend bestanden: vom 2. Jahrhundert nach der Hidschra bis in das 19. Jahrhundert. Dahinter steht aber bei mir eine These: die vom „denominationalism“ – also in etwa Konfessionalismus, vom englischen „denomination“. Der 63 Grundgedanke ist der, dass es eine Religion als solche nie gibt. Es gibt immer bloß einzelne Gemeinden. In diesem Fall hieße das, dass es gar keine Häresien in unserem Sinne gegeben hat, sondern nur verschiedene Gemeinden. In den von Ihnen untersuchten Büchern wird das sicherlich etwas anders dargestellt... Josef van Ess: Mir scheint, dass diese Bücher vor allem eine Bestandsaufnahme dessen sind, was es im Islam überhaupt an Konfessionen gibt. Zwar wird manchmal dazu gesagt, dass die Lehre dieser oder jener Konfession sich nicht gehört – aber damit sind sie noch lange keine Häresie. Der Begriff Häresie setzt eine Orthodoxie voraus. Das klappt im Christentum, weil wir da Kirchen haben – aber nicht im Islam. Wie wollen Sie Orthodoxie im Islam definieren? Es hat Versuche immer wieder gegeben, und es hat auch Orthodoxien in unserem Sinne gegeben, aber sie waren immer lokal und zeitlich begrenzt. In dem Augenblick, wo ein Herrscher oder die maßgeblichen Theologen irgendwo eine bestimmte IslamInterpretation als verbindlich definierten, gab es natürlich Gruppen, die als abartig bezeichnet wurden und nach unserem Vokabular dann Häresien wären. Aber grundsätzlich und überall verabscheut wurden nur ganz wenige Gruppen. Etwa die Ismailiten, in dem Augenblick vor allem, wo sie als Assassinen auftraten. Wie ging man mit solchen „abartigen“ Gruppen um? Josef van Ess: Selbst die Ismailiten wurden nicht ausgerottet: Ismailiten gibt es auch heute noch. Sie haben sich in Rückzugsgebiete flüchten müssen, aber sie haben überlebt. Noch viel mehr gilt das für frühe Gruppen, die sich gegen den Staat erhoben hatten. Beispielsweise iranische Gruppen, etwa der „verschleierte Prophet“ Al-Muqannaʿ im 8. Jahrhundert, der eine größere Anhängerschaft hatte. Er selbst wurde mit seiner Gemeinde verfolgt und tötete sich, als er sah, dass seine Sache scheiterte. Aber noch Jahrhunderte später fanden sich Anhänger dieses Mannes in den Bergen Turkestans. Und wenn Reisende, die das interessierte, dorthin fuhren und fragten: ‚Seid ihr Muslime, oder seid ihr keine mehr?’, dann sagten die Leute: ‚Ja, so genau wissen wir das auch nicht. Aber wir zahlen Steuern.’ Und das war das Entscheidende. An Aufstand dachten sie nicht mehr, dazu waren sie auch nicht mehr zahlreich genug. Nur wenn sie in der Stadt auftauchten und dort eine Gemeinde bildeten, wurde es kritisch – denn da waren sie natürlich Außenseiter. Aber solange sie irgendwo auf dem Land lebten, hatte man nichts dagegen. Ähnlich lief es auch mit so merkwürdigen Leuten wie den Nusairiern – in Syrien nennt man sie Alawiten –, die reine GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Gnostiker sind und vom Koran überhaupt nichts halten. Die gibt es auch noch, und sie haben sich auf dem Weg über die Armee heutzutage sogar durchsetzen können. Die Christen hätten die schon im Mittelalter ins Jenseits befördert. Wenn Sie an die Katharer denken – die hat man gnadenlos bekämpft und mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Das ist im Islam anders gelaufen, und darum geht es mir: Erstens darum, den Häresie-Begriff ein bisschen aufzulösen und zu fragen: Was ist denn überhaupt Orthodoxie? Und zweitens zu versuchen, von der Ketzerei wegzukommen und die Praxis, also den Umgang mit diesen Leuten, in den Vordergrund zu stellen. Das klingt beinahe zu harmonisch, um wahr zu sein. Josef van Ess: Natürlich ist es manchmal ausgesprochen rabiat zugegangen. Mahmūd von Ġazna etwa hat viele einfach einen Kopf kürzer gemacht – aber ganz bestimmte Leute, die ihm auch politisch im Weg standen. Doch zu anderen Zeiten hat man halbwegs friedlich nebeneinander her gelebt. Insofern bietet der Islam ein bunteres Bild als die christliche Welt. Bis jetzt in der Gegenwart durch die Macht der Medien die Sache umschlägt. Die Medien befördern nicht die Meinungsvielfalt, sondern die Standardisierung von Inhalten? Josef van Ess: Durch die Medien ist es viel leichter möglich, ein verbindliches Bild vom Islam unter die Leute zu bringen und etwa mit Geld durchzusetzen. Der Umschwung begann 64 schon unter den von uns so hoch geschätzten Reformatoren des späten 19. Jahrhunderts wie Muhammad ’Abduh. Die ja auch eine Rückkehr zur Schrift, zum Heiligen Buch, und zugleich eine Abkehr von der Mystik propagierten – und damit auf einen Einheitsislam hinauswollten. Die Ironie der Geschichte hat dann dazu geführt, dass schließlich der moderne Fundamentalismus daraus geworden ist. Widerspricht nicht die Vielzahl unterschiedlicher Islam-Interpretationen heute – etwa fundamentalistisch oder progressiv – der Vorstellung vom verbindlichen Einheitsislam? Josef van Ess: Wenn ich von einem erstarrten Islam rede, dann denke ich an Entwicklungen, wie sie sich etwa in SaudiArabien vollzogen haben und dann mit modernen Mitteln verbreitet worden sind. Allerdings muss man immer dazusagen: Auch das, was sich im so genannten Fundamentalismus abspielt, ist etwas Neues. Da steckt ja viel mehr Moderne drin – auch europäische Moderne –, als wir so denken. Genauso wie im islamischen Terrorismus zuerst einmal europäische Moderne steckt, denn wir haben schließlich mit so etwas angefangen. Wenn wir also moderne Ansichten, wie sie von Fundamentalisten vertreten werden, auf den Koran zurückführen, dann tun wir zwar den Fundamentalisten damit einen Gefallen, aber historisch gesehen ist das falsch. Dennoch: Im Grunde habe ich keine Angst um die islamische Welt. Ich bin sicher, dass auch die Fundamentalisten es nicht zu einer Orthodoxie schaffen werden. Das ist einfach in der Religion nicht angelegt. Josef van Ess (76) gilt als einer der weltweit bedeutendsten Forscher auf dem Gebiet der islamischen Theologie, Philosophie und Mystik. Sein Hauptwerk Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra erschien zwischen 1991 und 1997 in sechs Bänden. Im Juli 2010 wurde der 1934 geborene van Ess auf dem dritten „World Congress for Middle Eastern Studies“ in Barcelona für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Copyright: Goethe-Institut e. V., Fikrun wa Fann November 2011 GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 65 Arabische Kunst nach 9/11 Seit den Golfkriegen und sicherlich verstärkt durch den 11. September lässt sich in Europa und den USA ein gesteigertes Interesse für zeitgenössische Künstler aus dem Nahen Osten, Nordafrika oder Iran beobachten. Von Lotte Fasshauer und Michaela Kamburowa TASWIR – Utopia of Text, 2009. Foto: Di Mackey © Goethe-Institut, ha’atelier Die Videoarbeit Interview with three artists (2008) von Mo Nabil, einem Künstler aus Kairo, persifliert das stereotypisierte Image des libanesischen, ägyptischen und palästinensischen Künstlers, wie es von Kuratoren aus Europa und den USA auf Ausstellungen des letzten Jahrzehnts oft vermittelt wurde. Das Video besteht aus drei Teilen, in denen der Künstler selbst jedes Mal in anderer Verkleidung eines der drei Stereotypen verkörpert, jeweils vervielfältigt in neun kleinen Bildern, die den Bildkader ausfüllen. Gestik und Mimik sind auf jedem Bild gleich, aber zeitversetzt repräsentiert, wodurch ein serieller Eindruck entsteht. Am unteren Bildschirmrand läuft ein Text, der die fiktiven Erläuterungen des jeweiligen Künstlers zu seiner für eine Ausstellung geplanten Arbeit enthält. Dabei wird deutlich, dass der Künstler sich genau auf die Phänomene seines Landes bezieht, die in Europa und den USA im Fokus des Interesses stehen: der libanesische Bürgerkrieg, der Stadtmoloch Kairo, die Mauer, die Palästina eingrenzt. Individuelle Erfahrungen und Sichtweisen kommen dabei zu kurz. Seit den Golfkriegen, besonders seit dem letzten Jahrzehnt, sicherlich verstärkt durch den 11. September lässt sich in Europa und den USA ein gesteigertes Interesse für zeitgenössische Künstler aus dem Nahen Osten, Nordafrika oder Iran und eine erhöhte Nachfrage nach entsprechenden Ausstellungen beobachten. Beispiele sind DisOrientation, 2003 im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, Arabise Me, 2006 im Victoria & Albert Museum in London, Word into Art, 2006 im British Museum in London, Di/Visions, 2007–2008 in Berlin, und Unveiled, 2009 in der Saatchi Gallery. Diese breit angelegten Ausstellungen dienen dazu, die Öffentlichkeit in die zeitgenössischen Kunstpraktiken im Nahen Osten, in Nordafrika und Iran einzuführen bei gleichzeitiger Vermittlung ihrer Kontexte durch Vorträge, Panels und Filmvorführungen. Einerseits profitieren die Ausstellungen aufgrund eines erhöhten Aufklärungs- und Dialogbedarfs nach dem 11. September von verstärkt bereitgestellten Fördermitteln. Zugleich obliegt ihnen jedoch eine neue Verantwortung im Kontext des von Fremdenhass und Islamophobie geprägten Klimas nach dem 11. September. Ausstellungskonzepte werden auf die Goldwaage gelegt und müssen sich gegen massive Kritik von verschiedenen Seiten behaupten. In besonderem Maße sind sie einer erhöhten Wachsamkeit bei Kritikern einer orientalistischen Sichtweise ausgesetzt. Sie kommen daher nicht umhin, sich mit kulturellen Wahrnehmungsprozessen und Machtmechanismen kultureller Identitätskonzeptionen auseinanderzusetzen. GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Klischeebildungen Kuratoren zeigen, was sie für wichtig halten und was ihnen dem Publikumsinteresse zu entsprechen scheint. Daher werden diejenigen Künstler ausgewählt, die entsprechende Themen behandeln, was dazu führen kann, dass Künstler sich von den Erwartungen des Kurators bzw. des Publikums korrumpieren lassen. Es entstehen Klischeebilder, Stereotypisierungen, auf die der Künstler festgelegt wird, ein Image, das er nicht mehr los wird, eine Verallgemeinerung, die letztendlich sinnentleert und identitätslos ist. Zuschreibungen verfestigen sich. Das Problem vieler regional fokussierter Ausstellungen ist die Überbetonung des Kontextes, aus dem der Künstler stammt. In einem tagebuchähnlichen Text beschreibt der Kurator von DisOrientation – 16 arabische Künstler aus dem Nahen Osten, Jack Persekian, seine Reise zu den einzelnen für die Ausstellung vorgesehenen Künstlern. Sein Bericht stellt eine Region vor, die von politischen Unruhen und Konflikten geprägt ist, die es fast unmöglich machen, von einem zum anderen Land zu reisen, um die einzelnen Künstler ausfindig zu machen. Auf der einen Seite suggeriert der Text, dass es für die Künstler fast unmöglich sein muss, sich nicht mit ihrer geopolitischen Aktualität auseinanderzusetzen, auf der anderen Seite droht dieser außerkünstlerische Kontext zu sehr in den Vordergrund zu rücken: Beim Leser entsteht der Eindruck, die Künstler müssten schon allein aufgrund ihrer Herkunft gewürdigt werden und jedes Werk müsste in irgendeiner Weise auf die landesspezifische Problematik verweisen. Die ausgestellten Werke würden infolge dieser Wahrnehmung weniger nach ihrer künstlerischen Qualität, sondern vielmehr im Hinblick auf ihren geopolitischen Hintergrund beurteilt werden. Schon allein die Bezeichnung „Naher Osten“ offenbart die Vorherrschaft des westlichen Blicks. Vor allem nach dem 11. September wird diese Region von den Medien als Bedrohung hingestellt, so dass Kuratoren mit ihren Ausstellungskonzepten automatisch zu Erklärungen – „dass es im Nahen Osten nicht nur um Terror und Terrorismus geht“ – gedrängt werden. Solch eine Aussage, bemerkt die Kuratorin Nada Shabout, versetzt die Kunstwerke und Veranstaltungen unverzüglich in nicht-ästhetische Gefilde. Der Kunsthistoriker Saleh M. Hassan konstatiert, dass eine Mehrzahl der Ausstellungen nach dem 11. September mit nahöstlicher Kunst ausschließlich ein Bild zeige, welches westliche Ängste in Bezug auf die Region und den Islam spiegele, statt kritisch die komplexe Geschichte sowie ästhetische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Einer der Trends sei die obsessive Beschäftigung mit Geschlechterbeziehungen. Als Ausstellungsbeispiele nennt er unter anderem Without Boundary: Seventeen Ways of Looking , die 2006 im MoMA in New York stattfand, Harem Fantasies and the New Scheherazades, 2003 am Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, sowie Breaking the Veils: Women Artists from the Is- 66 lamic World, eine Wanderausstellung seit 2002, organisiert von der Royal Society of Fine Arts in Jordanien und FemmeArt-Méditerranée in Griechenland. Es mag erstaunen, dass solche Klischeebildungen auch von arabischen Ländern ausgehen können. Dabei wird deutlich, dass ebenso auch Beispiele der Selbstorientalisierung vorliegen. Die Ausstellung Without Boundary lobt Saleh M. Hassan für ihren Versuch einer kritischen Auseinandersetzung mit Fragen der Modernität und der Problematik der Kategorie „islamische Kunst“. Doch die Ausstellungspräsentation sowie die Interpretation mancher Werke im Ausstellungskatalog hätten die aufgeworfenen Problemstellungen der Kuratorin Ferestheh Daftari nur in eine Richtung gelenkt. Der Autor Homi Bhabha zum Beispiel habe das Werk Keffieh (1993–1999) der Künstlerin Mona Hatoum nur in Hinblick auf eine religions- und regionsspezifische interne Geschlechterproblematik analysiert, jedoch die Vielschichtigkeit des Werks außer Acht gelassen, wie die historische, soziopolitische und poetische Dimension, die aktive Rolle der Frau im palästinensischen Widerstandskampf, den Belagerungszustand, die oft allegorische Darstellung der weiblichen Figur für die Heimat Palästina. Homi Bhabha habe den typisch westlichen Diskurs bedient, der sich auf die Unterdrückung der Frau im Nahen Osten bzw. in der „islamischen Welt“ reduziere. Gegenpositionen arabischer Kunstpraxis Fragestellungen zur Repräsentierbarkeit des Krieges und die Kritik an hegemonialen Geschichtsdarstellungen im Spannungsfeld von Macht und medialer Repräsentation sind Kennzeichen eines post-orientalistischen Engagements, welches die libanesische Kunst prägt und nach dem 11. September neue Aktualität erfahren hat. Zur kritischen Methode der Künstler gehört die Intermedialität, die besonders geeignet ist, der manipulierenden Vorherrschaft eines einzigen Mediums – sei es das Fernsehen, die Zeitung oder das Plakat – den Boden zu entziehen, indem der Rezipient auf das Mediale der Botschaft hingewiesen wird. Saleh Barakat und Sandra Dagher, die Kuratoren des libanesischen Pavillons auf der Biennale in Venedig, der infolge des Julikriegs 2006, dem 33 Tage dauernden Krieg zwischen Hizbollah und der israelischen Armee, erstmalig ins Leben gerufen wurde, thematisieren im Vorwort zum Katalog die Problematik, die sich ihnen als Vermittler aktueller Positionen libanesischer Kunst stellt: „What story should we tell the international audience about Lebanon now? Should we promulgate the image of the wartorn country or should we present another image?” Denn sicherlich sind die Werke von den gesellschaftlichen und politischen Bedingungen, unter denen sie entstehen, und von einer gewissen Politiklastigkeit geprägt. Die Kuratoren stehen also vor einer doppelten Verantwortung, sich mit der eigenen Zeitgeschichte kritisch auseinanderzusetzen, ohne dabei jedoch in die Falle drohender Stereotypisierungen zu tappen. Im Juni 2007 erschien ebenfalls mit Bezug auf die GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 vielstimmigen Reaktionen nach dem Julikrieg eine komplett der Beiruter Kunstszene gewidmete Ausgabe im Art Journal. In ihrem Beitrag „Mining War“ geben Hannah Feldmann und Akram Zaatari zu bedenken: „Art, we insisted, could not be made to represent geopolitical identities without falling back on extreme simplifications.“ Alternative Ausstellungspraktiken Nach dem libanesischen Bürgerkrieg (1975–1990) sind es Künstler und nicht etwa Historiker, Soziologen oder Anthropologen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Vorherrschaft und die Kategorisierungen des westlichen Blicks in historischen Fotografien der arabischen Welt durch die Schaffung eines eigenständigen Archivs für fotografische Dokumente arabischer Herkunft zu brechen. Das in Beirut ansässige Fotoarchiv Arab Image Foundation, unter anderem von den Künstlern Akram Zaatari und Fuad El Koury 1997 gegründet und mit Mitgliedern wie Walid Raad, Lara Baladi oder Yto Barrada, umfasst eine Sammlung von über 300 000 Aufnahmen aus verschiedenen arabischen Ländern, die in zahlreichen Ausstellungen, Projekten und Publikationen präsentiert wurden. Ist das Interesse an der arabischen Kunstszene in den letzten zehn Jahren trotz der Gefahr von Klischeebildung bei regional bezogenen Ausstellungen nicht dennoch von einer Öffnung begleitet, die vorher nicht gegeben war? Die in London lebende Kuratorin Rose Issa, die sich auf Kunst aus dem Nahen Osten, Nordafrika und Iran spezialisiert, meint: „Many artists worry about being pigeonholed. However I have not seen a British artist or an American artist being offended by being labelled British or American. So what we have here is a matter of confidence.” Nicht alle teilen die Zuversicht von Rose Issa, dass sich über kurz oder lang das gleiche Vertrauen, das westlichen Künstlern entgegengebracht wird, auch auf Künstler aus dem arabischen Raum erstrecken wird. Ein in letzter Zeit öfter zu beobachtendes Ausstellungskonzept entgeht der vielfach unfreiwilligen geopolitischen Kategorisierung und Verallgemeinerung durch einen formalästhetischen Ansatz, der es erlaubt, Werke aus verschiedenen Zeitepochen in ein gemeinsames Bezugsfeld zu stellen. Zuletzt fand im Haus der Kunst in München die Ausstellung Die Zukunft der Tradition – Die Tradition der Zukunft (2010/2011) statt, die auf die erinnerungswürdige Ausstellung Meisterwerke muhammedanischer Kunst vor 100 Jahren Bezug nahm. Die Ausstellung Die Macht des Ornaments, 2009 in der Orangerie des Belvedere in Wien, spannte einen zeitlichen Bogen vom Wien der Jahrhundertwende bis in die Gegenwart, von Gustav Klimts Wasserschlangen bis zu Künstlern wie Adriana Czernin, Parastou Forouhar, Shirin Neshat, Raqib Shaw oder Philip Taaffe. 2007 67 fand im Sakıp Sabancı Museum in Istanbul wiederum die Ausstellung Blind Date Istanbul statt, die abstrakte Arbeiten aus der Sammlung Deutsche Bank und osmanische Kalligraphien der Sakıp Sabancı Sammlung paarweise einander gegenüber stellte. Ein weiteres Beispiel bildet die Ausstellung Taswir – Islamische Bildwelten und Moderne, die 2009/2010 am Martin-Gropius Bau in Berlin stattfand. Ihr Konzept knüpfte an die Idee eines Bilderatlasses an, wie ihn der Kunsthistoriker Aby Warburg in den 1920er Jahren entwarf. Anhand von Bilderreihen versuchte Warburg, über Räume und Zeiten hinweg Ähnlichkeiten in Form und Ausdruck unmittelbar sichtbar werden zu lassen. Entsprechend wurde in dieser Ausstellung den vielfältigen synchronen und diachronen Beziehungen zwischen westlichen und östlichen Bildwelten nachgegangen, um der Vorstellung von hermetisch gegeneinander abgegrenzten Kulturkreisen entgegenzuwirken und eine neue Sicht auf globale kulturübergreifende Kunstzusammenhänge zu ermöglichen. Dabei war weder Vollständigkeit noch Systematik angestrebt, sondern „eine Neudefinition des Wissens einer nicht nur westlich geprägten Moderne im Umgang mit den bildenden, musischen und performativen Künsten“, wie die Kuratorin der Ausstellung, Almut Sh. Bruckstein Çoruh, in einem Text zur Ausstellung formuliert. Während Ausstellungen wie Blind Date Istanbul die Möglichkeit bieten, stärker auf Details einzugehen und dabei den Fokus auf eine bestimmte Fragestellung zu richten, besteht bei breiter angelegten Ausstellungen eher die Gefahr, dass zugunsten eines leichteren Verständnisses Zugeständnisse und Vereinfachungen komplexer historischer Prozesse vorgenommen werden. Der Betrachter sieht sich klassischen Artefakten gegenübergestellt, die aus dem Zusammenhang gerissen erscheinen, da eine chronologische und geographische Anordnung mit dynastischem Bezugssystem nicht geboten wird. Gleichzeitig kann beim Blick auf die zeitgenössischen Werke kritisiert werden, dass sie entindividualisiert oder gar missinterpretiert werden können und unter dem Gesichtspunkt ihrer Zugehörigkeit zum Islam interpretiert würden, unabhängig davon, ob ein religiöser Bezug besteht oder nicht. De-Orientalisierung durch Globalisierung Zunehmend fordert eine neue global agierende Generation von Künstlern, Kuratoren und Wissenschaftlern eine bewusst de-orientalisierte Sichtweise auf die Weltbühne der Kunst. Auf dem im Frühjahr 2010 in Beirut zum fünften Mal stattfindenden von Ashkal Alwan organisierten Home Works -Forum waren drei documenta -Kuratoren anwesend, Catherine David, die das Langzeitprojekt Contemporary Arab Representations ins Leben rief, Okwui Enwezor sowie die zukünftige documenta -Kuratorin Carolyn Christov-Bakargiev. Teilnehmer waren ferner Andrew Ross von der New York University, die Kuratorin und Kunsthistorikerin Nada Shabout von der University of North Texas, der Autor und Kurator Shumon Basar aus London sowie Künstler wie Walid Raad oder Hito Steyerl. GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 Eines der Schwerpunktthemen war die neu entstehende Museumslandschaft auf Saadiyat Island in Abu Dhabi. Bis 2018 soll die Insel ein luxuriöses Wohnviertel von der Größe einer Kleinstadt beherbergen, mit vielerlei Freizeit-, Sport-, und Kulturangeboten. Die Hauptattraktion wird ein Kulturkomplex aus fünf monumentalen Museen sein, u. a. dem Louvre und dem Guggenheim Museum. Es geht um die Entwicklung einer immensen Infrastruktur, um Investitionen eines reichen Landes in die eigene Zukunft. Es handelt sich um ein Mischkonzept, in dem alle Bedürfnisse bedacht sind. Kunst und Kultur sind als Teilbereiche nicht nur berücksichtigt, sondern sollen als Herzstück des Projektes den Ausbau des Tourismus in Abu Dhabi fördern und zugleich ein Bildungsversprechen einlösen. Die Skepsis, mit der man einem solchen Megaprojekt begegnen mag, resultiert aus der Frage, ob man erst Strukturen schaffen und sich dann um die Inhalte kümmern kann, ob man erst das financial capital einsetzen und danach erst das human capital entwickeln kann. Wie kann sich ein von außen eingekauftes kulturelles Gesamtpaket ohne einen Zusammenhang mit der einheimischen Kultur und traditionellen Kunstpraxis vor Ort etablieren? Guggenheim-Chef Thomas Krens hat für Abu Dhabi die gleiche touristische Marketingkampagne wie in Bilbao vorgesehen: Eine unscheinbare Stadt bekommt durch ein Museum einen neuen Blickfang, der die Massen anzieht. Dabei sollen auch die lokalen Künstler des größten arabischen Emirats eine Plattform erhalten. In Bilbao allerdings wurde den lokalen Künstlern erst zehn Jahre nach der Museumseröffnung eine Ausstellungsmöglichkeit geboten. Angesichts der politischen Kluft zwischen Ost und West wäre Saadiyat Island aber mehr als ein importiertes Kulturpaket. Wie Zaki Nusseibeh, stellvertretender Vorsitzender der Abu Dhabi Culture and Heritage Authority (ADACH), bemerkt, will Abu Dhabi Brücken zur internationalen Kunstszene schaffen und dabei seine eigenen Traditionen mit einer globalisierten Welt in Einklang bringen, sich mit der universalen Weltzivilisation vereinigen und religiöse Unterschiede beiseite lassen, mit Kunst die Offenheit fördern. Doch solch ehrgeizige Megaprojekte mit globalem Geltungsbedürfnis müssen auch innerhalb der Bevölkerung vermittelt werden und Teilnahme finden. Dem will man mit einer Anzahl neuer Studiengänge wie Geisteswissenschaften, Museumsstudien und Kulturmanagement beikommen. Bislang gab es aber kaum öffentliche Diskussionen über die kulturellen Zielsetzungen des Landes, so dass es sich die Emirates Foundation zur Aufgabe macht, auf einem „menschlichen Maßstab“ aktiv zu werden. Die Stiftung vergibt u. a. Stipendien an Kulturschaffende der Emirate. In dem kleinen Nachbar-Emirat Katar sind die Ambitionen zum Aufbau einer weit angelegten Museumslandschaft nicht minder hoch gesteckt. 2008 eröffnete die Qatar Museums Authority – der Dachverband aller Museumsprojekte des 68 Landes – das Museum of Islamic Art, dessen Silhouette seither das Panorama der Hauptstadt Doha prägt. Ende 2010 folgten wie auf einen Schlag die QMA Gallery und das Al Riwaq Art Space als kleine und große Halle für Sonderausstellungen sowie das Museum of Modern Arab Art (Mathaf), das einzige seiner Art in der Region. Im Gegensatz zu den Vereinigten Arabischen Emiraten setzt man in Katar stärker auf eine Entwicklung von innen nach außen, also auf die Förderung und Präsentation eigener Sammlungen und Künstler. Das Mathaf beherbergt die umfangreiche Sammlung arabischer Moderne von Sheikh Hassan Al Thani. Die Wüstenfotografien von Sheikh Khalid Al Thani sollen nach einer ersten großen Ausstellung in Doha an mehreren Stationen in Europa, den USA und Asien einem internationalen Publikum zugänglich werden. Der von Abu Dhabi angestrebte Ausgleich zwischen global angelegten Museumsprojekten und kleineren, auf individuelle Förderung zugeschnittenen Programmen, konnte in Katar – zumindest im Konzept seiner beiden Museen – schon umgesetzt werden. So bilden das Museum of Islamic Art und das Mathaf eine Balance: Während das MIA stolz aus dem Wasser aufragt und der Bau des Architekten I.A. Pei durch Monumentalität und Eleganz imponiert, setzt das Mathaf auf das besagte „menschliche Maß“. In einem umgebauten und modernisierten Schulgebäude unweit von Education City, des neu entstandenen Campus mehrerer internationaler Universitäten, präsentiert sich die Sammlung offen, einladend und jugendnah. Die Ordnung der Sammlung und alle Informationsmaterialien sind leicht verständlich und sollen von einem umfangreichen Workshop-Programm begleitet werden, die Website – in hellblau und rosa gehalten und mit handschriftlichen Lettern versehen – bietet interaktive Beteiligung. Wie das Mathaf von seiner Zielgruppe angenommen werden wird, muss sich noch zeigen. Noch existieren in dem Land keine zusätzlichen Ausbildungsmöglichkeiten für Museums- und Kulturarbeit. Öffnung durch gemeinsamen Diskurs? Geht es wirklich um die Stärkung der lokalen arabischen Kunstszene, oder geht es um eine Machtdemonstration? Welche Konsequenzen werden die Umwälzungen im arabischen Raum auf die Kunstszene, die globale Ausstellungspolitik und die Museumspolitik in der Golfregion haben? Wie wird sich die gegenwärtige revolutionäre Stimmung auf die Museumsarbeit auswirken? Lässt sich eine Veränderung in der Wahrnehmung der Ausstellungspraktiken nach dem 11. September feststellen? Ist die Idee „Kunstszene nach dem11. September“ vielleicht schon orientalistisch? Gerade der Vorwurf einer stereotypisierten Sichtweise scheint zu einem verstärkten Bemühen um eine weitere Differenzierung des westlichen Blicks auf globale Kunstzusammenhänge geführt zu haben. Wenn man beachtet, dass die GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 vermeintlich klischeehaften Ausstellungen den kritischen Blick der wissenschaftlichen Forschung auf sich gezogen und somit verstärkte Bemühungen hin zu einer differenzierten Sichtweise angeregt haben, ließe sich eine Veränderung in der Wahrnehmung der Ausstellungspraktiken nach dem 11. September feststellen. Die Fragestellung wäre also nicht orientalistisch, wenn tatsächlich eine Zäsur feststellbar ist und diese eine höhere Sensibilität für orientalistische Sichtweisen befördert hat. Die Bewusstmachung der Klischees – wie dies das einführende Werkbeispiel Interview with three artists 69 von Mo Nabil gezeigt hat – ist der erste Weg zu einer Befreiung von Vorurteilen. Kuratoren und Publikum werden durch die Kritik des Künstlers und die neu angeregten Debatten mit ihren zu wenig reflektierten Rezeptionsbedürfnissen konfrontiert und können ihre Wertungen revidieren. Dann hätte der Künstler aufklärerische Arbeit geleistet. Man kann von einer Öffnung sprechen, die aber noch nicht vorgedrungen ist zur Annahme einer gleichberechtigten, nicht durch politische Diskurse verzerrten Wahrnehmung der arabischen Kunst. Michaela Kamburowa, Kulturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin, hat an verschiedenen Ausstellungsprojekten mitgearbeitet, u. a. im Haus der Kulturen der Welt, Berlin, und im Museum Kunstpalast, Düsseldorf. Sie ist seit 2010 Ausstellungsmanagerin von Qatar Museums Authority in Doha, Katar. Nach ihrem Studium der Arabistik bei Prof. Angelika Neuwirth wirkte Lotte Fasshauer als Mitarbeiterin am Martin-Gropius-Bau, Berlin, u. a. an der Ausstellung: „Taswir – Islamische Bildwelten und Moderne“ mit. 2010 folgte ein Promotionsstipendium am Orient-Institut in Beirut. Sie promoviert über das Werk des libanesischen Autorenfilmers und Videokünstlers Ghassan Salhab im Kontext zeitgenössischer Kunstpraktiken im Libanon. Copyright: Goethe-Institut e. V., Fikrun wa Fann November 2011 Kultur-Boom in Abu Dhabi http://universes-in-universe.org/deu/nafas/articles/2007/kulturboom_in_abu_dhabi de, en, ar, fa GOETHE-INSTITUT ART&THOUGHT / FIKRUN WA FANN 96 IMPRESSUM ART&THOUGHT - FIKRUN WA FANN 50. (10.) Jahr, Nr. 96 (Nr. 21), Juni – November 2011 Herausgeber: Goethe-Institut e.V. Chefredakteur: Stefan Weidner Anschrift des Herausgebers: Goethe-Institut e.V. Dachauer Str. 122 D-80637 München Deutschland Redaktionsbüro: Stefan Weidner Art&Thought / Fikrun wa Fann Pralat-Otto-Müller-Platz 6 50670 Köln Deutschland Das Kulturmagazin Art&Thought des Goethe-Institut e.V. erscheint zweimal jährlich in Englisch, Arabisch (Fikrun wa Fann), und Farsi (Andishe va Honar). ISSN 0015-0932 Das Magazin Art&Thought / Fikrun wa Fann können Sie auch in unserem Goethe-Webshop bestellen: http://shop.goethe.de [email protected] http://www.goethe.de/fikrun 70