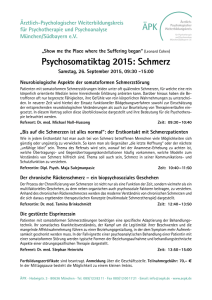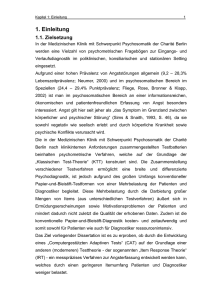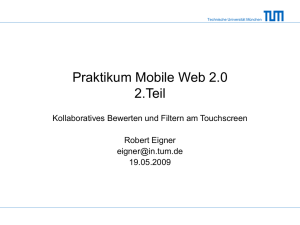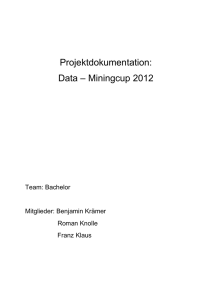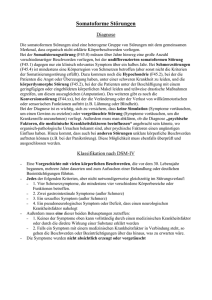Subjektive Krankheitskonzepte von Patienten mit somatoformen
Werbung

Aus der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychosomatik Abteilung für Psychotherapeutische Medizin und Psychotherapie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Subjektive Krankheitskonzepte von Patienten mit somatoformen Symptomen und ihre Veränderung im Rahmen der hausärztlichen Behandlung INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Medizinischen Doktorgrades der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau vorgelegt 2004 von Michael Ney geboren in Schaffhausen/ Saar Dekan: Prof. Dr. med J. Zentner 1. Gutachter: Priv. Doz. Dr. med. K. Fritzsche 2. Gutachter Prof. Dr. med. J. M. Hermann Jahr der Promotion: 2004 Danksagung Bedanken möchte ich mich bei Herrn Priv. Doz. Dr. med. Kurt Fritzsche, Oberarzt an der Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg für die Anregung des Themas dieser Arbeit und die Betreuung in den verschiedenen Phasen der Studie. Von ihm habe ich viele Anregungen bekommen, nicht nur zu dieser Arbeit sondern auch für meine klinische Tätigkeit. Mein Dank gilt ebenso Frau Dipl.-Psych. Astrid Larisch, die mich in vielen methodischen und inhaltlichen Fragen orientiert und unterstützt hat. Diese Arbeit wäre ohne das Engagement und Interesse der beteiligten Hausärzte und Hausärztinnen und ihrer Mitarbeiterinnen nicht möglich geworden. Mein Dank gilt daher ganz besonders: Frau Dr. med. G. Blatter, Steinen-Höllstein Herrn Dr. med. A. Boock, Pfaffenweiler Herrn Dr. med. Th. Eisele; Waldkirch Frau Dr. med. H. Forstreuter-Walbert; Freiamt Herrn Dr. med. B. Gläsker; March Herrn Dr. med. J. Götz, Freiburg Herrn Dr. med. P.-J. Kuben, Emmendingen Herrn Dr. med. A. Kühn, Müllheim Frau Dr. med. A. Ladous, Bad Krozingen Herrn Dr. med. V. Lenz, Emmendingen Herrn Dr. med. N. Niepelt; Albbruck Frau Dr. med. S. Renner, Freiburg Herrn Dr. med. J. Schirmer, Freiburg Herrn Dr. med. G. Schneider; Freiburg Herrn Dr. med. W. Stunder, Zell a. Hamersbach Frau Dr. med. A. Tritschler, Laufenburg Schließlich danke ich meiner Frau, Frau Dr. med. Brigitte Krings-Ney, die mich mit dem Projekt „Hausärztliche Versorgung von Patienten mit somatoformen Störungen“ in Verbindung gebracht hat, an dem wir gemeinsam über weite Strecken beteiligt waren. Ihr und unseren beiden Kindern sei diese Arbeit gewidmet. Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung................................................................................................................. 1 2. Subjektive Krankheitstheorien und Ursachenvorstellungen: Theoretische Grundlagen........................................................................................... 4 2.1. Begriffsbestimmung.......................................................................................... 4 2.1.1. Subjektive Theorien und verwandte Begriffe ........................................... 5 2.1.2. Attribution................................................................................................. 7 2.1.3. Begrifflichkeit der vorliegenden Arbeit.................................................... 9 2.2. Funktionen von Kausalattributionen und subjektiven Krankheitstheorien..... 10 2.2.1. Symptomwahrnehmung .......................................................................... 11 2.2.2. Kontrolle ................................................................................................. 13 2.2.3. Coping..................................................................................................... 14 2.2.4. Behandlungserwartungen und Compliance ............................................ 16 2.2.5. Subjektive Theorien in der Kommunikation Arzt-Patient...................... 18 2.2.6. Verantwortlichkeit und Schuld ............................................................... 20 2.3. Entstehung von Attributionen und subjektiven Theorien ............................... 21 2.4. Erfassung von Kausalattributionen und subjektiven Krankheitstheorien....... 23 3. Somatoforme Störungen: Begriffsbestimmung.................................................. 26 4. Krankheitskonzepte bei Patienten mit somatoformen Störungen ................... 29 4.1. Zum Konstrukt der Somatisierung.................................................................. 29 4.2. Gibt es krankheitsspezifische Konzepte? ....................................................... 32 4.3. Empirische Befunde........................................................................................ 33 4.4. Zusammenfassung .......................................................................................... 38 5. Fragestellungen und Hypothesen ........................................................................ 40 6. Methodik................................................................................................................ 42 7. 6.1. Setting der Untersuchung................................................................................ 42 6.2. Durchführung der Untersuchung .................................................................... 44 6.3. Messinstrumente ............................................................................................. 51 6.4. Statistische Auswertung.................................................................................. 54 Ergebnisse.............................................................................................................. 56 7.1. Wie sieht das Krankheitskonzept von Patienten mit multiplen somatoformen Symptomen aus? ......................................................................................................... 56 7.2. Verändert sich das Krankheitskonzept der Patienten mit somatoformen Symptomen im Laufe der Therapie? .......................................................................... 67 7.3. Hat das Krankheitskonzept einen Einfluss auf das Behandlungsergebnis?.... 71 8. Diskussion .............................................................................................................. 73 9. Zusammenfassung ................................................................................................ 80 10. Literatur ................................................................................................................ 81 11. Anhang................................................................................................................... 92 1 1. Einleitung Patienten und Patientinnen mit somatisch nicht erklärbaren körperlichen Beschwerden sind ein sehr häufiges, alltägliches Phänomen in der hausärztlichen Praxis. Ein großer Teil der Patienten zeigt die Beschwerden nur vorübergehend und lässt sich durch einen negativen medizinischen Befund beruhigen. Ein kleinerer Teil zeigt deutliche Chronifizierung (KRIEBEL et al. 1996). Diese Patienten gelten als schwierig, frustrierend, zeitraubend (COLLYER, 1979; LIN et al., 1991; zit. nach SENSKY et al., 1998). Sie sind mit ihren wiederholten Forderungen nach Diagnostik und Therapie kostenintensiv und verbrauchen einen unangemessen hohen Anteil der Ressourcen des Gesundheitssystems (LANGEWITZ et al., 1998, SENSKY et al., 1998, SMITH et al., 1986). Struktur und Honorierungssystem der ambulanten medizinischen Versorgung leisten der wechselseitigen Frustrierung von Ärzten und Patienten Vorschub und tragen somit zur Chronifizierung der somatoformen Beschwerden bei. Immer noch werden technische und apparative Leistungen gegenüber zeitintensiven Gesprächsleistungen besser honoriert. Dies ist unter vielen anderen ein Zeichen dafür, dass auch Jahre nach der Einführung der „Psychosomatischen Grundversorgung“ in die Weiterbildungsordnungen und die ärztlichen Gebührenordnungen der geforderte Paradigmenwechsel hin zu einem biopsychosozialen Modell von Erkrankungen (UEXKUELL, 1986) noch nicht stattgefunden hat. Weiterhin beherrscht die Schulmedizin mit ihrem Medizinischen Modell an den Universitäten die Krankenversorgung, die Forschung und die Lehre (WIRSCHING 2000) und setzt sich fort bis in die Primärversorgung in der hausärztlichen Praxis. Die Grundannahmen des Medizinischen Modells gehen letztlich zurück auf die Ablösung der alten Humoralpathologie durch die VIRCHOW`sche pathologische Anatomie bzw. das von KOCH und PASTEUR geprägte Modell der Infektionskrankheiten im 19. Jahrhundert. Die in dieser Tradition stehende Vorstellung von Krankheit impliziert nach NÜBLING (1992, S.58): • eine eindeutige Zuordnung zu den digitalen Kategorien „gesund“ oder „krank“ • die Möglichkeit einer eindeutigen Diagnosestellung und deren Abgrenzung zu anderen Krankheiten (Differentialdiagnose) sowie • eindeutige Handlungsanweisungen für den Arzt bzgl. Therapie (Indikation) im Sinne einer Wenn-dann-Zuordnung von Diagnose zu Therapie. 2 Dieses Medizinische Modell hat sich bei akuten Erkrankungen bewährt, weswegen es seit Ende des 19. Jahrhunderts die medizinische Wissenschaft dominiert. Während dieses Modell bereits bei chronischen somatischen Erkrankungen an seine Grenzen kommt (ENGEL, 1977, zit. bei MYRTEK, 1998), zeigt es sich unzureichend in der Auseinandersetzung mit und der Behandlung von Symptomen ohne (ausreichende) organische Erklärung, bei somatoformen Störungen. Doch auf diesem skizzierten Modell beruht einerseits nach wie vor die universitäre medizinische Ausbildung, steht die Sozialisation der Ärzte und Ärztinnen. Andererseits diffundiert dieses Modell auch in die Vorstellungen von Laien über Krankheit (PETERS et al., 1998, COPE et al., 1993). So ist eine Störung der Kommunikation zwischen Patient und Arzt vorprogrammiert, wenn erster eine (abnorme) körperliche Wahrnehmung als Symptom, d.h. als Krankheitszeichen präsentiert und letzter, in der Regel nach Ausschluss verschiedener möglicher Ursachen, keine für beide plausible Kategorie zur Verfügung hat, in die das Symptom einzuordnen und damit zu behandeln wäre. Erklärungskonzepte von Arzt und Patient für die Genese der Beschwerden sind nicht kongruent. Oder ähnlich wie LANGEWITZ et al. (1998) formulieren: Patienten klagen über Beschwerden, die ihre Ärzte nicht verstehen und Ärzte präsentieren Erklärungen (oder auch Nicht-Erklärungen), die ihre Patienten nicht verstehen. Dieses Kommunikationsproblem ist bei somatoformen Störungen so charakteristisch, dass es in der ICD-10 (DILLING et al., 1991) als diagnostisches Kriterium neben der eigentlichen Symptomatik zur Diagnosestellung herangezogen wird: „Das Charakteristikum der somatoformen Störungen ist die wiederholte Darbietung körperlicher Symptome in Verbindung mit hartnäckigen Forderungen nach medizinischen Untersuchungen trotz wiederholter negativer Ergebnisse und Versicherung der Ärzte, dass die Symptome nicht körperlich begründbar sind. Sind aber irgendwelche körperlichen Symptome vorhanden, dann erklären sie nicht das Ausmaß der Symptome oder das Leiden und die innerliche Beteiligung des Patienten. Auch wenn Beginn und Fortdauer der Symptome eine enge Beziehung zu unangenehmen Lebensereignissen [...] aufweisen, widersetzt sich der Patient gewöhnlich den Versuchen, die Möglichkeit einer psychischen Ursache zu diskutieren.[...] Das zu erreichende Verständnis für die körperliche und psychische Verursachung der Symptome ist häufig für Patienten und Arzt enttäuschend.“ 3 Aus dem Gesagten wird deutlich, dass es in der Auseinandersetzung mit und der Behandlung von Patienten mit somatoformen Symptomen unumgänglich ist, sich mit den Vorstellungen zu beschäftigen, die diese Patienten von ihren Beschwerden haben. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem zentralen Ausschnitt aus diesen komplexen Vorstellungen, den Ursachenvorstellungen. Sie werden dort untersucht, wo im Medizinalsystem die erste Anlaufstelle der betroffenen Patienten ist und wo in der Mehrzahl der Fälle auch die Behandlung erfolgt: in der Primärversorgung, der hausärztlichen Praxis. Insbesondere soll untersucht werden, • welche Vorstellungen betroffene Patienten von der Verursachung ihrer Beschwerden haben • ob es Zusammenhänge zwischen Ursachenvorstellungen und Symptomatik gibt • und welchen Verlauf die Ursachenvorstellungen während der hausärztlichen Behandlung im Rahmen der Psychosomatischen Grundversorgung einerseits und spezifischer psychosozialer Interventionen andererseits haben. Damit soll ein Beitrag geleistet werden zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Arzt/ Ärztin und Patient/ Patientin1, wenn es um organisch nicht erklärbare Beschwerden geht, und damit nach Möglichkeit zur Verbesserung der Behandlung dieser Beschwerden. 1 Im folgenden wird jeweils die männliche Bezeichnung Verwendung finden, auch wenn beide Ge- schlechter in gleicher Weise gemeint sind. 4 2. Subjektive Krankheitstheorien und Ursachenvorstellungen: Theoretische Grundlagen 2.1. Begriffsbestimmung Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Verhältnis zwischen Arzt und Patient in einem absoluten hierarchischen Gefälle gesehen: Auf der einen Seite der (all)wissende Arzt, der über das gesicherte universitäre Expertenwissen verfügt, auf der anderen Seite der unwissende, hilflose und hilfesuchende Patient. Diese Sicht wurde von PARSONS (1951, zit. nach MYRTEK, 1998 und ZENZ et al., 1996) in der Definition der Krankenrolle fixiert. Doch diese Rollendefinition wurde und wird dem Alltag im Medizinsystem nicht gerecht, vermag nicht die komplexe Beziehung zwischen Arzt und Patient zu beschreiben. Abweichungen von dieser idealisierten Rollenverteilung wurden als Störungen2 verstanden. Hiervon ausgehend setzten sich seit den 1950er Jahren die medizinische Psychologie wie die Sozialpsychologie und die Medizinsoziologie zunehmend mehr mit den Vorstellungen auseinander, die sich Laien und insbesondere betroffene Laien, nämlich Patienten, von körperlichen wie psychischen Beschwerden und Erkrankungen machen. Im Folgenden soll zunächst das begriffliche Rahmenwerk skizziert werden, in dem Arbeiten stehen, die sich mit Vorstellungen von Laien bzw. Patienten befassen. Die Richtung weisen dabei vor allem zwei Konstrukte, die sich mit entsprechenden Forschungstraditionen verbinden, welche ihrerseits vielfältige Querverbindungen aufweisen: 1. Subjektive Theorien (von Krankheiten) 2. Attributionen (zu Symptomen oder Krankheiten) 2 So benennt der Volkskundler SCHENDA (1976, zit. nach FALLER, 1983) als „Störfaktoren“: Selbstmedi- kation, Aberglauben, Nichtbefolgen ärztlicher Vorschriften, Praxis- und Krankenhausangst, Iatrophobie, Patientenaggressivität, unlauteres Heilgewerbe, Heilpraktikerwesen, Flucht in die Krankheit, Kommunikationsbarrieren zwischen Patient und Arzt 5 2.1.1. Subjektive Theorien und verwandte Begriffe Der Bergriff der „subjektiven Theorie“ meint allgemein den Sachverhalt, dass Subjekte Wissen und Erklärungsmuster über bestimmte Zusammenhänge ausbilden, die dann in ihr Handeln einfließen. Die Grundannahmen hinter diesem Begriff legen nahe, dass das Subjekt im Alltag ähnlich dem Wissenschaftler bestimmte Annahmen über sich und die Welt hat. Diese Annahmen hängen in sich zusammen und sind thematisch miteinander verknüpft (FLICK, 1998). Der Begriff basiert u.a. auf KELLYS Psychologie der personalen Konstrukte. KELLY (1955, zit. nach FLICK, 1998, S.9) geht von der grundsätzlichen Vergleichbarkeit des alltäglichen und wissenschaftlichen Denkens und Schließens aus, wofür er die Formel „man the scientist“ prägt. Damit setzt er sich kritisch mit dem Behaviorismus auseinander. Im Behaviorismus galt eine Unterschiedlichkeit der Menschenbilder für den Forscher als planendes und Hypothesen bildendes Subjekt und den Erforschten als lediglich auf äußere Reize reagierendes Objekt . Die Beschränkung des Begriffes auf rein kognitive Prozesse greift jedoch insbesondere da zu kurz, wo der Gegenstand der Theorie hoch mit Emotionen beladen ist, wie es bei Krankheiten der Fall ist. Darauf (und auf die damit verbundenen methodischen Probleme) weist z.B. FALLER (1989) hin. Auch lässt die Forderung der Parallelität mit wissenschaftlichen Theorien die spezifischen Funktionen außer acht, die subjektive Theorien von wissenschaftlichen unterscheiden (s.u.). Begriffe, die äquivalent (je nach Autor auch ohne die Restriktion auf rein kognitive Prozesse) verwandt werden sind: „Naive Theorien“, „Alltagstheorien“, „Laientheorien“, „Lay theories“. Subjektive Krankheitstheorien FALLER (1997) definiert „Subjektive Krankheitstheorien“ als die „Vorstellungen von Patienten über das Wesen, die Entstehung und die Behandlung ihrer Erkrankung“. Über diesen spezifischen Bereich subjektiver Erfahrung, nämlich Krankheit, hinaus implizieren FALLER und andere Autoren mit diesem Begriff weitere Aspekte: 6 Gerade bei subjektiven Krankheitstheorien sind die emotionalen Anteile solchen Wissens und der darin eingeflossenen Erfahrungen und Befürchtungen zu berücksichtigen (FALLER, 1989; VERRES, 1989, FLICK, 1998). Auch impliziert der Begriff spezifische Funktionen, die eine Vielzahl von Autoren insbesondere im Umgang mit der Erkrankung, deren Bewältigung und der Regulation der damit verbundenen Ängste sehen (s.u., Kapitel „Funktionen“). BISCHOFF und ZENZ (1989) betonen darüber hinaus zwei Aspekte, die medizinische Laien- von Expertentheorien unterscheiden: Die Rollendefinition in der Arzt-PatientBeziehung sowie die persönliche Betroffenheit durch die Krankheit. (S.13) Die FALLER´sche Definition subjektiver Krankheitstheorien entspricht weitgehend der Definition von „lay illness models“, die ROBBINS und KIRMAYER (1991, S. 1029)3 geben: „Lay illness models include ideas about the identity, cause, time course, consequences and curability of the condition.“ In derselben Weise sind auch weitere, in englischsprachigen Publikationen verwandte Begriffe beschrieben und definiert: lay theories of illness, illness schemata, illness perceptions, illness representations, illness beliefs, illness cognitions (SCHARLOO & KAPTEIN, 1997, S. 103f). Krankheitskonzepte Auch dieser Begriff steht in der Tradition des Konstruktes der „subjektiven Theorie“ mit der Betonung krankheitsbezogener Kognitionen. Jedoch lässt dieser Begriff parallele, nicht unbedingt kausal-logisch und zu einem quasi-wissenschaftlichem Theoriesystem verknüpfte Kognitionen zu. LINDEN (1985) definiert „Krankheitskonzept“ als „die Summe aller Meinungen, Deutungen, Erklärungen und Vorhersagen bezüglich Störungen des Gesundheitszustandes eines Menschen“. Krankheitskonzepte haben, nach diesem Autor, wesentlichen Einfluss auf die Krankheitswahrnehmung, die Kooperationsbereitschaft und die Behandlungszufriedenheit eines Patienten. 3 in Anlehnung an LEVENTHAL et al. (1980) und LAU und HARTMAN (1983) (zit. n. ROBBINS und KIRMAYER, 1991 und SCHARLOO & KAPTEIN, 1997, S. 104) 7 LANGEWITZ et al. (1998) sprechen von (erklärenden) Krankheitskonzepten bzw. Erklärungskonzepten ohne diesen Begriff exakt zu definieren. Jedoch scheinen sie damit ein eher loses Aggregat von Vorstellungen zu Krankheitsursachen zu meinen, ohne sich auf die Begrenzungen des Begriffs der subjektiven Krankheitstheorie zu beziehen. Ausführlich gehen sie auf kognitive Prozesse bei Arzt und Patient ein, die wesentlich von den erklärenden Krankheitskonzepten gesteuert werden und die wiederum sekundär zu emotionalen und motorischen Reaktionen führen. 2.1.2. Attribution Die meisten Medizinpsychologen bedienten sich der Begriffe und Methoden der der Sozialpsychologie entstammenden Attributionstheorien, um Patientenkonzeptionen von Beschwerden und Krankheiten zu beschreiben und zu kategorisieren (ZENZ & BISCHOFF, 1989) Attributionstheorien gehen wesentlich auf HEIDER (1958) zurück, der sich in seiner „Psychologie der interpersonalen Beziehungen“ mit der „common-sense-Psychologie“ befasst. Für HEIDER ist es „ein wichtiges Prinzip der common-sense-Psychologie und auch der Wissenschaftstheorie im Allgemeinen, dass der Mensch die Realität erfasst und sie vorhersagen und kontrollieren kann, indem er vorübergehende und veränderliche Verhaltensweisen und Ereignisse auf relativ unveränderliche zugrundeliegende Bedingungen bezieht, die sogenannten dispositionalen Eigenschaften seiner Welt“ (1977: S.99). In dieser Tradition beschäftigen sich Attributionstheoretiker „mit den Ursachen, mit denen der „Mann auf der Straße“ Ereignisse, Handlungen und Handlungsergebnisse erklärt“ (WEINER, 1994). So stehen im Zentrum des Interesses die Prozesse der Kausalattribution von Umweltbedingungen. Theorien zur Kausalattribution haben im allgemeinen vier hauptsächliche Grundannahmen gemeinsam, die sich z.T. bereits aus dem o.g. Zitat HEIDER´s ergeben (SENSKY, 1997; s.a. LANGOSCH, 1996): • Attributionstheorien sind im wesentlichen kognitive Theorien, basieren auf der zentralen Rolle, die Kognitionen für Verhalten, Affekte und Erfahrungen spielen. 8 • Individuen sind grundsätzlich motiviert kausale Erklärungen zu suchen. • Individuen sind daran interessiert, die Realität zu erfassen und bedienen sich dabei Methoden ähnlich derer der Wissenschaft. • Der Prozess des Bildens von Kausalattributionen ist adaptiv, dient der Adaption des Individuums an seine Umwelt, bzw. nach HEIDER (1958) der Vorhersagbarkeit und Kontrolle der Umwelt. Die Attributionstheorie wird zunächst von der Leistungs- und Motivationspsychologie übernommen (s.a. WEINER, 1986), um dann in den siebziger Jahren weite Verbreitung in der Sozialpsychologie zu erlangen. Diese Tatsache ist nach WEINER (1986) unter anderem auch dadurch zu erklären, dass zu dieser Zeit generell kognitive Ansätze vermehrt Bedeutung in der Psychologie bekamen. In der Klinischen Psychologie verhalf die attributionstheoretische Betrachtung der Depression zu einem neuen Verständnis dieser Störung im Modell der erlernten Hilflosigkeit nach SELIGMAN (1975). Dimensionen von Kausalattributionen Alle Ursachen von Ereignissen lassen sich nach WEINER (1986, 1994) durch drei Eigenschaften kategorisieren: • Sie sind entweder innerhalb (internal) oder außerhalb (external) des Handelnden lokalisiert (Lokationsdimension). • Sie sind über die Zeit stabil oder instabil (Dimension der Stabilität). • Sie sind durch den Handelnden willentlich kontrollierbar und veränderbar oder unkontrollierbar und unveränderbar (Dimension der Kontrollierbarkeit). In einer anderen Terminologie werden Attributionen auch differenziert in Situation (Umweltbedingungen, vorbestehende/ vorgegebene Umstände) und Disposition (z.B. persönliche Charakteristiken) (ROBBINS und KIRMAYER, 1991). Nach KELLEY (1971, zit. bei ROBBINS und KIRMAYER, 1991) kommen dispositionale Attributionen nur dann zum Tragen, wenn ein Ereignis unabhängig von situationalen Faktoren auftritt. Übertragen auf die wahrgenommenen Ursachen körperlicher Symptome bedeutet dieses Prinzip, dass Individuen, wenn irgend möglich, Symptome „normalisierend“ erklären, indem sie diese situativen Faktoren zuschreiben. Nur dann wenn eine solche normalisierende Attribution offensichtlich unzureichend ist, werden Symptome dispositionalen 9 Quellen zugeschrieben wie körperlicher Krankheit, übermäßigen Sorgen oder konstitutioneller Schwäche (ebd.). In Bezug auf die Wahrnehmung von Symptomen und Erkrankungen können dispositionale Kausalattributionen weiter unterschieden werden in psychologische und physische (organische/ somatische) Ursachen. Diese Unterscheidung lege sowohl die Forschung zu Symptomwahrnehmung als auch das biomedizinische Modell nahe, das die ärztliche Diagnostik leite (ebd.). Auch in den Arbeiten zur subjektiven Krankheitstheorie erscheint diese Dichotomie psychisch versus somatisch regelmäßig wieder. BISHOP konnte 1987 mit Hilfe einer multidimensionalen Skalierung ebenfalls die Achse physisch versus psychisch als eine von vier Dimensionen zur Klassifikation häufiger somatischer Symptome identifizieren, neben den Dimensionen ansteckend, Aktivitäten unterbrechend und oben/ unten im Körper. Die statistische Methode der multidimensionalen Skalierung sieht BISHOP als besonders vorteilhaft zur Untersuchung von Symptominterpretationen an, da sie ohne theoretische Vorannahmen des Untersuchers auskomme und die intuitive Zuordnung durch die Testpersonen erfasse. SENSKY (1997) betont die Unterscheidung zwischen komplexen und einfachen Attributionen. Bei einfachen Attributionen bedingt eine einzelne Ursache eine einzelne Wirkung. Da diese Attributionen leicht unter experimentellen Bedingungen überprüft werden können, haben sie nach SENSKY häufig im Fokus experimenteller sozialpsychologischer Untersuchungen gestanden. Dagegen seien selbst einfache Laienmodelle von Erkrankung und Behandlung von komplexen und oft voneinander unabhängigen Attributionen geprägt. 2.1.3. Begrifflichkeit der vorliegenden Arbeit Wie die vorangegangenen Abschnitte zeigen, gibt es unterschiedliche Begriffssysteme, die sich zum Teil parallel entwickelt haben, viele Überschneidungen aufweisen und sich gegenseitig ergänzen. Verwirrend ist, dass in vielen Arbeiten die Begriffe synonym oder nicht klar voneinander abgegrenzt verwandt werden. Auch im Folgenden werden wegen der wechselseitigen Bezüge und der sich daraus ergebenden thematischen Überschneidungen die Begriffe häufig gemeinsam betrachtet. Funke (1989) führt die Begriffe zusammen, indem er Attributionen als quasi kleinste kognitive Einheit subjektiver Theorien beschreibt. 10 Die vorliegende Arbeit übernimmt den Begriff des Krankheitskonzeptes nach NÜBLING (1992, S. 61), fokussiert dabei aber auf den Bereich der Ursachenkonzepte - im Sinn, wie auch z. B. LANGEWITZ et al. (1998) diesen Begriff verwandten: als loses, nicht kausal-logisch organisiertes Agglomerat von Vorstellungen zu Krankheitsursachen. In diesem Sinn zu verstehen ist auch das wesentliche Untersuchungsinstrument des empirischen Teils dieser Arbeit, der von Nübling (1992) entwickelte KKU. Wenn auch anhand der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten des Fragebogens Krankheitskonzepte bei somatoformen Beschwerden erfasst werden sollen, untersucht die vorliegende Arbeit ausgehend davon lediglich einen speziellen Aspekt davon: die Attribution der Ursachen auf psychosoziale versus somatische Faktoren. 2.2. Funktionen von Kausalattributionen und subjektiven Krankheitstheorien Wie bereits erwähnt, gehen die Attributionstheorien davon aus, dass Menschen grundsätzlich dazu motiviert sind, Ereignisse Bedingungen zuzuschreiben, und dass diese Zuschreibungen „funktional“ sind für die Auseinandersetzung mit diesen Ereignissen. Eine Vielzahl von Arbeiten untersucht diese Funktionalität von Kausalattributionen. FINK (1998) umreißt die Funktionen von subjektiven Theorien und grenzt sie damit von wissenschaftlichen Theorien ab: Subjektive Theorien haben andere Funktionen als wissenschaftliche. Sie • dienen der Situationsdefinition und ermöglichen eine rasche Lagekodierung. • ermöglichen eine nachträgliche Erklärung eingetretener Ereignisse. • ermöglichen eine Vorhersage künftiger Ereignisse. • erleichtern die Entwicklung von Handlungsempfehlungen. • haben (z.T.) handlungssteuernde bzw. -leitende Funktion. • dienen der Stabilisierung bzw. Optimierung des Selbstwertes. Einige Aspekte der Funktionen von Attributionen und subjektiven Theorien sollen näher betrachtet werden, insbesondere solche, die für das Verständnis von somatoformen Störungen bedeutsam sind und dafür, wie Patienten mit diesen Störungen umgehen. 11 2.2.1. Symptomwahrnehmung Einen besonderen Einfluss auf das Verständnis somatoformer Symptome hatten Theorien zur Symptomwahrnehmung. Diese gehen wesentlich auf Untersuchungen von PENNEBAKER (1982) zurück. Dieser beschäftigte sich mit der Frage, warum eine bestimmte Person aus einer unüberschaubaren Vielzahl (patho-)physiologischer Zustände auf bestimmte Zustände bzw. deren Veränderungen aufmerksam wird, diese als Beschwerden wahrnimmt, sie einer bestimmten Kategorie zuordnet und entsprechend darauf reagiert. Auch wenn Symptome im Allgemeinen auf aktuellen physiologischen Veränderungen beruhen, sind diese allein nicht ausreichend, um die Erfahrung körperlicher Symptome zu erklären. Nach GIJSBERS VAN WIJK & KOLK (1997) lassen sich die Annahmen der Theorien zur Symptomwahrnehmung zusammenfassen: Individuen haben eine begrenzte Aufnahmekapazität bezüglich Informationen, die gleichzeitig verarbeitet werden können. Potentielle Informationen liegen innerhalb und außerhalb von Individuen vor; es gibt eine ständige Konkurrenz zwischen inneren und äußeren Reizen. Wahrnehmung ist zum Einen ein von den Daten abhängiger Prozess („von unten nach oben“): Welche Information ausgewählt wird, ist zum Teil abhängig von der Quantität und Qualität der verfügbaren inneren und äußeren Stimuli. Wahrnehmung ist zum Anderen auch ein von Konzepten abhängiger Prozess („von oben nach unten“): Welche Information ausgewählt wird, ist zum Teil abhängig von Kognitionen und Persönlichkeitszügen des Individuums. Beide Richtungen der Wahrnehmungsprozesse erfolgen gleichzeitig; welche Strategie zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherrscht, hängt von der Deutlichkeit und Intensität der verfügbaren Information einerseits und der Stärke spezifischer Kognitionen und Persönlichkeitszüge andererseits ab. Im weiteren Verlauf der Informationsverarbeitung spielen Attributionsprozesse eine entscheidende Rolle; derselbe Stimulus kann zunächst multiple, somatische oder nichtsomatische Interpretationen hervorrufen. 12 Abbildung 1 Modell der Symptomwahrnehmung nach GIJSBERS VAN WIJK & KOLK, 1997: externe Information Emotionen psychologische Attribution Physiologie interne (somatische) Information psychologische Symptome somatische Wahrnehmung Pathologie Umwelt selektive Aufmerksamkeit auf den Körper somatische Attribution somatische Symptome - subjektive Gesundheit Krankheits- Krankenrolle verhalten - medizinische Inanspruchnahme Somatisation negative Affektivität PENNEBAKER (1982, zit. nach GIJSBERS VAN WIJK & KOLK, 1997) konnte zeigen, dass Personen nicht nur passiv Informationen aufnehmen, sondern aktiv nach solchen suchen (im Körper oder in der Umwelt), und zwar nach solchen, die vorbestehende Hypothesen bestätigen. Diese selektive Suche nach hypothesen-konsistenten Informationen sei geleitet von kognitiven Schemata. Solche Schemata können durch die Situation induziert sein oder auch stabile Dispositionen der Person sein. Somatisierung als allgemeine Neigung, Symptome somatischen Ursachen zuzuschreiben, ist in diesem Sinn als stabiler Persönlichkeitszug gedacht. Neben der schema-geleiteten selektiven Suche nach Informationen sind Schemata ebenso verantwortlich für die Interpretation von Informationen und deren Benennung als (z.B. körperliches oder psychisches) Symptom. Die wahrgenommene Ursache von Symptomen generiert wiederum neue, korrespondierende Hypothesen über die wahrscheinliche Ursache neuer körperlicher oder emotionaler Sensationen. In diesem Sinn gibt es eine wechselseitige Beeinflussung von Symptomen und ihren Interpretationen, wie ROBBINS & KIRMAYER (1991) ausführen: eines fördert die Suche nach dem anderen. Nach ROBBINS & KIRMAYER (1991) können Attributionsstile, also die Disposition, Attributionen in eine bestimmte Richtung vorzunehmen – normalisierend, somatisierend 13 oder psychologisierend – als ein Ausdruck der zugrundeliegenden Schemata angesehen werden. 2.2.2. Kontrolle Attributionstheoretische Arbeiten stellen immer wieder die Dimension der Kontrollierbarkeit wahrgenommener Ursachen als eine der zentralen Dimensionen von Kausalattributionen heraus (s.a. WEINER, 1994). Schon HEIDER (1958) vertritt die These, dass der Attributionsmotivation des Laien ein Kontrollbedürfnis zugrunde liegt. Indem der Laie relevante Ereignisse auf stabile Ursachen zurückführt, versetzt er sich in die Lage, Maßnahmen zu ihrer Kontrolle zu ersinnen und zu erproben. Je nach Definition bzw. Untersuchungs-Instrument sehen einige Autoren Kontrollattributionen als eigenständiges Konstrukt. Neben Kausalattributionen bezeichnen sie eine von fünf Dimensionen im Rahmen von umfassenderen Krankheitskognitionen bzw. – Theorien (Wesen der Erkrankung, Ursache, Konsequenzen, Verlauf und Kontrollierbarkeit; s. SCHARLOO & KAPTEIN, 1997). HASENBRING (1989) stellt die prospektive Bedeutung von Kontrollattributionen der eher retrospektiven Bedeutung von Kausalattributionen gegenüber. Im Rahmen vieler Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Krankheitskonzepten und Krankheitsverhalten4 wird dem Faktor Kontrolle (internal versus external) eine zentrale Rolle beigemessen. Insofern verdient dieser Aspekt der Krankheitskonzepte eine besondere Betrachtung im Rahmen der Überlegungen des Wechselspiels zwischen Kausalattributionen und Krankheitsverhalten. Als Beispiel für Arbeiten, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen sei die Untersuchung von OSTKIRCHEN und WILLWEBER-STRUMPF (1989) referiert, die mit einer Vorgängerversion des Patiententheorie-Fragebogen von ZENZ et al. (1996) Laientheorien von chronisch-rheumatischen Patienten untersuchten. Da das Erleben einer chronischen, mit Schmerzen und Funktionseinbußen einhergehenden Erkrankung in mehrerlei 4 siehe dazu die Übersicht von SCHARLOO & KAPTEIN, 1997, S. 111 ff 14 Hinsicht dem einer somatoformen Störung gleichen dürfte, sei im Rahmen der vorliegenden Arbeit näher auf diese Untersuchung eingegangen. Der verwandte Fragebogen geht nicht primär von attributionstheoretischen Überlegungen aus, sondern bündelt aus klinischen Beobachtungen hervorgegangene Aussagen zu entsprechenden Items auf fünf Skalen zur Kategorisierung von Krankheitsursachen. Die Autorinnen der genannte Untersuchung revidieren diese Skalen. Anhand einer Faktorenanalyse können sie drei Faktoren identifizieren; den wichtigsten davon (25,2 % Varianzaufklärung) bezeichnen sie mit „Kontrollverlust“. Zum einen unterstreicht dies erneut die Dimension Kontrolle im Rahmen von Kausalattributionen. Zum anderen könnte in diesem Faktor, wie die Autorinnen anmerken, möglicherweise „in geringerem Maße die Ursache der Erkrankung, sondern vielmehr bereits die Folge der täglichen Auseinandersetzung mit den Beschränkungen durch die Krankheit zum Ausdruck kommen“ (S. 129). Diese Überlegung bestätigt auch den von VERRES (1989) betonten Aspekt des prozessualen und kontextabhängigen Charakters von Kausalattributionen. Jenseits der schwer zu klärenden Frage, in welchem Maße in Krankheitskonzepten genuine Ursachenattributionen bzw. kognitive Bewältigungsstrategien zum Ausdruck kommen, zeigt sich am Befund von OSTKIRCHEN und WILLWEBER-STRUMPF (1989) der enge Zusammenhang zwischen vorgestellter Ursache, dem Erleben und der Bewältigung von Erkrankung mit dem Faktor der wahrgenommenen Kontrolle als vermittelnde Instanz dieser Ebenen. 2.2.3. Coping Coping, also der Umgang mit einer bestehenden Krankheit, z.B. im Sinn eines Bewältigungsversuches, ist ein wesentlicher Aspekt des Krankheitsverhaltens. In der Betrachtung der Funktionalität von krankheitsbezogenen Attributionen und subjektiven Theorien wird daher seit Beginn dieser Forschungstradition der Einfluss von Attributionen und Theorien auf das Coping untersucht. Eine Vielzahl von Arbeiten beziehen sich auf die Zusammenhänge zwischen (Kausal-)Attributionen und Coping bei körperlichen und psychischen Erkrankungen sowie weiteren sozialen Stigmata. Auch BALINT (1964) machte auf die wichtige Rolle der Krankheitsvorstellungen der Patienten für die Krankheitsbewältigung aufmerksam. 15 LEVENTHAL, MAYER und NERENZ (1980) postulierten im kognitiven Modell der Selbstregulierung, dass Patienten implizite Krankheitstheorien dazu gebrauchen, Krankheiten hinsichtlich ihrer Ursachen und Entstehung zu verstehen und damit ihr eigenes Gesundheitsverhalten zu regulieren (zit. nach THEBALDI, 1996). Eine Übersicht über beispielhafte Arbeiten zu dieser Thematik gibt SCHWARZER (1994). In der Mehrzahl der Studien scheint eine internale Attribution mit einer besseren Bewältigung einherzugehen. Bedeutsam ist dabei die Unterscheidung zwischen einer internalstabilen Attribution als dispositionale Selbstzuschreibung und einer internal-variablen Attribution als verhaltensbezogene Selbstzuschreibung („characterological self-blame“ versus „behavioral self-blame“ [JANOFF-BULMAN, 1979, zit. bei SCHWARZER, 1994, S.214]). Insbesondere eine internal-variable Attribution scheint für ein adäquates Coping förderlich. Deutlich wird dies aus den Untersuchungen an querschnittsgelähmten Unfallopfern (WORTMANN, 1977, und FREY, 1992, beide zit. bei SCHWARZER, 1994): Unfallopfer, die die Ursache des Unfalls wesentlich auch auf die eigene Person zuschreiben, zeigen eine bessere Bewältigung ihres Schicksals. Dabei sahen diese Patienten den Unfall als nicht vermeidbar, also als außerhalb ihrer Kontrolle an. Im Gegensatz dazu wird häufig als vermittelnder Faktor die Kontrolldimension von Kausalattributionen mit ihrem Einfluss auf Selbstwirksamkeits-Erwartungen herangezogen (MARSCHALL & FULLER, 1989, s.a. LANGOSCH, 1996: S. 18). Nach MYRTEK (1998) stellen kausale Attributionen eine determinierende Variable des Krankheitsverhaltens dar (S. 222). Wie sich Kausalattributionen auch dysfunktional auf das Krankheitsverhalten und damit den Behandlungserfolg auswirken können, zeigt MYRTEK am Beispiel von Infarktpatienten: Es gibt Hinweise, dass Infarktpatienten mit externalen Attributionen (Stress, Schicksal, Pech, usw.) einen ungünstigeren Verlauf der Erkrankung zeigen, vermutlich durch ihre geringere Motivation, die Risikofaktoren zu verändern (S. 218). Entgegen vielfältigen anderen Befunden (s.u.) belegt MYRTEK am Beispiel dieser Patientengruppe eine erhebliche Diskrepanz zwischen kausalen Attributionen und Behandlungserwartungen: Trotz der (psychologisierenden) StressAttribution stehen somatisch orientierte Behandlungserwartungen im Vordergrund (ebd.). SCHWARZER (1994) referiert einige weitere Untersuchungen, die den erwarteten Zusammenhang von Attributionen mit der Art der Bewältigungsbemühungen bei chronischen körperlichen Erkrankungen in Frage stellen. 16 VERRES (1989) lenkt die Betrachtungsweise auf die umgekehrte Abhängigkeit der Krankheitskonzepte vom Coping, von der situativen Bewältigung einer Krankheit und den mit ihr verbundenen Emotionen. Neben „persisitenten subjektiven Krankheitstheorien im Sinne von Überzeugungen“ gibt es demnach „Kognitionen, die als Ausdruck eines Abwehrmechanismus interpretiert werden können“ (S.19) und somit situativ variabel sind, z.B. abhängig vom jeweiligen Ausmaß der eigenen Betroffenheit. 2.2.4. Behandlungserwartungen und Compliance Compliance, die Befolgung ärztlicher Anordnungen, ist Teil der Krankenrolle (im Sinn von PARSONS, 1951, zit. nach ZENZ & al., 1996, S 8). Nach dem Health Belief Modell setzen Patienten bei einer Erkrankung den Aufwand der Behandlung in Beziehung zum erwarteten Erfolg und zeigen nur dann Compliance, wenn der Nutzen den Aufwand übersteigt. Dieses Abwägen hängt davon ab, was Patienten über die Krankheit denken, was die negativen Konsequenzen der Krankheit sein könnten und wie empfänglich sie sich selbst hinsichtlich solcher negativen Konsequenzen einschätzen (MYRTEK, 1998: S. 60 ff). Bereits zu Beginn der Beschäftigung mit subjektiven Vorstellungen von Patienten zur Entstehung ihrer Beschwerden und zu den Erwartungen an eine Behandlung stand das Bemühen im Vordergrund, mangelnde aktive Beteiligung der Patienten am (psycho-) therapeutischen Geschehen zu verstehen und Grundlagen zur Verbesserung der „Compliance“ zu erfassen. Vor diesem Hintergrund erschien 1968 eine medizinische Dissertation zum Thema „Krankheitstheorien und Behandlungserwartungen psychosomatischer Patienten (PLAUM, 1968). Diese war (im deutschsprachigen Raum) der Ausgangspunkt für zahlreiche weitere Untersuchungen zu Krankheitstheorien von Patienten. BECKER (1984) betont: „Gelingt eine Verständigung zur subjektiven Krankheitstheorie zwischen Arzt und Patienten nicht, kann dies einer der Hauptgründe für sogenannte Non-Compliance im therapeutischen Prozess sein.“ Auch LINDEN (1985) unterstreicht den Einfluss von Krankheitskonzepten von Patienten auf das Gesundheitsverhalten und insbesondere die Compliance der Patienten, insbesondere auch in Psychiatrie und Psychotherapie. 17 Das Problem (mangelhafter) Compliance, des Nicht-Befolgens einer Behandlung ist untrennbar mit der Frage verbunden, welche Art der Behandlung Patienten und Patientinnen erwarten. Daher ist seit Beginn der Untersuchungen zu subjektiven Krankheitstheorien immer wieder auch die Frage nach den Behandlungserwartungen gestellt worden, wie auch schon der Titel der erwähnten Arbeit von PLAUM (1968) zeigt. ZENZ et al. (1989) sehen die enge Korrelation zwischen Krankheitstheorien und Behandlungserwartungen im Kontrollmotiv der Attributionsmotivation begründet. Die Behandlung soll Faktoren außer Kraft setzen oder in Schach halten, die nach der Laientheorie ursächlich für die Beschwerden sind (S. 149). Dementsprechend sind psychosoziale Ursachenvorstellung mit der Erwartung psychosozialer Interventionen des Arztes verbunden, die Überzeugung einer physikalisch-somatischen Verursachung entsprechend mit somatischen Therapiemaßnahmen. Diese Hypothese wird in einer Vielzahl von Untersuchungen verifiziert, sowohl. bei Psychotherapiepatienten (PLAUM, 1968, SCHEER & MÖLLER, 1976, FALLER, 1997, NÜBLING, 1992, als auch bei Patienten in Allgemeinpraxen (ZENZ & KELLER, 1978). SCHEER & MÖLLER sowie NÜBLING gehen soweit, Behandlungserwartungen und Ursachenvorstellungen als konzeptuelle Bestandteile eines beide Bereiche übergreifenden Krankheitskonzeptes zu verstehen. Dagegen relativiert die erwähnte Untersuchung von MYRTEK (1998) ebenso wie die von FAHRENBERG et al. (1985, zit. bei MYRTEK, 1998: S.159) die Übereinstimmung von Kausalattributionen und Behandlungserwartungen. In der Studie von LANGOSCH (1996) zeigte sich eine entsprechende Übereinstimmung lediglich bei Patienten mit psychischen Ursachenvorstellungen, nicht eindeutig jedoch bei solchen mit anderen Ursachenvorstellungen. Diese Frage nach dem Zusammenhang von Behandlungserwartungen und Ursachenvorstellungen berührt besonders die Behandlung von Patienten mit somatoformen Störungen. Wenn gemäß der Definition nach ICD-10 Patienten mit somatoformen Störungen sich „gewöhnlich den Versuchen [widersetzen], die Möglichkeit einer psychischen Ursache zu diskutieren“ (DILLING et al., 1991), ist es nach der Mehrzahl der erwähnten Autoren nicht zu erwarten, dass sie für psychosoziale Interventionen offen sind. 18 2.2.5. Subjektive Theorien in der Kommunikation Arzt-Patient Patienten treten dem Arzt mit ihren mehr oder weniger stark ausgeprägten Krankheitskonzepten gegenüber, die sich mehr oder weniger stark von denen des Arztes unterscheiden und mit diesen konkurrieren. So treten zwei Interaktionspartner gegenüber, die Diagnose und Therapieplan miteinander aushandeln (s.a. BALINT, 1964). Wie oben ausgeführt, stehen Ursachenvorstellungen in engem Bezug zu Behandlungserwartungen und allgemein zur wahrgenommenen Kontrolle über die bedrohlich erscheinende Situation Erkrankung. In diesem Sinn müsste die vom Arzt angebotenen Theorie der Patiententheorie überlegen sein, d. h. sie muss dem Patienten Kontrollmöglichkeiten eröffnen, die effizienter sind als die in der Krankheitstheorie des Patienten implizierten Kontrollmöglichkeiten (ZENZ et al., 1989). Schon von daher ist es für den behandelnden Arzt unumgänglich, Kenntnisse von der Theorie seiner Patienten zu haben, spätestens dann, wenn sich am Problem der mangelnden Compliance oder - in psychoanalytischer Terminologie - des Widerstandes, differierende Konzepte manifestieren. ZENZ et al. (1989) untersuchten, ausgehend von diesen Überlegungen, ob Patienten ihre Theorien und Behandlungserwartungen äußern, und welches Arztverhalten die Äußerung fördert. Sie fanden, dass besonders Patienten mit psychosozialen Krankheitstheorien diese auch im Gespräch mit ihrem behandelnden Hausarzt äußern, und zwar um so mehr, je empathischer sich der Hausarzt verhält. Empathie wurde dabei entsprechend gesprächspsychotherapeutischer Forschungen durch das Ausmaß der Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte (VEE) operationalisiert. Dieser Befund zeigte sich trotz der durchweg sehr niedrigen (aber auf niedrigem Niveau unterschiedlichen) VEE-Werte im kleinen Kollektiv (n = 3) der teilnehmenden Allgemeinmediziner. Die Autoren folgern: „Sofern der Arzt auch nur ein bisschen auf die Gefühle des Patienten eingeht, beginnt der Patient psychosoziale Krankheitstheorien vorzutragen, und er äußert auch entsprechende Therapieerwartungen. Hingegen wird die Äußerung naturalistischer Theorien durch einen auf die Gefühle eingehenden Gesprächsstil der Ärzte eher gehemmt.“ Aber es gelte auch umgekehrt: „Sofern der Patient psychosoziale Krankheitstheorien und Therapieerwartungen vorträgt, geht der Arzt seinerseits auf die Gefühle ein, die in ihnen aufscheinen“ (S. 158). 19 PETERS et al. (1998) diskutieren eine Hypothese, die ebenfalls den Einfluss von Patiententheorien auf die Kommunikation mit und das Verhalten von Ärzten betrachtet: Danach äußern Patienten mit medizinisch nicht erklärbaren Symptomen im Gespräch mit Ärzten medizinische Vorstellungen, um stärker in der Interaktion mit Ärzten zu sein, und so Antwort einzufordern in Richtung einer medizinischen Behandlung (SALMON & MAY, 1995; MARCHANT-HAYCOX & SALMON, 1997, zit. nach PETERS et al., 1998). In ihrer Untersuchung kommen sie jedoch zum Schluss, dass für die Autorität von Patienten in der Interaktion weniger medizinische Ideen verantwortlich sind, jedoch (u.a.) ihre aktiven Bemühungen beim Bilden und Prüfen von Erklärungen für ihre Symptome. Das Laiensystem hat dabei medizinische Erklärungen übernommen; diese können dann dazu dienen, vorbestehende kulturelle Vorstellungen auszudrücken. Becker (1984) betrachtet neben den subjektiven Krankheitstheorien des Patienten auch die des Arztes und stellt fest, dass beide, Arzt und Patient, in der Tradition „magischen“ Denkens stehen. So muss sich auch der Arzt und die Ärztin über sein bzw. ihr Denken und die davon geprägten, nicht nur wissenschaftlichen Vorstellungen bewusst werden. In diesem Sinn plädiert Becker für eine Verbesserung der Arzt-Patient-Beziehung, die dann auch einer besseren Compliance zugute kommt. LANGEWITZ et al. (1998) stellen das Kommunikationsproblem zwischen Arzt und Patient, das letztlich auf unterschiedlichen Krankheitskonzepten der beiden Interaktionspartner beruht, ins Zentrum der Betrachtung somatoformer Störungen. „Somatoforme Störungen werden als mehrschichtiges Kommunikationsphänomen verstanden: zum einen als ein individueller Interpretationsvorgang, bei dem ein Individuum körperlichen Wahrnehmungen bestimmte Bedeutungen zuteilt (intraindividuelle Kommunikation zwischen wahrnehmenden und bewertenden Bewusstseinsanteilen), zum anderen als eine Kommunikation zwischen Patient und Arzt, bei der die Äußerungen des jeweiligen Gegenübers mit den Laien- bzw. professionellen Konzepten zu verwertbaren Zeichen „umkodiert“ werden.“ LANGEWITZ et al. fokussieren in diesem Zusammenhang ebenfalls die Bedeutung des Krankheitskonzeptes des Behandlers. Am Beispiel einer typischen Wahrnehmung eines Patienten mit linksthorakalen Schmerzen, die dieser als Symptom „Mein Herz tut weh“ präsentiert, schildern die Autoren das Schicksal einer Arzt-Patienten-Kommunikation. Nach Ausschluss einer KHK tritt für den Arzt an die Stelle des Symptoms „das Herz tut weh“ das Symptom „Beschwerde ohne Ursache“. Die Autoren führen aus: “Falls dem 20 Arzt für dieses Symptom ein erklärendes Konzept fehlt, wird die Kommunikation an dieser Stelle unterbrochen; ohne ein verknüpfendes Konzept erhält dieses Symptom nicht die Bedeutung eines Indikators einer Diagnose....Falls allerdings... das Symptom ‘Beschwerde ohne Ursache’ eine andere Bedeutung bekäme, nämliche die eines Indikators für das mögliche Vorliegen einer somatoformen Störung, erscheint möglich, dass das weiterhin bestehende Interesse das ärztliche Suchverhalten auf das Vorliegen weiterer unspezifischer Symptome lenkt.“ 2.2.6. Verantwortlichkeit und Schuld Nach WEINER (1994) bedeutet „die Klassifikation einer Ursache als kontrollierbar ... nicht nur, dass diese Ursache willentlich verändert werden kann, sondern impliziert auch persönliche Verantwortlichkeit... Zusammenfassend schließen somit Wahrnehmungen von Kausalität Annahmen von persönlicher Verantwortlichkeit mit ein.“ WEINER zeigt im Weiteren, insbesondere an stigmatisierten, z.B. kranken, Personen auf, wie Urteile über Verantwortlichkeit Emotionen (Ärger bzw. Mitleid) und Hilfeverhalten bedingen. So führt bei Testteilnehmern die Wahrnehmung, ein Betroffener trage persönliche Verantwortung für sein Stigma, zu Ärger und fehlendem Hilfeverhalten. Dagegen scheinen unkontrollierbare Stigmata beim Beobachter Mitleid hervorzurufen und Hilfeintentionen zu begünstigen. Nach WEINER folgen in diesem Modell Emotionen auf die Ursachenzuschreibung, und die Emotionen gelten ihrerseits als handlungsleitend. (Zu einer Diskussion über diesen Ansatz s.a. SCHWARZER, 1994: S. 221 ff). In einem Umkehrschluss der WEINER´schen Argumentation lässt sich die Beobachtung von BECKER (1984) verstehen, der bei einem Drittel der von ihm interviewten Mammakarzinom-Patientinnen Vorstellungen von Schuld und Strafe findet: Die Idee von Schuld impliziert eine eigene Verantwortung für die Erkrankung und somit die Zuschreibung von Kontrolle. BECKER deutet seinen Befund jedoch als Beleg für das Wirken von „magischen“ Denkmustern bei Patienten. Auf der anderen Seite zitiert BECKER SONTAG (1978), die als selbst betroffene Patientin darlegt, wie durch eine psychosomatische Sichtweise einer Krebserkrankung auf Zusammenhänge zwischen Krankheit und Persönlichkeit hingewiesen wird und dies zu einer schuldhaften Verarbeitung unter dem Gesichtspunkt von Eigenverantwortlichkeit führt. 21 Für somatoforme Störungen könnten diese Überlegungen bedeuten, dass das Festhalten an einem somatischen Krankheitskonzept und die Ablehnung einer psychosozialen Sichtweise (die als stigmatisierend wahrgenommen wird) mit dem Zurückweisen einer Eigenverantwortlichkeit im Sinne eines Eigenverschuldens verknüpft ist. Wie auch die Behandler in diesem Prozess von Schuldzuweisung und –zurückweisung bei somatisierenden Patienten involviert sind, kommentieren KIRMAYER et al. (1994). In der klinischen Praxis werden diese Patienten mit einer Reihe pejorativer Attribute belegt; auch die wissenschaftliche Tradition der Untersuchung von Persönlichkeitsvariablen bei Somatisierern ist davon nicht frei. Dies könne, so KIRMAYER et al., die Tendenz ausdrücken, solche Patienten als persönlich verantwortlich (und damit moralisch schuldig) zu sehen für die Verursachung, Verstärkung oder Übertreibung ihrer Probleme und die Zurückweisung der angebotenen medizinische Hilfe. 2.3. Entstehung von Attributionen und subjektiven Theorien Über die Entstehung von Attributionen, Attributionsstilen und subjektiven Theorien gibt es verschiedene theoretische Ansätze. Verbreitet und einflussreich auch für therapeutische Strategien sind kognitiv-psychologische Theorien, die sich mit der Ausbildung von Attributionen (quasi die kleinste kognitive Einheit subjektiver Theorien befassen, s. FUNKE, 1989). Auf HEIDER (1958) und KELLEY (1967, beide zit. nach FOERSTERLING, 1994) geht das Kovariationsprinzip zurück. Danach schließen Personen aus systematischen Kovariationen zwischen Effekten und Bedingungen auf die Ursachen. Neben Kovariationsbeobachtungen gibt es noch weitere Mechanismen, die die Ursachenvorstellungen bestimmen, so z.B. zeitliche und räumliche Kontiguität von Ereignis und potentieller Ursache sowie Ähnlichkeit zwischen beiden (FOERSTERLING, 1994, s. dort auch Hinweise auf entsprechende empirische Arbeiten). Attribuieren und Bilden von Theorien kann als kognitives „Verhalten“ betrachtet werden und unterliegt als solches denselben Lernmechanismen wie Verhalten allgemein. Auf die Rolle operanter Konditionierung und Modellernen bei der Ausbildung von Krankheitsverhalten (bei dem ja attributionale und kognitive Aspekte eine große Rolle spielen), weist MYRTEK (1998) hin. Auch PENNEBAKER (1983) betont lebens- und lerngeschichtliche Bedingungen für die Ausbildung von – wie es in seiner Terminologie heißt – Schemata und Hypothesen. Er schreibt: „In addition to these relatively transient 22 hypotheses, more long-lasting hypotheses concerning body state are often the result of socialisation, traumatic experiences... or even classical or instrumental conditioning” (zit. nach GIJSBERS VAN WIJK & KOLK, 1997). ROBBINS & KIRMAYER (1991) zeigen, dass der individuell bevorzugte Attributionsstil (somatisierend oder psychologisierend) mit einer jeweilig entsprechenden Krankheitsvorgeschichte zusammenhängt Eine rein kognitive Sicht von Attributionen und subjektiven Theorien wurde vielfach kritisiert. So weisen z.B. Arbeiten von VERRES (1989), FALLER (1989) und KAUDERERHÜBEL et al. (1989) auf die wechselseitige Abhängigkeit von Attributionen und Emotionen hin. VERRES (1989) betont den prozessualen Charakter subjektiver Krankheitstheorien. Deren Entstehung und Modifikation ist demnach in hohem Maße vom Stand der aktuellen Krankheitsverarbeitung mit der entsprechenden emotionalen Beteiligung bedingt. VERRES schreibt: „Der Stand der Entwicklung einer jeweiligen subjektiven Krankheitstheorie hängt stark von der persönlichen Betroffenheit im Sinne eines Berührtseins ab“ (1989, S. 20). Becker (1984) betrachtet neben den individuellen Bedingungen von subjektiven Krankheitstheorien (die er in psychodynamischer Terminologie beschreibt) auch soziokulturelle und historische Bedingungen. Danach bilden sich subjektive Krankheitstheorien aus folgenden Einflüssen aus: • Art und Dauer der Erkrankung • Lebensgeschichte und Persönlichkeit • Herrschende Wissenschaftstheorie • Magisches Denken • Reaktives Kausalbedürfnis „Magisches Denken“ bedeutet nach Becker ein vorwissenschaftliches Denken mit religiösen, animistischen und vitalistischen Konzepten (selbst handelnde Natur). Damit verbunden sind Vorstellungen von Schuld und Strafe im Rahmen subjektiver Krankheitstheorien. Auch KIRMAYER & YOUNG (1998) erweitern die Betrachtung von Attributionen und Theorien um eine kulturelle Perspektive, insbesondere was das Konstrukt der Somatisierung betrifft: „Somatization is a concept that reflects the dualism inherent in a Western cultural ideology of the person“ (S.427). Dagegen existiert dieser Dualismus zwischen Körper und Psyche in den meisten großen Medizintraditionen (z.B. Ayurveda oder Chinesische Medizin) nicht. Entsprechend sind subjektive Krankheitstheorien in 23 anderen medizinischen Traditionen von deren jeweils eigenen Begrifflichkeit geprägt. Hiermit beschäftigen sich zahlreiche ethnomedizinische Untersuchungen (z.B. KOHNEN, 1997). Einen Überblick über ethnomedizinische Arbeiten zu dieser Thematik gibt auch LANGOSCH (1996). 2.4. Erfassung von Kausalattributionen und subjektiven Krankheitstheorien Methoden zur Diagnostik erkrankungsbezogener Kausalattributionen und subjektiver Krankheitstheorien lassen sich grob unterteilen in qualitatitive und quantitative. Qualitative Zugänge bestehen in der Verwendung offener oder halbstrukturierter Interviews. Nach SCHARLOO & KAPTEIN (1997) verwandten die meisten Autoren diese Methoden zur Erforschung von Krankheitskonzepten bei chronischen körperlichen Erkrankungen. Interviews werden anschließend mit unterschiedlichen Methoden ausgewertet. Auf methodische Probleme bei der Interpretation von Interview-Daten gehen VERRES (1989) und Flick (1998: S. 24 ff) ein. Die begrenzte Aussagekraft solcher Interviewdaten, bei denen als inhaltsanalytische Kriterien die „a-priori“-Konzepte des Untersuchers dienen wurde mehrfach kritisiert (z.B. FALLER, 1983). Um eine solche Verzerrung zu vermeiden, entwickelten z.B. in der Untersuchung von PETERS et al. (1998) unterschiedliche Auswerter die Kriterien sukzessive aus den Interviews heraus. Fragebögen geben in der Regel eine unterschiedlich lange Liste von möglichen Krankheitsursachen vor. Die Befragten sollen die Wahrscheinlichkeit der vorgegebenen Aussagen anhand einer mehrstufigen, sog. LIKERT-Skala einschätzen. Die Items können klinischen Beobachtungen entstammen, als häufige oder „typische“ Äußerungen von Patienten, spiegeln aber auch oft mehr oder weniger explizit die Hypothesen der Testkonstrukteure wieder. Mit Hilfe einer Faktorenanalyse können Items zu einer begrenzten Anzahl von Faktoren geordnet werden; die Faktoren oder Skalen werden vorzugsweise anhand der am höchsten ladenden Items benannt und interpretiert (s.a. Faller, 1983). Als eine der ersten Arbeiten, die auf diese Weise Krankheitskonzepte empirisch zu erfassen versuchte, gilt die Dissertation von PLAUM (1968, zit. nach NÜBLING, 1992). Dieser untersuchte 49 Patienten einer psychosomatischen Universitäts-Ambulanz hin- 24 sichtlich ihrer „Krankheitstheorien und Behandlungserwartungen“ mit einem 49 Items umfassenden Fragebogen (31 zu Ursachen und 18 zu Erwartungen). Die Auswertung von 30 brauchbaren Datensätzen ergab hinsichtlich der Ursachenvorstellungen drei Variablencluster („Einstellungstypen“): Typ I organisiere seine Erkrankung psychisch, Typ II körperlich und Typ III hat keine konsistente Krankheitstheorie, er neige zu psychosozialem Fehlverhalten. Spätere Untersuchungen modifizierten den Plaum`schen Fragebogen und kamen zu veränderten Faktorenstrukturen. Beispielhaft seien folgende Arbeiten genannt (weitere bei NÜBLING, 1992): • SCHEER & MÖLLER (1976) untersuchten „Krankheitskonzepte psychotherapeutischer Patienten“ bei 80 Studenten, die eine universitäre psychotherapeutische Beratungsstelle aufgesucht hatten. Sie fanden drei bipolare Typen des Krankheitskonzeptes: „stressbezogen vs. psychologisch“, „körperbezogen vs. identitätsbezogen“ sowie „partnerbezogen vs. asthenisch“. • AHRENS und ELSNER (1981) verglichen die Krankheitskonzepte bei Ulcus-, Neurose- und somatischen Patienten. Sie eruierten einen einzigen bipolaren Faktor: „außenbezogenes stressorientiertes vs. innenbezogenes persönlichkeitsorientiertes Krankheitskonzept“. • ZENZ & KELLER (1978) legten die PLAUM´schen Items Patienten einer Allgemeinpraxis vor. Sie bildeten je zwei Skalen aus Krankheitsursachen („Humanitarismus“ und „Naturalismus“) und Behandlungserwartungen („psychosozial“ und „somatologisch“). • SCHEER et al. (1989) fanden bei akut kranken somatischen Patienten zwei Ursachenskalen: eine „psychosoziale Skala“ und eine „psychovegetative Skala“. Ausgehend von der Arbeit PLAUM´s, ihren eigenen Untersuchungen (ZENZ & KELLER, 1978) und weiteren Untersuchungen sowie attributionstheoretischen Überlegungen bildeten ZENZ, BISCHOFF & HRABAL (1996) (a priori) die Skalen „naturalistisch innen“, „naturalistisch außen“, „Gesundheitsverhalten“, „psychosozial innen“, „psychosozial außen“. Sie berücksichtigten so die Lokationsdimension von Kausalattributionen und den Aspekt der Selbstverantwortung. Entsprechend dieser Skalen konstruierten sie ihren Test (PATEF). Aus der Summe aller Antworten berechnen die Autoren einen „Gesamtscore als Indikator der Intensität, mit der sich der Patient mit den Ursachen seiner Krankheit beschäftigt“ (ebd., S. 11) 25 Auch der PUK („Persönlich erlebte Ursachen und Gründe für die Erkrankung“) von MUTHNY (1990) gibt potentielle Ursachenfaktoren vor; 20 Faktoren sind als Item formuliert; 7 Items sind zum Score „psychosoziale Belastungen“, 4 zu „Leistungsorientierung und Stress“ zusammengefasst. Eine Besonderheit des PUK ist, dass Probanden darüber hinaus auch den Grad der Bedrohlichkeit, die sie der einzelnen Erklärung beimessen, sowie frei formulierbare Ergänzungen und Erläuterungen anfügen können. NÜBLING (1992) bezieht sich bei der Konstruktion seines KKU, der auch in der vorliegenden Arbeit zur Anwendung kam, im wesentlichen auf den Fragebogen nach PLAUM. Die meisten Items übernimmt er, ergänzt sie durch Items aus dem PUK und aus Patientenäußerungen hergeleitete, selbst formulierte Items. Zu einer näheren Beschreibung dieses Instrumentes siehe Kap. 6 („Methodik“). WÄLTE et al. (1999) kritisierten die „klassischen“ Attributionsdimensionen Lokation, Stabilität, Kontrollierbarkeit und Globalität als unzureichend zur Abbildung von Krankheitsattributionen von Patienten. Vor diesem Hintergrund konstruierten sie ein Messinstrument, das die Einschränkungen bisheriger Instrumente überwinden sollte, zur Erfassung der Ursachenüberzeugungen von Patienten mit psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen. Dieser AFKA-I (Aachener Fragebogen zur Krankheitsattribution – Indexpatient) gibt 56 Items auf einer fünfstufigen Skala vor; diese lassen sich auf 8 Faktoren reduzieren (65% Varianzaufklärung): Familie, Selbst, Partnerschaft, Stress, Finanzen, Schicksal, Körper, Sucht. SCHEER et al. (1989) kritisieren den in Fragebögen realisierten Ansatz des „Gruppenvergleich auf Skalenebene“ als überholten Zugang, obwohl sie sich selbst dieses bedienen. Durch Fragebögen werde die Kontextabhängigkeit subjektiver Krankheitstheorien zu wenig berücksichtigt. Für kontextsensitive Erhebungsmethoden, die den lebensweltlichen Bedeutungshorizont der Befragten mit erfassen, plädiert vehement die Arbeitsgruppe um VERRES (VERRES, 1989). FALLER, selbst eher Verfechter der letztgenannten Haltung, diskutiert Vor- und Nachteile der verschiedenen methodischen Ansätze (im wesentlichen Interview vs. Fragebogen). So können Fragebögen durchaus sensitiver sein, wenn Patienten nur wenige spontane Äußerungen machen und auch Interviewer nicht alle relevanten Punkte berücksichtigen. Jedoch können auch Artefakte erzeugt werden, wenn Patienten, die sich aus Gründen ihrer emotionalen Bewältigungsstrategie nur zögernd auf eine Ursachensuche einlassen, forciert werden, eine Vielzahl von Items zu beurteilen (FALLER, 1989b: S. 101). 26 3. Somatoforme Störungen: Begriffsbestimmung Somatoforme Symptome sind definiert als körperliche Beschwerden, die nicht ausreichend auf eine organische Ursache zurückzuführen sind. Das Auftreten einzelner somatoformer Symptome ist nicht gleichbedeutend mit einer somatoformen Störung. Vorübergehende organisch unerklärte Körperbeschwerden, die nicht zum Anlass wiederholter Arztbesuche werden, gehören zur Normalität. Sie dürfen nicht mit den zur Chronifizierung neigenden somatoformen Störungen verwechselt werden (AWMF, 1998). Nach KELLNER (1987) nehmen 60% bis 80% der gesunden Bevölkerung einmal pro Woche körperliche Missempfindungen wahr. Nur wenn die körperlichen Beschwerden mit einem erheblichen subjektiven Leiden oder Beeinträchtigungen im sozialen, beruflichen oder familiären Lebensumfeld verbunden sind, kann nach DSM-IV (SASS et al. 1998) eine Diagnose aus der Gruppe der somatoformen Störungen gestellt werden. Die historischen Wurzeln des heutigen Begriffs der somatoformen Störungen liegen in der Bezeichnung „Hysterie“. Dieser Begriff wurde bereits in der Antike geprägt; er leitet sich vom griechischen Wort „Hystera“, Gebärmutter, ab. Damit verbunden war die Vorstellung, dass Bewegungen des Uterus bei Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch zu vielfältigen Beschwerden führen. Im Lauf der Geschichte wurde der Hysterie-Begriff in verschiedenen Bedeutungen verwandt; zwei Inhaltsbereiche lassen sich auch in den heutigen Konzepten nachweisen: Hysterie als Persönlichkeitszug, im Sinn der heutigen Bezeichnung der histrionischen Persönlichkeitsstörung sowie Hysterie als Krankheitsbild, das durch körperliche Beschwerden ohne organische Ursache umschrieben wird (RIEF 1996). Im letztgenannten Sinn machte der französische Psychiater BRIQUET 1859 erstmals den Versuch einer deskriptiven Erfassung des Störungsbildes der Hysterie, indem er eine Vielzahl von körperlichen und auch psychischen Beschwerden auflistete, die nach seinen Beobachtungen häufig in Kombination bei den betroffenen Patienten auftraten. Die Beobachtungen von BRIQUET wurden in den 1960er Jahren von der Arbeitsgruppe um GUZE in St. Louis aufgegriffen und weiterentwickelt. Die sogenannten St. LouisKriterien des „Briquet-Syndroms“ bildeten die Grundlage der Definition der „Somati- 27 sierungsstörung“ als Prototyp der neu formulierten diagnostischen Kategorie der somatoformen Störungen im amerikanischen Diagnosesystem DSM-III (APA 1980). Die Kriterien der somatoformen Störungen wurden in der aktuell gültigen Fassung des DSM-IV (APA 1994; dt. Bearbeitung SASS et al., 1998) mit Modifikationen prinzipiell übernommen. Sie dienten auch als Modell für die entsprechenden Kategorien im weltweit gültigen Diagnosesystem, der ICD-10 (WHO 1990, dt. Bearbeitung DILLING et al. 1991). In beiden Klassifikationssystemen werden die somatoformen Störungen im wesentlich durch eine bestimmte Anzahl von Beschwerden aus einer vorgegebenen Liste operationalisiert. Daneben kommen als diagnostische Kriterien auch Aspekte des Krankheitsverhaltens zum Tragen. Beide Klassifikationssysteme sind ähnlich, haben ähnliche Bezeichnungen für die Störungsbilder. Sie weisen jedoch Unterschiede sowohl in den Definitionen als auch in den Symptomlisten auf. Das führt teilweise zu Unsicherheiten in der Diagnosestellung und es macht Forschungsbefunde schwer vergleichbar. Zum Vergleich der beiden Diagnosesysteme s.a. KRINGS-NEY, 2002. Die Frage an ein Klassifikationssystem ist auch, ob sich die Gegebenheiten des Gesundheitswesens ausreichend darin abbilden lassen (RIEF 1995). So wurden die Kriterien für das Vorliegen einer Somatisierungsstörung , dem „Vollbild“ einer somatoformen Störung, vielfach als zu restriktiv kritisiert (RIEF & HILLER 1992). Es ergeben sich bei Anwendung dieser Kriterien sehr niedrige Prävalenzraten für das Vorliegen einer Somatisierungsstörung. NEUMER et al. (1998, zit. nach KRINGS-NEY 2002, S. 15) geben einen Überblick über epidemiologische Studien zur Somatisierungsstörung in der Normalbevölkerung. In diesen Studien werden Prävalenzen von 0,03% bis 1% genannt. Auch noch in der Primärversorgung ergeben sich niedrige Prävalenzen für die Somatisierungsstörung zwischen 0 und 6% (KRINGS-NEY, 2002), z.T. mit erheblichen Differenzen, je nachdem welches Diagnosesystem zur Anwendung kam. Im Praxis- und Klinikalltag stellen Patienten mit körperlichen Beschwerden ohne Organbefund jedoch eine große Gruppe dar. Auch wenn nach beiden Klassifikationssystemen die undifferenzierte Somatisierungsstörung (bzw. undifferenzierte somatoforme Störung) eine Restkategorie darstellt, kommt die undifferenzierte Somatisierungsstörung weitaus häufiger als die Somatisierungsstörung vor (SACK et al. 1998). Für die Diagnose einer undifferenzierten Somatisierungsstörung reicht ein einziges Symptom aus. Die Diskrepanz zwischen einem Symptom bei der undifferenzierten Somatisierungsstö- 28 rung und 8 Symptomen aus 4 verschiedenen Symptomgruppen für die Somatisierungsstörung (DSM-IV) ist groß. Vor diesem Hintergrund führten ESCOBAR et al. (1989) die sog. „abridged somatization disorder“ mit dem „Somatic Symptom Index“ (SSI) ein. Die Autoren schlugen vor, bereits bei 4 (bei Männern) bzw. 6 Symptomen (bei Frauen) aus der 35 Symptome umfassenden Liste der Somatisierungsstörung nach DSM-III von einer klinisch relevanten Störung zu sprechen. Dieser Somatisierungsindex nach ESCOBAR (SSI 4/6) konnte sich in einer Reihe weiterer empirischer Arbeiten als valides und praxisgerechtes Konstrukt behaupten; er gilt als gut geeignet, um Patienten mit dem Krankheitsbild einer charakteristischen somatoformen Störung unterhalb des Vollbildes einer Somatisierungsstörung zu beschreiben (SACK et al. 1998). 29 4. Krankheitskonzepte bei Patienten mit somatoformen Störungen 4.1. Zum Konstrukt der Somatisierung Der Begriff Somatisierung geht nach LIPOWSKI (1988) zurück auf die Anfänge des 20. Jahrhunderts und bezeichnete zunächst den Prozess, dass eine „tiefsitzende“ Neurose eine körperliche Störung produzieren könne. In psychoanalytischer Tradition wurde Somatisierung als unbewusster Abwehrmechanismus gesehen und erklärte so eine vermutete Psychogenese bestimmter körperlicher Störungen. LIPOWSKI greift den Begriff auf, definiert ihn aber neu: „...as a tendency to experience and communicate somatic distress and symptoms unaccounted for by pathological findings, to attribute them to physical illness, and to seek medical help for them. It is usually assumed that this tendency becomes manifest in response to psychosocial stress…”(S. 1359) BRIDGES und GOLDBERG (1985) definieren den Begriff operational anhand von vier Kriterien: • Konsultationsverhalten: Der Patient sucht medizinische Hilfe für somatische Symptome einer psychiatrischen Erkrankung, präsentiert aber keine psychischen Symptome • Attribution: Er attribuiert diese Symptome auf ein körperliches Problem. • eine psychiatrische Erkrankung liegt vor, diagnostiziert von einem Psychiater nach standartisierten Kriterien. • Besserung durch psychiatrische Behandlung: nach Meinung eines Psychiaters ist eine Besserung durch psychiatrische Behandlung zu erwarten. Diese und ähnliche Definitionen wurden wiederholt kritisiert (s.a. GIJSBERS VAN WIJK & KOLK, 1997), da sie von der Annahme ausgehen, dass es eine richtige, wirklichkeitsabbildende Art der Ursachenzuschreibung gebe, Patienten jedoch fälschlicherweise somatisch attribuieren anstatt ihr Problem als ein psychosoziales anzuerkennen. Zudem setzten die Kriterien von BRIDGES & GOLDBERG die Existenz eines quasi „neutralen“ Beobachters voraus. So ist der Begriff der Somatisierung für die Beschreibung von 30 Krankheitskonzepten bei Patienten mit somatoformen Störungen nur eingeschränkt sinnvoll, da er ja per Definition, á priori, von einer somatischen Attribution ausgeht. Auch BRIDGES & GOLDBERG (1985) weisen darauf hin, dass die definitorische Gleichsetzung von Somatisierung mit somatoformen Störungen unangebracht sei. Der Begriff solle vielmehr als ein allgemeiner psychologischer Mechanismus gesehen werden. Auch die Überlegungen von GIJSBERS VAN WIJK & KOLK (1997) nach der Symptom- wahrnehmungstheorie sehen in „Somatisierung“ einen intervenierenden Faktor (im Sinn einer Persönlichkeitseigenschaft), der zur Ausprägung eines bestimmten Krankheitsverhaltens, z.B. der Ausbildung einer subjektiven Theorie beiträgt. KIRMAYER & ROBBINS (1991) spezifizieren Somatisierung näher, indem sie drei Formen beschreiben, die sich zwar bei einer Reihe von Patienten überlappen, bei den meisten (82%) jedoch in „Reinform“ auftreten: • „Funktionelle Somatisierung“ als das Vorliegen multipler, organisch nicht erklärbarer, somatischer Symptome (also einer somatoformen Störung, z.B. im Sinn der „abridged somatization disorder“ nach ESCOBAR, 1989) • „Hypochondrische Somatisierung“ als hohes Maß von Krankheitsängsten beim Vorliegen milder körperlicher Symptome ohne diagnostischen Stellenwert. • „Präsentierende“ Somatisierung als ausschließliche Klage über körperliche Symptome einer psychischen Erkrankung, insbesondere Depression und Angststörung. Angesichts ihrer Beobachtung, dass viele Patienten in ihrem Attributionsverhalten flexibel scheinen, und dass dieses auch vom Gesprächspartner abhängt (in diesem Fall der forschende Psychiater bzw. der konsultierte Allgemeinarzt) sprechen BRIDGES & GOLDBERG (1985) von „pure“ und „facultative somatisation“. KIRMAYER & ROBBINS (1996) greifen diese Beobachtung auf und beschreiben bei somatisierenden Depressions- und Angstpatienten eine Übergangsreihe von „beginnend somatisierenden“ über „fakultativ somatisierenden“ zu „echt somatisierenden“ Patienten, die sie den Patienten gegenüberstellen, die ihre Beschwerden psychosozial präsentieren. Sie konnten so zeigen, dass trotz einer anfänglich somatischen Präsentation der Beschwerden die Mehrzahl der Patienten mit psychischen Störungen dennoch bereit sind, eine psychosoziale Mitverursachung anzuerkennen. Nur eine kleine Untergruppe der „echten Somatisierer“ widersetzt sich hartnäckig einer psychologischen Interpretation ihrer Problematik. Die Autoren machen jedoch keine Angaben darüber, inwieweit diese Befunde, erhoben bei „präsentierenden Somatisierern“ mit einer depressiven oder Angststörung auch auf 31 „funktionell somatisierende“ Patienten, also mit multiplen somatoformen Symptomen, übertragbar sind. In der Primärversorgung stellt in der Untersuchung von KIRMAYER & ROBBINS (1991) die Gruppe der „funktionell“ Somatisierenden, diagnostiziert nach dem SSI(4/6) nach ESCOBAR, die größte Gruppe. Sie stellt knapp die Hälfte aller Somatisierer mit einer Prävalenz von 16,6% der untersuchten Population (685 Patienten), gegenüber 7,7% „hypochondrischer Somatisierer“ und 8% „präsentierender Somatisierer“. Der Arbeit von Garcia-Campayo & Sanz-Carillo (1999) zufolge, die 8 Studien zu somatisierenden Patienten in der Primärversorgung verglichen, ist die vorherrschende Diagnose unter diesen Patienten eine generalisierte Angststörung, nicht etwa eine somatoforme Störung, die nur 15% aller Somatisierer betrifft (leider machen die Autoren keine Angaben zu den diagnostischen Kriterien einer somatoformen Störung). Bei KARLSSON et al. (1997) fanden sich in einer Population von 562 Patienten der Primärversorgung 96 „frequent attenders“, unter diesen 20,9% „psychiatrische“, überwiegend fakultativ somatisierende Patienten und 20,9% „chronisch somatisierende“ Patienten. In keiner dieser beiden Untergruppen wurde eine somatoforme Störung diagnostiziert. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit dem Begriff „Somatisierung“ noch kein eindeutiger Hinweis auf ein damit verbundenes Krankheitskonzept bei Patienten mit somatoformen Symptomen gegeben ist. Vielmehr bezeichnet Somatisierung einen psychischen Mechanismus oder Eigenschaft, interpretierbar möglicherweise als Persönlichkeitsdimension, die auf die Art der Ursachenattribution in unterschiedlich starkem Ausmaß Einfluss nimmt, und die bei verschiedenen Erkrankungen eine bedeutende Rolle spielt. 32 4.2. Gibt es krankheitsspezifische Konzepte? Bei der Frage nach Kausalattributionen und subjektiven Krankheitskonzepten bei Patienten mit einer somatoformen Störung stellt sich zunächst die Frage, ob es überhaupt störungsspezifische Attributionsstile oder Konzepte gibt. Bei der Betrachtung der dazu verfügbaren Literatur (Übersichten z.B. bei LANGOSCH, 1996; SCHARLOO & KAPTEIN, 1997) lässt sich trotz der unterschiedlichen theoretischen und methodischen Zugänge der jeweiligen Arbeiten feststellen, dass es keine so spezifischen Krankheitskonzepte gibt, die es erlauben würden, dadurch Erkrankungen oder Kategorien von Erkrankungen voneinander abzugrenzen. Die beschriebenen dimensionalen Strukturen von Attributionen bzw. subjektiven Theorien sind krankheitsübergreifend ähnlich (differieren wohl mit dem theoretischen Hintergrund der Arbeiten). Patientengruppen mit unterschiedlichen Diagnosen unterscheiden sich jedoch, wie einige Studien dazu feststellen, in der Ausprägung der Dimensionen von Attributionen/ Theorien. Doch auch dazu sind Befunde uneinheitlich. AHRENS & ELSNER (1981) verglichen in ihrer bereits oben erwähnten Untersuchung (Kap. 2.4) anhand eines Fragebogens neurotisch, psychosomatisch und somatisch Kranke hinsichtlich ihres Krankheitskonzeptes. Als beispielhaft für die Gruppe psychosomatisch kranker Patienten wurden Patienten mit endoskopisch gesichertem Ulcus duodeni ausgewählt (was aus heutiger Sicht diskussionswürdig ist). Diese wurden Patienten aus psychiatrisch-psychologischen Praxen und somatisch Kranken aus anderen Praxen gegenübergestellt (ohne weitere diagnostische Zuordnung in den beiden letztgenannten Gruppen). Die Autoren fanden, dass sich die Gruppen nur dann hinsichtlich ihres Krankheitskonzeptes unterschieden, wenn daneben auch noch die Antworttendenz, die die Häufigkeit der Beantwortung von Fragen misst, mitberücksichtigt wird. So ließen neurotische Patienten ein „innenbezogenes/ persönlichkeitsorientiertes Krankheitskonzept“ erkennen, die psychosomatischen (Ulkus-) Patienten aber ebenso wie die somatischen Patienten ein „außenbezogenes/ stressorientiertes Krankheitskonzept“. In der Antworttendenz unterschieden sich alle drei Gruppen signifikant voneinander; wobei Ulkuspatienten zwischen den beiden anderen Gruppen rangierten. SCHEER et al. (1989) untersuchten die Krankheitskonzepte bei akut kranken somatischen Patienten: Patienten mit einer Operation am offenen Herzen, solche mit einer konservativ-intensivmedizinisch behandelten Herzerkrankung (v.a. Myokardinfarkt) und Hepati- 33 tis-Patienten im akuten Stadium. Diese drei Patientengruppen konnten anhand des eingesetzten Fragebogens nicht voneinander differenziert werden. Der Fragebogen, glich dem in der vorher erwähnten Untersuchung von AHRENS & ELSNER (1981) und auch dem in der vorliegenden Untersuchung eingesetzten KKU von NÜBLING (1992). SCHEER et al. folgerten, dass das Krankheitskonzept zumindest in dieser Operationalisierung auf Skalenniveau unspezifisch hinsichtlich der Krankheit sei. 4.3. Empirische Befunde Es existiert eine Vielzahl von Untersuchungen zu Krankheitskonzepten bei Patienten mit definierten Diagnosen bzw. Diagnosegruppen, sowohl psychiatrischen als auch somatischen. Es sei hier nochmals auf die eingangs erwähnten Übersichten von LANGOSCH (1996) und SCHARLOO & KAPTEIN (1997) hingewiesen. Dagegen überrascht es, wie wenig Untersuchungen es hierzu bei Patienten mit somatoformen Symptomen bzw. Störungen (oder entsprechender älterer Termini) gibt, trotz einer zunehmenden Anzahl von Arbeiten insgesamt zu dieser Gruppe von Störungen. Dies steht im Gegensatz zur Bedeutung, die dieser Thematik im Allgemeinen bei dieser Patientengruppe beigemessen wird. Divergierende Krankheitskonzepte bei Arzt und Patient impliziert schon die Definition somatoformer Störungen nach ICD-10 (Dilling et al, 1991), ja macht dies quasi zum diagnostischen Kriterium. Die verfügbaren Studien sollen hier etwas ausführlicher referiert werden. NÜBLING (1992) untersuchte Patienten einer psychosomatischen Rehabilitationsklinik auf Psychotherapiemotivation, Vorstellungen zu Krankheitsursachen und Behandlungserwartungen anhand von ihm entwickelter bzw. weiterentwickelter Instrumente (zu einer näheren Beschreibung des Fragebogens zur Erfassung von Krankheitsursachen – KKU– s. Kap. 5). Er untersuchte Abhängigkeiten der genannten Variablen von einer Vielzahl von Patientenvariablen, z.B. soziodemographische Daten wie Alter, Versicherungsstatus, Schulbildung, Vorbehandlungen, Zuweisungsmodus etc.. So fand er signifikante Unterschiede der Mittelwerte der Ursachenskala „Psychische Ursachen“ in den diagnostischen Gruppen, nicht jedoch in den Skalen „Andere Ursachen“ und „Kindheit als Ursache“. Als Diagnosegruppen benannte NÜBLING: „Neurosen“ (n = 115), „funktionelle Störungen psychischen Ursprungs“ (n = 70), „psychogene Reaktionen“ (n = 36), „Persönlichkeitsstörungen“ (n = 13), „Psychosomatosen im engeren Sinn“ (n = 29) und „primär somatische Erkrankungen“ (n = 15). Die funktionellen Störungen, die wohl der 34 Kategorie der somatoformen Störungen in aktueller Terminologie zuzuordnen wären, hatten einen signifikant niedrigeren Mittelwert der Skala „Psychische Ursachen“ als die Neurosen und Persönlichkeitsstörungen (jeweils p<0,5). Interessant für die vorliegende Untersuchung ist auch, dass sich bei Patienten mit funktionellen Störungen die Mittelwerte der drei Skalen nicht wesentlich voneinander unterschieden: 47,6 für „psychische Ursachen“, 49,3 für „Andere Ursachen“ und 48,3 für „Kindheit als Ursache“ (S. 148 ff; leider fehlen hier Angaben zur Signifikanz). NÜBLING führte leider keine Varianzanalyse durch, um abzuschätzen, welche Faktoren – Diagnosegruppe oder andere Variablen – den wesentlichen Einfluss auf die Ursachenkonzepte haben. LANGOSCH (1996), die ebenfalls mit dem KKU nach NÜBLING subjektive Ätiologievorstellungen bei Patienten einer psychosomatischen Rehabilitationsklinik untersuchte, fand keinen Zusammenhang zwischen Diagnosen bzw. Diagnosegruppen und Krankheitskonzept-Skalen. (S.142). Ihre Stichprobe umfasste 91 Patienten, davon 56,7% mit psychiatrischen Diagnosen, einschließlich der n = 8 Patienten mit einem „psychovegetativen Syndrom“. FALLER (1998) erhob subjektive Krankheitstheorien bei Patienten einer psychotherapeutischen Universitätsambulanz mit einem Fragebogen, der 16 Items zu 4 Skalen bündelt: intrapsychische, soziale, interpersonelle und somatische Ursachen. Die Skala „somatische Ursachen“ umfasst drei Items: körperliche Erkrankung, schwacher Kreislauf, Wetterunverträglichkeit. FALLER weist darauf hin, dass zwischen den Skalen z.T. substantielle Interkorrelationen bestehen; lediglich die Skalen „interpersonell“ und „somatisch“ zeigen eine nur niedrige Korrelation. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt: 35 Tabelle 1: Unterschiede in Ursachenvorstellungen zwischen diagnostischen Gruppen (nach Faller, 1997) Ursachenvorstellungen Intrapsychisch Sozial Interpersonell Somatisch Diagnose n MW (SD) MW (SD) MW (SD) MW (SD) Depressive Störung 57 3,67 (1.01) 2,19 (0,76) 2,79 (1,07) 1,93 (0,86) Angststörung 26 3,82 (0,74) 2,01 (0,77) 2,37 (1,03) 1,60 (0,63) Somatoforme Störung 16 3,48 (1,16) 2,48 (1,31) 2,35 (0,98) 2,69 (1,03) Essstörung 3,75 (1,01) 2,62 (0,93) 3,05 (1,01) 1,71 (0,99) 4,53 (0,60) 2,83 (1,06) 3,10 (1,05) 2,01 (0,76) 7 Persönlichkeitsstörung 16 Es zeigt sich, dass Patienten mit somatoformen Störungen signifikant weniger intrapsychische Ursachen (p < .05) und signifikant mehr körperliche Ursachen (p < .01) für ihre Beschwerden verantwortlich machen. Jedoch weisen auch diese Patienten ein differenziertes Krankheitskonzept über alle benannten Skalen auf. Die Arbeit von LANGEWITZ et al. (1998) betrachtet die erklärenden Krankheitskonzepte von männlichen Patienten mit multiplen funktionellen Beschwerden ohne ausreichende somatische Erklärung, die so ausgeprägt waren, dass diesen Patienten ein stationäres Heilverfahren angeboten wurde. Sie stellen diesen die Krankheitskonzepte von Patienten nach akutem Herzinfarkt aus der Studie von KAUDERER-HUEBEL et al. (1989) gegenüber. In beiden Arbeiten wurde die Vorform des Patiententheorie-Fragebogens nach ZENZ, BISCHOFF und HRABAL (1996) verwandt. Zu den Ergebnissen s. Tabelle 2. Wie die Autoren schlussfolgern, „haben Patienten mit funktionellen Störungen ein mindestens ebenso großes Bedürfnis, ihre subjektive Symptomatik mit Hilfe unterschiedlicher Konzepte zu erklären, wie eine Gruppe von Patienten, bei denen die Untersuchung 6 Wochen nach einem akuten Myokardinfarkt durchgeführt wurde....Es zeigt sich bei diesen Ergebnissen auch, dass die Suche nach einem erklärenden Konzept nicht spezifisch gerichtet ist, sondern dass sie alle in diesem Fragebogen untersuchten Erklärungskonzepte umfasst“ (S. 236). 36 Tabelle 2: Krankheitskonzepte von Patienten mit funktionellen (somatoformen) Störungen und Patienten nach Herzinfarkt (nach LANGEWITZ et al., 1998) Skalen-Rohwerte (PATEF) Skala des PATEF (Zenz et al., 1996) Beispiel-Item somatoforme nach Herzin Störungen farkt (n = 178) (n = 363) psychosozial außen Mitmenschen haben kein Verständnis 16,9 15 psychosozial innen ...werde mit Problemen nicht fertig 22,4 19,6 Gesundheitsverhalten ungesunde Lebensweise 19,8 22,8 naturalistisch außen jahreszeitliche Schwankungen 12,8 10,4 naturalistisch innen schwacher Kreislauf 22,3 19,5 94,2 87,4 Gesamt-Score: Bedeutung von Erklärungskonzepten WÄLTE et al. (1999) gingen der Frage nach, ob sich Patienten mit somatoformen Störungen in ihren selbstreflexiven Kognitionen von Patienten mit anderen psychischen Störungen unterscheiden. Mit selbstreflexiven Kognitionen sind gemeint: Kausalattributionen, die sich auf die eigene Person beziehen, Selbstwirksamkeitserwartungen und Kontrollüberzeugungen. Dazu untersuchten sie 217 Patienten mit somatoformen Störungen, die sich zur Diagnostik in einer psychosomatischen Universitätsklinik einfanden; als Kontrollgruppen dienten Patienten mit Angststörungen, mit Depressionen, sowie mit Psychosomatosen (ICD-10: F45). Die Kausalattributionen wurden mit dem AFKA-I erhoben, der diese in acht Faktoren abbildet (s. Kap. 2.4.). Im Vergleich der Diagnosegruppen zeigten sich insgesamt durchaus ähnliche Attributionsprofile. Die Patienten mit somatoformen Störungen zeigten bei den Skalen „Stress“, „Körper“ und „Selbst“ die höchsten Werte. Dabei fällt jedoch im Vergleich mit den anderen diagnostischen Gruppen die relativ schwache Ausprägung der Attribution auf das „Selbst“ auf. Die diagnostischen Gruppen unterschieden sich jedoch nicht in ihren Attributionen auf der Skala „Körper“. Die Autoren deuten ihre Befunde dahingehend, dass somatoforme Patienten ihre eigene Person weitgehend als mögliche Ursache für ihre Beschwerden ausblenden. Einen anderen methodischen Zugang wählten PETERS et al. (1997). Sie interviewten 68 Patienten mit medizinisch ungeklärten Symptomen. Die Befragten stammten aus einer 37 Stichprobe von 228 Patienten aus Allgemeinpraxen. Die Beschwerden persistierten seit mindestens einem Jahr und waren durch Spezialisten bereits abgeklärt. Die Autoren vermeiden hier offensichtlich den Begriff der somatoformen Symptome. Die Interviews wurden nach inhaltsanalytischen Kriterien ausgewertet, u.a. auf die Annahmen und Erklärungen hin, die die Befragten zu ihre Symptomen haben. Die Autoren stellen fest, dass nur wenige Patienten zu Erklärungen ihrer Symptome gekommen sind, die sie selbst überzeugen und zufrieden stellen. Meistens waren Erklärungen inkomplett oder wenig zufriedenstellend und von daher fließend. Medizinische Vorstellungen waren nicht die vorherrschenden; Erklärungen konnten vielmehr nach vier nichtmedizinischen Themen kategorisiert werden: 1) Krankheit als Entität, die unabhängig vom Betroffenen existiert, 2) soziale Einflüsse, 3) inneres Ungleichgewicht, 4) nervöse und psychologische Mechanismen. PETERS et al. kommen zum Schluss, dass Patientenerklärungen zu persistierenden ungeklärten Symptomen nicht wesentlich von Erklärungen unselektierter Patientengruppen zu deren Symptomen abweichen. Die Unterschiede zu bisherigen Darstellungen in der Literatur ,vermuten die Autoren, bedingen sich u.a. durch die Rekrutierung von Patienten aus der Primärversorgung und den methodischen Zugang über Interviews mit einem nicht-medizinischen Beobachter. Die bisher zitierten Studien untersuchten die Struktur von Krankheitskonzepten bei Patienten mit einer somatoformen Störung. Kaum untersucht ist dagegen die Frage, inwieweit sich diese Krankheitskonzepte gezielt therapeutisch beeinflussen lassen, und ob dies einhergeht mit einer symptomatischen Verbesserung. LUPKE et al. (1995) untersuchten die Behandlung des Somatisierungsverhaltens in einem Allgemeinkrankenhaus über einen psychologischen Konsil- und Liaisondienst. Als Diagnosen, bei denen Somatisierungsverhalten häufig gefunden wird, schlossen sie in ihre Untersuchung ein: Depression (Interventionsgruppe: n = 3 / Kontrollgruppe: n = 12), Panikstörung (n =9 / 6), Somatoforme Störung (DSM-III-R 300.01, 300.81, 307.80) (n = 13 / 8), körperlicher Zustand, bei dem psychische Faktoren eine Rolle spielen (n = 10 / 6) sowie komorbide Störungen aus den vorgenannten (n = 15 / 18). Neben einer Beschwerderemission und anderen. Zielkriterien ging es in der Studie um die Modifikation der somatischen Krankheitssicht und die Erzeugung von Veränderungs- und Psychotherapiemotivation. Krankheitssicht wurde operationalisiert durch die „richtige“ Beantwortung von Fragen über störungsspezifische Kenntnisse in einem MultipleChoice-Fragebogen und die Einschätzung des behandelnden Psychologen hinsichtlich der Annahme eines psychologischen Erklärungsmodells. Ein signifikanter Unterschied 38 der Krankheitssicht im erwarteten Sinn im Vergleich von Interventions- zu Kontrollgruppe ließ sich nachweisen, ebenso eine Verbesserung der depressiven Stimmung, welche in der Katamnese nach einem Jahr jedoch nicht mehr nachweisbar war. Eine Differenzierung nach Diagnosegruppen war aufgrund der Fallzahl nicht möglich. Dass Krankheitskonzepte Einfluss haben auf den Verlauf der Symptomatik, zeigt eine Untersuchung von MORRISS et al. (1999) an Patienten mit psychischen Störungen, die medizinisch nicht erklärte Symptome aufwiesen. 112 Patienten wurden von Allgemeinmedizinern behandelt, nachdem diese ein spezielles Training zu somatisierten psychischen Störungen erhielten; 103 Patienten wurden von denselben Ärzten vor diesem Training behandelt. Von einer Behandlung durch trainierte Allgemeinmediziner profitierten die Patienten deutlich mehr, die an eine nur zum Teil organische Ursache ihrer Beschwerden glaubten, im Gegensatz zu denen, die von einer rein organischen Ursache überzeugt waren. 4.4. Zusammenfassung Die verfügbaren Daten zeigen, dass Patienten mit somatoformen Symptomen und Störungen über ein differenziertes Krankheitskonzept verfügen, das neben somatischen auch psychische und soziale Ursachen zulässt. Die Arbeiten von NÜBLING (1992), FALLER (1998) und WÄLTE et al. (1999), deuten darauf hin; dass Patienten mit somatoformen Störungen im Vergleich zu anderen Diagnosegruppen aus dem Spektrum der psychischen Störungen körperlich-medizinische Ursachenvorstellungen stärker und psychische dagegen weniger betonen. Aus den Untersuchungen von LANGOSCH (1996) und PETERS et al. (1997) geht ein solcher Unterschied jedoch nicht hervor; LANGEWITZ et al. (1998) konnten in dieser Hinsicht keine Unterschiede zu Herzinfarktpatienten finden. Welcher dieser Ursachenbereiche (somatisch versus psychosozial) im subjektiven Konzept von Patienten mit somatoformen Störungen überwiegt, lässt sich nach den vorliegenden Studien nicht entscheiden. Die Vergleichbarkeit der Studien ist stark eingeschränkt. Zum einen wurden sehr heterogene methodische Zugange gewählt. Zum anderen ist die Terminologie zur untersuchten diagnostische Kategorie unterschiedlich und teilweise unscharf definiert: NÜBLING (1992) spricht von „funktionellen Störungen psychischen Ursprungs“, LANGOSCH (1996) vom „psychovegetativen Syndrom“, LANGEWITZ (1998) von „multiplen funktionellen Beschwerden ohne ausreichende somatische Erklärung“. Bei FALLER (1998) und 39 WÄLTE (1999) ist es nicht klar, welche Unterkategorien von somatoformen Störungen berücksichtigt wurden. Eine wesentliche Einschränkung der Vergleichbarkeit ist das untersuchte Patientenkollektiv: NÜBLING und LANGOSCH untersuchten Patienten einer Rehabilitationsklinik, FALLER, LANGEWITZ und WÄLTE einer psychosomatischen Universitätsambulanz bzw. –Klinik. Patienten also, die vermutlich im Laufe einer möglicherweise umfangreichen Patientenkarriere bereits eine vielfachen Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen und anderen Erklärungskonzepten hatten. Bei PETERS et al. (1997) stehen dagegen wie in der vorliegenden Untersuchung Patienten der Primärversorgung im Fokus. Die Ausrichtung des Krankheitskonzeptes zwischen den Polen somatisch-psychisch könnte eine Auswirkung auf das Behandlungsergebnis durch Allgemeinmediziner haben, wie die Studie von MORRISS et al. (1999) nahe legt. Dass sich Krankheitsvorstellungen bei somatisierenden Patienten beeinflussen lassen, zeigt (diagnoseübergreifend) die Untersuchung von LUPKE et al. (1995), ohne jedoch beantworten zu können, ob damit auch ein besseres Behandlungsergebnis verbunden ist. 40 5. Fragestellungen und Hypothesen 1. Fragestellung: Wie sieht das Krankheitskonzept von Patienten mit multiplen somatoformen Symptomen aus? 1.1. Ist das Krankheitskonzept der Patienten mit multiplen somatoformen Symptomen eher von psychischen Ursachen oder eher von organmedizinischen Ursachen geprägt? Hypothese: Die Patienten mit multiplen somatoformen Symptomen sehen eher organmedizinische Ursachen als Auslöser ihrer Beschwerden. 1.2. Hängt das Ausmaß der Ursachenzuschreibung mit der Stärke der Symptomatik zusammen? Hypothese: Je mehr somatoforme Symptome vorhanden sind, desto ausgeprägter ist die Ursachenzuschreibung ( auf psychische wie auf nichtpsychische Ursachen). 2. Fragestellung: Verändert sich das Krankheitskonzept der Patienten mit somatoformen Symptomen im Laufe der Therapie? 2.1. Verändert sich das Krankheitskonzept der Patienten mit somatoformen Symptomen durch die Behandlung bei einem psychosomatisch geschulten Hausarzt (Gruppe A und Gruppe B)? Hypothese: Die Behandlung des psychosomatisch geschulten Hausarztes verändert das Krankheitskonzept dieser Patienten hin auf ein erhöhtes Verständnis psychischer Ursachen ihrer Symptomatik. 2.2. Ist die Veränderung des Krankheitsverständnisses unterschiedlich in den beiden untersuchten Gruppen: Spezifische psychosoziale Interventionen (SPI) des Hausarztes (A) vs. unspezifische psychosomatische Grundversorgung (B)? 41 Hypothese: Spezifische psychosoziale Interventionen des Hausarztes verändern eher als eine unspezifische psychosomatische Grundversorgung das Krankheitskonzept dieser Patienten hin auf ein Verständnis psychischer Ursachen ihrer Symptomatik. 2.3. Ist eine Veränderung des Krankheitskonzeptes in Richtung einer Psychogenese korreliert mit einer Verbesserung der Symptomatik bei Patienten mit somatoformen Symptomen ? Hypothese: Je eher eine Modifikation des Krankheitskonzeptes hin auf eine Psychogenese erzielt werden konnte, desto deutlicher ist die Reduktion der körperlichen Symptomatik. 3. Fragestellung: Hat das Krankheitskonzept einen Einfluss auf das Behandlungsergebnis? 3.1. Lassen sich anhand des vorherrschenden Krankheitskonzeptes Patientengruppen unterscheiden, die eher von einer hausärztlichen Behandlung (Gruppe A und Gruppe B) hinsichtlich einer Verbesserung der Symptomatik profitieren ? Hypothese: Patienten, die eher über ein psychischen Krankheitskonzept verfügen, profitieren von psychosomatischen Interventionen des Hausarztes mehr als Patienten mit nur gering von psychischen Ursachen bestimmten Krankheitskonzept. 3.2. Welche Patienten profitieren eher von spezifischen psychosozialen Interventionen als von einer unspezifischen psychosomatischen Grundversorgung? Hypothese: Patienten mit geringem psychischen Krankheitskonzept erfahren eine Verbesserung ihrer Symptomatik eher nach spezifischen psychosoziale Interventionen als durch eine unspezifische psychosomatische Grundversorgung. 42 6. Methodik 6.1. Setting der Untersuchung Die vorliegende Arbeit ist Teil einer Pilotstudie zur hausärztlichen Behandlung von Patienten mit somatoformen Symptomen. Diese Pilotstudie überprüft die Wirksamkeit spezifischer psychosozialer Interventionen des Hausarztes oder der Hausärztin nach einem Behandlungsmanual, das -orientiert an den Gegebenheiten und Möglichkeiten der Primärversorgung- 6 zwanzigminütige Sitzungen vorsieht. Als Kontrolle dient die Behandlung im Rahmen einer unspezifischen psychosomatischen Grundversorgung. D.h. alle teilnehmenden Ärzte (praktische Ärzte, Ärzte für Allgemeinmedizin und hausärztlich tätige Internisten), in der Interventions- wie der Kontrollgruppe, besitzen eine Qualifikation in psychosomatischer Grundversorgung gemäß den Richtlinien zur kassenärztlichen Versorgung. Die Ärzte der Interventionsgruppe wurden zusätzlich in drei Kurseinheiten zu je drei Stunden in der Behandlung von Patienten mit somatoformen Störungen trainiert und dabei mit dem Behandlungsmanual vertraut gemacht. Von diesen beiden Gruppen von Ärzten und Ärztinnen behandelte Patienten wurden vor und nach der Behandlung anhand standardisierter Messinstrumente untersucht und die Behandlungsergebnisse verglichen. Die Patienten wurden in die Studie eingeschlossen nach folgenden Kriterien: Einschlusskriterien: • Körperliche Beschwerden, die organisch nicht ausreichend erklärbar sind mit einer Mindestdauer von 6 Monaten; bei Männern mindestens 4 Symptome, bei Frauen 6 • Bisher noch keine fachpsychotherapeutische Behandlung • Alter > 18 bis 65 Jahre • Therapieverfügbarkeit für sechs Monate • Einwilligung des Patienten (informed consent) Ausschlusskriterien: • Schwere organisch begründbare Erkrankungen • ambulante oder stationäre fachpsychotherapeutische Behandlung in den letzten drei Jahren vor oder während der Interventionsphase • Psychose oder andere schwere psychiatrische Erkrankung 43 • Suizidalität • schwerer Alkohol- oder Medikamentenabusus • Mangelnde intellektuelle und/oder sprachliche Fähigkeiten Somit orientiert sich der Einschluss von Patienten in die Untersuchung an das Konzept der abridged somatization disorder (SSI 4/6) nach ESCOBAR (1989). Während jedoch dort die diagnostische Schwelle bei 4 bzw. 6 Symptomen aus der 35 Symptome umfassenden Liste der Somatisierungsstörung nach DSM-III liegt, bezieht sich der Cutt-off in der vorliegenden Untersuchung auf den insgesamt 53 Symptome umfassenden Fragebogen SOMS-2J. Dieser enthält sowohl die Symptome der Liste nach DSM-III bzw. IV, als auch die der ICD-10. Bei den Patienten wurden folgende Kriterien vor und nach der Behandlung erfasst und zur Beurteilung der Therapie herangezogen: • die körperliche Symptomatik • Ängstlichkeit und Depressivität als psychische Begleitsymptomatik • die gesundheitsbezogene Lebensqualität • die Behandlungszufriedenheit • Zeiten von Arbeitsunfähigkeit (AU) und stationären Behandlungen • Krankheitskonzepte der Patienten Die Studie verlief insgesamt von Dezember 1998 bis März 2000 Die vorliegende Arbeit fokussiert die Krankheitskonzepte und deren Veränderung im Lauf der Behandlung. Weitere Dissertationen aus derselben Arbeitsgruppe beleuchten andere der genannten Kriterien (bislang: POMMERSHEIM, 2001). 44 6.2. Durchführung der Untersuchung Rekrutierung der Arztpraxen: Für die Interventionsgruppe wurden 25 Hausärzte angeschrieben oder telefonisch kontaktiert, die außer dem Besuch des Curriculums zur psychosomatischen Grundversorgung z.T. auch an weiteren Aktivitäten der Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin der Universität Freiburg teilgenommen hatten. 14 Ärzte und Ärztinnen zeigten sich an einer Teilnahme an der Untersuchung und dem angebotenen Training zur Behandlung von Patienten mit somatoformen Störungen interessiert. 8 Hausärzte davon sprangen nach ausführlichen Informationen über den geplanten Ablauf, im Verlauf des Trainings oder des Screenings der Patienten ab, sodass noch 6 Hausärzte in der Interventionsgruppe verblieben. Zur Behandlung der Patienten der Kontrollgruppe wurden 465 Hausärzte in Südbaden, jeweils ehemalige Teilnehmer des Curriculums zur Psychosomatischen Grundversorgung angeschrieben und zur Mitwirkung eingeladen. 22 Hausärzte zeigten sich zunächst interessiert und wurden persönlich kontaktiert. Bereits vor bzw. im Verlauf des Screenings der Patienten sagten 12 Ärzte ihre Teilnahme ab, sodass für die Kontrollgruppe schließlich 10 Praxen zur Verfügung standen. Damit beteiligten sich 16 Hausärzte und Hausärztinnen (praktische Ärzte, Allgemeinmediziner und hausärztlich tätige Internisten) in ebenso vielen Praxen an unserer Studie; 6 in der Interventionsgruppe (A) und 10 in der Kontrollgruppe (B). Bei allen wurde ein Fragebogen zur Praxisstruktur und zur Fort- und Weiterbildung erfasst. Es handelt sich jeweils um hausärztliche Einzelpraxen. Alle Inhaber besitzen die Qualifikation in Psychosomatischer Grundversorgung. Die Ärzte der Interventionsgruppe erscheinen fachlich qualifizierter: In dieser Gruppe besitzen 2 Kollegen die Zusatzbezeichnung Psychotherapie, 2 sind Fachärzte für Innere Medizin. Die Kennzeichnung der Praxen ergibt sich nach folgender Tabelle: 45 Tab. 3: Beschreibung der Praxen Gruppe A Gruppe B gesamt Praktische Ärzte, Fachärzte für Allgemeinmedizin 4 10 14 Internisten 2 2 mit Zusatzbezeichnung Psychotherapie 2 2 Fachrichtung: Lage der Praxis Stadt 1 5 6 Kleinstadt 1 2 3 Land 4 3 7 < 500 3 3 6 500 - 1000 1 5 6 1000 - 1500 2 1 3 1 1 Praxisgröße (Scheine/ Quartal) > 1500 Praxisinhaber weiblich 2 5 7 männlich 4 5 9 Alter: MW (SD) 50,66 (5,35) 43,40 (8,08) 46,12 (7,87) 46 Rekrutierung der Patienten Der Einschluss der Patienten erfolgte nach einem dreistufigen Screeningverfahren: Zunächst erhielt während eines zusammenhängenden Zeitraums jeder Patient und jede Patientin zwischen 18 und 65 Jahren, die zu einer Konsultation die Arztpraxis besuchten, einen Fragebogen durch eine Arzthelferin ausgehändigt, mit der Bitte, diesen im Wartezimmer auszufüllen. Der Fragebogen bestand aus der Symptomliste des „Screening für somatoforme Störungen“ (SOMS-2, RIEF et al. 1997), ergänzt um Angaben zur Person und zu Vorbehandlungen (s. Anlage). Die Fragebögen wurden ausgeteilt, bis ein Rücklauf von 50-100 Bögen erreicht war (je nach Größe der Praxis). Abweichungen von dem beschriebenen Ablauf ergaben sich durch eine unterschiedliche Motivation und Kooperation der involvierten Arzthelferinnen. So kann eine Selektion der Patienten durch die Helferinnen nicht ausgeschlossen werden. Dies beträfe allerdings beide untersuchten Gruppen. Auf diese Weise wurden insgesamt 1094 Patienten erfasst. 623 davon (57%) gaben mindestens 4 (Männer) bzw. 6 (Frauen) Symptome im SOMS-2 an. 216 Patienten wurden aufgrund der im Screening-Fragebogen miterfassten Ausschlusskriterien (Alter, kurz zurückliegende oder aktuelle psychiatrische/ psychotherapeutische Behandlung) ausgeschlossen. In einer zweiten Stufe des Screenings wurden bei den verbleibenden 407 Patienten die o.g. Ein- und Ausschlusskriterien im Gespräch mit dem Hausarzt abgeklärt. Danach blieben 100 Patienten als mögliche Teilnehmer der Studie. Auf dieser Ebene wäre eine Selektion durch die Hausärzte möglich. Diese Patienten wurden schriftlich oder während einer Konsultation um Teilnahme an der Studie gebeten. 81 sagten die Teilnahme zu und gaben schriftlich ihr Einverständnis (informed consent). In der dritten Stufe des Screenings wurden die genannten 81 Patienten in den jeweiligen Hausarztpraxen durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe der Pilotstudie anhand eines diagnostischen Interviews (Mini-DIPS, MARGRAF 1994) untersucht. Ziel des Interviews war zum einen die Spezifizierung der somatoformen Störung nach ICD-10 und die Erfassung komorbider psychischer Störungen und zum anderen die nochmalige Überprüfung der Ein- und Ausschlusskriterien durch die Arbeitsgruppe. Die Ergebnisse des Interviews wurden mit der gesamten Arbeitsgruppe diskutiert. Hierdurch wurden weitere 47 19 Patienten ausgeschlossen; Der Datensatz eines weiteren Patienten konnte nicht mehr einer Praxis zugeordnet werden. Somit verblieben 61 Patienten, die in der Studie untersucht werden konnten; 25 in der Interventionsgruppe und 36 in der Kontrollgruppe. Eine Beschreibung der Patientenstichprobe anhand der erfassten soziodemographischen Daten ist der folgenden Tabelle zu entnehmen: Tab. 4: Soziodemographische Daten der Patienten Gruppe A Gruppe B Gesamt 25 36 61 Mittelwert 44,86 49,02 47,31 SD 11,77 11,89 11,92 Anzahl Alter Geschlecht Familienstand Schulbildung n (%) n (%) n (%) Frauen 16 (64) 27 (75) 43 (70,5) Männer 9 (36) 9 (25) 18 (29,5) mit Partner 21 (84) 26 (72,2) 47 (77,1) alleinlebend 2 (8) 2 (5,6) 4 (6,6) geschieden 1 (4) 8 (22,2) 9 (14,8) verwitwet 1 (4) 1 (1,6) Volksschule 12 (48) 20 (55,6) 32 (52,6) Realschule 7 (28) 8 (22,2) 15 (24,6) Gymnasium 2 (8) 3 (8,3) 5 (8,2) Hochschule 1 (4) 2 (5,6) 3 (4,9) keine Angaben 3 (12) 3 (8,3) 6 (9,8) berufstätig 16 (64) 15 (41,7) 31 (50,8) EU-/ BU-Rente 2 (8) 3 (8,33) 5 (8,2) Altersrente 2 (8) 7 (19,5) 9 (14,8) arbeitslos 1 (4) 1 (2,8) 2 (3,3) nicht berufstätig 1 (4) 2 (5,6) 3 (4,9) keine Angaben 3 (12) 8 (22,2) 11 (18) ohne Abschluss Arbeitssituation 48 Eingangsuntersuchung (T0) Bereits in den Tagen vor der Durchführung des diagnostischen Interviews erhielten die Patienten per Post oder ausgehändigt durch den Hausarzt ein Fragebogenpaket zur Eingangsuntersuchung. Durch die Wahl dieses Zeitpunktes konnten im Anschluss an das Interview noch Fragen und Unklarheiten, die die Fragebögen betrafen mit den Patienten geklärt werden. Das Fragebogenpaket erhielt, versehen mit kurzen Erklärungen und der Versicherung der Schweigepflicht auf einem Deckblatt folgende Messinstrumente: • SOMS-7 (RIEF et al., 1997) • Somatisierungsskala aus SCL-90R (DEROGATIS, 1977, dt.: FRANKE, 1995) • SF-12 (BULLINGER, M, KIRCHBERGER, I, 1998) • HADS (HERMANN et al., 1995) • KKU (NÜBLING, 1992) • Fragebogen zur Behandlungszufriedenheit Intervention Im Anschluss an die Eingangsuntersuchung und das diagnostische Interview erfolgte die Behandlung der Patienten in den beiden Gruppen durch ihre jeweiligen Hausärzte. Gruppe A sollte 6 Sitzungen à 20 Minuten nach dem Behandlungsmanual in zweiwöchigen Abständen erhalten. Gruppe B wurde im Rahmen einer unspezifischen psychosomatischen Grundversorgung behandelt. Auch hier wurden im Rahmen der Studie den behandelnden Ärzten 6 zwanzigminütige Sitzungen zweiwöchentlich empfohlen. Von diesem zeitlichen Schema ergaben sich jedoch häufige Abweichungen, v.a. im Sinn deutlich längerer Behandlungsintervalle; so wurde spätestens nach 4 Monaten die Beobachtung der Behandlungsphase der Kontrollgruppe beendet und die Patienten abschließend untersucht. Die teilnehmenden Ärzte dokumentierten Dauer und Inhalt der Sitzungen in einem Protokoll, das zum einen eine Auswahl möglicher Inhalte zum Ankreuzen vorgab, zum anderen auch die Möglichkeit einer auf kurzen freien Dokumentation zuließ. So wurde dem Bedürfnis der teilnehmenden Ärzte nach einer möglichst zeitökonomischen Dokumentation Rechnung getragen (s. Anhang). Den Behandlungsprotokollen zufolge erhielten die Patienten der Interventionsgruppe im Mittel 4,0 Sitzungen à 20,0 Minuten, die der Kontrollgruppe 4,1 Sitzungen à 14,5 Minuten. 49 Jeweils vor Beginn und am Ende der Behandlung wurden die Ärzte um Angaben zu Behandlungsmaßnahmen im Rahmen der Psychosomatischen Grundversorgung sowie eine Einschätzung des Gesundheitszustandes und der Behandlungszufriedenheit der Patienten gebeten (der entsprechende Fragebogen [„Basisdokumentation“] ist im Anhang abgedruckt). Abschlussuntersuchung (T1) Nach Beendigung der Behandlung wurden die Patienten anhand eines zur Eingangsuntersuchung identischen Fragebogenpaketes untersucht. Zum Zeitpunkt T1 lagen 50 gültige Datensätze vor; 3 Patienten aus der Interventionsgruppe und 9 aus der Kontrollgruppe füllten zu diesem Zeitpunkt den KKU nicht aus (drop out 19%). 50 Abb.2: Versuchsplan Gruppe A hier einfügen: Versuchsplan.doc 6 Hausarztpraxen Qualifikation in psychosomatischer Grundversorgung + Training in spezifischen psychosozialen Interventionen Gruppe B 10 Hausarztpraxen Qualifikation in psychosomatischer Grundversorgung n = 1024 Patienten Screening I: SOMS-2 n = 623 Screening II: Ein-/Ausschlußkriterien Screening III: Mini-DIPS n = 81 n = 61 Eingangsuntersuchung T0 Behandlung Gruppe A Behandlung Gruppe B Spezifische Psychosoziale Interventionen Unspezifische Psychosomatische Grundversorgung n = 25 n = 36 Abschlussuntersuchung T1 51 6.3. Messinstrumente 6.3.1. Das Screening für somatoforme Störungen (SOMS-2, SOMS-7) Das „Screening für somatoforme Störungen“ (SOMS, RIEF et al. 1997) ist ein Selbstbeurteilungsinstrument, das die Erkennung von Personen mit somatoformen Störungen erleichtert. Der SOMS-2 umfasst 53 Symptome mit Ja/ Nein- Antwortalternative für den gesamten Zeitraum der letzten 2 Jahre. Die aktuelle Fassung berücksichtigt alle körperlichen Symptome, die sowohl für eine Somatisierungsstörung nach DSM-IV oder ICD-10 als auch für die somatoforme autonome Funktionsstörung von Relevanz sind. Die Summe der positiv beantworteten körperlichen Symptome ergibt den „Beschwerden-Index Somatisierung“ oder „somatic symptom index“ (SSI). Weitere 15 Items, die die zentralen Ein- und Ausschlusskriterien der Somatisierungsstörung nach ICD-10 und DSM-IV sowie der somatoformen autonomen Funktionsstörung erfassen, wurden in der hier zum Screening verwendeten Modifikation durch Angaben zu soziometrischen Daten ersetzt. Die Sensitivität des SOMS-2 liegt bei 82-98%. Diese hohe Sensitivität geht zum Teil zu Lasten der Spezifität (43-85%). Nach RIEF und HILLER (1992) muss bei einer Selbstbeurteilung mittels Fragebogen im Vergleich zu einer Fremdbeurteilung mittels Interview mit einer Überschätzung somatoformer Beschwerden gerechnet werden.. Aufgrund des SOMS-2-Befundes kann ein Verdacht für das Vorliegen einer somatoformen Störung angezeigt werden (RIEF et al. 1997). Ein weiterer Fragebogen wurde von den Autoren zur Veränderungsmessung entwickelt (SOMS-7). In dieser Version wird nicht nur das Vorhandensein körperlicher Beschwerden in den vergangenen sieben Tagen erfragt, sondern auch die Intensität der Symptome. Die Intensität kann in einer 5-stufigen Skala angegeben werden (gar nicht vorhanden = 0, leicht = 1, mittelmäßig =2, stark = 3, sehr stark = 4). Damit kann zum einen die Beschwerdeanzahl (alle Symptome mit mindestens „1“) angegeben werden, zum anderen ein Intensitätsscore, gebildet aus der Summe der Werte aller Items. Diese Version fand in der vorliegenden Untersuchung zur Erfassung der somatoformen Symptomatik in der Eingangs- und Abschlussuntersuchung (Zeitpunkte T0 und T1) Verwendung. 52 6.3.2. KKU: Messinstrument zur Erfassung von Krankheitsursachen- konzepten Im Rahmen der Evaluation psychosomatischer Heilverfahren befasste sich R. NÜBLING (1992) mit der Bedeutung von Psychotherapiemotivation und subjektivem Krankheitskonzept für Verlauf und Ergebnis stationärer psychosomatischer Behandlungen. Dazu entwickelte er Instrumente zur Selbstbeurteilung von Psychotherapiemotivation und Krankheitskonzepten. Die Krankheitskonzept-Skalen wurden aus inhaltlichen Erwägungen und zur besseren Vergleichbarkeit mit anderen Studien in eine Ursachen(KKU) und Erwartungsskala (KKE) differenziert. Aus testtheoretischen Überlegungen wurde die Ursachenskala in zwei parallelen Halbformen entwickelt: KKU-A und KKUB die in ihrer Gesamtheit den KKU-G –oder kurz KKU– bilden. In unserer Studie zur hausärztlichen Behandlung somatoformer Störungen kamen nur die Fragen zu Krankheitsursachen zur Anwendung. Nübling verwandte zur Entwicklung seiner Fragebögen Items, die zum einen in einer Pilotstudie aus Patientenäußerungen in halbstrukturierten Interviews gewonnen wurden, zum anderen Items aus bereits vorhandenen Verfahren. Als Vorläufer für die Ursachen-Skala KKU zitiert er Items aus PLAUM (1968), SCHEER, MÖLLER (1976), MUTHNY (1986): Persönliche Ursachen für die Erkrankung (PUK), BISCHOFF, ZENZ (1990): Fragebogen zum Krankheitsbild des Patienten. 8 Items formulierte NÜBLING spezifisch zur Erfassung des Ursachenbereichs Kindheit. Der Autor entschied sich nach einer Faktorenanalyse des KKU für eine 3-FaktorenLösung. Die Faktoren benennt und beschreibt er wie folgt (pp. 100ff.): • „Der Faktor KKU1 „Psychische Ursachen“ (9,4% Varianzaufklärung) markiert Items, auf den Patienten als von ihnen vermutete Ursachen für ihre Beschwerden bzw. Krankheit seelische Probleme, Konflikte, mit denen sie nicht fertig werden, dauerhaft unerfüllte Wünsche und Bedürfnisse oder z.B. mangelnde Fähigkeit, mit Belastungen und Krisen umzugehen, angeben. • Auf dem Faktor KKU2 „Nicht-psychische Ursachen“ (6,7% Varianzaufklärung) bildet sich demgegenüber z.B. die Annahme ab, frühere Erkrankungen, Nebenwirkungen bestimmter Medikamente, eine versteckte körperliche Krankheit, Fehler o- 53 der Versäumnisse von Ärzten oder Vererbung seien für die heutigen Beschwerden verantwortlich. • Der Faktor KKU3 „Kindheit als Ursache“ geht mit einer Varianzaufklärung von 24.5% als bedeutsamster aus der Faktorenanalyse heraus. Er wird hier erst an dritter Stelle genannt, weil er aus unserer Sicht einen innerhalb der psychischen Ursachen sehr speziellen Bereich abdeckt.. Hier geben Patienten an, inwiefern sie bestimmte Aspekte der Kindheit bzw. der Beziehung zu den Eltern mit den heutigen Beschwerden in Zusammenhang sehen.“ In unserer Studie wurde die kindheitsbezogene Skala mit den dafür separat aufgeführten 8 Items nicht einbezogen, da zu diesem Aspekt keine Fragestellungen und Hypothesen bestanden. So umfasst der KKU in der hier verwendeten Form 42 Items, die jeweils auf einer 4-stufigen Skalierung zu beantworten sind, je nach der Stärke der Ursachenzuschreibung im Sinn der vorgelegten Frage. Die Entwicklung und Validierung des Instrumentes erfolgte an Stichproben, die dem Patientenkollektiv der Einrichtung entstammten, an dem der Autor seinerzeit tätig war. Untersuchungen an einer bevölkerungsrepräsentative Eichstichprobe oder Stichproben aus anderen Einrichtungen des Gesundheitssystems wurden nicht durchgeführt. So gibt der Autor auch keine „Normwerte“ oder „Cut-off“ zur Abgrenzung auffälliger von unauffälligen Werten an. Für die vorliegende Untersuchung schien die von Nübling vorgeschlagene Skaleneinteilung unbefriedigend. Daher wurde auf der Basis der vorliegenden Daten eine Faktorenanalyse durchgeführt, aus der eine gegenüber der Nübling´schen Fassung modifizierte Einteilung in zwei Faktoren hervorging (nähere Darstellung dazu im Ergebnisteil): • Skala PS: Psychosoziale Ursachen (16,2% Varianzaufklärung) • Skala ON: Organische/ naturalistische Ursachen (10,5% Varianzaufklärung) Daneben wird in der vorliegenden Arbeit die Antworttendenz betrachtet, als Maß dafür, in welcher Stärke die Patienten dazu neigen, Ursachenzuschreibungen überhaupt vorzunehmen. Ein Maß dazu bietet die Gesamtsumme aus den um fehlende Werte korrigierten Summenwerten der beiden Skalen PS und ON Analog betrachteten auch AHRENS & ELSNER (1981) die Antworttendenz bzw. ZENZ et al. (1996) den Gesamtscore des PATEF. 54 6.4. Statistische Auswertung Die mit den Messinstrumenten erhobenen Daten wurden in Form einer Datenbank mit dem Programm „Access 2.0“ erfasst. Alle statistischen Anwendungen erfolgen mit dem Statistikpaket SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) in der Version 9.0. Die Skalen-Mittelwerte der beiden Messinstrumente wurden mit T-Tests verglichen. Veränderungen über die Zeit im Gruppenvergleich wurden über eine Varianzanalyse mit dem „Allgemeinen linearen Modell“ überprüft (univariate Varianzanalyse mit Messwiederholung). Bei der Berechnung des Zusammenhangs zwischen einzelnen Skalen wurde der Korrelationskoeffizient nach Pearson angegeben. Dieser ist zulässig, da keine der Skalen signifikant von einer Normalverteilung abweicht (Prüfung mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test). Die berechneten Korrelationen können wie folgt beschrieben werden: r < 0,2: sehr geringe Korrelation 0,2 < r < 0,5: geringe Korrelation 0,5 < r < 0,7: mittlere Korrelation 0,7 < r < 0,9: hohe Korrelation r > 0,9: sehr hohe Korrelation Die Angaben des Signifikanzniveaus orientieren sich an folgender Einteilung: p ≤ 0,01: hoch signifikant 0,01 < p ≤ 0,05: signifikant p > 0,05: keine Signifikanz Missing Data Zum Zeitpunkt T0 lagen 61 Datensätze für den KKU vor. In 5 Datensätzen fehlte 1 Wert, in dreien 2 Werte und in jeweils einem Datensatz 3, 4 bzw. 8 Werte. Somit fehlen insgesamt 26 von 2562 Werten (1%). Bei einem Datensatz fehlen 8 Werte bei T0, 7 davon in Items, die psychische Ursachen betreffen. Dieser Fall wurde zum Berechnen der psychische Ursachen betreffenden Scores nicht herangezogen. Somit liegt die Fallzahl, mit der die Berechnungen durchgeführt wurden bei n = 60 bzw. 61. Zum Zeitpunkt T1 lagen 50 gültige Datensätze vor; 2 Patienten aus der Interventionsgruppe und 9 aus der Kontrollgruppe füllten zu diesem Zeitpunkt den KKU nicht aus (drop out 18%). In diesen Datensätzen fehlen bei 4 Datensätzen 2 bzw. bei 5 Datensätzen 1 Wert. Insgesamt fehlen damit bei T1 13 von 2100 Werten (0,6%). 55 Zur Faktorenanalyse wurden die fehlenden Werte durch den Skalenmittelwert des jeweiligen Items ersetzt. Zur Bildung der Summenscores und somit für die Mittelwertvergleiche zwischen den beiden Patientengruppen wurden die fehlenden Werte dagegen durch die Mittelwerte der Fälle ersetzt, um der unterschiedlichen Antworttendenz der Patienten Rechnung zu tragen. 56 7. Ergebnisse 7.1. Wie sieht das Krankheitskonzept von Patienten mit multiplen somatoformen Symptomen aus? Betrachtung auf der Ebene der einzelnen Items des KKU Zur Beantwortung dieser Frage wurden zunächst eine Rangreihe der einzelnen Items bei beiden Patientengruppen vor Beginn der Behandlung (T0) gebildet. Der Rang ergibt sich aus dem Durchschnittswert des Items; er ist der unten stehenden Tabelle 5 ersichtlich. Es wird deutlich, dass psychosoziale Faktoren am häufigsten als Ursachen für die Symptomatik genannt werden. In einem nächsten Schritt wurden die Mittelwerte der einzelnen Items vor Behandlungsbeginn zwischen Interventions- und Kontrollgruppe verglichen. Es zeigen sich die beiden Gruppen auf dem Niveau der Einzelitems sehr gut vergleichbar. Es ergeben sich lediglich bei 2 Items signifikante Unterschiede der Mittelwerte zum Beginn der Studie: Die Patienten der Gruppe B waren eher als die der Gruppe A geneigt, Vererbung für die Entstehung ihrer Beschwerden verantwortlich zu machen; in der Gruppe A gab es mehr Patienten, die Konflikte mit dem Vater als Ursache sehen. Die Werte im Einzelnen sind der Tabelle 6 zu entnehmen. 57 Tabelle 5 : Rangreihe der Items des KKU Item Nr Item 18 Stress und Hetze des täglichen Lebens 4 Wetterfühligkeit 32 Hohe Ansprüche an mich selbst 23 Allgemeine Erschöpfung 26 Seelische Probleme 2 Konflikte, mit denen ich nicht fertig werde 6 Fehlende innere Sicherheit 3 berufliche Belastungen und Sorgen 1 Vererbung 7 Eigene Willensschwäche 41 Familiärer Stress 19 Frühere Erkrankungen 11 Fehlen eines Menschen, mit dem ... 31 Alterungs- bzw. Abbauprozesse 24 Mangelnde Fähigkeit, mit Belastungen ... umzugehen 27 Dauerhafter Ärger mit bestimmten Personen 9 Unsichere finanzielle Lage 20 Verlust geliebter Personen 30 Mangelndes Durchsetzungsvermögen bei Konflikten 34 Ereignisse aus meiner Kindheit 42 Ungesunde Ernährung 5 Schwierigkeiten mit dem Partner 13 Schicksal 17 Umweltverschmutzung 14 Zufällige Ereignisse 35 Dauerhaft unerfüllte Wünsche und Bedürfnisse 12 Ungünstige Lebensgewohnheiten 40 Eine versteckte körperliche Krankheit 16 Einflüsse anderer Personen 33 Frühere Operationen 10 Sexuelle Schwierigkeiten 22 Einflüsse der Gestirne, von Erdstrahlen oder ... 36 Krankheitserreger (Viren o.ä.) 37 Konflikte mit meinem Vater 25 Angeborene Schwäche von bestimmten Organen 29 Nebenwirkungen bestimmter Medikamente 21 Übermäßiger Gebrauch von Genussmitteln 28 Bisheriger falscher Lebenswandel 38 Konflikte mit meiner Mutter 15 Fehler oder Versäumnisse der Ärzte 8 Übermäßiger Medikamentengebrauch 39 Mangelnde Selbstständigkeit Skala PS ON PS PS PS PS PS PS ON PS PS ON PS ON PS PS PS PS PS PS ON PS PS ON PS PS PS ON PS ON ON ON ON PS ON ON ON PS PS ON ON Mittel T0 (A+B) 2,3 2,26 2,13 2,1 2,1 1,98 1,92 1,9 1,85 1,82 1,82 1,81 1,79 1,79 1,76 1,76 1,68 1,68 1,68 1,61 1,6 1,58 1,52 1,52 1,51 1,51 1,48 1,48 1,44 1,44 1,41 1,4 1,36 1,34 1,32 1,32 1,31 1,27 1,27 1,26 1,19 1,19 Legende zur Tab. 5: Skala psychosoziale Ursachen (PS) – organisch/naturalistische Ursachen (ON) Mittel (T0): Mittelwert des Items zum Zeitpunkt T0; beide Gruppen gemeinsam 58 Tabelle 6 :Vergleich der Mittelwerte der einzelnen Items in beiden Gruppen zum Studienbeginn [(T0); T-Test bei unabhängigen Stichproben; *: signifikant (p<0,05)] Item Gr. N MW S 01 A 25 1,52 B 35 2,09 Sig. (2seitig) ,92 ,030* 1,01 02 A 26 2,04 B 36 1,94 1,00 ,83 ,687 23 A 26 1,96 B 36 2,19 1,00 ,86 ,328 03 A 26 2,08 B 34 1,76 1,13 ,85 ,227 24 A 26 1,69 B 36 1,81 ,88 ,71 ,578 04 A 26 2,15 B 35 2,34 1,05 1,03 ,484 25 A 26 1,42 B 36 1,25 ,81 ,55 ,321 05 A 24 1,50 B 36 1,64 ,83 ,72 ,496 26 A 26 2,15 B 36 2,06 ,92 ,79 ,655 06 A 25 1,96 B 36 1,89 ,79 ,89 ,749 27 A 26 1,92 B 36 1,64 1,09 ,76 ,232 07 A 25 1,84 B 36 1,81 ,90 ,82 ,877 28 A 26 1,19 B 36 1,33 ,40 ,53 ,262 08 A 26 1,19 B 36 1,19 ,49 ,47 ,986 29 A 25 1,24 B 35 1,37 ,60 ,69 ,445 09 A 26 1,50 B 36 1,81 ,71 ,98 ,181 30 A 26 1,62 B 36 1,72 ,75 ,66 ,555 10 A 26 1,42 B 35 1,40 ,70 ,69 ,899 31 A 26 1,65 B 36 1,89 ,80 ,71 ,226 11 A 26 1,88 B 35 1,71 ,91 ,96 ,485 32 A 25 2,04 B 36 2,19 1,02 ,98 ,554 12 A 25 1,44 B 35 1,51 ,71 ,85 ,723 33 A 26 1,42 B 36 1,44 ,70 ,88 ,919 13 A 26 1,54 B 35 1,51 ,81 ,85 ,911 34 A 26 1,73 B 35 1,51 ,83 ,66 ,260 14 A 25 1,52 B 36 1,50 ,77 ,77 ,921 35 A 25 1,56 B 36 1,47 ,82 ,70 ,654 15 A 26 1,19 B 36 1,31 ,40 ,52 ,360 36 A 25 1,48 B 36 1,28 ,87 ,61 ,292 16 A 26 1,58 B 36 1,33 ,90 ,53 ,188 37 A 26 1,62 B 36 1,14 17 A 26 1,50 B 35 1,54 ,86 ,66 ,826 38 A 26 1,38 B 36 1,19 ,75 ,40 ,203 18 A 25 2,20 B 36 2,36 ,96 ,80 ,478 39 A 26 1,15 B 36 1,22 ,37 ,48 ,548 19 A 26 1,96 B 36 1,69 1,00 ,98 ,298 40 A 25 1,56 B 36 1,42 ,96 ,77 ,521 20 A 26 1,73 B 36 1,64 1,12 ,99 ,734 41 A 26 1,69 B 36 1,92 ,93 ,91 ,345 21 A 26 1,27 B 36 1,33 ,72 ,63 ,712 42 A 26 1,62 B 36 1,58 ,90 ,81 ,883 Item Gr. N MW 22 A 25 1,36 B 35 1,43 S Sig. (2seitig) ,86 ,735 ,70 1,06 ,024* ,54 59 Faktorenanalyse Wie bereits beschrieben gingen in die ursprüngliche Fassung des KKU nach NÜBLING (1992, S 100f.) insgesamt 51 Variablen ein: die 42 Items des in der vorliegenden Untersuchung verwandten KKU, sowie 8 zusätzlich zu einem a priori postuliertem Ursachenbereich „Kindheit“ formulierte Items; ein Item schloss Nübling wieder aus. Für diese 51 Variablen schlug Nübling eine 3-Faktoren-Lösung mit einer Varianzaufklärung von 40,6% vor: • Faktor KKU1 „Psychische Ursachen“ (9,4% Varianzaufklärung). Dieser Faktor umfasst 16 Items, die Items Nr.: 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 24, 26, 27, 30, 32, 35, 39, 41. • Faktor KKU2 „ Nicht-psychische Ursachen“ (6,7% Varianzaufklärung) mit ebenfalls 16 Items: 1, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 33, 36, 40. • Faktor KKU3 „Kindheit als Ursache“ (24,5% Varianzaufklärung) mit den Items 37 und 38 sowie den 8 speziell für diesen Ursachenbereich formulierten Items. Diese Einteilung scheint aus mehreren Gründen für die vorliegende Untersuchung unbefriedigend: Die acht „Kindheit“-Items , die die höchste Faktorenladung aufweisen, da sie gezielt für einen entsprechend vermuteten Ursachenbereich konstruiert wurden, wurden in der vorliegenden Untersuchung den Patienten nicht vorgelegt. Weiterhin sind von den Patienten relativ häufig hoch eingestufte Items, die oben in der Rangreihe der Items stehen, nicht in den beiden übrigen Skalen nach NÜBLING enthalten. Diese Items erscheinen zwar eher unspezifisch, jedoch lassen sie sich im Kontext einer der beiden Ursachenbereiche zuordnen. So weist das Item „Stress und Hetze des täglichen Lebens“ auf ein undifferenziertes psychosoziales Verständnis der Krankheitsursache hin, das Item „Wetterfühligkeit“ eher auf ein naturalistisches Verständnis. Bereits aus theoretischen Gründen ist es unbefriedigend, diese Items nicht weiter zu berücksichtigen; würden solche Aussagen in einem Patient-Arzt-Gespräch geäußert, wären sie auf jeden Fall wichtige und offensichtlich häufig genannte Schlüssel, um in einen Dialog um die beiderseitigen Krankheitskonzepte einzusteigen. Aus den genannten Gründen wurden anhand der Daten aus der Eingangsuntersuchung (T0) beider Patientengruppen die Items einer Faktorenanalyse unterzogen. Es wurden Lösungen mit 2, 3, 4, 5 Faktoren gerechnet und miteinander verglichen. Dabei zeigte 60 sich eine 2-Faktorenlösung, die den eingangs genannten Hypothesen entspricht, am plausibelsten. Die Varianzaufklärung von 26,7% erscheint befriedigend und übertrifft die kumulierte Varianzaufklärung der Faktoren KKU1 und KKU2 nach NÜBLING (16,1%). Die Faktoren lassen sich bezeichnen als: • PS: Psychosoziale Ursachen (16,2% Varianzaufklärung): Items 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 41 • ON: Organische/ naturalistische Ursachen (10,5% Varianzaufklärung): Items 1, 4, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 33, 36, 40, 42 Die Faktorenladungen lassen sich der untenstehenden Tabelle 7 entnehmen (rotierte Komponentenmatrix. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung; die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert). Daraus ergibt sich eine Zuordnung der Items zu den Skalen wie in der anschließenden Tabelle 8 zu entnehmen. In dieser Tabelle sind die Items nach der Höhe der Faktorenladungen sortiert; die jeweils erstgenannten Items könnten sozusagen als Markeritems der betreffenden Skala gelten. Item 39 („mangelnde Selbstständigkeit“) lädt nahezu gleich hoch auf beiden Skalen. Eine Skalenzuordnung ist daher nicht eindeutig möglich. Die unterschiedliche Anzahl der Items, die den beiden Skalen jeweils zugeordnet sind, wird in der Berechnung der Scores berücksichtigt. Dadurch wird ein direkter Vergleich der Ausprägung der Skalen sowohl auf Fallebene als auch im Gruppenvergleich möglich: • Score (PS) = (Summe der Werte der Items der Skala PS) / 25 x 100 • Score (ON) = (Summe der Werte der Items der Skala ON) / 16 x 100 61 Tabelle 7: Rotierte Komponentenmatrix (Werte < 0,1 unterdrückt) Item 01 Item 02 Item 03 Item 04 Item 05 Item 06 Item 07 Item 08 Item 09 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 Item 27 Item 28 Item 29 Item 30 Item 31 Item 32 Item 33 Item 34 Item 35 Item 36 Item 37 Item 38 Item 39 Item 40 Item 41 Item 42 Komponenten Faktor 1: PS Faktor 2: ON ,402 ,655 -,232 ,345 ,132 ,507 ,363 ,656 ,204 ,464 ,285 ,191 ,528 ,377 ,228 -,269 ,496 ,369 ,131 ,480 ,234 ,447 ,135 -,134 ,634 ,525 ,559 ,307 ,659 ,196 ,102 ,343 ,417 ,592 ,450 ,374 ,581 ,387 ,724 -,217 ,611 -,220 ,294 ,196 -,137 ,552 ,436 ,150 ,456 ,602 ,168 -,239 ,494 ,491 ,246 ,704 ,163 ,286 ,473 ,382 ,423 ,252 ,264 -,248 ,228 ,636 ,110 ,129 62 Tabelle 8: Skalen Faktor Psychosoziale Ursachen 1 Organische/ natural. Ursachen 2 ohne Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Item Item 26 Item 35 Item 06 Item 02 Item 41 Item 27 Item 32 Item 24 Item 16 Item 11 Item 34 Item 13 Item 37 Item 07 Item 23 Item 14 Item 30 Item 38 Item 09 Item 12 Item 05 Item 03 Item 18 Item 28 Item 20 Item 19 Item 15 Item 22 Item 17 Item 29 Item 08 Item 04 Item 33 Item 31 Item 21 Item 01 Item 25 Item 36 Item 10 Item 40 Item 42 Item 39 Seelische Probleme Dauerhaft unerfüllte Wünsche und Bedürfnisse Fehlende innere Sicherheit Konflikte, mit denen ich nicht fertig werde Familiärer Stress Dauerhafter Ärger mit bestimmten Personen Hohe Ansprüche an mich selbst Mangelnde Fähigkeit, mit Belastungen und Krisen... Einflüsse anderer Personen Fehlen eines Menschen, mit dem ich mich aussprechen kann Ereignisse aus meiner Kindheit Schicksal Konflikte mit meinem Vater Eigene Willensschwäche Allgemeine Erschöpfung Zufällige Ereignisse Mangelndes Durchsetzungsvermögen bei Konflikten... Konflikte mit meiner Mutter Unsichere finanzielle Lage Ungünstige Lebensgewohnheiten Schwierigkeiten mit dem Partner berufliche Belastungen und Sorgen Stress und Hetze des täglichen Lebens Bisheriger falscher Lebenswandel Verlust geliebter Personen Frühere Erkrankungen Fehler oder Versäumnisse der Ärzte Einflüsse der Gestirne, von Erdstrahlen oder Wasseradern Umweltverschmutzung Nebenwirkungen bestimmter Medikamente Übermäßiger Medikamentengebrauch Wetterfühligkeit Frühere Operationen Abbauprozesse Übermäßiger Gebrauch von Genussmitteln Vererbung Angeborene Schwäche von bestimmten Organen Krankheitserreger (Viren o.ä.) Sexuelle Schwierigkeiten Eine versteckte körperliche Krankheit Ungesunde Ernährung Mangelnde Selbstständigkeit 63 Ist das Krankheitskonzept der Patienten mit multiplen somatoformen Symptomen eher von psychischen Ursachen oder eher von organmedizinischen Ursachen geprägt? Betrachtung des Krankheitskonzeptes auf Ebene der Skalen des KKU Beim Vergleich der Scores (d.h. der um die Anzahl der Items korrigierte Mittelwerte) beider Skalen in der gesamten Stichprobe vor Beginn der Behandlung zeigt sich, dass die Patienten ein stärker von psychosozialen Ursachen als von organischnaturalistischen Ursachen geprägtes Krankheitsbild haben (p = 0,001). Somit kann die eingangs genannte Hypothese, in der das Gegenteil vermutet wurde, nicht bestätigt werden. Hierin unterscheiden sich Interventions- und Kontrollgruppen nicht; die Scores beider Skalen zeigen keine signifikanten Unterschiede in beiden Gruppen. Tabelle 9: Mittelwerte der Skalen PS und ON vor der Behandlung N Score PS (TO) Score ON (T0) 60 61 1 0 171,88 151,29 Gültig Fehlend Mittelwert Sig. (T-Test) P = 0,001 Tabelle 10: Scores der Skalen vor Behandlung im Gruppenvergleich (T-Test für unabhängige Stichproben) Gruppe N Mittelwert Standardabweichung Sig. (2seitig) Score PS (T0) Gruppe A 24 173,91 47,05 ,761 Gruppe B 36 170,53 38,01 Score ON (T0) Gruppe A 25 148,41 38,24 Gruppe B 36 153,29 29,98 Gesamtsumme Gruppe A 24 67,13 14,58 (T0) 36 67,16 11,43 Gruppe B ,579 ,993 64 Hängt das Ausmaß der Ursachenzuschreibung mit der Stärke der Symptomatik zusammen? Bevor diese Frage beantwortet werden kann, soll die somatoforme Symptomatik vor der Behandlung im Gruppenvergleich betrachtet werden. Das eingesetzte Instrument SOMS-7 bietet hierzu zwei Größen: die Anzahl sowie den Intensitätsscore der Beschwerden der letzten sieben Tage. Im Mittel geben die Patienten 13,12 Symptome an mit einer Beschwerdeintensität von im Mittel 22,97. Die beobachteten Differenzen der Mittelwerte, nämlich eine höhere Symptomzahl und -Intensität in der Kontrollgruppe, sind statistisch nicht signifikant (s. Tab. 11). Tab. 11: Symptomzahl und Beschwerdenintensität im Gruppenvergleich. N Mittelwert Standardabweichung Gruppe A 14 10,64 6,92 Gruppe B 41 14,05 7,38 Gesamt 55 13,12 7,35 Gruppe A 14 18,14 10,06 Gruppe B 41 24,61 14,59 Gesamt 55 22,97 13,79 Signifikanz Symptomzahl (T0) ,136 Intensitätsscore (T0) ,131 Zur Beantwortung dieser Frage, die sich auf die gesamte Stichprobe bezieht, wurden die Korrelationen zwischen den Ergebnissen des SOMS-7 und des KKU betrachtet, jeweils vor Behandlung, zum Zeitpunkt T0. Verglichen wurden beide Maßzahlen für die Ausprägung der Symptomatik - die Symptomzahl und der Intensitätsscore - zum einen mit der Gesamtsumme des KKU, zum anderen mit den Scores aus den beiden Skalen PS und ON. Wie in der Hypothese postuliert, ergibt sich eine positive Korrelation zwischen Ausprägung der Ursachenzuschreibung und Ausprägung der Symptomatik. Dabei beruht der Zusammenhang vor allem auf der Skala ON des KKU. Mit anderen Worten: Je stärker die Symptomatik ist, desto mehr sind Patienten geneigt, organische Ursachen ihrer Beschwerden anzunehmen (Tab. 12). Dieser Befund wird durch das Streudiagramm (Abb. 3) grafisch verdeutlicht. Die Zuschreibung auf psychosoziale Ursachen zeigt sich dagegen zweitrangig: es besteht nur ein schwacher Zusammenhang zur An- 65 zahl der Symptome, zur Intensität der Symptome besteht kein signifikanter Zusammenhang. Tab. 12: Korrelationen Symptom- Intensitäts Score PS zahl (T0) score(T0) (T0) Score ON Gesamt (T0) summe T0 Symptomzahl (T0) Korrelation n. Pearson ,315* ,532** ,495** Signifikanz (2-seitig) ,027 ,000 ,000 49 49 49 Korrelation n. Pearson ,228 ,475** ,398** Signifikanz (2-seitig) ,115 ,001 ,005 49 49 49 N Intensitätsscore(T0) N Score PS (T0) Korrelation nach Pearson ,315* ,228 ,212 ,910 Signifikanz (2-seitig) ,027 ,115 ,105 ,000 49 49 60 60 ,532** ,475** ,212 ,599 ,000 ,001 ,105 ,000 49 49 60 60 ,495** ,398** ,910 ,599 ,000 ,005 ,000 ,000 49 49 60 60 N Score ON (T0) Korrelation n. Pearson Signifikanz (2-seitig) N Gesamtsumme (T0) Korrelation n. Pearson Signifikanz (2-seitig) N ** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. * Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 66 Abb. 3: Beziehung zwischen Symptomzahl und organischer Ursachenzuschreibung (T0) 40 30 Symptomzahl (T0) 20 10 0 80 100 120 140 160 180 200 220 240 Score ON (T0) Die unterschiedliche starke Ausprägung der somatoformen Symptomatik in den beiden untersuchten Patientengruppen vor der Behandlung, lässt ,wenn auch statistisch nicht signifikant, eine Überprüfung des Einflusses der Gruppenzugehörigkeit auf die Berechnung der Korrelationen sinnvoll erscheinen. In der Tabelle 13 sind die Korrelationskoeffizienten der beiden Gruppen einander gegenübergestellt. Der Übersicht halber erfolgt lediglich die Darstellung für die beiden einzelnen KKU-Skalen gegenüber der Symptomzahl im SOMS-7. Tab. 13: Korrelationen im Gruppenvergleich Symptomzahl (T0) Gr. A Gr. B Score PS (T0) Gr. A Gr. B Score ON (T0) Gr. A Gr. B ,413 ,143 14 ,698** ,006 14 ,456** ,006 35 ,241 ,257 24 ,189 ,269 36 Symptomzahl (T0) Korr. nach Pearson Signifikanz (2-seitig) N Score PS (T0) Korr. nach Pearson Signifikanz (2-seitig) N ,413 ,143 14 ,320 ,061 35 ,320 ,061 35 Score ON (T0) Korr. nach Pearson ,698** ,456** ,241 ,189 Signifikanz (2-seitig) ,006 ,006 ,257 ,269 N 14 35 24 36 ** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 67 Auch im Gruppenvergleich bestätigt sich der oben geschilderte Zusammenhang zwischen Symptomatik und Ausprägung der organischen Ursachenzuschreibung. Zwischen psychosozialen Ursachen und Symptomanzahl besteht in beiden Gruppen kein signifikanter Zusammenhang. 7.2. Verändert sich das Krankheitskonzept der Patienten mit somatoformen Symptomen im Laufe der Therapie? Verändert sich das Krankheitskonzept der Patienten mit somatoformen Symptomen durch die Behandlung bei einem psychosomatisch geschulten Hausarzt? Die erste Teilfrage dieser Fragestellung (s.S.40) bezieht sich auf eine Veränderung des Krankheitskonzeptes in der gesamten Stichprobe. Denn bei beiden untersuchten Gruppen erfolgte die Behandlung durch psychosomatisch geschulte Hausärzte. Hierzu wurden die Mittelwerte der Scores der beiden KKU-Skalen (psychosoziale Ursachen – PS und organisch/naturalistische Ursachen – ON) sowie der Gesamtsumme zu den beiden Messzeitpunkten vor und nach Behandlung miteinander verglichen (T-Test für gepaarte Stichproben). Es zeigt sich, dass im Laufe der Behandlung von Patienten mit somatoformen Symptomen entgegen der Erwartung keine signifikante Veränderung des Krankheitskonzeptes eintritt (Tab. 14). Tab. 14: Veränderung des Krankheitskonzeptes unter Therapie (T-Test für gepaarte Stichproben) Mittelwert N Standard- p abweichung Score PS Score ON Gesamtsumme (TO) 171,90 49 40,38 (T1) 168,24 49 40,86 (T0) 151,56 50 32,04 (T1) 152,16 50 33,87 (T0) 67,19 49 12,12 (T1) 66,48 49 13,78 ,496 ,860 ,676 68 Ist die Veränderung des Krankheitsverständnisses unterschiedlich in den beiden untersuchten Gruppen? Trotz dieses Ergebnisses für die Gesamtstichprobe soll im zweiten Teil der Fragestellung untersucht werden, ob sich im Gruppenvergleich Unterschiede in der Veränderung des Krankheitskonzeptes ergeben. Dazu wurde in einer Varianzanalyse mit dem „Allgemeinen linearen Modell“ die Veränderung über die Zeit innerhalb der Gruppen im Verhältnis zueinander berechnet (ZEIT * GRUPPE). Die Berechnung erfolgte wiederum für die drei Kriterien: Skala psychosoziale Ursachen – PS, Skala organisch/ naturalistische Ursachen – ON, Gesamtsumme. Hier zeigt sich eine Tendenz zur Abnahme der Ursachenzuschreibungen in der Interventionsgruppe, die insbesondere und entgegen der Erwartung auf einer geringer ausgeprägten Annahme psychosozialer Ursachen beruht. Dieser Effekt ist bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p = 0,062 tendenziell bedeutsam, jedoch nicht signifikant (s. Tab.: 15). Graphisch wird dieser Befund in den Abbildungen 4 - 6 verdeutlicht Tab. 15: Veränderungen des Krankheitskonzeptes im Gruppenvergleich (Varianzanalyse) Mittelwert (SD) Score PS Score ON Gesamt Gruppe A Gruppe B (TO) 171,35 (48,40) 172,35 (33,43) (T1) 156,64 (39,31) 177,68 (40,34) (T0) 145,97 (34,86) 156,32 (29,25) (T1) 141,60 (36,35) 161,16 (29,33) (T0) 66,07 (14,48) 68,10 (9,99) (T1) 61,92 (13,27) 70,21 (13,29) Signifikanz ZEIT ZEIT * GRUPPE 0,374 0,061 0,945 0,179 0,535 0,062 69 Abb. 4: Veränderung der Skala PS während der Therapie 180 178 KKU- Skala PS 172 171 170 160 Gruppe 157 Gruppe A Gruppe B 150 1 2 ZEIT Abb. 5: Veränderung der Skala ON während der Therapie 170 160 161 156 KKU - Skala ON 150 146 Gruppe 142 140 Gruppe A Gruppe B 130 1 2 ZEIT Abb. 6: Veränderung der Gesamtsumme während der Therapie 72 70 70 KKU - Gesamtsumme 68 68 66 66 64 Gruppe Gruppe A 62 62 Gruppe B 60 1 ZEIT 2 70 Korreliert eine Veränderung des Krankheitskonzeptes in Richtung einer Psychogenese mit einer Verbesserung der Symptomatik? Die Veränderung des Krankheitskonzeptes wurde operationalisiert als eine Differenz der Skalenwerte zwischen den Messzeitpunkten: • Veränderung PS = PS (T1) – PS (T0) • Veränderung ON = ON (T1) – ON (T0) In analoger Weise wurde mit den beiden Werten des SOMS-7, Symptomzahl und Intensitätsindex verfahren: • Verbesserung Symptomzahl = Symptomzahl (T0) – Symptomzahl (T1) • Verbesserung Intensität = Intensität (T0) – Intensität (T1) Entsprechend der Hypothese wäre anzunehmen, dass die Veränderung PS einen positiven Wert annehmen sollte [PS (T1) > PS (T0)] und positiv mit einer Verbesserung im SOMS korreliert. Dies bestätigt sich jedoch nicht (s. Tab. 16). Nach Berechnung des Korrelationskoeffizienten nach Pearson, gibt es keine signifikante Korrelation zwischen der Veränderung des Krankheitskonzeptes und der Veränderung der Symptomatik, weder in Bezug auf psychische noch auf organische Ursachen. Letzteres wäre nach dem obigen Befund einer Korrelation zwischen organischer Ursachenzuschreibung und Ausmaß der somatoformen Symptomatik plausibel gewesen. Bemerkenswert ist eine hochsignifikant korrelierte gleichsinnige Veränderung beider Skalen ON und PS: Je mehr sich eine Ursachenskala verändert, sei es in Richtung einer vermehrten oder verminderten Ursachenzuschreibung, desto mehr und in die selbe Richtung verändert sich auch die andere Skala. 71 Tab. 16 :Korrelationen der Veränderungen Veränderung Veränderung Verbesserung Verbesserung PS ON Symptomzahl Intens.index Veränderung PS Korrelation n. Pearson Signifikanz (2-seitig) N ,505 ,000 49 Veränderung ON Korrelation n. Pearson Signifikanz (2-seitig) N ,505 ,000 49 Verbesserung Symptomzahl Korrelation n. Pearson Signifikanz (2-seitig) N -,117 ,490 37 ,094 ,582 37 Verbesserung Intensitätsindex Korrelation n. Pearson Signifikanz (2-seitig) N -,248 ,138 37 ,041 ,809 37 -,117 ,490 37 -,248 ,138 37 ,094 ,582 37 ,041 ,809 37 ,899 ,000 38 ,899 ,000 38 7.3. Hat das Krankheitskonzept einen Einfluss auf das Behandlungsergebnis? Zur Bearbeitung dieser Frage wurde die Stichprobe in Untergruppen unterteilt. Es wurden jeweils 2 Perzentilgruppen gebildet, um Patienten mit hoher und niedriger Ausprägung eines psychosozialen bzw. organischen Krankheitskonzeptes zusammenzufassen. Die Summenwerte der Krankheitskonzept-Skalen lagen bei den entsprechenden Patienten damit über bzw. unter dem Median der entsprechenden Skala zum Zeitpunkt T0. Dadurch ergeben sich folgende Fallzahlen mit kompletten Datensätzen, die Mittelwertvergleiche über beide Messzeitpunkte ermöglichen (Tab. 17, 18): 72 Tab. 17: 2 Perzentilgruppen nach Ausprägung psychischer Ursachenvorstellung n davon Gruppe A Gruppe B PS (T0) < Median 19 7 12 PS (T0) > Median 19 5 14 Tab. 18: 2 Perzentilgruppen nach Ausprägung organischer Ursachenvorstellung n davon Gruppe A Gruppe B ON (T0) < Median 17 7 10 ON (T0) > Median 21 5 16 Zur Beantwortung der Teilfrage, ob Patienten mit höherer Ausprägung eines psychischen Krankheitskonzeptes mehr von einer hausärztlichen Behandlung der somatoformen Symptomatik profitieren, wurden die Mittelwerte der beiden Kennzahlen des SOMS-7 (Symptomzahl und –Intensität) getrennt in den beiden Perzentilgruppen einem T-Test unterworfen. Signifikante Unterschiede ergaben sich nicht. So hat also die Ausprägung eines psychosozialen Krankheitskonzeptes entgegen der Hypothese keinen Einfluss auf den Behandlungserfolg bei der untersuchte Stichprobe. Ebenso wenig ergaben sich bei der Untersuchung der beiden Gruppen mit starker oder schwacher organischnaturalistischer Ursachenattribution Unterschiede im Behandlungserfolg. Die geschilderte Überprüfung des Einflusses des Krankheitskonzeptes auf den Behandlungserfolg betraf Patienten aus Interventions- und Kontrollgruppe. Es ist denkbar, dass sich bei getrennter Betrachtung dieser beiden Gruppen Unterschiede darstellen. Die in spezifischen psychosozialen Interventionen trainierten Hausärzte der Gruppe A könnten z.B. gerade bei Patienten mit wenig psychisch ausgeprägten Krankheitskonzept bessere Behandlungserfolge erzielen als die Hausärzte ohne ein solches Training. Die entsprechende Hypothese (3.2, s. S. 41) wurde über eine Varianzanalyse nach dem Allgemeinen Linearen Modell überprüft. Dabei wurde bei beiden Perzentilgruppen beider Skalen der zeitlichen Verlauf der Symptomatik, jeweils getrennt nach Interventions- und Kontrollgruppe betrachtet. Es ergaben sich keine signifikanten Gruppenunterschiede im zeitlichen Verlauf. Also muss auch diese Hypothese verworfen werden. Es bestätigt sich auch bei getrennter Betrachtung von Interventions- und Kontrollgruppe der Befund, dass in der untersuchten Stichprobe von Patienten mit somatoformen Symptomen das Krankheitskonzept keinen Einfluss auf den Behandlungserfolg hat. 73 8. Diskussion Vor einer Diskussion der Ergebnisse sollen Studiendesign und die angewandten Methoden einem kritischen Blick unterworfen werden. Die vorliegende Arbeit ist Teil einer Pilotstudie zur hausärztlichen Behandlung von Patienten mit somatoformen Symptomen. Sie fokussiert die Krankheitskonzepte und deren Veränderung im Lauf der Behandlung. Weitere Dissertationen aus derselben Arbeitsgruppe beleuchten andere Kriterien (bislang: POMMERSHEIM, 2001; hier findet sich auch eine Analyse der sozidemographischen Daten der vorliegenden Untersuchung [pp 66-67]). Es handelt sich hier um eine kontrollierte Studie. Eine Randomisierung der Behandler wurde jedoch nicht durchgeführt; die Hausärzte wurden in den beiden Gruppen gesondert rekrutiert. Die Ärzte beider Gruppen zeigen sich an psychosomatischen Fragestellungen interessiert, was die vorausgegangene Teilnahme am Curriculum zur Psychosomatischen Grundversorgung belegt. Die Ärzte der Interventionsgruppe zeigten ein darüber hinausgehendes Interesse, da sie überwiegend auch an weiteren Aktivitäten der Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin der Universität Freiburg teilgenommen hatten. Dies zeigt sich auch in der höheren Qualifikation: 2 Ärzte der Interventionsgruppe besitzen die Zusatzausbildung Psychotherapie. Diese Unterschiede wirkten sich offensichtlich nicht auf das Ergebnis der Untersuchung aus, da keine signifikanten Gruppenunterschiede im Sinn der formulierten Hypothesen zu verzeichnen waren (s.u.). Die Durchführung der Behandlung wurde von den Behandlern selbst zeitlich und inhaltlich dokumentiert. Eine objektive Überprüfung der „Manualtreue“ der Interventionsgruppe war also nicht möglich und auch nicht intendiert. Das Manual stellt keine strikte Handlungsanweisung dar, sondern ein „Leitfaden“ der die „Grundlagen des therapeutischen Vorgehens in einem therapeutischen Setting“ skizziert (s. Anhang). Die vorgeschlagene Frequenz von 6 Behandlungen in 14-tägigem Abstand mit 20-minütiger Dauer wurde in beiden Gruppen nicht durchgehend eingehalten; Den Behandlungsprotokollen zufolge erhielten die Patienten der Interventionsgruppe im Mittel 4,0 Sitzungen à 20,0 Minuten, die der Kontrollgruppe 4,1 Sitzungen à 14,5 Minuten. Auch dieser Unterschied wirkte sich nicht als Gruppenunterschied in den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung aus. 74 Besser kontrollierte Bedingungen im Sinne einer experimentellen Studie wären also ev. von einem theoretischen Standpunkt aus wünschenswert gewesen. Dies entspräche dann jedoch kaum noch den Alltagsbedingungen an der medizinischen Basis, wo universitätsfern- die Behandlungen sehr stark individualisiert und geprägt von Erfahrungen, Routinen und den Persönlichkeiten von Arzt und Patient verlaufen. Aus dieser Sicht ist einem „naturalistischen Studiendesign“ wie in der vorliegenden Untersuchung den Vorzug zu geben. Die Diskussion um die angemessene Methodik zur Erfassung subjektiver Krankheitskonzepte wurde bereits in der Literaturübersicht im Theorieteil dieser Arbeit erörtert (Kap. 2.4). Danach ergeben sich für die beiden grundsätzlichen Erhebungsmethoden, Fragebogen vs. inhaltsanalytisch ausgewertete Interviews, spezifische Vorteile und Einschränkungen. So kann nach FALLER et al. (1991) der eher statische Aspekt subjektiver Theorien gut durch Fragebogendaten erfasst werden, während der dynamische Aspekt mit seiner Vielgestaltigkeit, Widersprüchlichkeit und Emotionsabhängigkeit nur im qualitativen Interview angemessen abgebildet werden kann. Ein weiterer Aspekt ist der spezifische situative Kontext des Interviews im Rahmen eines medizinischen Settings, der andere Krankheitskonzepte aktualisiert als ein in häuslicher Umgebung und anonym ausgefüllter Fragebogen. Die Entscheidung für den Zugang über einen Fragebogen erfolgte zunächst aus ökonomischen Gründen: Die Erfassung von Krankheitskonzepten stellte im Rahmen des durchgeführten Projektes lediglich einen Teilaspekt dar. Insgesamt musste ein Vorgehen gewählt werden, das sowohl für die involvierten Hausärzte als auch für die behandelten Patienten praktikabel erschien. Eine erhöhte zeitliche Belastung, z.B. durch wiederholte Interviews, hätte voraussichtlich die Bereitschaft zur Teilnahme an der Studie seitens der Ärzte und der Patienten beeinträchtigt und dadurch auch zu einer vermehrten Selektion in Richtung von hochmotivierten Teilnehmern geführt. Damit stellt sich die Studie den durch das gewählte Verfahren gegebenen Einschränkungen. Die individuell „wirklich“ vorhandenen Krankheitskonzepte können durch ein Rating von vorgegebenen Items nicht umfassend abgebildet werden. Dies war in der vorliegenden Untersuchung auch nicht intendiert. Für einen Gruppenvergleich auf Skalenebene stellt das Verfahren dagegen eine adäquate Methode dar. 75 Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung lassen sich – entsprechend den Fragestellungen – wie folgt zusammenfassen: • Patienten mit multiplen somatoformen Symptomen, die eine hausärztliche Behandlung aufsuchen, haben ein differenziertes Krankheitskonzept. Dieses lässt sowohl psychosoziale als auch organisch-naturalistische Ursachenvorstellungen zu. Je ausgeprägter jedoch die Symptomatik ist, desto betonter ist die organische Ursachenzuschreibung. • Das Krankheitskonzept der Patienten ändert sich nicht signifikant durch eine hausärztliche Behandlung im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung. Auch spezifische psychosoziale Interventionen durch darin geschulte Hausärzte führen nicht zu einer Veränderung der Krankheitskonzepte. • Dabei hat das Krankheitskonzept keinen Einfluss auf das Behandlungsergebnis im Sinn einer symptomatischen Verbesserung. Diese ist unabhängig davon, ob psychosoziale oder organische Ursachenzuschreibungen vorherrschen. Der erste genannte Befund überrascht, umso mehr als nach der vorliegenden Untersuchung psychosoziale Ursachenvorstellungen einen sogar noch größeren Stellenwert haben als organische. Dies zeigt sich zum einen bei der Betrachtung der einzelnen Items: Items mit einer Aussage bezüglich einer psychosozialen Genese werden häufiger genannt als Items mit einer organischen Aussage. So finden sich in der Rangreihe, die sich aus den durchschnittlichen Ratings der Items ergibt, unter den ersten 10 Items lediglich zwei aus der Skala „organische/ naturalistische Ursachen (ON)“. Zu beachten ist dabei, dass den 16 Items dieser Skala (ON) 25 Items der Skala „psychosoziale Ursachen (PS)“ gegenüberstehen. Auf Skalenebene ergibt sich ein hochsignifikant höher ausgeprägter Score der Skala PS gegenüber dem Score der Skala ON (Score(PS) = 171,88. Score(ON) = 151,29. p = 0,001). Die Hypothese postulierte das Gegenteil, entsprechend allgemeiner Vorstellungen über das Krankheitsbild, und dem was die diagnostischen Kriterien nach ICD-10 nahe legen. Der Befund ist jedoch konsistent mit den vorliegenden Ergebnissen aus der Literatur, 76 soweit eine Vergleichbarkeit bei unterschiedlichen methodischen Zugängen und unterschiedlicher Definition des untersuchten Krankheitsbildes möglich ist. In allen verfügbaren Untersuchungen zeigten „somatoforme“ Patienten ein differenziertes Krankheitskonzept, eines das auch für eine psychische Ursache offen ist. Einige Untersuchungen zeigen lediglich im Vergleich von Patienten mit unterschiedlichen psychiatrischen Diagnosen eine geringere Ausprägung psychischer Ursachenvorstellungen bei Patienten mit somatoformen (bzw. funktionellen) Symptomen (NÜBLING 1992, FALLER 1997, LANGEWITZ et al. 1998, WÄLTE et al. 1999). Andere Untersuchungen konnten dagegen auch im Vergleich von Diagnosegruppen keine signifikanten Unterschiede bezüglich des Krankheitskonzepts erheben (LANGOSCH 1996, PETERS et al 1997). Ein solcher Vergleich mit anderen Diagnosen oder mit einer gesunden Bevölkerung war in der vorliegenden Untersuchung nicht intendiert. Die vorliegende Arbeit bestätigt die Meinung von LANGEWITZ et al. (1998), dass Patienten mit ‘funktionellen Störungen’ ein Bedürfnis haben, ihre subjektive Symptomatik mit Hilfe unterschiedlicher Konzepte zu erklären. In der überwältigenden Mehrzahl von Untersuchungen zu Krankheitskonzepten bzw. Kausalattributionen, gleich welches Krankheitsbild betreffend, lassen sich -wie hier- mehrere „Unter“-Konzepte abbilden, die durchaus widersprüchlich erscheinen können. Das komplexe Netzwerk von Voraussetzungen und Funktionen von Ursachenvorstellungen und subjektiven Theorien, wie im ersten Teil der vorliegenden Arbeit beschrieben, macht diese Varianz plausibel. Eine Ausnahme bildet lediglich eine Gruppe von Patienten, die als „pure“ oder „true somatizer“ (nach BRIDGES & GOLDBERG 1985 bzw. KIRMAYER & ROBBINS 1996) Symptome einer psychischen Erkrankung, insbesondere Angst und Depression, rein somatisch attribuieren. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die untersuchten Patienten mit somatoformen Symptomen keine „true somatizer“ sind, sondern über ein mehrdimensionales Krankheitskonzept verfügen. Wie kommt es zum „Ruf“ von Patienten mit somatoformen Symptomen, sie seien hartnäckige Somatisierer? Eine Antwort gibt möglicherweise der Befund, dass das Ausmaß der organischen Ursachenzuschreibung mit der Anzahl und Ausprägung der Symptome positiv korreliert. Die Mehrzahl von bisherigen Untersuchungen zu somatoformen Störungen erfasste zum einen häufig Patienten mit einer stärker ausgeprägten Symptomatik (z.B. im Sinn des Vollbilds einer Somatisierungsstörung nach ICD-10/ DSM-IV), zum 77 anderen Patienten aus einer anderen Versorgungsstufe (z.B. Universitätsambulanz). Gerade den letzten Punkt betonen bereits PETERS et al. (1997), die zu ihrer Untersuchung ebenfalls Patienten aus der Primärversorgung rekrutierten. Überlegungen und Untersuchungen zur Bedeutung und zum Schicksal von Krankheitskonzepten in der Arzt-Patient-Kommunikation, wie sie hier im Kap. 2.2.5. referiert sind, legen nahe, dass die typische Patientenkarriere bei somatoformen Störungen zu einer Selektion von somatischen Ursachenkonzepten führt. Es sind dies die Konzepte, die das schulmedizinisch ausgebildete Gegenüber am ehesten wahrnimmt und ernst nimmt, Konzepte, die die Kommunikation Arzt-Patient aufrecht erhalten (s. LANGEWITZ et al. 1998) bzw. die die Position des Patienten in der Kommunikation stärken können (s. PETERS et al. 1998). Pointierter ausgedrückt, wäre die einseitige Betonung von organischen Ursachenvorstellungen das Ergebnis einer iatrogenen Fixierung. Diese Hypothese sollte in einer weiterführenden Untersuchung überprüft werden, indem die Konzepte miteinander verglichen werden ,die Patienten aus unterschiedlichen Versorgungsstufen, bzw. mit unterschiedlicher Anzahl von in der Behandlung involvierten (Fach-)Ärzten vorbringen. Eine Unterstützung dieser Hypothese könnte auch der Befund sein, dass mit stärkerer Ausprägung der körperlichen Symptomatik auch die somatische Ursachenzuschreibung stärker wird. Es ist anzunehmen (und zu überprüfen), dass eine stärkere Symptomatik auch mit häufigeren Arztbesuchen einhergeht. Die Zuschreibung auf psychosoziale Ursachen zeigt sich dagegen nur in geringem Maße von der Ausprägung der Symptomatik abhängig: es besteht nur eine schwache Korrelation mit der Anzahl der Symptome. Zur Intensität der Symptome besteht kein signifikanter Zusammenhang. Eine gewisse Enttäuschung ist der Befund zur zweiten Fragestellung. Hier zeigt sich möglicherweise ein Deckeneffekt: Bereits initial sind psychosoziale Ursachenvorstellungen höher als erwartet ausgeprägt. Im Rahmen der durchgeführten Behandlungen gelang es nicht, das Krankheitskonzept der Patienten hin zu noch mehr psychischen Ursachenvorstellungen zu modifizieren. Hier erbrachten auch die zusätzlich in spezifischen psychosozialen Interventionen geschulten Hausärzte, die die Behandlung am vorgestellten Manual orientiert durchführten, keine „besseren“ Ergebnisse. Gilt doch eine entsprechende „Krankheitseinsicht“ als Schlüssel zu einer Behandlungserwartung und damit Compliance im Sinn einer Veränderungs- und Therapiemotivation (s. Kap. 2.2.4). Dementsprechend stellt auch die Modifikation des Krankheitsverständnisses einen we- 78 sentlichen Teil des Behandlungsmanuals dar, das hier zur Anwendung kam. Dass eine Veränderung der Konzepte durch begrenzte Interventionen möglich ist, zeigten LUPKE et al. 1995 in der erwähnten Untersuchung (Kap.4.3) in einem psychologischen Konsilund Liaisondienst an einem Allgemeinkrankenhaus. Eine kognitive Umstrukturierung, so der verhaltenstherapeutischer Terminus für eine Veränderung von Konzepten im Rahmen einer Therapie, geht über das hinaus, was eine Psychosomatische Grundversorgung durch Hausärzte im Allgemeinen leistet. Auch lässt sich kritisch hinterfragen, ob die vorgestellten spezifischen psychosozialen Interventionen nach dem Manual und das Training dazu ausreichend auf den Aspekt der Krankheitskonzepte und deren Veränderung fokussieren und ob der Rahmen des Manuals mit 6 Sitzungen des Hausarztes à 20 min überhaupt ausreichend sein kann, um entsprechende Veränderungen zu initiieren. Die zitierte Untersuchung von LUPKE et al. (1995) kann nur bedingt zum Vergleich herangezogen werden, da hier ein anderer situativer und zeitlicher Rahmen für die Interventionen zur Verfügung stand und diese von geschulten Verhaltenstherapeuten durchgeführt wurden. Der etwas enttäuschende Befund der mangelnden Effizienz der untersuchten Behandlungen hinsichtlich der Veränderung des Krankheitskonzeptes relativiert sich jedoch durch die Befunde zur dritten Fragestellung. Demnach hat weder das vor Behandlung vorliegende Krankheitskonzept, noch eine Veränderung desselben (in Richtung Psychogenese) unter der Behandlung eine signifikante Auswirkung auf den Behandlungserfolg, gemessen als Verringerung von Anzahl und Intensität der somatoformen Symptome. Hat also der Aspekt der Krankheitskonzepte eine untergeordnete Bedeutung hinsichtlich symptomatischer Verbesserung? Dem gegenüber steht die Untersuchung von MORRISS et al. (1999) an Patienten mit psychischen Störungen, die medizinisch nicht erklärte Symptome aufwiesen. Von einer Behandlung durch trainierte Allgemeinmediziner profitierten hier die Patienten deutlich mehr, die an eine nur zum Teil organische Ursache ihrer Beschwerden glaubten, im Gegensatz zu denen, die von einer rein organischen Ursache überzeugt waren. Hier bedarf es zur Klärung weiterer Untersuchungen. Bei der vorliegenden zeigte keiner der untersuchten Patienten eine rein organische Ursachenzuschreibung. Zudem erlaubte die geringe Fallzahl lediglich eine Differenzierung der untersuchten Patienten in zwei Perzentilgruppen. Darüber hinaus erfasst die Operationalisierung von Behandlungserfolg als Symptomverbesserung wesentliche weitere 79 Kriterien nicht, so z.B. die Verbesserung der Lebensqualität oder die Reduktion der Inanspruchnahme des Gesundheitssystems und damit der krankheitsbezogenen Kosten. Gerade unter letztem Gesichtspunkt wäre es interessant zu untersuchen, ob eine Veränderung des Krankheitskonzeptes eine Verringerung von Überweisungen, kostenintensiven Untersuchungen und Verschreibungen nach sich zieht. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung können möglicherweise einen Beitrag leisten zum besseren Management von Patienten mit somatoformen Symptomen. Die Ergebnisse machen bescheiden, was die Erfolge für gezielte Interventionen im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung durch Hausärzte betrifft. Dies zu berücksichtigen, beugt einer frühzeitigen Frustrierung der Hausärzte vor, einer Frustrierung, die wesentlich zu der typischen leidvollen „Patientenkarriere“ der Betroffen beiträgt. Stattdessen kann das Wissen um die Mehrdimensionalität von Ursachenvorstellungen neugierig machen, ein offenes Weiterfragen ermöglichen und so die Kommunikation zwischen Arzt und Patient in einer für beide befriedigenden Weise in Gang halten. Wenn dann auch der Arzt oder die Ärztin sich den eigenen, in der Regel wohl ebenfalls mehrdimensionalen Ursachenvorstellungen bewusst wird, wie der Erfahrung, dass linearkausale Ursachen-Handlungs-Optionen den Betroffenen üblicherweise nicht gerecht werden, kann ein partnerschaftlicher Dialog möglich werden, in dem beide Interaktionspartner an einer für beide akzeptierbaren und vielleicht immer wieder vorläufigen Wirklichkeit arbeiten. So könnte sich der Patient oder die Patientin besser verstanden wissen und sich vertrauensvoll auf eine hausärztliche Führung einlassen. 80 9. Zusammenfassung Patienten mit somatoformen Symptomen gelten häufig bei ihren behandelnden Hausärzten als schwierig, frustrierend und zeitraubend. Dazu trägt wesentlich eine Meinung bei, nach der diese Patienten hartnäckig an einer Weigerung festhalten, andere als organische Ursachen ihrer Beschwerden anzunehmen. Die vorliegende Untersuchung fokussiert die subjektiven Krankheitskonzepte dieser Patienten in der Primärversorgung. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche Vorstellungen betroffene Patienten von der Verursachung ihrer Beschwerden haben und ob es Zusammenhänge zwischen diesen Krankheitskonzepten und der Symptomatik gibt. Darüber hinaus wird untersucht, welchen Verlauf die Krankheitskonzepte während der hausärztlichen Behandlung im Rahmen der Psychosomatischen Grundversorgung einerseits und spezifischer psychosozialer Interventionen andererseits haben und ob das Krankheitskonzept einen Einfluss auf das Behandlungsergebnis hat.. Dabei bestätigen sich vorhergehende Untersuchungen, nach denen Patienten mit somatoformen Störungen ein differenziertes Krankheitskonzept haben, das somatische wie psychosoziale Ursachen zulässt. In der vorliegenden Untersuchung anhand eines Fragebogens ergibt sich sogar das Bild einer überwiegenden psychosozialen Ursachenzuschreibung. Dabei korreliert jedoch eine stärkere Symptomatik mit einem verstärkten organischen Krankheitskonzept. Die hausärztliche Behandlung im Rahmen der Psychosomatischen Grundversorgung konnte ebenso wenig wie darüber hinaus gehende, manualgestützte psychosoziale Interventionen das Krankheitskonzept modifizieren. Jedoch zeigte sich das Behandlungsergebnis (d.h. der Verlauf der Symptomatik) unabhängig von Ausprägung und Verlauf der Ursachenvorstellungen. Diese Ergebnisse können einen Beitrag leisten zum besseren Management von Patienten mit somatoformen Symptomen. Die Ergebnisse machen bescheiden, was die Erfolge für gezielte Interventionen im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung durch Hausärzte betrifft. Sie ermutigen jedoch zu einem offenen Dialog zwischen Arzt und Patient, der eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Führung des Patienten ermöglicht. 81 10. Literatur AHRENS, S; ELSNER H (1981). Empirische Untersuchungen zum Krankheitskonzept bei neurotischen, psychosomatischen und somatischen Patienten. Teil I u. II. Medizinische Psychologie 7: 95-109, 175-190 APA (American Psychiatric Association) (1980). Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders, 3rd ed.. Washington D.C.: APA. APA (American Psychiatric Association) (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders, 4th ed.. Washington D.C.: APA. AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften) (1998). Leitlinien der deutschen Gesellschaft für Psychotherapeutische Medizin: Leitlinie somatoforme Störungen 1. Internet-Dokument. ARMBRUSTER, U (1997). Psychosomatische Grundversorgung: Erwartungen von Patientinnen und Patienten an ihre Hausärztinnen und Hausärzte. Med. Diss., Freiburg/Brsg. Balint, M (1964). The doctor, his patient, and the illness. London: Pitmann Medical Publishing BARSKY, AJ, BORUS, JF.(1999). Functional somatic syndromes. Annals of Internal Medicine. 130(11):910-21 BECKER, H (1984). Die Bedeutung der subjektiven Krankheitstheorie des Patienten für die Arzt-Patienten-Beziehung. Psychotherapie, Medizinische Psychologie 34:313-321 BISCHOFF ,C; ZENZ, H (HG) (1989). Patientenkonzepte von Körper und Krankheit. Bern: Huber BISHOP, GD (1987). Lay conception of physical symptoms. Journal of Applied Social Psychology 17:127-46 BRIDGES, KW, GOLDBERG, DP (1985). Somatic presentation of DSM III psychiatric disorders in primary care. Journal of Psychosomatic Research 29(6): 563-569 82 BULLINGER, M, KIRCHBERGER, I (1998). SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand: Handanweisung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe COPE, H, DAVID, A, MANN, A (1994). "Maybe it´s a virus?": Belief about viruses. Journal of Psychosomatic Research 38:89-98 DILLING, H, MOMBOUR, W, SCHMIDT, MH (Hg.) (1991). Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V (F): Klinisch-diagnostische Leitlinien, Weltgesundheitsorganisation. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber DILLING, H, MOMBOUR, W, SCHMIDT, MH, SCHULTE-MARKWORT (Hg.) (1994). Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V (F): Forschungskriterien, Weltgesundheitsorganisation. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber EPSTEIN, RM, QUILL, TE, MCWHINNEY, IR (1999). Somatization Reconsidered: Incorporating the Patient's Experience of Illness. Archives of Internal Medicine 159; 3; 21522 ESCOBAR, JI, RUBIO-STIPEC, M, CANINO, G, KARNO, M (1989). Somatic Symptom index (SSI): A new and abriged somatization construct - Prevalence and epidemiological correlates in two large community samples. Journal of Nervous and Mental Desease, 177: 140-146 FAHRENBERG, J (1994). Somatic complaints in the German population. Journal of Psychosomatic Research 39(7): 809-817 FALLER, H (1983). Subjektive Krankheitstheorien als Forschungsgegenstand von Volkskunde und medizinischer Psychologie. Curare 6: 163-180 FALLER, H (1989). Subjektive Krankheitstheorie des Herzinfarkts. In :.Bischoff, C, Zenz, H (Hg.). Patientenkonzepte von Körper und Krankheit. Bern, Stuttgart, Toronto: Huber FALLER, H (1989b). Das Krankheitsbild von Herz-Kreislauf-Kranken – ein Gruppenund Methodenvergleich. In:.Bischoff C, Zenz H (Hg.). Patientenkonzepte von Körper und Krankheit. Bern, Stuttgart, Toronto: Huber 83 FALLER, H (1997). Subjektive Krankheitstheorien bei Patienten einer psychotherapeutischen Ambulanz. Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie 45:264-78 FALLER, H (1998). Somatisierung, Krankheitsattribution und Public Health. Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie 46(3), 193-214 FALLER, H (1998b). Behandlungserwartungen bei Patienten einer psychotherapeutischen Ambulanz. Psychotherapeut 43: 8-17 FALLER, H (1999). Somatoforme Störungen - neue oder alte Krankheitsbilder?. In: Berufsverband Deutscher Psychologen/ Arbeitskreis Klinische Psychologie in der Rehabilitation: Somatoforme Störungen - Diagnostik und Therapie in der Rehabilitation. Bonn: Dt. Psychologen-Verl. FALLER, H, SCHILLING, S, LANG, H (1991). Die Bedeutung subjektiver Krankheitstheorien für die Krankheitsverarbeitung. Im Spiegel der methodischen Zugänge. In: FLICK, U (Hg). Alltagswissen über Gesundheit und Krankheit. 28-42. Heidelberg: Asanger FINK, P; SORENSEN, L; ENGBERG, M; HOLM, M; MUNK-JORGENSEN, P (1999). Somatization in primary care. Prevalence, health care utilization, and general practitioner recognition. Psychosomatics 40(4): 330-8 FLICK, U (1998). Subjektive Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit. In:Flick, U (Hg). Wann fühlen wir uns gesund?: Subjektive Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit. Weinheim, München: Juventa FLICK, U (HG.) (1998). Wann fühlen wir uns gesund?: Subjektive Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit. Weinheim, München: Juventa FLICK, U (HG.) (1991). Alltagswissen über Gesundheit und Krankheit. Heidelberg: Asanger FÖRSTERLING, F (1994). Attributionstheorien in der Klinischen Psychologie: Gemeinsamkeiten mit Kognitiven und Verhaltenstherapien. In: Försterling, F (Hg.). Attrbutionstheorie: Grundlagen und Anwendungen. Göttingen: Hogrefe FÖRSTERLING, F (HG.) (1994). Attrbutionstheorie: Grundlagen und Anwendungen. Göttingen: Hogrefe 84 FRANKE, GH (1995). SCL-90-R – Die Symptomcheckliste von Derogatis: Deutsche Version. Göttingen: Hogrefe FUNKE, U (1989). Effekte einer therapeutischen Modifikation subjektiver Krankheitsursachen und Kontrollannahmen am Beispiel Migräne. In: Bischoff, C, Zenz, H (Hg.). Patientenkonzepte von Körper und Krankheit. Bern, Stuttgart, Toronto: Huber GARCIA-CAMPAYO, J, SANZ-CARILLO, C (1999).A review of the differences between somatizing and psychologizing patients in primary care. International Journal of Psychiatry in Medicine. 29(3):337-45 GARCIA-CAMPAYO, J. LARRUBIA, J. LOBO, A. PEREZ-ECHEVERRIA, MJ. CAMPOS, R. (1997). Attribution in somatizers: stability and relationship to outcome at 1-year followup. Acta Psychiatrica Scandinavica. 95(5):433-8 GERBER, W, HAAG, W (1982). Migräne. Berlin: Springer GIJSBERS VAN WIJK, CMT, KOLK, AM (1997). Sex differences in physical symptoms: The contribution of symptom perception theory. Social Science and Medicine 45(2):231-246 HASENBRING, M (1989). Laienhafte Ursachenvorstellungen und Erwartungen zur Beeinflussbarkeit einer Krebserkrankung - erste Ergebnisse einer Studie an Krebspatienten. In: Bischoff, C, Zenz, H (Hg.). Patientenkonzepte von Körper und Krankheit. Bern, Stuttgart, Toronto: Huber HEIDER, F (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. New York: Wiley & Son - (deutsch: 1977). Die Psychologie der interpersonalen Beziehungen. Stuttgart: Klett HERRMANN, CH, BUSS, U, SNAITH, RP (1995). HADS-D. Hospital Anxiety and Depression Scale - Deutsche Version: Testdokumentation und Handanweisung. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber KAPFHAMMER, HP (2001).Somatisierung - somatoforme Störungen - ätiopathogenetische Modelle. Fortschr Neurol Psychiat 69: 58-77 85 KARLSSON, H. JOUKAMAA, M. LAHTI, I. LEHTINEN, V. KOKKI-SAARINEN, T. (1997). Frequent attender profiles: Different clinical subgroups among frequent attender patients in primary care. Journal of Psychosomatic Research. 42(2):157-66 KAUDERER-HÜBEL, M, ZENZ, H, BUCHWALSKY, R, BRUCH, L (1989).Der Zusammenhang zwischen dem subjektiven Krankheitsbild von Herzinfarktpatienten mit Gesundheitsverhalten und Berufsaufnahme. In: Bischoff, C, Zenz, H (Hg.). Patientenkonzepte von Körper und Krankheit. Bern, Stuttgart, Toronto: Huber KELLNER, R (1987). Hypochondriasis and somatization. JAMA, 258: 2718-2722 KESSLER, D, LLOYD, K, LEWIS, G,GRAY, DP (1999). Cross sectional study of symptom attribution and recognition of depression and anxiety in primary care. British Medical Journal 318: 436-440 KIRMAYER, LJ, ROBBINS, JM, DWORKIND, M, YAFFE, MJ (1993). Somatization and the recognition of depression and anxiety in primary care. .American Journal of Psychiatry 150(5): 734-741 KIRMAYER, LJ, ROBBINS, JM, PARIS, J (1994). Somatoform Disorders: Personality and the social matrix of somatic distress. Journal of Abnormal Psychology 103(1): 125-136 KIRMAYER, LJ, YOUNG, A (1998). Culture and somatization: Clinical, epidemiological, and ethnographic perspectives. Psychosomatic Medicine 60: 420-430 KIRMAYER, LJ, ROBBINS, JM (1996). Patients who somatize in primary care: a longitudinal study of cognitive and social characteristics. Psychological Medicine 26: 937951. KIRMAYER, LR, ROBBINS, JM (1991). Three forms of somatization in primary care: prevalence, co-occurence, and sociodemographic characteristics. Journal of Nervous and Mental Disease 179(11): 647-655 KOHNEN, N (Hg.) (1997). Kognition, Krankheit, Kultur. Bd.1 Ethnomedizin. Band 2, 3 Kognitionspsychologie. Berlin: VWB, Verl. für Wiss. und Bildung KRINGS-NEY, B (2002). Somatoforme Symptome in der hausärztlichen Praxis: Eine empirische Untersuchung zur Häufigkeit, psychischen Symptomatik und Lebensqualität. Med. Diss. Freiburg/ Brsg. 86 LANGEWITZ, W, KISS, A, SCHÄCHINGER, H (1998). Von der Wahrnehmung zum Symptom - vom Symptom zur Diagnose: Somatoforme Störungen als Kommunikationsphänomen zwischen Arzt und Patient. Schweizer Medizinische Wochenschrift 128(7): 232244 LANGOSCH, K (1996). Subjektive Ätiologievorstellungen, Kontrollüberzeugungen und Behandlungserwartungen in der psychosomatischen Rehabilitation - eine Verlaufsstudie. Med. Diss. Freiburg/Brsg. LINDEN, M. (1985). Krankheitskonzepte von Patienten. .Psychiatrische Praxis 12: 8-12 LIPOWSKI, Z.J. (1988). Somatization: the concept and its clinical application. Psychiatry, 145: 1358-1368 LOHAUS ,A; SCHMITT, GM (1989). Fragebogen zur Erhebung von Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit (KKG). Göttingen, Hogrefe LUPKE, U, EHLERT, U, HELLHAMMER D (1995). Verhaltensmedizin im Allgemeinkrankenhaus: Behandlung des Somatisierungsverhaltens. Verhaltensmodifikation und Verhaltensmedizin 16: 3-35 LUPKE, U (1994). Behandlung des Somatisierungsverhaltens im Rahmen eines psychologischen Kosiliar- und Liaisondienstes in einem Allgemeinkrankenhaus .Europäische Hochschulschriften: Reihe 6, Psychologie, 476. .Frankfurt/Main. Lang. MACLEOD, AK, HAYNES, C, SENSKY, T. (1998). Attributions about common bodily sensations: their associations with hypochondriasis and anxiety. Psychological Medicine 28(1): 225-8 MARGRAF, J. (1994). Diagnostisches Kurzinterview bei psychischen Störungen (MiniDIPS). Berlin, Heidelberg, New York: Springer MARSCHALL, P, FULLER, S (1989). Attribution der Gesundheitskontrolle und gelerntes Selbstkontrollvermögen als Vorhersagevariablen von planendem Verhalten und Selbsteffizienz in der Rehabilitation von Herzinfarktpatienten. In: Bischoff, C, Zenz, H (Hg.). Patientenkonzepte von Körper und Krankheit. Bern: Huber 87 MIRANDA, J, PEREZ STABLE, EJ, MUNOZ, RF, HARGREAVES, W, HENKE, CJ (1991). Somatization, psychiatric disorder, and stress in utilization of ambulatory medical services. Health Psychology. 10(1): 46-51 MORRISS, RK, GASK, L, RONALDS, C, DOWNES-GRAINGER, E, THOMPSON, H, GOLDBERG, D. Clinical and patient satisfaction outcomes of a new treatment for somatized mental disorder taught to general practitioners. British Journal of General Practice 49(441): 263-7. MUTHNY, FA (1990A). Persönliche Ursachen für die Erkrankung (PUK). Weinheim: Beltz MUTHNY, FA (1990B). Erkrankungsbezogene Kontrollatributionen (EKOA). Weinheim: Beltz MUTHNY, FA, BECHTEL, M, SPAETE, M (1992). Laienätiologien und Krankheitsverarbeitung bei schweren körperlichen Erkrankungen. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie 42: 41-53 MYRTEK, M (1998). Gesunde Kranke - kranke Gesunde: Psychophysiologie des Krankheitsverhaltens. Bern, Göttingen, Toronto; Seattle: Huber MYRTEK, M, FAHRENBERG, J (1998). Somatoforme Störungen: Konzeptuelle und methodologische Kritik und ein Plädoyer für die funktionale Analyse des Krankheitsverhaltens. In: Margraf, J, Neumer, S, Rief, W (Hrsg.): Somatoforme Störungen. Ätiologie, Diagnose und Therapie. Berlin, Heidelberg, New York: Springer NOYES R JR. LANGBEHN DR. HAPPEL RL. SIEREN LR. MULLER BA. (1999). Health Attitude Survey. A scale for assessing somatizing patients. Psychosomatics. 40(6): 470-8 NÜBLING, R (1992). Psychotherapiemotivation und Krankheitskonzept: Zur Evaluation psychosomatischer Heilverfahren. Frankfurt/Main. VAS OSTKIRCHEN G, WILLWEBER-STRUMPF A (1989, ).Laientheorien bei chronisch rheumatischen Erkrankungen. In: Bischoff C, Zenz H (Hg.). Patientenkonzepte von Körper und Krankheit. Bern, Stuttgart, Toronto: Huber, 1989 PENNEBAKER, JW (1982). The psychology of physical symptoms. New York: Springer 88 PETERS, S, STANLEY, I, ROSE, M, SALMON, P (1998). Patients with medically unexplained symptoms: sources of patients' authority and implications for demands on medical care. Social Science and Medicine 46(4-5): 559-65 PETRIE, KJ, WEINMAN, JA & al. (Ed) (1997). Perceptions of health and illness: Current research and applications. Singapore: Harwood Academic Publishers. PEVELER, R, KILKENNY, L, KINMONTH, AL (1997). Medically unexplained physical symptoms in primary care: A comparison of self-report screening questionnaires and clinical opinion. Journal of Psychosomatic Research, 42(3): 245-252 PFLANZ, M (1958). Über ätiologische Vorstellungen. Die Medizinische (= Die Medizinische Welt) 1: 52-55 PLAUM, FG (1968). Krankheitstheorien und Behandlungserwartungen psychosomatischer Patienten. Med. Diss. Giessen RIEF, W. (1996). Die somatoformen Störungen: Großes unbekanntes Land zwischen Psychologie und Medizin. Zeitschrift für klinische Psychologie, 25: 173-189 RIEF, W., HILLER, W. (1992). Somatoforme Störungen. Körperliche Symptome ohne organische Ursache. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber RIEF, W, HILLER, W, HEUSER, J (1997). SOMS, das Screening für somatoforme Störungen: Manual zum Fragebogen. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber ROBBINS, JM, KIRMAYER, LJ (1991). Attributions of common somatic symptoms. Psychological Medicine 21(4): 1029-45 SACK, M, LOEW, T, SCHEIDT, CE (1998). Diagnostik und Therapie der Somatisierungsstörung und undifferenzierten Somatisierungsstörung: Eine Übersicht zur empirischen Literatur. Zeitschrift für psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 3: 214-232 SASS, H, WITTCHEN; HU, ZAUDIG, M, HOUBEN, I. (1998). Diagnostisches und statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-IV (dt. Bearbeitung). Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe SCHARLOO, M, KAPTEIN, A (1997). Measurement of illness perceptions in patients with chronic somatic illness: a review. In: Petrie, KJ; Weinman, JA. et al. (Ed). ). Percep- 89 tions of health and illness: Current research and applications. Singapore: Harwood Academic Publishers. SCHEER, JW, KLAPP ,BF, LAUBACH ,W, WEILAND ,BJ, SALM ,A (1989). Erfassung von Krankheitskonzepten bei akut kranken somatischen Patienten. In: Bischoff C, Zenz H (Hg.). Patientenkonzepte von Körper und Krankheit. Bern, Stuttgart, Toronto: Huber SCHEER, JW, MÖLLER, L (1976). Krankheitskonzepte psychotherapeutischer Patienten I/ II. Med. Psychologie 1: 13-29/ 30-48 SCHREIBER, U (1993). Chronische Schmerzpatienten: Erfassung des Wissens über psychologische Zusammenhänge der Erkrankung unter besonderer Berücksichtigung der krankheitsbezogenen Kausalattributionen und Kontrollüberzeugungen sowie ihre Einstellung zu Psychologen. Psych. Diplomarbeit. Freiburg/ Brsg. SCHWARZER, R (1994). Kausalattributionen als gesundheitsbezogene Kognitionen. In: Försterling F (Hg.). Attrbutionstheorie: Grundlagen und Anwendungen. Göttingen: Hogrefe SENSKY, T (1997). Causal attributions in physical illness. Journal of Psychosomatic Research 43: 565-73 SENSKY, T, HAYNES, C, RIGBY, M, MACLEOD, A. (1998). Attribution von Körperempfindungen bei Patienten in der medizinischen Erstversorgung: Zusammenhänge mit der Häufigkeit von Arztbesuchen und mit Hypochondrie. Verhaltenstherapie 8(2), 101-10 SENSKY, T. MACLEOD, AK. RIGBY, MF (1996). Causal attributions about common somatic sensations among frequent general practice attenders. Psychological Medicine 26(3): 641-6 SMITH ,GR, MONSON ,RA, RAY ,DC (1986). Patients with multiple unexplained symptoms. Their characteristics, functional health, and health care utilization. Archives of Internal Medicine 146: 69-72 STURM, J, ZIELKE, M (1988). Chronisches Krankheitsverhalten: Die klinische Entwicklung eines neuen Krankheitsparadigmas. .Praxis der klinischen Verhaltensmedizin 1: 17-27 90 THEBALDI, B, FRANZ, M, SCHELLBERG, D, SCHEPANK, H (1996). Differente Laienätiologien bei psychogen beeinträchtigten Probanden aus einer epidemiologischen Feldstudie. Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 42(1): 71-87 THOMMEN, M, BLASER, A, RINGER, C, HEIM, E (1990). Zum Stellenwert subjektiver Krankheitstheorien in der Problemorientierten Therapie (POT). Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie 40: 172-177 UEXKÜLL, Th v. (1986). Geschichte der deutschen Psychosomatik: Philosophische und historische Wurzeln. Psychotherapie, Medizinische Psychologie, 36: 18-24 VAN DULMEN, AM, FENNIS, JF, MOKKINK, HG, VAN DER VELDEN, HG, BLEIJENBERG, G, (1995). Doctor-dependent changes in complaint-related cognitions and anxiety during medical consultations in functional abdominal complaints. Psychological Medicine 25(5): 1011-8 VAN WIJK, CM, KOLK, AM (1997). Sex differences in physical symptoms: the contribu- tion of symptom perception theory. Social Science and Medicine 45(2): 231-46 VERRES, R (1989). Zur Kontextabhängigkeit subjektiver Krankheitstheorien. In: .Bischoff, C, Zenz, H (Hg.). Patientenkonzepte von Körper und Krankheit. Bern, Stuttgart, Toronto: Huber VERRES, R (1998). Gesundheitsforschung und Verantwortung: Gedanken zur Differenzierung und Vertiefung der Rekonstruktion subjektiver Gesundheits- und Krankheitstheorien. In: Flick, U (Hg). Wann fühlen wir uns gesund?: Subjektive Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit. Weinheim, München: Juventa WAELTE, D, EBEL, H, BRANDENBURG, U, KROEGER, F (1999). Kognitive Selbstregulation bei somatoformen Störungen. In: Kröger, F, Petzold, ER. Selbstorganisation und Ordnungswandel in der Psychosomatik. Konzepte systemischen Denkens und ihr Nutzen für die Psychosomatische Medizin. VAS Verlag für Akademische Schriften, Frankfurt a.M.: 424-442 WEINER, B (1986). An attribution theory of motivation and emotion. Berlin: Springer WEINER, B (1994). Sünde versus Krankheit: Die Entstehung einer Theorie wahrgenommener Verantwortlichkeit. In: Försterling, F (Hg.). Attrbutionstheorie: Grundlagen und Anwendungen. Göttingen: Hogrefe 91 WHO (World Health Organization) (1990). Tenth revision of the international classification of diseases, chapter V (F): mental and behavioural disorders …. Geneva: WHO. WIEGAND, M, MATUSSEK, P (1991). Vorstellungen depressiver Patienten über die Ursachen ihrer Erkrankung. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie 41:199-205 WITTCHEN, HU, SASS, H, ZAUDIG, M, KOEHLER (1989). Diagnostisches und statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-III-R (dt. Bearbeitung). Weinheim: Beltz WIRSCHING, M. (2000). Arztbild 2000. Gesundheitswesen 62, Sonderheft 1: 54-56 WISE, TN, MANN, LS (1995). The attribution of somatic symptoms in psychiatric outpatients. Comprehensive Psychiatry 36(6): 407-10 ZENZ, H, BISCHOFF, C, FRITZ, J, DUVENHORST, W, KELLER, K (1989). Das Schicksal von Krankheitstheorien und Behandlungserwartungen des Patienten im Gespräch mit dem praktischen Arzt In:.Bischoff, C, Zenz, H (Hg.). Patientenkonzepte von Körper und Krankheit. Bern, Stuttgart, Toronto: Huber ZENZ, H, BISCHOFF, C, HRABAL, V (1996). Patiententheoriefragebogen (PATEF). Göttingen: Hogrefe ZENZ, H, KELLER, K (1978). Krankheitstheorien und Behandlungserwartungen von Patienten einer Allgemeinpraxis. Der Praktische Arzt 15(78), 3079-3088. Sonderdruck Heft 27. Dortmund, Krüger ZWILLICH, SH (1999). More thoughts on somatization. Archives of Internal Medicine 159(15): 1813-4 92 11. Anhang 93 11.1. SOMS-7 Anleitung: Im folgenden finden Sie eine Liste von körperlichen Beschwerden. Geben Sie nur solche Beschwerden an, für die von Ärzten keine genaue Ursachen gefunden wurden und die Ihr Wohlbefinden stark beeinträchtigt haben. Bitte geben Sie an, ob und wie sehr Sie im Laufe der vergangenen 7 Tage unter diesen Beschwerden über kürzere oder längere Zeit gelitten haben oder immer noch leiden. Ich habe die Anleitung gelesen: ڤJa ڤNein Ich haben in den vergangenen 7 Tagen unter folgenden Beschwerden gelitten: Ausmaß der Beeinträchtigung gar mittelsehr leicht stark nicht mäßig stark 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (1) Kopf- oder Gesichtsschmerzen (2) Schmerzen im Bauch oder in der Magengegend 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (3) Rückenschmerzen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (4) Gelenkschmerzen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (5) Schmerzen in den Armen oder Beinen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (6) Brustschmerzen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (7) Schmerzen im Enddarm 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (8) Schmerzen beim Geschlechtsverkehr 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (9) Schmerzen beim Wasserlassen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (10) Übelkeit 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (11) Völlegefühl (sich aufgebläht fühlen) 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (12) Druckgefühl, Kribbeln oder Unruhe im Bauch 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (13) Erbrechen (außerhalb einer Schwangerschaft) 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (14) Vermehrtes Aufstoßen (in der Speiseröhre) 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (15) „Luftschlucken“, Schluckauf oder Brennen im Brust- oder Magenbereich 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (16) Unverträglichkeit von verschiedenen Speisen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (17) Appetitverlust 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (18) Schlechter Geschmack im Mund oder stark belegte Zunge 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (19) Mundtrockenheit 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (20) Häufiger Durchfall 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (21) Flüssigkeitsaustritt aus dem Darm 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (22) Häufiges Wasserlassen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (23) Häufiger Stuhldrang 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 94 SOMS-7 Seite 2 Ausmaß der Beeinträchtigung gar mittelsehr leicht stark nicht mäßig stark 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (24) Herzrasen oder Herzstolpern (25) Druckgefühl in der Herzgegend 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (26) Schweißausbrüche (heiß oder kalt) 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (27) Hitzewallungen oder Erröten 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (28) Atemnot (außer bei Anstrengung) 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (29) Übermäßig schnelles Ein- und Ausatmen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (30) außergewöhnliche Müdigkeit bei leichter Anstrengung 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (31) Flecken oder Farbänderung der Haut 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (32) Sexuelle Gleichgültigkeit 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (33) Unangenehme Empfindungen im oder am Genitalbereich 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (34) Koordinations- oder Gleichgewichtsstörungen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (35) Lähmung oder Muskelschwäche 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (36) Schwierigkeiten beim Schlucken oder Kloßgefühl 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (37) Flüsterstimme oder Stimmverlust 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (38) Harnverhaltung oder Schwierigkeiten beim Wasserlassen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (39) Sinnestäuschungen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (40) Verlust von Berührungs- oder Schmerzempfindungen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (41) Unangenehme Kribbelempfindungen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (42) Sehen von Doppelbildern 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (43) Blindheit 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (44) Verlust des Hörvermögens 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (45) Krampfanfälle 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (46) Gedächtnisverlust 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (47) Bewusstlosigkeit 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 Für Frauen: (48) Schmerzhafte Regelblutungen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (49) Unregelmäßige Regelblutungen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (59) Übermäßige Regelblutungen 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (51) Erbrechen während der gesamten Schwangerschaft 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 (52) Ungewöhnlicher oder verstärkter Ausfluß aus der Scheide 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 Für Männer: (53) Impotenz oder Störungen des Samenergusses 0 ––– 1 ––– 2 ––– 3 ––– 4 95 11.2. KKU Für meine Beschwerden bzw. meine Krankheit, derentwegen ich hier bin, sind aus meiner Sicht folgende Ursachen von Bedeutung: wenig ziemlich stark Wie stark als Ursache bedeutsam? gar nicht Bitte kreuzen Sie auf dieser Seite an, wie stark in Ihrem Fall mögliche Gründe und Ursachen für Ihre Beschwerden bzw. Ihre Krankheit von Bedeutung sind. Machen Sie bitte in jeder Zeile nur ein Kreuz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vererbung Konflikte, mit denen ich nicht fertig werde berufliche Belastungen und Sorgen Wetterfühligkeit Schwierigkeiten mit dem Partner Fehlende innere Sicherheit Eigene Willensschwäche Übermäßiger Medikamentengebrauch Unsichere finanzielle Lage Sexuelle Schwierigkeiten Fehlen eines Menschen, mit dem ich mich aussprechen kann Ungünstige Lebensgewohnheiten Schicksal Zufällige Ereignisse Fehler oder Versäumnisse der Ärzte Einflüsse anderer Personen Umweltverschmutzung Stress und Hetze des täglichen Lebens Frühere Erkrankungen Verlust geliebter Personen Übermäßiger Gebrauch von Genussmitteln Einflüsse der Gestirne, von Erdstrahlen oder Wasseradern Allgemeine Erschöpfung Mangelnde Fähigkeit, mit Belastungen und Krisen umzugehen Angeborene Schwäche von bestimmten Organen Seelische Probleme Dauerhafter Ärger mit bestimmten Personen Bisheriger falscher Lebenswandel Nebenwirkungen bestimmter Medikamente Mangelndes Durchsetzungsvermögen bei Konflikten mit Anderen Alterungs- bzw. Abbauprozesse Hohe Ansprüche an mich selbst Frühere Operationen Ereignisse aus meiner Kindheit Dauerhaft unerfüllte Wünsche und Bedürfnisse Krankheitserreger (Viren o.ä.) Konflikte mit meinem Vater Konflikte mit meiner Mutter Mangelnde Selbstständigkeit Eine versteckte körperliche Krankheit Familiärer Stress Ungesunde Ernährung 96 11.3. Behandlungsprotokoll Hausärztliche Behandlung von Patienten mit somatoformen Symptomen Gruppe A (bitte zutreffendes ankreuzen) 1. Sitzung: Dauer: Datum: ( ) Ausführliche Exploration der Symptome ( ) Subjektives Krankheitsverständnis ( ) Körperliche Untersuchung ( ) Psychosoziale Anamnese ( ) Weitere Inhalte: (welche?) 2. Sitzung: Dauer: Datum: ( ) Vervollständigung der psychosozialen Anamnese ( ) Entwicklung eines alternativen Krankheitsmodells ( ) Erläuterung psycho-physiologischer Zusammenhänge ( ) Weitere Inhalte: (welche?) 3. Sitzung: Dauer: Datum: ( ) Auslösende Situationen für die Symptomatik ( ) Beschwerdemindernde u. –verstärkende Situationen und Lebensumstände ( ) Erklärung psychophysiologischer Zusammenhänge ( ) Alternatives Krankheitsmodell ( ) Erklärung des Teufelskreises ( ) Kniebeugen ( ) Weitere Inhalte: (welche?) 4. Sitzung: Dauer: Datum: ( ) Verbalisieren von Gefühlen ( ) Teufelskreis ( ) Kniebeugen ( ) Hausaufgaben, z.B. Tagebuch – welche:___________________________ ( ) Weitere Inhalte: (welche?) 97 5. Sitzung: Dauer: Datum: ( ) Hausaufgaben (welche): _________________________________________ ( ) Entspannungsübungen ( ) Zusammenhang zwischen Lebensgestaltung und Symptomatik ( ) Psychosoziale Anamnese ( ) Erläuterung von Schon- und Vermeidungsverhalten ( ) Förderung der Selbstständigkeit ( ) Verbalisieren von Gefühlen ( ) Weitere Inhalte: (welche?) 6. Sitzung: Dauer: Datum: ( ) Zusammenhang zwischen körperlichen Symptomen und belastenden Lebenssituationen ( ) Entwicklung alternativer Verhaltensweisen in Beruf und Privatleben ( ) Förderung der Selbstständigkeit ( ) Reflexion des Entwicklungsstandes ( ) Verbalisieren von Gefühlen ( ) Motivierung für Fachpsychotherapie ( ) Motivierung zur Teilnahme an einem Kurs in einem Entspannungsverfahren ( ) Weitere Inhalte: (welche?) Kooperation mit Psychotherapeuten 1. Telefonische Beratung 2. Supervision (45-60 Min.) 3. Gemeinsames Gespräch mit dem Patienten und/oder der Familie 4. Vorstellung in der Balintgruppe 5. Vorstellung im Qualitätszirkel 6. Weitere Aktivitäten (welche?) Anzahl für diesen Fall ( ) ( ) ( ( ( ( ) ) ) ) 98 Hausärztliche Behandlung von Patienten mit somatoformen Symptomen Behandlungsprotokoll Gruppe B (bitte zutreffendes ankreuzen) 1. Sitzung: Dauer: Datum: ( ) Exploration der Symptomatik ( ) psychosoziale Anamnese ( ) körperliche Untersuchung ( ) techn. Untersuchungen in der Praxis (Labor, EKG, Spirometrie ect.) ( ) Überweisung zum Facharzt ( ) Überweisung zur Psychotherapie ( ) Verordnung von ( ) Psychopharmaka ( ) andere Medikation ( ) physikal. Therapie / Krankengymnastik ( ) Entspannungsverfahren ( ) Arbeitsruhe (AU) ( ) andere Maßnahmen (stat. Einweisung, Reha-Antrag ect.) ( ) Erörterung/ Beratung − Inhalte: 2. Sitzung: Dauer: Datum: ( ) Exploration der Symptomatik ( ) psychosoziale Anamnese ( ) körperliche Untersuchung ( ) techn. Untersuchungen in der Praxis (Labor, EKG, Spirometrie ect.) ( ) Überweisung zum Facharzt ( ) Überweisung zur Psychotherapie ( ) Verordnung von ( ) Psychopharmaka ( ) andere Medikation ( ) physikal. Therapie / Krankengymnastik ( ) Entspannungsverfahren ( ) Arbeitsruhe (AU) ( ) andere Maßnahmen (stat. Einweisung, Reha-Antrag ect.) ( ) Erörterung/ Beratung − Inhalte: 99 3. Sitzung: Dauer: Datum: ( ) Exploration der Symptomatik ( ) psychosoziale Anamnese ( ) körperliche Untersuchung ( ) techn. Untersuchungen in der Praxis (Labor, EKG, Spirometrie ect.) ( ) Überweisung zum Facharzt ( ) Überweisung zur Psychotherapie ( ) Verordnung von ( ) Psychopharmaka ( ) andere Medikation ( ) physikal. Therapie / Krankengymnastik ( ) Entspannungsverfahren ( ) Arbeitsruhe (AU) ( ) andere Maßnahmen (stat. Einweisung, Reha-Antrag ect.) ( ) Erörterung/ Beratung − Inhalte: 4. Sitzung: Dauer: Datum: ( ) Exploration der Symptomatik ( ) psychosoziale Anamnese ( ) körperliche Untersuchung ( ) techn. Untersuchungen in der Praxis (Labor, EKG, Spirometrie ect.) ( ) Überweisung zum Facharzt ( ) Überweisung zur Psychotherapie ( ) Verordnung von ( ) Psychopharmaka ( ) andere Medikation ( ) physikal. Therapie / Krankengymnastik ( ) Entspannungsverfahren ( ) Arbeitsruhe (AU) ( ) andere Maßnahmen (stat. Einweisung, Reha-Antrag ect.) ( ) Erörterung/ Beratung − Inhalte: 100 5. Sitzung: Dauer: Datum: ( ) Exploration der Symptomatik ( ) psychosoziale Anamnese ( ) körperliche Untersuchung ( ) techn. Untersuchungen in der Praxis (Labor, EKG, Spirometrie ect.) ( ) Überweisung zum Facharzt ( ) Überweisung zur Psychotherapie ( ) Verordnung von ( ) Psychopharmaka ( ) andere Medikation ( ) physikal. Therapie / Krankengymnastik ( ) Entspannungsverfahren ( ) Arbeitsruhe (AU) ( ) andere Maßnahmen (stat. Einweisung, Reha-Antrag ect.) ( ) Erörterung/ Beratung − Inhalte: 6. Sitzung: Dauer: Datum: ( ) Exploration der Symptomatik ( ) psychosoziale Anamnese ( ) körperliche Untersuchung ( ) techn. Untersuchungen in der Praxis (Labor, EKG, Spirometrie ect.) ( ) Überweisung zum Facharzt ( ) Überweisung zur Psychotherapie ( ) Verordnung von ( ) Psychopharmaka ( ) andere Medikation ( ) physikal. Therapie / Krankengymnastik ( ) Entspannungsverfahren ( ) Arbeitsruhe (AU) ( ) andere Maßnahmen (stat. Einweisung, Reha-Antrag ect.) ( ) Erörterung/ Beratung − Inhalte: Kooperation mit Psychotherapeuten 1. Telefonische Beratung 2. Supervision (45-60 Min.) 3. Gemeinsames Gespräch mit dem Patienten und/oder der Familie 4. Vorstellung in der Balintgruppe 5. Vorstellung im Qualitätszirkel 6. Weitere Aktivitäten (welche?) Anzahl für diesen Fall ( ( ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) 101 11.4. Lebenslauf Name: Geburtsdatum: Geburtsort: Familienstand: Michael Ney 16. 06. 64 Schaffhausen/ Saar verheiratet, 1 Kind Schulbildung: 1970 - 1974 1974 - 1983 Grundschule Ensdorf/ Saar Staatliches Gymnasium Saarlouis Zivildienst: 07/ 83 - 10/ 84 Altenheim der Arbeiterwohlfahrt Trier Studium: 10/ 85 - 12/ 92 Medizinstudium an der RWTH Aachen Examen 14.12 92 3. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung, Pflegetätigkeiten studienbegleitend verschiedene Alten- und Pflegeheime Chirurgische Abteilung, Luisenhospital Aachen Auslandspraktika: 12/ 84 - 07/ 85 07/ 90 - 11/90 10/ 94 - 05/95 Bolivien: Pflegepraktika Brasilien: Famulatur bei der „Pastoral de Saúde“ Brasilien: Praktikum beim Sozialdienst „São Bento“, Salvador: Feldforschung zu traditioneller Phytotherapie Ärztliche Tätigkeiten: Arzt im Praktikum Praxisassistent Praxisassistent Assistenzarzt 01/ 93 - 06/ 94 07/ 94 - 09/ 94 10/ 95 - 06/ 96 08/ 96 - 01/ 98 Praxisassistent 02/ 98 - 09/ 99 Assistenzarzt 10 /00 - 05/03 Assistenzarzt Seit 09/ 03 Innere Abteilung, St.- Antonius- Krankenhaus Wegberg Dr. H.-O. Fries, Internist, Praxisgemeinschaft Siersburg Dr. W. Foellmer, Arzt f. Allgemeinmedizin, Aachen Chirurg. Abteilung, Städt. Krankenhaus, 78112 St. Georgen Praxis Drs. Graner, Laufenburg (Innere/ Allgemeinmedizin) Penta-Klinik, Bad Säckingen, Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Psychiatrische Tagesklinik Bad Säckingen Facharztprüfung 15.02.99 Arzt für Allgemeinmedizin Erziehungszeiten 10/ 99 - 09 /00 und 11/ 01 - 02/02