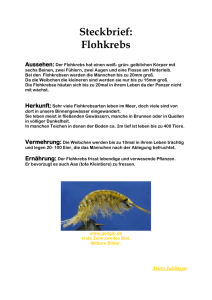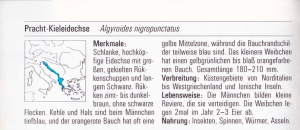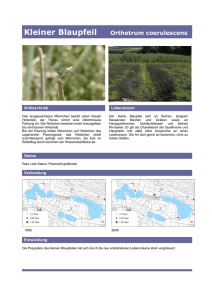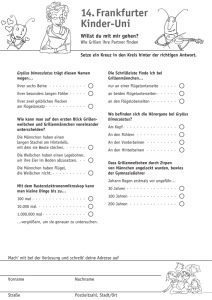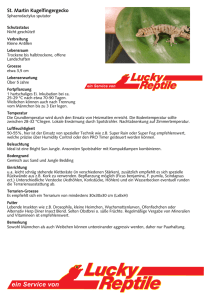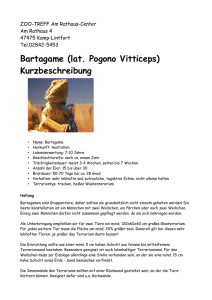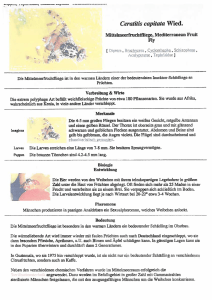Verhaltensbiologie König
Werbung

Verhaltensbiologie König Inhaltsangabe: Das Verhalten der Tiere aus evolutionärer Sicht.........................1 Die Erblichkeit des Verhaltens..........................................2 Das Konzept der Erblichkeit...........................................2 Das angeborene Verhalten................................................3 Das Lernen..............................................................5 Das assoziative Lernen................................................5 Klassische Konditionierung..........................................5 Operante Konditionierung............................................6 Lernen ohne Bestrafung oder Belohnung.................................7 Das Raumlernen......................................................7 Habituation.........................................................7 Prägung.............................................................7 Motivation..............................................................8 Zyklisches Verhalten...................................................10 Innerartliche Kommunikation............................................12 Chemische Kommunikation..............................................12 Elektrosensorische Kommunikation.....................................13 Mechanische Kommunikation............................................13 Die Kehrseite der Kommunikation......................................14 Das Gruppenleben.......................................................14 Vorteile des Gruppenlebens...........................................14 Fitnessnachteile des Gruppenlebens...................................16 Altruismus...........................................................16 1 25.4.02 Das Verhalten der Tiere aus evolutionärer Sicht Der Mensch ist bei den verschiedenen Konzepten miteingeschlossen. Der Sinn und Zweck der Verhaltensforschung ist die Lebensweise von Schädlingen besser kennen zu lernen, um gezielter gegen sie vorgehen zu können; ausserdem ist die Domestikation von Nutztieren etc., die ebenfalls im Rahmen der Verhaltensbiologie untersucht wird, für die Nahrungs- und Arzneimittelproduktion nützlich. Das Ziel ist Konzepte für das Verhalten zu suchen und zu erkennen. Die Verhaltensstudien sind an die Biologie, d.h. an lebende Organismen gebunden. Man beobachtet Eigenleistungen und selbsterzogene Funktionalität. Zentral ist die Frage nach der Funktion des spezifischen Verhaltens (warum dieses Verhalten zu dieser Zeit). Die Verhaltensstudien sollten aber nicht nur auf die sichtbaren Bewegungen/Geschehnisse bezogen werden, denn viele Verhaltensweisen haben auch Funktionen, die nicht sichtbar sind. Deshalb gilt grundsätzlich: ‚EIN Verhalten gibt es in der Biologie nicht’. Die Begründer der modernen Verhaltensbiologie waren Konrad Lorenz und Niko Tinbergen. Sie betrieben Ethologie (= Studium des statischen und bewegten Verhaltens von Tieren) und beide bekamen in den 70er Jahren den Nobelpreis für Medizin und Physiologie (Martin P. & Bateson P.: „Ethology is the biological study of behaviour.“). Das erste Konzept der Ethologie geht aber auf C. Darwin zurück. Er sah im Verhalten das Ergebnis der Evolution und der natürlicher Selektion (ebenso wie anatomische und physiologische Aspekte/Bereiche). Bereits Darwin erkannte, dass das Studium des Verhaltens nur dann sinnvoll ist, wenn die Organismen sich in ihrer natürlichen Umgebung unter natürlichen Bedingungen aufhalten (Lorenz arbeitete jedoch oft mit von Menschen aufgezogenen Tieren in Gehegen). Tinbergen erkannte seinerseits, dass das Verhalten der Organismen auch von deren Physiologie und Neurologie abhängt. Das Verhalten ist somit auf verschiedenen Ebenen untersuchbar. Aufgrund dessen erstellte Tinbergen das Konzept der vier Analyseebenen des Verhaltens: 1. Proximate (unmittelbare) Ursache des Verhaltens 2. Entwicklung oder Ontogenie des Verhaltens 3. Ultimate (letztendliche) Ursache des Verhaltens 4. Evolution oder Phylogenie des Verhaltens Punkt 4. ist auf Plausibilitätsargumente angewiesen. Lorenz betrieb vor allem vergleichende Verhaltensbiologie (also was sind primitive Merkmale und was nicht). Nochmals: Die Grundannahme ist, dass das Verhalten das Ergebnis eines evolutiven Prozesses ist. Somit muss jedes Verhalten einen Zweck haben. Die zentralen Fragen der Verhaltensbiologie lautet somit: Wie beeinflusst das Verhalten die Lebenserwartung und vor allem die Reproduktion von Organismen? Das Verhalten wird aber nur verständlich, wenn die Mechanismen erkannt werden und somit bekannt sind. Das Institut der UniZH wurde 1997 auf Anregung von B. König von Ethologie zu Verhaltensbiologie umbenannt, da die Verhaltensbiologie vielfältigere Aspekte untersucht und der Begriff ‚Ethologie’ nicht mehr dem von Lorenz und Tinbergen eingeführten Begriff entspricht. Lorenz ging bei seinen Forschungen davon aus, dass das Verhalten der Population nütze (zum Wohl der Art sei). Als Beispiel führte er die ritualisierte Aggressivität an. Diese stellt keinen eigentlichen Kampf dar; somit werden die beiden Kontrahenten nicht verletzt (Fitness würde sinken). Diese Annahme ist aber aus heutiger Sicht falsch, da sie nicht mit der Genetik in Einklang gebracht werden kann. Heute geht man davon aus, dass die Verhaltensweisen dem einzelnen Individuum und nicht in erster Linie der Population nützen. Zu diesem Schluss muss man kommen, wenn man anstelle einer Art- eine Individualselektion postuliert. C. Darwin (1822-1882) kannte zwar den genetischen Mechanismus und die Vererbungslehre noch nicht, erkannte aber das Prinzip der natürlichen Selektion. G. Mendel (1822-1884) war Begründer der Vererbungslehre; seine Erkenntnisse wurden aber nach deren Entdeckung vergessen und erst später wiederentdeckt. Die Verhaltensökologie zeigt ein konsequentes Einhalten des Neodarwinismus. Zentral hier sind die ultimaten Ursachen des Verhaltens (→ welchen Vorteil hat das Verhalten für das Individuum). Die Soziobiologie erforscht das soziales Verhalten aus evolutiver Sicht. Entstanden sind eine Fülle neuer Abeitsgebiete, ausgehend von der „klassischen“ Verhaltensbiologie (Verhaltensökologie, Soziobiologie, Lernethologie, Verhaltensontogenie, Verhaltensgenetik, Verhaltensrhythmik u.a.). Alle müssen von der Annahme ausgehen, dass das Verhalten genetisch reguliert sei, da es ansonsten nicht selektier- und vererbbar ist. 2 Die Erblichkeit des Verhaltens Darwin beobachtete (bei Tieren wie auch dem Menschen), dass Kinder ihren Eltern bezüglich Aussehen und Verhalten ähnlicher sind als anderen Menschen/Individuen der gleichen Art. Es scheint somit unterschiedliche Allele eines Gens bezüglich eines Merkmals vorhanden zu sein, was in einer grossen Diversität innerhalb einer Art sichtbar wird. Neben den bekanten physischen Ähnlichkeiten erstaunen die Ähnlichkeiten im Verhalten auf den ersten Blick etwas. Man muss als Folge dieser Beobachtung genetische Anlagen des Verhaltens postulieren. Behavioristen sind Gegner dieser eben gemachten Aussage. Die von John Watson zwischen 1930 und 1940 geprägte Richtung des Behaviorismus geht davon aus, dass einzig Umwelteinflüsse das Verhalten beeinflussen. Diese Meinung steht versus der Verhaltensgenetik. Eine heftige Diskussion um „Nature/Nurture“ wurde in den 1960er Jahren geführt. Heute geht man davon aus, dass das Verhalten sowohl von den Genen als auch durch die Umwelt reguliert wird. Beispiele: • Klonierung: Dolly ist das Produkt aus einem Zellkern einer Euterzelle, der in eine kernlose Eizelle eingesetzt wurde. Die Euterzelle nahm in der Folge in der Eizelle das Programm einer Embryonalzelle an. • Reptilien haben kein genetisches Geschlecht. Die Geschlechtsbestimmung läuft über die Aussentemperatur ab, die auf das Gelege wirkt (in einem gewissen Zeitfenster → vgl. Briegel). • Bei Hausmäusen ist ein Effekt der Lage im Uterus (Uterus bicornis) beschrieben worden; so findet man bereits bei den Embryonen verschiedene Hormontiter. Die relative Lage der Embryonen beeinflusst die Testosteron/Östradiol-Konzentration innerhalb des einzelnen Embryos. Allgemein gilt: Männliche Embryonen haben mehr Testosteron als weibliche, weibliche haben mehr Östradiol als männliche. Die Weibchen, die aber im Uterus zwischen zwei Männchen lagen, haben eine erhöhte Testosteronkonzentration als normal, was beim Adulttier zu erhöhter Aggressivität und gesenkter sexueller Aktivität führt. Bei Weibchen, die zwischen zwei Weibchen lagen, führt der erhöhte Östradiolgehalt ebenfalls zu erhöhter Aggressivität und gesenkter sexueller Aktivität. Die Ähnlichkeiten zwischen Eltern und Kindern beruhen aber nicht allein auf der genetischer Anlage, sondern auch auf der ähnlichen oder gleichen Umwelt, in der sie aufwachsen. Das Konzept der Erblichkeit (=Heritabilität) Die Heritabilität eines Merkmals ist gleich dem Anteil, der in einer Population beobachteten phänotypischen Varianz, welcher der genetischen Variation zuzuschreiben ist. Beispielsweise die Körpergrösse. Wenn die Heritabilität = 0 ist, wird die Körpergrösse nur über die Umwelt reguliert; ist die aber Heritabilität = 1 ist sie nur genetisch bedingt. Die Ausprägung eines Merkmals ist aber sowohl von genetischem Material, als auch von der Umwelt (z.B. Nahrung) abhängig. VORSICHT: Heritabilität bezieht sich auf Populationen und nicht auf Individuen. Bei hohen Heritabilitätswerten sind die Populationen leichter selektierbar (bei Getreide z.B. auf Pestizide o.a.). Der tatsächlicher Wert ist jedoch abhängig von Umweltfaktoren aufgrund der Umwelt-Gen-Interaktion. • • In den 40er Jahre des letzten Jahrhunderts wurden Experimente mit Ratten durchgeführt. Dabei wurden ausgehend von einer ‚Anfangspopulation’ zwei unterschiedliche Linien gezüchtet. Das Selektionsprinzip beruhte auf der Geschicklichkeit der Ratten in einem Labyrinthtest nach schlauen/dummen Ratten. Bei der Linie mit den ‚schlauen’ Ratten kamen die Tiere durchschnittlich noch schneller durchs Labyrinth; bei der ‚dummen Linie’ hingegen waren die Individuen eher noch langsamer. Es war somit ein Auseinanderdriften der Linien nachweisbar (diese Resultate sind nur mit einer Vererbung des selektierten Merkmals zu erklären). In einem zweiten Testverfahren wurden die Linien ‚dumm’ und ‚schlau’ in verschiedene Umgebungen gebracht. Die Umgebungen waren: reizarm (ohne Beschäftigungsmöglichkeiten für die Ratten), normal (‚normaler Rattenkäfig’ mit notwendigen Dingen (Laufrad etc.)), reizreich (viele Beschäftigungsmöglichkeiten mit labyrinthähnlicher Einrichtung). Die Resultate sind in Abb.1 dargestellt. Ergebnis: Bei reizreicher Umgebung schnitten beide Linien gleich gut ab, obwohl sie genetisch eindeutig verschieden waren. Die Zwillingsforschung konzentriert sich besonders auf eineiige Zwillinge, die nach der Geburt getrennt wurden und somit nicht im gleichen Umfeld aufwuchsen (vgl. Minnesota-Studie). Die Zwillinge zeigten trotz einem anderem Umfeld viele Gemeinsamkeiten. Die Studie ergab einen Heritabilitätswert von 0.65. 3 26.4.02 Das angeborene Verhalten Mithilfe der künstlichen Selektion lässt sich die genetische Grundlage des Verhaltens nachweisen (vgl. Rattenexperiment). Um Verhalten untersuchen zu können muss man zwingend von einer genetischen Komponente dieses ausgehen. • Steve Arnold (Chicago) hat mit Strumpfbandnatter (Thamnophis elegans) gearbeitet, die unterschiedliche Habitate besiedeln. Eine Population lebte in höheren und trockeneren Lagen, die anderen an der nebligen und feuchten Küste. Jedoch waren nicht nur die klimatischen Verhältnisse anders, sondern auch die Nahrung der Schlangen war unterschiedlich. Während die Küstenschlangen bevorzugt Nacktschnecken frassen, ernährten sich die Binnenschlangen von Fischen und Fröschen (obschon bei ihnen auch Nacktschnecken vorkamen). Es liess sich vermuten, dass genetische Unterschiede für das unterschiedliche Verhalten verantwortlich waren. Um dies zu untersuchen sammelte Arnold trächtige Weibchen der beiden Populationen. Er hielt sie unter standardisierten Bedingungen und wartete bis sie ihre Jungen zur Welt brachten (lebendgebärend). Sofort nach der Geburt isolierte er die Jungen und zog sie unter gleichen (Standart-) Bedingungen auf. Einige Tage später bot er an zehn aufeinanderfolgenden Tagen jeder Jungschlange ein Stück (alle gleiche Grösse) Nacktschnecke zum Fressen an. Von den Küstenschlangenjungen frassen praktisch alle die gesamten angebotenen zehn Stücke, nur sehr wenige frassen keines. Bei den Binnenschlangen rührten über 75% der Jungtiere kein einziges Stück Nacktschnecke an. Die Jungtiere zeigten also bereits ein unterschiedliches Verhalten, ohne dass sie je eine echte Nacktschnecke oder eine andere Schlange zu Gesicht bekommen hatten. Mit einem weiteren Versuch wollte Arnold beweisen, dass die Chemorezeptoren der Schlangen aus den beiden Populationen unterschiedlich sind und damit das unterschiedliche Fressverhalten der Schlangen erklärbar wäre. Zu diesem Zweck hielt er den Schlangen einen Wattebausch vor den Mund und zählte die Züngelbewegungen und die Angriffe gegenüber dem Wattebausch. Das Züngeln führt die Duftmoleküle zum Jakobsonschen Organ (paarig), das sich im Gaumendach befindet. In einen ersten Versuch war der Wattebausch mit Kaulquappenextrakt getränkt (Kaulquappen sind in beiden Gebieten Beute). Die Jungtiere zeigten keinerlei Unterschiede in den Züngelbewegungen und den Angriffen auf den Wattebausch. Beim zweiten Versuch mit Nacktschneckenextrakt war dagegen ein Unterschied auszumachen. Während die Binnenschlangen den Wattebausch praktisch ignorierten, sahen die Küstenschlangen, den Wattebausch als Beute an. Arnold schloss daraus, dass sich die beiden Populationen physiologisch unterscheiden (andere Chemorezeptoren) und dass die Bereitschaft Nacktschnecken zu fressen auf Unterschiede in der genetischen Konstitution zurückzuführen sind, das proximate Verhalten ist somit unterschiedlich (Variation im Phänotyp). Eine Heratibilitätsuntersuchung für das Nacktschneckenfressen ergab jedoch nur einen Wert von 0.17 was erstaunlicherweise sehr niedrig ist (etwa 17% der Variation innerhalb einer Population sind auf genetische Unterschiede zurückzuführen). Das heisst, dass die Unterschiede grösstenteils umweltbedingt sind. Es lässt sich vermuten, dass die ‚standardisierten’ Bedingungen, doch nicht alle Faktoren ausschliessen konnten, die bei der Entwicklung der Jungschlangen eine Rolle spielen (h (Heritatbilität) sehr gering innerhalb der Population). Innerhalb der Population ist das Beuteverhalten praktisch fixiert. Es lässt sich nun vermuten, dass durch die Selektion die genetische Variabilität der Küstenpopulation verringert wurde (die beiden Populationen sind innerhalb der Population sehr ähnlich). So unterscheidet mindestens ein Allel (wenn nicht mehrere) die Populationen. Dies lässt sich mit einem Experiment nachweisen. Zufällige Kreuzungen sollten die Variabilität erhöhen, wenn die Annahme stimmt, dass die Variabilität genetisch bedingt ist. Es lässt sich eine Zunahme der Variabilität beobachten und folglich kann man auf genetische Unterschiede zwischen den Populationen als Erklärung für die Verhaltensunterschiede schliessen. Somit zeigt sich eine allgemeine ‚Erkenntnis’: Mit Hybridisierung (=Bastsardisierung) lässt sich die genetische Grundlage nachweisen. Nun beginnt die Spekulation. Ein mögliches Szenario könnte folgendermassen aussehen: Die Küsten wurden durch die Strumpfbandnattern erst nach dem Binnenland besiedelt. Die ersten Besiedler frassen per Zufall Nacktschnecken, daraus entwickelte sich eine Nacktschneckenakzeptanz (Vorsicht Lamarck). Dies brachte diesen Individuen einen Selektionsvorteil. Falls der Fortpflanzungserfolg nur 1% (sehr konservativ) grösser war, mussten weniger als 10'000 Jahre vergehen, um einen nachweisbaren genetischen Unterschied zwischen den Populationen zu erzeugen. Das Allel für die Akzeptanz Nacktschnecken zu fressen breitet sich aus. Warum wurde aber dieses Allel im Binnenland gegenselektioniert, obschon auch dort Nacktschnecken vorkommen (genetische Anlage fixiert)? Erklärung: Strumpfbandnattern, die Schnecken fressen, fressen auch Egel (an der Küste nicht vorhanden). Die gefressenen Egel können aber nach dem Verschlucken noch einige Minuten weiterleben und so der Schlange innere Verletzungen zufügen. Dies könnte ernsthaftere Schäden bei der Schlange hervorrufen, was den Fortpflanzungserfolg vermindern würde. Die proximate Erklärung für das unterschiedliche Verhalten sind die genetischen und physiologischen Unterschiede. Während als ultimate Erklärung gelten kann, dass Binnenschlangen Egel vermeiden müssen, während Küstenschlangen nie auf Egel treffen. 4 Es lassen sich keinerlei Hinweise darauf finden, dass die Schlangen aufgrund bestimmter Reize ihr Verhalten erlernen; man kann darauf schliessen, dass es um ein angeborenes Verhalten handelt. Angeborenes Verhalten ist aber nicht gleichbedeutend mit ‚keine Umweltfaktoren wirken’ (vgl. Männchen oder Weibchen (sie müssen eines von beiden werden) angeboren aber umweltvariabel (Eidechsen)). Das angeborene Verhalten muss nicht erlernt werden, das heisst die Anpassung an die Umwelt ist evolutiven Ursprungs. Angeborenes Verhalten tritt bei Artgenossen einer Population auf, und wird meist durch einen einfachen Stimulus ausgelöst; dazu ist kein ‚Wissen’ nötig, dieses liegt im evolutiven Prozess. Früher brauchte man häufig den Begriff ‚Instinkt’, heute aber eher ‚angeborenes Verhalten’. Das Tier reagiert auf einen bestimmten Reiz biologisch richtig aufgrund, des angeborenen Verhaltens. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Erbkoordination (fixed action pattern): Eine Reaktion, die von selbst vollständig abläuft, wenn sie erst einmal durch einen adäquaten Reiz (Schlüsselreiz, Auslöser (innerartliche Kommunikation) oder Signal) aktiviert ist. • Niko Tinbergen untersuchte Erbkoordination bei jungen Silbermöven. Diese zeigen ein spezielles Verhalten um gefüttert zu werden. Mit einen Stock, an dessen Ende eine roter Kontrast angebracht wurde, konnte ein Picken des Jungen gegen diese Altvogelschnabelattrappe hervorgerufen werden (sogar mehr picken als bei einer Attrappe, die den Altvogel genau nachbildete). Dieses Beispiel zeigt, dass bei Verhaltensuntersuchungen und im Speziellen Untersuchungen an Erbkoordination häufig Attrappen eingesetzt werden, dabei ist der Grand der Minimalisierung, sprich des Schlüsselreizes oft sehr erstaunlich (im obigen Beispiel reichte ein langer Stock mit einer am unteren Ende angebrachten rot-schwarz-Streifung um die Kücken zum Picken zu animieren). • Beim Menschen lassen sich auch Erbkoordinationen beobachten. Das Gähnen einer anderen Person kann zum Schlüsselreiz für das eigene Gähnen werden. Es gibt auch Verhaltenweisen, die sich zuerst nach und nach entwickeln müssen. Wenn das Individuum einen Vorteil daraus zieht, wird es dieses Verhalten noch vervollkommnen (schwimmen/fliegen). Das Stadium des unkoordinierten/unbeholfenen Verhaltens kann dabei innerhalb von Stunden oder auch erst von Tagen oder Jahren verlassen werden. Ob die zunehmende Verbesserung auf Lernen oder auf eine (angeborene) genetische Reifung zurückzuführen ist, muss im einzelnen bestimmt werden. Mit Experimenten kann diese Frage geklärt werden: • Jungvögel üben ihre Schwingen häufig über dem Nest. Bei einem Experiment mit Tauben, wurden diese an diesem ‚Üben’ gehindert, indem man sie in einer Tonröhre aufzog. Dennoch konnten sie als Adulte gleich gut fliegen wie die anderen. Daraus folgt, dass das Fliegen bei Tauben auf eine genetische Reifung und nicht auf Lernen zurückzuführen ist (andere Manöver (Landen usw. vgl. Tölpel) müssen erlernt werden). • Untersuchungen mit Hühnerküken. Zu Beginn picken die Jungen nach allem möglichen. Nach vier Tagen treffen sie das anvisierte Ziel. Hess zog nun Küken auf und setzte ihnen eine Prismenbrille auf, die das Gesichtsfeld nach links oder nach rechts verschob; der Kontrollgruppe setzte er Brillen mit normalem Fensterglas (Kontrollgruppe) auf. Die Prismenküken trafen auch nach einigen Tagen ihr Ziel nicht. Hess schloss daraus, dass das Picken auf eine genetische Reifung und nicht auf Lernen zurückzuführen ist. Dies führt bald einmal zu einem ‚Glauben’ an ein unveränderliches Schicksal; doch dies ist falsch, denn Angeborenes lässt sich durch Lernen modifizieren (Hand vor dem Mund beim Gähnen kulturell unterschiedlich). Auch die Behandlung von Erbkrankheiten passt nicht in das Bild, dass allein die Gene unser Schicksal bestimmen. Durch eine Beeinflussung des Genoms ist eine Behandlung möglich. Ein Küken nimmt eine riesige Flut an äusseren Eindrücken auf; um die richtigen Entschiede treffen zu können, muss ein neurosensorischer Filtermechanismus vorhanden sein, der Unwichtiges wegfiltern kann. Wenn der Schlüsselreiz aufgenommen wurde (vgl. Attrappe) kommt der angeborene Auslösemechanismus (AAM) ins Spiel. • Die Schlüsselreize konnten z.B. auch bei akustischen Untersuchungen nachgewiesen werden; beim Singen der Heuschrecken (Schrillleiste wird über Schrilllade gezogen). Der Gesang der Feldheuschrecken (Chorthippus biguttulus) besteht aus Versen. Das Weibchen reagiert auf den Gesang des Männchens mit zurücksingen. Die Komponenten, die ein Zurücksingen auslösen, wurden nun mit Hilfe akustischer Attrappen untersucht. Es zeigte sich, dass nur wenige Parameter nötig waren; nämlich nur das Verhältnis von Pausendauer zu Silbendauer. Das Signal des Senders koevoluierte mit den Sensoren des Empfängers. Die Einfachheit der reaktionsrelevanten Schlüsselreize ermöglicht eine rasche Antwort. Dies ist ein angeborener Auslösemechanismus der einen weiteren angeborenen Auslösemechanismus (Schlüsselreizsensor) anspricht; dabei tritt kein Lernen auf. • Die Balzbewegungen der Winkerkrabbe (Uca sp.) sind artspezifisch und nur ein bestimmtes Merkmal des Winkens dient als Schlüsselreiz. Eine Beziehung zwischen Schlüsselreiz und Erbkoordination tritt häufig bei der Paarung, bei Flucht, Angst und der Kommunikation innerhalb der Population auf. Erst durch diese Faktoren ist ein Sozialverhalten möglich. Dieses Sozialverhalten kann nun aber auch ausgenutzt werden, indem sich ein Organismus in die Kommunikation einklinkt und diese zu seinen Gunsten ausnutzt. 5 • • Die Arbeiterinnen der Roten Waldameise (Formica polyctena) füttern ihre im Nest verbliebenen Schwestern indem sie von diesen betrillert werden und sie dadurch Nahrung hervorwürgen. Dem Büschelkäfer (Atemes pubicollis) ist es gelungen, den Code dieser einfachen Erkoordination zu knacken. Dieser Käfer scheidet ein Pheromon aus, mit dem er sich als Ameisenlarve ausgibt. Er wird somit in die Puppenstube getragen, wo er sich von Ameisenlarven und -eiern ernährt. Er hat aber auch den Trillercode geknackt und lässt sich somit auch von den Arbeiterinnen füttern. Ein anderes Beispiel eines Sozialparasiten ist das Ausnützen des Paarfindeverhaltens von Leuchtkäfern (Photinus macdermotti) durch Pholuris versicolor. Als Antwort auf das artspezifische Blinken der Männchen antworten die Weibchen auch mit Blinken, worauf, entweder das Weibchen zum Männchen hinfliegt oder das Männchen zum Weibchen. Eine räuberische Art hat sich dies nun zunutze gemacht, indem sie die Männchen mit dem Signalcode der arteigenen Weibchen anlockt und danach auffrisst. 2.5.02 Bei angeborenen Verhaltensweisen ist es für den Organismus wichtig, dass diese gleich beim ersten Auftreten eines adäquaten Schlüsselreizes richtig ablaufen. Die Erfahrung kann als sehr wichtige Komponente Verhaltensweisen verändern/modifizieren. Dies bedingt aber ein Lernen. Das Lernen Nun kommen wir zu den unterschiedlichen Lernformen. 1. Das assoziative Lernen Bei dieser Form des Lernens wird aus der Beziehung zwischen dem eigenen Verhalten und der Umwelt auf zukünftiges Verhalten geschlossen. a) Klassische Konditionierung. Der Physiologe I. Pawlow war mit seinen Experimenten in erster Linie an Verdauungsvorgängen interessiert, stellte aber nebenbei der Lernforschung ein klassisches Experiment. Er bekam aber 1904 den Nobel Preis für seine physiologischen Studien. Die Versuchshunde in seinen Experimenten speichelten, nachdem er ihnen zermahlenes Futter ins Maul geblasen hatte. Nun stellte Pawlow aber fest, dass bei den Hunden ein Lernen auftrat, indem sie nach mehrmaliger Durchführung des gleichen Experimentes bereits zu speicheln begannen, wenn der Experimentator den Raum betrat. Das ursprüngliche Speicheln nach der Futtergabe ist unkonditioniert. Pawlow führte danach Experimente mit einem neutralen Reiz (Klingel) durch. Kurz vor der Futtergabe liess er diese ertönen. Nach mehrfacher Wiederholung zeigte sich, dass die Hunde früher mit der Speichelproduktion (nach dem Ertönen der Klingel, aber noch vor dem Verabreichen des Futters) einsetzten und dass somit die Speichelproduktion unabhängig vom Futter wurde. Die Hunde zeigten sehr schnell eine oben beschriebene Reaktion und nach 45 Wiederholungen war es bei allen in der oben beschriebenen Weise vorhanden. Die Hunde haben bei diesem Versuch einen ursprünglich neutralen Reiz (klingeln) zu einem Schlüsselreiz gemacht. Der Ton der Klingel wird somit zu einem konditionierten Reiz. Der konditionale hat den neutralen Reiz ersetzt (Klingeln hat Futter ersetzt). Der konditionierte Reiz wird zum Schlüsselreiz. Die Reaktion (das Speicheln) stellt eine konditionierte Reizreaktion dar, da eine neue Assoziation hergestellt wurde. Bei weiteren Versuchen wurde ein breites Spektrum von verschiedenen Formen weiterer Reize (akkustische, optische usw.) entdeckt, die sich zur Konditionierung eignen. Diese beschriebenen Formen des Lernens laufen alle über eine positive Konditionierung (Belohnung); es gibt aber auch Experimente mit negativer Konditionierung. Dabei ist zu beachten, dass man nicht zu starke Bestrafungen wählt, da sonst eine Vermeidereaktion auftritt und das Tier beim Versuch nicht mehr mitmacht; für Säuger wählt man zum Beispiel einen leichten Luftstoss, der ins Gesicht geblasen wird. Mit einer Kombination aus positiver und leicht negativer Konditionierung lassen sich physiologische Grenzen erkennen. Die Hörschwelle lässt sich zum Beispiel erforschen, wenn man eine Maus bei einem bestimmten Frequenzbereich belohnt, bei einem anderen bestraft. Wenn nun die Maus die beiden Frequenzen unterscheiden kann, wird sie die Bestrafung vermeiden; wenn die Hörschwelle erreicht ist (Frequenzen zu nahe beieinander) wird sie die Bestrafung nicht mehr bewusst umgehen können. Die Form des assoziativen Lernens ist weit verbreitet. Sogar Strudelwürmer können konditioniert werden. Wenn man diesen Tieren einen optischen Reiz gibt (Aufleuchten einer Lampe) und ihnen danach einen leichten Stromstoss versetzt, zeigen sie ebenfalls eine Reaktion auf die Lampe. 6 b) Operante Konditionierung Diese Form der Konditionierung geht auf den amerikanischen Psychologen E. Thorndike zurück. Er brachte Katzen in einen Trickkäfig. Dieser Käfig war mit einer Schlaufe ausgestattet, die bei Betätigung die Tür öffnete. Die Katzen wurden nun für mehrere Stunden nicht gefüttert und vor dem Käfig wurde ein Fressnapf aufgestellt, so dass die Motivation der Tiere gross war, sich aus dem Käfig zu befreien. Die Experimente zeigten, dass sich bei jeder weiteren Wiederholung des Versuches die Konzentration der Katzen immer mehr auf die Schlaufe fokussierte, bis sie schliesslich gleich nach dem Einsperren an der Schlaufe zogen und sich befreiten. Dieser Versuch-Irrtum-zufälliger-Erfolg wird heute als operante oder instrumentale Konditionierung bezeichnet. Andere Vorgehensweisen, die keinen Erfolg brachten werden mit der Zeit unterlassen (herumlaufen im Käfig und einen anderen Ausgang suchen). Der Behaviorist Skinner untersuchte, ob bei Tieren Antizipationen vorkommen. Heute ist man der Meinung, dass die Tiere in Laborumgebungen die Reaktion auf eine Handlung nicht abschätzen (antizipieren) können, dass dies aber in der natürlichen Umgebung durchaus möglich ist. In seinen Skinner-Boxen untersuchte er vor allem Tauben und Ratten. Skinner liess die Ratten zuerst lernen, dass das Drücken eines Hebels Futter bringt. Danach schränkte er das ganze ein; indem er nur noch Futter verabreichen liess, wenn die Ratte den Hebel drückte nachdem ein Licht aufgeleuchtet hatte, bei den Versuchen den Hebel zu drücken, wenn die Lampe zuvor nicht aufgeleuchtet hatte, liess er leicht bestrafen. So konnte er auch Untersuchungen an den physiologischen Grenzen durchführen (Farbsehen der Ratten). Diese operante Konditionierung ist ein Lernen am Erfolg. Die Zeitdauer zwischen dem konditionierten (bedingten) Reiz (rote Lampe) und dem unkonditionierten (unbedingten) Reiz des Hebeldrückens ist entscheidend für den Lernerfolg. Der konditionierte darf dabei nicht vor dem unkonditionierten Reiz aufhören. Das Ende ist also sehr wichtig. B. Moore (?) untersuchte die Frage, ob zwischen der klassischen und der operanten Konditionierung wirklich solch grosse Unterschiede bestehen wie oftmals angenommen wird. Bei der klassischen Konditionierung wird aus einem neutralen Reiz ein konditionierter Reiz. Die Sensorik der Tiere ist somit anders; die Reaktion bleibt aber dieselbe (Speicheln). Bei der operanten Konditionierung muss kein neuer Reiz gelernt werden, sondern eine neue Reaktion (das motorische Repertoire wird erweitert). Ob wirklich ein Unterschied besteht, versuchte Moore mit Tauben in einer Skinner-Box zu erforschen. Er hat sich dabei das Pickverhalten der Tauben angeschaut und festgestellt, dass die Tauben unterschiedlich pickten, je nachdem ob sie Wasser oder Futter erwarten durften. Wenn die Belohnung Futter war, pickten sie mit geschlossenen Augen und leicht geöffnetem Schnabel; bei Wasser waren die Augen offen und der Schnabel geschlossen (Tauben saugen Wasser mit dem geschlossenen Schnabel). Moore schloss daraus, dass die Taube die Scheibe als Futterkorn oder Wasser angesehen hat und dass somit die Reaktion der Tauben gar nicht so zufällig war als man bis dahin betrachtete. Es zeigt sich, dass eigentlich die Unterscheide zwischen der klassischen und der operanten Konditionierung nicht so gross sind, da die Tauben eigentlich auf die Scheibe konditioniert werden und diesen vormals neutralen Reiz nun als Futter oder Wasser betrachten (klassische Konditionierung). Die unterschiedlichen Arten lassen sich unterschiedlich gut auf bestimmte Reize konditionieren. Diese artspezifische Lerndisposition ist ein Produkt der natürlichen Selektion. Bei den Konditionierungen wird ein eigenes Verhaltensmuster (aus dem eigenen Repertoire) modifiziert. Man kann sich nun fragen, warum die Arten nicht alles gleich gut lernen. Vermutung zielen dahin, dass bestimmte Arten nur bestimmte Dinge lernen müssen. Die Schwierigkeiten andere Sachen zu lernen ist ein evolutiver Schutz, damit die Tiere nicht unwichtiges lernen und sich zu stark verzetteln. So kann man bei Laboruntersuchungen einige Assoziationen sehr schnell und andere fast gar nicht erstellen. Ratten finden ihre Nahrung über den Geruchs- und Geschmackssinn. Wenn eine neue Nahrung zum ersten Mal auftritt, fressen die Tiere am ersten Tag nur ein kleines Stück, am zweiten etwas mehr usw. Erst nach einigen Tagen ist die neue Nahrung im Nahrungsrepertoire vollständig aufgenommen worden. Diese Verhaltensweise macht eine Vergiftung der Ratten sehr schwierig, da sie bei Übelkeit auf die neue Nahrung schliessen und von dieser ablassen. Die heute eingesetzten Gifte zeigen erst nach einer bestimmten Zeit Vergiftungserscheinungen, so dass die Tiere die Nahrung nicht mit der Übelkeit in Verbindung bringen. Die heutigen Gifte führen zu einem qualvollen inneren Verbluten der Tiere. J. Garcia führt Experimente mit γ-Strahlen durch, die bei den bestrahlten Tieren nach einer Stunde zu Übelkeit führen. Ratten bevorzugen Saccharin gesüsstes Wasser gegenüber normalem Leitungswasser. Nach der Verabreichung von gesüsstem Wasser bestrahlte er sie mit γ-Strahlen. Die konditionierten Ratten stellten ihre Nahrungsaufnahme in der Folge sofort ein, falls bei einem Nahrungsmittel Saccharingeschmack auftrat. Beim Menschen ist es sehr ähnlich; eine Nahrungsmittelvergiftung hat oft zur Folge, dass man das betreffende Nahrungsmittel über längere Zeit nicht mehr essen kann. In einem weiteren Experiment liess Garcia die Tiere Saccharin gesüsstes Wasser trinken, danach liess er eine Klingel ertönen (oder ein optisches Signal, vgl. Vögel, auftreten) und bestrahlte die Tiere anschliessend. Es zeigt sich, dass die konditionierten Tiere in der Folge, das gesüsste Wasser vermieden, jedoch das Klingeln nicht; sie stellten also keine Assoziation zwischen dem Unwohlsein und dem Klingeln her. Bei einem anderen Versuch wurde den Tieren wieder gesüsstes Wasser angeboten, es ertönte darauf eine Klingel, danach wurde ihnen aber über den Fussboden ein leichter elektrischer Schlag verpasst. In der Folge tranken die Tiere trotzdem gesüsstes Wasser, vermieden aber die Klin- 7 gel. Es wurde also keine Assoziation zwischen dem Geschmack der Nahrung und dem elektrischen Schlag hergestellt. Die Assoziationen erfolgten also zwischen Geschmack und Übelkeit, Klingeln und Strafreiz (elektrischer Schlag) und erfolgten nicht zwischen Geschmack und Strafreiz, Klingeln und Übelkeit (Abb.2). Es zeigt sich somit, dass die Art der Reize für den Erfolg der Konditionierung (Lernerfolg) von ausschlaggebender Bedeutung ist. Vögel verbinden optische Reize sehr wohl mit Übelkeit. Es zeigt sich, dass beim Lernen die natürlichen Verhaltensweisen mitberücksichtigt werden müssen. So finden Ratten ihre Nahrung über den Geruch und Geschmack und nicht über optische Anhaltspunkte; deshalb können sie kaum ein optisches Signal mit Übelkeit assoziieren. Vögel dagegen wählen ihre Beute nach optischen Kriterien aus, so dass bei ihnen eine solche Konditionierung erfolgen kann. Auch Experimente mit Katzen liefern ein ähnliches Ergebnis. Einer Katze kann kaum beigebracht werden, dass sie laufen in einem Tretrad mit Nahrung assoziiert, da Katzen bei der Nahrungssuche lauern und nicht viel umherlaufen. Auch wird eine Katze auf der Flucht kaum einen Hebel betätigen. Die Lernfähigkeit stellt eine evolutive Anpassung dar. Aufgrund dieser evolutiven Geschichte ist die Lernfähigkeit nicht so flexibel wie man das oftmals gerne beschreibt; der genetische Background liefert die Grenzen. Die Lernfähigkeit ist somit nicht unbegrenzt. Durch die natürliche Evolution wird nur eine Lernfähigkeit in bestimmten ‚Sparten’, die den Tieren einen Vorteil bieten, zugelassen. 2. Lernen ohne Bestrafung oder Belohnung a) Das Raumlernen Das Raumlernen hat eine grosse Bedeutung. Die Tiere müssen sich in ihrer Umgebung zurechtfinden um z.B. angelegte Nester wiederzufinden. Mit dem Bienenwolf (Phillanthus triangulum), einer Grabwespe, die ihre Eier in Sandboden legt, wurden solche Versuche von N. Tinbergen durchgeführt. Bevor die Grabwespe ihr Nest verlässt, untersucht sie die Umgebung und merkt sich Besonderheiten dieser. So wurden im Versuch Tannenzapfen im Kreis um das Nest angeordnet. Als die Grabwespe zur Jagt ausflog, haben die Forschen die Landmarke (den Tannzapfenkreis) um einige Meter verschoben. Die zurückkehrende Grabwespe suchte in der Folge den Eingang zu ihrer Höhle in der Mitte des Kreises. Tinbergen konnte somit das Raumlernen nachweisen. Das Raumlernen ist reversibel, damit die Tiere auf sich verändernde Bedingungen reagieren können (Grabwespe hat das Nest trotzdem noch gefunden). Es stellt sich aber die Frage nach artspezifischen Lerndispositionen. Diese Frage wurde an Kleinnagern der Familie der Microtinen untersucht. Bei den verschiedenen Arten sind die Aktionsradien der Männchen und Weibchen zum Teil gleich und zum Teil verschieden. Bei den polygynen (ein Männchen mehrere Weibchen) Männchen der Art Microts pennsylvanicus (Wiesenmaus) ist der Aktionsradius viermal so gross wie derjenige der Weibchen. Bei den monogamen Arten M. orchogaster (Präriewühlmaus) und M. pinetorum (Kiefernwühlmaus) finden sich keine Überlappungen in den Aufenthaltsbereichen der Männchen und Weibchen. Bei Labyrinthversuchen, bei denen der richtige Weg mit Nahrung belohnt wurde, wurde nun getestet wie schnell die Weibchen und die Männchen einer Art einen Weg lernten. Es zeigte sich, dass die These, dass sich das Raumlernverhalten geschlechtsspezifisch verschieden ist, bei M. pennsylvanicus nachgewiesen werden kann. Die Männchen begingen auf ihrem Weg weniger Fehler als die Weibchen, während bei den anderen Arten kein signifikanter Unterschied festzustellen war. Die Hypothese, die dazu aufgestellt wurde, geht davon aus, dass Männchen, die eine schnelleres/effizienteres Raumlernfähigkeit zeigen daraus einen Selektionsvorteil ziehen können. Diese erhöhte Fitness führt zu einer grösseren Selektion auf Raumlernen. Wenn diese Vermutung stimmt, müsste eigentlich das Hirnareal, das für die räumliche Orientierung zuständig ist, bei den Männchen von M. pennsylvanicus gegenüber demjenigen der Weibchen vergrössert sein. Und tatsächlich konnte ein grösserer Hyppocampus nachgewiesen werden. b) Habituation (Nicht-mehr-reagieren) Es hat sich gezeigt, dass wiederholtes Auslösen einer Reaktion ohne Belohung die Motivation auf den Reiz zu reagieren herabsetzt. Am nächsten Tag kann sie aber wieder mit unvermittelter Motivation durchgeführt werden. Das Tier ist also habituiert, doch kann die Ansprechbarkeit wieder steigen. Diese Vermutung wurde auch für aggressives Verhalten nachgeprüft. Die Hassreaktion von Buchfinken gegenüber einem Fressfeind nimmt im Laufe der Zeit tatsächlich ab (die Buchfinken haben von diesem Feind nichts zu befürchten). Bei Kampffischen, steigt jedoch mit zunehmendem Präsentieren einer Attrappe die Kampfbereitschaft (der Buntbarsch muss sein Revier verteidigen, dabei steigert ein Aggressor, der nicht zurückweicht, die Heftigkeit der Reaktion) c) Prägung Die Prägung ist an eine sensitive Phase gebunden. Die Prägung führt zu einer langanhaltenden oder sogar irreversiblen Verhaltensveränderung. Die Prägungsprozesse sind für das Zusammenleben in einem Sozialverband von eminenter Bedeutung. 8 Definition der Prägung: ‚Lernprozess, der während einer speziellen Phase der Entwicklung stattfindet und das weitere Verhalten gegenüber Eltern, Altersgenossen oder Geschlechtspartnern beeinflusst.’ Der Begriff der Prägung stammt nicht von Lorentz, sondern Oskar Heinrot hat den Begriff geprägt; des weiteren war Lorentz nicht der erste, der sich mit der Prägung befasste. Nachfolgeprägung Für seine Untersuchungen der Nachfolgeprägung wählte Lorentz Graugansküken; er stellte fest, dass nach 24h eine irreversible Prägung eingetreten war und dass die sensitive Phase sich von 12 bis 20 Stunden nach dem Schlüpfen erstreckte. 3.5.02 Es stellte sich nun die Frage warum die Küken gerade zu diesem Zeitpunkt für eine Prägung empfänglich waren. Untersuchungen zeigen, dass in der sensiblen Phase die motorische Lauffähigkeit voll ausgebildet und dass die Furchtreaktion noch nicht ausreichend entwickelt ist. Vor der sensiblen Phase können die Küken noch nicht genug gut laufen, um mit einem Elterntier mitzuhalten, danach ist die Furchreaktion zu stark ausgebildet, als dass das Küken noch einem ungeprägten Objekt folgen würde. Da sich die Prägung auf ein bewegliches lauterzeugendes Objekt bezieht, wird normalerweise in der sensiblen Phase eine Prägung auf die Mutter erfolgen. Die Prägung auf die Mutter hat den Sinn, dass das Küken nicht einem Fressfeind nachläuft oder einem Artgenossen, der ihm aber kein Futter und keinen Schutz bietet. Jedoch kann nicht auf beliebige sich bewegende Ersatzobjekte geprägt werden. Die Grösse des Objekts setzt die Grenzen; ein Küken zeigt in jeder Lebensphase eine Furchtreaktion gegenüber einem zu grossen Objekt, während es nach zu kleinen pickt. Dadurch, dass unterschiedliche Farben und Formen, die Nachfolgeprägung unterschiedlich gut auslösen, konnte geschlossen werden, dass hier eine artspezifische Lerndisposition vorliegt. Man findet also einen AAM (Angeborener Auslöse Mechanismus). Sexuelle Prägung Klaus Immelmann stellte fest, dass handaufgezogene Zebrafinken den Menschen als Sexualpartner betrachten. Bei seinen Untersuchungen liess er Zebrafinkeneier von Japanischen Möwchen ausbrüten und die Jungen aufziehen. Die jungen Zebrafinkenmännchen zeigten danach eine sexuelle Fehlprägung, indem sich ihre Balz an die Japanischen Möwchen richtete. Wenn er die fehlgeprägten Individuen nur mit Zebrafinkenweibchen in einem Käfig hielt, kam es zwar zu Paarungen, doch sobald ein Japanisches Möwchen dazugegeben wurde, liessen sie von ihren Artgenossen ab. Dies zeigt, dass die Fehlprägung nicht aufgehoben wird. Weitere prägungsähnliche Fixierungen sind in den letzten Jahren beschrieben worden. So die Nahrungsprägung, die sozialen Beziehungen, bei Parasiten (Bsp. Schlupfwesepen) wird die Wirtsspezifität geprägt, die Wegfindung verschiedener Tierarten (Lachs erkennt Geburtsfluss am Geruch), das Gesangslernen (Wenn Buchfinken isoliert aufgezogen werden, bringen sie keinen artspezifischen Gesang sondern nur ein Gestammel hervor. Wenn sie zusammen mit Wiesenpiepern aufgezogen werden, werden Komponenten deren Gesangs eingebaut; diese Nachahmung führt zu einer irreversiblen Prägung. Wenn jedoch ein Buchfink mit dem Gesang eines Wiesenpiepers und eines Artgenossen aufgezogen wird, filtert er den arteigenen Gesang heraus. Die Gesangsprägung ist mit 13 Monaten abgeschlossen. Dieser Zeitpunkt ist hormonal reguliert, da kastrierte Männchen nicht singen, spritzt man jedoch Testosteron (auch noch im Alter von 2 Jahren) wird die Prägung noch nachgeholt), der Spracherwerb des Menschen (neuronal), Sozialprozesse (→Entwicklung von sozialer Kompetenz; Säuglinge in Säuglingsheimen sind anfälliger gegenüber Krankheiten (Deprivatisierung/Hospitalismus), da die soziale Bindung fehlt). Motivation Viele Organismen leben nicht in völlig stabilen Umgebungen. So schwankt z.B. die Nahrung; die Tiere sind aufgrund dessen gezwungen Verhaltensweisen aktivieren zu können, die ihnen ein Ausgleichen der Schwankungen ermöglichen. Die Tiere müssen, obschon sie unregelmässig Nahrung aufnehmen, eine energetische Konstanz aufrecht erhalten können. Das zu erstrebende Gleichgewicht ist sehr wichtig, da die Stoffwechselvorgänge auf einem bestimmten Level optimiert sind (Homöostasis); dies bietet dem Organismus einen evolutiven Vorteil. Das bisher Diskutierte kann jedoch nicht das ganze Verhalten eines Tieres erklären, denn die Motivation/der innere Zustand muss berücksichtigt werden. Erstens, das der Situation angepasste Verhalten lässt sich über die Handlungsbereitschaft (Motivation) eines Tieres erklären. So versteht man auch, wieso derselbe Reiz zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Reaktionen auslösen kann (manchmal reicht ein geringer Reiz, zu einem anderen Zeitpunkt dagegen ein starker Reiz um dieselbe Reaktion auszulösen). Zweitens kann der innere Zustand innerhalb von Minuten oder Stunden wechseln, ausserdem ist diese Veränderung reversibel (Gegensatz zum Lernen und zur Prägung). Drittens wird nicht ein Verhalten betroffen, sondern funktionelle Verhaltenszusammenhänge werden beeinflusst (bei Hunger wird das Suchen, Jagen, Töten, Fressen usw. aktiviert während die Suche nach 9 einem Sexualpartner in den Hintergrund rückt). Viertens wird das angepasste Verhalten noch mit der Umwelt abgeglichen. So ist der Selbstschutz wichtiger als das Fressen. R. Woodworth entwickelte das System der Triebe. Der Trieb liefert dabei die Energie zur Durchführung eines bestimmten Verhaltens. Somit führt eine Anhäufung von Energie zu einem bestimmten Verhalten. Lorentz entwickelte sein System des inneren Drangs auf dem System von Woodworth aufbauend. Er stellte sich die Frage, wieso Katzen nur fressen wenn sie hungrig sind. Es wurde versucht sein auf Seite 2 abgebildetes Modell experimentell nachzuweisen. Mit zunehmendem Hunger häuft sich im Tier handlungsspezifische Energie an (Fresstrieb). Das Ventil stellt die motorische Aktivität dar, die bei niedriger Motivation (niedriger Pegelstand) durch eine Feder zurückgehalten wird. Durch das Gewicht wird die Reizstärke symbolisiert. Das Ventil kann nun über einen hohen Wasserstand (grosse Motivation/innere Handlungsbereitschaft) und/oder über ein grosses Gewicht (grosse Reizstärke) geöffnet werden. Wenn der Pegelstand einen kritischen Wert erreicht hat, kann das Ventil auch ohne Reiz geöffnet werden, es kommt somit zu einer Leerlaufhandlung. Danach ist der Behälter leer und es muss sich zuerst wieder ein neuer Trieb aufbauen. Der Trog symbolisiert die motorischen Komponenten; bei leichter Öffnung wird nur eine leichte Stufe aktiviert (leichte Mobilisation (vermehrtes Suchen)), bei einer starken Öffnung dagegen wird der Trog gefüllt und die motorische Aktivität ist grösser. Lorentz übertrug dieses System auch auf das Aggressionsverhalten von Tier und Mensch. Diese Übertragung hatte grossen Einfluss auf die menschliche Gesellschaft, da impliziert wird, dass die Aggressivität des Menschen nicht reguliert werden kann, da sich in ihm ein Aggressionspotential aufbaut, das in einer aggressiven Handlung abgebaut werden muss. Das Modell von Lorentz bietet aber den Vorteil, dass es experimentell nachzuprüfen ist. Sollte es tatsächlich so ablaufen, dass der Vorratsbehälter mit der Zeit volläuft und durch eine Handlung entleert wird, sollte nach einer aggressiven Handlung der Behälter leer sein und das Tier sollte im Folgenden kein aggressives Verhalten mehr zeigen (auf ein Handlung sollte eine Ruhephase folgen, die Aggressionsmotivation nimmt ab). Diese Aussage konnte jedoch experimentell nicht nachgewiesen werden, vielmehr wurde gezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Auch ein Anhäufen der Aggression, konnte nicht nachgewiesen werden. Untersuchungen an Buntbarschen (Pelmatochromis ssp.) zeigten, dass bei einzeln gehaltenen Individuen kein Aufstauen der Aggressivität nachgewiesen werden konnte und dass nach dem Präsentieren eines Revierkonkurrenten, der nicht vertrieben werden konnte (wurde in einer Glasröhre ins Aquarium des einzelnen Tieres gebracht), keine Abnahme in der Aggressivität beobachtet werden konnte, im Gegenteil, die Aggressivität blieb über mehrere Tage auf einem höheren Level als zuvor. Das Lorentz’sche Triebkonzept kann somit das Verhalten der Tiere nicht ausreichend erklären und voraussagen; es ist deshalb irreleitend und wurde verworfen. Es wäre eigentlich auch evolutiv unlogisch, dass die Aggressivität nach Ausführen einer aggressiven Handlung absinkt und vielleicht sogar eine Zeit den Wert null erreicht, da ja ein Revier verteidigt werden muss, dabei sollte die Motivation um dieses Revier zu kämpfen auf keinen Fall sinken, da ansonsten die zuvor geleistete Arbeit wertlos wäre. Des weiteren muss ein Kontrahent mit vermehrter Kraft und Aggressivität bekämpft werden, wenn er nicht abzieht, nach dem Modell von Lorentz würde aber die Motivation den Rivalen zu vertreiben sinken. Wichtig ist auch die Feststellung, dass es zu keinem Aufstauen von Aggressivität kommt, sondern dass innere und äussere Faktoren für die Ausprägung von Aggressivität eine Rolle spielen. Das Lorentz’sche Modell wurde in der Folge, durch ein Modell ersetzt, indem die Rückkopplung mit berücksichtigt wird. Dieses Homeostatische Motivationsmodell ist ebenfalls auf Seite 2 abgebildet. Es stellt einen einfachen Regelkreis dar, der mit einer Raumheizung verglichen werden kann. Der Sollwert (Idealzustand) wird dabei ständig mit dem Istwert vom Gehirn verglichen. Das eigene Verhalten hat dabei einen Einfluss auf den Istwert. Der Hypothalamus (Überwachung der Temperatur, Wasserhaushalt usw.) nimmt die gelieferten Daten auf, verarbeitet sie und gibt entsprechende Signale an die Hypophyse ab. Die Hypophyse steht als Leitstelle des endokrinen Systems auch mit anderen Hirnregionen in sehr enger Verbindung. Das Modell kann zwar das Verhalten der Tiere um einiges besser erklären als das alte Lorentz’sche Modell, doch ist es immer noch nicht zufriedenstellend. Neben dem Feedback muss auch ein Feedforward auftreten, da Tiere nicht als Antwort auf ein Durstgefühl trinken, sondern bereits in Erwartung von Durst. Ein Trinken als Antwort auf den Durst würde ohne Regulation zu einer Aufnahme eine zu grossen Wassermenge führen (erst nach 7.5min ist das Blutplasma ausreichend verdünnt und erst nach 12min sind die Körperflüssigkeiten physiologisch ausgeglichen). Untersuchungen an Menschen, denen 24h keine Flüssigkeitsaufnahme erlaubt wurde, haben aber gezeigt, dass die Probanden innerhalb von 2.5min genau die physiologisch ausreichende Menge Wasser aufnahmen (zuviel Wasser müsste wieder über Energieverbrauch ausgeschieden werden). Man vermutet Osmorezeptoren im Mund, die dieses beobachtete Feedforwart erklären könnten. Diese Resultate wurden auch mit Ratten bestätigt, deren Ernährung zu einem künstlichen Vitaminmangel führten. Die Ratten wählten aus den unterschiedlichen Nahrungen, die ihnen angeboten wurden, diejenige aus, die das mangelnde Vitamin enthielt. Das Vitamin konnte dabei von den Ratten weder gerochen noch geschmeckt werden. Es zeigt sich ausserdem, dass sogar zuvor unbekannte Nahrung ins Nahrungsspektrum zusätzlich aufgenommen wurde, um den Vitaminmangel zu kompensieren. Die allgemeine Wahrnehmung von Emotionen (geht es einem Hund schlecht wenn er Hunger hat?) konnte noch nicht definitiv geklärt werden. Man vermutet, dass die Tiere am Allgemeinen Wohlergehen und Gesundheit anstreben. Ein neues Modell, das die Ungereimtheiten seiner Vorgänger ausräumen sollte, wird zur Zeit besprochen. Diese adaptive Kontrolle berücksichtigt, dass Tiere häufig in Motivationskonflikten stehen (stärkste Motivation setzt 10 sich durch). Auch Lorentz hat dies schon beobachtet und von einem Parlament der Treibe gesprochen, wobei heute der Begriff des Triebs nur noch selten gebraucht wird. Die Motivationspriorität kann beim Teichmolch (Triturus vulgaris) nachgewiesen werden. Bei diesem kommt es zu einer Unterwasserbalz. Die Tiere sind aber nicht mehr befähigt über Kiemen zu atmen, so dass sie zum Luftholen auftauchen müssen. Die Männchen leiten die Balz mit starken Schwanzbewegungen ein, die einen grossen Sauerstoffverbrauch zur Folge haben. Nachdem das angebalzte Weichen geantwortet hat, läuft die Balz weiter. Erst nachdem das ganze Repertoire abgeschlossen wurde, gibt das Männchen einen Spermatophoren ab, der vom Weibchen aufgenommen wird. Erst danach steigt das Männchen zur Oberfläche auf um Luft zu holen. Das Männchen steht somit im Motivationskonflikt zwischen Luftholen und Fortpflanzung. Tim Hallyday konnte den normalen Balzverlauf unterbrechen, indem er die Weichen in eine ‚Zwangsjacke’ steckte, so dass sie nicht antworten konnten. Die Männchen waren somit in einem Verhalten gefangen, da sie nur weiterbalzen, wenn das Weibchen eine Antwort gibt. Es zeigte sich, dass die Männchen länger unter Wasser blieben als gewöhnlich. Die Sexualität steht somit in der Priorität über dem Luftholen. 10.5.02 Zyklisches Verhalten Alle Tiere zeigen eine zyklische Aktivität. Nun stellt sich die Frage, wie diese Zyklizität gewährleistet wird. Es lassen sich drei verschiedene Theorien aufstellen, die diese Frage beantworten. 1. Ein inneres Zeitsystem ist für die Aufrechterhaltung des Verhaltens zuständig (endogener Rhythmus = innere Uhr). 2. Das Verhalten erfolgt als Antwort auf einen sich verändernden Umweltreiz (exogener Rhythmus). 3. Eine Kombination der ersten beiden Punkte könnte den Rhythmus bestimmen. Da Grillen optisch ausgerichtete Räuber fürchten müssen, findet die Sexualpartnersuche erst nach Einbruch der Dunkelheit statt. Die Männchen passen die Zeit, in der sie singen, diesem Umstand an. Um aber beispielweise immer um vier Uhr Nachmittags mit dem Singen zu beginnen, müssen sie einen Zeitgeber haben, der sie den Anfang und das Ende der Gesangesperiode bestimmen lässt. Bei amerikanischen Grillen (Teleogryllus commods) wurde nun untersucht welche der oben genannten Erklärungen für diese Rhythmik zutrifft. Ob allein ein äusserer Faktor eine Rolle spielt, ist recht einfach nachzuweisen, denn Grillen im Dauerlicht sollten sofort ihren Gesangesrhythmus verlieren. Die Experimente zeigten aber, dass die Gesangsdauer ziemlich konstant bleibt, dass aber die Anfangszeit pro Tag jeweils etwas nach hinten verschoben wird (Zykluslänge 25-26h). Dies schliesst allein äussere Faktoren aus. Aber auch innere Faktoren können nicht allein verantwortlich sein, da sich unter Dauerlichtbedingungen der Anfang verschiebt. Man schliesst daraus, dass eine Kombination für den Rhythmus verantwortlich ist. Dabei übernimmt der endogene Rhythmus die Rolle eines groben Taktgebers, der über die exogenen Faktoren feinreguliert wird. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem freilaufenden circadianen Rhythmus. Sobald den Grillenmännchen aber wieder der natürliche Tag-Nacht-Rhythmus geboten wurde, stellte sich das System – sprich die Anfangszeit des Gesangs – wieder normal ein. Das heisst, dass ein äusserer Faktor Einfluss auf den endogenen Rhythmus nehmen kann. Ein äusserer Reiz wirkt somit als Zeitgeber für den endogenen Rhythmus. Aschow hat den Begriff des Zeitgebers geprägt. Das Kontrollsystem für den Grillengesang beinhaltet somit beide Komponenten; eine innerer (endogene) und eine äussere (exogene) Zeitgebungseinheit (umweltaktivierte Anpassung). Diese Resultate sind in Abbildung 3 zusammengefasst. Beim sogenannten Bunkerversuch wurden menschliche Probanden für drei Wochen in einen Raum eingesperrt, ohne Zugang zu künstlichen oder natürlichen Zeitgebern. Es zeigt sich, dass der Mensch auch einen endogenen Rhythmus von 26-27h hat. Die Aktivitätszeit bleibt in etwa konstant über die Versuchsdauer. Es zeigte sich, dass sowohl Wirbeltiere wie auch Wirbellose eine innere Uhr besitzen. Mit anderen Experimenten wurde versucht, diese innere Uhr zu lokalisieren. Es zeigt sich, dass bei beiden Gruppen das Gehirn eine zentrale Rolle spielt. Bei den Säugern wurde im Speziellen (besser untersucht als andere) festgestellt, dass eine bestimmte Zellgruppe im Hypothalamus den Takt vorgibt. Dabei wird dieser endogene Rhythmus über äussere Faktoren abgeglichen (Hell-Dunkel, Luftfeuchtigkeit usw.). Neben dem circadianen lässt sich auch ein circalunarer Zyklus bei einigen Gruppen finden. Der Mond zeigt einen Zyklus von 29.5 Tagen (er geht täglich 50min später auf). Am besten untersucht sind dabei marine Organismen (im Speziellen der Palolo-Wurm), die den Mond zur Synchronisation der Ei- und Spermienabgabe brauchen. Auch dieser lunare Rhythmus ist freilaufend und circalunar und wird durch den Mond noch feinreguliert. Für das Fortpflanzungs-, Zugverhalten und die Mauser der Vögel wurde lange Zeit ein circannualer Rhythmus (saisonales Verhaltensmuster) besprochen. Auch beim Winterschlaf der Säuger scheint es sich um einen annualen Zyklus zu handeln. Der Frage nach dem Vorhandensein annualer Rhythmen bei Vögeln ging E. Qwinnes nach, obschon die Erwartung auf ein mehrjähriges Experiment die meisten Forscher abschreckt. Qwinnes führte seine Experimente unter völlig standardisierten Bedingungen (für jeden Vogel hatte er einen eigenen Raum, um eine gegenseitige 11 Beeinflussung ausschliessen zu können) mit afrikanischen Schwarzkehlchen (Saxicola torquatus) durch. Normalerweise beginnt in ihren Heimatgebieten die Regenzeit im April, darauf wird die Fortpflanzung ausgerichtet, damit die Jungen in ein reiches Nahrungsangebot an Insekten geboren werden. Die Tiere zeigen auch unter den standardisierten Bedingungen einen Rhythmus der eine Fortpflanzung im April erfolgen lassen würde. Doch ist auch dieser Zyklus freilaufend und circannual, da sich die Fortpflanzungsperiode im Laufe der Jahre nach vorne verschiebt. Die Fortpflanzungszeit wurde anhand der Hodengrösse bestimmt (vgl. Vorlesung Briegel). Auch hier spielt also ein äusserer Reiz die Rolle eines Feinregulators. Lange Zeit wurde die Photoperiode als äusserer Faktor ausgeschlossen, da in der Tagelänge nahe am Äquator praktisch keine Unterschiede festzustellen sind. Die Tiere, die nahe dem Äquator leben, können aber bereits minimale Unterschiede in der Tageslänge feststellen und diese als Regulator verwenden. Häufig ist aber der eigentliche äussere Zeitgeber unbekannt. Bei unseren heimischen Vögeln wurde die Photoperiode eindeutig als exogener Faktor bestimmt. Es stellt sich nun die Frage wieso die Regulation über einen äusseren Reiz im Laufe der Evolution nicht aufgegeben und nicht durch die Selektion der endogene Zeitgeber auf genau 24h eingestellt wurde. Auch in den Äquatorgebieten setzt die Regenzeit nicht immer am gleichen Datum ein; der Beginn kann um mehrere Wochen differieren. Ein Verhalten, das einzig durch den endogenen Rhythmus bestimmt würde, wäre in einem solchen Fall zu unflexibel und die Tiere würden stur immer am selben Tag mit dem Brüten beginnen, egal ob die Bedingungen günstig oder ungünstig sind. Aufgrund dessen ist eine Feinregulation über die exogenen Faktoren nötig. Bisher wurden die abiotischen Faktoren, die als Zeitgeber fungieren können, besprochen (Nahrung ist ebenfalls ein abiotischer Faktor). Daneben werden aber auch soziale Reize als Zeitgeber besprochen. G. Perrigo hat zu diesem Thema Versuche an Hausmausmännchen durchgeführt. Mausmännchen halten sich in ihrem Territorium ein Harem und verteidigen dieses Gebiet gegenüber anderen Mausmännchen. Es konnte nun beobachtet werden, dass die Mausmännchen, die ein neues Gebiet erobern, zu Beginn alle Nestlinge, die sie finden, totbeissen. Auslöser für dieses aggressive Verhalten ist eine Ejakulation bei der Paarung mit einem adulten Weibchen. In den folgenden 20 Tagen führen die Männchen Infantizid aus. Um in den folgenden 30 Tagen führsorgliche Väter zu sein, die sehr um das Wohl der Jungtiere besorgt sind. 50 Tage nach erfolgter Ejakulation folgt wieder ein aggressives Verhalten gegenüber Nestligen, wenn seit der ersten Ejakulation keine weitere erfolgt ist. Dieses Verhalten hat den Sinn, dass nach Übernahme eines fremden Territoriums, die Nachkommen noch nicht vom neuen Besitzer stammen können und er somit die fremden Gene ‚entfernt’. Nach einer Tragzeit von 21 Tagen werden nun seine Jungen geboren und er muss um das Wohlergehen seiner Jungen besorgt sein. Wenn danach aber keine Ejakulation mehr stattfindet, können Jungtiere, die sich nach dem 50sten Tag in einem Nest befinden nicht von ihm stammen, da die Jungtiere im Alter von 30 Tagen, nach 17 Tagen Säugezeit, das Nest verlassen und selbständig leben. Perrigo vermutete, dass die Männchen einen endogenen Zähler besitzen, der anhand der Hell-Dunkelwechsel bestimmt wie viele Tage seit der Paarung vergangen sind. Wenn also die Anzahl Wechsel von Hell zu Dunkel als Zeitgeber angenommen werden kann, sollte die absolut vergangene Zeit seit der Paarung keine Rolle für den Verhaltenswechsel spielen. Zuerst musst Perrigo aber eine Beeinflussung der Männchen durch die Weibchen ausschliessen; dies gelang ihm auch. In der Folge konzentrierte er sich auf den endogenen Rhythmus. Zu diesem Zweck hielt er Mausmännchen unter Kurztagbedingungen (11h hell, 11h dunkel), eine Gruppe unter Langtagbedingungen (13.5h hell, 13.5 dunkel) und eine Kontrollgruppe unter 12h hell und 12h dunkel. Nach effektiv 20 Tagen waren bei den Kurztagmäusen schon 22 Hell-Dunkelwechsel und bei den Langtagmäusen erst 18 abgelaufen. Perrigo konnte nun nachweisen, dass tatsächlich die Anzahl der Hell-Dunkelwechsel für den Wechsel im Verhalten zuständig ist und dass die effektiv vergangene Zeit keine Rolle spielt. Wie dies aber genau abläuft konnte bis heute nicht geklärt werden. Auch bei Rothirschen wurden soziale Zeitgeber vermutet. McComb hat zu diesem Zweck eine grosse Population an Rothirschweibchen in drei Gruppen eingeteilt. Gruppe A wurde mit einem röhrenden aber vasektomierten Hirschmännchen gehalten, Gruppe B erhielt das Röhren eines Männchens ab Tonband vorgespielt und Gruppe C wurde völlig isoliert von männlichen Artgenossen gehalten (auch keine akustischen Signale). Nach einer gewissen Zeit wurden die Weibchen zu einer Gruppe potenter Männchen gebracht und die Zeit gemessen, bis das erste Kalb geboren wurde. Aus dem Geburtstag konnte geschlossen werden, wann der Östrus aufgetreten war. Bei Gruppe A und B trat dieser viel schneller ein als bei Gruppe C. McComb schloss daraus, dass das Röhren der Männchen Einfluss auf die saisonale Fortpflanzungsbereitschaft der Weibchen hat. Neben der reinen Zeitbestimmung können die endogenen und exogenen Faktoren, welche die innere Uhr beeinflussen auch einen richtungsgebende Komponente enthalten. Die Zugrichtung der Vögel ist beispielweise zeitabhängig. Anhand der Zugunruhe, die Ornithologen mühelos bestimmen können, kann der Zeitpunkt des normalen Ziehens bestimmt werden. Die Himmelsrichtung, auf die sich der Zug konzentrieren würde, kann mit Hilfe eines kreisrunden Käfigs, der in der Mitte eine Sitzstange und kreisförmig angeordnet weitere, die über einen Kontakt einen Zählmechanismus in Gang setzten können, bestimmt werden. E. Qwinner konnte mit Hilfe dieser Methode bei Untersuchungen an Gartengrasmücke (Sylvia borin) die Wegstrecke, welche die Tiere auf ihrem Zug zurücklegen würden, nachzeichnen. Anhand der gezählten Kontakte konnte er die Wegstrecke, welche die Tiere zurücklegen würden bestimmen; diese Wegstrecke aufgetragen mit der Zeit ergab genau die Route, die sie auf dem Zug einschlagen würden. Im August lösten sie vor allem die Sitzstange im Südwesten aus, während im September 12 hauptsächlich die südliche Stange ausgelöst wurde. Die Tiere wurden in einem Haus gehalten, in dem sie den Himmel sehen und somit die Zeit bestimmen konnten. Neben der Bestimmung der Zeit ist der Himmel für die Zugvögel unerlässlich. Bei Tagziehern konnte eine Orientierung mit Hilfe der Sonne (Sonnenkompass/orientierung) nachgewiesen werden. Nachzieher können sich mit Hilfe der Sterne orientieren. Bei Staren und Bienen konnte ein solcher Sonnenkompass nachgewiesen werden. Stare sind aber insofern speziell, als dass sie auch in der Nacht ziehen können und demzufolge auch einen Orientierungssinn besitzen müssen, der ihnen ein Richtungsbestimmung in der Nacht ermöglicht. Bei Bienen konnte ebenfalls ein Sonnenkompass nachgewiesen werden. Die Bienen müssen aber auch einen endogenen Zeitgeber besitzen, damit sie die Zeit seit ihrem Abflug vom Stock mit einrechnen können um die Bewegung der Sonne mit dem Standpunkt des Stockes abzugleichen. 16.5.02 Innerartliche Kommunikation Die Kommunikation ist ein grundlegender Eigenschaft des Lebens (Zell-Zell-Kommunikation, Befruchtung, Immunsystem, Partnerwahl etc.). Die Kommunikation zwischen Organismen hat zur Folge, dass A etwas macht, was das Sinnessystem von B so beeinflusst, dass B sein Verhalten ändert. Der Sender übermittelt über eine bestimmte Übertragungsstrecke ein Signal an einen Empfänger (Abb.4). Es existieren praktisch keine Organismen, die nicht innerhalb der Art miteinander kommunizieren. Die Informationen, die von einem Organismus zu einem anderen übertragen werden, sind enorm vielfältig und beziehen sich auf Gruppenmitglieder, Artmitglieder, Organismen gleichen oder verschiedenen Alters, Fortpflanzungsgemeinschaften u.a.. Darwin war überzeugt, dass Tiere Gefühle haben und dass über die Kommunikation eine Äusserung dieser Gefühle erfolgt. Konrad Lorenz und andere haben die Studien über die Kommunikation wieder aufgenommen. Lorenz stellte dabei vor allem vergleichende Untersuchungen an, um die Evolution der Kommunikation zu ergründen. Er war der Meinung, dass die Kommunikation bei Tieren über bestimmte Merkmale (Schlüsselreize) abläuft, die als Auslöser bei den Artgenossen eine bestimmte Reaktion (Auslösemechanismus) auslösen (Sender gibt Auslöser/Schlüsselreiz → Empfänger zeigt Auslösemechanismus). Zu diesem Zweck führte er Versuche mit Attrappen durch. Soziale Arten können wir nur verstehen, falls sie kommunizieren und wir diese Kommunikation auch verstehen. Signale entstanden häufig aus nicht-kommunikationsgebundenen Verhaltensweisen, die eine andere Bedeutung erhielten; man spricht in diesem Zusammenhang von einer Ritualisierung (Tinbergen). Bei Vögeln lässt sich ritualisiertes Putzverhalten beobachten. Dabei zeigen die Männchen in der Balz ein ritualisiertes Putzen und Sortieren des Gefieders als Kommunikationssignal innerhalb der gleichen Art. Im Allgemeinen kann man sagen, dass sich ritualisiertes Verhalten mit einer innerartlichen Intentionsbewegung verbunden ist. Dies lässt sich am Beispiel eines Taubenschwarms beobachten. Wenn ein Vogel, nachdem er katapultartig abgesprungen ist, wegfliegt sich aber vorher geduckt und den Kopf in den Nacken gelegt hat, bleiben die anderen ruhig. Wenn ein Vogel aber wegfliegt ohne die Intentionsbewegung ausgeführt zu haben, wird dies von den anderen als Alarm-Signal aufgefasst und alle Vögel fliegen weg. Es zeigt sich, dass der Unterschied in der Reaktion der Artgenossen auf das Verhaltend des ersten Vogels zurückgeführt werden kann. Das Ducken und in den Hals legen des Kopfes ist die Intentionsbewegung, welche die Absicht des Vogels anzeigt (Intention = Absicht). Das Aufstellen der Haare, das Aufplustern bei Vögeln und die Beeinflussung des peripheren Blutsystems (durch das vegetative Nervensystem gesteuert) stellt ein autonomes Bewegungsverhalten dar. Mit Hilfe des letzten Punktes (Thermoregulation) kann eine Aussage über den Gemütszustand gemacht werden. Man nimmt heute an, die Duftdrüsen seinen aus Scheiss-/Talgdrüsen ritualisiert worden. Innerhalb eines Konflikts stehen oft mehrere Möglichkeiten zur Auswahl (z.B. Flucht oder Angriff). Das Konfliktverhalten des Teichmolchs (Aufsteigen um Luft zu holen versus Weiterführen der Balz: gegenläufige Motivation) während der Balz ist geprägt durch schnelle Hin- und Herwechsel zwischen Annäherung an das Weibchen und wieder Entfernen. Bei einem Konflikt wird oft weder das eine (Vormarsch) noch das andere (Rückzug) ausgeführt; die Tiere zeigen ein Übersprungverhalten, das oft völlig sinnlos erscheint. Konfliktverhalten bei Silbermöwen (ruhendes Weibschen neben sich putzendem Männchen / (Territoriumsgrenze) grasrupfendes Männchen). Obschon ein Weibchen vorhanden ist, zeigen die beiden Männchen kein Kampfverhalten; nach dem Motto: Greifst du mich nicht an, greife auch ich dich nicht an. Die ersten Signale waren wahrscheinlich chemischer Natur = Pheromone, die sowohl im Pflanzen- wie auch im Tierreich vorkommen (→ Pheromone als Kommunikationssignale). • Chemische Kommunikation: Das Sozialverhalten von Ameisen (leben ausschliesslich in Gruppen/Kolonien) wird fast ausschliesslich über chemische Stoffe erreicht. Es lassen sich eine bis mehrere Königinnen finden, deren Brut durch Arbeiterinnen aufgezogen wird. Geschlechtreife Tiere wandern ab, bleiben im Stock oder zeigen andere Verhaltensweisen. Jede Ameise bildet eigentlich eine kleine Chemiefabrik, da sie mit Drüsen 13 • • vollgepackt ist. So lassen sich bei den Weberameisen (stammen aus Südamerika) Dufour’sche und Giftdrüsen als eigentliches Kommunikationssystem finden, beide sind exokrin. Die Ernteameisen, die in den Trockengebieten Südamerikas leben (Version Barbara) (die mit vier Familien vorkommen (Alte und Neue Welt) (Version Philipp)), ernähren sich von Samen, die sie in ein unterirdisches Speichersystem eintragen) und haben demzufolge ein grosses Schadenpotential, da sie auch von Kulturpflanzen Samen absammeln. Der Schaden ist so gross, da eine Kolonie zwischen 100'000 und 1'000'000 Individuen umfassen kann. Ökologisch von Interesse, dass beim Einsammeln oft einzelne Samen verloren gehen. Dieser Verlust hat eine grosse Bedeutung für die Abundanz (Häufigkeit) und die Verbreitung der Pflanzen. Die Nahrungssuche kann auf zwei unterschiedlichen Ausprägungen erfolgen. Erstens eine individuelle und zweitens eine Nahrungssuche in Gruppen (hier eher eigentliches Einsammeln). Die Kundschafterinnen der Ernteameisen (Pogonomyrmex) suchen Nahrungsquellen (optische Orientieren nach Landmarken, olifaktorsich nach Duftmarken und zusätzlich noch Kompassorientierung). Die Duftspuren der Ernteameisen wurden genauer untersucht. Auffällig ist, dass die Ameisen scheinbar ziellos durch die Gegend laufen aber trotzdem immer zum Nesteingang zurückfinden. Wenn sie einen einzelnen Samen gefunden haben, bringen die Kundschafterinnen diesen zum Nest zurück; wenn sie jedoch auf eine reichhaltigere Quelle gestossen sind, kehrt die Kundschafterin zwar auch zum Nest zurück drückt dabei aber auf dem Weg ihren Hinterleib auf den Boden und legt damit eine Duftspur, der die Arbeiterinnen folgen können. Die Nestgenossinen laufen entlang dieser durch die Kundschafterin gelegten Duftspur (=Rekrutierungsspur). Dabei tragen auch sie beim Zurücktragen eine chemische Spur (Pheromone) auf (Stammspur). Das hat zur Folge, dass je grösser die Futterquelle desto breiter die chemische Spur ist (Abb.5). Die Pheromone, die von den Arbeiterinnen abgegeben werden, stammen aus der Dufour’schen Drüse und sind Tage oder sogar Wochen aktiv. Die Kundschafterinnen legen ein anderes Pheromon aus; dieses stammt aus der Giftdrüse (drücken Stachel zu Boden), ist sehr kurzlebig (Stunden bis Tage) und ist nicht identisch mit demjenigen der Arbeiterinnen. Dieses Signal der Rekrtierungsspur muss durch die Stammspur, welche durch die Arbeiterinnen gelegt wird, verstärkt (überdeckt) werden. Die Arbeiterinnen sind sehr ortstreu und wählen immer dieselbe Spur (einige weichen von Spur ab, kehren aber immer wieder auf die Stammspur zurück). Die Kundschafterinnen dagegen erforschen die Gegend. Wenn die Samenquelle erschöpft ist werden die Arbeiterinnen an einem anderen Ort neu rekrutiert. Bemerkenswert ist, dass die einzelne Arbeiterin bevorzugt Samen einer Art sucht und sammelt; es gibt somit unterschiedliches Spezialisierungen bezüglich der Nahrungssuche innerhalb der gleichen Kolonie. Kolonie- und individuelle Nahrungssuche sind sehr effizient, da das Lernverfahren minimalisiert worden ist (nur eine Samenart muss einer einzelnen Ameise bekannt sein). Der ganze Regulationsmechanismus ist für sein Funktionieren auf eine artspezifische Mischung der Pheromone (sowohl Pheromone zur Markierung als auch zur Anlockung sind artspezifisch (gilt nicht nur für Ameisen)) angewiesen; jede Art besitzt somit eine Art Privatsphäre. Untersuchungen ergeben ein für alle (auch bei sympatrisch lebenden) Arten gleiches Rekrutierungshormon. Die Hormone aus der Dufour’schen Drüse dagegen sind nicht nur Art sondern auch koloniespezifisch. Dies hat zur Folge, dass verschiedene Kolonien das gleiche Gebiet zur gleichen Zeit erkunden können; dies ist ein Mechanismus zur Konfliktvermeidung, da sich die Kolonien nicht vermischen. Bei anderen Arten kann man sogar individualspezifische Pheromone nachweisen. Das Mischverhältnis macht dabei eine individuelle chemische Kommunikation möglich. Bei der elektrosensorischen Kommunikation, haben sich aus Muskelzellen mit einer ursprünglich anderen Funktion, modifizierte und ritualisierte Muskelzellen gebildet und ermöglichen so eine innerartliche Kommunikation. Objekte, die sich in der Nähe des Fisches befinden, können die Feldlinien seines elektrischen Dipolfeldes verändern, wenn sie eine andere Leitfähigkeit als das umgebende Wasser besitzen. Dabei zeigt eine erhöhte Rezeptoraktivität ein Objekt mit einer höheren Leitfähigkeit, eine verringerte Rezeptoraktivität eine geringere Leitfähigkeit als das umgebende Wasser an (Abb.6). Das Tier kann ein solches System zur Orientierung einsetzen. Mechanische Kommunikation: Es lässt sich eine Vibrationskommunikation (über ein Substrat) und eine akustische Kommunikation (über die Luft) beobachten. Bei der Vibrationskommunikation erzeugen Arthropoden einen Substratschall (trommeln auf Untergrund), das die Artgenossen über die Extremitäten wahrnehmen. Die Wasserläufer nehmen Wasserwellen war. Ihre Beine sind behaart und befettet; die Beinspitzen sind somit nicht benetzbar, dabei dienen die Vorderbeine dem Beutefang. Die Männchen des einheimischen Wasserläufers (Gerris reminis) produzieren Signale von 90Hz um Weibchen anzulocken. Bei einem Experiment wurde nun einem Weibchen ein Magnet ans Hinterbein geheftet, der künstlich zur Vibration gebracht werden konnte. In der Folge wurde das Weibchen von den Männchen attackiert, da sie das Weibchen über die 90Hz Frequenz für ein konkurrierendes Männchen hielten. Wenn der Magnet erst bei der Paarung zum Schwingen gebracht wurde, liess das Männchen das Weibchen sofort los (→ homosexueller Fehler). Die Schallkommunikation läuft über ein schwingendes Medium. Dabei erkennen die Ohren die mechanische Vibration. Bei der Kommunikation über Schall sind vor allem die Frequenz, die Länge usw. von Bedeutung (vgl. Gesang von Vögeln, Grillen, Walen usw.). 14 Die Kehrseite der Kommunikation bildet deren Ausnutzung und Verwendung durch Feinde (Parasiten, Fressfeinde). Die Kommunikation kann auch durch diese Kehrseite verstanden werden. • Dies kann am Beispiel des Tungara-Frosches (Physalaemus pustulorus)aus Panama gezeigt werden. Die männlichen Lockrufe bestehen aus Wimmer- und Glucklauten. Die Weibchen hören dabei mehrere Männchen an, bevor sie sich entscheiden und ihre Eier in das vom Männchen gebaute Schaumnester abgeben. Es wurde nun gezeigt, dass die Wimmerlaute der Arterkennung dienen. Die Glucklaute sind aber nötig bei der Wahl der Weibchen für einen Partner (grosse Tiere erzeugen einen tiefen (niederfrequenten) Glucklaut und wirken aus diesem Grund sexuell attraktiv). Einige Männchen geben aber trotzdem nur einen Wimmerlaut von sich. Es stellt sich die Frage nach dem Warum. Der Grund liegt im Feindruck. Fransenlippenfledermäuse jagen Tungara-Frösche indem sie die Tiere anhand ihrer Rufe lokalisieren. Wimmerlaute (schmalbandig) werden aber durch die Fledermaus weniger gut erkannt (weniger gute Lokalisation) als die Glucklaute (breitbandig → gute Lokalisation). Damit sind Tiere die Glucklaute von sich geben einer höheren Fressgefahr ausgesetzt als wimmernde Frösche. Die Frösche umgehen dieses Problem, indem sie nur in der Gruppe Glucklaute produzieren, da in einer Gruppe die Wahrscheinlichkeit geringer ist, gefressen zu werden. Wenn sich die Tiere aber alleine aufhalten geben sie nur Wimmerlaute von sich; das Resultat ist eine grössere Überlebenschance, dafür sind die Tiere sexuell weniger attraktiv. Das Gruppenleben Warum leben Organismen in Gruppen mit mehr als zwei Individuen? Weshalb kommt es zu kooperativem Verhalten? Sozietäten sind kooperative Gruppen für die eine Kommunikation essentiell ist. Was bildet aber den Anpassungsvorteil einer Gruppe? Vorteile des Gruppenlebens 1. Schutz vor Feinden - Früheres Erkennen (die Feindabwehr wird verbessert). Der Fressfeind wird früher erkannt (viele Augen sehen mehr, viele Nasen riechen mehr usw.) und durch die Kommunikation kann, dieses Erkennen Kund getan werden. Ein anderes Individuum kann auf dieses Signal adäquat reagieren. Das einzelne Individuum muss nicht stets gleich aufmerksam sein. Bei Angriffen von Habichten auf eine Gruppe von Ringeltauben haben Untersuchungen ergeben, dass die Gruppengrösse einen Einfluss auf die Zahl der erfolgreichen Angriffe hatte. Je grösser die Gruppe, desto geringer waren die Chancen des Räubers. Der Habicht wird dabei von einer grösseren Gruppe früher erkannt; des weiteren signalisiert ein grosser Schwarm einem Angreifer eine niedrige Erfolgswahrscheinlichkeit. - Verwirrungseffekt, der durch eine grosse Anzahl an Individuen auf einem kleinen Raum dazu führt, dass sich der Angreifer schlecht auf ein einziges Tier konzentrieren kann. - Verdünnungseffekt. Ein Räuber fängt immer nur wenige Opfer. Ein einzelnes Gruppenmitglied ist vor Feinden in der Gruppe besser geschützt, als wenn es alleine lebt. Der Einfluss der Gruppengrösse beim Dreistacheligen Stichling auf parasitische Karpfenläuse wurde untersucht. Dabei wurden in verschiedenen Aquarien unterschiedlich grosse Populationen von Stichlingen gehalten. Zugegeben wurde eine definierte Anzahl an Läusen. Es zeigt sich, dass die Angriffsrate der Läuse mit der Gruppengrösse zunimmt. Dabei ist der Angriffserfolg nicht von der Gruppengrösse abhängig. Die Infektionsgefahr für die einzelnen Stichlinge nimmt jedoch mit der Gruppengrösse rapide ab. Für den Parasiten steigt mit zunehmender Gruppengrösse das Risiko durch einen Stichling gefressen (Gegenangriffe der Stichlinge gegen Karpfenläuse) zu werden (die Läuse bewegen sich am Boden bis sie die Stichlinge parasitieren). Die Forscher stellten nun die Frage, ob die Gruppenbildung vom Lausbefall abhängt. In zwei Aquarien wurde eine gleiche Anzahl Stichlinge gegeben; im einen Aquarium mit Läusen im anderen ohne. Dabei wurde beobachtet, dass die Tendenz zur Gruppenbildung im Aquarium mit Läusen deutlich grösser ist. Der Nutzen für das Individuum ergibt sich dabei rein passiv (→ Verdünnungseffekt). - Eigennützige Herde. Durch die Gruppenbildung wird zwar die Gesamtbeuterate nicht geringer, sondern bleibt plus minus gleich; aber das Einzelindividuum kann die Wahrscheinlichkeit selbst Opfer zu werden durch geschicktes Verhalten verringern. In eigennützigen Herden geht man davon aus, dass zwar eine grössere Gruppe auffälliger ist, dass aber die Wahrscheinlichkeit, dass gerade ein bestimmtes einzelnes Individuum gefressen wird, vermindert wird. Die Artgenossen können dabei praktisch als Schutzschild dienen. Dies führt zum Schluss, dass kooperative Gruppen eigentlich nur aus ‚eigennützigen’ Individuen entstehen. Die Idee dabei ist, immer andere zwischen sich und der Gefahr zu haben. Dabei sollte eine Tendenz erkennbar sein, immer ins Zentrum zu streben, wobei die Distanz zu den anderen Individuen gehalten wird (kooperatives Weide- und Wanderverhalten durch Wahren eines gewissen, stets gleichbleibenden Abstands zu anderen Herdenmitgliedern = Dauerschutzeinrichtung gegen Fressfeinde), und das 15 obwohl im Zentrum der Nahrungsdruck grösser ist als an der Peripherie. Beobachtungen haben gezeigt, dass Tiere, die sich in der Herdenmitte befinden, ruhiger sind, als solche in den Randzonen, da ein Feind kaum oder überhaupt nicht in der Herdenmitte anzutreffen ist. Das eigennützige Verhalten zeigt sich vor allem bezüglich der Reproduktion. Das Verhalten eines Individuums in einer eigennützigen Herde ist geprägt durch die Abhängigkeit vom gesamten Gruppenverhalten; es herrscht eine Art Dominoeffekt (wird jemand als Schutzschild ‚missbraucht’, sucht sich dieser auch ein Schutzschild usw.) → Mitglieder müssen dadurch nicht sicherer sein als wenn sie allein leben würden. 17.5.02 - Überschwemmungseffekt (durch gleichzeitiges Schlüpfe der Jungtiere werden die Räuber gewissermassen mit einem Nahrungsangebot überflutet, so dass trotzdem einige Jungtiere überleben. Aktive Feinabwehr (dieses Räubervermeideverhalten ist für Huftiere gut dokumentiert; sie stellen sich dabei im Kreis auf und schützen ihre Jungtiere im Innern des Kreises) 2. Verbesserte Nahrungsversorgung - Informationsübertragung (dieses System ist vor allem bei Arten, die auf ein Nahrungsangebot angewiesen sind, das über grosse räumliche Distanzen verteilt ist, an gewissen Stellen aber in sehr grossen Mengen auftritt (Früchte tragende Bäume, Insekten- und Fischschwärme usw.) häufig zu finden. Es stellt sich nun die Frage, ob innerhalb der Gruppe ein Informationsaustausch bezüglich der Nahrungsquellen stattfindet. De Groot hat mit Untersuchungen an Webervögeln (Quelea quelea) gezeigt, dass nicht nur ein Informationsaustausch bezüglich Vorhandensein einer Nahrungsquelle stattfindet, sondern dass auch die Güte und Ergiebigkeit einer Quelle mitgeteilt werden kann. Webervögel finden sich nicht nur zum Nisten zusammen an einem Ort ein, sondern auch während der Nacht (Schlafbäume). Für die Experimente teilte er eine vier kleinere Abteile, die nur über eine enge Röhre zu erreichen waren, von einem grösseren Raum ab (Abb.7) ab. Er teilte für seine Untersuchungen eine Gruppe Webervögel in zwei kleinere Gruppen auf und dressierte Gruppe A darauf, dass sich im dritten Abteil Wasser befindet, danach entfernte er die Vögel aus der Voliere und dressierte Gruppe B darauf, dass im ersten Abteil Nahrung zu finden ist. Am Abend brachte er nun beide Gruppen in die Voliere und beobachtete ihr Verhalten am nächsten Morgen. Wenn er die Tiere vorher einige Tage hungern liess, flogen die Individuen der Gruppe A zielstrebig denjenigen der Gruppe B zur Futterquelle nach. Wenn er ihnen eine gewisse Zeit das Wasser vorenthielt, konnte ein umgekehrtes Verhalten beobachtet werden. In einem zweiten Versuch dressierte er die Individuen der Gruppe A auf eine sehr gute und diejenigen der Gruppe B auf eine nicht so ergiebige (Futterkörner im Sand versteckt, dadurch mühsam für Vögel) Nahrungsquelle. Nach einigen Tagen Hunger liess er sie wieder in die Voliere und die Vögel der Gruppe B flogen denjenigen der Gruppe A gezielt nach. Es hat also auch ein Informationsaustausch bezüglich der Güte der Nahrungsquelle stattgefunden, wie dieser aber genau abläuft ist bis heute noch nicht bekannt. - Kooperatives Jagen. Wenn Möwen einen Fischschwarm angreifen, bricht dieser auseinander; die Tiere machen vom Verwirrungseffekt gebrauch. Götmark hat nun Lachmöwen in einer grossen Voliere gehalten, wo sie auch Zugang zu einem Bassin erhielten, in dem Fische gehalten wurden. Er konnte nun die Gruppengrösse variieren und dadurch die Abhängigkeit des Jagderfolges von der Gruppengrösse während einer 30min Periode dokumentieren (Abb.8). Es zeigte sich, dass mit zunehmender Gruppengrösse der Jagderfolg des einzelnen Individuums steigt. Dies lässt sich durch die Tatsache erklären, dass ein einzelnes Tier einen Fisch, der auf der Flucht ist, am Schwanz packen muss. Es ist nun aber viel schwieriger einen Fisch am Schwanz zu packen und festzuhalten als am Kopf. Bei einer grösseren Gruppe treiben sich die einzelnen Tiere ihre Beute praktisch gegenseitig zu, wodurch sie die Fische am Kopf packen und somit ihre Jagd erfolgreicher gestalten können. 3. Kooperative Unweltgestaltung - Die Tiere müssen sich in einer wandelnden Umwelt ständig neuen Gegebenheiten anpassen. Jeder Schritt, der es ermöglicht die Auswirkung einer schwankenden Bedingung zu reduzieren, ist für den Organismus förderlich. Wenn ein Organismus es schafft sich den Schwankungen im weitesten Sinn zu entziehen wird eine Feinregulation beispielsweise seiner Biochemie erst möglich. Dies lässt sich am Beispiel der Homoethermie sehr gut zeigen. Der Stoffwechsel gleichwarmer Tiere ist nicht auf die Aussentemperaturen angewiesen, was zwar einerseits mit einem Energieaufwand verbunden ist, um die Körpertemperatur zu halten, auf der anderen Seite aber eine Feinregulation des Stoffwechsels erlaubt (Biochemie kann optimiert werden). Ein Weg sich wechselnden Umweltbedingungen zu entziehen, ist das eigene Verhalten und die eigene Physiologie auf die wechselnden Bedingungen auszurichten. So rücken Jungvögel und Jungtiere im Winterschlaf näher zusammen um das Oberflächen-Volumenverhältnis in einem günstigen Mass zu verschieben. Diese Anpassung geht sogar so weit, dass Jungtiere, die überwintern ohne Gruppe nicht über- 16 leben können. Eine aktive Gestaltung der Umwelt stellen zum Beispiel die Schlösser der Termiten dar. In ihnen findet man eine konstante Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit und ein konstanter CO2-Gehalt. Diese Bedingungen sind aber nicht nur für die Termiten optimal, sondern auch für die Pilze, die von den höheren Termiten als Nahrungsquelle in ihren Bauten angebaut werden. 4. Kooperative Jungenaufzucht. - Bei der kooperativen Jungenaufzucht, wie sie bei Mäusen bei bestimmten Bedingungen beobachtet werden kann (Gemeinschaftsnester), wird die Überlebenswahrscheinlichkeit der Jungtiere zum Teil erheblich verbessert. Fitnessnachteile des Gruppenlebens • Grössere Konkurrenz innerhalb der Gruppe um Nahrung, Paarungspartner, Brutplätze oder andere limitierende Ressourcen. • Grösseres Infektionsrisiko durch ansteckende Krankheiten oder Parasiten. • Grössere Auffälligkeit gegenüber Fressfeinden. • Grösseres Risiko, dass eigener Nachwuchs durch Artgenossen getötet wird. Bei all diesen Punkten ist jedoch zu beachten, dass viele Arten in Gruppen leben. Ein solches Verhalten kann nur dadurch erklärt werden, dass die Vorteile eines Gruppenlebens die Nachteile an Bedeutung übertreffen. Altruismus Es gibt Verhaltensweisen, die auf den ersten Blick für uns unlogisch erscheinen. Es gibt Tierarten, bei denen einige Individuen über eine gewisse Zeit oder für immer keine Nachkommen haben und anderen Individuen bei der Aufzucht ihrer Jungen helfen. William Hamilton hat in diesem Zusammenhang den Begriff des ‚Altruismus’ eingeführt: ‚Verhalten, welches für den Träger oder Ausüber dieser Eigenschaft mit Fitness-Kosten verbunden ist und den Empfänger der Eigenschaft Fitness-Vorteile vermittelt.’ Wie ist ein solches Verhalten zu erklären? Bereits Darwin hat dieses Problem im Zusammenhang mit sozial lebenden Insekten erkannt. Sogenannte HelferSozietäten treten vor allem bei Insekten auf (Ameisen, Termiten, Blattläuse, Wespen usw.) aber auch bei Säugern. Bei den Nacktmullen (Heterocephalus glaber) pflanzt sich in einer Gruppe von ungefähr 100 Individuen jeweils nur eine Königin fort; ein solches Verhalten ist auch bei den Graumullen zu beobachten. Aber auch bei Wölfen verzichten einige Tiere auf die Fortpflanzung, um das α-Paar bei der Aufzucht ihrer Jungen zu unterstützen. Auch bei Erdmännchen kann man ein ähnliches Verhalten beobachten. All diese Beispiele stellen ein Problem für das Dogma der Individualselektion dar. Hamilton hat in den 60er Jahren eine genetische Lösung des Problems vorgeschlagen. Ihm fiel auf, dass ein Individuum nicht nur seine Gene weitergeben kann indem es sich selbst fortpflanzt, sondern auch indem es Verwandten hilft bei der Aufzucht ihrer Jungen. Die genetische Verwandtschaft wird folgendermassen definiert: ‚Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewähltes Allel aus dem Erbgut eines Individuums bei einem anderen Individuum ebenfalls vorhanden ist, weil beide Individuen einen gemeinsamen Vorfahren haben.’ Die Berechnung einer solchen Verwandtschaft betrachtet die Wahrscheinlichkeit in der F1 ein bestimmtes väterliches und mütterliches Allel zu finden. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit auf Ebene der Nachkommen berechnet (Abb.9). Mit welcher Wahrscheinlichkeit findet man ein bestimmtes Allel auch in der Vollschwester? p (probability (Wahrscheinlichkeit), dass zwei Vollschwestern dieselbe Kopie von der Mutter erhalten haben) = 0.5*0.5 = 0.25 (das erste 0.5 beschreibt die Wahrscheinlichkeit ein Allel in der einen Schwester zu finden, das zweite 0.5 beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Allel auch in der Vollschwester zu finden ist). Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Vollschwestern dieselbe Kopie vom Vater erhalten haben ist somit ebenfalls 0.25 (in einem diploiden System). Wie gross ist nun die Gesamtwahrscheinlichkeit ein bestimmtes Allel in beiden Vollschwestern zu finden: p = 0.25+0.25 = 0.5 (Verwandtschaftskoeffizienten Häufigkeit z.T. mit r abgekürzt). Eine solche Berechnung zeigt, dass ein diploider Erbgang zwischen zwei Vollgeschwistern immer im Mittel einen Verwandtschaftsgrad von 0.5 liefert. Ebenfalls einen Verwandtschaftsgrad von 0.5 liefert eine sexuelle Fortpflanzung. Der Verwandtschaftsgrad zwischen Vollschwestern ist somit gleich gross wie derjenige zwischen den Eltern und den Kindern. Die Definition der genetischen Verwandtschaft kann somit erweitert werden: ‚Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewähltes Allel aus dem Erbgut eines Individuums bei einem anderen Individuum ebenfalls vorhanden ist, weil beide Individuen einen gemeinsamen Vorfahren haben, oder der zu erwartende Anteil am gesamten Genom eines Tieres, den es mit einem anderen Individuum aufgrund gemeinsamer Abstammung teilt.’ Berechnungen der Verwandtschaftskoeffizienten (r) liefern folgende Werte: r Elter – Kind 0.5 Vollgeschwister 0.5 Halbgeschwister 0.25 Grosselter – Enkel 0.25 Onkel/Tante – Nichte/Neffe 0.25 Cousin – Cousine 0.125 17 Da zwischen einem Elter und einem Kind der gleiche Verwandtschaftsgrad wie zwischen Vollgeschwistern auftritt, spielt es evolutiv keine Rolle, ob ein Tier direkte oder indirekte Nachkommen produziert. Es bringt dem Tier (bezüglich dem Auftreten seiner Allelen in der nächsten Generation) genau gleich viel, ob es selbst Junge produziert oder ob es seinen Eltern hilft weitere Vollgeschwister zu produzieren. Man kann häufig beobachten, dass bereits geschlechtsreife Jungtiere noch bei den Eltern bleiben und ihnen bei der Aufzucht der Jungen helfen. Bei einem solchen Verhalten muss der Empfänger der Hilfe aber mehr Nachkommen produzieren, als einer dem nicht geholfen wird, sonst würde sich der Altruismus als Verhaltensmutante nicht durchsetzten (wenn ein Tier seinem Verwandten hilft mehr Nachkommen zu produzieren, werden ja mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.5 auch die Allele des altruistischen Verhaltens an die nächste Generation weitergegeben). Die Allele werden somit indirekt weitergegeben, man spricht in diesem Zusammenhang auch von indirekten Fitness im Gegensatz zur direkten Fitness. Die abstammungsidentischen Allele werden an die nächste Generation weitergegeben. Aus der Addition der direkten und indirekten Fitness ergibt sich die Gesamtfitness. Diese Rechnung wird aber nicht populationsgenetisch durchgeführt sondern Stufe des Individuums betrachtet. Bei der indirekten Fitness werden dabei nicht alle Verwandten berücksichtigt, sondern man betrachtet nur den Beitrag, der effektiv geleistet wurde. Die Berechnung läuft somit nicht über die Produktion weiterer Nachkommen von Verwandten, zu dem das betrachtete Individuum nur zu Beginn einen Beitrag geleistet hat. Die direkte Selektion wirkt über die Variation im individuellen Fortpflanzungserfolg; die indirekte Selektion wirkt über die Variation in dem Einfluss, den ein Individuum auf den Fortpflanzungserfolg von Verwandten hat (Abb.10). All diese besprochenen Beispiele gehen davon aus, dass Altruismus nur unter Verwandten auftreten kann, da nur so abstammungsidentische Allele weitergegeben werden können. Altruismus wäre somit auf Sozialverbände, mit einem typischerweise erweiterten Brutpflege-/Vermehrungssystem, ausgerichtet. Es gibt aber auch uneigennütziges Verhalten welches sich nicht auf Verwandte bezieht (Mutualismus/Reziprokizität); dies wird aber hier nicht besprochen. Möhlmann hat bei seinen Untersuchungen am Schabrackenschakal (Canis mesomela) beobachtet, dass geschlechtsreife Junge oft als Helfer noch bei den Eltern bleiben und diese bei der Jungenaufzucht unterstützen (ein solches Verhalten ist vor allem bei den Hymenopteren bekannt). Die Resultate seiner Untersuchungen (Abb.11) zeigen, dass die Anzahl der überlebenden Jungen von der Anzahl der Helfer abhängt. Bei einem diplohaploiden Erbgang, wie er z.B. bei Bienen zu beobachten ist, zeigen die Resultate, dass die Individuen noch mehr Interesse daran haben sollten ihrer Mutter bei der Produktion weiterer Vollschwestern zu helfen (Abb.12). Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Vollschwestern dieselbe Kopie eines Alles von der Mutter bekommen haben, liegt bei p = 0.5*0.5 = 0.25. Dass die beiden Vollschwestern ein bestimmtes Allel vom Vater erhalten haben liegt bei p = 0.5*1 = 0.5. Dies ergibt eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 0.75. Dies bedeutet, dass zwei Vollschwestern näher miteinander verwandt sind als die Mutter mit einer Tochter. Dieses Resultat impliziert, dass eine immense Prädisposition vorliegen sollte, dass die Nachkommen der Mutter bei der Produktion weiterer Vollschwestern helfen, da sie auf diesem Wege einen grösseren Prozentsatz an Allelen in die nächste Generation einbringen können als bei einer direkten Fortpflanzung. Diese genetische Erklärung, die zu Beginn für grosses Aufsehen gesorgt hat, ist heute nicht mehr der Wahrheit letzter Schluss. Mit dem oben beschriebenen Modell lassen sich z.B. die Sozialverbände der Termiten mit einem diploiden Erbgang nicht erklären. Die Genetik allein kann nicht alle Beobachtungen erklären, es müssen auch ökologische Faktoren eine Rolle spielen. Auch hat sich gezeigt, dass die Verwandtschaft unter den Individuen eines Sozialverbandes gar nicht so hoch wie berechnet ist (75%). Entweder hat ein Volk mehrere Königinnen oder die eine Königin wurde von mehreren Männchen begattet.