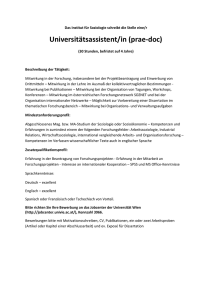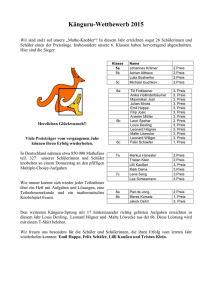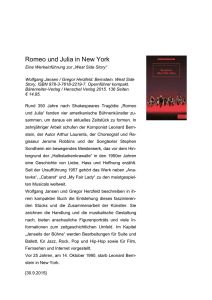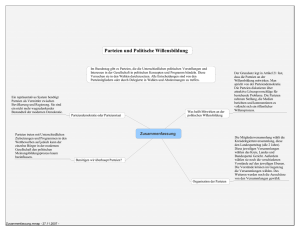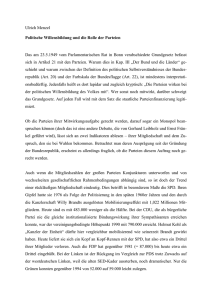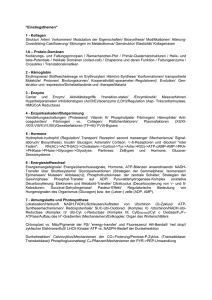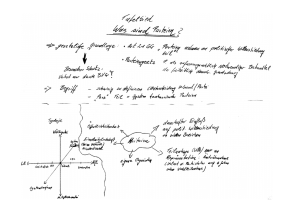Ressource, Risiko und ohne Alternative: warum die Politik nicht auf
Werbung
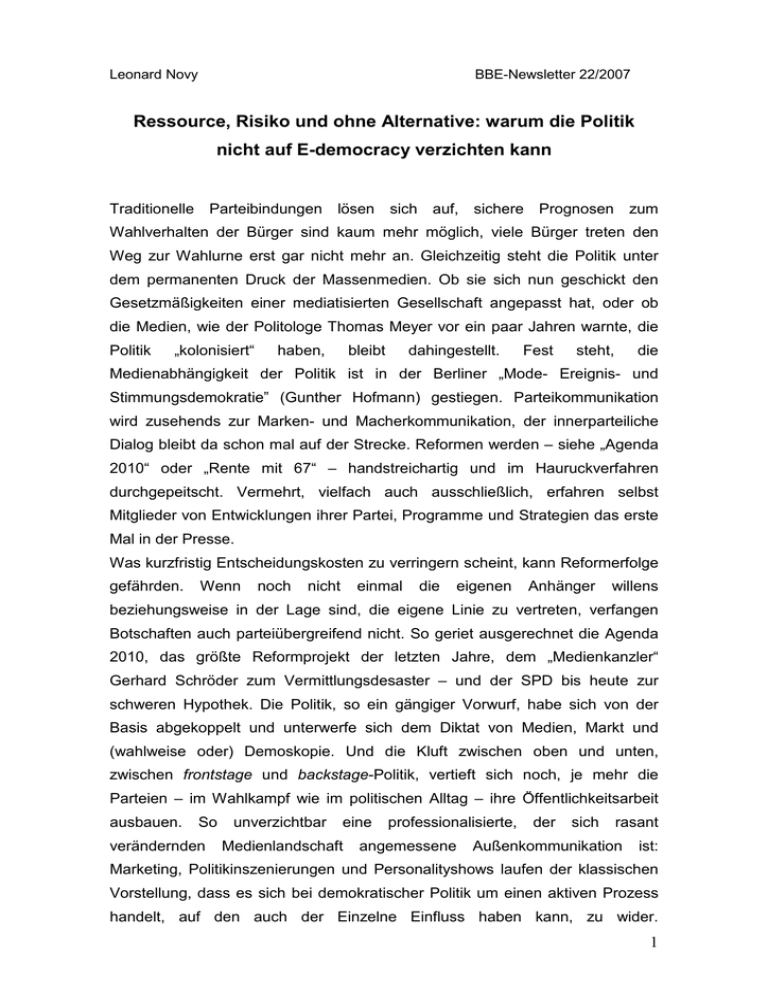
Leonard Novy BBE-Newsletter 22/2007 Ressource, Risiko und ohne Alternative: warum die Politik nicht auf E-democracy verzichten kann Traditionelle Parteibindungen lösen sich auf, sichere Prognosen zum Wahlverhalten der Bürger sind kaum mehr möglich, viele Bürger treten den Weg zur Wahlurne erst gar nicht mehr an. Gleichzeitig steht die Politik unter dem permanenten Druck der Massenmedien. Ob sie sich nun geschickt den Gesetzmäßigkeiten einer mediatisierten Gesellschaft angepasst hat, oder ob die Medien, wie der Politologe Thomas Meyer vor ein paar Jahren warnte, die Politik „kolonisiert“ haben, bleibt dahingestellt. Fest steht, die Medienabhängigkeit der Politik ist in der Berliner „Mode- Ereignis- und Stimmungsdemokratie” (Gunther Hofmann) gestiegen. Parteikommunikation wird zusehends zur Marken- und Macherkommunikation, der innerparteiliche Dialog bleibt da schon mal auf der Strecke. Reformen werden – siehe „Agenda 2010“ oder „Rente mit 67“ – handstreichartig und im Hauruckverfahren durchgepeitscht. Vermehrt, vielfach auch ausschließlich, erfahren selbst Mitglieder von Entwicklungen ihrer Partei, Programme und Strategien das erste Mal in der Presse. Was kurzfristig Entscheidungskosten zu verringern scheint, kann Reformerfolge gefährden. Wenn noch nicht einmal die eigenen Anhänger willens beziehungsweise in der Lage sind, die eigene Linie zu vertreten, verfangen Botschaften auch parteiübergreifend nicht. So geriet ausgerechnet die Agenda 2010, das größte Reformprojekt der letzten Jahre, dem „Medienkanzler“ Gerhard Schröder zum Vermittlungsdesaster – und der SPD bis heute zur schweren Hypothek. Die Politik, so ein gängiger Vorwurf, habe sich von der Basis abgekoppelt und unterwerfe sich dem Diktat von Medien, Markt und (wahlweise oder) Demoskopie. Und die Kluft zwischen oben und unten, zwischen frontstage und backstage-Politik, vertieft sich noch, je mehr die Parteien – im Wahlkampf wie im politischen Alltag – ihre Öffentlichkeitsarbeit ausbauen. So verändernden unverzichtbar eine Medienlandschaft professionalisierte, angemessene der sich rasant Außenkommunikation ist: Marketing, Politikinszenierungen und Personalityshows laufen der klassischen Vorstellung, dass es sich bei demokratischer Politik um einen aktiven Prozess handelt, auf den auch der Einzelne Einfluss haben kann, zu wider. 1 Frustrationen sind die Folge. Der Mitgliederschwund der großen Parteien spricht eine klare Sprache. Ein weiteres Indiz sind Umfragen, denen zufolge das Vertrauen in die demokratischen Institutionen und insbesondere die Parteien schwindet. Offensichtlich gelingt es kaum mehr, dem Bürger die Sinnhaftigkeit der oft mühsamen demokratischen Aushandlungsprozesse vor Augen zu führen und ihn von der Qualität der erzielten Lösungen zu überzeugen. Ein vielversprechendes Mittel, diesen Zustand zu überwinden, sehen Optimisten im Internet, dessen Potenzial für politische Kommunikation und Partizipation oft unter dem Begriff E-democracy subsumiert wird. Längst hat sich das Internet nicht nur bestehende Öffentlichkeiten erschlossen, es schafft neue Kommunikationsräume. Seine Interaktivität und Responsivität, also die Möglichkeit, in Echtzeit auf Informationen zugreifen und unmittelbar darauf reagieren zu können, haben den Mythos des egalitären Medientyps begründet und Hoffnungen geweckt, dass daraus neue Möglichkeiten politischer Mitwirkung entstehen können. In der Tat ermöglicht das Internet theoretisch ein Mehr an Selbstbestimmung, Flexibilität und Informationspluralismus: Traditionelle Hierarchien, Gatekeeper und Meinungsführer Onlineprojekte, wie können etwa umgangen die werden. Kontroll- und Sowohl innovative Transparenzinitiativen http://www.theyworkforyou.com/ oder www.abgeordnetenwatch.de, als auch Projekte in konkreter Anbindung an klassische Politikprozesse (virtuelle Parteitage, Programmforen, etc.) zeichnen sich durch Zeit- und Raumflexibilität aus, was die Einstiegsschwellen für Einsteiger senkt. Sie demokratisieren das Agenda-Setting und ersetzen die klassische Abwärtskommunikation durch horizontale Strukturen. So können themenabhängig Communities entstehen, in denen nicht nur der Austausch von Informationen und Meinungen stattfindet, sondern in denen jenseits von Ortsvereinen und Hinterzimmern Politik gemeinsam gestaltet und erfahren werden kann. Als erste Metropole experimentiert die Stadt Köln mit einem Online-Bürgerhaushalt, Parteien wie die SPD sind dabei, sich „web 2.0“-Technologien für ihr Mitgliedernetz zunutze zu machen. Als Kanal für flexibilisierte Beteiligungsformen kommt das Internet den veränderten Wertorientierungen einer Gesellschaft entgegen, die sich zunehmend außerhalb traditioneller politischer Strukturen organisiert und statt der Gemeinschaftserfahrung „Ortsverein“ flexible und themenorientierte 2 Gestaltungsmöglichkeiten sucht. Zugleich entstehen damit Gegengewichte „zur Wirklichkeit parteienstaatlicher Allzuständigkeit“ (Ulrich Sarcinelli). Spätestens hier wird deutlich, dass das Internet sowohl eine Ressource als auch ein Risiko für politische Organisationen darstellt. Beteiligung über das Internet kann nur funktionieren, wenn Regierung wie Parteien auf einen gewissen Teil der Kontrolle verzichten – kommunikativ wie substanziell – und wenn sie die Vermittlung von Politik tatsächlich um den Aspekt des Zuhörens erweitert. Doch während der Einsatz des Internets im Regierungsalltag im Ausland, etwa in den Niederlanden oder Großbritannien, längst eine Selbstverständlichkeit ist, hält sich die Begeisterung für wirklich innovative Onlineformate hierzulande noch in Grenzen. In Großbritannien machte sich der ehemalige Premier Tony Blair mit einem E-Petitionssystem ein etabliertes Onlineformat für die Regierungskommunikation zunutze und sammelte in den ersten acht Monaten des Bestehens über 4 Millionen Unterschriften unter mehreren tausend Petitionen. Das „Beta“-Zeichen auf der Projektseite signalisierte dem Nutzer, hier an einem Versuch teilzuhaben. Es verweist aber auch auf eine Experimentierfreudigkeit, die in Deutschland wohl unvorstellbar wäre. Eine breite politische Beteiligungskultur lässt sich nicht allein durch technische Innovation herbeiführen. Wichtig ist, dass das online-Handeln in der offline-Welt nicht ohne Folgen bleibt; dass die Folgen politischen Handelns als eine Art Return on Investment wahrnehmbar sind, so dass es sich erkennbar lohnt, sich in politische Prozesse zu involvieren. Die zentrale Frage ist jedoch, ob und unter welchen Umständen es das Internet vermag, die Desinteressierten an das politische Geschehen heranzuführen und zu mobilisieren? Bestärkt es nicht vielmehr lediglich den Aktivismus der ohnehin bereits politisch Interessierten, die das Netz ergänzend zu konventionellen Kanälen politischen Engagements nutzen? Die Prognosen der CyberOptimisten, denen zufolge das Internet quasiautomatisch ein Revival der athenischen Agora bewirke, sind in jedem Fall zu hoch gegriffen. Es käme einer Illusion gleich, zu glauben, der Schritt zur interaktiven Beteiligungsdemokratie sei bereits vollzogen, nur weil die Technik das technische Potenzial dafür bereitstellt. Längst ist die „digitale Spaltung“, also die ungleiche Verteilung des Zugangs zu digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien, nicht überwunden. Dazu kommt: Zugang alleine schafft weder Orientierung noch führt er einem Automatismus gleich zur fundierten Meinungsbildung, die Mitwirkung vorangehen könnte. Medienkompetenz und Wissensmanagement 3 werden daher weiter an Bedeutung gewinnen – als zentrale Herausforderung für die politische Bildung. Und so kann, wer von E-democracy redet, von der offline-Politik, von der Notwendigkeit etwa, politisch Aktiven auch ohne lange Parteikarrieren mehr Mitsprache und politisches Gewicht zu verleihen, nicht schweigen. Erwägenswert im Sinne direktdemokratischer Konzepte wäre es auch, mehr Entscheidungsprozessen auf die Mikroebene zivilgesellschaftlicher Willensbildung zu verlagern. Dies würde allerdings die Bereitschaft der Politik zu einem Machttransfer von oben nach unten voraussetzen, was - unabhängig von der Frage der Realisierbarkeit - eine Umsetzung nicht wahrscheinlich erscheinen lässt. Die Parteien werden indes nicht umhinkommen, neue Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen, die einen Dialog zwischen Spitze und Basis eröffnen. Sie sollten dabei kreativer vorgehen als in den 90er Jahren. Schon damals war es en vogue, direkt-demokratische Elemente in die parteiinterne Willensbildung einzuführen, zu versuchen, Parteistrukturen zu öffnen. Doch gelang es nicht, die Organisationskulturen der Parteien nachhaltig zu verändern und jenen neuen Partizipationsbedürfnissen Rechnung getragen, die auf die (auch temporäre) Mitwirkung an konkreten politischen Projekten ausgerichtet sind. Oft wurde in Mitgliederparteien der Vergangenheit beschworen. Stets der Niedergang haben sie der auf klassischen gesellschaftliche Veränderungen reagiert. Unabhängig davon, ob sie sich zu „Profiparteien“, „Berufspolitikerparteien“ oder, wie es der Politikwissenschaftler Uwe Jun formulierte, „professionalisierten Medienkommunikationsparteien“ entwickeln: Für Parteien wie auch für jede Regierung gilt: wollen sie ihre gesellschaftliche Verankerung sichern und ihre Gestaltungskraft bewahren, müssen sie schon während der Themenfindung und Politikformulierung (und nicht lediglich als Teil der nachträglichen PR) eine ernsthafte und systematische Dialogkommunikation mit der Öffentlichkeit betreiben. Auch, aber nicht nur über das Internet. Leonard Novy ist Projektmanager bei der Bertelsmann-Stiftung. Kontakt [email protected] 4