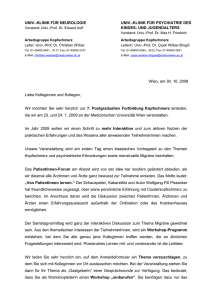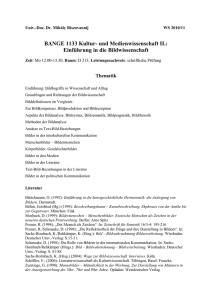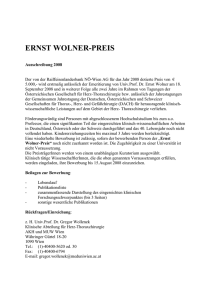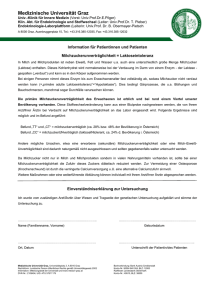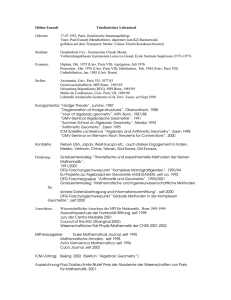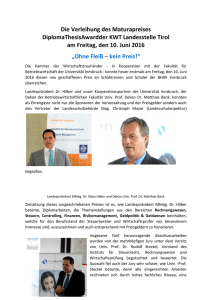Kosten
Werbung

Vorlesung Kostenrechnung Universität Salzburg ao. Univ. Prof. Mag. Dr. Werner Mussnig Inhaltsübersicht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Konzeptionelle Grundlagen Aufbau und Ablauf der Kostenrechnung Kostenartenrechnung Kostenstellenrechnung Kostenträgerrechnung Kostenauflösung Kostenrechnungssysteme Periodenerfolgsrechnung (inkl. FDR) Break Even Analyse Preisuntergrenzen 11. Optimales Produktionsprogramm ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Seite 3 20 24 49 66 80 96 121 131 160 171 2 Kapitel 1 n e g a l nd u r G e l l e ng n u o i n t h p e ec z r n n o e t K os K r e d ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 3 Betriebliche Steuerungs- und Zielsysteme Zielebenen Erfolg Finanzierungskreislauf Erfolgspotenziale Liquidität ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 4 Das Zielsystem von Unternehmen Innenf inanzierungs- Insolv enz e. Kürzung des Kreditziels Abweisung v on kraft (CashFlow) Hauptkunden eines Hauptlief eranten Kreditanträgen Plötzliche Mittelv erwendung Priv atentnahmen Inv estitionen Kreditrück zahlung en Erhöhung der starkes LagerDebitorenbestände wachstum Gewinn/Verlust Umsatz Absatzmengen Kostensteigerung Absatzpreise Materialauf wand Personalauf wand Finanzier ungs Energie u. u. Kapitalaufwand sonst. Auf wand Erfolg Interne Erf olgspotemtiale : Rationalisierungspotentiale, Größenv orteile, Auslastungsv orteile, Produktiv itätsv orteile Wettbewerbsv orteil Marktsituation Externe Erf olgspotentiale - Technologie - Qualität - Kosten- u. Preisv orteile - Distribution - Image -etc. Konjunktur Marktwachstum u. -sättigung Staatliche Eingriff e und sonstige Umwelteinf lüsse ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Verbraucherv erhalten Erfolgspotentiale Konkurren zstärke und - intensität Handlungsspielraum Transparenz der Informationslage Lauf ende Mittelv erwendung Liquidität Liquidität 5 Informationssysteme und Unternehmensziele Strategische Analysen Ermittlung v. Chancen u. Bedrohungen Bereitstellen strat. Kosteninformationen Erstellen der Periodenerfolgsrechnung Erfolg Kosten- und Leistungsrechnung Durchführung von Kalkulationen Erwirtschaften des optimalen Gewinns Durchführung der Ergebnisrechnung Ermittlung des Cash Flow Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung Liquidität Planung der zukünftigen Finanzlage Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit Ermittlung des Liquiditätsstatus ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Liquiditätsbzw. Finanzrechnung R echnungsw esen Aufbau und Pflege von Erfolgspotenzialen Ermittlung v. Stärken u. Schwächen Betriebliches Erfolgspotenziale 6 Stellung des betrieblichen Rechnungswesens im Zielsystem Unternehmensführung Aufgaben Aufgabenträger betriebliches Rechnungswesen Kostenrechnung Anhang Jahresabschluß GuV internes Rechnungswesen Bilanz externes Rechnungswesen Finanz- und Geschäftsbuchhaltung Leistungsrechnung Erlösrechnung Ergebnisrechnung ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig sonstige interne Statistiken und Rechnungen 7 Aufgabenschwerpunkte und Informationsempfänger des betrieblichen Rechnungswesens BETRIEBLICHES RECHNUNGSWESEN externes Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung) internes Rechnungswesen (Betriebsbuchhaltung) Aufgabenschwerpunkt Aufgabenschwerpunkt Abbildung der finanziellen Beziehungen des Betriebes zu seiner Umwelt Rechenschaftslegung Jahresabschluß Abbildung des wirtschaftlich bedeutsamen Geschehens im Betrieb Planung, Steuerung und Kontrolle des Betriebsgeschehens Eigentümer Gläubiger Belegschaft Lieferanten Kunden Fiskus ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Behörden Öffent- Unternehmenslichkeit leitung 8 Systematisierung nach dem Zeitbezug Zeitbezug des Rechnungswesens Arten des RW Externes Rechnugnswesen Vergangenheit Rechnungslegung z.B.: Steuererklärung Jahresabschluss (Bilanz und GuV) internes Rechnugnswesen Abweichungsrechnung z.B.: Nachkalkulation Soll/Ist-Vergleich Betriebsstatistik Zukunft Kreditanträge Adressaten des RW unternehmensexterne Adressaten z.B.: Business Plan Kredittilgungsplan Plan rechnung unternehmensinterne Adressaten z.B.: Leistungs- u.Finanzbudget Investitionsrechnung Plankostenrechnung ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 9 Zielsetzung der Kostenrechnung Primäres Ziel: Möglichst realitätsnahe Abbildung der betrieblichen Strukturen und Prozesse Sekundäres Ziel: Wirtschaftlichkeitskontrolle (z.B.: der Kostenstellen) Kalkulation (Kostenträger) Unterstützung dispositiver Entscheidungen (Leistungsprogramm, Outsourcing, Rationalisierungsentscheidungen, etc. ) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 10 Alternative oder simultane Zielsetzungen Kalkulation und Preisfestlegung von Leistungen Ermittlung der Selbstkosten Ermittlung von Preisuntergrenzen Ermittlung von Verrechnungspreisen Wirtschaftlichkeitskontrolle Kontrolle der Kostenartenentwicklung Kontrolle der Kostenstellen Ermittlung von Soll-Ist-Abweichungen Unterstützung von Managemententscheidungen Leistungsprogrammentscheidungen Verfahrensentscheidungen Outsourcingentscheidungen (make or buy) sonstige Aufgaben Bestandsbewertung i. R. d. Bilanzierung Bemessung von Versicherungswerten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 11 Kostenbeeinflussung und Kostenverhalten Erst die Existenz von Kosten ermöglicht die Bereitstellung von Leistung Das Leistungsniveau definiert daher wesentlich das Niveau der Kosten! Kosten sind keine homogene Masse. Wir unterscheiden zwischen dem Kostenniveau, der Kostenstruktur und dem Kostenverlauf. Kosten können nur kurzfristig beliebig gesenkt werden. Entweder wird dadurch das Leistungsvermögen des Systems zerstört oder die Kosten manifestieren sich in anderer Art und Weise wieder im System. § JoJo-Effekt (die selben Kosten tauchen zeitversetzt wieder auf) § Kostenumwandlung (andere Kosten erhöhen sich an Stelle der „Wegrationalisierten“ (z.B. Leasing statt Abschreibung, Fremdleistungen statt Personalkosten) § Kostenumlastung (die selben oder andere Kosten tauchen an anderer Stelle (Kostenstelle) wieder auf). • Kostenremanenzen (Kosten lassen sich kurzfristig nicht oder nur sehr ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 12 eingeschränkt beeinflussen) Das Phänomen: Kosten Erst die Existenz von Kosten ermöglicht die Bereitstellung von Leistung Das Leistungsniveau definiert daher wesentlich das Niveau der Kosten! Kosten sind keine homogene Masse. Wir unterscheiden zwischen dem Kostenniveau, der Kostenstruktur und dem Kostenverlauf. Kostenniveau var Kostenverlauf Kostenstruktur fix t0 ao. Univ. t1 Prof. tDr. t3 Mussnigt4 2 Werner t5 13 Überlegungen zur Kostenrechnung Ein Kostenrechnungssystem ist keine Garantie, dass ein Unternehmen nicht in eine Krise schlittern kann! Einem Unternehmen, dass sich in einer ungünstigen strategischen Position befindet, kann seine Ertragssituation mit einer Kostenrechnung nicht nachhaltig verbessern. Was im Potential nicht enthalten ist, kann man nicht realisieren – auch dann nicht, wenn der Unternehmer / die Unternehmerin die Woche 80 Stunden arbeitet! Unternehmen, mit einem adäquaten Kostenrechnungssystem haben jedoch die Chance aus ihrer strategischen Situation höhere Erträge herauszuholen! z.B.: durch: effektive Preispositionierung optimales (gestrafftes) Produktsortiment effiziente Kostenkontrolle effektive Ansatzpunkte für Rationalisierungsprogramme Unternehmen mit Finanzierungsschwierigkeiten (insb. Liquiditätsschwierigkeiten) benötigen nicht unmittelbar ein Kostenrechnungssystem. Zunächst gilt es, die Liquiao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 14 ditätssiutation zu stabilisieren! Häufige Fehler im Rahmen der Zielbildung Ziele werden explizit nicht definiert (unklare Erwartungshaltung, Anspruchsinflation an das System) Die Kostenrechnung wird als Preisermittlungsverfahren verstanden (Kalkulation von Gewinnanteilen in einzelnen Kostenpositionen, von Durchschnittlichen Branchenwerten etc.) Die Kostenrechnung wird „standardisiert“ eingeführt (betriebliche Zielsetzung fließen nicht in das System ein, die konkrete Problemstellung wird nicht erkannt) Orientierung der Zielsetzungen an den edv-technischen Möglichkeiten (vorhandene Software wird als Maßstab für die Entwicklung des Kostenrechnungssystems herangezogen) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 15 Grundbegriffe des betrieblichen Rechnungswesens Abgang liquider Mittel Forderungsabgang Schuldenzugang erfolgswirksame Ausgabe Zugang liquider Mittel Auszahlung Ausgabe Aufwand Kosten Einzahlung Einnahme Ertrag Leistung bewerteter betriebsbedingter Güterverbrauch Forderungszugang Schuldenabgang erfolgswirksame Einnahmen bewertete betriebsbedingte Güterentstehung ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 16 Definition von Auszahlung, Ausgaben u. Aufwand Sachvermögen Sachvermögen Eigenkapital Einnahmen Forderungen Ausgaben Einzahlungen Auszahlungen Forderungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Einnahmen Liquide Mittel Ausgaben Ertrag Sachvermögen Aufwand Ertrag Aufwand Eigenkapital Liquide Mittel Einnahmen Ausgaben Eigenkapital Forderungen Verbindlichkeiten Ertrag Aufwand Liquide Mittel ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Ertrag Aufwand 17 Der Kostenbegriff Wertmäßiger Kostenbegriff (Schmalenbach): Kosten sind der bewertete Verzehr von Produktionsfaktoren Dienstleistungen (einschließlich öffentlicher Abgaben), der zur Erstellung und zum Absatz betrieblicher Leistungen sowie zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft (Kapazitäten) erforderlich ist. 3 Wesensmerkmale des wertmäßigen Kostenbegriffs: 1. Es muss ein Güterverzehr vorliegen. 2. Der Güterverzehr muss leistungsbezogen sein. 3. Der Güterverzehr muss bewertet sein. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 18 Definition von Kosten und Leistungen (Erlösen) Güterausbringung Gütereinsatz Güterverbrauch Kosten Sachzielbezogenheit Bewertung Produktionsprozess Unternehmenszweck Güterentstehung Sachzielbezogenheit Abbildung ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Leistungen Bewertung 19 Abgrenzungsbeispiele (1) Auszahlung Ausgabe Auszahlung = Ausgabe Ausgabe Aufwand Ausgabe = Aufwand Kosten Auszahlung aber nicht Ausgabe 1 Ausgabe aber nicht Aufwand Auszahlung zugleich Ausgabe 4 Aufwand aber nicht Kosten Ausgabe zugleich Aufwand 7 Aufwand 2 Ausgabe aber nicht Auszahlung 5 Aufwand zugleich Kosten Kosten = Aufwand 3 Aufwand aber nicht Ausgabe 8 ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 6 Kosten aber nicht Aufwand 9 20 Abgrenzungsbeispiele (2) Nr. Begriff 1 Auszahlung, aber keine Ausgabe 2 Auszahlung zugleich Ausgabe 3 Ausgabe aber nicht Auszahlung 4 Ausgabe aber nicht Aufwand 5 Ausgabe zugleich Aufwand Beispiel und Erklärung Die Tilgung eines entfälligen Kredites ist eine Auszahlung, während die Ausgabe mit dem Eingehen der Schuld (Kreditvertrag) bereits zuvor passiert ist. Der Barkauf einer Maschine ist eine Auszahlung und zugleich eine Ausgabe, da zum selben Zeitpunkt der Kaufvertrag unterschrieben wird. Der Zieleinkauf von Rohstoffen, stellt zunächst nur eine Ausgabe dar. Mit der Bestellung und Entgegennahme der Ware, geht man eine Willenserklärung ein. Die Bezahlung erfolgt später. Der Kauf von Rohstoffen, die erst in einer späteren Periode verbraucht werden, stellt durch die Willenserklärung eine Ausgabe dar. Die Ware wird aber erst durch das Eingehen in den Produktionsprozess zum Aufwand. Vorerst erhöht die Waren des Bestand und nicht den Einsatz. Werden hingegen Rohstoffe eingekauft, die sofort (in der selben Periode) dem Produktionsprozess zugeführt werden, so stellt dieser Vorgang sowohl eine Ausgabe als auch einen Aufwand dar. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 21 Abgrenzungsbeispiele (3) Nr. Begriff 6 Aufwand aber nicht Ausgabe 7 Aufwand aber nicht Kosten 8 Aufwand zugleich Kosten 9 Kosten aber nicht Aufwand Beispiel und Erklärung Die Abschreibung einer in einer Vorperiode (Vorjahr) angeschafften Maschine stellt einen Aufwand dar, die Ausgabe ist hingegen schon in den Jahren davor erfolgt. Die Spende für einen karikativen Zweck stellt (sofern absetzbar) einen Aufwand dar. Aufgrund des Fehlens der Sachzielbezugs (Notwendigkeit des Aufwandes für die betriebliche Leistungserstellung) stellt dieser Geschäftsprozess jedoch keine Kosten dar. Der betrieblich eingesetzte Energie stellt sowohl einen Aufwand als auch Kosten dar. Die Zinsen für das Eigenkapital können nicht von der Steuerbelastung in Abzug gebracht werden und stellen daher keinen Aufwand dar. Die Zinsen für das Eigenkapital stellen hingegen Kosten dar, da man das Eigenkapital auch anders einsetzen könnte und damit Renditen (Zinsen) erwirtschaften könnte. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 22 Abgrenzung zwischen Aufwand und Kosten Aufwand Neutraler Aufwand betriebsfremder Aufwand periodenaußerordentlicher fremder Aufwand Aufwand Zweckaufwand aufwandsgleiche Kosten Grundkosten betragsmäßig Korrigierte Kosten Anderskosten wertverschieden Zusatzkosten wesensverschieden Kalkulatorische Kosten Kosten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Quelle: Schmalenbach 23 Abgrenzung zw. den einzelnen Rechengrößen Auszahlung Ausgabe bereits in de vorhergehenden Periode erfolgt Ausgabengleiche Auszahlung Ausgabe erfolgsneutrale Ausgaben Aufwandsgleiche Ausgaben Aufwand Neutraler Aufwand Zweckaufwand betriebs - außerperiodenfremder ordentlicher fremder Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand, der zugleich betriebsbezogen, ordentlich und periodenrichtig ist Grundkosten Anderskosten wert verschieden Zusatzkosten wesens verschieden Kalkulatorische Kosten Kosten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 24 Abgrenzung zwischen Aufwand und Kosten Aufwand betriebsfremd betriebsbedingt periodenfremd außerordentlich Neutraler Aufwand ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig periodenrichtig normalisiert Kosten 25 Grundbegriffe des betrieblichen Rechnungswesens 1 z.B. Begleichung einer Lieferantenverbindlichkeit in bar 2 z.B. Bareinkauf von Rohstoffen 3 z.B. Zieleinkauf von Rohstoffen 4 z.B. Kauf und Einlieferung von Rohstoffen 5 z.B. Kauf von Rohstoffen, die noch in der gleichen Periode verbraucht werden 6 z.B. Lagerentnahme von Rohstoffen für die Fertigung I/II: Ebene der Investitions-, Finanz- und 7 Liquiditätsplanung III: Ebene der Finanzbuchhaltung (Bilanz und GuV) IV: Ebene der Kostenrechnung und kurzfristigen 8 Erfolgsrechnung z.B. Spenden für karitative Zwecke, Katastrophenschäden I. Auszahlung 1 II. 2 Ausgabe 4 III. 3 5 6 Aufwand 7 8 9 Kosten IV. 9 z.B. Akkordlöhne, Verbrauch von Verpackungsmaterial z.B. kalkulatorischer Unternehmerlohn ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 26 Merkmale der Kostenrechnung Zwingende Merkmale der Kostenrechnung unternehmensinterne Rechnung kalkulatorische (Bestandteile enthaltende) Rechnung Kostenrechnung ist stets eine kurz- bis mittelfristige Rechnung erfolgsbezogene Rechnung freiwillig aufgestellte Rechnung laufende Rechnung Fakultative Merkmale der Kostenrechnung Planrechnung oder Ist-Abrechnung stückbezogene und/oder periodenbezogene Rechnung Kostenrechnung kann sein eine auf Vollkosten und/oder Teilkosten basierende Rechnung auf Ermittlungs- und Dokumentationszwecke und/oder Entscheidungszwecke abstellende Rechnung Quelle: Hummel/Männel [Kostenrechnung 1 1980], S. 145 (modifiziert) buchhalterisch und/oder statistisch-tabellarisch durchgeführte Rechnung ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 27 Kapitel 2 uf a l b A d n u ng u u a n b f h ec Au r n e t os K r e d ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 28 Teilgebiete der Kostenrechnung Kostenartenrechnung Kostenartenrechnung Kostenstellenrechnung Kostenstellenrechnung Kostenträgerrechnung Kostenträgerrechnung ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 29 Grundstruktur der Kostenverrechnung Kostenartenrechnung Kostenstellenrechnung Kostenträgerrechnung Kostenträger AB Gemeinkosten Vertrieb Verwaltung Fertigung Material Kostenstellenbereiche Kostenstellen Kostenarten Kosten(arten) für die Betriebsabrechnung Abgrenzung zwischen Aufwand und Kosten Aufwand in der Finanzbuchhaltung Einzelkosten Einzelkosten Gemeinkosten Gemeinkosten (Kalkulationssätze) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 30 Struktur eines Kostenrechnungssystems Finanzbuchhaltung neutraler ZweckAufwand aufwand Personalverrechnung Lohnaufwand und Lohnnebenkosten Schnittstellenprogramm Anlagenbuchhaltung kalk kalk Zinsen Abschreibung Erfassungsmodul Kostengleicher Aufwand = Grundkosten Erfassungsmodul kalkulatorische Kosten Kostenarten Kostenträgergemeinkosten Kostenträgereinzelkosten Hauptkostenstellen Umlage Hilfskostenstellen Kostenstellensumme Bezugsgröße Verrechnungssatz Bügel Nr.: ___ Mittelteil Nr.: ___ Montage MEK MGK FEK FGK HSK Bügel MEK MGK FEK FGK HSK MT MEK MGK FEK FGK HSKMont. Model Nr.: ___ HSK VWVT SK Verp./SEK Gesamtk. Erfassungsmodul Stück- Fertigungspläne listen Materialwirtschaft Erfassungsmodul Zeitwirt- Bezugs- größen schaft ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Betriebsdatenerfass. 31 Kapitel 3 Die ar n e t s Ko te ng u n h nrec ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 32 Kostenartenrechnung Sie ist jener Teilbereich der Kostenrechnung, in dem die gesamten Kosten einer Abrechnungsperiode systematisch erfasst werden. Weiters werden die für eine Weiterverrechnung der Kosten benötigten Zusatzinformationen gesammelt. WELCHE Kosten sind angefallen? Die Kostenartenrechnung ist die Grundlage für die Kostenstellen- und die Kostenträgerrechnung. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 33 Wichtige Kostenarten Materialkosten Fertigungsmaterialkosten, Hilfsmaterialkosten Personalkosten Löhne und Lohnnebenkosten, Gehälter und Gehaltsnebenkosten, Überstundenentgelte, sonstige Personalkosten Fremdleistungskosten Transportkosten, Reparaturkosten, Werbekosten, Reisekosten, Versicherungskosten Kalkulatorische Kosten kalkulatorische Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, kalkulatorische Wagnisse, kalkulatorischer Unternehmerlohn ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 34 Materialarten Rohstoffe sind jene Stoffe, die den wesentlichen Bestandteil eines Produktes ausmachen - sie können diesem i.d.R. unmittelbar zugerechnet werden Hilfsstoffe sind ebenfalls Bestandteile eines Produktes, bestimmen jedoch nicht seinen Charakter. Hilfsstoffe sind i.d.R. Gemeinkosten Betriebsstoffe gehen überhaupt nicht in das Produkt ein, sondern dienen zum Betreiben der Betriebsmittel ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 35 Methoden zur Ermittlung des mengenmäßigen Materialverbrauchs 1 Inventurmethode (Befundrechnung) 2 Skontration (Fortschreibung) 3 Retrograde Methode + = Anfangsbestand Zugänge Endbestand (lt. Inventur) Verbrauch + = = Anfangsbestand Zugänge Verbrauch (lt. Materialaufschreibung) Sollendbestand Istendbestand (lt. Inventur) Schwund x = hergestellte/abgesetzte Menge Stückliste/Rezeptur Sollverbrauch ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 36 Methoden zur Ermittlung des wertmäßigen Materialverbrauchs Ermittlung Ermittlung der derMaterialeinsatzmenge Materialeinsatzmenge Bewertung Bewertung des desMaterialeinsatzes Materialeinsatzes § Bewertung mit Einstandspreisen •Mit tatsächlichen Einstandspreisen o Identitätspreis •Mit durchschnittlichen Einstandspreisen o Gleitender Durchschnittspreis o Gewogener Durchschnittspreis •Mit konstruierten Einstandspreisen o FIFO (first in, first out) o HIFO (highest in, first out) o LIFO (latest in, first out) (unterstelle Verbrauchsfolge) § Bewertung mit Tagesbeschaffungspreisen § Erfassung mit festen Verrechnungspreisen ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 37 Formen des Arbeitsentgelts Gehälter Löhne Ergänzende Arbeitsentgelte z.B. 13. und 14. Monatsgehalt Entlohnungsformen produktionstechnische Bedeutung Zurechenbarkeit Zeitlohn Fertigungslohn Einzelkostenlohn Akkordlohn Hilfslohn Gemeinkostenlohn Prämienlohn Nichtleistungslohn ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 38 Zusammensetzung der Arbeitskosten Leistungszeit Anwesenheits- Nichtanwesenheitszeit zeit Sonderzahlungen Soziale Lasten Fertigungslohn Leistungslohn Nichtleistungslohn Lohnnebenkosten Einzelkosten Gemeinkosten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 39 Struktur der Personalkosten (2) 52 Wochen Anwesenheitszeit Nichtanwesenheitszeit direkt verindirekt verrechenbare Zeit rechenbare Zeit = = Leistungszeit Hilfszeit Leistungslöhne Weihnachtsrenu meration, Urlaubsgeld, Prämien, Gewinnbeteil. Soziale Lasten Abgaben des Arbeitgebers auf die Jahresbruttolöhne und die Sonderzahlungen Nichtl eistungslöhne (auf die Arbeitszeit, -menge, u. -intensität fallende Löhne) Leistungslöhne (Bruttolöhne für die Anwesenheitszeit) Urlaub, Krankheit, Feiertage Sonderzahlungen (auf die Abwesenheitszeit und die Sonderzahlungen fallende Löhne Lohnnebenkosten (jener Kostenbetrag, um den die gesamten Personalkosten die Bruttolöhne für die Anwesenheitszeit übersteigen Fertigungslohn Lohnabhängige Gemeinkosten Bruttolohn für die direkt verrechenbare Leistungszeit jener Kostenbetrag, um den die gesamten Personalkosten die Bruttolöhne für die direkt verrechbare Leistungszeit übersteigen ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 40 ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 10 20 30 40 50 60 70 80 90 49,8 45,6 43,5 Anwesenheitszeit 52 Sonderzahlungen 42,5 80,9 61,5 56 Bezahlte Arbeitszeit 83,1 52 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2,1 Wo 1,0 Wo. Leistungslohn und Erstattung 36 % von 4,0 Wo Weihn.r. 4,0 Wo 1 Jahr = Feiertage Sonstiges Lohnnebenkosten gem. EFZG 60 Wochen 1,5 Wo sonst. Urlaubszu.52 WochenWochen Bezahlte Ausfallzeiten Lohnnebenkosten Anwesenheitszeit 1 Jahr = 2,2 Wo Kran- 4,2 Wo Wochen 52 Wochen kenstand Urlaub Komponenten der Personalkosten 41 Struktur der Fehlzeiten Ausmaß der Gesamtfehlzeiten (Angenommene Jahresdurchschnittszahl 12%) Betrieblicher Krankenstand Entschuldigte Fehlzeiten (Arztbesuche o.ä.) Unentschuldigte Fehlzeiten ca. 0,5% ca. 6 - 7% ca. 1,5% Medizinisch notwendig beeinflußbar Motivational bedingter Absentismus beeinflußbar, aber Gefahr des Edelabsentismus Gesetzlich geregelte Fehlzeiten (Schwangerschaften etc.) ca. 2 - 3% nicht beeinflußbar Kuren, Rehabilitationsmaßnahmen ca. 1% nicht beeinflußbar nicht beeinflußbeein- bar flußbar ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 42 Systematik der kalkulatorischen Kosten Kalkulatorische Kostenarten Anderskosten Zusatzkosten Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Kalkulatorische Miete Zurechnungsproblem, da beides möglich Kalkulatorisches Wagnis Kalkulatorischer Unternehmerlohn ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Kalkulatorische Zinsen Kalkulatorische Miete 43 Kalkulatorische Abschreibung Die kalkulatorische Abschreibung erfaßt den verursachungsgerechten Wertverzehr in jeder Abrechnungsperiode, während der ein mehrperiodig nutzbares und abnutzbares Betriebsmittel eingesetzt ist. Die kalkulatorische Abschreibung richtet sich ausschließlich nach internen Erfordernissen. Abschreibungsursachen verbrauchsbedingt wirtschaftlich bedingt mengenmäßige Abnahme durch Gebrauch, Zeitverschleiß, Substanzverringerung. wertmäßige Abnahme durch Nachfrageverschiebungen, techn. Fortschritt, sinkende Preise, Fehlinvestitionen. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig zeitlich (rechtlich) bedingt Nutzungsvorrat ist nach Ablauf einer bestimmten Zeit erschöpft (Miet- oder Pachtverträge, Schutzrechte, Konzessionen). 44 Anschaffungskosten Prinzip der kalkulatorischen Abschreibung W ert 2. Jahr 3. Jahr Anschaffungskosten Anschaffungskosten 1. Jahr Anschaffungszeitpunkt de rA nla g e 4. Jahr d un e e t t ne dien rate h r c s rre rve ng ve ede ibu wi chre s Ab Nutzungsdauer Anschaffungsao. zeitpunkt Nutzungsdauer Anschaffungs- ErsatzUniv. Prof. Dr. Werner Mussnig zeitpunkt zeitpunkt Nutzungsdauer Ersatzzeitpunkt 45 Verrechnung der kalkulatorischen Abschreibung Kostenstelle Lager Betrag Kostenart • • • Abschreibung • • Summe Kosten Bezugsgröße Verrechnunssatz Kalkulation Betrag Fertigungsmat. Fertigungsmatgk. Fertigungslöhne Fertigungslohngk Herstellkosten Verwaltungskosten Vertriebskosten Selbstkosten Gewinn Verkaufspreis Selbstkosten Abschreibung ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 46 Kalkulatorische Abschreibung • FIBU: beschränkt durch EStG • KORE: kann sich von FIBU unterscheiden (Nutzungsdauer (ND), Abschreibungsbasis, Abschreibungsverfahren) • Nutzungsdauer – wirtschaftliche ND – technische ND • Abschreibungsbasen – Anschaffungswert (Problem: Finanzierungslücke) – Wiederbeschaffungswert – Tageswert • Problem: Verlängerung der Nutzungsdauer ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 47 Lineare Abschreibung Rest(buch)wert 100.000 Abschreibungsbasis = Anschaffungspreis - Restwert 55.000 10.000 0 Rest- oder Schrottwert 5 10 Jahre Abschreibungsbasis Lineare Abschreibung = Nutzungsdauer ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 48 Berechnung der kalkulatorische Abschreibung Erfassung der Abschreibungsbasis Wiederbeschaffungspreis + Beschaffungsausgaben (Transport, Installation, Klimaanlage, Fundament, etc.) = Wiederbeschaffungswert - Restwert = Abschreibungsbasis zeitabhängige Abschreibung Abschreibungsbasis techn. / wirtsch. Nutzungsdauer = Abschreibungsbetrag je Periode (p.m. / p.q / p.a) =(fixe Kosten) leistungsabhängige Abschreibung Abschreibungsbasis Gesamtleistung (ges. ND) = Abschreibungsbetrag je Leistungseinheit Abschreibungsbetrag pro Leistungseinheit * Leistungseinheiten der Periode = Abschreibungsbetrag je Periode (p.m. / p.q / p.a) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig =(variable Kosten) 49 Kalkulatorische Zinsen • • • • • • • In der Erfolgsrechnung werden nur die für das Fremdkapital gezahlten Zinsen als Aufwand verrechnet Durch die kalkulatorischen Zinsen werden in der KoRe Zinsen für das gesamte im Leistungsprozeß eingesetzte Kapital (betriebsnotwendiges Kapital) berücksichtigt (=Anderskosten) Berechnungsgrundlage: betriebsnotwendiges, zinsberechtigtes Kapital Ausgangspunkt: Vermögen laut Handelsbilanz Korrekturen – Wertberichtigung, Stille Reserven, nicht betriebsnotwendiges Kapital Abzugskapital – Verbindlichkeiten , die dem Unternehmen zinsenfrei zur Verfügung stehen – Verbindlichkeiten, für die bereits an anderer Stelle der Kostenrechnung Zinsen berücksichtigt wurden Nicht zinsberechtigtes Vermögen – für welches schon an anderer Stelle der KoRe Zinsen berechnet wurden – welches einen gesonderten Ertrag bringt ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 50 Berechnung des zinsberechtigten Kapitals Zinskosten Zinsen für Fremdkapitel (pagatorische Kosten) + Zinsen für Eigenkapitel (kalkulatorische Kosten) Vermögen lt. Handelsbilanz nicht betriebsnotwendige (in der Bilanz enthaltene) Vermögensteile betriebsnotwendige (nicht in der Bilanz enthaltene) Vermögensteile (z. B. Geringwertige Wirtschaftsgüter) = +/= = Zwischensumme Umwertungen (Auflösung stiller Reserven) betriebsnotwendiges Vermögen Abzugskapital betriebsnotwendiges Kapital Aktiva betriebsnotw. Vermögen Passiva betriebsnotw. Kapital Voraus -zahlungen Betriebsnotwendiges Kapital * Zinssatz = kalkulatorische Zinsen ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 51 Kalkulatorische Zinsen Durchschnittswertmethode Gebundenes Kapital (€) 25.000 Anschaffungswert * i AW Jahre Gebundenes Kapital (€) 25.000 Durchschn. Bestand* i ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Jahre 52 Kalkulatorische Zinsen Durchschnittswertmethode Gebundenes Kapital (€) 25.000 Ohne Restwert: Anschaffungswert 2 12.500 AW 2 10 Gebundenes Kapital (€) *i Jahre 25.000 Mit Restwert: 15.000 ( AW - R +R 2 5.000 R AW - RW 2 ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Jahre 10 + RW ) *i 53 Kalkulatorische Wagnisse Risiken nicht quantifizierbar quantifizierbar versicherbar nicht versicherbar versichert nicht versichert kalkulatorische allgemeines Wagnisse Unternehmerwagnis im Gewinnzuschlag Einzelkosten als Wagnis Versicherungsprämie als Kosten Gemeinkosten Sonderkosten Kostenrechnung Kalkulation ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 54 Kalkulatorischer Unternehmerlohn ð die kostenrechnungsmäßige Abgeltung für die Arbeitsleistung des Unternehmers bzw. der Gesellschafter und mittätigen Angehörigen, soweit sie kein Gehalt beziehen. (Es ist die Rechtsform des Unternehmens zu beachten!) Kalkulatorische Miete ð wird berücksichtigt, wenn der Unternehmer (ein Gesellschafter) private Räume für betriebliche Zwecke zur Verfügung stellt und dafür keine Miete verrechnet (Zusatzkosten) ð tatsächliche Mietkosten werden durch die ortsübliche Miete ersetzt (Anderskosten) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 55 Zuliefersystem der Kostenrechnung Standardzuliefersysteme Zulieferdaten Finanzbuchhaltung Aufwandsgleiche Kosten Lohnverrechnung Löhne, Gehälter je Mitarbeiter + Nebenkosten Betriebsdatenerfassung Arbeitszeit je Mitarbeiter + Arbeitsgang, Stückzahlen Anlagenbuchhaltung (kalkulatorische Abschreibungen ev. kalk. Zinsen) Arbeitsvorbereitung / PPS Stücklisten, Arbeitspläne, Artikelnummer Auftragserfassung Auftragsnummern, Verkaufspreis, Stückzahlen Lagerbuchhaltung bzw. Materialentnahme Warenwirtschaftssystem ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 56 Beispiel: Kostenartennummer Kostenart 44000 Hilfsstoffe 46100 Heizöle 46400 Strom 46600 Wasser, Kanal 50000 Fertigungslöhne 53000 Akkordlöhne 55000 Lehrlingslohn 59000 Lohn für Werkzeuganfertigung 60000 Instandhaltung 60900 Reinigung Gebäude/Büro 61000 Müllabfuhr 61100 Eingangsfrachten 61200 Ausgangsfrachten 61300 Transporte durch Dritte 61400 KFZ-Sprit 61600 Treibstoff Toyota 61700 Treibstoff Volvo 62000 Post Telefon 62100 Post Porto 62300 Miete Gebäude 62400 Miete Telefonanlage 63200 Leasing 64000 Werbung 65000 Kosten der Schlosserei 65500 Maschineninstandhaltung 65800 Reparaturen 66000 Bürobedarf 66300 EDV-Kosten 67000 Versicherungskosten 67900 Transportversicherung 68000 Steuerberatung 68100 Beratungskosten 68700 sonstige Kosten 68800 Sozialaufwand 90900 kalkulatorische Abschreibung 90910 kalkulatorische Zinsen 90920 kalkulatorische Steuern ao.kalkulatorischer Univ. Prof. Dr. Werner 90930 Unternehmerlohn Mussnig 57 Kapitel 4 o K e i D g n u n ch e r n e ell t s n e st ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 58 Kostenstellenrechnung Sie dient der Verteilung der in einer Abrechnungs-periode angefallenen Gemeinkosten auf die Unternehmensbereiche, in denen sie angefallen sind. WO sind die Kosten angefallen? Die Kostenstellenrechnung ist das Bindeglied zwischen der Kostenarten- und der Kostenträger-rechnung ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 59 Kostenstellenrechnung Begriff Kostenstelle Ort der Kostenentstehung Betrieblicher Teilbereich, der kostenrechnerisch selbständig abgerechnet wird. Bildung der Kostenstellen nach • • • • • Funktionsbereichen Verantwortungsbereichen Räumlichen Gesichtspunkten Abrechnungstechnischen Gesichtspunkten Leistungstechnischen Gesichtspunkten Aufgaben der Kostenstellenrechnung • Verursachungsgerechte Zurechnung der Gemeinkosten auf die Stellen • Darstellung der Leistungsbeziehungen der Kostenstellen untereinander ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig • Bildung von Kalkulationssätzen • Abteilungsbezogene Wirtschaftlichkeitsrechnung 60 Notwendigkeit von Kostenstellen S 50,- / min S 80,- / min S 150,- / min S 200,- / min S 100,- / min Produkt B 10 min 10 min Herstellkosten Produkt B Produkt A 10 min 20 min S 50,— ⋅ 10 min = S 500,— S 80,— ⋅ 10 min = S 800,— 15 min S 150,— ⋅ 20 min = S 3000,— 15 min S 100,— ⋅ 15 min = S 1500,— 5 min HSK S. 5.800,- Herstellkosten Produkt A S 50,— ⋅ 10 min = S 500,— S 200,— ⋅ 15 min = S 3000,— S 100,— ⋅ 5 min = S 500,— HSK ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig S 4000,— 61 Arten von Kostenstellen Vorkostenstellen (VerrechnungsKST) Hilfskostenstellen Allgemeine EnergieHilfskostenzentrale stellen Lager Hauptkostenstellen Fertigung, Vertrieb ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 62 Prinzipien der Kostenstellenbildung • Homogene Kostenverursachung Die Bezugsgrößen zusammengefaßter Funktionen sollen eine gleichartige bzw. proportionale Beziehung von variablen Kosten und erstellten Leistungen aufweisen. • Abgegrenzte Verantwortungsbereiche Die Zuständigkeit und Weisungsbefugnis im Bereich einer Kostenstelle müssen eindeutig festgelegt sein. • Eindeutige Zuordenbarkeit Die Differenzierung der Kostenstellen muß ein genaue Kontierung von Kostenbelegen gewährleisten. • Wirtschaftlichkeit und Übersichtlichkeit Die Kostenstelleneinteilung darf nur so differenziert sein, daß eine Übersichtlichkeit gewahrt bleibt und das Verhältnis von Aufwand und Ertrag als sinnvoll anzusehen ist. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 63 LAGER Orientierungspunkte bei der Kostenstellenbildung LAGER ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 64 Grundsätze der Kostenstellenbildung Folgende Grundsätze sollten jedenfalls beachtet werden: Es sollten nicht völlig unterschiedliche Tätigkeiten in einer Kostenstellen zusammen gefasst werden (da meist auch unterschiedliche Kosten verursacht werden)! Es sollten nicht Funktionen mit unterschiedlichen Automatisierungsgrad (manuelle und. automatisierte Tätigkeiten) zusammen gefasst werden! Es sollten nicht Mitarbeiter mit unterschiedlichen Qualifikations-und Lohnniveau zusammen gefasst werden! Große Maschinen (hohes Investitionsvolumen) bilden meist eine eigene Kostenstelle! Durch Transportsysteme fix verknüpfte Maschinen bilden eine Kostenstelle (Fertigungsstraßen innerhalb einer geschlossenen Fliessstrecke)! Maschinen mit ähnlichen Leistungs- und Kostenstrukturen können in einer Kostenstellen zusammengefasst werden. Um die Entwicklung der Instandhaltungen, Reparaturen und Rüst- Arbeitszeitrelationen zu kontrollieren, sollten Vorkostenstellen angelegt werden. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 65 Ø Übungsbeispiel Analysieren Sie den folgenden Kostenstellenplan und identifizieren Sie entwaige Fehler. Machen Sie entsprechende Verbesserungsvorschläge! Kostenstellennumm Kostestelle er 2005 Betriebsgebäude 2010 Lager 1 2011 Lager 2 2020 Werkstatt 2030 Maschinenpark 2100 Glashäuser 2150 Außenflächen 2180 Baumschule 2190 Schnittblumen 2200 Verwaltung 2230 Werbung 2250 Verkauf Ø Übungsbeispiel Ein Unternehmen produziert Maschinen für die Herstellung von Bremsbelegen. Neben der Produktion wird auch die Montage und das Service für die Maschinen als Leistungen angeboten. Im Rahmen der Implementierung der Kostenrechnung wird vorgeschlagen eine Kostenstelle für die Monage und eine Kostenstelle für das Service einzurichten. Welche Fragen müßten Sie stellen, um festzustellen, ob eine gemeinsame oder zwei separate Kostenstellen gebieldet werden sollten? ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 66 Zurechenbarkeit der Kosten Zurechenbarkeit der Kosten Einzelkosten einem einzelnen Kalkulationsobjekt eindeutig (ohne Schlüsselung) zurechenbare Kosten “Echte” Gemeinkosten einem einzelnen Kalkulationsobjekt nicht eindeutig, sondern allenfalls anteilig (mittels Schlüsselung) anlastbare Kosten Mischkosten einem einzelnen Kalkulationsobjekt nicht zurechenbare Kosten, wohl aber der Objektgruppe (z.B. Produktgruppe). Auf Ebene des Produktes Gemeinkosten, auf Ebene der Produktgruppe Einzelkosten “Unechte” Gemeinkosten Einzelkosten, die aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wie Gemeinkosten behandelt werden ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 67 Durchführung der Kostenstellenrechnung mit Hilfe des Betriebsabrechnungsbogens (BAB) BAB Meistens als Tabelle, in der zeilenweise die Kostenarten und spaltenweise die Kostenstellen angeführt sind Vorgehensweise der Abrechnung 1. 2. 3. 4. Verteilung der primären Gemeinkosten aus der KAR auf die Kostenstellen Durchführung der innerbetrieblichen Leistungsverrechung Bildung von Kalkulationssätzen Kostenstellenweise Kostenkontrolle ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 68 Beispiel eines BAB Kostenstellen Betrag Kostenarten (KostenträgerGemeinkosten) (0) (1) Art der Zurechnung auf die Kostenstellen d = direkt Allgemeine Fertigungs-Hilfs- Fertigungshauptkostenstelle MaterialVerVertriebs K S T/ E K Kostenkostenstelle n kostenwaltungsDreherei Galvanik Montage s = Schlüsselung stelle (EnergieverReparaturabteilun stelle kostenkostenK S T/G K sorgungsanlage) g stelle stelle Hilfskostenstellen (5) (2) (3) 1. Hilfs- und Betriebsmaterial 2 500 d (Entnahmescheine) 2. Hilfslöhne und Gehälter 10 500 d (Lohn-/Gehaltsabrg. 3 3. Kalkulatorische Abschreibungen 000 d (Analgenkartei) 4. Heizungskosten 600 s (Länge der installierten Heizkörper) 5. Übrige Gemeinkosten 4 000 6. Summe I 20 600 s (installierte KWh) 7. Umlage der Kosten der Allgemeinen Kostenstelle 8. Summe II d (Reparaturab- 9. Umlage der Hilfskostenstelle Reparaturabteilung 10. Summe III s (unterschiedliche Schlüssel) rechnungen) 20 600 Hauptkostenstellen (6) (7) (8) (9) (4) (10) 370 600 550 400 300 180 70 750 2 800 1 000 800 650 1 000 2 300 1 200 200 400 900 600 300 150 180 270 30 40 170 100 80 70 70 40 300 400 1 000 800 600 400 200 300 1 650 4 240 3 620 2 700 1 930 1 800 2 820 1 840 ./. 1 650 240 220 160 330 200 320 180 3 840 2 860 2 260 2 000 3 140 2 020 800 640 880 700 500 960 4 640 3 500 3 140 2 700 3 640 4 480 ./. 4 480 ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 30 2 980 69 Bezugsgrößen Maßgrößen der Kostenverursachung Bezugsgrößen direkte Bezugsgrößen Einproduktfall indirekte Bezugsgrößen Mehrproduktfall Produktmenge= Retrograd erfaßteUnmittelbar erfaßte Bezugsgröße Bezugsgrößen Bezugsgrößen Bezugsbasis Arbeitsminuten Maschinenstunden Apparatestunden Abgeleitet aus Bezugs- Abgeleitet aus Kostengrößen anderer KST artenbeträgen Σ Deckung Bezugsgrößen Σ Lohn- und Gehaltskonten Begründung Personenarbeitszeiten zum Teil arbeitskräfteabhängige Maschinenarbeitszeit Trommelstunden Σ Materialkosten Abgeleitet aus Umsatz Σ Herstellkosten des Umsatzes Erfassung Zeiterfassung (BDE) Zeiterfassung (BDE) Zählautomaten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 70 Grundsätze der Bezugsgrößenauswahl Für die Bildung der Bezugsgrößen sind vor allem zwei Grundsätze zu beachten: • • Die Bezugsgröße als Ausdruck der Leistung der Kostenstelle muss in einem direkten Zusammenhang mit den variablen Kosten der Kostenstelle stehen. Erhöht sich die Bezugsgröße, so müssen auch die variablen Kosten steigen. ( Steigen z. B. die Fertigungsminuten, müsste auch der Leistungsstrom steigen.) Die Bezugsgröße muss einen direkten Bezug zum Kostenträger aufweisen. Die Einheiten der Bezugsgröße müssen sich den einzelnen Kostenträgern zuordnen lassen können (z.B. Fertigungsminuten je Kostenträger). ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 71 Abgrenzung von Leistungen Leistungen außerbetriebliche Leistungen innerbetriebliche Leistungen absatzbestimmte abgesetzte Leistungen, z.B. Leistungen, z.B. unfertige und verkaufte Fertigfertige Erzeugnisse erzeugnisse auf Lager Kundenleistungen aktivierbare als Kosten zu Leistungen, verrechnende z.B. selbsterstellte innerbetriebliche Maschinen Leistungen in der Periode ratenmäßig der Entstehung verrechnet, z.B. verrechnet, z.B. selbstausgeführte selbsterzeugter Großreparatur Strom ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 72 Grundtypen innerbetrieblicher Leistungsverflechtung Typ 1 Einseitiger, einstufiger Leistungsprozeß an nur eine nachgelagerte KSt. Einseitiger, einstufiger Leistungsprozeß an mehrere nachgelagerte KSt. Typ 2 Einseitiger, mehrstufiger Leistungsprozeß Typ 3 Wechselseitiger Leistungsprozeß Typ 4 ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 73 Primäre und sekundäre Kosten Hilfskostenstellen ä re Prim n koste n i e Gem Hilfskostenstellen ä re pr i m o e i nk m e G s te n Umlageschlüssel / Verrechnung ndä seku re o e i nk m e G sten Bezugsgröße ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 74 Kostenträger Kapitel 5 g un n h c e rr e g ä r ent t s n) o o i t K a l e u k Di l a K ( ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 75 Kostenträgerrechnung In der Kostenträgerrechnung werden Kosten auf die betrieblichen Leistungen, durch die sie verursacht worden sind, verrechnet. WOFÜR sind die Kosten angefallen? Die Kostenträgerrechnung ist die letzte Stufe der Kostenrechnung. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 76 Kostenträgerrechnung Kostenträgerzeitrechnung (Erfolgsrechnung) Kostenträgerstückrechnung (Kalkulation) • Periodenrechnung • Kalkulation, Stückrechnung • ermittelt die nach Leistungsarten gegliederten, in der Periode insgesamt angefallenen Kosten • ermittelt die Selbst- bzw. Herstellkosten der betrieblichen Leistungseinheiten • Kosten je Periode • Kosten je Einheit (Stück) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 77 Kostenträgerstückrechnung Kalkulationsarten - Plankalkulation Stückkostenermittlung auf der Grundlage geplanter Kosten, die i. d. R. für die gesamte Planungsperiode gültig ist und für jede Produktart detailliert erstellt wird. - Vorkalkulation ex-ante durchgeführte Stückkostenermittlung auf der Grundlage überschlägig geplanter Kosten, die sich auf spezielle Einzelaufträge bezieht - Zwischenkalkulation Nachkalkulation für unfertige Erzeugnisse bei Kostenträgern mit langer Produktionsdauer (z.B.: Anlagen und Schiffe) - Nachkalkulation Ermittlung der Istkosten für bestimmte Aufträge oder Einzelerzeugnisse zur stückbezogenen Kosten- und Erfolgskontrolle nach Abschluß der Produktion ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 78 Grundschema der Zuschlagskalkulation Fertigungsmaterialeinzelkosten Materialgemeinkosten Materialkosten Fertigungslohneinzelkosten Fertigungsgemeinkosten Herstellkosten Fertigungskosten Selbstkosten Sondereinzelkosten der Fertigung Verwaltungsgemeinkosten Vertriebsgemeinkosten Sondereinzelkosten des Vertriebs ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 79 Prinzip der Zuschlagskalkulation Lager Summe GK Bezugsgröße Verrechnungssatz % Fertigungsmaterial Materialgemeinkosten Zentrifugieren Schneiden Fertigungslöhne Schrauben Gemeinkosten Schrauben Herstellkosten Verwaltungsgemeinkosten Vertriebsgemeinkosten Selbstkosten Zentrifugieren €/Mh Schneiden Schrauben Verwaltung €/min % % Vertrieb €/Auftr. ### % €/Mh €/min ### % ### % €/Auftr ### Gemeinkosten Lager Materialeinzelkosten % auf die Materialeinzelkosten Gemeinkosten Schneiden Arbeitsminuten Schneiden € pro Arbeitsminute Gemeinkosten Verwaltung Herstellkosten % von den Herstellkosten Gemeinkosten Zentrifuge Maschinenstunden Zentrifuge € pro Maschinenstunde Gemeinkosten Schrauben Fertigungslöhne Schrauben ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig % auf die Lohneinzelkosten Gemeinkosten Vertrieb Anzahl Aufträge 80 € pro Auftrag Bezugskalkulation Bruttoverrechnungspreis Umsatzsteuer (Vorsteuerabzug) Nettorechnungspreis Rabatt Zielpreis Skonto Kassapreis Bezugsspesen Einstandspreis (=Materialeinzelkosten) Betriebskalkulation Materialeinzelkosten Materialgemeinkosten Fertigungseinzelkosten Fertigungsgemeinkosten Herstellkosten Verwaltungskosten Vertriebskosten Selbstkosten Absatzkalkulation Selbstkosten Gewinn Nettoverkaufspreis Vertreterprovision Kassapreis Skonto Zielpreis Rabatt Listenpreis exkl. Umsatzsteuer Umsatzsteuer Univ. Listenpreis Prof. Dr. inkl. Werner Mussnig Umsatzsteuer retrograde Kalkulation progressive Kalkulation Progressive vs. Retrograde Zuschlagskalkulation ao. 81 Differenzkalkulation Selbstkosten Gewinn Nettoverkaufspreis Vertreterprovision Kassapreis Skonto Zielpreis Rabatt Listenpreis exkl. Umsatzsteuer Umsatzsteuer ao. Univ. Prof. Dr. Werner Listenpreis inkl. Umsatzsteuer Differenzalkulation Bezugskalkulation Materialeinzelkosten Materialgemeinkosten Fertigungseinzelkosten Fertigungsgemeinkosten Herstellkosten Verwaltungskosten Vertriebskosten Selbstkosten Absatzkalkulation Bruttoverrechnungspreis Umsatzsteuer (Vorsteuerabzug) Nettorechnungspreis Rabatt Zielpreis Skonto Kassapreis Bezugsspesen Einstandspreis (=Materialeinzelkosten) Betriebskalkulation Differenzkalkulation Mussnig 82 Rechnungsprinzipien der Zuschlagskalkulation - auf hundert - von hundert - von hundert + + von hundert + von hundert + von hundert + von hundert + von hundert + in hundert + in hundert + in hundert + von hundert Bruttoverrechnungspreis Umsatzsteuer (Vorsteuerabzug) Nettorechnungspreis Rabatt Zielpreis Skonto Kassapreis Bezugsspesen Einstandspreis (=Materialeinzelkosten) Materialeinzelkosten Materialgemeinkosten Fertigungseinzelkosten Fertigungsgemeinkosten Herstellkosten Verwaltungskosten Vertriebskosten Selbstkosten Selbstkosten Gewinn Nettoverkaufspreis Vertreterprovision Kassapreis Skonto Zielpreis Rabatt Listenpreis exkl. Umsatzsteuer Umsatzsteuer Listenpreis inkl. Umsatzsteuer + von hundert + in hundert + in hundert - - auf hundert - auf hundert - auf hundert - auf hundert - auf hundert - von hundert - von hundert - von hundert - auf hundert + von hundert * 1,.. - auf hundert : 1,.. - von hundert * 0,.. + in hundert : 0,.. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 83 Algorithmus der Prozentrechnung * 1,2 von hundert hinauf von hundert hinunter * 0,8 „Wenn Sie von 100 % als Basis ausgehend rechnen, arbeiten Sie immer mit einer Multiplikation“ auf hundert hinauf (in hundert) auf hundert hinunter : 1,2 : 0,8 „Wenn Sie auf 100 % als ao. Ergebnis Univ. Prof. hinrechnen, Dr. Werner arbeiten Mussnig Sie immer mit einer Division“ 84 Maschinenstundensatzrechnung (Produzierendes Gewerbe) Abschreibungen Zinsenkosten Energiekosten Reparaturkosten Werkzeugkosten Raumkosten Betriebsmittel maschinenabhängige Gemeinkosten maschinenabhängige Gemeinkosten Leistungszeit Maschine = Stundensatz Maschine Fertigungslöhne lohnabhängige Gemeinkosten lohnabhängige Gemeinkosten Fertigungslöhne = Zuschlagssatz Lohngemeinkosten Summe der Vorgabezeiten der Gutstück = Lastlaufzeit Kalkulation Fertigungslöhne ### Lohngemeinkosten ### Kosten Maschinenstunden ### ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig### Herstellkosten 85 Beispiel einer Maschinensatzrechnung Angaben: Angaben: Kalkulation: Kalkulation: DM/Std. DM/Std. Anschaffungspreis Anschaffungspreis Wiederbeschaffungspreis Wiederbeschaffungspreis 330.000 330.000DM DM 360.000 360.000DM DM Kalkulatorische KalkulatorischeAbschreibung Abschreibung 360.000 360.000/ /88/ /1.500 1.500 Wirtschaftliche WirtschaftlicheNutzungsdauer Nutzungsdauer Kalkulatorischer KalkulatorischerZinssatz Zinssatz 88Jahre Jahre 8% 8%p.a. p.a. Kalkulatorische KalkulatorischeZinsen Zinsen 180.000 180.000* *0,08 0,08/ /1.500 1.500 9,60 9,60 Jährlicher JährlicherInstandhaltungssatz Instandhaltungssatz Flächenbedarf Flächenbedarf 3% 3%d.d.WBW WBW 17 17qm qm Instandhaltungskosten Instandhaltungskosten 360.000 360.000* *0,03 0,03/1.500 /1.500 7,20 7,20 Raumkosten-Verrechnungssatz Raumkosten-Verrechnungssatz Elektrische ElektrischeNennleistung Nennleistung 0,04 Raumkosten 0,04DM/qm*Std. DM/qm*Std. Raumkosten 8,4 17 8,4kW kW 17* *0,04 0,04 Auslastung Stromkosten Auslastungd.d.elektr. elektr.Nennleistung Nennleistung 60% 60% Stromkosten Kraftstrompreis 0,14 8,4 Kraftstrompreis 0,14DM/kWh DM/kWh 8,4* *0,6 0,6* *0,14 0,14 Werkzeugkosten 3,80 Werkzeugkosten 3,80DM/Std. DM/Std. Werkzeugkosten Werkzeugkosten Restfertigungsgemeinkosten 5,70 Restfertigungsgemeinkosten 5,70DM/Std. DM/Std. Restfertigungsgemeinkosten Restfertigungsgemeinkosten Sollstunden Sollstundenpro proJahr Jahr 1.500 1.500Std. Std. 30,00 30,00 0,68 0,68 0,71 0,71 3,80 3,80 5,70 5,70 Maschinenstundensatz Maschinenstundensatz(FGK/Std.) (FGK/Std.) 57,69 57,69 ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 86 Sonderform der Kostenträgerrechnung: Stundensatzrechnung (Dienstleistungsgewerbe) Anzahl Kalenderwochen - Urlaube -Feiertage - Krankenstände - sonst. Verhinderungenszeiten = Anwesenheitszeit -Hilfszeiten = Leistungszeit (dir. verrechenb. h) 52,0 Wochen 5,0 Wochen 2,2 Wochen 2,4 Wochen 1,3 Wochen 41,1 Wochen 8,6 Wochen 32,5 Wochen Summe aller Gemeinkosten = Stundensatz Leistungszeit * 38,5 * Anzahl Mitarbeiter Rechnung Löhne € 450.000,Gehälter € 180.000,Fremdleistungen € 75.000,Betriebsstoffe € 25.000,Miete € 40.000,Versicherung € 35.000,Abschreibungen € 150.000,Zinsen € 95.000,Summe Gemeinkosten €1.050.000,- € 1.050.000,32,5 * 38,5 * 10 = € 80,77 / h Materialkosten (positionsweise inkl. Gewinnaufschl.) Anzahl Stunden * Stundensatz (inkl. Gewinnaufschl.) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Rechnungssumme 87 Handesspanne Sonderform der Kostenträgerrechnung: Handelsspannenkalkulation Handelsspanne = (Aufschlag) Einkaufspreis + Bezugskosten = Einstandspreis + Handlungskosten (Regien) = Selbstkosten + Gewinn = Barverkaufspreis (Kassapreis) + Skonto = Zielverkaufspreis (Zielpreis) + Rabatt = Listenpreis (exkl. MWSt.) + Ust. = Listenpreis (inkl. MWSt.) Umsatz – WES WES Gemeinkostenzuschlag = Handelsspanne = (Abschlag) Regien Gewinnzuschlag = WES ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Umsatz – WES Umsatz Gewinn Selbstkosten 88 Kapitel 6 Die g n u s flö u a n e Kost ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 89 Vollkostenrechnung Vollkosten sind jene Stückkosten, die man erhält, wenn sämtliche Kosten einer Periode auf die entsprechenden Kostenträger verrechnet werden. Teilkostenrechnung In den Systemen der Teilkostenrechnung werden nur bestimmte Teile der Gesamtkosten auf die Kostenträger kalkuliert. Die übrigen Teile werden auf anderem Wege in das Betriebsergebnis übernommen. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 90 Abhängigkeit der Kosten vom Leistungsniveau (Beschäftigung als Kosteneinflußgröße) Abhängigkeit der Kosten vom Leistungsniveau Beschäftigungsvariable Kosten Beschäftigungsfixe Kosten bei gegebener Kapazität und gegebener Betriebsbereitschaft sich mit dem Leistungsvolumen in ihrer Höhe ändernde Kosten sich nur mit dem Auf- und/oder Abbau der Kapazität bzw. Betriebsbereitschaft ändernde Kosten (zusätzliche Dispositionen aufgrund erwarteter längerfristiger Variation des Leistungsvolumens) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 91 Unterschiedliche Kostenverläufe Kostenverläufe Kostenverläufeje jeEinheit Einheit kv Kostenverläufe Kostenverläufein inSumme Summe Variable (proportionale) Kosten Kv Menge Menge kf Kf fixe Kosten Menge kf Menge Kf sprungfixe Kosten Menge ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Menge 92 Fixe und sprungfixe Kosten “Sachlich und zeitlich genau abgegrenzte Kosten nennt man fix hinsichtlich einer bestimmten Einflussgröße, wenn sich die Kostenhöhe bei Variation dieser Größe innerhalb eines angegebenen Intervalls nicht ändert.” K a) Sprungfixe Kosten b) Fixe Kosten 1 2 3 4 5 ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig X 93 Summe der Kosten Prämisse: Linearisierung des Kostenverlaufs nter a v e srel h g n c eidu nberei h c s ent Koste Anzahl Einheiten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 94 Voraussetzung für die Teilkostenrechnung Wesentliches Merkmal der Teilkostenrechnung ist die Zerlegung der Gesamtkosten in Kostenkategorien (Kostenspaltung, Kostenauflösung). Der Zweck einer solchen Kostenauflösung besteht darin, den einzelnen Endprodukten nur die beschäftigungsproportionalen Kosten anzurechnen, wobei die proportionale Beziehung zwischen Kosten und Beschäftigungsgrad als Rechtfertigung für die Zurechnung gilt. Beschäftigungsfixe Kosten werden als periodenbezogene Größe interpretiert und müssen von den zusammengefaßten Bruttoerfolgen der Endprodukte gedeckt werden, wenn für die Periode zumindest Vollkostendeckung angestrebt wird. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 95 Verfahren der Kostenauflösung Trennung der Kosten in bezug auf eine Kosteneinflußgröße (hier: Beschäftigung) in fixe und variable Bestandteile. 1. 1.Buchtechnische BuchtechnischeKostenauflösung Kostenauflösung 2. 2.“Mathematische” “Mathematische”Kostenauflösung Kostenauflösung 3. 3.“Statistische” “Statistische”Kostenauflösung Kostenauflösung 4. 4.Planmäßige PlanmäßigeKostenauflösung Kostenauflösung Verfahren 1 - 3 gehen von tatsächlich entstandenen Kosten aus. Das planmäßige Verfahren basiert auf einem vorausgeplanten Mengengerüst und Bewertung dieser Faktoreinsatzmengen. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 96 Buchtechnische Kostenauflösung Die buchtechnische Kostenauflösung erfolgt in der Form, daß das Verhalten der einzelnen Kostenarten in Abhängigkeit von der Beschäftigung festgestellt und den Kostenkategorien (fix / variabel / Mischkosten) zugeordnet wird. Der Zuordnung zu den Kostenkategorien liegen meist Erfahrungen der Vergangenheit zugrunde. Mit Hilfe von statistischen Methoden wird versucht, die Ergebnisse des buchtechnischen Verfahrens zu präzisieren. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 97 „Mathematische“ Kostenauflösung Bei der “mathematischen” Kostenauflösung Schmalenbachs werden für zwei oder mehrere Beschäftigungsgrade die jeweils angefallenen Gesamtkosten ermittelt. Die ermittelte Kostendifferenz wird durch die Differenz der Beschäftigung dividiert (lineare Interpolation). Man erhält die variablen Kosten je Einheit, den sog. proportionalen Satz: Kostenzuwachs Proportionaler Satz = Produktmengenzuwachs Schmalenbach unterstellt hierbei einen linearen Kostenverlauf. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 98 „Mathematische“ Kostenauflösung Extremwertmethode höchste Periodenkosten - niedrigste Periodenkosten =variabler Kostensatz höchste Periodenleistung - niedrigste Periodenleistung je Leistungseinheit Schmalenbachmethode Kosten der Periode 1 - Kosten der Periode 2 =variabler Kostensatz Leistung der Periode 1 - Leistung der Periode 2 je Leistungseinheit Kosten der Periode 2 - Kosten der Periode 3 =variabler Kostensatz Leistung der Periode 2 - Leistung der Periode 3 je Leistungseinheit Kosten der Periode 3 - Kosten der Periode 4 variabler Kostensatz = Leistung der Periode 3 - Leistung der Periode 4 je Leistungseinheit Summe der variablen Kosten je Leistungseinheit ∑ variabler Kostensatz = je Leistungseinheit Anzahl derao.Perioden 1 Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 99 „Statistische“ Kostenauflösung Die statistische Kostenauflösung (graphisch und rechnerisch) basiert auf empirischen Informationen über die Höhe der Gesamtkosten, die bei unterschiedlichen Ausbringungsmengen angefallen sind. Die Auflösung der Kosten erfolgt dabei mit Hilfe der “Methode der kleinsten Quadrate” oder ähnlicher statistischer Verfahren, z.B. Regressionsrechnung und linearer Trend. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 100 Kostenspaltung 1 Mathematisch-statistisches Verfahren Als Grundlage für die Kostenspaltung dienen die statistischen Aufschreibungen vergangener Perioden über den Kostengüterverbrauch einer Kostenart. Diesen wird die während der betreffenden Perioden realisierte Beschäftigung - ausgedrückt in Einheiten der zugrundegelegten Einflußgröße - gegenübergestellt. Werden diese Wertepaare aus Kosten- und Beschäftigungswerten in ein Koordinatensystem eingetragen, ergibt sich ein Streupunktdiagramm. Beispiel: Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Beschäftigung (x) in 1.000 Stück 20 10 15 20 25 30 30 25 25 15 10 ______ 15 Kosten (y) in 1.000 35 22 25 30 36 45 50 34 35 28 20 ______ 24 ao. Univ. Prof.∑Dr.240 Werner Mussnig∑ 384 101 „Statistische“ Kostenspaltung 1 a Grafische Lösung Man zeichnet “freihändig” durch das Streupunktdiagramm eine Ausgleichsgerade in der Weise, daß die Summe der Abstände der einzelnen Punkte von der Geraden möglichst gering bleibt. Der Schnittpunkt der Trendgeraden mit der Ordinate gibt die Höhe der fixen Kosten an. Das Steigungsmaß der Trendgeraden spiegelt den Verlauf der variablen Kosten wider. y K K (v) X x X XX X X X X X X K (f) X Je mehr Wertepaare zur Verfügung stehen, um so genauer wird die Lösung (d.h. die Gerade). Obwohl die Wertepaare tatsächlich gemessen sind, sollten eventuelle Extremwerte (“Ausreißer”) unberücksichtigt bleiben. Diese Vorgehensweise ist mit dem Normalcharakter, den die Kosten haben sollen, zu begründen. Allerdings ist dieses Verfahren derart ungenau, daß es keine praktische Relevanz besitzt, schon gar nicht mehr im Zeitalter der EDV. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 102 „Statistische“ Kostenspaltung 1 b Rechnerische Lösung Genauer ist die Errechnung der Trend- bzw. Regressionsgeraden mit Hilfe der Methode der kleinste Quadrate. Die Berechnung erfolgt dabei nach der Formel M n x = Beschäftigung _ x = - Beschäftigung y = Kosten y = - Kosten ( xi - x ) * ( yi - y ) * (x-x) M i=1 y - y = ________________________ n ( xi - x )2 i=1 Für das ergibt _ bereits _genannte Beispiel _ _ sich2 xi - x yi - y ( xi - x ) * ( yi - y ) ( xi - x ) 0 3 0 0 - 10 - 10 100 100 - 5 -7 35 25 0 -2 0 0 5 4 20 25 10 13 130 100 10 18 180 100 5 2 10 25 5 3 15 25 -5 -4 20 25 - 10 - 12 120 100 -5 -8 40 25 0 0 670 550 x = y = y = 20 32 670 y - 32 = _______ * ( x - 20 ) 550 y = 1,22x - 24,4 + 32 7,6 + 1,22x Fixkosten : 7.600 variable Kosten : 1,22x ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 103 Planmäßige Kostenauflösung Bei der planmäßigen Kostenauflösung, die auch analytische Kostenplanung oder “engineering approach” genannt wird, werden das Mengengerüst der Kosten und der Wertansatz geplant. a) Variator Dieser beschreibt die Reagibilität einer Kostenart, d.h. das Verhältnis der variablen Kosten zu den Gesamtkosten. (v=O: Kosten sind fix; v=10: Kosten sind variabel v=7: 70% der Kosten sind variabel) b) Planung in absoluten Zahlen Größere Genauigkeit in der Praxis, da: - Zwischenwerte möglich sind - Nicht die Gefahr der “einfachen” Übernahme ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 104 Kapitel 7 os K r e d e m e Syst ng u n h c tenre ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 105 Einteilung der Kostenrechnungssysteme 1. Gliederung nach dem Sachumfang Vollkostenrechnung Istkostenrechnung Teilkostenrechnung Normalkostenrechnung Plankostenrechnung 2. Gliederung nach dem Zeitbezug ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 106 Das Prinzip der Vollkostenrechnung Produkt A Preis Kosten je Stück Gewinn je Stück Menge Gewinn je Produkt xxx Produkt B Produkt C xxx xxx Produkt D Produkt E xxx xxx Ergebnis (Gewinn/Verlust) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 107 Das Prinzip der Teilkostenrechnung (Deckungsbeitragsrechnung) Produkt A Preis Variable Kosten je Stück Deckungsbeitrag je Stück Menge Summe Deckungsbeitrag je Produkt xxx Produkt B Produkt C xxx xxx Produkt D Produkt E xxx xxx Summe Deckungsbeitrag aller Produkte Fixe Kosten Ergebnis (Gewinn/Verlust) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 108 Vollkostenrechnungssysteme In Systemen der Vollkostenrechnung werden sämtliche Kostenarten vollständig auf die Endprodukteinheiten weiterverrechnet, und zwar zum Teil direkt (als Einzelkosten) und zum Teil indirekt (als zugeschlüsselte Gemeinkosten). Wegen dieser umfassenden Weiterwälzung der Kosten nennt man die Vollkostenrechnung auch Kostenüberwälzungsrechnung. In der Betriebsergebnisrechnung werden den Leistungen die vollen Kosten gegenübergestellt. Die aus dieser Saldierung hervorgehende Differenz ist als Nettoergebnis zu bezeichnen. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 109 Vorteile der Vollkostenrechnung Entscheidungshilfe für die Preisfindung bei Produkten und Leistungen ohne Marktpreis oder öffentlichen Aufträgen (LSÖ, LSP) Ermittlung von innerbetrieblichen Verrechnungspreisen Ermittlung des Stück-/Auftragsgewinnes ist rechnerisch möglich Bilanzielle Vorschriften (Bewertung von Halb- und Fertigfabrikaten) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 110 Nachteile der Vollkostenrechnung Keine Information über die kurzfristige Preisuntergrenze (insbesondere bei Unterbeschäftigung / Leerkapazitäten) Proportionalisierung der fixen Kosten (Fixe Kosten werden wie variable Kosten behandelt) Periodisierung der fixen Kosten durch Lagerbewertung zu vollen Herstellkosten Manipulation der Gewinnhöhe durch Wahl der Zuschlagsbasis Falsche Entscheidung über Zusatzaufträge “Kalkulieren aus dem Markt” bei fallender Auslastung und/oder stark steigenden Einzelkosten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 111 Das alte Denken im Verkäufermarkt: Cost Plus Kosten + Kosten + Kosten + Gewinnzuschlag = Preis Fazit: • Die Kosten sind „vorgegeben“ (Einzel- und Gemeinkosten) • Der Gewinnzuschlag ist „fix“ • Der Preis ist das Ergebnis der Kalkulation, er ist die „variable, abhängige“ Größe • Der Kunde muss bezahlen, was das Produkt „wert“ ist, d.h. was es gekostet hat! ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 112 Problem der “Cost-plus”-Preisermittlung der VKR bei rückläufiger Beschäftigung Kosten Preise Selbstkosten Cost-plus Preise P4 Grundaufbau der traditionellen Kalkulation von “Cost-plus”Preisen proportionale Kosten als Basis der jeweiligen IstBeschäftigung kalkulierte (“anteilige”) fixe Kosten P3 prozentualer Gewinnzuschlag Cost-plus-Gewinnzuschlags-Preis P2 P1 B4 B2 Mussnig B1 ao. Univ. B3 Prof. Dr. Werner Beschäftigung 113 Fixe Kosten je Stück fixe Kosten: z.B. Anzahl Betten Auslastung 20000000 100 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 10,00% 25,00% 50,00% 100,00% 110,00% 120,00% 1 2 3 4 5 10 25 50 100 110 120 20.000.000 10.000.000 6.666.667 5.000.000 4.000.000 2.000.000 800.000 400.000 200.000 181.818 166.667 kf Fixkostenprogression Fixkostendegression ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 114 Auslastung Fixkostenprogression und –degression in der Teilkostenrechnung Planmenge: 1000 Stück Vollkostenrechnung Teilkostenrechnung pro Stück 100 in Summe 100.000 volle Kosten 70 70.000 Ergebnis 30 30.000 Preis pro Stück Preis variable Kosten Deckungsbeitrag fixe Kosten Ergebnis 100 40 60 30 30 in Summe 100.000 40.000 60.000 30.000 30.000 100 40 60 15 45 in Summe 200.000 80.000 120.000 30.000 90.000 Istmenge: 2000 Stück Vollkostenrechnung Teilkostenrechnung pro Stück 100 in Summe 200.000 volle Kosten 70 140.000 Ergebnis 30 60.000 Preis pro Stück Preis variable Kosten Deckungsbeitrag fixe Kosten Ergebnis Istmenge: 500 Stück Vollkostenrechnung Teilkostenrechnung pro Stück 100 in Summe 100.000 volle Kosten 70 35.000 Ergebnis 30 Preis ao.15.000 Univ. pro Stück Preis variable Kosten Deckungsbeitrag fixe Kosten Ergebnis Prof. Dr. Werner 100 40 60 60 Mussnig 0 in Summe 50.000 20.000 30.000 30.000 0 115 Voll- vs. Teilkostenrechnung Kosten ) (TK n e st e Ko l l o v ll vo ste o eK fixe Kosten ) VK ( n Menge ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 116 Abweichung der Voll- und Teilkosten nach der jeweiligen Beschäftigungslage Kosten ) (TK n e st e Ko l l o v ) VK ( ten s o eK l l vo fixe Kosten Menge ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 117 Proportionalisierung der fixen Kosten Kosten Überschätzung des Kostenanstiegs Überschätzung des Kostenrückgangs Menge ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 118 Fehleinschätzung der Ertragslage Erlöse Kosten kumulierte Gewinne prognostizierter Gesamtkostenverlauf (VK) unbekannter, realistischer Gesamtkostenverlauf (TK) Break Even Menge in der Verlustzone falsch Angenommener Gewinn) überschätzter Gewinn ao. Univ. Prof. Dr. unterschätzter Gewinn Werner Mussnig 119 Deckungsbeitragsrechnung Traditionelle Vollkostenrechnung: Stückkosten (k) = variable Kosten/Stück (kv) + anteilige Fixkosten/Stück (kf) Stückpreis (p) = Stückkosten (k) + Stückgewinn (g) Problem der Preiskalkulation zu Vollkosten: “Kalkulation aus dem Markt hinaus” Deckungsbeitragsrechnung: Deckungsbeitrag einer Produkteinheit (db) = Preis (p) - zugerechnete Teilkosten (kv) Bei den zugerechneten Teilkosten kann es sich u.a. um folgende Kosten handeln: - Einzelkosten der Erzeugniseinheit (typische DB-Rechnung im Handel) - variable Stückkosten der Erzeugniseinheit (typische DB-Rechnung in der Industrie ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 120 Deckungsbeitragsrechnung Stückdeckungsbeitrag: db = p - kv Deckungsbeitrag (db) Preis einer Leistungseinheit (p) Verwendung variable Kosten der Leistungseinheit (kv) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Fixkostendeckung Gewinnerzielung 121 Deckungsbeitragsrechnung (Direct Costing) Berechnungsschema: Preis Preis//Stück Stück --var. Stückvar.Stückselbstkosten Stückselbstkosten betrachtung Deckungsbeitrag Deckungsbeitrag(DB) (DB)//Stück Stück ∑∑ DB DBi i**xxi i --fixe fixeKosten Kosten GesamtPeriodengewinn betrachtung Periodengewinn Deckungsbeitrag = Jeder Deckungsbeitrag über der Gewinnschwelle bedeutet einen Gewinn in der Höhe dieses Deckungsbeitrags, jeder Deckungsbeitrag darunter einen Verlust in der Höhe des DB. Beitrag zur Deckung der gesamten fixen Kosten. Ist die Summe der Deckungsbeiträge gleich der Höhe der gesamten Fixkosten, erreicht das Unternehmen die Gewinnschwelle. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 122 Das alte Denken im Übergangsmarkt: Der Deckungsbeitrag entscheidet Preis - variable Kosten = Deckungsbeitrag Deckungsbeitrag - fixe (Gemein-)Kosten = (hoffentlich) Gewinn Fazit: • Die Preise sind vom Markt her vorgegeben • Die variablen Kosten werden zu Lasten der steigenden Gemeinkosten optimiert • Auf den fixen (Gemein-)Kosten sitzt man fest, ihre Notwendigkeit ist undurchschaubar • Der Gewinn ist das Ergebnis, er ist die „variable, abhängige“ Größe, und hoffentlich am Jahresende da • Hauptsache, man hat noch einen Deckungsbeitrag! ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 123 Vorteile der Teilkostenrechnung Keine Schlüsselung der fixen Kosten Periodengerechte Zurechnung der fixen Kosten Ermittlung der kurzfristigen Preisuntergrenze Auswirkungen von Auslastungsänderungen sind ersichtlich und Berechnungen sind korrekt Auswirkungen von Entscheidungen sind ersichtlich Berechnung des Break-Even-Point ist möglich Einblick in die Gewinnstruktur (flexibel auswertbar) kalkulatorisch richtige Behandlung von Zusatzkosten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 124 Nachteile der Teilkostenrechnung Größerer Aufwand (Belege, Datenerfassung, EDV) Kein Stück- oder Auftragsgewinn “rechnerisch” zu ermitteln Preisdifferenzierung möglich, ABER: Gefahr, dass solche Sonderpreise auf das Grundgeschäft durchschlagen (Markttransparenz, Verhandlungsmacht der Kunden, Wettbewerb) In gesättigten Märkten mit freien Kapazitäten verleitet die TKR zur Preispositionierung an der kurzfristigen Preisuntergrenze, wodurch ein ruinöser Wettbewerb entstehen kann. In der Praxis kommt es häufig zu Umsatzmaximierung statt Gewinnmaximierung Bei steigenden Fixkosten kommt es im Rahmen der Teilkostenrechnung zu einem “black-box”-Syndrom Fixkosten dürfen nicht auf Dauer als fix angesehen werden, da sie in der Realität abbaubar sind ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 125 Disponierbarkeit von Fixkosten Beschäftigungsfixe Kosten sind hinsichtlich etwaiger Beschäftigungsschwankungen unveränderlich. Diese Kosten sind jedoch mittel- bis langfristig über den Aufbau oder Abbau der Kapazität oder der Betriebsbereitschaft in ihrer Höhe zu beeinflussen. Grenzen der Disponierbarkeit von Fixkosten Fixkosten lassen sich nur sprunghaft verändern, da ihre Höhe von der Teilbarkeit der sie verursachenden Potentiale abhängt. In Abhängigkeit von der jeweiligen Bindungsdauer der Potentiale sind Fixkosten nur in bestimmten zeitlichen Intervallen zu verändern. Da die erforderliche Kapazitätsveränderung oftmals nur bei Einhaltung vorgegebener Kündigungsfristen möglich ist, sind Fixkosten oft nur zu bestimmten Terminen zu verändern. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 126 Kostenremanenz (Kostenresistenz) Beschreibt die zeitliche Verzögerung der Kostenänderung auf geänderte Beschäftigungslagen. Problematisch bei sinkender Auftragslage: die Leistung paßt sich der Marktsituation an, die Kostenhöhe bleibt bei einigen Kostenarten unverändert (oder ändert sich erst mit zeitlicher Verzögerung). Kostenremanenz Kostenremanenzbei bei variablen Kosten variablen Kosten Kostenremanenz Kostenremanenzbei bei sprungfixen sprungfixenKosten Kosten Kosten Kosten K sprungfix K variabel 0 Beschäftigung ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Beschäftigung 127 Hauptursachen der Kostenremanenz 1. Rechtliche Ursachen (z.B. Kündigungsfristen) 2. Politische Ursachen (wie nicht durchsetzbare Entlassungen) 3. Soziale Ursachen (Rücksichtnahme auf Belegschaft) 4. Prestigemäßige Ursachen (Imagepflege vor Kostensenkung) 5. Unternehmenspolitische Ursachen (Vermeidung von Kosten der Wiederingangsetzung) 6. Organisatorische Ursachen (Interdependenzen verhindern den Abbau) 7. Technische Ursachen (technische Schwierigkeiten bei der Eindämmung und Steigerung) 8. Marktmäßige Ursachen (freizusetzende Anlagen sind unverkäuflich) 9. 10. Psychologische Ursachen (“Arbeitsstreckung”, Erwartungen) Informatorische Ursachen (Informationsdefizite) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 128 Kapitel 8 . w z b ung n h c re s ng g u l n o h f er ec r n s e g d l o fo ri r e E P e e ) tig Di s R i r D f F z . Kur (inkl ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 129 Kurzfristige Erfolgsrechnung Gesamtkostenverfahren zu Vollkosten Volle HSK der produzierten Stück Umsatz volle Vertriebskosten der abgesetzten Stk. volle HSK der abgesetzten Stück Umsatz volle Vertriebskosten der abgesetzten Stück Bestandsverringerung Bestandserhöhung Gewinn (Verlust) Gesamtkostenverfahren zu Teilkosten Var. HSK der produzierten Stück Umsatzkostenverfahren zu Vollkosten Gewinn (Verlust) Umsatzkostenverfahren zu Teilkosten Umsatz var. HSK der abgesetzten Stück var. Vertriebskosten der abgesetzten Stk. Umsatz var. Vertriebskosten der abgesetzten Stück gesamte fixe Kosten gesamte fixe Kosten Bestandsverringerung Bestandserhöhung Gewinn Gewinn (Verlust) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig (Verlust) 130 Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER) nach dem Gesamtkostenverfahren (GKV) produktionsorientiert Wird auch als kostenartenorientierte Betriebsergebnisrechnung bezeichnet. Das Gesamtkostenverfahren entspricht in seinem formalen Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung (materieller Unterschied zur GuV: Erträge Leistungen; Aufwendungen - Kosten). Die Leistungen setzen sich hierbei aus den Umsatzerlösen und den bewerteten Lagerbestandsveränderungen an Halb- und Fertigfabrikaten zusammen. Vorteile: einfache Handhabung bei der Erstellung der KER Möglichkeit die GuV mit geringem Arbeitsaufwand aus der kurzfristigen Erfolgsrechnung zu erstellen. Nachteile: Einfluss einzelner Produktarten auf das Ergebnis ist nicht ersichtlich, daher können keine Erkenntnisse für die Sortimentsplanung und Absatzsteuerung gewonnen werden. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 131 Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER) nach dem Umsatzkostenverfahren (UKV) umsatz- oder absatzorientiert Das Umsatzkostenverfahren gliedert die Kosten der abgesetzten Leistungseinheiten nach Produktarten (Kostenträgern) - kostenträgerorientierte Betriebsergebnisrechnung. Das Umsatzkostenverfahren verzichtet auf die Erfassung der Bestandsveränderungen an Halb- und Fertigfabrikaten. Als Leistungen werden nur Erlöse erfasst, an Stelle der Kosten der produzierten Erzeugnisse treten die Kosten der abgesetzten Erzeugnisse. Vorteile: bessere Möglichkeiten zur Analyse der betrieblichen Verhältnisse. Informationen für Absatz- und Sortimentsentscheidungen. Unternehmen ohne Kostenstellen- und -trägerrechnung können das Betriebsergebnis auch ohne Inventur ermitteln. Nachteile: Das Umsatzkostenverfahren ist aufgrund der Genauigkeit aufwendiger als das Gesamtkostenverfahren. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 132 Gesamtkostenverfahren Gesamtkosten K = 1.000,- Euro Absatzmenge davon Vertriebskosten VK = 25% Anfangsbestand Preis p = 10,- Euro Endbestand xa = 125 Stück AB = 0 EB = 25 Betriebsergebnis 1) In der Periode entstandene Gesamtkosten 3) In der Periode abgesetzte Güter (= Erlöse) 1.000,2) Herstellkosten der Bestandsminderungen an Halb- und Fertigerzeugnissen -Gewinn 1.250,4) Herstellkosten der Bestandsmehrungen an Halb- und Fertigerzeugnissen 375,- 125,- 1.375,- 1.375,- ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 133 Umsatzkostenverfahren Gesamtkosten davon Vertriebskosten Preis K = 1.000,- EuroAbsatzmenge VK = 25% Anfangsbestand p = 10,- Euro Endbestand xa = 125 Stück AB = 0 EB = 25 Betriebsergebnis 1) Herstellkosten der abgesetzten Güter 3) In der Periode abgesetzte Güter (= Erlöse) 625,- 1.250,- 2) Vertriebskosten der Periode Gewinn 250,- 375,1.250,ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 1.250,134 Von der DB-Rechnung zur Stufenweisen FDR 1. Stufe: Die Die“klassische” “klassische”(einstufige) (einstufige)Deckungsbeitragsrechnung Deckungsbeitragsrechnungübernimmt übernimmt die diefixen fixenKosten Kostenals alsungeteilten ungeteiltenBlock Blockaus ausden denKostenstellenrechnungen Kostenstellenrechnungeninin die diePeriodenerfolgsrechnung, Periodenerfolgsrechnung,die dieDeckungsbeiträge Deckungsbeiträgewerden werdennur nurauf aufder der Ebene der Produkte bzw. Produktarten berechnet. Ebene der Produkte bzw. Produktarten berechnet. Black-box-Syndrom 2. Stufe: Die DieZweistufige ZweistufigeDeckungsbeitragsrechnung Deckungsbeitragsrechnungtrennt trenntden denFixkostenblock Fixkostenblock ininzwei Gruppen, (1) allgemeine Unternehmensfixkosten (overheads) zwei Gruppen, (1) allgemeine Unternehmensfixkosten (overheads)und und (2) (2)spezielle spezielleFixkosten Fixkostender dereinzelnen einzelnenProduktgruppen Produktgruppenoder oderBetriebe. Betriebe. 3. Stufe: Die Diestufenweise stufenweiseFixkostendeckungsrechnung Fixkostendeckungsrechnung(Agthe) (Agthe)teilt teiltden denFixFixkostenblock kostenblocknach nacheiner einerMittel-Zweck-Beziehung Mittel-Zweck-Beziehungininfolgende folgendefünf fünfBereiche: Bereiche: (1) Erzeugnisartenfixkosten (1) Erzeugnisartenfixkosten (2) Erzeugnisgruppenfixkosten (2) Erzeugnisgruppenfixkosten (3) (Kostenstellenfixkosten) (3) (Kostenstellenfixkosten) (4) Bereichsfixkosten (4) Bereichsfixkostenund und (5) Unternehmensfixkosten (5) ao. Univ. Unternehmensfixkosten Prof. Dr. Werner Mussnig 135 Fixkostendeckungsrechnung (Agthe) Die Verrechnung der Fixkosten wird von der Zurechenbarkeit zu bestimmten Erzeugnisarten oder Erzeugnisgruppen festgelegt. Bei der differenzierten Fixkostendeckungsrechnung werden folgende Arten von Fixkosten unterschieden: 1. Erzeugnisfixkosten 2. Erzeugnisgruppenfixkosten (3. Kostenstellenfixkosten) 4. Bereichsfixkosten 5. Unternehmungsfixkosten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 136 Vorteile der stufenweisen Fixkostendeckungsrechnung Die Fixkosten werden auf jener Hierarchieebene zugerechnet, wo dies ohne Schlüsselung möglich ist. Die Frage lautet: “Fallen diese Fixkosten in Summe weg, wenn dieser Teilbereich wegfällt?” ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 137 Vorgehensweise der Stufenweisen FDR Produktarten 1 Umsatzerlöse 100 - var. Kosten der abgesetzten Menge 80 DB I - Produktartenfixkosten 20 DB II - Produktgruppenfixkosten 20 DB III - KST-Fixkosten 2 3 4 5 6 7 8 210 160 360 420 260 310 190 140 110 230 310 205 130 80 70 50 130 110 55 180 110 30 10 40 20 70 40 40 40 90 90 110 70 50 25 10 65 105 90 20 35 DB IV - Bereichsfixkosten 80 20 DB V - Fixkosten des Gesamtbetriebes 60 Betriebsergebnis 55 100 70 55 70 115 35 150 130 80 ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 138 Kapitel 9 r Die B en v E eak e s y l a An ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 139 Break-Even-Analyse Ermittlung der Absatzmenge (des Umsatzwertes), die (der) erreicht werden muss, um Gewinne realisieren zu können. Die Break-Evenanalyse wird oft auch als Gewinnschwellenanalyse bezeichnet. Der DerBreak-Even-Point Break-Even-Point(BEP) (BEP)ist istjener jenerPunkt Punkt(Umsatzniveau (Umsatzniveauoder oder Mengeneinheiten), bei dem gilt: Mengeneinheiten), bei dem gilt: •• •• •• •• Gesamterlös Gesamterlös==Gesamtkosten Gesamtkosten Übergang von der Übergang von derVerlustVerlust-inindie dieGewinnzone Gewinnzone Gewinn Gewinn==00 jener jenerUmsatzwert, Umsatzwert,bei beidem demdie diebisher bishererlösten erlösten Deckungsbeiträge gerade ausreichen, Deckungsbeiträge gerade ausreichen,die dieGesamtGesamtfixkosten der Unternehmung zu decken; jeder fixkosten der Unternehmung zu decken; jeder zusätzliche zusätzlicheUmsatz Umsatzbringt bringteinen einenGewinn GewinnininHöhe Höhe des desvollen vollenDeckungsbeitrages. Deckungsbeitrages. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 140 Darstellungsformen der Break-Even-Analyse I Erlöse Kosten Break-Even-Point Break-Even-Point sten o k t m a Ges Gewinn variable Kosten t s u l Ver fixe Kosten öse l r E Menge / Umsatz ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 141 Kosten, Erlöse Prinzip der Break-Even-Analyse Break Even Point inn w Ge fixe Kosten n de n Ku en m e Kost d = ( e kte e) f ix c e t ed hne ust g l t c ich erre Ver n = ch erv 3 no weit 2 6 5 4 n de n Ku sten m e e Ko d = ( fix kte ete) c e ed echn g ts rr rei erve e b eit w 1 aktueller Beitrag einer Einheit zur Deckung der fixen Kosten Menge bereits realisierter Beitrag zur Deckung der fixen Kosten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 142 Darstellungsformen der Break-EvenAnalyse II fixe Kosten Deckungsbeitrag Break-Even-Point Break-Even-Point Gewinn fixe Kosten fixe Kosten Verlust nie i l s g eitra b s g un Deck 0 G+ Menge / Umsatz fixe Kosten Deckungsbeitrag fixe Kosten Gewinn V- Menge / Umsatz Verlust Dec slinie g a r t sbei kung Break-Even-Point Break-Even-Point ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 143 Break Even Analyse fixe Kosten DB Kosten Umsatz fixe Kosten fixe Kosten DB Kosten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 144 Umsatz DBU als Verhältniszahl von DB zu Umsatz DB K fix DB Produkt D DB Produkt C DB Produkt B DB Produkt A Umsatz Produkt A Umsatz Produkt B Umsatz Produkt C ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Umsatz Produkt D Umsatz 145 Mengengewichteter DBU DB K fix Produkt D u P r od Pr Pr tA k u od B kt u od me ng ic ew g en c De e t ht e kt C g kun sbe ie slin g a itr Umsatz ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 146 DB, Erlöse Break-Even-Analyse bei mehreren Produkten kt C odu r P rag Bei t fixe Kosten Pr od uk Be i tr ag fixe Kosten tA Verlustzone 0 duk t D Beit rag Pro ag i tr e B t uk d Pro Gewinnzone B DBU = inie ag l s g r itra r Bei t e b ngs ttliche u k i c De hschn c dur Break-Even Umsatz erreichter Umsatz Sicherheitskoeffizient ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 147 Abweichungen in der Break-Even-Analyse Kosten, Erlöse Menge 1 n oste K . r va 4 2 3 fixe Kosten öse l r E 5 Menge Planwerte Istwerte ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 148 Break Even und Fixkostenerhöhung DB Kosten 1250 + 25 % 1000 2000 + 25 % ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 2500 Menge 149 Break Even und Anstieg der var. Kosten + 23 % DB Kosten 1000 2000 + 30 % ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 2600 Menge 150 Break Even und Preissenkung - 10 % DB Kosten 1000 2000 2500 + 25 % ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Menge 151 Break Even und kum. Abweichungseffekte Fixkostenwirkung + 25 % DB Kosten Wirkung var. K. + 30 % Preiswirkung + 25 % - 10 % + 23 % + 80 % 1250 + 25 % 1000 ao. Univ. 2000 Prof. Dr. Werner Mussnig + 120 % 4400 Menge 152 Deckungsbeitrag Break-Even-Point fixe Kosten fixe Kosten fixe Kosten Deckungsbeitrag Break-Even-Analyse und Risikobeurteilung D ec e sl i ni i trag e b s k ung Break - EvenUmsatz Ist Umsatz Ist - Umsatz Mindest - Umsatz = absoluter Sicherheitsabstand Ist - Umsatz = relativer Sicherheitsabstand in % SA = Umsatz - Break-Even-Umsatz Umsatz ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 153 Kostenauflösung im Rahmen der Break Even Analyse auf Basis der GuV Materialaufwand Wareneinsatz Fremdleistungen variable Kosten variable Kosten Personalaufwendungen Löhne Gehälter Aufwand für Abfertigungen, Pensionen Aufwand für gesetzliche Sozialabgaben sonstige Sozialaufwendungen variable Kosten (ev. fix) fixe Kosten keine Kosten (LNK) LNK (Variator von Basis abh.) Mischkosten sofern freiwillig - kein Kostencharakter Abschreibungen Abschreibungen Geringwertige Wirtschaftsgüter fixe Kosten fixe Kosten (ev. keine Kosten) sonstige betriebliche Aufwendungen Strom, Wasser Beheizung Instandhaltungen, Reparaturen Treibstoffe variable Kosten fixe Kosten Mischkosten (Variator 5) Variator v. Tätigkeit abhängig Versicherungen Reinigungskosten Betriebssteuern Werbung Post, Telefon KFZ-Aufwand sonstige betr. Aufwendungen fixe Kosten fixe Kosten fixe Kosten fixe Kosten fixe Kosten fixe Kosten Mischkosten Finanzaufwand Aufwendungen aus Beteiligungen Abschreibungen auf Finanzwerte Zinsen und ähnliche Aufwendungen keine Kosten keine Kosten fixe Kosten außerordentlicher Aufwand keine Kosten Steuern vom Einkommen und Ertrag Zuweisung zu unversteuerten Rücklagen Zuweisung zu Gewinn-/ Kapitalrücklagen keine Kosten keine Kosten keine Kosten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 154 fixe Kosten Deckungsbeitrag Break-Even-Analyse im Baunebengewerbe geplanter Break-Even-Point Gewinn fixe Kosten e ni i l gs a r eit b s ng u ck De Jän Feb M ärz Apr Mai Jun Juli Auf Sept geplanter Deckungsbeitrag realisierterDeckungsbeitrag ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Okt Nov Dez Menge / Umsatz 155 Break-Even-Analyse im Tourismus Umsatzgrenze max. Umsatz MindestUmsatz max. Gewinn IST-Umsatz Fixe Kosten aktueller Verlust e e i ni l l i ni s z t g a a s i tr sbe g Um n ku D ec Break Even Point VollbelegsVollbelegs tage tage IST MUSS ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Öffnungs- Tage tage (Kapazitätsgrenze) 156 Bewertung von Zusatzaufträgen Ertragssituation bei bereits gedeckten fixen Kosten Kapazit ätsgrenze K K fix DB x ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 157 Bewertung von Zusatzaufträgen bei unterschiedlicher Ausgangssituation K K K fix K fix DB DB x ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig x 158 Nutzung freier Kapazitäten mit einem Zusatzauftrag DB, Kosten Ausgangssituation DB, Kosten lust Ver Situation nach Annahme des Zusatzauftrages i nn Gew fixe Kosten fixe Kosten inn Gew icher zusätzl n Gewin l us t Ver ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 159 Durchschlagen des Zusatzauftrages auf den Grundpreis DB, Kosten Situation nachdem der Preis des Zusatzauftrages teilweise auf den Grundpreis durchgeschlagen hat. Situation nachdem der Preis des Zusatzauftrages zur Gänze auf den Grundpreis durchgeschlagen hat. DB, Kosten lust Ver fixe Kosten fixe Kosten Gewinn Verlust ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 160 Verluste nicht trotz Umsatzwachstum sondern wegen Umsatzwachstum fixe Kosten DB, Kosten Kapazitäts-Kapazitäts-Kapazitätsgrenze A grenze B grenze C zusätzliche Verlust Verlust Bedingungen: Markttransparenz mit illoyalen Kunden und niedrigen Transportkosten Derselbe Kunde (unterschiedliche Ansprechpartner bzw. Abteilungen) bekommen unterschiedliche Preise Schleichender Verlust der deckungsbeitragsstarken Kunden (durchgestoßene statt angestoßene Rabatte) Die Kunden stehen selbst unter extremem Wettbewerbs- und damit auch Preisdruck Parallelimporte möglich (d.h. der Kunden wird zu meinem eigenen Konkurrenten) Scharfer Kampf um Marktführerposition („Kampf der Platzhirsche“) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 161 Zinsen auf EK fixe Kosten (Kostendeckung) ausgabewirksame fixe Kosten AfA Maximalverlust Zielgewinn Alternative Zielpunkte in der Break Even Analyse Deficit Point Cash Point Break Even Point EVA Point ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Target Point 162 Kostencharakter (1) fixe Kosten Summe der Kosten Summe der Kosten variable Kosten Anzahl Einheiten Kosten pro Einheit Kosten pro Einheit Anzahl Einheiten Anzahl Einheiten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Anzahl Einheiten 163 Aufbau von Markteintrittsbarrieren mittels der Fixkostendegression Verkaufspreis a Verkaufspreis b Verkaufspreis c volle Kosten je Stück var. Kosten je Stück Break Even A Break Even B Break Even C ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 164 Kostencharakter (2) sprungfixe Kosten Summe der Kosten Summe der Kosten fixe Kosten Anzahl Einheiten Kosten pro Einheit Kosten pro Einheit Anzahl Einheiten Anzahl Einheiten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 165 Anzahl Einheiten Auswirkungen der Fixkostenprogression in schrumpfenden Märkten Verkaufspreis a Verkaufspreis b Verkaufspreis c volle Kosten je Stück var. Kosten je Stück ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 166 Kosten, Verkaufspreis Kostenstruktur und Auslastung volle Kosten je Flug-km volle Kosten je Flug-km var. Kosten je Flug-km var. Kosten je Flug-km Menge Flug-km/Flüge ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 167 Kapitel 10 Di n e z n e gr r e t n i su e r P e ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 168 Unternehmensziele und Preispolitik Unternehmensziele Erhaltung der Liquidität Erzielung von Gewinn Aufbau von Erfolgspotenzialen absatzwirtschaftliche Ziele produktionswirtschaftliche Ziele • Steigerung der Absatzmenge • Steigerung des Umsatzes • Gewinn von Marktanteilen • Erhöhung der Kundenanzahl • Erhöhung des Stammkundenanteils • Aufbau eines Preisimagesv • Erreichen einer Kapazitätsauslastung • Erzielen der Fixkostendegression • Sicherstellung der Refinanzierung • Erzielen von Lernkurveneffekten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig finanzwirtschaftliche Ziele • Erhöhung des Cash Flow • Erhaltung der Substanz • Ausweis eines hohen Kapitalwertes • Erzielung eines bestimmten Shareholder Values • Sicherstellung einer kurzen • Amortisationszeit (Early Cash Return) 169 Marktpreise und Preispositionierung Wert / Kundennutzen Positionierungsfeld potenzieller Preise absolute Preisobergrenze Preispositionierung der Konkurrenten langfristige Preisuntergrenze Absolute, kurzfristige Preisuntergrenze variable Kosten • persönliche Kundenbindung • Zusatznutzen • Grundnutzen volle Selbstkosten • bei Vollauslastung ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig• bei Unterauslastung 170 Bestimmungsparameter des Verkaufspreises Unternehmens ziele - Marktpreise Ziele der Preispolitik Preiselastizität der Kunden Marketing strategien Staatliche Preisregelung Nachfrage Nachfrage- -// verkaufsprognose Verkaufsprognose Kostenberechnung Preispolitik Preispositionierung Verkaufspreise Konkurrenzangebot Verhandlungen mit den Kunden ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 171 Taktische- und strategische Preispolitik Gesamtkosten Gesamtkosten Variable Kosten variable Kosten Fixe Kosten fixe Kosten ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig Preisuntergrenze „ taktische Preispolitik“ taktische Preispolitik“ langfristige Preisuntergrenze absolute / kurzfr . Gesamterlös Gesamterlös „strategische „strategische Preispolitik“ Preispolitik“ 172 Kurz- und langfristige Preisuntergrenzen Preisuntergrenzen kurzfristiger Entscheidungshorizont langfristiger Entscheidungshorizont Unterbeschäftigung variable Kosten DB = 0 volle Selbstkosten Vollbeschäftigung variable Kosten + Opportunitätskosten volle Selbstkosten + Opportunitätskosten Opportunitätskostenprinzip: Kurzfristige Preisuntergrenze: entgangener DB (in der Teilkostenrechnung) bzw. entgangener Gewinn (in der Vollkostenrechung) einer nicht gewählten Alternative. In der Praxis zeitweise unterschritten, z.B. bei Sortimentsverbünden, Erlösinterdependenzen im PLZ, kalkulatorischen Ausgleich, Anbahnungsgeschäften, verderbliche Produkte, etc. ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 173 Sortimentspolitische Kompensation taktischer Preisaktionen (kalkulatorischer Ausgleich) Preis Stückgewinn Stückdeckungsbeitrag Kompensationsbereich Subventionsbereich ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 174 Kurz-, mittel- und langfristige Preisuntergrenzen Preis untergrenzen kurzfristiger Entscheidungs horizont Unterbesch äftigung beschäftigung variable Kosten DB = 0 Voll besch äftigung beschäftigung variable Kosten + Opportunit Opportunitätskosten mittelfristiger Entscheidungs horizont variable Kosten + ausgabewirksame fixe Kosten volle Selbstkosten + ausgabew . fixe Kosten + Opportunitätskosten Opportunit ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig langfristiger Entscheidungs horizont volle Selbst kosten volle Selbstkosten + Opportunit Opportunitätskosten 175 Zeitliche Kompensation taktischer Preisaktionen K o m p e n s a t i o n volle Kosten + Gewinn volle Kosten t ausgabewirksame Kosten var. Kosten kurzfristig mittelfristig langfristig ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 176 Entscheidungsrelevanz von Kosten kurzfristig entscheidungsrelevante Kosten mit den laufenden Entscheidungen beeinflussbare Kosten variable bzw. proportionale Kosten (Grenzkosten) mit den laufenden Entscheidungen nur zu bestimmten Zeitpunkten beeinflussbare Kosten sprungfixe bzw. Intervallfixe Kosten kurzfristig entscheidungsirrelevante Kosten von den laufenden Entscheidungen unabhängige, aber in der Höhe beeinflussbare fixe Kosten ausgabewirksame fixe Kosten von den laufenden Entscheidungen unabhängige fixe Kosten absolut fixe Kosten „sunk costs“ TeilKORE GrenzKORE FDR VollKORE ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 177 Preisgrenzen und Rationalisierungsprojekte Kundennutzen absolute Preisobergrenze persönliche Kundenbindung erfolglose Rationalisierungsstrategie erfolgreiche Rationalisierungsstrategie Zusatznutzen volle Kosten langfristige Preisuntergrenze variable Kosten absolute (kurzfr.) Preisuntergrenze Grundnutzen ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 178 Kapitel 11 m m a r g spro Das on i t k u od r P e l a m i t op ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 179 Optimales Produktionsprogramm Es werden 3 Entscheidungssituationen unterschieden, bei denen eine spezielle Methode zur Ermittlung des optimalen Produktionsprogramms eingesetzt wird: 1.1.Es Esliegt liegtkein keinEngpass Engpassvor vor Entscheidungsfindung: Entscheidungsfindung: Alle AlleAufträge Aufträgemit mitabsolutem absolutempositivem positivem Deckungsbeitrag Deckungsbeitragwerden werdendurchgeführt durchgeführt 2.2.Es Esliegt liegtnur nurein einEngpass Engpassvor vor Entscheidungsfindung: Entscheidungsfindung: Relativer Relativer(engpassbezogener, (engpassbezogener,spezifischer) spezifischer)DB: DB: Stückdeckungsbeitrag / beanspruchte Engpasseinheit Stückdeckungsbeitrag / beanspruchte Engpasseinheit 3.3.Es Esliegen liegenmehrere mehrereEngpässe Engpässevor vor Entscheidungsfindung: Entscheidungsfindung: Lineare LineareOptimierung Optimierung ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 180 Produktionsprogrammplanung ohne Engpass (Fall A) Preis (Euro/Stück) Proportionale Kosten (Euro/Stück) Zierleisten 10,-11,-- Balken Bretter Leisten 14,-- 12,-- 8,-- 7,-- 16,-9,-- Deckungsbeitrag (DB) (Euro/Stück) mit einem Engpass (Fall B): Maschinenbelastung (h/Stück) Hobelmaschine mit 600 h/Q. 0,3 0,2 0,15 0,1 800 1.000 1.400 2.400 Engpassbezogener DB (Euro/h) Soll-Absatz (Stück/Quartal) ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 181 Vorgehensweise bei der Ermittlung des optimalen Produktionsprogramms Produkt Menge DB/ prod. abges. Stück Engpassbelastung 1 2 DB/ EE Ranking 3 5 Kapaz.bedarf 4 6 Restkapazität ∑ DB A B C D E F G H ∑Kapaz. 1 2 3 4+5 6 ∑ DB - Kf = Betriebsergebnis Ermittlung des Deckungsbeitrags / Engpasseinheit für alle Produkte Ranking nach Höhe des relativen Deckungsbeitrags (DB/EE) Abgleichung des Kapazitätsbedarfs der Produkte mit der vorhandenen Kapazität des Engpasses Ermittlung der Restkapazität nach jedem Produkt und Abgleichung mit dem Kapazitätsbedarf des folgenden Produkts Ermittlung der Deckungsbeiträge der produzierten Produktstückzahlen ao. Univ. Prof. Dr. Werner Mussnig 182