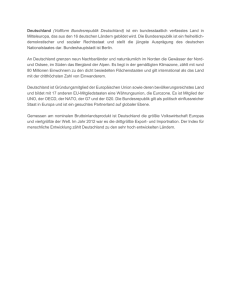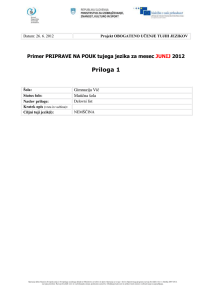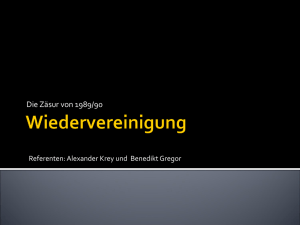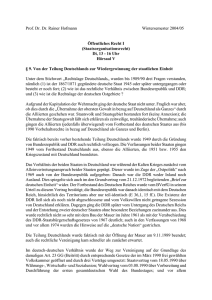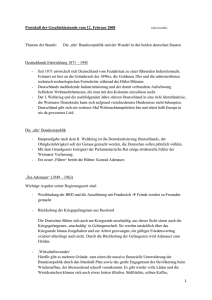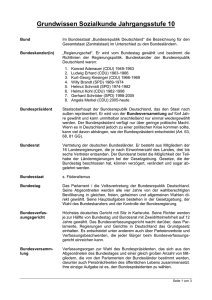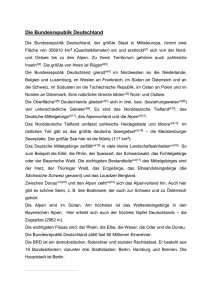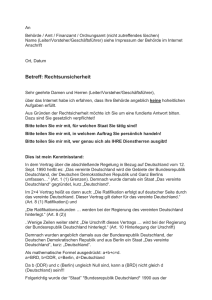Bundesrepublik Deutschland - Geschichte und Perspektiven
Werbung

Bundesrepublik Deutschland - Geschichte und Perspektiven Dieter Thränhardt 23.3.2009 Die Entstehung der Bundesrepublik ist geprägt von der Katastrophe des "Dritten Reiches" und der Auseinandersetzung mit dem sowjetischen Kommunismus. Von den Nachkriegsjahren bis zur deutschen Wiedervereinigung war es ein langer Weg. Bundeskanzler Willy Brandt kniet vor dem Denkmal der Helden des Aufstandes im Warschauer Ghetto nieder. Die Entspannungspolitik der Regierung Brandt führte zur Annäherung an die östlichen Nachbarn der Bundesrepublik. (© AP) 1. Innenpolitische Grundlegung Die Entstehung der Bundesrepublik ist geprägt von der politisch-moralischen und militärischmateriellen Katastrophe des "Dritten Reiches" und der Auseinandersetzung mit dem sowjetischen Kommunismus. In der unmittelbaren Nachkriegszeit bestand auf der Ebene der Besatzungsmächte und der deutschen Politik ein antifaschistischer Konsens unter Einschluss der Kommunisten. Dem Einheitsdenken der unmittelbaren Nachkriegszeit entstammen wesentliche Strukturprinzipien der Parteien- und Verbändelandschaft wie die Einheitsgewerkschaft, der einheitliche Bauernverband, die überkonfessionelle CDU und CSU, die Öffnung der SPD gegenüber neuen Schichten und die Vereinigung der nationalliberalen und linksliberalen Traditionslinien in der FDP. Während der Blockade Berlins durch die Sowjetunion 1948/49 kam ein antikommunistischer Konsens hinzu. Auf dieser Grundlage gingen die Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder auf das Angebot der Westmächte ein, einen Staat aus den Westzonen zu bilden zunächst als Provisorium oder Transitorium (Th. Heuss) bis zu einer gesamtdeutschen Lösung betrachtet. Die so entstandene Bundesrepublik sollte nach der von dem ersten SPDVorsitzenden Kurt Schumacher formulierten "Magnet-Theorie" so attraktiv gemacht werden, dass die Sowjets ihre Zone allein mit militärischer Macht nicht halten könnten. Die breite sozialistische Grundstimmung der Nachkriegszeit, die bis weit in die CDU/CSU hinein reichte, wich in den fünfziger Jahren schrittweise einem Konsens über die Soziale Marktwirtschaft, die von dem ersten Wirtschaftsminister Erhard repräsentiert und vertreten wurde. Die Grundlage dafür war das "Wirtschaftswunder", d.h. die hohen Wachstumsraten seit 1951, die breiten Schichten die Möglichkeit eröffneten, sich einen nie gekannten Wohlstand zu erarbeiten. Nach mehr als drei Jahrzehnten von Kriegen und Krisen brachte die neue stabile Ordnung zum ersten Mal wieder ein Gefühl der Sicherheit und Normalität. Nach anfänglichen Wahlniederlagen von CDU und CSU in Landtagswahlen 1951/52 bildete der Wirtschaftserfolg seit dem "Korea-Boom" bei der zweiten und dritten Bundestagswahl die Grundlage für das "Wahlwunder": 1957 erreichte zum ersten und einzigen Mal eine Partei in freien Wahlen die absolute Mehrheit. Dies schuf die Grundlage für eine hegemoniale Stellung der CDU/CSU in der Bundespolitik. Da in diesen Jahren auch die Ministerien und Verwaltungen aufgebaut wurden, sprachen Kritiker nicht ohne Grund polemisch vom "CDUStaat". Entgegen den liberalen Ideen Erhards blieben Staatseingriffe, Bankenmacht und korporatistische Arrangements in Wirtschaft und Gesellschaft entscheidend (Abelshauser 1983). Eine weitgreifende und undoktrinäre Sozialpolitik bildete wesentliche "Integrationsklammern" (Kleßmann 1988) des neuen Staates. Den zwölf Millionen Ostvertriebenen wurde, finanziert von Vermögensabgaben, ein Lastenausgleich gewährt, der zunächst vor allem in produktive Investitionen floss. Ein Umsiedlungsprogramm erleichterte ihnen den Weg in die Industriezentren. Im sozialen Wohnungsbau errichteten gewerkschaftliche, kirchliche und kommunle Träger mit staatlicher Hilfe Millionen Mietwohnungen. Kriegsopfer erhielten Renten. Wenige Monate vor der Bundestagswahl 1957 wurden die Altersrenten wesentlich erhöht und zugleich an die Einkommensentwicklung gebunden ("dynamisiert"), erst seitdem lagen sie überwiegend über dem Existenzminimum. Die staatliche Umverteilungsquote übertraf in den Gründungsjahren der Bundesrepublik die aller anderen westlichen Länder. Im ständigen Wettbewerb zwischen den beiden großen Parteien bildeten sich stabile Muster des Sozial- und Verteilungsstaates aus, alle Beteiligten gewöhnten sich an wachsende Erträge und staatliche Leistungen. Nach dem Stolz auf die eigene ökonomische Leistung, dem Wirtschaftspatriotismus, entwickelte sich nun der Stolz auf den Sozialstaat, Sozialpatriotismus. 2. Einbindung in westeuropäisch-atlantische Strukturen Schon vor der Gründung der Bundesrepublik waren die westlichen Besatzungszonen in den Marshall-Plan und die auf ihm fußenden europäischen Handelsstrukturen einbezogen worden. In den folgenden Jahren wurde die Politik der Westintegration konsequent weitergeführt, ohne Rücksicht auf die immer rigider werdende Teilung Deutschlands. Dies war der Kern der Außenpolitik des ersten Bundeskanzlers Adenauer. Die Bundesrepublik sollte fest im westeuropäischen und atlantischen Zusammenhang verankert und auf diese Weise sowohl gesichert wie vor nationalistischen Sonderwegen bewahrt werden. Adenauer war bereit, gegenüber dem Westen Vorleistungen zu erbringen und weitreichende Kompromisse zu schließen, um damit Verbesserungen zu erreichen. Mit diesem pragmatischen Vorgehen gelang es ihm, der westeuropäischen Einigung Schubkraft zu geben und die Bundesrepublik als Partner in die europäische und atlantische Staatengemeinschaft zu führen (Europapolitik). Im Petersberger Abkommen 1949 erreichte Adenauer das Ende der westlichen Demontagen. Die Bundesrepublik trat gleichzeitig in die Ruhrbehörde ein und sanktionierte so eine Sonderkontrolle des Kerns der deutschen Industrie. 1952 entstand mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) eine supranationale europäische Struktur, mit der einerseits die deutsche Schwerindustrie kontrolliert wurde, in der aber andererseits die Bundesrepublik als gleichberechtigter Partner mit Frankreich, Italien und den BeneluxStaaten zusammenwirkte. Im Jahr 2002 lief dieser Vertrag aus. Weitergehende europäische Projekte wie die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) und die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), in der deutsche Truppen ohne direkte NATO-Beteiligung aufgestellt werden sollten, scheiterten indes am französischen Widerstand. Stattdessen wurde die Bundesrepublik 1955 mit den Pariser Verträgen Partner in der Westeuropäischen Union (WEU) und der NATO (Äußere Sicherheit/ Verteidigung/NATO), der sie alle künftigen Truppen unterstellte. Sie verzichtete auf eigene atomare, biologische und chemische (ABC-) Waffen und erlangte die Souveränität - abgesehen von Viermächte-Zuständigkeiten für Berlin und Gesamtdeutschland. Bestandteil des Vertragspakets war ein Abkommen mit Frankreich über die endgültige Abtrennung des Saarlandes (Land Saarland), das mit einem "europäischen Statut" unter französischem Einfluss verbleiben sollte. Als das saarländische Volk dieses Modell mit großer Mehrheit in einer Abstimmung ablehnte, gelangte das Saarland 1957 an die Bundesrepublik zurück. In der Konferenz von Messina 1955 vereinbarte die Bundesrepbulik mit Frankreich, Italien und den Benelux-Staaten die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), die 1957/58 gleichzeitig mit der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) ins Leben trat. Die EWG wurde von beiden großen Parteien getragen, die FDP lehnte sie als zu protektionistisch ab. Sie hat als Keimzelle der EG bzw. EU langfristig große Bedeutung gewonnen, indem sie Westeuropa einen stabilen ökonomischen Unterbau gab und Unternehmen ebenso wie Konsumenten einen großen Markt öffnete. 3. Kalter Krieg und Verfestigung der Teilung Deutschlands So phantasievoll, konstruktiv und kompromissbereit Adenauer seine Politik nach Westen gestaltete, so inflexibel, desinteressiert und verständnislos war er gegenüber dem Osten. Jedes sowjetische Angebot wurde mit Misstrauen betrachtet, Kompromisse mit der Sowjetunion oder der DDR galten als unmoralisch. Befürworter von Verhandlungen mit dem Osten wurden kommunistischer Sympathien bezichtigt. Dies traf im westlichen Deutschland auf Befürchtungen und Sicherheitsängste der Bevölkerung. "Sicherheit" und "keine Experimente" waren zentrale Slogans der Regierung in den Wahlkämpfen. Schon beim Petersberger Abkommen hatte der SPD-Oppositionsführer Schumacher deutsche Gleichberechtigung angemahnt. Auch der EVG und den Pariser Verträgen stimmte die SPD nicht zu. Für die Verhandlungsführung des Bundeskanzlers war diese Opposition zu Hause nicht ungünstig, ließ sie ihn doch als gemäßigteren Vertreter Deutschlands erscheinen. Als die UdSSR 1952 und nochmals 1955 das Angebot einer Wiedervereinigung mit freien Wahlen unter der Bedingung der Neutralität Deutschlands machte, polarisierte sich die Debatte um die Außenpolitik. Die mit den Westverträgen verbundene Wiederbewaffnung und das Streben nach Atomwaffen 1958/59 riefen Kriegsängste hervor. Aggressive Äußerungen wie die Forderung Adenauers nach einer Neuordnung Osteuropas oder Straußsche Überlegungen zu einem Präventivschlag gegen den Osten verstärkten diese Ängste noch. Nicht nur die SPD, sondern auch viele FDP-Politiker und der Minister für gesamtdeutsche Fragen, J. Kaiser (CDU), wollten das sowjetische Angebot ausloten. Adenauer brachte gleichwohl eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag für den NATO-Beitritt und die Wiederbewaffnung zustande. Er versuchte Verhandlungen mit der UdSSR zu hintertreiben und kündigte immer wieder an, die wachsende Überlegenheit des Westens werde die Wiedervereinigung bringen ("Politik der Stärke"). In der Praxis war die Wiedervereinigung aber für die Regierung Adenauer "im besten Fall eine sekundäre Angelegenheit", entscheidend blieb immer der sacro egoismo des Weststaates (Besson 1970: 129, 152). Auch die Wellen von Demonstrationen und Kundgebungen gegen die Wiederbewaffnung 1950/53 ("Ohne-mich-Bewegung") und gegen die Atomrüstung in Deutschland 1958/59 ("Ostermarsch-Bewegung") konnten an der Aufrüstung im Herzen Europas nichts ändern. Zwar erhielt die Bundesrepublik keine Atomwaffen, wie das Strauß als Verteidigungsminister geplant hatte. Dies war aber weniger das Verdienst der Demonstranten als des Unwillens der Westmächte, dem geteilten D Massenvernichtungswaffen anzuvertrauen. Stattdessen wurde die Bundeswehr konsequent in die NATO integriert, die sich strategisch und taktisch auf amerikanische Atomwaffen stützte. In Mitteleuropa entstand das dichteste Waffenarsenal der Welt. In den folgenden Jahren schien jedoch nicht der Westen, sondern der Osten stärker zu werden. Mit dem spektakulären Sputnik-Start 1957 wurde ein sowjetischer Vorsprung in der Raketentechnik deutlich. In der nuklearen Hochrüstung entwickelte sich das "Gleichgewicht des Schreckens", der einen Nuklearkrieg zum allseitigen Selbstmord gemacht hätte. Unter der dynamischen Führung Chruschtschows versuchte die UdSSR ihre neue Stärke auszunutzen, die DDR zu stabilisieren, deren Anerkennung durchzusetzen und die Westmächte aus Berlin zu verdrängen. Als der amerikanische Präsident Kennedy daraufhin nur die Sicherung Westberlins und der freien Zugänge dorthin als "essentials" definierte, baute die DDR die Berliner Mauer und vollendete damit die Teilung Deutschlands. Eine Wiedervereinigung gegen die UdSSR ließ sich also nicht erreichen, die Bundesregierung musste sich dieser Tatsache beugen. Dies galt gleichermaßen für die SPD-Opposition. Sie musste erkennen, dass eine Wiedervereinigung auf Jahrzehnte irreal geworden war und Europa in zwei Blöcken organisiert war. Deutschland war gespalten, aber in der Bundesrepublik waren die Grundlagen für ein stabiles demokratisches Gemeinwesen gelegt worden. Das deutsche Nationalgefühl wurde europäisch überformt, der Staat durch die Einbindung in stabile europäische und atlantische Zusammenhänge gezähmt und neu orientiert worden. Ein besonderer Beitrag dazu war das Abkommen mit Israel über deutsche Zahlungen zur "Wiedergutmachung". Es wurde nicht mit der Mehrheit der Regierungsparteien, sondern mit den Stimmen der SPD und großer Teile der CDU ratifiziert. Für die geistige Neuorientierung war die Übernahme dieser Verantwortung ein wichtiger Schritt, dem Entschädigungen für andere Opfer des Nationalsozialismus folgten. 4. Entspannungspolitik und Friedensbereitschaft 19621989 Auch nach dem Bau der Mauer hielt die Bundesregierung am Alleinvertretungsanspruch für Deutschland fest. Zwei deutsche Botschaften gab es nur in Moskau, anderen Staaten gegenüber wurde die Aufnahme von Beziehungen zur DDR mit dem Abbruch der Beziehungen durch die Bundesrepublik beantwortet (Hallstein-Doktrin). 1965 führte diese selbst gesetzte Erpressbarkeit zu dem Fiasko, dass die Bundesrepublik in der arabischen Welt kaum mehr vertreten war. Im Westen drohte ebenfalls zunehmend Isolation, weil das Beharren der Bundesrepublik auf deutschlandpolitischen Konzessionen die Entspannungspolitik behinderte (Baring 1982: 444). Auflockerungsversuche des Außenministers Schröder (CDU) in Richtung auf die Ostblockstaaten unter Umgehung der DDR scheiterten 1964. Auch die weitergehenden Versuche der Großen Koalition 1966-69 waren nicht erfolgreich und verfingen sich im Streit zwischen den Koalitionspartnern, der auch die Unterzeichnung des Atomwaffensperrvertrages blockierte. Erst die sozialliberale Koalition 1969-82 brachte den Mut auf, die existierenden Grenzen anzuerkennen, um sie durchlässiger zu machen und auf dieser Grundlage ein neues, friedliches Verhältnis zu Osteuropa zu suchen. Im Gegenzug konnte in Viermächteverhandlungen die Beilegung des ständig schwelenden Berlin-Konflikts erreicht werden. Die harten Auseinandersetzungen um die Ostpolitik und die Übertritte einiger Abgeordneter zur CDU/CSU führten 1972 zum erfolglosen Versuch eines Misstrauensvotums gegen Bundeskanzler Brandt und schließlich zu Neuwahlen, in denen die Regierung mit deutlicher Mehrheit bestätigt wurde. Zum ersten Mal wurde die SPD in dieser von der Auseinandersetzung um die Ostverträge bestimmten Wahl stärkste Fraktion im Bundestag. Nach der Westintegration in den 50er Jahren wurde mit dieser Wahlentscheidung die Friedenspolitik nach Osten Konsens. Schrittweise schloss sich in den folgenden Jahren auch die CDU/CSU dieser Grundorientierung an, vor allem als sie 1982 wieder an die Regierung kam. Mit der Vermittlung des "Milliardenkredits" an die DDR 1983 sprang auch Strauß, der sich jahrzehntelang in der West-Ost-Konfrontation profiliert hatte, auf den Zug der Entspannung auf. Innenpolitisch unkontrovers war die Vertiefung und Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft, in der EWG, EGKS und Euratom zusammengefasst wurden. Sie gelang in Brandts Kanzlerzeit aufgrund des durch die Ostpolitik gewachsenen Gewichts der Bundesrepublik, das die französische Regierung mit Großbritannien ausbalancieren wollte. Seit der Kanzlerzeit H. Schmidts wurde das deutsch-französische Sonderverhältnis innerhalb der EG als Antriebskern europäischer Entscheidungen aktiviert. An die Stelle des Dollars als Leitwährung trat in Europa eine europäische Währungszone, in der die DM die Ankerwährung bildete. Die Bundesrepublik wurde zum größten Handelspartner aller EU- Länder außer Spanien und Irland, die ökonomischen und politischen Beziehungen sind eng miteinander verflochten. Da die deutschen Exportinteressen aber über die EU hinausgehen, trat die Bundesrepublik von jeher für eine offene Handelspolitik nach außen ein, mit Ausnahme der protektionistischen Landwirtschaftspolitik. Für ihr Selbstverständnis sind diese Weltoffenheit und Friedensbereitschaft konstitutiv geworden, sie wird deswegen als Exportund Handelsstaat charakterisiert (Rosecrance 1987). Sicherheitspolitisch konnte das deutsch-französische Verhältnis wegen der Sonderrolle Frankreichs in der NATO nicht fruchtbar gemacht werden. Noch die Gründung des deutschfranzösischen Eurokorps 1992 hatte keine operative, sondern eher symbolische Bedeutung. Die USA blieben die entscheidende Führungsmacht der NATO und der eigentliche Sicherheitsgarant, vor allem in Bezug auf West-Berlin. Die Bundesrepublik wurde andererseits wegen der konventionellen Stärke der Bundeswehr als Alliierter für die USA immer wichtiger. Das gefährliche Ausmaß der sowjetischen Raketenrüstung Ende der 70er Jahre wurde zuerst von Bundeskanzler Schmidt kritisiert. Als Reaktion kündigte die NATO eigene Raketen an, falls die sowjetische Hochrüstung nicht eingestellt werde ("Doppelbeschluss"). Zusätzliche Besorgnis löste der sowjetische Einmarsch in Afghanistan aus, der dann zur Wahl Reagans als US-Präsident und seinem harten Konfrontationskurs beitrug - einem Nachwinter des Kalten Krieges. Die Raketenaufstellung rief in der Bundesrepublik leidenschaftliche Reaktionen hervor ("Friedensbewegung"), die das pazifistische Selbstverständnis der deutschen Gesellschaft sichtbar machten. Jedoch waren beide deutsche Staaten auch während des neuen Ost-West-Konflikts, der "Nachrüstung" im Westen und der östlichen Reaktion einer weiteren Raketenaufstellung bemüht, die Spannungen zu begrenzen, statt wie früher die Konfrontation zu schüren. "Von deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen" wurde ein gesamtdeutsches Leitwort. Die Ereignisse machten dem sowjetischen Führungspersonal einerseits klar, dass der Westen reaktionsfähig blieb und stärker war, andererseits aber, dass D sich entscheidend gewandelt hatte und ein Friedenskonsens entstanden war. Im Frühjahr 1989 wurde dies noch einmal deutlich, als D angesichts der sowjetischen Abrüstung die Stationierung neuer Kurzstreckenraketen verweigerte und diese vermittelnde Haltung in den USA als "Genscherismus" kritisiert wurde. 5. Gesellschaft im Wandel 1962-1989 Auch als 1960 die Vollbeschäftigung erreicht, die Kriegszerstörungen weitgehend beseitigt, der Vorkriegs-Lebensstandard überschritten und die Nachholbedürfnisse befriedigt waren, ging das epochale Wirtschaftswachstum weiter. D hatte nach dem Krieg mit einem niedrigen Lebensstandard begonnen. Aufgrund niedrigerer Löhne und der Unterbewertung der DM auf dem Weltmarkt bis 1969 war es besonders konkurrenzfähig, die Kapitalbildung war hoch. Vor allem wenig industrialisierte Regionen wie Bayern (Land Bayern ) profitierten von der Zuwanderung von Großunternehmen wie Siemens und von Branchenkernen aus den Vertreibungsgebieten, der DDR oder Berlin. Auf diese Weise entwickelten sich auch bis dahin benachteiligte Regionen zu modernen Industriezentren, und regional ergab sich eine weitgehende Ausgewogenheit. Als 1961 der Arbeitsmarkt erschöpft und der Zustrom aus der DDR abgeschnitten war, zudem der Aufbau der Bundeswehr dem Arbeitsmarkt Kräfte entzog, ging die Bundesrepublik in großem Ausmaß zur Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte über. Wie vorher die Vertriebenen zogen sie dorthin, wo die Industrie sie brauchte. Zunächst wurden sie für ein bis zwei Jahre angeworben und leisteten meist schwere oder unbeliebte Arbeit. Da aber ganze neue Produktionslinien etwa bei den Automobilunternehmen auf ihrer Arbeitskraft beruhten, wurden viele von ihnen für die Industrie unverzichtbar und zu Stammarbeitern. Die Vertragszeiten verlängerten sich von Jahr zu Jahr und die Vorstellung von der Zeitweiligkeit des Aufenthalts wurde immer mehr Fiktion. Gleichwohl wurde mit dem Schlagwort "kein Einwanderungsland" an ihr festgehalten. Die rechtlich marginale Existenz der "Gastarbeiter", die ökonomisch zum Kern der Industriearbeiterschaft gehörten, wurde zum permanenten Provisorium - wie das der Bundesrepublik selbst. In den 60er Jahren gewann die Bundesrepublik Selbstbewusstsein hauptsächlich über ihre ökonomische Leistung, und in der Zeit der Vollbeschäftigung hatten fast alle Bürger eine reale Möglichkeit, daran zu partizipieren. Da Arbeitskräfte knapp waren, entwickelten sich die unteren Einkommen günstig. Als die dringendste Wohnungsnot befriedigt war, nahm der Eigenheimbau zu. Alle Schichten wuchsen immer mehr in die Konsumgesellschaft hinein, die über ihr standardisiertes Angebot nivellierend wirkte. Die großen Bevölkerungsumschichtungen verstärkten diesen Prozess, und regionale ebenso wie konfessionelle Identitäten verloren an Relevanz. Insgesamt kam es zu einer sozialen Homogenisierung der Bevölkerung und der Lebensstile. Immer mehr Menschen arbeiteten als abhängig Beschäftigte. Der Anteil der Landwirte in den alten Bundesländern sank zwischen 1950 und 2001 von 24,6% auf 2,4%, ihr Anteil an der Wertschöpfung sank auf 1,2%. Die Zahl der mithelfenden Familienangehörigen und Hausangestellten ging zurück, die Anteile kommerzieller und administrativer Dienstleistungen nahmen zu. Während die Lebenserfahrung 1914-45 in extremer Weise nationalstaatlich eingeschnürt worden war, wurde die Bundesrepublik von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ein offeneres Land. Jahr für Jahr reisten mehr Menschen als Touristen ans Mittelmeer und in andere europäische Länder, seit den 80er Jahren auch stärker nach Afrika, Asien und Amerika. Die kommerzielle Jugendkultur prägte eine Generation nach der anderen, Englisch wurde immer mehr zur dominierenden Sprache der Unterhaltungskultur. Im Film setzten sich amerikanische Genres vom Western bis zu den soap operas durch. Auch die Hochkultur gewann ihre Internationalität zurück. Wirtschaft und Wissenschaft wurden internationaler, auch hier wurde Englisch zur dominierenden Sprache. Solange die Wirtschaft wuchs, konnte auch immer mehr verteilt werden. Insbesondere wuchsen die Infrastrukturausgaben. Straßen, Autobahnen und Kanäle, Wasser- und Abwassersysteme, Gas- und Ölleitungen wurden modernisiert. Auch die Renten konnten mit dem Rhythmus des Wachstums erhöht werden. Stockte das Wachstum, so wurden Anpassungen notwendig. Mit dem Erfolg der Rentenformel ergab sich allerdings eine Unausgewogenheit zwischen den Leistungen für die Alten und denen für die Kinder. Kindergeld und Kinderfreibeträge blieben bis 1998 sehr bescheiden. Benachteiligt blieben durch die Rentenformel, die sich am Verdienst orientierte, die Mütter, die geringe oder keine Einkommen gehabt hatten. Früher und dramatischer als in anderen Industrieländern gingen die Kinderzahlen zurück. 1970 fielen sie unter die Reproduktionsrate, heute sind die nachwachsenden Jahrgänge um ein Drittel schwächer als die Erwachsenen-Jahrgänge. Dem entsprechen andererseits hohe Einwanderungsraten. Bei der Wiedervereinigung wiederholte sich der Geburtenrückgang in Ostdeutschland in zugespitzter Weise, die Geburten fielen zeitweilig auf ein Drittel der Ausgangswerte. 6. Die Parteien-Demokratie und ihre Konflikte In der inneren und äußeren Stabilität der Anfangsjahrzehnte der Bundesrepublik, nach all den Katastrophen, erfuhren die Bundesdeutschen die Demokratie als Ordnung, die Sicherheit und Wohlstand brachte. Dies kam zunächst der Regierungspartei zugute, die mit ihren Führungsfiguren Adenauer und Erhard Sicherheit und Wohlstand verkörperte. Erst als der Kanzler selbst in der langen Krise um seine Nachfolge diesen Mythos zerstörte, schlug die Stunde der Opposition. Zunächst plante Adenauer 1959, nach dem Ausscheiden des populären Präsidenten Heuss dessen Nachfolge anzutreten, besann sich dann aber anders, um eine Nachfolge Erhards im Amt des Bundeskanzlers zu verhindern. Als diese Nachfolge 1963 dann schließlich doch zustande kam, hatte Adenauer viel vom Prestige beider zerstört. In der Berlin-Krise seit 1959 entstand vielfach der Eindruck, Adenauer reagiere hilflos. In der anschließenden Bundestagswahl 1961 verlor die CDU/CSU ihre absolute Mehrheit. Die FDP, die angekündigt hatte, mit der CDU, aber ohne Adenauer zu regieren, konnte den Kanzler zunächst nicht zum Amtsverzicht zwingen und belastete sich mit dem Odium des "Umfallens". Die SpiegelAffäre 1962, in der Verteidigungsminister Franz Josef Strauß die staatliche Verfolgung dieses kritisch über ihn berichtenden Magazins organisieren ließ, führte zu einer kritischen Wendung der Öffentlichkeit. Punkt für Punkt wurden illegale Machinationen und Falschaussagen aufgedeckt, Strauß musste zurücktreten, Adenauer sein Ausscheiden für 1963 ankündigen. Zwischen CSU und FDP tat sich seit der "Spiegel-Affäre" eine Kluft auf, die bis zum Tode von Strauß bestehen blieb. Mit Erhard als Kanzler feierte die CDU 1965 noch einmal einen glanzvollen Wahlsieg, der aber schon ein Jahr später von Gesichtsverlust gerade in Erhards Kompetenzbereich, der Ökonomie, abgelöst wurde. Überhitzung der Wirtschaft hatte die Bundesbank zu Diskonterhöhungen veranlasst, die stark durchschlugen und schließlich im Februar 1967 zu 637.572 Arbeitslosen führten - eine Ziffer, die damals wegen der Identifikation mit dem ökonomischen Erfolg und der Gewöhnung daran tief erschütternd wirkte. Die CDU verlor 1966 im Zuge dieser Krise die Wahlen in NRW, das sie zwei Jahrzehnte regiert hatte (Land Nordrhein-Westfalen ). Bundeskanzler Erhard trat zurück, das bürgerliche Bündnis war zerrüttet. Stattdessen wurde eine Große Koalition unter Kiesinger (CDU) gebildet. Mit Wirtschaftsminister Karl Schiller stellte für die nächsten Jahre die SPD die ökonomische Identifikationsfigur. Er vermittelte die Vorstellung einer Globalsteuerung der Wirtschaft durch den Staat und der Einbeziehung von Unternehmern, Gewerkschaften und anderen Verbänden in die Wirtschaftspolitik in der "Konzertierten Aktion". Der rasche ökonomische Aufschwung, der den Einbruch von 1966/67 mehr als wettmachte, bestätigte ihn und brachte gleichzeitig die Mittel und den Optimismus, mit dem die Modernisierungsreformen der nächsten Jahre in Angriff genommen werden konnten. Die sozialdemokratischen Vorstellungen über "Gemeinschaftsaufgaben", die in den 60er Jahren entwickelt worden waren, wurden nun zum Modernisierungskonsens: Bildungs- und Wissenschaftsförderung, Umweltschutz, Ausbau des Gesundheitswesens, der sozialen Sicherung und der Infrastruktur. Die Bundesländer schufen in Gebietsreformen größere kommunale Gebietseinheiten. Die staatlichen Konfessionsschulen fielen weitgehend der Bildungsreform zum Opfer, in Bayern wurde dies mit einem Volksbegehren durchgesetzt. Steigende Übergangsquoten zu weiterführenden Schulen, bis dahin vielfach mit Unbehagen betrachtet, wurden nun ein allgemein anerkanntes Ziel. Die Große Koalition hatte zwiespältige Effekte. Einerseits wurden ihre Stabilitätserfolge und modernisierenden Reformen zur Grundlage aller künftigen Politik. Andererseits wurde sie wegen ihrer erdrückenden Mehrheit als undemokratisch empfunden. Das Gemeinschaftsdenken, das zu Beginn der Bundesrepublik noch allgemein verbreitet gewesen war, hatte der Übernahme des britischen Parlamentarismus-Modells Platz gemacht: Einer leistungsfähigen Regierung sollte eine starke Opposition gegenüber stehen. Die Befürchtung von Demokratieverlust mischte sich mit anderen Themen. Eines war der Vietnam-Krieg, der das amerikanische Modell entzauberte und kommunistische Befreiungskämpfer faszinierend erscheinen ließ. Ein anderes war die nationalsozialistische Vergangenheit, die erst in den 60er Jahren zum großen Thema wurde und deren Schrecken durch den großen Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963-65, durch die Debatten um die Verjährung von NS-Verbrechen und auch durch literarische Auseinandersetzungen wie Hochhuths Anklage-Drama "Der Stellvertreter" ins Bewusstsein vieler jüngerer Deutscher getreten war. Obwohl der Prozess und die offene Auseinandersetzung Zeichen für die neue Qualität der deutschen Demokratie waren, nährten sie bei vielen einen generellen Verdacht gegenüber staatlicher Macht. Zum Ausdruck kam diese Furcht bei der Debatte um die Notstands-Gesetzgebung (Notstandsverfassung), mit der der Katastrophen- und Verteidigungsfall geregelt werden sollte. Ängste vor dem Chaos und kommunistischer Bedrohung auf der einen Seite standen Ängsten vor einem neuen Faschismus auf der anderen gegenüber - eine Ex-post-Bewältigung der Vergangenheit mit dem falschen Adressaten. Überhaupt löste die Studentenbewegung eine neue Ideologisierung aus, es entstanden neue Konfliktfronten in Politik und Gesellschaft. Sprach man vorher vom "Ende der Ideologien", so wurden nun Probleme ideologisch aufgeladen und überfrachtet - von der Linken ebenso wie von der Rechten. Die Wahlkämpfe der folgenden Jahre lebten von diesem Gegensatz. 1968 zog auch die NPD (Splitterparteien), die nach der Verunsicherung der Wähler bei Erhards Sturz ihre ersten Erfolge gefeiert hatte, aus der Konfrontation mit der Studentenbewegung Gewinn. Die Wahlen von 1969, die über das eher spezielle Problem einer Aufwertung der DM ausgetragen wurden, ermöglichten eine Regierungsbildung aus SPD und FDP und damit den ersten wirklichen Machtwechsel. Dies rief bei der CDU/CSU, die stärkste Partei blieb, Aggressionen hervor. Über Abwerbungs- und Konfliktstrategien suchte sie die neue Regierung Brandt/Scheel zu stürzen. Als offensichtlich wurde, dass auch Geld im Spiel war, entstand Erregung in der Bevölkerung. Erst das eindeutige Ergebnis der Wahlen von 1972 brachte eine Klärung. War die Große Koalition eher technokratisch aufgetreten, so strahlte die sozialliberale Koalition Reform-Enthusiasmus aus. Die Themen blieben die gleichen - Bildung, Wissenschaft, Forschung, Infrastruktur, insbesondere Verkehr und Städtebau, Gesundheit und Sozialpolitik. Neu hinzu kamen die Erhaltung und der Schutz der Umwelt. Stärker wurde nun allerdings nicht das bloße Mehr, sondern die Neuorganisation und Umverteilung angestrebt, was Widerstände auslöste. Vor allem in den Fragen von Schulen und Hochschulen ergab sich eine brisante Mischung aus Reformwille, entgegenstehenden Statusängsten und Ideologisierung, die in der Nachfolge der Studentenbewegung zum Teil unrealistisch und sektiererisch wurde. Solange es immer mehr zu verteilen gab, ließen sich derlei Diskrepanzen verkraften. 1972 erlebte die Verteilungspolitik einen neuen Höhepunkt, als die CDU/CSU mit einer kurzzeitigen Stimmenmehrheit im Bundestag noch über die dynamische Rentenformel hinausging, zusätzliche Erhöhungen durchsetzte und andererseits Reformen in Richtung Mindestrente blockierte, die sich vor allem zugunsten von Frauen ausgewirkt hätten. Die Ölpreiskrise von 1973/74 setzte diesem Typus von Verteilungspolitik ein Ende. Die Verwerfungen in der Weltwirtschaft schlugen auch auf die Bundesrepublik durch. Es gab vorübergehend keine Zuwächse zu verteilen, und seither ist es nicht mehr gelungen, die Vollbeschäftigung wiederherzustellen. Das demokratische System wurde mit diesen Herausforderungen entgegen einigen sozialwissenschaftlichen Thesen über "Legitimationskrisen" (Offe) gut fertig. H. Schmidt übernahm nach dem Rücktritt W. Brandts 1974 das Kanzleramt und wurde schnell zur Vertrauensfigur der Deutschen in den neuen ökonomisch-politischen Weltkonflikten. Die Bewältigung der Wirtschaftskrise und die produktive Zusammenarbeit der Tarifparteien mit der Regierung ließ Wissenschaftler sogar das Wahlkampfschlagwort vom "Modell Deutschland" ernst nehmen. Das Reformklima aber war mit der neuen Lage beendet. Da es weniger zu verteilen gab, wurden Konflikte bitterer. Die Ideologisierung setzte sich fort, der CSU-Vorsitzende Strauß versuchte das Unbehagen mit einem Kurs der totalen Konfrontation auszunutzen ("SonthofenStrategie"), erreichte aber damit nur die Isolierung der CDU/CSU in der Opposition und eine Verhärtung der innenpolitischen Lage. Gespenster-Kampagnen über "Systemveränderung" bestimmten die Bildungspolitik. Auch die ökologische Diskussion wurde ideologisch aufgeladen, beispielsweise durch die Kampagnen gegen das Benzin-Blei-Gesetz und die Geschwindigkeitsbegrenzung ("freie Fahrt für freie Bürger"). Einsparungen bei den Renten wurden zur "Rentenlüge" stilisiert. Die größte Zuspitzung erreichte die innenpolitische Konfrontation bei den Themen Extremismus und Terrorismus. Die spektakulären Anschläge kleiner Gruppen und die Reaktion des Staates prägten ein Klima des Verdachts und der Angst. Intellektuelle und Politiker wurden als "Sympathisanten" der RAF verdächtigt. In einer Zitatensammlung des CDU-Generalsekretärs Geißler wurde sogar der Präsident des Bundeskriminalamtes in diesen Verdacht einbezogen, dem andererseits Kritiker wie Enzensberger vorwarfen, einen "Sonnenstaat" mit totaler Kontrolle anzustreben. Abgelöst wurde dieses Thema seit 1979 durch Kampagnen gegen "Asylanten", die 1980-82 zum ersten Mal auch Gewaltanschläge zur Folge hatten. Im Wahlkampf 1982 versprach Oppositionsführer Kohl die Reduzierung der Zahl der "ausländischen Mitbürger", andere Politiker gingen in ihren Formulierungen noch weiter. Der zweite Ölpreisschub 1979/80 wurde von der Regierung Schmidt nicht mit "deficit spending" oder einem Reformkonzept angegangen, sondern mit Einschnitten in den Staatshaushalt. Der Abschwung wurde dadurch verstärkt. Nur die aggressive betriebene Kanzler-Kandidatur von F.-J. Strauß sicherte der Regierung Schmidt 1980 noch einmal eine breite Mehrheit. Die Arbeitslosigkeit stieg an und belastete die Sozialkassen, was zu Einschnitten führte und innerhalb der SPD Unzufriedenheit weckte. Gleiches galt für den von Schmidt initiierten NATO-Beschluss über die "Nachrüstung" angesichts der sowjetischen Raketenstationierungen. Schwere Einbrüche der SPD in Landtagswahlen folgten. Die FDP setzte sich daraufhin von der SPD ab. Sie forderte eine "Wende" und Einschnitte ins "soziale Netz" und setzte Kürzungen und eine quälende Debatte darüber durch. Ihre Taktik der langsamen Demontage des Kanzlers Schmidt wurde von diesem schließlich mit der Entlassung von Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff beantwortet. Mit einem konstruktiven Misstrauensvotum wählten CDU/CSU und FDP daraufhin am 1.10.1982 H. Kohl zum Kanzler. Angesichts der verbalen Radikalität der politischen Auseinandersetzungen überraschte viele das Ausmaß der Kontinuität nach der "Wende". Es gab nur wenige grundlegende Einschnitte, darunter bei den Stipendien für Schüler und Studenten. Die Abschaffung der Förderung des sozialen Wohnungsbaus (Wohnungspolitik) musste nach der Wiedervereinigung wieder rückgängig gemacht werden. Ansonsten wurden zwar Kürzungen vorgenommen, aber an anderer Stelle Neues hinzugefügt. Ein Musterbeispiel war das Mutterschaftsgeld. Es wurde zunächst gekürzt, dann 1986 vor der Wahl in Erziehungsgeld umbenannt und auf nichtberufstätige Frauen erweitert und schließlich partiell wieder aufgestockt. Insgesamt war eine Verlagerung der Finanzleistungen des Staates hin zu den Ober- und Mittelschichten nicht zu verkennen, was gleichzeitig eine Verarmung der unteren Gruppen bedeutete ("Zweidrittelgesellschaft"). Dies beruhte großenteils allerdings auf Marktprozessen und wurde von staatlichen Umverteilungen nur akzentuiert. Für den Staat war die "Wende" gleichwohl stabilisierend. Viele Gruppen identifizierten sich neu mit der Regierung. Auch die CDU/ CSU profilierte sich in der folgenden Zeit mit Themen, die sie vorher scharf abgelehnt hatte, etwa dem Umweltschutz. Wesentlich trug dazu der Wahlerfolg der Grünen bei, denen es 1983 als erster Partei nach dreißig Jahren gelang, neu in den Bundestag einzuziehen. Entgegen allen Ausgrenzungs- und Selbstausgrenzungsbemühungen hatten sie letztlich eine integrative Funktion. Sie führten viele Gruppen, die sich in der Tradition der Studentenbewegung fundamental-oppositionell verstanden hatten, wieder in den politischen Prozess zurück. Während die CDU sie noch 1983 beschuldigte, verfassungsfeindlich zu sein, koalierte sie 1995 schon in fünfzig Kommunen mit ihnen, darunter auch in Großstädten wie Mülheim. 7. Das vereinte Deutschland Im Rahmen der Entspannungspolitik entwickelte sich schrittweise ein eigenartiges Sonderverhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten. Zwar blieb es bei Mauer, Stacheldraht und Schüssen an der Grenze, bei der Betonung der Eigenständigkeit der DDR und dem Verfassungsgebot der Wiedervereinigung im Westen. Die Rigidität der totalitären Grausamkeit wurde aber abgemildert. Statt in harte Haft wurden DDR-Oppositionelle nach Westen abgeschoben, was Protestaktionen kalkulierbarer machte. Wichtig dabei war der Wunsch der DDR-Führung nach Respektabilität im Westen, aber auch nach Transferzahlungen. Häftlingsfreikauf, Einreise- und Aufenthaltsgebühren, Pauschalen für die Straßenbenutzung, Finanzierung von Verkehrswegen nach Berlin, kirchliche Zahlungen, private Geschenke und westdeutsche Kredite stabilisierten das DDR-Regime, machten es aber gleichzeitig abhängiger und weniger gewaltsam. In der westdeutschen Öffentlichkeit wurden der Unrechtscharakter und die Rigidität des Regimes immer weniger registriert. Die Medien berichteten über wirtschaftliche Erfolge der DDR, Günther Gauss beschrieb den Charme der "Nischengesellschaft". Westdeutsche Ministerpräsidenten wetteiferten um Fototermine bei Erich Honecker, und 1987 schließlich erschien dieser zum Staatsbesuch in Bonn, Saarbrücken und München, womit die Anerkennung der DDR vollendet zu sein schien und ihre internationale Respektabilität einen Höhepunkt erreichte. Der Zusammenbruch der DDR 1989 traf die Westdeutschen überraschend, mehrheitlich hatten sie die Wiedervereinigung (Vereinigung) abgeschrieben. Enthusiastisch wurde das Ende von Mauer und Stacheldraht zwischen Ost und West begrüßt. In Bezug auf die eigentliche Wiedervereinigung aber fand Bundeskanzler Kohl es nötig, den Deutschen zu versprechen, keinem werde es schlechter und vielen besser gehen und es werde nicht zu Steuererhöhungen kommen. SPD-Kanzlerkandidat Lafontaine äußerte Zweifel an diesem Konzept und machte im Wahlkampf immer wieder seinen geringen Enthusiasmus für die staatliche Wiedervereinigung deutlich. Der Wettbewerb der westdeutschen Parteien überlagerte rasch auch die Politik im Osten. Zunächst profilierten sich die neu gegründete ostdeutsche SPD und Bündnis '90 als einzige unbelastete Parteien. Im Frühjahr 1990 gelang es der CDU, aus zwei Blockparteien und einer Neugründung eine "Union für Deutschland" zu formieren. Entsprechendes geschah bei der FDP. Mit einem Kanzlerwahlkampf erreichte die Koalition 1990 in allen drei Wahlen in Ostdeutschland dominierende Mehrheiten. Ökonomisch war die DDR seit der Öffnung der Grenze auf die Bundesrepublik angewiesen. Im nun einsetzenden Vergleich der beiden Systeme und der Herausstellung der skandalösen Verhältnisse in der DDR erstrahlte die Bundesrepublik in hellem Licht. Das Grundgesetz, einst als Provisorium konzipiert, war inzwischen zum Symbol des neuen demokratischen D geworden (Verfassungspatriotismus). Für die Mehrheit der Westdeutschen stand es nicht zur Debatte, für die Ostdeutschen war sein Artikel über den Beitritt populär. Hier wiederholte sich das materielle Motiv bei der Eingliederung in den Westen, das auch für die Westdeutschen so wichtig gewesen war. Im Vertrag über den Beitritt der DDR, bei dessen Gestaltung Innenminister Schäuble dominierte, wurde die Bundesrepublik in jeder Beziehung zum Modell. Außer der Fristenlösung wurde hier nichts verändert, in der DDR dagegen so gut wie alles. Auch extrakonstitutionelle Regelungen in der Bundesrepublik erhielten aus diesem Anlass zum ersten Mal allgemeinen Gesetzesrang, so die privilegierte Stellung der Wohlfahrts -und der Sportverbände und die Kultusministerkonferenz. In Hinsicht auf die ökonomische Neuordnung fiel die Bundesregierung ihrer eigenen Propaganda zum Opfer. Während die dynamische Marktwirtschaft in der alten Bundesrepublik von staatlichen, großindustriellen und korporatistischen Entscheidungsmustern begleitet wurde, setzten Bundesregierung, Sachverständigenrat und Wirtschaft nun auf die Selbstorganisationskraft des Marktes, aus der "blühende Landschaften" entstehen sollten. Die Folge dieser Illusionen war eine weitgehende Entindustrialisierung Ostdeutschlands. Zudem kam es wegen des Restituierungsprinzips für das Eigentum zur Blockierung ökonomischer Entscheidungen wegen unklarer Eigentumsverhältnisse vor allem bei Grundstücken. Das Wegbrechen der industriellen Basis führte auch zum Verlust der meisten Industriearbeitsplätze, was wiederum die Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte bedeutete. Mittelfristig hat das einen empfindlichen Rückgang der Bevölkerung im Osten zur Folge, zugespitzt von den geringen Geburtenraten. Der Verzicht auf Opfer und Einschnitte zu Beginn der Wiedervereinigung, wie sie von Helmut Schmidt und Gerd Bucerius im Herbst 1989 angemahnt wurden, machte spätere Belastungen erforderlich, die vor allem über die sozialen Sicherungssysteme vorgenommen wurden. Wegen des hohen Niveaus des privaten Verbrauchs, wie er etwa im Tourismus zum Ausdruck kommt, veränderte sich die Leistungsbilanz Ds 1991-97 ins Negative. Unlustgefühle und Parteienverdrossenheit waren 1992/93 die Formen, in denen sich die Frustration äußerte. Die Spannungslosigkeit des Parteiensystems nach dem Verlust der äußeren Feinde und Bedrohungen führte in diesem Zusammenhang zu weiterer Demotivation. Erst die Bundestagswahl 1994 mit einer klareren Konfrontation der Parteien brachte wieder stärkere Integration. Im Wahlkampf 2002 entwickelte sich eine spannende Auseinandersetzung mit neuen Themen, die integrative Wirkungen zeigte. Im Gegensatz zu den inneren Aspekten der Wiedervereinigung konnten die außenpolitischen Aspekte sehr erfolgreich bewältigt werden. Der Friedenskonsens, der sich in D entwickelt hatte, war dabei wesentlich. Die Auflösung des sowjetischen Imperiums wurde ohne unnötigen Triumphalismus genutzt. Die Verankerung im Westen blieb erhalten und wurde verstärkt, ohne dass die sich auflösende Sowjetunion dies verhindern konnte. Die Furcht vor einem neuen großen D, die bei einigen Nachbarn ebenso wie bei einigen Intellektuellen geäußert wurde, erwies sich als unsinnig. Die pragmatische Haltung des "Handelsstaates", den Außenminister Genscher verkörperte, erleichterte den Übergang zu internationalen Lösungen, insbesondere die Grenzverträge mit den Nachbarn. Zum ersten Mal seit 1914 ist D wieder ein Land ohne Grenzprobleme. Auch nach dem Amtsantritt der rot-grünen Regierung 1998, der ersten vollständigen Regierungsübernahme durch die Oppositionsparteien im Bund, wurde die außenpolitische Linie bruchlos fortgesetzt. Ironischerweise mussten die beiden Parteien, die sich mit Friedenspolitik identifizierten, sich sofort mit der Kosovo-Intervention beschäftigen. Sie nahmen dabei stark moralische Argumente zu Hilfe und bezogen sich sogar auf Auschwitz. Deutsche Truppen wurden in immer mehr Ländern mit friedenserhaltenden Aufgaben eingesetzt. 2001/02 wurden sie im Zusammenhang mit dem Kampf gegen El Kaida ebenso wie 1999 im Kosovo auch zu friedenserzwingenden Einsätzen kommandiert. D stellte dabei zwar die zweitgrößte Truppenzahl, blieb aber im Gegensatz zu den USA ein stark pazifistisch gestimmtes Land und erhöht seine Militärausgaben nicht wesentlich. In den vier Jahren der rot-grünen Koalition wurden entscheidende Weichen in der Staatsangehörigkeits- und Zuwanderungspolitik gestellt. Mit dem Staatsangehörigkeitsrecht, das Kindern ausländischer Eltern mit mehr als acht Jahren Aufenthalt von Geburt an zu deutschen macht, wurde die Tendenz gestoppt, immer mehr Einwohner als Ausländer zu belassen und damit die demokratische Basis des Staates auszuhöhlen. Das Zuwanderungsrecht von 2002 ermöglicht einen rationaleren und ganzheitlicheren Zugang zur Einwanderungspolitik, auf die D in den nächsten Jahrzehnten angewiesen sein wird. Trotz aller polemischen Auseinandersetzungen standen diese Veränderungen - ebenso wie die privatisierende Rentenreform und die Schritte zur Gleichstellung der Homosexuellen bei den Wahlen 2002 nicht zur Disposition. 8. Perspektiven In der Staatenwelt tritt D heute als pragmatischer Partner auf. Eingedenk seiner historischen Erfahrungen ist es gewaltsamen Konflikten abgeneigt und hat eine weitgehende Abrüstung vollzogen, die pazifistische Grundstimmung ist allgemein geworden. Die Bundeswehr ist nach dem Ende des Ost-West-Konflikts verstärkt in internationale Zusammenhänge eingebracht worden: So entstand das Eurokorps, das deutsch-niederländische Korps, die NATO-Eingreiftruppe und ein deutsch-dänisch-polnischer Verband. Zunächst zögernd wurde auch die Beteiligung an friedenserhaltenden und -schaffenden Aktionen der UN und der NATO in Angriff genommen, obwohl die deutsche Bevölkerung eine starke humanitäre Hilfsbereitschaft zeigte und die öffentliche Meinung 1992 die zeitweilige Aufnahme von 350.000 bosnischen Flüchtlingen durchsetzte. Erst im Kosovo-Konflikt kam es zu Kampfeinsätzen der Bundeswehr mit einem humanitären Ziel, und zwar mit der immer wieder angeführten Begründung, Lehren aus der deutschen Geschichte zu ziehen. Dominierend sind bei militärischen Problemen aber immer die USA, die auch nach dem Ende des Kalten Krieges in D ihre wichtigste militärische Basis haben. Eine führende Rolle spielt D dagegen in der europäischen Einigung. Stärker als in vielen Partnerländern ist ein breiter proeuropäischer Konsens verankert, der im 1990 beschlossenen Europa-Artikel des Grundgesetzes seinen Ausdruck fand. Trotz zunächst weit verbreiteter Skepsis über den Verlust der DM wurde auch die Einführung der Europäischen Währungsunion 1999 und des Euro 2002 mit den Stimmen aller Fraktionen verabschiedet. Nach wie vor trägt D auch einen sehr hohen Anteil an den europäischen Finanzen und wird diese Last auch weiterhin schultern müssen, wenn der Beitritt der östlichen Nachbarstaaten gelingen soll. Finanzhilfen und kooperative Einbeziehung in europäische Strukturen sind auch die bevorzugten Mittel Ds zur Lösung von Konflikten auf dem Balkan. Auf diese Weise drückt sich eine allgemein gewordene Grundhaltung aus, die auf Frieden, Wohlstand, freien Handel und eine offene Welt setzt. Der deutsch-französischen Sonderbeziehung, die schwieriger geworden ist, wird häufig eine ähnlich positive Entwicklung im deutschpolnischen Verhältnis zur Seite gestellt. Die starke Ausprägung des Umweltbewusstseins seit den 80er Jahren veranlasste auch zunächst zögernde Regierungspolitiker zum Einschwenken. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl und eine Kette von Umweltskandalen verstärkten diese Effekte. D wurde zur finanziellen Hauptbasis von Greenpeace. Deutsche Politiker suchten sich auf der europäischen und der internationalen Ebene mit Umweltthemen zu profilieren, Klaus Töpfer wurde in diesem Zusammenhang 1988 Leiter des Umweltprogramms der UN. Allerdings konfligierte dieses Umweltbewusstsein mit anderen gewichtigen Interessen der Deutschen, insbesondere dem Automobilismus, der in der Tatsache zum Ausdruck kommt, das D als einziges Land die Geschwindigkeit auf Autobahnen nicht begrenzt. Bundeskanzler Schröder, dessen Partei ein weitgehendes Umweltprogramm besitzt, verkörperte diesen Widerspruch als "Automann". Widersprüchliche Entscheidungen zwischen Umwelt, Konsum und Produktion machten die deutsche Politik inkonsistent und schadeten ihrer Durchsetzungsfähigkeit. Ähnlich wie Greenpeace fand auch amnesty international eine besonders starke Basis in D. Menschenrechtspolitik wurde zu einem allgemein anerkannten Leitprinzip. Trotz bemerkenswerter Resolutionen des Bundestages, etwa zur chinesischen Tibetpolitik, gelang es aber nicht, die Menschenrechtspolitik produktiv mit der Handels- und Wirtschaftspolitik zu verknüpfen. Auch in der Entwicklungshilfe war dieser Widerspruch spürbar. Sie wurde vielfach an Exportinteressen gebunden und ging in ihrem Umfang seit dem Ende des Kalten Krieges zurück. Die Stabilität Ds beruhte in der Vergangenheit auf einer Kombination marktwirtschaftlicher Dynamik mit ausgebauter sozialer Absicherung. Mit der Einbeziehung Ostdeutschlands über Finanztransfers wurde dieses System empfindlich belastet. Erkennbar wird zudem eine demographische Lücke, die den "Generationenvertrag" gefährdet. Zugleich zeigen sich Steuerungs- und Effektivitätsdefizite im Bildungssystem und der öffentlichen Verwaltung. Die zentrale Herausforderung für Politik, Verwaltung und Wissenschaft besteht darin, das System effektiver und produktiver zu machen, ohne seine integrativen Vorteile aufzugeben. Dazu gehören insbesondere die im Vergleich zu den USA geringe Kriminalitätsbelastung und die funktionierende Integration der Jugendlichen in das Beschäftigungssystem, u.a. mit Hilfe der dualen Ausbildung. Als zentrales innenpolitisches Problem wird allgemein die Arbeitslosigkeit definiert, die etwa vier Mill. Menschen direkt betrifft. Sie war - in Verbindung mit der Wirtschaftskompetenz das entscheidende Thema der Wahlkämpfe von 1998 und 2002. Deutlich wurde bei beiden Wahlen ein sozialstaatlicher Konsens in der Bevölkerung, auf den sich die Wahlkämpfer beider großer Parteien einstellten. Unabhängig von der Konstellation dauert dieser Konsens an, denn die jeweilige Oppositionspartei verfolgt als Opposition eine Strategie der Kritik am Abbau staatlicher Leistungen. Finanzielle Einschnitte, mit denen die Regierung die Haushaltssituation bereinigen will, stoßen auf Kritik und helfen der Opposition, was wiederum Entscheidungsprozesse blockieren kann. Der Versuch der Regierung Kohl, dieses Patt in der "Standortdebatte" offensiv aufzulösen, brachte eher Pessimismus und Rufschädigung im Ausland als produktive Entscheidungen. Notwendig sein wird eine exakte Analyse der Probleme und eine ständige Anpassung der Sozialsysteme an die neuen Herausforderungen. Während sich in den 80er Jahren die "Grünen" etablierten und zeitweise auch rechtsextreme Parteien in Ländern und Kommunen zum Zuge kamen, haben um die Jahrhundertwende die beiden großen "Volksparteien" mehr Gewicht gewonnen. Sie dominieren die öffentliche Debatte und die Wähler pendeln großenteils zwischen ihnen. Ausdruck dieser Tendenz waren mehrere Regierungswechsel in den Ländern zugunsten der Opposition, die am Ende der Ära Kohl nur noch drei CDU/CSU-dominierte Länder und zwei Länder mit großen Koalitionen übrig ließen. Der Höhepunkt dieser deutlichen Alternanz zwischen den beiden großen Parteien war die Bundestagswahl 1998, mit der zum ersten Mal eine Bundesregierung insgesamt durch Wahlen abgelöst wurde. Weniger als ein halbes Jahr nach ihrer deutlichen Niederlage war die CDU indes fähig, ihrerseits die SPD in Hessen zu verdrängen und das erste Land zurück zu gewinnen. Mit Regierungswechseln in Sachsen-Anhalt, Hamburg und Niedersachsen setzte sich dieser Trend fort und brachte den Oppositionsparteien im Sommer 2003 eine sehr starke Stellung im Bundesrat ein. Im Jahr 2002 konnte allerdings die SPD zum ersten mal über zwei Wahlen hinweg als stärkste Partei behaupten. Die "Grünen" sahen sich bei der Regierungsübernahme mit einer Halbierung ihrer Wählerschaft konfrontiert. Nach einer langen Krisenzeit konnten sie erst wieder aufholen, als das hohe Prestige ihres Außenministers Fischer sich auf ein Friedensthema beziehen ließ. Die FDP konnte 1999-2002 von einer Krise der CDU profitieren und erreichte in NordrheinWestfalen mit 9,8% der Stimmen einen großen Erfolg, gefolgt von einem ersten Durchbruch in einem ostdeutschen Land seit 1990 bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Bei den Bundestagswahlen kam ihr "Spaßwahlkampf" angesichts ernsthafter Themen aber nicht mehr an. Grüne und FDP liegen in den neuen Ländern mit der erwähnten Ausnahme unterhalb der Fünf-Prozent-Klausel, was ihre gesamtstaatliche Präsenz beeinträchtigt. Auch die großen Parteien leiden im Osten an einer geringen Mitgliedschaft und einer entsprechend geringen Wählerstabilität. Einzige große Mitgliederpartei ist dort die PDS, die in einigen Ländern sogar zweitstärkste Partei wurde. Langfristig dürften ihre Chancen aber wegen der Überalterung ihrer Mitgliedschaft, des mangelnden Realitätsbezuges ihrer Aussagen und der Chancenlosigkeit im Westen geringer werden. Die Niederlage 2002 ist dabei ein Markstein. Praxistests in Landesregierungen schmälern zudem ihr Oppositionsimage. Literatur Abelshauser, Werner 1983: Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 19451980. Frankfurt. Baring, Arnulf 1982: Machtwechsel. Die Ära Brandt-Scheel. Stuttgart. Bark, Dennis L./Gress, David R. 21995: A History of West Germany, 2 Bde. Oxford/Cambridge, Mass. Benz, Wolfgang 41989: Die Bundesrepublik Deutschland. 4 Bde. Frankfurt. Benz, Wolfgang 1990: Deutschland seit 1945. Entwicklungen in der Bundesrepublik und der DDR. Chronik, Dokumente, Bilder. Bonn. Besson, Waldemar 1970: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. München. Beyme, Klaus von/Schmidt, Manfred G. (Hrsg.) 1990: Politik in der Bundesrepublik Deutschland. Opladen. Blancke, Bernhard/Wollmann, Helmut (Hrsg.) 1991: Die alte Bundesrepublik. Opladen. Bracher, Karl Dietrich u.a. 1981-89: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 5 Bde. Wiesbaden/Stuttgart. Conze, Werner/Metzler, Gabriele 1999: 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Daten und Diskussionen. Stuttgart. Deutsche Einheit. Sonderedition aus den Akten des Bundeskanzleramtes 1989/90, 1999, bearb. v. Hanns J. Küster u. Daniel Hofmann. München. Görtemaker, Manfred 1999: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gründung bis zur Gegenwart. München. Hesse, Joachim Jens/Ellwein, Thomas 71992: Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland. Opladen. Katzenstein, Peter J. 1987: Policy and Politics in West Germany. Philadelphia. Kleßmann, Christoph 51991: Die doppelte Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945-1955. Bonn. Kleßmann, Christoph 1988: Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955-1970. Bonn. Rosecrance, Richard 1987: Der neue Handelsstaat. Frankfurt am Main. Rudzio, Wolfgang 41996: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Opladen. Schäfer, Gerhard/Nedelmann, Carl (Hrsg.) 21969: Der CDU-Staat. Analysen zur Verfassungswirklichkeit der Bundesrepublik Deutschland. 2 Bde. Frankfurt am Main. Schäuble, Wolfgang 1991: Der Vertrag. Wie ich über die deutsche Einheit verhandelte. Stuttgart. Schöllgen, Gregor 1999: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. München. Thränhardt, Dietrich 1999: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt am Main. Willems, Ulrich (Hrsg.) 2001: Demokratie und Politik in der Bundesrepublik 1949-1999. Opladen. aus: Bundesrepublik Deutschland - Geschichte und Perspektive, Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik