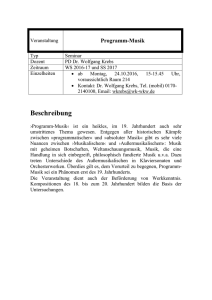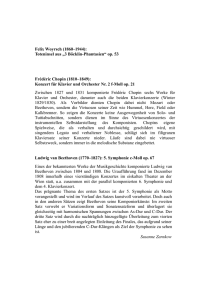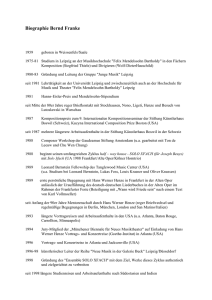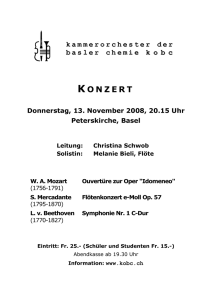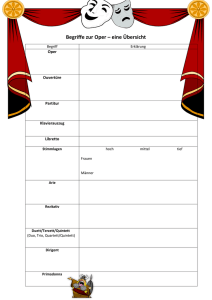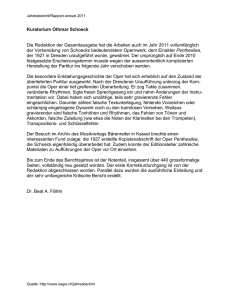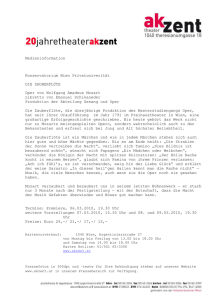Musiklexikon
Werbung

Le se pr ob e Musiklexikon Inhalt 2 Bibliografie 3 Inhalt 4–6 CD-ROM 7–32 Ausgewählte Artikel 33 Impressum Musiklexikon Überreicht durch: Musiklexikon 2., aktual. und erw. Auflage 2005. Ca. 3.400 S., 500 s/w Abb., 200 farbige Abb., zahlreiche Grafiken, Notenbeispiele, 4 Bände + CD-ROM im Schmuckschuber ISBN 3-476-02086-X Erscheint am 20. September 2005. eu N 4 Bände + CD-ROM nur € 169,95 € (A) 175,90/CHF 272,– 2 Das Musiklexikon. Die 4 Bände in der Neuauflage. DAS Nachschlagewerk zu allen Facetten und Epochen. In mehr als 6.500 Personenartikeln, 5.000 Sachartikeln und 700 Abbildungen, davon 200 farbig, informiert es aktuell über: 씰 Rund 3.500 Komponisten 씰 Rund 350 Ensembles und 700 Dirigenten, Bandleader, Kapellmeister 씰 Musiker, Choreographen, Regisseure, Tänzer, Impresarios, Arrangeure u.v. m. 씰 Klassik bis Pop 씰 Opern, Arien, Oratorien, Ballette, Operetten, Musicals 씰 Gattungen, Musiklehre mit Notenbeispielen, Instrumentenkunde u.v. m. Neue Einträge in der 2. Auflage: 씰 Interpreten 씰 Komponisten der Gegenwart 씰 Bühnenwerke 씰 Weltmusik 3 Die CD-ROM Die CD-ROM liefert den Text der vier Bände im interaktiven Zugriff. In einer überzeugenden multimedialen Umsetzung ergänzt die CD-ROM das Musiklexikon um: 씰 6 Stunden Hörbeispiele 씰 1.300 Abbildungen 씰 Chronik mit Zeittafeln 씰 2.000 Beiträge und Rezensionen aus ›Die Zeit‹ 1.300 zusätzliche Abbildungen illustrieren den Text. Verlinkungen erschließen Ihnen Gesucht – gefunden. Volltextsuche, vertiefendes Wissen. Problemlos erweiterte Suche und Stichwortauswahl lassen sich Textausschnitte führen Sie schnell und mühelos zur kopieren oder ausdrucken. gewünschten Information. Hörbeispiel gewünscht? Einfach anklicken und die Musik erklingt. 4 Den ausgewählten Eintrag anklicken – die Chronik-Kurzinfo erläutert Ihnen den Begriff und führt zu tiefgehenden Informationen. Was prägte einen bestimmten Zeitabschnitt? Herausragende Künstler und Ereignisse werden optisch hervorgehoben. Die Zeitleiste von 3.000 vor Chr. bis heute. Zeittafeln zu den Epochen ermöglichen Ihnen eine rasche Orientierung. 5 Die CD-ROM Die Partitur zum Mitlesen. Die Noten der ausgewählten Instrumentengruppe sind hell unterlegt. Namhafte Künstler liefern Ihnen die Hörproben. Viola Den Dirigenten anklicken und das ganze Orchester spielt für Sie. Oder Sie wählen eine Instrumentengruppe aus. Deren Stimmführung können Sie dann deutlich heraushören. 6 Leseprobe Ausgewählte Artikel 1 Abou-Khalil Afrobeat *17.8.1957, Beirut, libanesischer 씮Ud-Spieler, Flötist und Komponist. In seiner Heimatstadt erlernte A. schon als Kind das Spiel auf der arabischen Kurzhalslaute Ud, floh 1978 wegen des Bürgerkriegs nach München. Dort begann er zunächst ein Hochschulstudium im Fach Querflöte und beschäftigte sich mit der Musik des Abendlandes. Aus dieser analytischen Perspektive heraus entdeckte er sein arabisches Erbe neu. Fortan trachtete er danach, mit verschiedenen Musikkulturen, namentlich der europäischen Klassik, des Jazz und der des arabischen Raumes eine neue Klangsprache zu schaffen. Westliche Kompositionstechnik kombinierte er dabei mit Jazz-Improvisation und den komplexen Metren und Skalen des Nahen Ostens. Zur Realisierung seiner Ideen arbeitete A. mit Musikern verschiedenster Disziplinen, unter ihnen 씮Charlie Mariano, das 씮 Kronos Quartet oder der französische Tubist Michel Godard. Zu seinen wichtigsten Aufnahmen zählen Roots And Sprouts (1990), Blue Camel (1992), The Sultan’s Picnic (1994), The Cactus Of Knowledge (2001) und Morton’s Foot (2004). s. franzen die Symphonien Haydns, Mozarts und Beethovens als Prototypen a.r Musik. Richard Wagner beschreibt den für ihn – im Vorausgriff auf sein Konzept des Gesamtkunstwerks – entscheidenden Übergang von der »reinen Instrumentalmusik« zur Verbindung von Musik und Sprache in Ludwig van Beethovens Neunter Symphonie als das Verlassen der »Schranken der absoluten Musik« (Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bd. II, Leipzig 41907, S. 61). Ähnlich, doch nun positiv ins Erstrebenswerte gewendet, versteht Eduard Hanslick Instrumentalmusik als die einzig wahre, »reine, absolute Tonkunst« (Vom Musikalisch-Schönen, Leipzig 1854, S. 20). Die Diskussion um die absolute Musik wird damit Teil des sogenannten Parteienstreits zwischen der 씮 »Neudeutschen Schule« und dem Kreis um Hanslick, wobei die Verwendung des Begriffs keineswegs einheitlich und ebensowenig auf die Instrumentalmusik beschränkt bleibt. Häufig tritt er in Opposition zur 씮 Programmusik. Ihrerseits in Abgrenzung zur Inhaltsästhetik des 19. Jahrhunderts propagieren später Vertreter der Neuen Musik des 20. Jahrhunderts die a. M. als eher intellektuelle, sachliche, von romantischen Vorstellungswelten unbeeinflußte und in sich formvollendete l’art pour l’art. Andererseits bildet die a. M. einen – unter anderen von Arnold Schönberg favorisierten – ästhetischen Gegenentwurf zur funktionalen, mithin im weitesten Sinne zweckgebunden konzipierten Musik vornehmlich der 20er Jahre. Eben darin, ein Gegenmodell zu bestimmten, jeweils aktuellen ästhetischen Strömungen und musikalischen Entwicklungen zu benennen, scheint letztlich auch die wesentliche Gemeinsamkeit dessen zu liegen, was seit dem 19. Jahrhundert als a. M. bezeichnet worden ist. l. jeschke ABOU-KHALIL, Rabih, ABSOLUTE MUSIK, verschieden konnotierte Beschreibung der (klassischen) Instrumentalmusik oder auch von Musik allgemein mit Hilfe des aus dem Lateinischen entlehnten Adjektivs »absolut«, welches wörtlich »losgelöst«, »frei« bedeutet. Die a. M. wird in diesem Sinne als frei von außermusikalischen Intentionen oder Programmen verstanden, in Anlehnung an die romantische Ästhetik Schellings oder Schlegels aber auch als umfassend, auf der höchsten Stufe stehend, vollendet. Gewicht und polemische Aussagekraft erhielt der Begriff vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, während der er insbesondere im deutschsprachigen Raum in Kritiken und ästhetischen Schriften geradezu inflationär verwendet wurde. Häufig gelten dabei die klassischen Instrumentalwerke und insbesondere AFROBEAT, urbane Form der nigerianischen Popularmusik. Als Schöpfer des A. gilt der Sänger, Saxophonist Afrobeat Allemande 2 und Bandleader 씮 Fela Kuti. Ende der 1960er kombinierte Kuti Einflüsse aus dem amerikanischen 씮 Soul und 씮 Funk von 씮 James Brown und aus dem Jazz à la 씮 Miles Davis mit traditionellen Rhythmen und Gesängen der Yoruba sowie dem 씮 Highlife. Kutis Bigbands zeichneten sich durch einen vielköpfigen, responsorischen Frauenchor, große Besetzung in der Blechblas- und Perkussions-Sektion und die innovative Rhythmengebung des Schlagzeugers Tony Allen aus. Den A. kennzeichnet des weiteren ein sozialkritisches Bewußtsein, das Kuti durch Kontakt mit den Black Panthers ausgebildet hatte: Seine harschen Texte im Broken English treten für ein geeintes Afrika ein, verdammen die Korruption der Machthabenden und beschreiben ihre Folgen für die Gesellschaft. Seit Kutis Tod (1997) hat sein Sohn Femi das Erbe des A. mit internationalem Erfolg angetreten, Schlagzeuger Allen pflegt eine psychedelische Variante. Darüber hinaus hat sich auch in New York eine kleine Szene etabliert, und zahlreiche amerikanische sowie europäische DJs verwenden in ihren Mixen Samples und Textur des A. in RISM). Es handelt sich hier um mehrteilige Tanzstücke im geraden Takt mit paarweise wiederholten 4-, 6- oder 8-Takt-Gruppen: Oberstimme der VII. Allemaigne für 4 Instr. aus T. Susato, Het derde musyck boexken, An 1551. Der A. kann – wie dem deutschen »Tantz« – auch ein schneller Nachtanz (Recoupe, Saltarello) im Dreiertakt folgen: s. franzen (frz., eig. »danse allemande« = deutscher Tanz; it.: allemanda; engl.: alman), geradtaktiger Tanz des 16.–18. Jahrhunderts. Der dem Namen entsprechende deutsche Ursprung der A. ist in den bürgerlichen deutschen Schreittänzen zu suchen, die im 16. Jh. unter der Bz. »Dantz« bzw. »Tantz« bekannt waren und die mit einem gesprungenen »Nachtantz« eine choreographische und musikalische Einheit bildeten. Die Geschichte der A. beginnt dann außerhalb Deutschlands um 1550 mit der Veröffentlichung einiger A.n für Laute bzw. für Instrumentalensemble in Sammeldrucken von Phalèse (RISM 154628 ), Le Roy & Ballard (RISM 155124 ) und Susato (1551, nicht ALLEMANDE J. S. Bach, Französische Suite Nr. 2 J. S. Bach, Partita Nr. 1 Almanda für Laute aus Carminum pro Testudine Liber IV, Löwen 1546. Nach Th. Arbeau (Orchésographie, 1589) wurde die A. (»une danse pleine de médiocre gravité«), die zu den hoffähigen Tänzen zählte, von mehreren Paaren getanzt. 3 Allemande Seit dem frühen 17. Jh. gehört die A. zu den beliebtesten Tanztypen sowohl in der Musik für Tasteninstrumente als auch in der Ensemble- und Lautenmusik. Für Virginal schrieben in England namentlich J. Bull und W. Byrd zahlreiche A.n, die manchmal mit Widmungsbezeichnungen versehen sind (z. B. The Duke of Brunswick’s Alman von Bull, The Queen’s Alman von Byrd). In der Ensemblemusik (für Violen und andere Instrumente) wurde die A. außer in England vor allem in Deutschland heimisch, nachdem der Engländer W. Brade dort die Bz. A. durch seine 1609–21 in Hamburg gedruckten Tanzsammlungen eingeführt hatte (um 1600 war bei Haßler, Hausmann u. a. noch die Bezeichnung »Deutscher Tanz« gebräuchlich). A.n finden sich nun häufig bei Schein (Banchetto musicale, 1617), Scheidt und ihren Zeitgenossen, und in der Mitte des 17. Jh. wurde die A. fester Bestandteil der deutschen Orchester- und Klaviersuite (씮 Suite), wo sie regelmäßig als 1. Satz steht. Gleichzeitig normalisiert sich ihre formale Gestaltung; sie ist meist zweiteilig mit Wiederholung der beiden Teile und zeigt den auch für andere Tanzsätze dieser Zeit charakteristischen harmonischen Verlauf 얍 : Tonika 씮 Dominante : 얍 : Dominante 씮Tonika: 얍. In Frankreich entwickelte sich im 17. Jh. im Bereich der Lautenmusik ein eigener A.n-Typ ohne die ausgeprägte 4-, 6- oder 8-Taktigkeit und die tanzmäßige Rhythmik. Statt dessen läßt sich hier in Verbindung mit dem 씮 Style brisé eine kontrapunktische Auflockerung beobachten. A.n dieser Art, die keine Tanz-, sondern Charakterstücke sind, begegnen im 17. Jh. u. a. bei D. Gaultier, im 18. Jh. u. a. in der Klaviermusik von J. S. Bach (z. B. in der 2. Französischen Suite). In Italien erscheint die A. in der 1. Hälfte des 17. Jh. vor allem in der Ensemblemusik, z. B. bei B. Marini (als Balletto Alemano oder Baletto alla Alemana). Später prägt sich dort auch ein besonderer A.-Typ aus. Er ist von flüssigerer, kontinuierlicher rhythmischer Bewegung und im allgemeinen homophon gehalten. Dieser italienische Typ erscheint u. a. in den Triosonaten von Vivaldi sowie in der Klaviermusik Rameaus (Nouvelles Suites de clavecin); auch Bach verwendet diesen Typ (z. B. in der Partita Nr. 1). In der formalen Gestaltung aller A.n-Typen bleibt es bei der herkömmlichen Zweiteiligkeit mit Wiederholung der beiden Teile, die im 18. Jh. in zunehmendem Maße durch melodische Fortspinnung und einen farbigeren harmonischen Verlauf gekennzeichnet sind. Jedoch geht im wesentlichen mit J. S. Bach die Geschichte der A. als einer musikalischen Gattung zu Ende, wenn auch noch um 1760 die A. in Paris als beliebter bürgerlicher Tanz bezeugt ist. Der »Deutsche Tanz« freilich lebt in der Folgezeit wieder auf, ohne direkt die Tradition der A. fortzusetzen (씮 Deutscher Tanz). Balanchine George Melitonowitsch Balanchine BALANCHINE, George (eig. Georgij) Melitonowitsch (eig. Balantschiwadse), * 9.(22.)1.1904 St. Petersburg, † 30.4.1983 New York; russ. Tänzer und Choreograph. 1914 trat er in die Kaiserliche Ballettschule ein, tanzte dann im Ballett des Marijnski-Theaters und studierte Musik am Kons. seiner Vaterstadt. 1925 engagierte ihn Diaghilew als Tänzer und Choreographen für seine »Ballets Russes«. Hierfür choreographierte er u. a. Apollon Musagète (1928) von Strawinski, mit dem er seitdem besonders eng zusammenarbeitete. Nach dem Tode Diaghilews (1929) wurde er Ballettmeister erst der Pariser Oper, dann in Kopenhagen, 1932 Choreograph der »Ballets Russes« in Monte Carlo. Anschließend gründete er in Paris eine eigene Gruppe, »Les Ballets 1933«. 1934 ging er in die USA, um die Leitung der »School of American Ballet« in New York zu übernehmen. Als Balletmeister der Metropolitan Opera arbeitete er fortan mit verschiedenen selbständigen Gruppen. 1939 wurde er amerikanischer Staatsbürger. Aus der Ballet Society von 1946 ging das »New York City Ballet« hervor, das er zu weltweitem Ruhm führte. In seinen letzten Lebensjahren hat B. choreographisch Balanchine Buena Vista Social Club auch an der Hamburgischen Staatsoper und an der Deutschen Oper in Berlin gearbeitet. B. gehörte zu den bedeutendsten Choreographen des Balletts, das er bei zunehmender Betonung des Tänzerischen vom Realismus weg zu einer neuklassischen Richtung führte. Das Instrumentarium des B. hat sich in verschiedenen B.-Landschaften (Mississippi, Texas, Carolina etc.) unterschiedlich ausgeprägt. Nach Gitarre und Piano bilden sich in den 30er Jahren standardisierende B.Gruppen. Bei der stärkeren Durchdringung der afro-amerikanischen Musik mit Elementen einer an der europäischen Kunstmusik orientierten Tonalität wird der originär modale B. mit Hilfe der Funktionsharmonik umgedeutet. Das Ergebnis ist die sog. Bluesformel, der in ihrer einfachsten Version das folgende 12taktige Schema zugrunde liegt. BHANGRA, Volkstanz aus dem Punjab (Nordwestindien), der urspr. während der Erntefeierlichkeiten gepflegt wurde (Hindi: bhang = Hanf). Sein kräftiger, durch die 씮 Dholak geschlagener Rhythmus und seine romantischen Texte verhalfen dem B. zu einer Adaption in den British Asian Communities englischer Metropolen, die ihn in den 1970ern mit westlichem Popinstrumentarium zu einem Disco-Tanz umfunktionierten. Pioniere des modernen B. waren die Band Alaap und die Sängerin Sangeeta. Der B. war in England zunächst nur unter den asiatischen Jugendlichen populär, wurde später aber auch vom britischen Radio entdeckt. In den 1990ern fanden eine Vielzahl von Fusionen zwischen B. und den aktuellen Stilen der Tanzclubs statt. Mit dem Vokabular des B. arbeiteten immer wieder einige Vertreter des sog. Asian Underground – DJs und Produzenten asiatischer Herkunft, die vorrangig indische Instrumente und Vokallinien mit Drum & Bass, 씮 House und Dub mischen. Wichtigste Künstler dieser neuen Spielart sind die Band Achanak, Apache Indian, der B. mit 씮 Reggae kreuzte, sowie die Produzenten Bally Sagoo und Talvin Singh. s. franzen BLUES. 1) Die aus der afro-amerikanischen Musikpraxis hervorgegangene, heute noch populärste Musikform, die in der Entwicklung des 씮 Jazz und des 씮 Rap eine maßgebliche Rolle spielt. Der einstimmig vorgetragenen, vokalen Form des B. liegt eine Stegreifdichtung in Strophenform zugrunde. Die Melodie wird mit Hilfe standardisierter Modelle gestaltet, die vor allem Übernahmen epischer Formen afrikanischer Volksmusik sind. Sämtliche Begebenheiten des täglichen Lebens werden in dieser im Black American English vorgetragenen Poesie reflektiert und haben in der Regel moralisierenden Charakter. Sie ist im Gegensatz zu der von den Weißen mit der Bz. B. (blue = schwermütig) vorgenommenen Charakterisierung unsentimental, direkt und anschaulich. Der B. zeichnet sich vor allem durch enge Anlehnung an den Sprachduktus, Zeilenmelodik (Phrasen), vehemente, neutrale Tongebung (Blue Notes) und Off-Beat-Rhythmisierung aus. Auch formal zeigt sich ein enger Zusammenhang zwischen Text und Melodie: Beide gliedern sich beispielsweise im 12taktigen B. in »Anrufung«, »Anrufungswiederholung« und »Antwort« (씮Call-and-Response-Pattern): Ein Sachverhalt wird formuliert (Statement); es folgt eine unveränderte oder leicht modifizierte Wiederholung und eine Begründung (Response). 4 Vom Beginn dieses Jahrhunderts bis in die 40er Jahre hinein lassen sich über 220 standardisierte Bluesformeln finden, die sich u. a. in den Spielweisen von Jazz, Rhythm & Blues oder Rock ’n’ Roll auf die heute meistbenutzte Standardformel reduzieren. In demselben Maß, wie die afroamerikanische Musik verstädterte, wurde aus dem ursprünglichen Country B. schließlich ein »sophisticated« und differenziert begleiteter City B., der 1920 erstmals auf Schallplatten aufgenommen wurde. Dessen Derivate wiederum prägten ein weites Feld der zeitgenössischen U-Musik. Zu den wichtigsten Bluessängern, die sich großenteils auch selbst begleiten, gehören (in chronologischer Folge): Blind Lemon Jefferson, Leadbelly (Huddie Ledbetter), Big Bill Broonzy, Jimmy Rushing, Josh White, Lightnin’ Hopkins, Sonny Terry und Brownie McGhee, Muddy Waters; bei den Frauen Ma Rainey, Ida Cox, Bessie Smith, Billie Holiday, Bertha Chippie Hill, Dina Washington. – 2) Um 1920 in Amerika aufgekommener und seit etwa 1930 auch in Europa verbreiteter Gesellschaftstanz im langsamen 4/4-Takt. BUENA VISTA SOCIAL CLUB, kubanische Allstar-Formation. Ins Leben gerufen vom Sänger, 씮Tres-Spieler und Arrangeur Juan De Marcos Gonzalez (*1954, Havanna), der 1996 Stars der 1940er und 1950er in den staatlichen EGREM-Studios von Havanna versammelte, um die nach der kubanischen Revolution niedergegangenen Stile wie 씮 Son und 씮 Bolero zu beleben. Zur Stammformation gehörten u. a. die Vokalisten Compay Segundo (*18.11.1907, †13.7.2003), Ibrahim Ferrer (*20.2.1927) und Omara Portuondo (*1930), der Bassist Orlando »Cachaíto« López (*1933) und der Pianist Rubén González (*26.9.1919, †8.12.2003). Für die Aufnahmen tat sich González mit dem britischen Produzenten Nick Gold und dem amerikanischen Gitarristen 씮 Ry Cooder zusammen. Unterstützt durch eine Musikdokumentation vom Wim Wenders erlangte der B. weltweit enorme Popularität: Die CD verkaufte sich millionenfach, am bekanntesten wurde das Lied 5 Buena Vista Social Club Dvořák »Chan Chan«. Der B. hat bei einem weitgefächerten Hörerkreis ein großes Interesse an kubanischer Musik angeregt. Etliche Solo-Produktionen seiner Mitglieder erschienen seit dem Startalbum: Introducing Rubén González (1997), Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer (1999), Cachaíto (2001), Buena Vista Social Club Presents Manuel »Guajiro« Mirabal (2004). s. franzen ( c – e – g), für Moll die kleine Terz ( c – es – g) des 씮 Dreiklangs. Den D.-Dreiklang als 4., 5. und 6. Partialton aus der Obertonreihe abzuleiten, ist seit J.-Ph. Rameau (1722) üblich; die akustische Begründung des Moll ist dagegen bis heute umstritten (씮 Dualismus). – Die Bezeichnung D. geht auf die mittelalterlichen 씮 Hexachorde zurück: das Hexachord f – d mit dem Ton b, der aufgrund seiner runden Schreibweise »b rotundum« oder »b molle« genannt wurde, hieß hexachordum molle; das Hexachord g – e dagegen hexachordum durum, da sein Ton h aufgrund quadratischer Schreibung »b quadratum« oder »b durum« genannt wurde (씮 B). Diese etymologische Herleitung widerspricht der Auffassung, D. und Moll als »hart« und »weich« charakterisierten den D.- und Moll-Dreiklang; gleichwohl empfand G. Zarlino (1558) den D.-Dreiklang als heiter, den Moll-Dreiklang als traurig – eine Anschauung, die über das Tongeschlecht hinaus auf das Problem des Charakters der 씮Tonarten verweist. Durch Glarean war die D.-Skala als ionischer Modus den acht 씮 Kirchentönen zugefügt worden: unter Berufung auf antike Schriften, die von mehr als acht Modi sprechen, und gestützt durch die Beobachtung, daß zu seiner eigenen Zeit der ionische C-Modus transponiert als FModus mit dem Ton b im Gebrauch war, ergänzte er in seiner Zwölftonartenlehre (Dodekachordon, 1547) die acht Kirchentöne um den aeolischen und ionischen Modus sowie deren plagale Skalen (씮 plagal). Anfang des 17. Jh. spricht J. Lippius (Synopsis musicae novae, 1612) vom D.-Dreiklang noch als einer »Trias harmonica perfecta«, J. Kepler (Harmonice Mundi, 1619) nennt die D.-Skala »Genus durum«, J. G. Walther (Musicalisches Lexicon, 1732) »Modus major«. – Für die Ausbreitung der D.-Moll-Tonalität kommt der Errechnung der gleichschwebenden 씮 temperierten Stimmung durch A. Werckmeister (1698) hervorragende Bedeutung zu. Die dur-moll-tonale Musik vom 17. bis 19. Jh. beruht auf den Prinzipien von D. und Moll: Ordnungsprinzip des D.-Moll-Systems ist die Tonalität, die Bezogenheit von Tönen und Akkorden auf ein tonales Zentrum (씮Tonika) und deren hierarchische Ordnung innerhalb dieses tonalen Bezugssystems. Die Funktionstheorie beschreibt dieses System, das einerseits an eine harmonisch inspirierte D.-Moll-Melodik gebunden ist, andererseits durch die Akkordfunktionen 씮Tonika, 씮 Subdominante und 씮 Dominante ausgeprägt wird. Durch fortschreitende Chromatisierung und kompliziertere Akkordbildungen wurde das D.-Moll-System seit dem 19. Jh. mehr und mehr in Frage gestellt. Wagners Tristan signalisiert die »Krise der Dur-Moll-Tonalität« (E. Kurth). Eine Konsequenz aus dieser Entwicklung war der Umschlag in die 씮 Atonalität. c. kühn DHOLAK, Dhol, Dholki, Dholaka, eine vor allem in Nordindien populäre Trommel, die zur Begleitung der klassischen Vokstänze und zur Begleitung religiöser Lieder, aber, da der Klangcharakter im Gegensatz zur 씮Tabla und zur 씮 Mridanga neutral bleibt, besonders in der Pop-, Tanz- und Filmmusik verwendet wird. Der zylindrische, ca. 55 cm hohe Korpus ist beidseitig mit einem Fell (Ziege, Kalb) mittels einer Schnur- oder Schraubvorrichtung bespannt. Angeschlagen wird die D. mit Fingern, Hand oder dünnen Holzschlägeln. Typisch sind die Glissandoeffekte, die durch Druck mit dem Handballen erzeugt werden. s. fink * 19.6.1948 Rangun (Burma), † 25.11. 1974; engl. Folk-Sänger und Gitarrist. In der Tradition von Van 씮 Morrison oder Tim Buckley stehend, bevorzugte D. sanfte, fragile Balladen, die in ihrer überaus großen Schwermut zunächst nur wenig Anklang fanden. 3 LPs zwischen 1969 und 1972 reflektierten den fehlenden Lebensmut des u. a. wegen seiner Erfolglosigkeit in Depressionen verfallenen Künstlers. Kaum noch fähig zur kreativen Arbeit, nahm D. in den letzten Jahren vor seinem Tod nur noch sporadisch Lieder auf, diese zumeist solo auf der Akustikgitarre. Seine Talente als Songwriter wurden erst posthum gewürdigt, so bes. 1986, als Zusammenstellungen der besten sowie einiger bis dahin unveröff. Songs nicht nur bei der Kritik Anerkennung fanden. D.s Werk umfaßt die Alben Five Leaves Left (1969), Bryter Layter (1970), Pink Moon (1972), Time of No Reply (1986) und Fruit Tree (1986). c. hoffmann DRAKE, Nick, D. ist neben 씮 Moll eines der beiden Tongeschlechter, auf denen die tonale Musik beruht. Die D.Skala (c – d – e – f/g – a – h – c) ist aus zwei gleich gebauten 씮Tetrachorden zusammengesetzt, die jeweils mit einem Halbton enden; der Halbtonschritt von der 7. zur 8. Stufe stellt den eigentlichen, zur Auflösung strebenden Leitton der Skala dar. Demgegenüber zeigt die asymmetrisch aufgebaute natürliche Moll-Skala (a – h – c – d – e – f – g – a) Halbtonschritte zwischen der 2. und 3. (h – c) sowie zwischen der 5. und 6. Stufe (e – f). In Analogie zur D.-Skala können die 7. Stufe (harmonisches Moll) oder die 6. und 7. Stufe (melodisches Moll) erhöht werden; umgekehrt kann sich die D.-Skala durch Übernahme der kleinen Sexte der Moll-Skala annähern: c – d – e – f – g – as – h – c bezeichnet das harmonische Dur. Maßgeblich für D. ist also letztlich die große DUR. * 8.9.1841 Nelahozeves bei Prag, † 1.5.1904 Prag; tschech. Komponist. Musikalische DVOŘÁK, Antonín, Dvořák Dvořák 6 er bis 1895 leitete und von wo aus er dem amerikanischen Musikleben mannigfache Anregungen vermittelte, wo er aber auch Eindrücke für sein eigenes Schaffen in sich aufnahm. In die Heimat zurückgekehrt, setzte D. 1895 seine Lehrtätigkeit am Prager Konservatorium fort, dessen Direktor er seit 1901 war. Antonín Dvořák, Fotografie (um 1900) Grundlagen erhielt er als Chorknabe und als Geiger in Tanzkapellen. 16jährig wurde er in die Organistenschule des Prager Konservatoriums aufgenommen. Später spielte er als Bratscher u. a. in der Kapelle von K. Komzák und 1866–71 im Orchester des Prager Interimstheaters unter Fr. Smetana. 1872 wurden seine ersten größeren Werke (Kammermusik und Lieder) öffentlich aufgeführt; im gleichen Jahr dirigierte Smetana seine 2. Symphonie. 1873 heiratete D. Anna Cermák, die Tochter eines Goldschmieds. Nachdem er seine Tätigkeit am Theater aufgegeben hatte, wirkte er einige Jahre als Organist an St. Adalbert in Prag und widmete sich hauptsächlich der Komposition. In dieser Zeit lernte er auch J. Brahms kennen, dem er eine lebenslange Freundschaft bewahrte und durch den er Kontakt mit dem Verleger Simrock erhielt. Dessen Veröffentlichung der Slawischen Tänze und der Klänge aus Mähren (1878) machten D. zunehmend in ganz Europa bekannt und berühmt. Ein weiteres entscheidendes Ereignis war der große Erfolg des Stabat Mater in London (1883) und New York (1884), mit dem sich sein Ruhm gerade in England und in den Vereinigten Staaten festigte. 1890 wurde D. Lehrer am Konservatorium in Prag. 1892 ließ er sich beurlauben und nahm eine Einladung des National Conservatory in New York an, das Werke : 1 ) Instr.-Werke : a ) Kammermusik: Für Klv. zu 2 Händen: Tänze (Polka, Menuette, Walzer, Mazurkas, Dumkas, Furiant) · Charakterstücke, darunter: Silhouetten, op. 8 (1879) · Humoresken, op. 101 (1894), bekannt daraus vor allem Nr. 7 Ges-Dur, nicht zuletzt durch die zahlr. Bearb. fremder Hand, auch vokal Eine kleine Frühlingsweise. – Für Klv. zu 4 Händen: Slawische Tänze, I: op. 46 (1878) · II: op. 72 (1886), auch für Orch. bearb. · Aus dem Böhmerwalde, op. 68 (1884) u. a. Charakterstücke. – Für V. u. Klv., u. a.: Romantische Stücke, op. 75 (1893) · Sonatine, op. 100 (1893) · einige Stücke für Vc. u. Klv. · Streichtrio, op. 65 (1883) · Trio (Terzett) für 2 V. u. Va., op. 74 (1887) · 2 Klv.-Trios, op. 21 (1875), op. 26 (1876) u. op. 90 (Dumky-Trio) (1891) · 17 Streichquartette, davon mit Opuszahlen op. 10 (1870), 16 (1874), 80 (1876), 34 (1877), 51 (1879), 61 (1881), 96 (Nigger-Quartett) (1893), 105 (1895) u. 106 (1895) · Klv.-Quartette, op. 23 (1875) u. op. 87 (1889) · Streichquintette op. 1 (1861), ohne Opuszahl (1872), op. 77 (1875), op. 97 (1893) · Klv.-Quintett, op. 81 (1887). – b ) Für Orch.: 9 Symphonien (die Numerierung v. 1–9 gemäß der Reihenfolge ihrer Entstehung ist erst neuerdings üblich · die alte Numerierung, die v. D. nur für die 5 letzten Symphonien durchgeführt war, ist in römischen Ziffern hinzugefügt. Für die ersten 5 Symphonien hatte D. Opuszahlen vorgesehen, die aber später anderweitig vergeben wurden: op. 3, 4, 10, 13 u. 24): Nr. 1 u. 2 (1865), Nr. 3 (1873), Nr. 4 (1874), Nr. 5 (III), op. 76 (1875), Nr. 6 (I), op. 60 (1881), Nr. 7 (II), op. 70 (1884), Nr. 8 (IV), op. 88 (1889), Nr. 9 (V) Aus der neuen Welt, op. 95 (1893) · Serenade für Str., op. 22 (1875) · Symphonische Variationen, op. 78 (1877) · Serenade für Bläser, Celli u. Kontrabässe, op. 44 (1878) · 3 Slawische Rhapsodien, op. 45 (1878) · Orch.Fassung der Slawischen Tänze, op. 46 u. 72 (1878, 1886) · Ouvertüre Husitská, op. 67 (1883) · 5 Symphonische Dichtungen nach Balladen v. J. Erben, op. 107–111: Die Mittagshexe, Das goldene Spinnrad, Die Waldtaube, Heldenlied · ferner einzelne weitere Orch.-Stücke. – Konzerte: für Klv., op. 33 (1876), für V., op. 53 (1880), für Vc., op. 104 (1893). – 2 ) Vokal- u. Bühnen-Werke : Lieder für SingSt u. Klv., u. a.: Zigeunermelodien, op. 55 (1880) · Biblische Lieder, op. 99 (1894), teilweise v. D. für Orch. bearb. · Duette mit Klv., darunter: Klänge aus Mähren, op. 32 (1876) für Sopran u. Alt · einige a cap. Chöre · Werke für Chor u. Orch. mit u. ohne Soli, u. a.: Stabat Mater, op. 58 (1877), UA: Prag 1880 · Oratorium Die heilige Ludmila, op. 71, UA: Leeds 1886 · Messe D-Dur (1887) · Requiem, op. 89 (1890), UA: Birmingham 1891 · Te Deum, op. 103, UA: New York 1892. – 10 Opern, darunter die tragische Oper Wanda (1875), UA: Prag 1876 · komische Oper Der Bauer ein Schelm (1877). UA: ebd. 1878 · Dimitrij (1881–82), UA: ebd. 1882 · lyrisches Märchen Rusalka (1900), UA: ebd. 1901. D.s kompositorisches Schaffen läßt sich etwa in vier Perioden einteilen, deren erste die Werke bis zum Stabat Mater (1876) umfaßt. In dieser Zeit stand D. unter dem deutlichen Einfluß der Musik der deutschen Romantik und J. Brahms’, was sich sowohl in der Kammermusik 7 Dvořák (Streichquartette op. 16 und 86, Klavierquartett op. 23) wie in den Orchesterwerken (Symphonien Nr. 1–5) zeigt. In einigen Werken dieser Zeit begann D. bereits auch Anregungen aus der tschechischen und slawischen Volksmusik zu verarbeiten, die dann entscheidend für die zweite Periode (ca. 1878–91) wurden. Zu nennen sind hier vor allem die Slawischen Rhapsodien (1878), das Streichquartett op. 51 (1879), das eine 씮 Dumka enthält, die Ouverture Husitská (1883) und das Dumky-Trio (1891). Die Oper Dimitrij (1881) und das Oratorium Die heilige Ludmila (1885–86) nehmen auch durch ihr Sujet auf den nationalen Bereich bes. Bezug. Mit dem letzteren Werk setzte D. den mit dem Stabat Mater eingeschlagenen Weg als Schöpfer großer oratorischer Werke fort, der im Requiem (1890) zu einer der bedeutendsten Requiemvertonungen des 19. Jh. führte. Auf dem Gebiet der Orchestermusik zeigen in dieser zweiten Periode vor allem die Symphonien Nr. 6–8 und die Konzerte für Violine und Klavier D. auf der Höhe seiner Kunst, zumal in der reichen melodischen Erfindung und in der brillanten Instrumentierung. Mit dem Aufenthalt in Amerika begann für D. eine dritte Phase seines Schaffens. Ein neuer Ton klingt in den dort entstandenen Werken an. Symptomatisch dafür ist die Symphonie Nr. 9 mit ihrem bezeichnenden Untertitel Aus der neuen Welt und mit ihren an Spirituals und amerikanische Songs gemahnenden Melodien. Ähnliches gilt für die Biblischen Lieder (1894), mit denen er zugleich einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des geistlichen Sololieds geleistet hat. Auch das Cellokonzert in h-moll, bis heute vielleicht das populärste Werk D.s, enthält manche Anklänge an Melodien der neuen Welt. Nach seiner Rückkehr in die Heimat konzentrierte sich D. vornehmlich auf die Gattung der Symphonischen Dichtung (Zyklus von 5 Werken nach Balladen von J. Erben, 1895–96) und auf die Oper. Außerhalb seiner tschechischen Heimat konnte er sich aber nur mit Rusalka (1900) gegenüber der zeitgenössischen Opernproduktion durchsetzen. D. hat mit Smetana die Weltgeltung der tschechischen Musik begründet. Während aber bei diesem das nationale Idiom einen elementaren Grundzug seines Stils ausmacht, ist für D. das Nationale nur ein – wenn auch im Einzelfall starker – Quell der musikalischen Inspiration. Er wird gewissermaßen aufgesogen von einer für seine Zeit seltenen Universalität des künstlerischen Schaffens, das inmitten des symphonischen, kammermusikalischen und oratorischen Erbes des 19. Jh. bis heute einen unverwechselbaren Platz einnimmt. Ausgaben : GA, hrsg. v. C. Šourek u. a. (Pr 1955 ff.), 6 Serien, bisher 42 Bde. erschienen. Eötvös EÖTVÖS, Peter, *2.1.1944 Székelyudvarhely (Transsylvanien); ungar. Dirigent und Komponist. E. studierte 1958–66 an der Musikakademie Budapest und anschließend an der Musikhochschule Köln. Seit 1962 komponierte er Film- und Theatermusik, 1968–76 war er Pianist und Schlagzeuger im Ensemble von K. Stockhausen und 1971–79 arbeitete er als Assistent im elektronischen Studio des WDR Köln. E. ist einer der international bekanntesten Interpreten der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. 1979–91 leitete er das Ensemble InterContemporaine, 1985–88 war er erster Gastdirigent des BBC Symphony Orchestra London, ab 1994 Chefdirigent des Radio-Kammerorchesters Hilversum.1991 gründete er das Internationale EötvösInstitut für junge Dirigenten. 1985 wurde er Professor für Dirigieren am Internationalen Bartók-Seminar in Szombathely. Seit 1991 ist er – abgesehen von einer Professur an der Musikhochschule in Köln 1998–2001 – Professor für Dirigieren und Ensemblespiel an der Musikhochschule Karlsruhe. E. erhielt zahlreiche internationale Preise und Auszeichnungen. Seine Kompositionen sind vorwiegend Musik aus, über und als Sprache und beeinflußt durch ungarische Volksmusik und Erzähltraditionen. Abgesehen von mehreren Bühnenwerken handelt es sich bei vielen seiner Stücke um imaginäres Theater und Sprachimitationen mit vokalen, instrumentalen oder elektronischen Mitteln. In eklektizistischer Vielstimmigkeit vereinen seine Werke sprechende und rituelle Gesten, erzählenden Duktus und theatralische, vokale und instrumentale Aktionen mit außermusikalischen Elementen, Naturklängen, Bildern, Szenen, Handlungen, Texten. Werke: 1) Instr.-Werke: Kosmos (1961/1999) für 1 oder 2 Klaviere · Mese (»Märchen«, 1968) Sprachkomposition auf Tonband · Cricket music (1970) für Tonband · Music for New York (1971) für Sopran-Sax. u. Schlagzeug-Improvisation mit Tonband · Elektrochronik (1974) für Stereotonband · Windsequenzen (1975/1987) für Fl., Ob., 2 Klarn., Bassklar., Tuba, Kb., Trommel u. Akkordeon · Now Miss! (1972) für V., Synthesizer u. Stereotonband · Grillenmusik (1979) für Tonband · Intervalles – Interieurs (1981) für Klar., Pos., V., Vc., Schlagzeug u. Stereotonband · Steine (1985–90, rev. 92) für Ensemble · Chinese Opera (1986) für 28 Instrumentalisten · Korrespondenz – Szenen für Streichq. (1992/93) · Psalm 151 (in memoriam Frank Zappa) (1993) für Schlagzeug solo oder 4 Schlagzeuger · Triangel (1993) Aktion für 1 kreativen Schlagzeuger und 27 Musiker · Psychokosmos (1993) für Cimbalom solo u. traditionelles Orch. · Derwischtanz (1993/2000) für Klar. solo · Zwei Promenaden (1993/ 2001) für 2 Schlagzeuger, Keyboard u. Tuba · Shadows (1996) für Fl., Klar. u. verstärktes Orch. · Psy (1996) für Fl., Vc. u. Cimbalom · Der Blick (1997) Multimedia, Video u. Tonband · Replica (1998) für Va. Solo u. Orch. · Two Poems to Polly (1998) Solo für einen sprechenden Eötvös Getz Cellisten · zeroPoints (1999) für Orch. Brass – The Metal Space (1999) Aktionsstück für 7 Blechbläser u. 2 Schlagzeuger · 600 Impulse (2000) für Bläserensemble u. Schlagzeug · Paris-Dakar (2000) für Pos. solo u. Bigband · Snatches of a Conservation (»Gesprächsfetzen«) (2001) für Doppeltrichter-Trompete u. Ensemble · désaccord (in memoriam B. A. Zimmermann) (2001) für 2 Va. · Jet Stream (2002) für Solo-Tromp. u. Orch. · Erdenklavier – Himmelklavier (in memoriam Luciano Berio) (2003) für Klv. solo · Un taxi l’attend, mais Tchékhov préfere aller à pied (2004) für Klv. solo. – 2) Vokal-Werke: Drei Madrigalkomödien für 12 Solostimmen (1963–90) · Endless Eight I (1981) für 3 Soprane, 3 Alt, 3 Tenöre, 3 Bässe, 3 Schlagzeuger, E-Git. u. 2 Hammondorg. · Endless Eight II – Apeiron musikon (1988/89) für 2 Soprane, 2 Alt, 2 Tenöre, 2 Bässe, doppelten gem. Chor, 2 Schlagzeuger u. Synthesizer · Atlantis (1995) für Knabenchor, Bariton, Cimbalom solo, virtuellen Chor (Synthesizer) u. gr. Orch. · Zwei Monologe (1998) für Bariton u. Orch. · IMA (»Gebet«) (2001/02) für gr. gem. Chor u. Orch. – 3) BühnenWerke: Harakiri (1973) Musiktheater auf einen Text von István Bálint · Radames (1975/97) Kammeroper auf ein eigenes Libretto nach Texten u. a. von G. Verdi u. M. Niehaus · Drei Schwestern (1996/97) Oper in drei Sequenzen nach dem gleichnamigen Drama von A. Tschechow · As I crossed a Bridge of Dreams (1999) Klangtheater auf Texte einer japanischen Hofdame des 11. Jahrhunderts. · ILe Balcon (2002) comédie lyrique nach J. Genet · Angels in Amerika (2004) Oper in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Theaterstück von T. Kusher. – 4) Schriften: Wie ich K. Stockhausen kennenlernte, in: Feedback Papers 16 (1978), Nachdruck Köln 1979, S. 421 · Penser a Bruno Maderna, in: Bruno Maderna. Festival d’Automne à Paris 1991, S. 52–53 · »Meine Musik ist Theatermusik« – P. E. im Gespräch mit M. LORBER , in: MusikTexte 59, Köln 1995, S. 7–13 · »Ich sehe mich als ›Testpiloten‹ für Neue Musik« – P. E. im Gespräch mit R. Ulm, in: »Eine Sprache der Gegenwart« – musica viva 1945–1995, hrsg. von R. Ulm, München 1995, S. 332– 339 r. nonnenmann feiert wurde. Auf weiteren Alben schwenkte E. auf einen rein akustischen Stil um und avancierte mit Miss Perfumado (1992) zu einem der gefragtesten Stars der 씮Weltmusik. Mit ihrem berühmtesten Lied Sodade war sie im Soundtrack zu Emir Kusturicas filmischem Balkan-Epos Underground zu hören. Eine Synthese zwischen kapverdianischer und kubanischer Musik unternahm sie auf dem Album Café Atlantico (1999). EVORA, Cesaria, *27.8.1941, Mindelo, Kapverdische In- seln; Sängerin. E. stammt von der Insel Sao Vicente, wo sie sich als Jugendliche die Interpretation der traditionellen kreolischen Liedformen aneignete. Hierbei handelt es sich um die Morna (getragen, melancholisch) und die Coladeira (belebter), deren Entwicklung aus der brasilianischen 씮 Modinha und dem afrikanischen Lundu vermutet wird. Nachdem E. jahrzehntelang in den Bars ihrer Heimatstadt aufgetreten war, kam sie 1985 auf Einladung einer portugiesischen Frauenorganisation nach Portugal, um Konzerte zu geben. In Paris nahm sie ihr erstes, mit karibischem 씮 Zouk vermischtes Album La Diva Aux Pieds Nus (1988) auf, das in den kapverdianischen Exilgemeinden der ganzen Welt ge- 8 s. franzen GESZTY, Sylvia, * 28.2.1934 Budapest; dt. Sängerin (Sopran) ungarischer Herkunft. Sie wurde 1952–59 am Konservatorium und an der Musikhochschule in Budapest ausgebildet und debütierte dort 1959 am Opernhaus. 1961–70 gehörte sie der Berliner Staatsoper an und gastierte u. a. an der Komischen Oper in Berlin, in London, Hamburg, Moskau, Wien und in Rom sowie bei den Edinburgher (seit 1966) und den Salzburger (seit 1967) Festspielen. Seit 1972 ist sie Mitglied der Staatsoper in Stuttgart und singt daneben als Gast an allen bedeutenden Bühnen Europas. G., die sich u. a. als brillante Mozartsängerin profilierte, zählt zu den bedeutendsten Koloratursopranistinnen der Gegenwart. Sie tritt oft auch in klassischen Operetten auf. Bedeutende Erfolge hat sie ebenso als Oratorienund Liedsängerin. Sie lehrt seit 1975 als Prof. Gesang an der MH in Stuttgart. (Stanley), * 2.2.1927 Philadelphia, † 6.6. 1991 Los Angeles (Kalifornien); amerik. Jazzmusiker (Tenorsaxophon). G. wurde mit 15 Jahren Berufsmusiker und spielte 16jährig bei Jack Teagarden, der sein Vormund wurde. Nach Engagements in verschiedenen Bands, u. a. 1943–45 bei Stan Kenton, danach u. a. bei Jimmy Dorsey und Benny Goodman, leitete er 1947 ein eigenes Trio, bildete im selben Jahr mit den Saxophonisten Herbie Stewart, Jimmy Giuffre und Zoot Sims die jazzgeschichtlich bedeutsame Gruppe Four Brothers im Orchester Woody Herman, mit dem er Early Autumn einspielte. Seitdem galt er als überragender, am 씮Cool Jazz orientierter Balladeninterpret. 1949 hatte er ein eigenes Quartett, unternahm 1951 eine Skandinavientournee, hatte danach verschiedene Gruppen, war 1955 wieder in Skandinavien, reiste danach durch die USA, ging 1957/58 erneut nach Europa und blieb anschließend 3 Jahre in Kopenhagen. In die USA zurückgekehrt, leitete er dort 1961 ein eigenes Quartett und machte 1962 mit dem Gitarristen Charlie Byrd den Bossa Nova populär (LP Jazz Samba). In den 60er Jahren wandte er sich wieder mehr dem Bebop und dem Cool Jazz zu und nahm den Vibraphonisten Gary Burton in seine Gruppe. In den 70er Jahren präsentierte er die Pianistin Joanne Brackeen. GETZ, Stan 9 Gould Klezmatics Mainstream Jazz, bei dem das Improvisieren über ein festes Repertoire-Stück (Standards) gepflegt wird, charakteristisch. m. pfleiderer KHALED (Khaled Hadj Brahim), *29.2.1960 Oran; alge- rischer Sänger. K. gilt als der international bekannteste Vertreter des 씮 Raï. In seiner Jugend sang er bei Hochzeiten und Festen in der Nachbarschaft traditionelle Lieder, eiferte zugleich seinen Idolen Johnny Hallyday und 씮 Elvis Presley nach. Als er anfing, Raï zu singen, hatte sich dieser gerade durch Innovationen an die westliche Rockmusik angenähert. Wie etliche algerische Sänger nannte sich K. zunächst »Cheb« (Junge), um die jugendliche Herangehensweise an das Genre zu unterstreichen. Durch einen Auftritt in Paris 1986 brachte K. den Raï nach Europa. Das mit dem Amerikaner Don Was produzierte Album N’ssi N’ssi (1993) begründete seinen internationalen Ruhm und verlieh seinem Raï Züge des 씮 Funk. Sein bekanntestes Album Sahra entstand 1997 mit Jean-Jacques Goldman, es enthielt den Hit Aïcha. Immer wieder hat K., wie etwa auf Ya-Rayi (2004), Raï, traditionelle Stile des Maghreb und Elemente aus der 씮 Salsa in seinen Liedern kombiniert. s. franzen (bürgerlich Carole Klein), * 9.2.1942 Brooklyn/New York, amerikanische Sängerin und Songschreiberin. K. hatte bereits als Kind Klavierunterricht und arbeitete später als Sessionsängerin, bevor sie zusammen mit ihrem Mann Gerry Goffin zu einem der erfolgreichsten Songschreiber-Duos der USA wurden. Carole schrieb die Musik und Gerry die Texte zu weit über 100 Songs, die sie meist an bereits etablierte Künstler verkauften. Einige ihrer größten Hits in den 60er Jahren waren »Will You Love Me Tomorrow«, »Locomotion« und »Go Away Little Girl«. Ihren ersten eigenen Charterfolg hatte K. mit »It Might As Well Rain Until September« im Jahre 1962. Nach dem Scheitern ihrer Ehe 1967 zog sie nach Los Angeles und verfaßte jetzt auch die Texte zu ihrer Musik selbst. Mit ihrer einfühlsamen, ausdruckstarken Stimme und meist sanfteren Klängen aus Rythm & Blues Wurzeln kam sie sensationell an, und von ihrem Album »Tapestry« (1970), für das sie 1972 vier Grammy Preise erhielt, wurden weltweit über 14 Millionen Stück abgesetzt. In den 80er Jahren zog sich Carol King zunehmend aus dem Showgeschäft zurück. 1990 wurden sie und Gerry Goffin in die Rock ’n’ Roll Hall Of Fame aufgenommen. Weitere LP’s sind u. a. Carole King and The City (1968), Wrap Around Joy (1974), Pearls (1980), City Streets (1989) und Colour Of Your Dreams (1993). m. falk KING, Carole Glenn Gould (1958) GOULD, Glenn Herbert, * 25.9.1932 Toronto, † 4.10. 1982 ebd.; kanadischer Pianist. Nach Studien bei A. Guerrero am Kons. in Toronto gab er 1946 sein erstes öffentliches Konzert. 1955 debütierte er in den Vereinigten Staaten, 1957 in Europa sowie (als erster kanadischer Künstler) in der Sowjetunion. G. erklärte 1964 – frustriert durch die vielfältigen Zwänge des Konzertbetriebs – seinen Abschied von der Bühne und widmete sich neben Rundfunkaufnahmen fortan sehr intensiv dem Medium Schallplatte. Dabei ging G. häufig auch in interpretatorischer Hinsicht neue Wege, was ihm, gekoppelt mit seiner unorthodoxen Lebensführung, nicht selten den Ruf eines Exzentrikers einbrachte. Unter seinen Einspielungen ragen Aufnahmen von Werken Bachs, Beethovens, Brahms’ sowie von Kompositionen der Zweiten Wiener Schule als nachgerade legendär hervor. G. trat auch als Komponist hervor. r. noltensmeier JAM SESSION, Bz. für ein informelles Zusammenspiel im Jazz, bei dem die Improvisationen der Musiker ganz im Mittelpunkt stehen. In der Swing-Ära der 30er Jahre entstanden, sind J. S.s sowohl als Experimentierfeld für neue stilistische Entwicklungen, z. B. des 씮 Bebop der 40er Jahre, als auch für den konventionellen KLEZMATICS, The; New Yorker 씮 Klezmer-Band. Die international bekanntesten Exponenten der US-amerikanischen Klezmer-Szene gründeten sich 1986 um den Klezmatics Konzert 10 Jazztrompeter Frank London, die Violinistin Alicia Svigals und den Sänger Lorin Sklamberg. Zunächst orientierten sie sich an alten Aufnahmen osteuropäischer Musiker und bildeten dann ihren eigenen Stil aus, der Jazz- und Rock-Züge mit dem Klezmer vereint und bei Puristen umstritten ist. The K. pflegen intensive Kontakte zu Musikern aus anderen Disziplinen von Klassik über Free Jazz bis hin zum Gospel, sie spielten u. a. mit John Zorn, 씮 Itzhak Perlman und 씮Giora Feidman. Zu ihren wichtigsten Veröffentlichungen zählen Jews With Horns (1994) und die Kollaboration mit der israelischen Diva Chava Alberstein, The Well (1998). s. franzen (engl.: double bassoon, contrabassoon; frz.: contrebasson; it.: contrafagotto; span.: contrafagot), Doppelrohrblattinstrument mit enger, konisch gebohrter, mehrfach umgelegter Röhre (Länge des Rohres ca. 593 cm), verlängert durch ein S-förmiges Anblasrohr, auf welches das Doppelrohrblatt aufgesteckt wird, sowie nach unten gerichteter Metallstürze und einem Stachel zum Aufstützen des Instruments. Es erklingt eine Oktave tiefer als das 씮 Fagott (Notierung 1 Oktave höher) und hat mit C-Stürze einen Tonumfang von C1-g, bei Verwendung der A-Stürze von A1-g (a). Die tiefen Töne haben einen vollen warmen Klang, während die hohen Töne leise sind. Die Entwicklung, die zum K. führte, setzte bereits um 1620 ein; nach M. Praetorius (Syntagma musicum II, 1619) habe der Berliner Musiker Hans Schreiber ein solches Instrument (Fagot contra) bauen wollen. Das älteste erhaltene Exemplar stammt von Andreas Eichentopf aus Leipzig (1714). 1727 wurde ein K. von Thomas Stanesby (London) bei Aufführungen Händelscher Werke verwendet. Im Laufe des 18. Jh. wurde das Instrument bes. in Österreich vorrangig für die Militärmusik gebaut, aus der es im 19. Jh. durch die Entwicklung von klangvolleren tiefen Blechblasinstrumenten (씮Tuba) verdrängt wurde. Der Bedarf an Kontrabaßinstrumenten in der Militärmusik führte zu zahlreichen Experimenten, um die Klangqualität und vor allem die Lautstärke des Instruments zu verbessern, u. a. zum Universalkontrabaß oder Tritonikon (1839) von Schöllnast & Sohn (Preßburg), einem Kupfer-K. mit großen geschlossenen Klappen, die ein klaviermäßiges Spiel erlaubten. C. W. Moritz (Berlin) benutzte diesen Mechanismus sogar dazu, auf seinem Klaviatur-K. eine Klaviertastatur mit weißen und schwarzen Unter- und Obertasten anzubringen (Patent 1856). Für die musikalische Verwendbarkeit des K. wichtiger war jedoch das Kontrabassophon (1850) von H. J. Haseneir (Koblenz) mit einer Drehklappenanlage. Endgültig durchsetzen konnte sich das K. aber erst mit dem von W. Heckel (Biebrich) entwickelten Typ (1876), der heute allgemein benutzt wird. Partien für K. finden sich u. a. bei G. Fr. Händel KONTRAFAGOTT Kontrafagott, 20. Jh. (Alexander’s Feast), J. Haydn (Die Schöpfung; hier auch tonmalerisch bei den Worten Vor Freude brüllend steht der Löwe da), W. A. Mozart (Maurerische Trauermusik, KV 477), L. van Beethoven (5. und 9. Symphonie; Fidelio, 2. Akt, Kerkerszene), J. Brahms (1. und 4. Symphonie; Haydn-Variationen), A. Bruckner (9. Symphonie), H. Pfitzner (Palestrina), R. Strauss (Salome; Eine Alpensinfonie), G. Puccini (Tosca, l. Akt, Finale), A. Schönberg (Gurre-Lieder), I. Strawinsky (Le sacre du printemps), Cl. Debussy (La mer), G. Mahler (8. Symphonie), M. Ravel (Daphnis et Chloé; Suiten Nr. 1 und 2), G. Holst (The Planets), O. Respighi (I pini di Roma), Dm. Schostakowitsch (7. Symphonie, »Leningrad«) und B. Bartók (Konzert für Orchester). m. bröcker KONZERT, Concert (von it. concerto = Übereinstimmung, Vereinigung, Einverständnis) bezeichnet in einem Prozeß fortschreitender Ausdifferenzierung 1. ein Stilprinzip und später eine Werkgattung, 2. ein Ensemble der Ausführenden, 3. eine Veranstaltung, in der Musik dargeboten wird. 1) Concerto und Konzert als Stilprinzip und Werkgattung (씮Concerto). Bereits im frühen 16. Jh. in Italien in der Bedeutung Zusammenklang und synonym mit Concento verwendet, ließ die Bz. zunächst keine nähere Spezifikation zu, diese mußte vielmehr durch Zusätze verdeutlicht werden (Concerto di voci, 1519; Concerto de gl’istrumenti, M. A. Ingegneri 1598). In dieser allgemeinen Form wurde sie bis Ende des 17. Jh. verwendet und blieb austauschbar mit ähnlich allgemeinen Bezeichnungen wie Concento und Sinfonia. Ende des 16. Jh. 11 Konzert Konzert wurde der Terminus concertato zur Bezeichnung eines mit der Mehrchörigkeit zusammenhängenden Stilprinzips eingesetzt, das gekennzeichnet ist durch Auflösung des kontrapunktischen Satzverbunds, die Tendenz zu Rahmensatz-Anlage, veränderte Funktion des (instrumentalen) Basses und Kleingliedrigkeit der Motivik. Die Reduktionspraxis der Zeit ermöglichte die Wirksamkeit dieses Stilprinzips auch für kleine Besetzungen. Im Laufe des 16. Jh. verfestigte sich der Wortgebrauch daneben auch bereits zur Bezeichnung musikalischer Werke noch ohne Spezifikation auf vokale oder instrumentale Ensemblemusik (vgl. Concerti di Andrea, et di Gio. Gabrieli, 1587 u. a.), bei Cl. Monteverdi (7. Madrigalbuch) wird Concerto als Sammelbegriff für 6– 16st. Besetzungen verwendet. Obwohl A. Banchieri 1595 8st. Stücke Concerti ecclesiastici nannte und der Wortgebrauch in Verbindung mit Mehrchörigkeit andauerte, begründete L. Viadana mit seinen Concerti ecclesiastici (1602 ff.) zum ersten Mal K. als Gattungsbegriff für die geringstimmige generalbaßbegleitete Motette. Er wurde als geistliches Konzert (u. a. von H. Schütz) in Deutschland aufgenommen. Noch J. G. Walther (Musicalisches Lexicon, 1732) und J. Mattheson (Der Vollkommene Capellmeister, 1739) bezeichnen Viadana als den Erfinder des K.s schlechthin. In dieser Weise wirkt der Begriff bis ins 18. Jh. hinein: noch J. S. Bach verwendete Concerto als Gattungsbegriff für die Kirchen- Kantate. Daneben wurde K. zunehmend auf instrumentale Ensemble-Stücke angewendet, zunächst noch ohne Wechsel zwischen Solo und Tutti. Aus ihnen differenzierten sich zwei Gattungstypen heraus, die beide wohl durch die von M. Praetorius aufgebrachte Fehletymologie K. = Wettstreit (von vermeintlich lat. concertare = wettstreiten, kämpfen, Syntagma musicum III, 1619) beeinflußt wurden (vgl. etwa den Titel von Th. Selle, Concertatio Castaldium h[oc] e[st] Musicalischer Streit, H 1624). Bei dem einen Typus wurde ein solistischer, aber vollstimmiger (2 Violinen mit B.c.; Satz a due canti) Klangkörper (Concertino) einem mehrfach besetzten (Concerto grosso) gegenübergestellt, nach diesem wurde der Typus insgesamt bezeichnet (Concerto grosso). Der andere K.-Typus experimentierte mit einem oder mehreren (Melodie-)Soloinstrumenten, die dem Tutti gegenübertraten. Nach unterschiedlichen genetischen Vorstufen, die z. T. zeitlich noch über die Hauptentwicklung hinausreichten (G. Torelli, E. F. dall’Abaco u. a.), bildete A. Vivaldi einen festen Gattungstypus des Solokonzerts aus. Konstitutiv für den Solokonzert-Typus Vivaldis ist das Tutti-Ritornell, das auf verschiedenen Tonstufen wiederkehrend, den Satz gliedert, während das Solo mit freien Spielfiguren von einem zum nächsten Ritornell moduliert, wobei seine unthematischen Figuren nicht weiterverarbeitet werden und bei jedem Einsatz des Solo wechseln. Dieses Modell (in der Formenlehre als »Modulationsrondo« bezeichnet), bei dem erstmals Tonalität formbildend wirkte, kam zunächst dem rationalistischen Formverständnis so sehr entgegen, daß es sich rasch ausbreitete. Als ästhetisch unbefriedigend wurde jedoch zunehmend empfunden, daß gerade das klanglich dominierende Solo an den formbildenden thematischen Vorgängen unbeteiligt blieb und die Spielfiguren zumeist ohne Rücksicht auf den Charakter des Solo-Instruments eingesetzt wurden. Die wohl auf T. Albinoni zurückgehende Technik der »Devisen«Bildung, die das Solo wenigstens bei seinem ersten Auftreten mit dem Ritornell verknüpfte, oder G. Ph. Telemanns Experimente mit einer Art strophischer Variation vermochten diesem grundsätzlichen Mangel nicht abzuhelfen. – Während das Concerto grosso ohne eigenen Formtypus meist der viersätzigen Anlage der Sonata da chiesa folgt, bevorzugte das Solokonzert die dreisätzige Anlage, wobei der langsame Mittelsatz arienhaften Charakter hatte, während das Finale entweder ebenfalls als Modulationsrondo oder als zweiteiliger K.-Satz gestaltet wurde. Die Faszination des Vivaldischen K.-Typus endete um 1740 so abrupt, wie sie aufgetreten war. Albinonis op. 10, publiziert ungefähr zur gleichen Zeit, als Vivaldi selbst in Venedig aus der Mode kam, zeigt bereits deutlich die Tendenz der späteren Entwicklung. J. J. Quantz (Versuch einer Anweisung …, 1752), der in seiner Jugend auch im Banne Vivaldis gestanden hatte, sah diesen Vorgang bereits klar als historischen Prozeß. Nach Ablösung des Modulationsrondo-Konzerts geriet das K. rasch in den Sog der inzwischen ausgebildeten Symphonie. Wie sich dieser Vorgang im einzelnen vollzog, ist noch unerforscht. Bei den Wiener Klassikern ist dieses symphonische K. bereits fertig ausgebildet; die anderen Komponisten in Wien folgten der Entwicklung allerdings in einigem zeitlichem Abstand. Die Dreisätzigkeit des älteren K.s wirkte jedoch so stark nach, daß auch das symphonische K. diese beibehielt und nicht die viersätzige Anlage der Symphonie übernahm. Das Solo setzt in dem K. dieses Typs in der Regel erst ein, nachdem die gesamte Exposition des Sonatensatzes im Tutti abgelaufen ist; häufig erfüllt das Solo die Funktion der Wiederholung der Exposition, wie sie in der Symphonie üblich ist. Das Solo läuft jedoch nicht mehr wie beim älteren K. unbeteiligt neben der thematischen Entwicklung her, sondern ist voll in die thematischen Prozesse des klassisch-romantischen Sonatenprinzips integriert. Weniger selbständig ist die Funktion der meist wechselnden Soli in der Sinfonia concertante, die sich um die Mitte des 18. Jh. als Sonderentwicklung von der Symphonie abspaltet. Die Bezeichnung K. wurde seit der Wiener Klassik beinahe zum Synonym für Solo-Konzert. Insgesamt Konzert Kreisler entsteht nun ein reiches Repertoire von K.en, zunächst vorzugsweise für Klavier und für Violine, später zunehmend auch für nahezu alle gebräuchlichen Instrumente (vgl. die entsprechenden Artikel). Nur vereinzelt treten noch K.e für mehrere Instrumente auf (L. van Beethoven, Tripelkonzert op. 56, J. Brahms, Doppelkonzert op. 102). In der Musik des 20. Jh. genügt die Beziehung von Solo und Tutti, um – unabhängig von Form und Kompositionstechnik – den Gattungsbegriff zu rechtfertigen. Auch Bezeichnungen wie 씮Concertino und Concerto grosso treten, meist historisierend, aber ohne direkten Bezug zur historischen Besetzung und Satztechnik, wieder auf. 2) Concert(o) als Ensemble. Der umgangssprachlichen Bedeutung des Wortes in Italien entsprechend, war Concert(o) zeitweise auch die Bezeichnung für das (Vokal- und Instrumental-)Ensemble der Aufführenden selbst und ist seit dem 16. Jh. häufig belegt, u. a. für die berühmten Madrigalsängerinnen des Hofes von Ferrara (Concerto di donne). Für Walther (Musicalisches Lexicon, 1732), Mattheson (Das neu-eröffnete Orchestre, 1713) und J. A. Scheibe (Critischer Musicus, 1739) war auch dieser Wortgebrauch noch selbstverständlich. 3) Konzert als Veranstaltung. Wie weit die Verwendung von K. als Bezeichnung für Aufführungen zurückreicht, ist schwer bestimmbar, weil die Belege oft nicht zweifelsfrei erkennen lassen, ob die Ausführenden oder die Aufführung gemeint sind; so etwa wenn 1565 vom »Concerto maggiore« des Herzogs von Ferrara berichtet wird. Seit dem 18. Jh. wurde dann die Verwendung von K. als Bezeichnung von Aufführungen allgemein: 씮Concert spirituel (Paris ab 1725), Castle Concerts (London ab 1724), Gentlemen’s Concerts (Manchester ab 1774). Dieser Wortgebrauch ist eng verknüpft mit der sozialgeschichtlichen Wandlung des Musiklebens; ursprünglich bezeichnete wohl K. musikalische Aufführungen gegen Entgelt, die im allgemeinen der Öffentlichkeit zugänglich waren. Im angelsächsischen Sprachgebrauch wurde bis heute an der Bezeichnung K. (Concert) nur für Ensemblemusik festgehalten, solistische Aufführungen heißen Recital. Von England drang wohl auch der Typus des Konzertunternehmers auf den Kontinent vor und ersetzte die Form des von ausübenden Künstlern auch wirtschaftlich selbst verantworteten Konzerts. Bekannte Beispiele aus dem 18. Jh. sind hier die sogenannten Bach-Abel-Konzerte und die Salomon-Konzerte in London. Kennzeichnend für diese Entwicklung ist eine Bezeichnung wie »Professional Concerts« (London ab 1783). Seit Ende des 18. Jh. verdrängt der Begriff K. allgemein die (in Wien noch bis in die Beethoven-Zeit hinein) gängigeren Bezeichnungen wie 씮 Akademie und 씮 Recital. KORNER, Alexis, s. kross 12 * 19.4.1928 Paris, † 1.1.1984 London; brit. Sänger und Gitarrist. Als Sohn eines Österreichers und einer Griechin wuchs K. in Frankreich, der Schweiz und Nordafrika auf, ehe sich die Familie 1939 in England niederließ. Er lernte Klavierspielen, kam 1947 als Besatzungsoffizier nach Deutschland und arbeitete als Discjockey für BFN und NWDR. Nach England zurückgekehrt, spielte er bei Chris Barber und Ken Colyer Dixieland. Außerdem begleitete er div. Bluesgrößen (u. a. Muddy Waters und Memphis Slim) auf deren England-Tourneen. 1961 gründete er die Band Blues Incorporated. Seine einzigen Single-Hits landete er (mit der Rock-Big Band CCS) zwischen 1970 und 1972. Er spielte in etlichen stilübergreifenden Bands, trat aber wegen seines rapide sich verschlechternden Gesundheitszustandes Anfang der 80er Jahre nur noch selten auf. K., der als einer der Urväter des europäischen Blues gilt, förderte viele talentierte Bands, darunter die Rolling Stones, Led Zeppelin, Pentangle und Free. Sein eigener Erfolg blieb indes bescheiden. Zu seinen bemerkenswertesten Platten zählen New Generation of Blues (1968), Both Sides (1970), Snap Live in Germany (1972) und The Party Album (1979). m. falk KREISLER, Fritz, * 2.2.1875 Wien, † 29.1.1962 New York; östr. Violinist und Komponist. Er studierte Musik bei seinem Vater, bei J. Hellmesberger d. J. und A. Bruckner in Wien, dann bei L. Massart und L. Delibes in Paris. Nach einer Konzerttournee durch die USA mit dem Pianisten Moriz Rosenthal (1888) gab er für 6 Jahre das Violinspiel auf, studierte Medizin und leistete seinen Militärdienst ab. Seit 1898 konzertierte er wieder in Europa und den USA. Nach Heilung einer Kriegsverwundung (1914) nahm er seine Konzerttätigkeit bald wieder auf. 1924–32 lebte er Fritz Kreisler 13 Kreisler Neudeutsche Schule überwiegend in Berlin, 1933–34 in Paris, dann in den USA. K. war einer der beliebtesten Violinisten seiner Zeit. Seine Alt-Wiener Tanzweisen für Violine und Klavier (Liebesfreud, Liebesleid, Schön Rosmarin, aus den Klassischen Manuskripten) sind bis heute als Unterhaltungsmusik erfolgreich geblieben. mat – The Guide (1994). N. war einer der ersten afrikanischen Musiker, die ihre Musik in der Heimat in einem eigenen Studio produzierten, um den eurozentrischen Charakter der 씮Weltmusik zu umgehen, und machte sich so im Senegal einen Namen als Förderer junger Musiker. Heute veröffentlicht N. in Dakar regelmäßig Mbalax-Aufnahmen, für Europa produziert er Platten mit internationalem Pop-Charakter (Joko, 1999 und Nothing’s In Vain, 2002). s. franzen Werke : Für V. u. Klv.: Klass. Manuskripte, 18 H.e (Mz 1910), urspr. unter der Vorgabe veröffentlicht, es handele sich hier um Bearbeitung älterer hsl. erhaltener Werke (u. a. v. A. Pugnani), gab K. 1935 (vgl. Lochner) die eigene Autorschaft preis · Original-Kompositionen, 13 H.e (Mz 1910), darin Caprice viennois · Transkriptionen, 28 H.e (Mz o. J.) · Meisterwerke der V., 18 H.e (Mz o. J.) · Volkslieder aus Östr., 4 H.e (Mz o. J.) · V.-Konzert G-Dur. – Operetten Apple Blossows, UA: New York 1919, u. Sissy, UA: Wien 1932 · einige Lieder. – Ferner veröff. K. Four Weeks in the Trenches. The War Story of a Violinist (Boston – NY 1915). MISÉRABLES, LES, Musical von Claude-Michel Schönberg, Buch von Alain Boublil nach dem gleichnamigen Roman von Victor Hugo; UA: 8.10.1985 in London (Barbican Theatre); EA in dt. Sprache: 15.9.1988 in Wien (Raimundtheater), deutsch von Heinz Rudolf Kunze. Les Misérables ist zum einen die Geschichte des Sträflings Jean Valjean, der beschließt, ein neues Leben zu beginnen und sich fortan für die Rechte der Schwachen einsetzt. Inhalt des Musicals ist außerdem die Geschichte des Waisenkindes Cosette und ihrer Liebe zum jungen Marius, den Jean Valjean vor dem Tod auf den Barrikaden rettet. Schließlich ist Les Misérables ein Musical um Gerechtigkeit und Liebe, um Armut und Ideale – und um den Aufstand der Geknechteten im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Musikalisch stellt Les Misérables ein durchkomponiertes Musical dar und ist quasi der Form der Oper angeglichen. Die Musik ist eine Mischung aus Märschen, Patter Songs, Arien, Liebesduetten und »großen Nummern«. 1987 feierte das Musical seine Broadway-Premiere und wurde im selben Jahr mit acht Tony Awards, den Oscars der Theaterwelt, ausgezeichnet. m. gaul N’DOUR, Youssou, *1.10.1959 Dakar; senegalesischer Sänger und Produzent. Als Sohn einer Griotte (traditionelle Sängerin) des Tukuleur-Volkes lernte N. zunächst Tauf- und Hochzeitslieder kennen und fiel als Jugendlicher durch seine außerordentlich helle Stimme auf, was ihn zur Star Band de Dakar brachte. Mit Mitgliedern dieser Band gründete er 1979 seine eigene Formation Étoile de Dakar, später Super Étoile de Dakar, die den 씮 Mbalax populär machte. 1981 trat er erstmals in Paris auf, arbeitete ab Mitte der 1980er mit europäischen Größen der Popmusik wie 씮 Peter Gabriel und 씮 Sting. Wichtige Einspielungen dieser Phase sind Immigrés (1988) und The Lion (1990). Den Durchbruch in der internationalen Popmusik brachte das Album Wom- NEUDEUTSCHE SCHULE, ein 1859 von dem Musikschriftsteller und -historiker Franz Brendel für die Vertreter des musikalischen Fortschritts seiner Zeit, vor allem Berlioz, Wagner und Liszt, geprägter Begriff, der den polemischen und irreführenden Terminus 씮 »Zukunftsmusik« ersetzen sollte. Brendel verwendete ihn erstmals in seiner Rede Zur Anbahnung einer Verständigung auf dem Leipziger Tonkünstlerfest aus Anlaß des 25jährigen Bestehens der Neuen Zeitschrift für Musik. Des scheinbaren Widerspruchs, Liszt und Berlioz zu einer »deutschen« Schule zu zählen, war sich Brendel bewußt und versuchte ihn mit dem Hinweis aufzufangen, daß Berlioz und Liszt in der deutschen Musik wurzelten, da sie »ihren Ausgangspunkt von Beethoven genommen« hätten. Tatsächlich waren die als wesentlich inhaltlich bestimmt rezipierten Werke Beethovens der Anlaß, nach neuen Wegen der Verbindung von Musik und anderen Künsten, insbesondere der Literatur, zu suchen, wie sie sich sowohl in der Symphonik von Berlioz und Liszt als auch in Wagners Musikdrama ausprägten. Die Vorstellung, daß alle drei – trotz gravierender Unterschiede – eine gemeinsame Schule bildeten, gründete neben der Freundschaft Liszts mit Berlioz und Wagner und den hieraus resultierenden gegenseitigen Anregungen hauptsächlich in der Rezeptionsgeschichte. Bereits 1834 hatte Liszt eine »Klavierpartitur« der Symphonie fantastique erarbeitet, nach der u. a. Schumann seinen für die Berlioz-Rezeption in Deutschland grundlegenden Aufsatz über dieses Werk verfaßte (NZfM 3 [1835]). Insbesondere aber von Weimar aus setzte sich Liszt dann nach 1848 vehement für Berlioz und Wagner, der Deutschland 1849 verlassen mußte, ein (EA Tannhäuser 1849, UA Lohengrin 1850, Berlioz-Woche 1852, Wagner-Woche 1853). Ergänzt wurde dies durch Musikfeste außerhalb Weimars (Ballenstedt 1852, Karlsruhe 1853, Aachen 1857) sowie eine rege publizistische Tätigkeit des Weimarer Kreises, zu dem neben Liszt (u. a. Lohengrin und Tannhäuser, Leipzig 1851, und Berlioz und seine Haroldsymphonie, NZfM 1855) vor allem J. Raff, H. von Bülow, P. Cornelius, R. Pohl und F. Draeseke zählten. Es war wohl nicht zuletzt diese Fokussierung der Rezeption in und von Weimar aus, die zu der Zusammenfassung der Werke von Berlioz, Wagner und Liszt unter dem polemischen Begriff der »Zukunftsmusik« führte. Neudeutsche Schule Noten 14 Als Brendel diesen Begriff durch den der Neudeutschen Schule ersetzte, benannte er also nur etwas neu, was allgemein als zusammengehörig empfunden wurde, postulierte durch seine Terminologie jedoch zugleich, daß diese die fortschrittliche deutsche Musik schlechthin repräsentiere. Gerade dieser historische Anspruch aber, der in Brendels von Hegel geprägtem Geschichtsdenken wurzelte, mußte Widerspruch hervorrufen, wie er sich nicht zuletzt in der von Brahms, J. Joachim und anderen unterzeichneten Erklärung gegen die »Produkte der Führer und Schüler der sogenannten ›Neudeutschen‹ Schule« manifestierte (Berliner Musik-Zeitung Echo 10 [1860])., Brendel übernahm den Begriff auch in seine Geschichte der Musik (ab der 3. Auflage 1860), allerdings nur mehr auf Wagner, Liszt »und ihre Schule« bezogen, während Berlioz der vorangehenden Epoche zugeordnet blieb. In diesem Sinne erscheint der Begriff der Neudeutschen Schule durchaus geeignet, wesentliche Entwicklungen der Musikgeschichte im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts, insbesondere während Liszts Weimarer Jahren (1848–1861), wie die Programmsymphonie, die Symphonische Dichtung und das Musikdrama als zusammengehörig zu begreifen. r. kleinertz NOTEN (von lat. nota = Zeichen; engl. und frz.: note; it. und span.: nota), Bz. für Zeichen zur graphischen Wiedergabe von Tönen, wobei die Tonhöhe durch ihre jeweilige Lage im 씮 Liniensystem und der Wert durch ihre Form bestimmt wird. Die folgende Tabelle zeigt, wie die N. und Pausen der »modernen« Notenschrift aus den Zeichen der Mensuralnotation (씮 Notenschrift) hervorgegangen sind und wie sich der N.-Bestand in Richtung auf die kleineren Werte erweitert hat. NEUE DEUTSCHE WELLE, um 1979 entstanden. Zunächst von der Punkbewegung beeinflußt, übernahmen die Vertreter der N. D.W. deren Spontaneität und Dilettantismus, um in jugendlicher dt. Sprache und zumeist minimalistisch produzierten Liedern ihre Befindlichkeiten zu artikulieren und Klischees aus Rock und Schlager bloßzustellen. Um 1980 bildete eine Fülle junger Gruppen sowie kleiner, unabhängiger Plattenfirmen und Vertriebe eine ausgesprochen kreative und vielfältige Musikszene. Gruppen wie Fehlfarben, Der Plan, Palais Schaumburg, Abwärts, D.A.F oder Neonbabies verfolgten ernsthafte und z. T. aggressive Konzepte. Etwa ab 1981 wurden viele Musiker, darunter Ideal, Trio, Extrabreit, Joachim Witt und v. a. Nena von der Unterhaltungsindustrie entdeckt und außerordentlich erfolgreich vermarktet. Doch bereits 1982, als Interpreten wie Markus, UKW, Frl. Menke oder Andreas Dorau mit frechen Pop-Schlagern für kurze Zeit ins Rampenlicht gelangten, zeigten sich erste Übersättigungstendenzen. Lediglich Nena konnte zunächst den kommerziellen Erfolg konservieren, und nur wenige Gruppen überstanden die nächsten Jahre. Dennoch gilt die N. D.W. als Wegbereiter für ein neues Selbstbewußtsein in der dt. Pop- und Rockmusik, die sich abseits weniger etablierter Stars wie BAP, H. Grönemeyer oder M. MüllerWesternhagen in den 90er Jahren positiv entwickelte, repräsentiert durch unterschiedliche Künstler wie Element of Crime oder Blumfeld. c. hoffmann Die dargestellten Werte können durch Beifügung eines 씮 Punktes um die Hälfte, durch 2 Punkte nacheinander um 3/4 ihres Wertes verlängert werden, jedoch seit der 1. Hälfte des 19. Jh. nicht über den Taktstrich hinaus. In diesem Falle werden die Notenwerte durch Haltebögen (씮 Bogen l) verbunden. Die einzelnen Teile einer Note heißen Notenkopf, Notenhals und Notenfahne (-fähnchen). Der Notenhals hatte in den älteren Notenschriften als 씮Cauda eine bestimmende Funktion, vor allem bei den verschiedenen Typen der 씮 Ligatur. Bei Einzelnoten war er bis zum Ende des 15. Jh. in der Regel nach oben gerichtet; erst durch die normierende Kraft des 씮 Notendrucks entstand die Gewohnheit, N. auf und oberhalb der 3. Notenlinie nach unten zu »halsen« und umgekehrt. Neben den Notenfahnen – die bis zum 17. Jh. gleichermaßen für Einzelnoten wie für N.-Gruppen verwendet wurden – kamen mit dem Aufblühen des Notenstichs die Notenbalken in Gebrauch. In der Instrumentalmusik werden seitdem Achtel- und kleinere Notenwerte gruppenweise »gebalkt«, etwa im 4/4-Takt meist bis zur Länge 15 Noten Obertongesang einer halben Note, und in der Regel nicht über den Taktstrich hinweg; jedoch variiert die Balkensetzung stark. Einige Beispiele: auch verstand. Mit der Rückbesinnung auf traditionelles Liedgut ging auch eine Neuentdeckung der Instrumente der Indios einher. Auf Festivals und Treffen fand ein reger Austausch der 씮 Liedermacher über Ländergrenzen hinweg statt. Als Schlüsselfiguren gelten der argentinische Gitarrist und Sänger Atahualpa Yupanqui (*22.1.1908, †23.5.1992) und die chilenische Liedermacherin Violeta Parra (*4.10.1917, †5.2.1967), deren Biographien wie die vieler ihrer Mitstreiter von Gefängnisaufenthalten und Exil geprägt ist. Tragischster Fall ist der Chilene Victor Jara, der 1973 von der Militärjunta ermordet wurde und dessen Songs heute auch in der internationalen Rockmusik interpretiert werden (씮 Sting, 씮 Bruce Springsteen). In Kuba firmierte die N. unter Nueva Trova, ihr Stammvater ist Carlos Puebla, dessen Werk von Silvio Rodriguez und Pablo Milanés weitergeführt wurde. Von den Begründern der Bewegung sind die argentinische Sängerin Mercedes Sosa und die chilenische Gruppe Inti-Illimani bis heute aktiv. Balken dienen gelegentlich auch der graphischen Verdeutlichung einer melodisch-rhythmischen Figurierung und haben in diesem Fall Konsequenzen für die Phrasierung, bes. wenn eine Kombination von Balken und Fähnchen gegeben ist wie in der folgenden Passage aus W. A. Mozarts Klaviersonate KV 279 = 189d: (siehe oben) Ähnlich wie für die Einzelnoten haben sich im Laufe der letzten Jahrhunderte für den Notenstich detaillierte (wenn auch nicht einheitliche) Orthographie-Regeln hinsichtlich der jeweiligen Richtung der Hälse in gebalkten Notengruppen entwickelt: In der Vokalmusik richtet sich seit der Einführung der Notenbalken deren Setzung und die von Notenfahnen nach dem zugeordneten Text: Balken bei melismatischer, Fähnchen bei syllabischer Textierung, z. B. (aus der h-moll-Messe von J. S. Bach): In der Gegenwart findet man seit einiger Zeit zunehmend eine weitgehende Balkensetzung auch bei syllabischer Textierung, z. B. (aus den Jedermann-Monologen von Fr. Martin): NUEVA CANCIÓN, Bz. für eine Bewegung von 씮 Lieder- machern in Lateinamerika, insbes. in Chile, Argentinien und Kuba. Sie formierte sich in den frühen 1960ern mit dem Bestreben, den politischen Kampf um Reformen und die Befreiung von Militärregimes musikalisch zu unterstützen. Ihre Inspirationen empfingen die Vertreter der N. oft aus Liedern der ländlichen Bauern und Arbeiter, als deren Stimme sie sich s. franzen OBERTONGESANG, Untertongesang. Auch unter dem Begriff Kehlgesang zusammengefasste Gesangstechnik, die bei asiatischen Völkern gepflegt wird, insbesondere in Südsibirien und Tibet, aber auch bei den Frauen der südafrikanischen Xhosa und in der europäischen Kunstmusik. Physiologisch betrachtet ergibt sich beim O. ein komplexes Zusammenwirken von Bauch-, Zwerchfell- und Brustatmung, von Stimmbändern, Stimmritze und Kehlkopfknorpel, von Zunge, Lippen und Mundhöhle. Mittels starken Drucks durch die äußerst gespannten Stimmbänder wird ein Grundton erzeugt, über dem mit Hilfe der besonderen Stellung von Mundhöhle und Lippen dann Töne aus der beim Singen mitschwingenden Naturtonreihe so hervorgehoben werden, daß sie als Melodien über dem gesungenen 씮 Bordun erklingen. Bei der Variante des Untertongesanges, wie ihn die tibetischen Mönche beim MantraSingen oder die Xhosa-Frauen erzeugen, wird durch eine verwandte Technik die erste subharmonische Stufe unter dem Grundton hervorgehoben. In der Mongolei und der nördlich davon gelegenen Republik Tuva (ehem. UdSSR) verfügen die Sänger über das differenzierteste System von O., von denen der bekannteste der Chöömej ist. Der Ursprung des zentralasiatischen O. liegt sowohl in einem praktischen (etwa Herbeilokken der Tiere) als auch schamanischen Bezug des singenden Nomaden zur Natur bzw. Geisterwelt. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion gelangte der O. aus diesem Kulturkreis auch nach Europa. Exponenten Obertongesang Operninszenierung 16 sind die tuvinische Formation Huun-Huur-Tu, die in Deutschland lebende mongolische Gruppe Egschiglen und die Tuvinerin Sainkho Namtchylak, die den O. auf den experimentellen Jazz übertragen hat. In der westlichen Welt beherrschen ebenfalls einige Sänger diese Gesangstechnik, so z. B. in Deutschland Michael Vetter, in der Schweiz Christian Zehnder von der Gruppe Stimmhorn, in den USA David Hykes und sein Harmonic Choir. s. franzen OF THEE I SING, amerik. Musical von George Gershwin (1898–1937), Buch von George S. Kaufman und Morrie Ryskind, Songtexte von Ira Gershwin. Ort und Zeit der Handlung: Amerika der 20er Jahre. UA: 26.12. 1931 in New York (Music Box Theater). Ein witzig-ironischer Blick auf die politischen und kulturellen Institutionen Amerikas wie Außenpolitik, Kongreßdebatten, die Rolle des Vizepräsidenten und Schönheitswettbewerbe um den Preis der »Miss Amerika«. Handlung und Musik um den Präsidentschaftskandidaten Wintergreen, der seine Wahlkampagne unter das Motto »Liebe« stellt, hatten mehr Anklänge an die Operetten von W. Schw. Gilbert und A. Sullivan als an das Broadway-Musical üblicher Machart. Die Autoren Kaufman, Ryskind und Ira Gershwin erhielten dafür, zu ihrer Überraschung, den erstmals für ein Musicalbuch vergebenen Pulitzer-Preis. Bekannte Songs sind: Wintergreen for President, Of Thee I Sing Baby, Who Cares, Hello, Good Morning und Love Is Sweeping The Country. r. wallraf OISTRACH. – 1) David Fjodorowitsch, * 17. (30.) 9.1908 Odessa, † 24.10.1974 Amsterdam (begraben in Moskau); sowjet. Violinist und Dirigent. O. absolvierte 1926 die Violinklasse von Pjotr Stoljarski am Musikdramatischen Institut in Odessa. 1928 ging er nach Moskau, wo er 1932–34 und erneut seit 1941 Solist der Moskauer Philharmonie war. 1934 wurde er Dozent am Moskauer Konservatorium (1939 Professor). Seit 1935 konzertierte er im Duo mit L. Oborin und im Klaviertrio mit Oborin und Swjatoslaw Knuschewizki. 1937 errang er den 1. Preis beim Ysaye-Wettbewerb in Brüssel, wurde rasch international bekannt und trat mit den großen Orchestern der Welt auf. Sein Repertoire umfaßte die Violinliteratur von J. S. Bach, W. A. Mozart, L. van Beethoven und R. Schumann bis B. Bartók, P. Hindemith, S. Prokofjew und Dm. Schostakowitsch. Die ihm gewidmeten Violinkonzerte von N. Mjaskowski, A. Chatschaturjan, Nikolai Rakow und Dm. Schostakowitsch hat er wie auch die 1. Violinsonate von Prokofjew und die Violinsonate von Schostakowitsch uraufgeführt. Seine langjährige Begleiterin bei Duo-Abenden war Frieda Bauer. Seit 1961 trat O. erfolgreich auch als Dirigent auf. In seinem Spiel vereinigte er brillante Technik und sinnliche Schönheit des David Oistrach (1964) Geigentons mit vergeistigter, ganz im Dienste des Werks stehender Interpretation. Aus seiner Schule gingen berühmte Violinisten hervor. – O. wurden zahlreiche Ehrungen zuteil. Er war Volkskünstler der UdSSR (1953), Staatspreisträger (1943) und Leninpreisträger (1960). 1959 wurde er Ehrenmitglied der Royal Academy of Music in London, 1961 der Academy of Sciences and Arts in Boston und der Accademia nazionale di S. Cecilia in Rom und ebenfalls 1961 korrespondierendes Mitglied der Deutschen Akademie der Künste in Ost-Berlin. Die Universität Cambridge verlieh ihm 1969 die Ehrendoktorwurde. Werke : Stati, awtobiografitscheski otscherk (Aufsätze, autobiographische Skizze), hrsg. v. M. A. Grjunberg (Mos 1962). OPERNINSZENIERUNG. Während der musikalische Text einer Opernaufführung in der Partitur präzise fixiert ist, bedarf die visuelle Realisierung einer schöpferischen Konkretisierung der meist rudimentären Regieanweisungen. In der heutigen Opernpraxis entwickelt ein Regisseur auf der Grundlage der Partitur ein szenisches Konzept, zu dem ein Bühnen- und ein Kostümbildner Entwürfe für die Anfertigung der Ausstattung 17 Operninszenierung Parsifal beitragen. In mehrwöchigen Proben erarbeitet der Regisseur mit den Solisten und dem Chor die Personenregie, die während der Endproben mit den Dekorationen und Kostümen sowie der Lichtgestaltung und dem Orchester koordiniert wird. Bei späteren Neueinstudierungen ist man bestrebt, die Identität der Inszenierung auch bei wechselnder Besetzung durch neuerliche szenische Proben zu erhalten. In der frühen höfischen und in der barocken Oper lag die visuelle Komponente meist in der Hand des Hofarchitekten, der für die Errichtung des Theaterraumes einschließlich der Bühne und der Ausstattung verantwortlich war. Die weitgehend statische Rollendarstellung war in die symmetrische Bildhaftigkeit integriert, Gestik und Bewegungen folgten den Normen des höfischen Tanzes, während die Positionen im Raum durch die im Libretto angelegte Hierarchie der Personen vorgegeben waren. In volkstümlichen Formen der Oper des 18. Jahrhunderts, wie der Opéra-comique und der opera buffa, besaßen die Darsteller größeren Spielraum für eine lebensnahe bewegte Spielweise. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts veränderte sich die Inszenierungsweise hin zur bürgerlich-repräsentativen Oper des 19. Jahrhunderts, in der Authentizität der Ausstattung (oft historisch oder exotisch) und Natürlichkeit der Rollendarstellung zum Qualitätsmaßstab wurden. Verbesserte Beleuchtungsmöglichkeiten und plastischere Bühnendekorationen erlaubten nun auch Bewegungen der Darsteller in der Bühnentiefe. Erst im Zuge der Reform der Schauspielregie um 1900 mehrten sich Versuche, auch die Rollengestaltung der Sänger konsequent einem Inszenierungskonzept unterzuordnen und detailliert zu erarbeiten. Aus dem bloß arrangierenden wurde so der schöpferische Opernregisseur, dessen Arbeit Anerkennung als eigene Kunstleistung fand. Nach dem 1. Weltkrieg suchte die Oper auf dem Gebiet der Bühnenausstattung Anschluß an die Moderne. Während an vielen großen Häusern weiter ein naturalistischer Repräsentationsstil gepflegt wurde, setzten Theater wie die Berliner Kroll-Oper entscheidende neue Akzente. Die Zeit der großen Persönlichkeiten der Opernregie kam jedoch erst nach 1945. Anknüpfend an das Regietheater der 20er Jahre und bedingt auch durch eine Erstarrung des Repertoires, wurden ambitionierte Neuinszenierungen zum Gegenstand heftiger Kontroversen. Prominente Regisseure übernahmen zudem die Intendanzen bedeutender Opernhäuser. Es hat sich durchgesetzt, einerseits den Notentext unangetastet zu lassen, andererseits aber szenische Anweisungen als unverbindlich zu betrachten, um durch Ausstattung und Personenregie zwischen der Handlungszeit, der Entstehungszeit der Werkes und der Ge- genwart der Ausführenden und Rezipienten zu vermitteln (씮 Musiktheater). Neue Techniken ermöglichen heute die audiovisuelle Aufzeichnung und Verbreitung von Inszenierungen. So trugen etwa die weltweiten Fernseh-Übertragungen von den Bayreuther Festspielen ab 1972 entscheidend dazu bei, bedeutende Inszenierungen als eigene Kunstwerke wahrzunehmen. a. langer PARSIFAL, Bühnenweihfestspiel in 3 Akten von Richard Wagner (1813–83), Text vom Komponisten. Ort und Zeit der Handlung: Auf dem Gebiet und in der Burg der Gralshüter »Monsalvat« und Klingsors Zauberschloß, Spanien in mythischer Vergangenheit. UA: 26.7.1882 in Bayreuth. Mythische Bereiche repräsentieren in diesem Werk moralische Prinzipien: so stehen die Burg des heiligen Grals für das Gute und das Zauberreich des Klingsor für das Böse. Beiden Bereichen sind musikalische Ausdrucksmittel schwerpunktmäßig zugeordnet: oratorisch-sakrale, primär diatonisch harmonisierte Werkphasen der Gralswelt und exzessiv chromatische, dramatisch-affektbewegte Phasen dem Klingsor-Reich. Wagners wichtigste literarische Quelle war Wolfram von Eschenbachs Dichtung Parzival (1210); dem Umkreis der bretonischen Artus-Sagen entstammen die Grundelemente der Handlung: Der jugendliche Parsifal erweist sich als verheißener Erlöser, der durch seelische Reinheit und Mitleidsfähigkeit berufen ist, den lebensmüden Amfortas von den Qualen einer offenen, einst von Klingsor zugefügten Wunde zu heilen und dessen Amt als Gralskönig zu übernehmen. Durch das dichte Symbolgeflecht, zu dem Wagner gedankliche Elemente christlicher und nicht-christlicher Weltanschauungen verwob, wird das Bühnengeschehen als eine Kette von Gleichnissen semantisiert – ohne Aufgabe der erlebnishaften Kontinuität einer »Geschichte«. In der poetischen und musikalischen Konturierung der Figuren ergibt sich dadurch eine ständige Ambivalenz zwischen zwei dramaturgischen Funktionen der Figur: Individualcharakter einerseits und Repräsentant einer Idee andererseits. Meisterhaft gelang Wagner in diesem seinem letzten Bühnenwerk die musikalische Integration dieser beiden Faktoren: gleichgewichtig bestimmen sie Gestalt und Grundaffekt der Leitmotive; d. h., bereits das thematische Material wird zum semantischen Bindeglied von seelischen Grundeigenschaften und ideologischem Kontext; somit finden gedankliche Beziehungssysteme ihre bruchlose musikalische Entsprechung. Der Konflikt ethischer Prinzipien wird gleichermaßen verschlüsselt und erhellt: die musikdramatische Symbolisierung ermöglicht Vermittlung des Abstrakten in emotionaler Eindringlichkeit. Wagner betrachtete das Werk – dessen Entstehung einen Zeitraum von über drei Jahrzehnten umspannte – Parsifal Pause 18 Szene aus dem 1. Aufzug von Richard Wagners Parsifal in der Inszenierung von Wolfgang Wagner, Bayreuther Festspiele 1995. als persönlichstes Vermächtnis und ließ die Aufführungsrechte auf Bayreuth beschränken – ohne Erfolg: bereits am 10.11.1884 wurde P. in London aufgeführt. w. a. makus PAUSE. – 1) (engl.: silence; frz.: repos; it.: pausa; span.: silencio), das zeitweilige Aussetzen einer, mehrerer oder aller (씮Generalpause) Stimmen eines Musikstücks. – 2) (lat.: pausa, suspirium; engl.: rest; frz.: silence; it. und span.: pausa), in der Notenschrift Zeichen für Pause 1). Systematisch erfaßt wurden die P.n erstmals in der Mensuralnotation, in der sie durch einen senkrechten Strich im Liniensystem angegeben werden; je nach Dauer einer P. nimmt dieser einen halben (씮 Semibrevis-P., 씮 Minima-P.), einen ganzen (씮 Brevis-P.) oder mehrere (씮 Longa-P., 씮 Maxima-P.) Zwischenräume ein. Seitdem entspricht in der Notenschrift bis heute jedem Notenwert eine bestimmte P.: der ganzen Note die 씮 ganze Pause, der halben Note die 씮 halbe Pause, der Viertelnote die 씮Viertelpause, der Achtelnote die 씮 Achtelpause, der Sechzehntelnote die 씮 Sechzehntelpause, der Zweiunddreißigstelnote die 씮 Zweiunddreißigstelpause, der Vierundsechzigstelnote die 씮Vierundsechzigstelpause. Für 2 Takte wird die alte Brevis-P., für 4 Takte die Longa-P. gebraucht. Für eine größere Anzahl von P.n-Takten wird manchmal eine Folge dieser Zeichen, meist aber werden Ziffern über Quer- oder Schrägbalken verwendet: Sie werden entsprechend gegliedert, wenn Taktart oder Tempo wechseln: Die P., in der älteren Musik lediglich ein Mittel der musikalischen Gliederung, dient seit dem 17. Jh. in der Vokalmusik auch als Ausdruck von Sinn und Affekt des Textes, namentlich dort, wo musikalisch die Vorstellung des Abbrechens, Abschneidens, Atemlosen, der Stille vermittelt werden soll. In der Lehre von den musikalischen 씮 Figuren gibt es dafür eine ganze Gruppe 19 Pause Philippinen von Figuren, z. B. Aposiopesis (씮Generalpause), Tmesis oder 씮 Suspiratio. In der späteren Zeit bis heute sind P.n gerade auch in der Instrumentalmusik oft wesentliche Elemente musikalischer Gestalten und Entwicklungen. Sie können gleichermaßen Ruhe wie Spannung bewirken und sind seit H. Riemann häufig Gegenstand formgeschichtlicher und ästhetischer Reflexion. spielen ist eine bes. Ehre, die nur bedeutenden Mitgliedern der Gemeinschaft vorbehalten ist. Gongs können Bestandteil der Mitgift sein oder gegen Tiere und Land getauscht werden. Die Gangsa werden gespielt bei Versöhnungsfesten, der Einweihung eines Hauses oder Reisfeldes oder den Familienfesten der Reichen. Im Itundakgangsa-Ensemble der Karao z. B. werden 5 flache Gongs unterschiedlicher Tonhöhe mit verschiedenen Rhythmen angeschlagen. Diese Rhythmen bilden einen eigenartigen Gesamtklang und lassen sich folgendermaßen notieren: PHILIPPINEN. Entsprechend der Geschichte dieses südostasiatischen Kulturraumes lassen sich mehrere unterschiedliche Musiktraditionen feststellen. Die älteste, charakteristisch südostasiatische Tradition ist heute noch vor allem im Norden bei den Igorot und Negrito anzutreffen. Im islamischen Süden hat sich ein islamisch-südostasiatischer Musikstil entwickelt, der dort neben alten vorislamischen Formen existiert. Die Mehrheit der Filipinos identifiziert sich jedoch mit einer Volksmusik, die sich im Laufe der spanischen Fremdherrschaft (1521–1896) gebildet hat. Diese besitzt zwar typische eigenständige Merkmale, ist jedoch stark europäisch beeinflußt, mit überwiegend iberischen wie spanisch-mexikanischen Elementen. Das gleiche gilt für die Tanzformen. Auch die anschließende Herrschaft der USA (1898–1946) hat eindeutige Spuren hinterlassen. Der Einfluß der durch die modernen Massenmedien verbreiteten euroamerikanischen Popularmusik wird auf den Ph. bes. spürbar, so daß das Musikleben als westlich geprägt gelten kann. Die Musik des Nordens. Wie überall in Südostasien ist die traditionelle Musik bes. reich an Musikinstrumenten. Als wichtigstes Material dient Bambus. Unter den Idiophonen sind neben kleinen Aufschlagröhren, Klappern, Xylophonen, Maultrommeln aus Bambus die meistens paarweise gespielten Schlagbäume zu nennen. Auf dem langen Baum spielen 5 Spieler mit jeweils 2 Stöcken unterschiedliche Rhythmen, während dazu ein weiterer Spieler auf dem kleineren einen gleichbleibenden Begleitrhythmus schlägt. Diese Musik erklingt zu Krankenheilungszeremonien (anito = Geist), bei denen der Kranke von bösen Geistern befreit werden soll. Unter den Chordophonen sind vor allem die Röhrenzither zu nennen mit 2 Saiten, die mit Stöcken angeschlagen, oder die mit 5–11 Saiten, die angezupft werden. Brettzithern, Musikbogen und eine dreisaitige Fiedel sind neben der europäischen Violine und Gitarre weitere Saiteninstrumente. Man spielt außerdem Flöten unterschiedlicher Typen, u. a. die Nasenflöte, Panflöten mit 5 Röhren und eine schmale Bambusklarinette. Ein größeres Sozialprestige als diese Instrumente genießen Gongs (Gangsa) und Gongensembles, die z. T. von Trommeln begleitet werden und die bei bedeutenden Festen und Zeremonien erklingen. Während der Zeremonien die Gangsa zu Bestandteil der Zeremonien sind außerdem Solound Chorgesänge, die bei jeder ethnischen Gruppe andere charakteristische Merkmale besitzen. Die Kalinga kennen einen rhythmisch freien Sologesang (dango) mit zahlreichen Tremoli, die Töne verlängern, die durch Glissando, Parlando und Pausen unterbrochen werden. Die Musik ist hier wichtiger Teil bei der Behauptung der kulturellen islamischen Identität. Bei den Tausug werden zu islamischen Festen (z. B. Geburtstag des Propheten) und Familienfeiern von speziell ausgebildeten Frauen stark melismatische Sologesänge (lugu) in arabischer Sprache vorgetragen. Andere, von Männern wie Frauen gesungene Sologesänge sind Liebeslieder und gesungene Erzählungen oder Epen, die bei Hochzeiten oder geselligen Treffen im Dorf eine ganze Nacht und länger dauern können. Begleitinstrumente können das Xylophon Gabbang mit 16–19 heptatonisch gestimmten Platten und das Streichinstrument Biola sein. Andere Soloinstrumente sind u. a. die Maultrommel (Kubing), die Laute Ku- Die Musik des Südens. Philippinen Puente dyapi mit 2 Saiten, Röhrenzithern ähnlich denen im Norden, Quer- und Längsflöten (u. a. vom indonesischen Suling-Typ), Trompeten und Klarinetten aus Bambus sowie zylindrische Trommeln mit einem oder 2 Fellen. Das populärste Ensemble ist das sog. Kulintang (an), benannt nach einem Gongspiel aus 8 oder 11 Buckelgongs, die in einer Reihe auf einem Gestell liegen. Die Stimmung ist heptatonisch. Hinzu kommen bei den Magindanao: Babandil (ein größerer Gong), Agung (ein hängendes Gongpaar), Gandingan (ein weiteres Gongpaar) sowie die Zylindertrommel Dabakan; bei den Tausug im Sulu-Archipel: Tunggulan (ein großer hängender Gong), Duwahan (ein hängendes Gongpaar) sowie ein Paar zweifelliger Gandang-Trommeln. Indem auf dem Kulintang 2 Spieler spielen, können virtuose komplexe rhythmische Kombinationen entstehen, die bei den Magindanao z. B. auf 3 Grundrhythmen (duyug, sinulug, tidtu) beruhen. Jeder Spieler bildet dabei aus zwei oder drei Tönen eine melodischrhythmische Kernzelle, die im Laufe des Spiels leicht verändert wird. Das Ensemble dient der Tanzbegleitung auf Festen und Familienfeiern. Europhilippinische Musik. Die Jahrhunderte spanischer Herrschaft sind auch in der Musik des Landes unüberhörbar. In weiten Gebieten haben sie zu einer völligen Verdrängung südostasiatischer Traditionen geführt. Die ersten Missionare unterrichteten den Meßgesang, das Orgel-, Gitarren- und Flötenspiel sowie das Notenlesen. Von diesen Gemeinden aus entwickelte sich eine halbliturgische Musik. Daneben entstanden freiere weltliche Formen der Tanzmusik wie Balitao, Fandango, Carinosa, Paso doble und Vokalformen wie Kundiman (Liebeslied), Composo, Harana. PLEYEL & CO., frz. Klavier- und Harfenfabrik. Sie wurde 1807 von I. 씮 Pleyel in Paris gegründet und nahm einen raschen Aufschwung. 1815 trat I. Pleyels Sohn Camille als Teilhaber in das Unternehmen ein und 1829 Fr. Kalkbrenner, der viel zur Verbreitung der Pleyelschen Instrumente beitrug. Seit 1830 wurden in Zusammenarbeit mit dem Harfenisten Dizi auch Harfen gebaut. Neuerungen dieser Zeit sind im Klavierbau die Verwendung des Gußeisenrahmens (1826) und eine Auslösungsmechanik, bei der die Tasten ohne Abschrauben des Spieltisches herausgenommen werden konnten. Nach dem Tod von I. Pleyel übernahm C. Pleyel das Unternehmen. Unter seiner Leitung entwickelten sich die seit 1830 bestehenden Salons Pleyel zu einem künstlerischen Mittelpunkt. 1832 trat hier Chopin erstmals öffentlich in Paris auf. Auch J. B. Cramer, I. Moscheles und D. Steibelt unterhielten enge Beziehungen zum Hause Pleyel. 1834 wurde der Verlag P. an verschiedene Verlagshäuser verkauft (Lemoine, Guillaume, Richault, Schlesinger usw.), die Klavierfabrik jedoch bestand fort. 1839 ließ C. Pleyel einen Konzertsaal bauen, wo u. a. C. Franck, C. Saint-Saëns und A. Rubinstein ihr Debüt gaben. Die Fabrik hatte inzwischen einen Ausstoß von 1000 Klavieren jährlich, der sich bis 1870 auf 2500 steigerte. 1852 trat Auguste Wolff, * 3.5.1821 Paris, † 9.2.1887 ebd., ein Neffe von A. Thomas, Pianist und Lehrer am Pariser Conservatoire, als Teilhaber in die Firma ein, die er nach dem Tod von C. Pleyel 1855 unter dem Namen »Pleyel, Wolff & Co.« übernahm. Er konstruierte einen von Ch. Gounod »crapaud« (= Kröte) genannten Kleinflügel mit kreuzsaitigem Bezug, ferner Transpositionsinstrumente, Tonhaltepedale und Pedalklaviere. Wolffs Schwiegersohn, Gustave Lyon, * 19.11.1857 Paris, † 12.1.1936 ebd., leitete das Unternehmen 1887–1930 und modernisierte die Fabrik in St.-Denis, die ihre jährliche Produktion auf 3000 Klaviere steigern konnte. Er verbesserte die Klangstärke der Instrumente durch Bespannung mit bes. verstärkten Stahlsaiten und durch Gußstahlrahmen, baute ein von E. Moor erfundenes zweimanualiges Klavier mit Kopplungsvorrichtung (1924), Doppelflügel, eine pedallose chromatische Harfe (pro Ton eine Saite) und eine chromatische Laute. Außerdem förderte er die Produktion des mechanischen Klaviers »Pleyela« und verbesserte das Cembalo durch Einbau eines 16′-Registers. 1927 ließ er einen großen Konzertsaal, die Salle Pleyel, bauen. 1930 erwarb die Firma Teile der bekannten Orgelbaufirma Cavaillé-Coll und stattete die Salle Pleyel mit einer eigenen Orgel aus (4 Manuale, 70 Register). Bei den städtischen Fiestas spielen die Rondalla genannten Ensembles populäre Lieder des Landes oder europäischer Herkunft, mit Vorliebe jedoch italienische Opernarien. Die Instrumente des Rondalla, eines Orchesters aus gezupften Saiteninstrumenten, wie Banduria, Laud, Octavina, Guitara und Banjo sind Adaptionen europäischer und mexikanischer Saiteninstrumente. Gegen Ende des 19. Jh. kam es zur Gründung von europäisch ausgerichteten Musikschulen, Symphonieorchestern, Chören, Kammermusikgruppen und Operntruppen. Die Beschäftigung mit den eigenständigen Traditionen begann erst 1924 durch Bildung eines Forschungskomitees, das Volkslieder und -tänze sammelte. j. maceda – a. simon 20 j. gardien PUENTE, Tito *20.4.1923 Harlem, †31.5.2000 New York; puertoricanischer Perkussionist und Bandleader. 21 Puente Streichquartett Im Alter von 13 Jahren stieg P. als Drummer in der Bigband von Ramon Olivera ein, studierte dann Komposition, Orchestration und Piano an der New York School Of Music. Prägende Einflüsse erfuhr er bei Machito, der pionierhaft Jazz und Latin Music zusammenbrachte. Ab1949 war P. mit seinem eigenen Orchester an der Verbreitung des 씮 Mambo sowie des 씮ChaCha-Cha beteiligt. Er spielte mit allen Spitzenperkussionisten der lateinamerikanischen Musik, unter ihnen Mongo Santamaria und Johnny Pacheco, und trug die Beinamen »Rey del Timbal« und »King Of Mambo«. Gleichwohl adaptierte P. auch Bossa Nova- und Broadway-Hits und nahm etliche Jazz-Alben auf. Weltweit bekannt wurde sein Hit Oye Como Va, der später von 씮Carlos Santana interpretiert wurde. Unter seinen späten Aufnahmen findet sich eine Kollaboration mit der bekanntesten kubanischen Salsa-Sängerin, Celia Cruz, und sein Live-Album Mambo Birdland, für das ihm Monate nach seinem Tod ein Latin Grammy zugesprochen wurde. s. franzen die oberitalienischen Concerti und Sinfonie a quattro von G. Tartini und G. B. Sammartini, die sich vom Generalbaß gelöst haben, sind weiter die Triosonaten und erweiterten Sonate a quattro, die es in Italien, Frankreich und Mitteldeutschland zu Beginn des 18. Jh. gab, und schließlich die süddeutschen Quartettsinfonien und Quartettdivertimenti (Fr. Tuma, G. M. Monn). Die Loslösung vom Generalbaß und die beginnende Homogenität des Gesamtklangs sind satztechnische Prinzipien, die das Entstehen der neuen Gattung ermöglichten. Gleichwohl ist die Entstehung kein Prozeß, sondern eine bewußte Erfindung, die unabhängig voneinander den Komponisten J. Haydn und L. Boccherini zuzuschreiben ist. Die zentrale Bedeutung Haydns für die Ausbildung des klassischen S.-Typus wurde schon zu dessen Lebzeiten erkannt; mit den zwischen 1755–59 entstandenen S.en op. 1 und 2 fußt er zwar noch auf der süddeutschen Divertimentomusik, aber spätestens seit den 1769/70 komponierten S.en op. 9 (die S.e op. 3 sind als Werke von Roman Hoffstetter nachgewiesen worden) läßt sich Stimmigkeit des Satzes, polyphone Vertiefung der Homophonie, Ausgleich konzertanter Elemente und motivischer Arbeit, Einbeziehung des durchbrochenen Satzes, Erweiterung und Konzentration der Formen, Differenzierung und Individualisierung der Satzcharaktere und zyklische Bindung der Sätze zueinander konstatieren. Die S.e sind viersätzig, der Formenreichtum bleibt zwar beim stets experimentierenden Haydn erhalten, gewinnt aber feste Konturen. Wirkt sich in den 1771 und 1772 entstandenen S.en op. 17 und 20 experimentelle Vielfalt und dramatischer Ausdruck eher dissoziierend aus, markieren die 1781 komponierten S.e op. 33 (die Haydn selbst als »auf eine gantz neue Art« gesetzt bezeichnet) so etwas wie die Idealform klassischer S.-Komposition. »Höchste Konzentration der Arbeit, größter Reichtum der Gestalten bei strenger Begrenzung des Materials, einfache Klarheit der Form bei subtiler Feinheit des Details, klar überschaubare Gruppierung, Zielstrebigkeit der Entwicklung und höchste Mannigfaltigkeit in strengster Einheit« (L. Finscher) machen diese neue Art aus, die von nun an für das Komponieren von S.en Verbindlichkeit erhält. In seinen weiteren 8 S.-Zyklen hat Haydn den hier erreichten Standard entwickelt und variiert, aber nicht mehr einschneidend verändert – op. 33 war Anknüpfungspunkt sowohl für W. A. Mozart wie für L. van Beethoven. Boccherinis S.e entstanden seit 1761: anders als bei Haydn gibt es keine kontinuierliche Entwicklung, die Form steht von Anfang an bereits in satztechnischer Vollendung da. Ein voll entwickelter vierstimmiger Satz, charakteristische Tonfälle und konzertante Instrumentenbehandlung prägen alle 91 S.e, die Boccherini 1761–1804 komponierte. STADLER, Anton Paul, * 28.6.1753 Bruck an der Leitha, † 15.6.1812 Wien; östr. Klarinettist und Bassetthornspieler. Er war mit seinem Bruder Johann Nepomuk, * 6.5.1755, † 2.5.1804 Wien, im Dienste des Fürsten Golizyn, des russischen Gesandten am Wiener Hof. 1783 wurden beide Mitglieder der »Kaiserlichen Harmonie« und 1787 der Hofkapelle. S. war seit etwa 1784 mit W. A. Mozart befreundet. Ihre Beziehungen verstärkten sich mit dem Eintritt S.s in die Freimaurerloge »Zum Palmbaum« (1785), der auch Mozart angehörte. S. begleitete Mozart 1791 nach Prag, wo er bei den ersten Aufführungen von La clemenza di Tito die Soloklarinette bzw. das Solobassetthorn spielte. Mozart schrieb für ihn das Klarinettenquintett KV 581 und das -konzert KV 622. S., der auch als Komponist mit Stücken für seine Instrumente hervorgetreten ist, trug wesentlich zur Verbesserung des Bassetthorns und der Klarinette bei. STREICHQUARTETT (engl.: string quartet; frz.: quatuor a cordes; it.: quartetto d’archi; span.: cuarteto de cuerda) ist einerseits eine Besetzungsangabe, die ein solistisches Ensemble von 2 Violinen, Viola und Violoncello meint, andererseits eine kammermusikalische Gattung für diese Besetzung, die seit dem 2. Drittel des 19. Jh. als die im Rang höchste innerhalb der Kammermusik angesehen wird. Die Gattung S. entwickelte sich in der Mitte des 18. Jh.; ihre Voraussetzungen reichen jedoch zurück ins 16. und 17. Jh.: in den musiktheoretischen Bereich, der seit G. P. da Palestrina die Vierstimmigkeit als das vollkommenste Prinzip des musikalischen Satzes ansah, die zudem den menschlichen Stimmgattungen Sopran, Alt, Tenor und Baß entsprach. Vorformen des S.s sind Streichquartett Streichquartett 22 Streichquartett Lithographie (um 1830) von M. Vielhorsky Mozarts S.e entstanden zwischen 1770 und 1790; nach Jugendwerken sind es die 6 Haydn gewidmeten S.e KV 387, 421, 428, 458, 464, 465 (entstanden zwischen 1782 und 1785), die – an Haydns op. 33 orientiert – als Frucht »langer und mühseliger Arbeit«, wie es in der Widmung heißt, Mozarts Rang als Quartettkomponist ausmachen. Ergänzt werden sie durch die S.e KV 499 (1786) und KV 575, 589 und 590 (1789– 90), die das Bild eines formal eher konservativen, aber im Detail außergewöhnlich einfallsreichen und kunstvollen Quartettstils bestätigen und abrunden. Beethovens frühe S.e op. 18 (1798–99) fußen auf Haydn und Mozart; um so gewaltiger ist die Entwicklung über die großräumig-konzertanten S.e op. 59 (1805–06), die subjektiv-individuellen op. 74 (1809) und op. 95 (1810) bis hin zu den spröden, komplizierten, in der Radikalität der Tonsprache inkommensurablen Spätwerken op. 127, 130, 131, 132, 135 und der Großen Fuge op. 133, die Beethoven zwischen 1822 und 1826 schrieb und die wie ein erratischer Block das ganze 19. Jh. beunruhigten. Neben diesen Hauptwerken gibt es zwischen 1770 und 1830 eine Fülle von Quartettkompositionen von Klein- und Nebenmeistern; denn die Gattung war zur Mode geworden, galt als vorbildlich für hausmusizierende Dilettanten und brachte so auch zahlreiche Trivialstücke, Bearbeitun- gen und Arrangements hervor. Die Spielarten des Quatuor brillant mit solistischer erster Violine und des Quatuor d’airs connus (also Opernbearbeitungen) fanden bes. in Frankreich und England Verbreitung, während das Quatuor concertant, Haydnschen Satzstrukturen verpflichtet, im Umkreis der Wiener Klassik reüssierte. Zugleich wandelte sich der soziale Ort: seit etwa 1815 gab es mehr und mehr professionelle Ensembles, und seit 1830 setzten sich S.-Konzerte durch: die Einheit von Spieler und Zuhörer, die schon Beethovens op. 59 leugnete, löste sich auf: die anspruchsvoller und komplexer werdenden Stücke verlangten den spezialisierten Interpreten. Hatte sich Schubert mit seinen späten S.en c-moll, D 703 (1820), a-moll, D 804, d-moll, D 810 (1824) und G-Dur, D 887 (1826) noch neben Beethoven und eher zum Lyrisch-Intimen tendierend behaupten können, so wich die Quartettkomposition des 19. Jh. dem Vorbild eher aus: Komponisten wie L. Spohr und G. Onslow schrieben konzertante S.e; lediglich F. Mendelssohn Bartholdy (7 S.e zwischen 1823 und 1847) setzte sich mit Beethovens Spätwerk auseinander. In Deutschland blieb das S. eine hochgeachtete, aber eher sporadisch bedachte Gattung: so u. a. bei R. Schumann (3 S.e op.41, 1842), J. Brahms (3 S.e op. 51 und 67 1873–75), M. Reger, H. Wolf und H. Pfitzner. Dafür spielte sie in 23 Streichquartett Taraf de Haïdouks den nationalen Schulen eine große Rolle (A. Dvořák, B. Smetana, P. Tschaikowsky, N. Rimski-Korsakow, A. Borodin, A. Rubinstein, S. Tanejew, A. Glasunow), in den nordischen Ländern (E. Grieg, N. W. Gade, J. Sibelius), in Frankreich (C. Franck, É. Lalo, G. Fauré, Cl. Debussy, M. Ravel) und – weniger umfangreich – in Italien (G. Donizetti, G. Verdi, G. Sgambati). In der ersten Hälfte des 20. Jh. rückt das S. erneut in den kompositorischen Mittelpunkt: die S.e von B. Bartók, L. Janáček, A. Schönberg, A. Berg und A. Webern sind nicht nur individuell ausgeformte Einzelwerke, sie stehen auch wieder für den Rang der Gattung als Ort kompositorischen Experiments und neuer Form, Struktur- und Klangentwicklung. Auch auf P. Hindemith trifft dies zu, und eine ganze Reihe von Komponisten (D. Milhaud, E. Wellesz, H. Villa-Lobos, G. Fr. Malipiero, Dm. Schostakowitsch) schrieb umfangreiche Werkzyklen. Daneben sind I. Strawinskys Quartettstücke eher Versuche, sich aus der Tradition zu lösen. Nach 1945 führte die experimentelle Tendenz, die der Gattung weiterhin anhing, zumal zu einer Ausweitung der klanglichen und klangfarblichen Spektren des S.s (P. Boulez, Livres, 1949; Krz. Penderecki, S.e 1960, 1968; H. Lachenmann, Gran Torso, 1971), schließlich auch zu einer formalen Ausweitung bis in aleatorische (Fr. Evangelisti, Aleatorio, 1959; W. Lutosławski, S., 1964) und zufallsgesteuerte Bereiche hinein und hält die Strukturen in hyperkomplexen Formen in der Schwebe zwischen festen und scheinbar zufälligen Abläufen (M. Kagel, 1967, G. Ligeti, 1968). In den letzten Jahren dagegen wird eine Tendenz zur formalen Rückbesinnung (S.e von M. Trojahn, 1976; U. Stranz, 1976; W. Rihm) spürbar, ebenso eine bewußte semantische Füllung durch Erweiterung des Klangspektrums (L. Nono, Diotima; H. Zender, Hölderlin lesen) bis hin zur Ergänzung des Ensembles durch Elektronik (George Crumb, T. de Leeuw, Enrique Raxach). Seit dem zweiten Drittel des 19. Jh. haben sich mehr und mehr feste, spezialisierte Quartettensembles herausgebildet: war es für Beethoven das SchuppanzighQuartett, so für Mendelssohn und Schumann das Müller-, für Brahms das Joachim- und das HellmesbergerQuartett, für Schönberg und Hindemith das Rosé-, das Kolisch- und das Amar-Quartett. Waren diese Ensembles in der Regel auf einen engeren geographischen und kulturellen Raum beschränkt, so hat das Zeitalter der Massenmedien dazu geführt, daß führende Quartettensembles unserer Zeit (Amadeus-Quartett, Juilliard String Quartet, LaSalle Quartet, Quartetto Italiano, Alban Berg-, Guarneri- und Melos-Quartett, Tokyo String Quartet) weltweit bekannt geworden sind. Schallplatte und Rundfunk übernehmen immer mehr eine Repertoirepflege, die das öffentliche Konzert nur noch in Ausnahmefällen leistet – von der Prä- sentation und Durchsetzung neuerer Quartettwerke ganz zu schweigen. w. konold TANGO, Musik-, Tanz- und Liedform, die Ende des 19. Jh. in den von europäischen Einwanderern geprägten Vorstädten von Buenos Aires, Montevideo und den Hafenstädten am Rio de la Plata entstand. Im T. treffen sich die einheimischen Musikformen der 씮 Milonga und des afroargentinischen Candombe mit der kubanischen 씮 Habanera und dem spanischen, von der Habanera beeinflußten T. andaluz. Europäisch geprägte Melodik und Harmonik verbindet sich in den T.-Kompositionen mit dem Habanera-Rhythmus (2/4-Takt: ), der durch Akzentuierungen, Synkopierung und Agogik erweitert wird. Bereits vor dem ersten Weltkrieg war der T. in Paris, bald darauf in ganz Europa, Nord- und Lateinamerika und Japan ein populärer, wegen seiner angeblichen Herkunft aus dem Bordell-Milieu jedoch nicht unumstrittener Gesellschaftstanz. Der frühe T. wurde von Instrumental-Trios (Flöte, Violine, Gitarre) gespielt, bevor größere Besetzungen mit verschiedenen Saiteninstrumenten (Violine, Kontrabaß, Klavier, Gitarre) und dem von deutschen Immigranten eingeführten Bandoneon aufkamen. Neben den Instrumentalgenres T. de corte milonga und T. de corte romanza entwickelte sich in den 20er Jahren das T.-Lied (T. canzión), dessen Texte von unglücklicher Liebe, dem Verlust der Jugend und der moralischen Integrität handeln. Populärster T.-Sänger war Carlos Gardel (1887–1935). Der Bandoneon-Spieler Astor Piazolla (1921–1992) verschmolz nach dem zweiten Weltkrieg Jazz-Einflüsse in seinen modernen T. nuevo. m. pfleiderer TARAF DE HAÏDOUKS, rumänisches Roma-Ensemble. Die bis zu vierzehnköpfige Gruppe um den Geiger Nicolae Neacsu (†2002) war die erste Formation, die nach dem Zusammenbruch des Ostblocks die Musik der balkanischen Roma auf mitteleuropäische Bühnen brachte. Die Mitglieder stammen aus dem wallachischen Dorf Clejani und sind Vertreter der jahrhundertealten Tradition der Taraf-Ensembles, die in der Besetzung Geigen, 씮Cimbalom, Akkordeon und Baß spielen. Aufgrund des langwährenden osmanischen Einflusses trägt ihre Musik orientalische Züge. Für die Europa-Touren wurden 1989 Musiker verschiedener Generationen eines Musiker-Klans von zwei belgischen Musikproduzenten zu einer All-Star-Band zusammengestellt. Später arrangierte man die Zusammenarbeit mit 씮Yehudi Menuhin und dem 씮 R Kronos Quartet. Die T. stießen ein großes Interesse an den musikalischen Traditionen der Roma an, in ihrer Nachfolge geben weitere Tarafs und Blaskapellen u. a. aus Rumänien, Macedonien und Serbien weltweit Gastspiele. s. franzen Te Deum Die tote Stadt 24 TE DEUM, Te Deum laudamus (lat., = Herr Gott, dich loben wir), ist der von der Legende den Kirchenvätern Ambrosius und Augustinus zugeschriebene »ambrosianische« Lobgesang, dessen aus verschiedenen Quellen kunstvoll geformter Prosatext im Antiphonar von Bangor (um 690, aus dem irisch-keltischen Bereich) erstmals aufgezeichnet wurde. Den Klosterregeln des Benedikt von Nursia sowie Caesarius und Aurelianus von Arles zufolge war das T. in der 1. Hälfte des 6. Jh. in Italien und Südfrankreich verbreitet und bildete den Abschluß des monastischen Nachtoffiziums. Aus diesen Anfängen wurde das T. als Abschluß Bestandteil der 씮 Matutin, ausgenommen die Advents- und Fastenzeit. An besonderen Festtagen, bei Bischofs- und Abtsweihen, Fronleichnams-, Reliquien- und Dankprozessionen sowie bei Messen zu politischen Anlässen (Krönungen, Fürstentaufen usw.) bildete es als Lob-, Dank- und Bittgesang den Abschluß. Ungeklärt ist, ob Niketas von Remesiana († 441) der Autor des Textes ist. Inhaltlich gliedert sich das T. in 3 Abschnitte: 1. Der Lobpreis Gottvaters ist symmetrisch um das Sanctus gestaltet und wird von der (wahrscheinlich jüngeren) Doxologie beschlossen. 2. Der christologische Teil mündet in das Fürbittgebet Te ergo quaesumus. 3. Abschließende Psalmversikel krönen den Lobpreis. – Für das chorale T. sind 2teilige psalmodische Rezitationsformeln charakteristisch, die zum ältesten Bestand liturgischer Gesänge gehören. Zur Überlieferung der Melodien geben die Musica enchiriadis (Ende 9. Jh.) und Guido von Arezzo Hinweise mit Melodiezitaten. Verbreitung und die spätere Übernahme durch M. Luther führten zu Varianten und Neubildungen. In der römischen Kirche stehen heute 4 Melodien zur Verfügung: 1. Der Tonus simplex; 2. der melodisch reichere Tonus solemnis, der häufig mehrstimmigen Bearbeitungen als C.f. zugrunde liegt; 3. der Tonus juxta morem Romanorum; 4. der Tonus des monastischen Antiphonale. – Bereits für das 9. Jh. sind dt. Übersetzungen nachweisbar, die die Bedeutung des Gesanges für die Volksfrömmigkeit bezeugen; seit dem 16. Jh. gehört die Nachdichtung als Kirchenlied zum festen Bestand ev. und kath. Gesangbücher (Großer Gott, wir loben dich; Herr Gott, dich loben wir). Die älteste mehrstimmige Bearbeitung des T. ist ein als Fragment erhaltenes Ms. aus der 2. Hälfte des 13. Jh. aus Cambridge. Erst im 15./16. Jh. begegnet das mehrst. T. wieder und bildet mit Magnificat und Hymnen einen Sonderbereich motettischer Sätze. Von den zahlreichen nachweisbaren Kompositionen stammen die meisten von reformatorischen Komponisten. Die überwiegend hsl. Überlieferung läßt auf lokale Bestimmung schließen. In vielen motettischen T. ist die versweise Komposition gemäß dem 1st. T. beibehalten, die überwiegende Zahl der Kompositionen jener Zeit berücksichtigt im Sinne der Alternativ-Praxis nur jeden 2.Vers; Unterstützung (auch des choralen T.) durch Orgel oder andere Instrumente, bes. Trompeten, ist vielfach belegt. Im ev. Bereich waren Vertonungen des lat. Textes üblich, solche auf dt. Übersetzungen selten. Die 7 T. des M. Praetorius (in Musae Sioniae III, V, VII und Urania) folgen der lat. Tradition. Im Barock wird das T. zu einer der repräsentativ prunkvollen Kompositionen konzertanter Kirchenmusik, die im Zusammenhang mit dem politischen und gesellschaftlichen Leben standen; Sondereffekte wie Glocken oder Kanonen in einigen T. betonen dies. Herausragend sind die T. von M.-A. Charpentier (aus einem von ihnen stammt die Eurovisions-Fanfare), J.-B. Lully (zur Taufe seines Sohnes 1677 geschrieben, dessen Pate Ludwig XIV. wurde) und 4 von J. A. Hasse, davon eines zur Einweihung der Dresdner Hofkirche 1751. A. Caldaras T. entstand zur Taufe des späteren Kaisers Joseph II., H. Purcell und G. Fr. Händel vertonten die seit Mitte des 16. Jh. bekannte engl. Version. Von den T. W. A. Mozarts (KV 141) und der Brüder Haydn ist das für Maria Theresia komponierte Hob. XXIIIc : 2 von J. Haydn das bedeutendste. Neben historisierenden kleineren T. wie dem F. Mendelssohn Bartholdys von 1827 nahmen die T.Kompositionen im 19. Jh. Dimensionen an, die an Pracht- und Klangentfaltung den Maßstab von Oper und Symphonik legten. Die wichtigsten stammen von H. Berlioz (1854), Fr. Liszt (1859), A. Bruckner, A. Dvořák (1892) und G. Verdi (1896). Im 20. Jh. haben veränderte kompositorische und kirchenmusikalische Auffassungen auch z. T. den Charakter des T. verändert. Neben größer besetzten Werken von G. Raphael (1930), J. Haas (1945) und E. Pepping (1956) entstanden das T. für Doppelchor und Bläser von S. Reda (1950) und das T. laudamus deutsch von K. Huber (1955/ 56) aus kirchenmusikalischer Neubesinnung. Das Meißner T. von W. Hufschmidt, zur 1000Jahr-Feier des Bistums Meißen 1968 geschrieben, bezieht einen fragenden Gegentext von Günter Grass ein. g. schumacher TOTE STADT, DIE, Oper in 3 Akten von E. W. Korngold, op. 12, Text vom Komponisten und seinem Vater Julius Korngold (unter dem Pseudonym Paul Schott) nach George Rodenbachs Roman Bruges-la-Morte (Das tote Brügge, 1892). Ort und Zeit der Handlung: Brügge, Ende des 19. Jh.; UA: 4.12.1920 Hamburg und Köln (am selben Abend). Klangliche Ästhetisierung des Alten und Vergangenen, eine Atmosphäre der Versunkenheit und des Schwebens zwischen Traum und Realität sind Hauptcharakteristika des musikalischen Bildes, das von Korngold in seiner erfolgreichsten Oper entworfen wird. Paul lebt zurückgezogen in Brügge, der »toten« Stadt, passiv und mutlos seiner verstorbenen Frau nachtrauernd. Deren Ebenbild glaubt er in der jungen Tänzerin Marietta zu sehen; durch einen Traum erkennt er jedoch, daß seine Gefühle für Marietta nur der krampf- 25 Die tote Stadt Trio hafte Versuch waren, seine Frau zu neuem Leben zu erwecken: Als Marietta sich über Pauls Ergriffenheit und beinahe sakralen Ernst belustigt, erwürgt er sie; mit dem Erwachen ist Paul von seinen Zwangsvorstellungen befreit und beginnt ein neues Leben. – Nicht nur die unheimlich-groteske Parodie auf die Auferstehungsszene aus Meyerbeers Oper Robert der Teufel ist die Ursache für die einstige Berühmtheit des Werkes; Korngolds Treffsicherheit in der Auswahl kompositorischer Mittel von Spätromantik und Impressionismus sowohl in der Affektdarstellung als auch in der Situationscharakteristik, vor allem jedoch die Beherrschung des klanglich »überwältigenden« Orchesterapparats (u. a. dreifaches Holz, Celesta, Orgel und Glockenspiel) weisen die Oper als musikalisches Meisterstück aus. w. a. makus Brahms: Bargiel, Dietrich, Gade, Kiel, Rubinstein, Goldmark, Raff. Andere Traditionslinien formten sich zeitgleich in Frankreich (Franck, Alkan, Blanc, Reber, Saint-Saëns, Fauré, Ravel) und später in Rußland (Tschaikowsky, Rachmaninow, Arensky, Tanejew). Der vormals durchsichtige kammermusikalische Duktus wandelte sich Ende des 19. Jahrhunderts entsprechend den allgemeinen stilistischen Tendenzen zusehends ins Orchestrale, wobei dem Klavier als Akkordinstrument wieder eine tragende Funktion zugewiesen wurde (u. a. Dvořák, Juon, Reger). In diesem Kontext steht das bemerkenswerte Trio (1904/11) von Ives einzigartig dar. Im Gegensatz zum ästhetisch etablierten und äußeren Bedingungen nahezu gänzlich enthobenen Streichquartett, zeigt sich die Abhängigkeit des Klaviertrios von seinem sozialhistorischen Kontext besonders mit Blick auf die Entwicklung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Durch den gesellschaftlichen Umbruch verlor es mit dem bürgerlichen Salon seinen vornehmlichen (aber nicht ausschließlichen) Aufführungsort. Zudem führten klangliche und satztechnische Bedenken zu einem deutlichen Desinteresse der Komponisten an Kammermusikbesetzungen mit Klavier. Die Gattung Klaviertrio ist seither nur noch mit Einzelwerken bedacht worden: Copland (Vitebsk, 1929), Casella (op. 62, 1938), Schostakowitsch (op. 67, 1944), Blacher (1970), Killmayer (Brahms-Bildnis, 1976), Feldmann (1980), Rihm (Fremde Szenen, 1982/84), Kagel (1984/85). Tripelkonzerte (mit dem Klaviertrio in solistischer Funktion) schrieben Beethoven (op. 56), Casella (ebenfalls op. 56, 1933) und Martinů. Ein eigenes Repertoire weist die Besetzungsvariante mit Violine und Viola auf (Lindblad, Lachner, Ph. Scharwenka, Reger). Sie betont gegenüber dem Klavierbaß die unabhängige Führung der Mittellage. Wird ein Streich- durch ein Blasinstrument ersetzt, spricht man entsprechend (wenn auch mißverständlich) von einem Klarinettentrio (Beethoven, Brahms, Zemlinsky) oder Horntrio (Brahms, Ligeti). Besonders die alternative Besetzung der Violine durch eine Flöte war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts sehr beliebt (Clementi, Weber, L. Farrenc). Werke mit zwei Blasinstrumenten schrieben u. a. Glinka, Reinecke, Poulenc. 3) Der Begriff Streichtrio (bis weit ins 19. Jahrhundert noch Violintrio) bezieht sich vor allem auf die heute gültige Standardbesetzung Violine, Viola und Violoncello. In der Variante mit zwei Violinen und Violoncello (besonders bei Boccherini) ist noch die Herkunft von der barocken Triosonate deutlich zu erkennen. Eine Bezifferung der Baßstimme als Continuo wurde dabei von den Komponisten nicht vorgenommen, sondern oftmals von den auf Absatz bedachten Verlegern ergänzt. Seitenzweige bildeten sich mit dem oft zweisätzigen dialogisierenden Trio und dem konzertierenden Trio, bei dem die erste Violine solistisch her- TRIO (von it. tre = drei). – 1) Als Satz-Bz. bei Tänzen (z. B. Menuett) und Märschen ein zwischen dem Hauptteil und seiner Wiederholung eingeschobener Mittelteil. Der Terminus weist darauf hin, daß es sich ursprünglich um einen im Unterschied zur Vollbesetzung der Rahmenteile 3st. Satz handelte, so bei J.B. Lully um einen Abschnitt in der Besetzung für 2 Ob. oder 2 Fl. und Fag. innerhalb einer 5st. Streicherbesetzung. In 씮 Menuett und 씮 Scherzo hat das T. seit der Wiener Klassik vollere Besetzung, ist in der Regel jedoch ruhiger gehalten als der Hauptsatz und weist kantable Melodieführung, häufig auch Tonart- und Tempowechsel auf. 2) Als Klaviertrio wird seit Anfang des 19. Jahrhunderts sowohl eine Komposition für Violine, Violoncello und Klavier als auch das entsprechende Instrumentalensemble bezeichnet. Entstanden aus der vom Continuo oder obligaten Cembalo begleiteten Violinsonate, der Triosonate und der begleiteten Klaviersonate, entwickelte sich das Klaviertrio im ausgehenden 18. Jahrhundert (etwas später als das Streichquartett) zu einer eigenständigen Gattung. Haydn, Mozart und ihre Zeitgenossen bezeichnen es wegen dem mehr oder weniger deutlichen Übergewicht des Klaviers noch als »Sonate«. 1795 setzte Beethoven einen Meilenstein mit seinen drei 1795 als op. 1 veröffentlichten Trios, bei denen die drei Instrumente gleichwertig obligat behandelt werden. Durch sein großformatiges Trio op. 97 (»Erzherzogtrio«, 1816) setzte sich (im Gegensatz zur klavierbegleiteten Solosonate) die viersätzige Anlage als Norm durch. Wichtige Kompositionen aus dieser Zeit stammen von Louis Ferdinand, Hummel, Onslow, Schubert und Chopin. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts schufen Marschner, A. Fresca, Hiller, Pixis, Reissiger, Spohr, Litolff und Berwald eigene Werkgruppen. Doch allein die Klaviertrios von Mendelssohn und Schumann wirkten geradezu schulebildend auf das gesamte Repertoire der jüngeren Generation um Trio Zappa 26 vortritt. Eine Besonderheit waren um 1750 die sogenannten Orchestertrios, etwa von Johann Stamitz und Mysliveček (beide op. 1), die »ou à trois ou avec toutes l’orchestre« aufgeführt werden konnten. In der Besetzung für Violine, Viola und Violoncello entstanden in Wien einige zum Teil fünf- und gar sechssätzige Werke im leichteren Tonfall des Divertimentos, wie etwa bei Mozart (KV 563) und Beethoven (op. 3 und op. 8). Mit seinen drei großformatigen, streng kammermusikalisch gearbeiteten viersätzigen Streichtrios op. 9 (1798) löst sich Beethoven dann aber aus der Sphäre funktionaler Gesellschaftsmusik, ohne darin allerdings bis auf ganz wenige Einzelwerke – etwa Schuberts Trio (D 581) – direkte Nachfolger zu finden. Zu sehr rückten Streichquartett und Klaviertrio in das Zentrum des schöpferischen Interesses. Erst um 1900 entstand wieder eine kleine Gruppe von nun serenadenartigen Kompositionen (Reinecke, Reger, Dohnányi, Haas), die aber offensichtlich den Anstoß zu einer neuerlichen Auseinandersetzung gaben. Herausragende Werke schrieben Hindemith (op. 34, 1924; 1933), Alexander Jemnitz (op. 21 und op. 24), Webern, Schönberg, Milhaud (op. 274), Rihm (Musik für drei Streicher 1977). Einen Sonderfall des Streichtrios stellen die weit über 100 Divertimenti für 씮 Baryton, Viola und Violoncello dar, die J. Haydn für den Fürsten Esterházy komponierte. 4) Als Bläsertrio werden Werke für drei Blasinstrumente, aber auch solche in Mischbesetzung bezeichnet. Um 1800 erfreute sich die Kombination von 2 Oboen und Englisch Horn großer Beliebtheit (Trio op. 87 von Beethoven), Serenaden für Flöte, Violine und Viola schrieben Beethoven (op. 25) und Reger (op. 77a und op. 141a). Ein aus Oboe, Klarinette und Fagott zusammengesetztes Ensemble wird Trio d’anches (RohrblattTrio) genannt. Für diese klanglich reizvolle Besetzung schrieben Flégier (Concert Suite 1897), Villa-Lobos (Trio 1921) und Schulhoff (Divertimento 1927), bevor in den 30er Jahren auf Anregung der Pariser Verlegerin Louise Dyer zahlreiche weitere Komposition (u. a. von Bozza, Ibert, Koechlin, Milhaud, Roussel) entstanden. starken zu stiften. Er wird bei einer Messerstecherei getötet. Mit seiner Mischung von lyrischen Liebesszenen, Kritik an der modernen Großstadtgesellschaft, mitreißenden Ballettnummern und anspruchsvoller Musik, wurde die W. zum bis dahin kühnsten Werk des amerik. Musiktheaters. Zu Evergreens wurden: Tonight, Maria, America, I Feel Pretty, Somewhere. Abb. siehe Seite 37 r. wallraf ZAPPA, Frank (eig. Francis Vincent), * 21.12.1940 Baltimore (Maryland), † 4.12.1993 Los Angeles; amerik. Rockmusiker. Er gründete 1964 die Gruppe Mothers of Invention. Ihre Musik, die Elemente des Rock ’n’ Roll, Jazz, neuerer Musik (I. Strawinsky, E. Varèse, J. Cage), des Vaudeville sowie Revue-Gags und technische Effekte (Elektronik, Verzerrungen, Übersteuerungen) zu sogenannten »musikalischen Müllskulpturen« (Z.) vermischt, wendet sich mit sozialkritischen Texten und teilweise obszön-provokativen Showeinlagen gegen den sogenannten »American way of life«. 1969 löste Z. die Band auf, formierte sie später aber neu, drehte mit ihr 2 Filme und unternahm zahlreiche Tourneen, u. a. auch nach Deutschland (zuletzt 1982). Von seinen Schallplatteneinspielungen sind zu nennen: Freak Out! (1966), Absolutely Free (1967), Cruisin’ with Ruben & 771e Jets (1968), Weasles Ripped My Flesh (1970), Fillmore East June 71 (1971), Just Another Band from L. A. (1972), Over Nite Sensation (1973), Apostrophe (1974), One Size Fits All (1975), Orchestral Favourites (1979), Tinsel Town Rebellion (1981), Perfect Stranger (1984), Broadway the Hard Way (1989) m. kube ( 2 – 4 ) WEST SIDE STORY, amerik. Musical von L. Bernstein. Buch von Arthur Laurents; Songtexte von Stephen Sondheim. Ort und Zeit der Handlung: New York, in den 50er Jahren. UA: 26.9.1957 New York (Winter Garden Theater; 734 Vorstellungen); Idee, Regie und Choreographie: Jerome Robbins. EA in dt. Sprache: 25.2.1968 in Wien (Volksoper). Verfilmt 1961. Angelehnt an W. Shakespeares Romeo und Julia, werden hier die Capulets und Montagues zu verfeindeten Halbstarken-Banden, den einheimischen Jets und den eingewanderten puertoricanischen Sharks. Der New Yorker Tony liebt Maria, die Schwester des Anführers der Sharks, und versucht Frieden zwischen den Halb- Frank Zappa (1991) Impressum Die Auszüge der Stichwörter aus dem Musiklexikon sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. © J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart Stand: Juni 2005 Anfragen und Zuschriften richten Sie bitte an: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und C. E. Poeschel Verlag GmbH Hausanschrift: Werastr. 21–23 70182 Stuttgart Postanschrift: Postfach 10 32 41 70028 Stuttgart Telefon 07 11/21 94-0 Telefax 07 11 /21 94-119 Internet: http://www.metzlerverlag.de