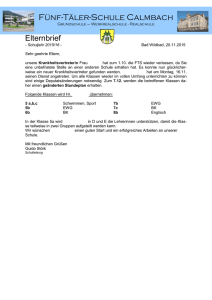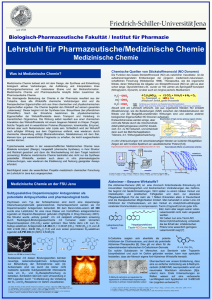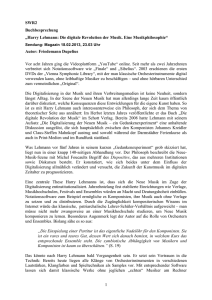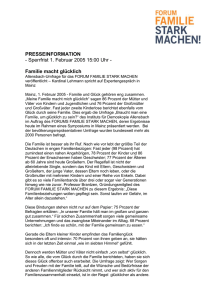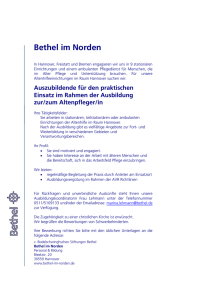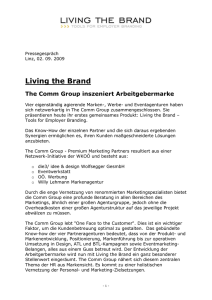Der Umgang mit Musikauffassung als Schlüssel in
Werbung

BARBARA BALBA WEBER Der Umgang mit Musikauffassung als Schlüssel in Vermittlungsprozessen Abschlussarbeit für den Master of Research on the Arts Januar 2013 2 Inhalt 1 Einleitung S. 4 2 Fragestellung und Ausgangshypothese S. 7 3 Untersuchungsgegenstand und Methode S. 8 4 Forschungsstand/ Theorieübersicht S. 9 5 Die zwei untersuchten Fallbeispiele S. 11 5.1 Fall „Dozentin Klassik“ (DK) S. 11 5.2 Fall „Dozent Jazz“ (DJ) S. 17 6 Versuch einer Analyse drei verschiedener Musikauffassungen 7 S. 22 6.1 Hörverhaltenskonsistenz nach Lehmann S. 23 6.2 Dimensionen des Musikerlebens (nach Lehmann) S. 24 6.3 Analyse der Musikauffassung von BBW: „Flucht“ S. 25 6.4 Analyse der Musikauffassung von Fall DK: „Rhetorik“ S. 27 6.5 Analyse der Musikauffassung von Fall DJ: „Selbstbestimmung“ S. 28 Faktoren einer Musikauffassung S. 29 7.1 Musikauffassung als Identitätskarte S. 29 7.2 Familiäre Prägung einer Musikauffassung S. 30 7.3 Einfluss auf die Musikauffassung durch die Ausbildung S. 31 7.4 Zusammenhang von Musikauffassung und Genre-Zugehörigkeit S. 32 7.5 Musikauffassung und „Definition“ von Musik S. 33 7.6 Musikauffassung und Bewertung von Musik S. 34 7.7 Musikauffassung und die Funktion von Musik S. 35 8 „Musik“ dürfte kein Singular sein (Kaden) S. 36 9 Musikauffassung und Vermittlungstätigkeit S. 39 9.1 Orte der Vermittlung S. 39 9.2 Umgang mit dem „Anderen“ S. 39 9.3 Handwerk/ Ansätze S. 40 10 Strategien im Umgang mit dem „Anderen“ (Barth) S. 41 11 Schlusszusammenfassung S. 43 12 11.1 Fazit S. 43 11.2 Anwendungsmöglichkeit des Ergebnisses für die Praxis S. 44 11.3 Schlusswort S. 46 Literaturverzeichnis S. 48 3 4 Der Umgang mit Musikauffassung als Schlüssel in Vermittlungsprozessen „Der durchschnittliche Hörer erlebt Musik in seinem alltäglichen Leben immer funktional, nie völlig zweckfrei. Dieser wichtige Zugang sollte kein musikpädagogisches Tabu sein, das aus einem falsch verstandenen Autonomieanspruch des Kunstwerks abgeleitet wird“ (LEHMANN 1993) Zusammenfassung/ Abstract Die Herausforderung, gewisse Musik an gewisse Rezipierende zu vermitteln, kann Berufsmusikerinnen und –musiker vor teilweise frustrierende Probleme stellen, für deren Lösung ein professionelles Handwerk unabdingbar ist. Ein möglicher Schlüssel in Vermittlungsprozessen stellt der Umgang mit der eigenen und der differenten Musikauffassung dar. Hiermit möchte die vorliegende Arbeit einen Beitrag zu einem noch kaum erforschten Thema innerhalb der Musikvermittlung leisten. Mittels zwei qualitativen Fallstudien wurden die Faktoren für eine Musikauffassung ermittelt, Zusammenhänge zu den angewandten Vermittlungs-Strategien untersucht und mit Ansätzen aus Musikpsychologie, Musiksoziologie und Musikpädagogik kontextualisiert. Das Ergebnis der Forschung ist evident, in der Berufspraxis und der Lehre aber als Haltung und Handwerk in Vermittlungsprozessen noch selten anzutreffen: Musikvermittlung funktioniert am besten, wenn nicht die eigene Musikauffassung zu vermitteln versucht wird, sondern wenn von der Musikauffassung des/der Rezipienten/in ausgehend Brücken zu einzelnen Faktoren der „Kultur“ einer „anderen“ Musik geschlagen werden. 1 Einleitung Vor einiger Zeit gab mir ein scheinbar alltägliches Vorkommnis den Anstoss, mich dem scheinbar alltäglichen Thema „Musikauffassung“ zuzuwenden: in einem meiner Seminare im Herbst 2011 zur Praxis der Musikvermittlung verweigerte sich ein Student einer praktischen Übung (Erstellen von Lehrermaterial zur Vermittlung eines Konzertprogramms an Jugendliche), weil er den „Auftragsgegenstand“ (eine Komposition des zeitgenössischen Westschweizer 5 Komponisten Michael Jarrell) als „keine Musik“ beurteilte. Für mich als Spezialistin in Neuer Musik war das zwar kein ungewohntes Phänomen, da ich Reaktionen heftiger Abneigung und Unverständnis gegenüber diesem Musikgenre aus langjähriger Erfahrung kannte, aber in diesem konkreten Fall drohte die Ablehnung des Studenten eine Eigendynamik innerhalb der Gruppe zu bewirken und eine Weiterarbeit am Thema zu verhindern. Kurz: ich kam nicht umhin, mich in diesem Moment dem Problem mit voller Aufmerksamkeit zuzuwenden und über diesen Moment hinaus eine in meiner Musikvermittlungspraxis seit langem beobachtete Erscheinung endlich etwas genauer zu untersuchen: Worauf verweist das Phänomen, dass Menschen sich über die Vorstellungen davon, was „Musik“ sei, streiten können? Nach Wochen der Lektüre, die mich von musikalischer Hermeneutik und Semantik über die Philosophie und Musikpsychologie bis hin zur Neurowissenschaft und Musikpädagogik führte, wurde mir immer klarer, dass ich hier eine Frage gefunden hatte, die eventuell zentrale Herausforderungen innerhalb der jungen Profession Musikvermittlung aus einer bisher kaum eingenommenen Perspektive zu beleuchten und gewisse Schwierigkeiten im Umgang mit Bildungsaufträgen zu erklären vermag und dass es sich durchaus lohnen könnte, in dieser Richtung weiter zu forschen. Zurück zum Anschauungsbeispiel aus der Praxis: Für das Berufsziel Musikgymnasiallehrer sollte der betreffende Student in diesem Seminar unter anderem das Handwerk lernen, mit Bildungsaufträgen wie eben dem vorliegenden exemplarisch umzugehen (hier: Vermittlung einer zeitgenössischen Komposition an Jugendliche). Die Verweigerung der Übung und der emotionale Ausbruch des Studenten stellten mich vor grundlegende Fragen: Warum schaffte es der Student nicht, diese Musik als Gegenstand einer Übung zu abstrahieren, sondern steigerte sich in eine verbale Abgrenzung hinein, die in einem vehementen Plädoyer gegen Kunstmusik des 20.Jahrhunderts generell gipfelte? Wieso gelang es mir nicht, diesem Studenten die Angst vor der Aufgabe zu nehmen, eine von ihm nicht präferierte Musik einem jugendlichen Publikum vermitteln zu müssen? Warum versuchte er sich der Aufgabe dadurch zu entziehen, dass er einer real existierenden Musik die Berechtigung absprach, „Musik“ zu sein? Ich entschied mich für ein kleines Experiment, änderte deshalb nach der Pause das Programm und liess die Studierenden als erstes je ein Wort an die Tafel schreiben, das für sie persönlich einer Definition von „Musik“ am nahesten kommt. Die Worte der Studierenden 6 unterschieden sich, wie zu erwarten war, teilweise grundlegend voneinander. Als ich den betreffenden Studenten „Versöhnung“ als Definition von Musik an die Tafel schreiben sah, fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Obwohl sich Musik selbstverständlich nicht definieren lässt und jede unvorbereitete Umschreibung nur eine mehr oder weniger hilflose Wortsucherei bleiben kann, so liess diese Notfall-Übung zumindest ahnen, welchen Zugang zu Musik dieser Student haben könnte, welche Funktion Musik für ihn hat und wieso die Musik von Michael Jarrell in ihm eine derart grundlegende Abneigung hervorrufen konnte. Die Tonsprache von Jarrell, die mit heftigen Dissonanzen, extremer Dynamik und permanenter Rastlosigkeit eher auf menschliche Abgründe und unlösbare Fragen hinweist, widersprach dem Wunsch des Studenten an Musik, Unterstützung von friedlichem und fröhlichem Zusammensein und Ermöglichung einer heiteren und positiv gestimmten Gemütslage zu sein. Für ihn war „Musik“ Agens und Movens von „Frieden“, in Jarrells Komposition fand er „Konflikt“- in seiner persönlichen Logik also durchaus „keine Musik“. Hätte sich dieser Student dazu entschlossen, diese Musik tatsächlich an Jugendliche zu vermitteln, dann hätte er zwangsläufig seine eigene Auffassung von „Musik“ als nur eine von vielen möglichen betrachten müssen. Er hätte von verschiedenen parallel existierenden möglichen Funktionen von Musik ausgehen müssen, um eine „andere“ als seine präferierte Musik Jugendlichen erfolgreich näher bringen zu können. Dass ein solcher Schritt unter Umständen für einen jungen Musiker eine kaum lösbare Aufgabe bedeuten kann, wurde mir nach dieser ersten spontanen Analyse schlagartig bewusst. Für unseren Seminartag positiv ausgewirkt hat sich, dass ich dem Studenten daraufhin Verständnis entgegenbringen konnte; und eine Weiterarbeit am Thema war möglich, da wir auf den Kern eines Problems gestossen waren und nicht mehr nur über Symptome dieses Problems streiten mussten. Das kleine Vorkommnis zeigte mir, dass für (angehende) Berufsmusikerinnen und musiker einerseits eine Analyse der eigenen Musikauffassung und das Wissen um parallel existierende Vorstellungen und Funktionen von „Musik“ ein zentral wichtiges Thema im Zusammenhang mit Vermittlung von Musik zu sein scheint und dass andererseits ein echtes Interesse (Neugier) an der Musikauffassung des Gegenübers Wunder bewirken kann. Seither hat mich das Thema nicht mehr losgelassen und ich habe mich ein Jahr später entschlossen, zur Frage des Zusammenhangs von Musikauffassung und Musikvermittlung eine Untersuchung zu machen. 7 2 Fragestellung und Ausgangshypothese Welche Rolle spielt die Musikauffassung von Berufsmusikerinnen und –musikern in deren Vermittlungstätigkeit, welche Schwierigkeiten können sich im Umgang mit den differenten Musikauffassungen von Rezipierenden in Vermittlungsprozessen ergeben, und welche Strategien im Umgang mit der eigenen und der differenten Musikauffassung haben welche Wirkung auf eine intendierte Vermittlung einer bestimmten Musik? Es stellt sich also einerseits die Frage, was eine Musikauffassung überhaupt sein könnte: In welchem Kontext steht der Begriff zu ähnlichen Begriffen wie beispielsweise Musikgeschmack, Musikpräferenz, Musikbegriff, Musikverständnis, Musikfunktion, etc.? Wie und wo manifestiert sich eine Musikauffassung? Welche Faktoren für eine Musikauffassung lassen sich eruieren? Lassen sich Musikauffassungen typologisieren? Andererseits stellt sich die Frage nach dem Umgang mit dem „Anderen“ als grundlegende Strategie in Vermittlungsprozessen: Verweist der Umgang mit einer anderen Musikauffassung exemplarisch auf den Umgang generell mit anderen Sichtweisen und anderen Ansichten? Welche Strategien gibt es überhaupt, um mit differenten musikalischen Auffassungen umzugehen? Vor welche Herausforderungen werden Berufsmusikerinnen und –musiker in dem Zusammenhang gestellt? Wodurch unterscheiden sich verschiedene Musikauffassungen von Berufsmusikern gegenüber derjenigen von Nicht-Profis? Und wie lässt sich ein bewusster Umgang mit der eigenen und der differenten Musikauffassung als Basis für eine professionelle Musikvermittlung in der Praxis umsetzen? Ausgangshypothese Überall dort, wo Musik im kleinen oder grossen Rahmen ausgeübt, gelehrt, angehört oder diskutiert wird, findet in irgendeiner Form Vermittlung statt. Zwischen der Musik und den Rezipierenden stehen in den meisten Fällen Berufsmusikerinnen und – musiker, die sich ihrer Vermittlungstätigkeit unter Umständen kaum bewusst sind und auch über keine fundierte Ausbildung in diesem Bereich verfügen. Ein Bildungsauftrag (mit dem eine Vermittlung auch im ausserschulischen Kontext zu tun hat, sobald es sich um in irgendeiner Form subventionierte 8 Musik handelt) stellt Berufsmusikerinnen und – musiker deshalb in der Praxis vor teilweise schwer lösbare Probleme. Exemplarisch dafür möchte ich am Beispiel des Umgangs mit der „anderen“ Musikauffassung aufzeigen, wie wichtig für eine erfolgreiche Vermittlung ein professionelles Handwerk sein kann. Ich gehe dabei davon aus, dass es grundsätzlich ganz verschiedene Musikauffassungen im Sinne einer Art persönlicher musikalischer Identitätskarte gibt und dass die Musikauffassung des Berufsmusikers mit derjenigen des Rezipienten selten deckungsgleich ist, was zu Schwierigkeiten führen und bei fehlendem professionellem Handwerk unter Umständen eine erfolgreiche Vermittlung verunmöglichen kann. 3 Untersuchungsgegenstand und Methode Exemplarisch für die Situation von Berufsmusikerinnen und –musikern in Vermittlungsprozessen habe ich Dozierende aus dem Fachbereich Musik der Hochschule der Künste Bern untersucht. Sie erschienen mir besonders relevant für eine Untersuchung von Berufsmusikern in Vermittlungsprozessen, einerseits weil sie in einem weitreichenden Netz zu anderen Schnittstellen von Musik und Rezipierenden stehen (Konzertwesen, Kulturpolitik, Medien, Musikschulen, etc.) und gleichzeitig wiederum zukünftige Musikerinnen und Musiker für vermittelnde Berufsfelder innerhalb der Musik ausbilden. Andererseits, weil ich selber Dozentin an der Hochschule der Künste Bern bin und es mir im Sinne einer modernen Feldforschung (HAHN 2005/ BARZ et al. 2008) unumgänglich schien, als Strategie für die eigene emotionale Involviertheit mich als „Fall“ in die Untersuchung teilweise auch einzubringen. Die qualitative Inhaltsanalyse (nach MAYRING 2010) von zwei im April 2012 geführten Interviews bildet die Grundlage für die Analyse von Musikauffassung und Vermittlungsstrategien von Berufsmusikerinnen und -musikern. Meine beiden Fälle habe ich dafür nach den Kriterien Musiksparte, Geschlecht, Alter/Erfahrung, stilistische Vielfalt/Einschränkung, „typischer“/“untypischer“ Hochschuldozent und Nationalität ausgewählt. Um sicherzustellen, dass möglichst unterschiedliche Ausgangslagen für die Musikpraxis vorhanden sind (beispielsweise Interpretation versus Improvisation, klassisches Umfeld versus Jazz/Pop-Umfeld), habe ich je eine Vertretung aus der Abteilung Klassik und der Abteilung Jazz der Hochschule der Künste genommen. 9 Der Fall „Klassik“ (im Text Dozentin Klassik „DK“ genannt), repräsentiert dabei den an Hochschulen üblichen Typus von hochspezialisierten Kernfachdozierenden, die eine klassisch traditionelle Karriere als Instrumentalistin gemacht haben (oder noch machen) und auf dem internationalen Parkett als Solistin und Kammermusikerin mit einem stilistisch relativ stark eingegrenzten Repertoire auftreten (in dem Fall: klassisch-romantisches Repertoire mit einzelnen Abstechern zu Klassikern des 20.Jahrhunderts). Der Fall „Jazz“ (im Text Dozent Jazz „DJ“ genannt) repräsentiert den an Hochschulen eher unüblichen Typus von Musikern, die in diversen Musiksparten (in dem Fall Jazz, Pop, Klassik, Elektro, Neue Musik) und sowohl in Komposition, Improvisation als auch in Interpretation gleichermassen versiert sind. Ich habe bewusst einen Mann und eine Frau gewählt, um allfällige geschlechtsspezifische Strategien oder Verhaltensweisen abgedeckt zu haben. Ebenso erschien es mir von Bedeutung, einen jüngeren (also vermittlungsunerfahrenen) Fall (DK) einem älteren, vermittlungserfahreneren Fall (DJ) gegenüberstellen zu können. Bei der Nationalität hingegen habe ich darauf geachtet, dass beide aus dem gleichen kulturellen (hier: deutschsprachigem) Raum kommen, da Fragen nach kulturell bedingten Unterschieden von Vermittlungsstrategien und Musikauffassungen ein zu grosses Feld eröffnet und die Ergebnisse schwer interpretierbar gemacht hätten. In meinem eigenen Fall handelt es sich um die im folgenden BBW genannte Dozentin für Musikvermittlung, die aus dem gleichen Kulturraum kommt wie die beiden untersuchten Fälle und musikalisch insofern eine Mischung aus den beiden Fällen DK und DJ darstellt, als sie eine traditionell klassische Ausbildung hat, dann aber einen musikalischen Weg über Neue Musik, Performance, Improvisation und Komposition gegangen ist. 4 Forschungsstand/ Theorieübersicht In der noch jungen Disziplin der Musikvermittlung (verstanden als Profession) gibt es zwar mittlerweile einige wegweisende hörerzentrierte Studien zu Methoden und Qualitäten von Musikvermittlung und Konzertpädagogik (WIMMER 2010), kaum aber Untersuchungen, die die musikvermittelnden Personen selbst zum Gegenstand haben. Ich stelle deshalb meine Arbeit in einen theoretischen Kontext aus den verwandten Gebieten Musikpsychologie, Musikpädagogik und Musiksoziologie. 10 Zentrale Grundlage für meine Untersuchung der Musikauffassung bildet die Studie des Hannover Musikpsychologen Andreas C. Lehmann zu habituellen und situativen Rezeptionsweisen beim Musikhören (LEHMANN 1993), die er in Anlehnung an die Studie von Klaus-Ernst Behnes Typologie des Musikgeschmacks (BEHNE 1986) gemacht und mit der er die Skala für eine Typologisierung des habituellen Hörverhalten erweitert hat. Die Arbeit von Lehmann war einerseits sehr hilfreich für meine Forschung, weil seine Begriffe für das Erleben von Musik, resp. für das habituelle Hörverhalten möglichen (bisher noch nicht existierenden) Faktoren für eine Musikauffassung sehr nahe kommen und von mir versuchsweise direkt übertragen werden können. Und andererseits verweist seine Studie indirekt auf die Herausforderungen, die bei Vermittlungsprozessen von Berufsmusikerinnen und –musikern gegenüber Nichtmusikerinnen und –musikern auftreten können (wenn es beispielsweise um die Bedeutung des strukturierenden Rezipierens von Musik oder um die Funktion von Musik geht), aber auch auf Chancen für das Schaffen von Zugängen gegenüber Rezipierenden (resp. differenten Musikauffassungen). Da es beim Thema der Musikauffassung und dem Umgang mit dem „Anderen“ im weitesten Sinne auch um die Frage geht, was unter dem so nur in Westeuropa existierenden Singular „Die Musik“ zu verstehen sei, nehme ich des weiteren den Artikel „Was ist Musik? Begriffsgeschichtliche Beobachtungen, Ketzerein, Paraphrasen“ (KADEN 1993) des Berliner Musiksoziologen, Musikwissenschaftlers und Musikethnologen Christian Kaden als eine der drei Grundlagen für meine Arbeit. Seine These, dass „Die Musik“ als Singular eigentlich gar nicht existiert, leistet mir eine wertvolle Unterstützung für meine Gedanken zum Umgang mit differenten Musikauffassungen. Aus einer dritten Richtung wird meine Arbeit zudem durch den interkulturell orientierten Ansatz der Hamburger Musikpädagogin Dorothee Barth unterstützt. In ihren Schriften zum Kulturbegriff in der interkulturellen Bildung (BARTH 2000) plädiert sie unter anderem dafür, eine bestimmte „Kultur“ als eine Art plastisches Gebilde zu verstehen, das von einer Gemeinschaft mittels gemeinsam geleisteter Bedeutungszuweisung erst quasi existent gemacht wird. Diesen Ansatz möchte ich übertragen auf mein Thema, indem ich eine bestimmte (zu vermittelnde) Musik als eine Art von „Kultur“ im Sinne von Dorothee Barth behandle, deren Bedeutung erst durch die Akteure in einem (Vermittlungs)prozess generiert wird. 11 5 Die zwei untersuchten Fallbeispiele Um Einsicht zu erhalten in das Wesen der persönlichen Musikauffassung und den Zusammenhang mit der Vermittlungstätigkeit als Berufsmusiker, resp. Berufsmusikerin, habe ich die beiden Hochschuldozierenden nach der Prägung ihrer Musikauffassung gefragt, nach Einflüssen in der Ausbildung, nach der Entwicklung im Verlaufe des bisherigen Lebens und nach dem Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Musikgenre. Um die jeweilige individuelle Musikauffassung heraus zu kristallisieren, habe ich zudem versucht zu eruieren, welche Funktion(en) Musik für die beiden Fälle hat, wie sie Musik bewerten, gegenüber welcher Art von Musik sie sich abgrenzen und welche Definitionsversuche von Musik sie unternehmen. In einem zweiten Teil habe ich nach der Vermittlungstätigkeit gefragt, um herauszufinden, wie und wo sie sich als Vermittelnde erleben, welches ihre Motivation ist, mit welchen Herausforderungen sie sich konfrontiert sehen, wie sie mit differenten Musikauffassungen umgehen und mit welchem Handwerk sie Vermittlung betreiben. 5.1 Fall „Dozentin Klassik“ (DK) 5.1.1 Prägung und Verlauf der Musikauffassung DK betont, dass sie nicht aus einer Musikerfamilie kommt und sich den Weg zur Musik „über Umwege, die nicht unbedingt nötig gewesen wären“ (Z. 34-35) selbst gesucht hat: „Also ich komme nicht aus einer Musikerfamilie, das ist sicher entscheidend für mich insofern als ich eine sehr freie und ungeprägte Zugangsweise von früh an hatte. Also ich hab mir das eigentlich alles selbst.. .“ (Z. 22-24). In ihrer Musikauffassung geprägt wurde sie erstens durch Lehrer: „Sicher haben mich Lehrer sehr geprägt, und da hab ich eigentlich glückliche Erfahrungen gemacht mit meinen Lehrern, die mir eigentlich eine sehr ehrliche Art vermittelt haben, Musik zu machen, beziehungsweise ich hab das auch gesucht“ (Z. 25-27), zweitens durch Kurse: „Ich hab mir sehr viel Anregung geholt von verschiedensten Seiten, also ich war viel auf Kursen, ich bin überall hingegangen, wo ich was irgendwie kriegen konnte, erfahren konnte, verschiedenste Richtungen eigentlich, das hat mich total oft durcheinander gebracht“ (Z. 31-34), drittens durch 12 Kammermusikpartner: „ja wie hat die sich gebildet… ja, das ist meine, durch meine persönlichen Erfahrungen eigentlich, mit Lehrern, mit ehm.. andern Musikern, also als Studentin schon, in der Kammermusik…“ (Z. 28-30) und vor allem aber „durch viel Musikhören“ (Z.31). Ihre Musikauffassung empfindet DK als „schon immer da“ (Z.70), sie spricht von Begeisterung und Entdeckung: „Früher war es einfach eine grosse Begeisterung für fast alle Komponisten (lacht), zumindest für alle grösseren ja, als Jugendliche so, diese Entdeckung, diese Welt und diese Werke“ (Z.71-72), und immer wieder von Liebe zur Musik: „Und im Prinzip ist die Inspiration, diese Begeisterung, diese Liebe zur Musik schon gleich geblieben, also das, wie ich schon vorhin sagte, das trägt mich so durch die ganzen Schwierigkeiten des Musikerdaseins auch“ (Z. 75-77). Eine Veränderung im Verlauf ihrer Musikauffassung empfindet sie höchstens im Sinne eines besser Verstehens: „Jetzt ist mir klarer, was mir liegt, wo ich mich wirklich vertraut fühle, es gibt auch Komponisten, die ich jetzt besser verstehe als früher, deren Grösse ich erst später erkannt habe, beziehungsweise die ich über die Jahre und Jahrzehnte neu wieder erkannt habe“ (Z. 72-75). Eine Zäsur tritt mit dem Beginn des Unterrichtens ein: „Ich bin mir dessen bewusster , was mir wichtig ist, wenn ich spiele, und auch grade im Unterrichten, was mir besonders wichtig ist für meine Studenten… also auch in ihrem künstlerischen Weg. Das ist mir jetzt viel klarer“ (Z. 79-82). 5.1.2 Genre-Zugehörigkeit DK sieht sich vor allem als Geigerin, Solistin und Kammermusikern und fühlt sich der Klassik, besonders der Wiener Klassik zugehörig: „Aber so Wiener Klassik, also früher Haydn, Mozart, Beethoven, dieses Sprechende, Rhetorische, oder Schubert, wo es dann auch ins Lied übergeht, das ist schon etwas, womit ich sehr viel anfangen kann“ (Z. 255-257). Mit anderen Musikgenres hat sie sich kaum auseinandergesetzt: „Also oberflächlich wird man immer eingeordnet als klassische Musikerin. Gut, ich mache keine Popmusik und ich mache keine Rockmusik (lacht) und diesen Bereich (lacht) und es interessiert mich auch nicht besonders. Überhaupt nicht eigentlich“ (Z. 11-13). 5.1.3 Definition von „Musik“ Für DK ist es eindeutig, „dass Musik schon in erster Linie mit Gesang, mit Singen zu tun hat“ (Z. 190-191). Sie fasst dabei Singen, Kommunikation, Lebendigsein und Sprechen in einen gemeinsamen Kontext: „Also mehr in diese Richtung, dass mehr musiziert wird, dass mehr 13 gesungen wird, dass es eine lebendige Art von Musikmachen ist, dass es eine Art der Kommunikation ist, dass es eine Musik ist, die spricht, mit der man kommuniziert“ (Z. 321-323) und auch als Beziehungs-Kunst: „Es geht mir um Lebendigkeit und auch um Musik als Kommunikation, als Beziehungs-Kunst“ (Z. 340). 5.1.4 Bewertung von Musik DK zeigt sich offen dafür, gute Musik nicht nur in ihrem eigenen Genre zu finden: „Aber sonst gefällt mir eigentlich alles, was gute Musik ist- und das kann Renaissance-Musik sein, das kann zeitgenössische Musik sein, und das kann auch gute Unterhaltungsmusik sein, also es muss nicht nur dieser Bereich E- und U-Musik, also den sehe ich nicht so getrennt.“ (Z.14-19). Aber „wirklich gute Musik“ sieht sie eindeutig in der Klassik: „Ich muss dann schon sagen, für mich wirklich gute Musik, da komme ich dann schon immer wieder auf Bach, Beethoven, Schubert (lacht) und Brahms zurück“ (Z.117-119), die sie als „die ganz Grossen natürlich“ (Z.121) bezeichnet, „aber es gibt auch immer wieder Überraschungen natürlich in der zeitgenössischen Musik. Also Kurtag zum Beispiel“ (Z. 121-122). Gute Musik kennzeichnet sich für DK durch Vielschichtigkeit aus „Also das sind zum Beispiel schon, das sind dann Komponisten, ja, in deren Werk man sehr tief eindringen muss, das sehr vielschichtig ist, ja, wo ich schon, wenn ich das mehrmals spiele, immer wieder Neues entdecke“ (Z. 122-124), von der sie als Geigerin zur sorgfältigen Arbeit herausgefordert ist: „Ich muss es so genau arbeiten und es hat einen Sinn, dass ich so genau arbeiten muss, weil nur genau dadurch wird es wirklich stimmig“ (Z. 125-126). Schlechte Musik ist für DK entsprechend „ oft Musik, die für mich relativ plakativ wirkt, also die relativ einfach strukturiert ist, wo man sozusagen in kürzester Zeit erfasst hat, worum’s geht, und wenn du das dann ein zweites oder drittes Mal spielst, dann findest du nichts mehr weiter“ (Z. 114-117). Als Beispiel nennt sie „überromantische Musik“ (Z. 164) und „Minimal Music“ (Z.166). Eine grosse Abneigung empfindet sie gegenüber Musik, die „nicht atmet. Dieses absolute Mechanische, nicht Atmende. Das empfinde ich als Folter, ja.“ (Z. 173-174). Zum Beispiel Techno: „Mit Techno könnte man mich auf jeden Fall foltern, doch.“ (Z. 169-170). Musik, die nicht atmet, ist für sie aber auch alles, was „gepusht“ ist: „Dass die irgendwie unglaublich natürlichen Zugang haben, die spielen natürlich, das atmet, das ist lebendig, ja, und trotzdem konnten sie sehr gut, ja, was heisst trotzdem, also es ist nicht nur gepusht sozusagen.“ (Z.317-319). Musik aus der „Konserve“ ist für DK sehr nahe an „keine Musik“, weil nicht 14 lebendig: „Also das kann ja nicht nur aus der Konserve kommen, dann stirbt es ja sowieso früher oder später, ja…“ (Z.341-342). 5.1.5 Funktion von Musik Musik hat für DK die Funktion von emotionaler Betätigung und geistiger Auseinandersetzung: „Zugleich ist es für mich eine, nicht nur eine emotionale Betätigung, es ist auch ne geistige Auseinandersetzung“ (Z. 55-56). Das Musikmachen sieht sie als „Expressivität, also die Möglichkeit, sich damit auszudrücken“ (Z.50-51). Musik kann die Funktion einer Alltags-Flucht und einer Herstellung von Transzendenz haben: „Ein Konzerterlebnis zwei Stunden, die mich wirklich von meinem Alltag... die mich die Ewigkeit spüren lassen sozusagen (lächelnd), die mich meinem Alltag entreissen“ (Z. 58-60) und die Funktion von Gemeinschaftsbildung: „Und Musik verbindet natürlich, also das ist ja ganz klar, wenn man Kammermusik macht, wenn man im Orchester spielt, also das sind unglaubliche Gemeinschaftserlebisse auch. Also auch für Kinder und Jugendliche“ (Z. 298-300). Musik funktioniert für DK als eine Art Sprache jenseits von Worten: „Beim gemeinsam Musizieren hoffe ich doch, dass sich sehr viel durch Suggestion und aufeinander hören, also das ist eigentlich das Ziel, finde ich, wenn man sich gut versteht, wenn man Kammermusik macht, dass man nicht das alles besprechen muss und dann entscheidet, eine Lösung findet (lacht), ja, (lacht). Also es wäre wünschenswert, dass ich solche Kammermusikpartner hab, wo das so funktioniert.“ (Z. 96-101). 5.1.6 Orte der Vermittlung Für DK gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Vermittlungssituationen: „Auf jeden Fall beim Unterrichten und beim selbst Konzertieren, beim Miteinander, auch mit anderen Musikern natürlich“ (Z.88-89). Dabei unterscheidet sie zwischen verbaler und nonverbaler Vermittlung: „Also ich finde es schon, wenn ich jetzt mit andern Kammermusik mache, ist es was ganz anderes als beim Unterrichten; beim Unterrichten muss ich’s vielmehr in Worte fassen, je nachdem wie der Student reagiert, möglicherweise reagiert er auch mehr über den Klang, über das Vorspiel, aber meistens ist es ja doch ein Bewusst-Machen“ (Z.93-96). 5.1.7 Umgang mit dem „Anderen“ Als Umgang mit anderer Auffassung kann sich für DK bei der Kammermusik Veränderung einstellen: „Wenn ich mit jemandem spiel, der… irgendwie auch einen andern Zugang zum 15 Instrument hat als ich und ich das so nah erlebe, dann kann das auch sein, dass ich meine Spiel verändere, und dass ich was übernehme, was ich sonst nicht so leicht gefunden hätte. Also das finde ich schon mal sehr interessant, dass man unterschiedlich spielt, je nachdem, mit was für Kammermusikpartnern man spielt“ (Z. 105-109). DK kann andere Musik als ihre eigene durchaus schätzen, solange sie nahe an ihrer eigenen Musikauffassung liegt: „Bei Cesaria Evora war es jetzt einfach diese... diese Melancholie in ihrer Stimme, und… Das ist nur das rein Rhetorische“ (Z. 367-368). Es gibt aber eine Art, mit Musik umzugehen, die DK ablehnt: „Und so eine Art, diese Art von Musikmachen brauchen wir nicht. Also ich möchte so weder jemanden meine Kinder unterrichten lassen, noch möchte ich’s mir im Konzert anhören. Also ich finde auch in einem Orchester hat das eigentlich keinen Platz.“ (Z. 273-276). Es handelt sich dabei vor allem um eine besondere Spielweise: „Ich hab keinen Zugang, keinen persönlichen Zugang gespürt zu ihrem Klang, zu ihrem Tun, zu ihrem Instrument eigentlich. Und mit so einer Art, Musik zu machen, habe ich schon grosse Probleme, also das will ich eigentlich gar nicht unterstützen, also da bin ich eigentlich eher dafür, lieber was anderes zu tun“ (Z.259-263), die sie als Gegensatz zu ihrer persönlichen Musikauffassung empfindet: „Es ist mir schon passiert, also insofern mit eh Fällen (lacht), die sehr oft auch aus einer anderen Kultur kamen, andere Kulturkreis, die von klein an auf diesem Weg, also im Gegensatz zu mir, die ich das von zuhause, also das war meine Entscheidung, nicht so in diesen Weg rein gepresst wurde sozusagen, aber die von klein an aufgrund ihrer Begabung jetzt in dem Bereich in diesen Weg geschickt wurden, ohne eigentlich zu fragen, auch später, ob sie’s eigentlich wollen, und ob sie’s wirklich lieben. Also das ist für mich wirklich der ausschlaggebende Punkt“ (Z. 248-253). Es fehlt ihr „die Lebendigkeit und die Ausdruckskraft meistens“ (Z. 273) und „dass dann, denen dann möglicherweise eine gewisse Expressivität, ne Liebe dazu fehlt, also ich komme immer wieder auf dieses Wort“ (Z. 253-255). Im Umgang mit dem Anderen steht DK vor einem Dilemma: „ Also erstmal ist natürlich dieser Perfektionsgrad, den wir jetzt heutzutage erreicht haben, ehm, in gewisser Weise auch hinderlich für eine persönliche Lebendigkeit, und damit kämpf ich auch, also das finde ich sogar den grössten Kampf, weil ich, auch durch das Unterrichten und so, von mir, an mich diesen Anspruch auch habe eines möglichst hohen Grades an Perfektion, der mich dann wiederum aber fast blockiert, frei zu sei im Ausdruck, und… ja, wirklich frei umzugehen mit dem Material sozusagen“ (Z. 345-351). 16 5.1.8 Handwerk und Ansätze DK glaubt nicht an leichte Vermittlung da, wo jemand zu einer Musik kein Verständnis hat: „Man kann nicht erwarten, dass jemand, der zu Schubert gar keinen Zugang hat, dass ich dem das Verständnis für Schubert einfach vermitteln kann. Also dann geht’s auch drum, Schubert Lieder zu hören, oder selber zu spielen vielleicht auf der Geige, oder mal bisschen auf Klavier, oder… Das ist schon ein längerer Prozess“ (Z. 241-244). DK möchte Musikmachen als eine Form der Kommunikation verstanden wissen: „Dass mehr musiziert wird, dass mehr gesungen wird, dass es eine lebendige Art von Musikmachen ist, dass es eine Art der Kommunikation ist, dass es eine Musik ist, die spricht, mit der man kommuniziert“ (Z. 321- 323). Eine Lösung für diesen Anspruch sieht sie nicht, sie empfindet eher gegenseitige Fremdheit: „Also das vermiss ich auch hier oft, oft eigentlich, Kinder die machen schon Musik, aber trotzdem wenn man dann im Unterricht oder so versucht, spiel eine Geste, spiel ein Motiv so, dass ich es wie in einem Dialog, so dass ich eine Geste von dir bekomme, dann ist es ihnen immer ganz fremd, das, das find ich manchmal irritierend, also das würde ich mir wünschen, dass das viel näher ist an unserer Kommunikation einfach, Musik machen“ (Z.323-328). Ihre Aufgabe als Interpretin sieht DK darin, Leuten eine Sternstunde zu ermöglichen: “Man kann Leuten ja, so eine Sternstunde vermitteln für ein zwei Stunden, und wenn es davon nur fünf Minuten sind“ (Z. 297-298). Als Interpretin ist sie dafür auf der ständigen Suche nach einer Balance zwischen persönlichem Ausdruck und Stilsicherheit: „Und das ist eben unsere Aufgabe, auch unsere Aufgabe als Interpreten natürlich, schon in dem Stil, das betrachte ich dann als geschmackvoll, aber das ist natürlich wieder persönlich, Geschmack... ehm… ja, also, wenn man das zu sehr alles seine eigene Art, allem seine eigene Art zu sehr aufstülpt, so sehr ich persönliches Spiel lieb, aber es gibt ne Grenze dafür natürlich. Schwierig (lacht).“ (Z. 286-290). 5.1.9 Motivation DK sieht das Vermitteln als Interpretin als ihren wichtigsten Antrieb: „Als Interpretin ist das ja ein besonderer Fall… also dass ich den Werken durch meine persönliche Inspiration irgendwie, dass ich die an eine Zuhörerschaft bringe. Und das ist etwas, das mich absolut beglückt; und deswegen mache ich Musik, denke ich, das ist der wichtigste Antrieb“ (Z. 52-55). In der pädagogischen Vermittlung motiviert sie die geistige Auseinandersetzung: „Es ist auch, und das ist für mich auch wichtig in der Bildung, also in der Pädagogik auch… (entschieden) es ist auch 17 eine geistige Auseinandersetzung“ (Z.60-62), die sie sogar erst durch das Unterrichten kennengelernt hat: „Also ich war sehr intuitiv lange Zeit, bis ich angefangen hab zu unterrichten“ (Z. 82). 5.2 Fall „Dozent Jazz“ (DJ) 5.2.1 Prägung und Verlauf der Musikauffassung DJ ist in einer Familie aufgewachsen, in der vor allem Klassik präsent war: „Meine Eltern, die sind mit klassischer Musik gross geworden, und bei uns stand ein Plattenspieler und so alte Bandgeräte, und ich bin hauptsächlich, ehm ich hab alle Klassik mitgepfiffen, mitgespielt, mitgesungen, von Mozart, Beethoven, Bach, Opern, alles, eigentlich alles. Ich habe das alles gehört und auch alles durchgehört, ich hatte keine Berührungsängste, ich mochte das und mag es immer noch“ (Z. 27-31). Die Musik, von der DJ während seiner Kindheit geprägt wurde, empfindet er als nicht seiner Musikauffassung entsprechend: „Ich bin als Kind erzogen worden, musikalisch, oder mit Musik konfrontiert worden, die nicht gestaltbar war oder eigentlich mein grösster Wunsch war, die Musik selbst gestalten zu können.“(Z. 13-15). DJ kann bei Klassik nur sehr eingeschränkt selber bestimmen: „Das heisst, ich kann meine eigene Emotionalität oder meine Ästhetik, bestimmen, was ich bei klassischer Musik nur sehr bedingt kann“ (Z. 22-24). Zur Klassik kam er erst sehr viel später wieder zurück: „(..) merk ich, dass ich auch wieder zur Klassik zurückfinde, aber auf ne Art, auf ne andere Art.“ (Z. 18-19). Einer anderen Art von Musik begegnete DJ erst später, ausserhalb der elterlichen Umfelds: „Das hat mir erst improvisierte Musik eröffnet, und der Begriff Jazz, der war mir damals, eh, vielleicht fremd, oder unfassbar, und Pop auch, und so hab ich den Einstieg so über BoogieWoogie Blues gefunden“ (Z. 15-17). Er merkt später, „dass die Leute, die Jazz improvisieren, dass die aus dem Moment raus Musik machen, und dass mir, ehm, dass mich diese Freiheit sehr anspricht, dieser freiheitliche Gedanke, ich kann im Moment, aus dem Moment raus was gestalten“ (34-36). Mit der Zeit findet DJ dann zu seiner eigenen Musiksprache, dadurch, „dass ich gemerkt habe, welche Gestaltungsräume mir zur Verfügung stehen und wie ich die nutzen kann und damit ne eigene persönliche Musiksprache zu finden. Aber ansonsten, das Bewusstsein um den Gestaltungsfreiraum, da, ehm, das hat sich nicht verändert“ (Z. 40-43). 18 Prägende Einflüsse erlebt DJ ab dann nur noch als temporäre Auseinandersetzung mit der Musiksprache einer anderen Musikerpersönlichkeit: „Also das Reproduzieren von Interpreten oder Spielauffassung, das hab ich während dem Studium viel gemacht, weil ich rauskriegen wollte, wie jemand, in welchen Strukturen jemand denkt und fühlt.“ (Z.60-62), von denen er sich inspirieren lässt und sich dann wieder löst: „Wie wenn du bei deiner Muttersprache jemanden imitierst, du imitierst den Dialekt, den Tonfall, die Sprachmelodie und alles mögliche und einen Teil davon übernimmst du und von andern Dingen löst du dich wieder.“ (Z. 64-66). 5.2.2 Genre-Zugehörigkeit DJ versteht sich als dem Jazz zugehörig: „Die Jazz-Auffassung, die ich so als Musik, mit der ich als Musiker meistens zu tun habe, die ist in fast allen Bereichen gestaltbar. Das heisst, ich kann meine eigene Emotionalität oder meine Ästhetik bestimmen“ (Z. 21-23), wenn er auch anderen Genres, wie beispielsweise der Klassik gegenüber offen ist: „Ich hatte keine Berührungsängste, ich mochte das und mag es immer noch.“ (Z. 30-31). Er kennt auch die Vorurteile seinem Musikgenre gegenüber: „Ich erleb es oft, dass Leute vorgefasste Meinungen über bestimmte Musikrichtungen haben, das sind so Klischees, die kursieren, eh, wo man eben sagt, ja, Jazz ist so kopflastig und lick- und patternorientiert und steckt fest in seiner Entwicklung.“ (Z. 168 -170). 5.2.3 Definition von „Musik“ Eine mögliche Definition von Musik liegt für DJ darin, Musik als von Menschen geordnete Klangereignisse fest zu legen: „Das ist vielleicht eine andere Definition davon, also indem du Klangereignisse in eine gewisse Ordnung bringst.“ (Z. 142-144). Wichtig ist ihm vor allem die Definition von Musik als gestaltbares Medium („Ich verstehe unter Musik gestaltbares Medium“, Z. 13) und als Sprache: „Also, dass es ne Sprache ist, ist glaub ich unumstritten. Es ist nur ne Sprache, die eben anders verstanden wird, und sie ist nicht ne Sprache, die Handlungen so direkt auslösen kann, so wie es Sprache kann. Aber indirekt vielleicht schon.“ (Z.242-244). Zudem ist Musik für DJ „immer dann, wenn sie neu entsteht“ (Z.107) auch ein Spiegel von Veränderungen in der Gesellschaft:„Du kannst an Musik ablesen, was sich grade abspielt in der Gesellschaft.“ (Z. 209). 5.2.4 Bewertung von Musik 19 DJ unterscheidet grundsätzlich zwischen Musik, die ihn berührt, solcher, die ihn beeindruckt und solcher, die gut gemacht ist: „Also erstens mal muss sie handwerklich gute gemacht sein, sie muss gut gespielt sein, gut interpretiert sein und es muss mich berühren, das geht mir immer wieder so, wenn mich Musik nicht berührt, dann kann sie mich höchstens beeindrucken.“ (Z. 7476). Gut gemachte Musik will er grundsätzlich nicht gewertet haben: „ Ich find, dass jede Musik, wenn sie gut gemacht ist, ihre Berechtigung hat, dass keiner das Recht hat, das zu beurteilen, ob das jetzt gute oder schlechte Musik ist, ehm das kommt immer auf den Standpunkt an.“ (Z. 151 153). Auch beeindruckende Musik lässt er grundsätzlich wertfrei stehen, auch wenn er nur Musik als wirklich „gut“ empfindet, die ihn berührt: „Das Beeindrucken ist schon auch ein wichtiger Teil für mich, dass man virtuos spielt, oder mit seinem Instrument gut umgehen kann, aber schlussendlich ist für mich Musik, was Dich im Inneren bewegt und berührt, und deswegen ist das für mich gute Musik, was dich berührt.“ (Z. 78 -80). „Schlechte“ Musik ist für DJ „eine Musik, die mir nicht gut tut, die mich negativ berührt, ja, das ist eigentlich schon die Antwort darauf, schlechte Musik ist für mich Musik, die mich stört, die mich nicht weiterbringt, eh, die nichts in mir bewegt, die mich aggressiv macht, die mich unruhig macht“ (Z.88-90) und ganz besonders grenzt er sich ab gegenüber „Musik, die mich steuert. Zum Beispiel Musik, von der ich das Gefühl hab, sie ist ehm, sie hat so einen starken funktionalen Charakter, dass sie schon zu stark Einfluss auf mich nimmt und das möchte ich nicht.“ (Z. 90-93). Als Beispiel nennt er Meditationsmusik, wobei er als Ausnahme Meditationsmusik gelten lässt, die gut gemacht ist: „Wobei es gibt Meditations, von Brian Eno zum Beispiel diese Ambient Music oder Music for Airports, (…), die ist sehr clever gemacht, weil sie, der Kopf, der dort dahinter steckt, weiss genau, was er mit dieser Musik will. Und das ist deswegen keine billige Musik.“ (Z. 98-101). Schlechte Musik ist für DJ auch Musik, die nur gefallen will, „oberflächliche Popmusik zum Beispiel, wie von Leuten, die, wie Dieter Bohlen oder sowas, das find ich unerträglich.“ (Z. 103-104), wobei ihn hier nicht die Funktionalität stört, sondern „mich stört, dass sich die Musik so anbiedert dem Geschmack, mit allen Mitteln. Weil sie keine Eigenständigkeit hat, sie hat keinen Mut zur Widersprüchlichkeit, sie hat keinen innovativen Charakter.“ (Z. 106 -109). Für DJ beginnt Musik dort, „wo Menschen das in eine gewisse Ordnung oder Unordnung bringen.“ (Z. 141 -143), und „aufhören würde sie wahrscheinlich… dort in dem Szenario, das Kubrick im 2001 zeichnet, in dieser letzten Reise, so diese, so dieses Zusammenschmelzen von 20 Klängen, wo du nicht mehr identifizieren kannst, wo das jetzt herkommt und wer das spielt und wie das erzeugt wird, so dieser abstrakte Klang.“ (Z. 119- 122). Grundsätzlich betrachtet er Musik als etwas unabhängig von ihm selbst Existierendes: „Also ich denk, die Musik hört gar nicht auf, wenn ich sie nicht mehr höre, dann hört sie jemand anders, irgendwo, und ehm, das will ich jetzt gar nicht von mir jetzt abhängig machen, ich finde, das ist ein unendliches Phänomen.“ (Z. 129 -132). 5.2.5 Funktion von Musik Für DJ hat die Musik in erster Linie die Funktion einer Sprache: „Zum Beispiel löst man sich von seinem Mutterdialekt, vielleicht wenn man in eine anderes Land zieht, oder kriegt ne andere Sprachprägung, zum Beispiel du siehst viele Leute, die nach Amerika gehen und dort lange leben, die haben plötzlich, ehm, ja, ne andere Sprache, nen anderen Akzent. Und das Reproduzieren, Imitieren, ehm, ist für mich ein wichtiger Vorgang, um den Menschen dort dahinter kennen zu lernen.“ (Z. 66-71). Deshalb ist es für ihn wichtig, „dass ich hoffentlich eine eigene persönliche Musiksprache gefunden habe“ (Z.50-51), da er sich über Musik als Person erkennbar machen können will: „Und eigentlich war es eines meiner Ziele, dass ich als Musiker erkennbar werde. Also dass ich für andere klanglich, ja, identifizierbar werde.“ (Z.51- 53). Musik ist für DJ also eine Form von Sprechen: „Das sind Figuren, das sind Klänge, das sind Akkordstrukturen, Melodiestruktur, formale, kompositorische Strukturen, die aus meinem Inneren sprechen“ (Z.55-56). Ebenso wie die Wort-Sprache hat die Musik für DJ auch die Funktion der Kommunikation: „Wir bleiben in dem Genre Jazz, dann ist es ne dialogische Sprache, auf jeden Fall. Also ich kann mit jemand kommunizieren, das kann Musik leisten, nur einfach auf ner anderen Ebene“ (Z.245 -247). 5.2.6 Orte der Vermittlung Ausserhalb seiner pädagogischen Tätigkeit sieht DJ vor allem eine Einwirkung seiner Musikauffassung innerhalb der eigenen Familie: „Also wenn du jetzt, sagen wir mal den nicht pädagogischen Raum ansprichst, dann ist es zuhause in der Familie, hab ich meine Kinder mit der Musikauffassung geprägt, ganz stark“ (Z. 46 -48). Zudem sieht er einen Einfluss auf andere in seinem musikalisch-künstlerischen Berufsfeld, einerseits bei Konzerten: „Wenn ich auf Konzerten spiele, dann macht sich das auch bemerkbar, dass ich damit meine eigene Sprache spreche“ (Z. 48-49), andererseits nennt er in dem Zusammenhang auch seine Aufnahmen: „Das 21 dritte wären meine Aufnahmen, die ich gemacht hab. Also auf allen CDs merkst du, dass ich hoffentlich eine eigene persönliche Musiksprache gefunden habe“ (Z. 49-51). 5.2.7 Umgang mit dem „Anderen“ DJ ist sich bewusst, dass Vorurteile und Geringschätzung einer bestimmten Musik gegenüber entstehen mangels intensiver Auseinandersetzung mit der Materie: „Das gibt’s immer wieder, aber viel davon beruht auf Ignoranz, wenn man eine Musik nicht kennt und sie vorher aburteilt, und ich nicht weiss, wie die Mechanismen dieser Musik funktionieren“ (Z. 149 -150). DJ beobachtet die Hierarchisierung von Musik am Beispiel von anderen: „Nehmen wir zum Beispiel ein Klischee, was sehr stark kursiert, die Abneigung von klassischen Musikern gegenüber Popmusik, weil sie sagen, das ist keine ernst zu nehmende Musik, das entsteht meistens daraus, weil sie mit der Musik selbst sich noch nicht intensiv beschäftigt haben, mit den Produktionsmethoden, mit den Ideen, mit den Visionen, die dort dahinter stecken, deswegen wird die Musik klassifiziert, wenn du so willst, und dann meistens runter klassifiziert, weil man das Gefühl hat, die eigene Musik, die man macht, ist besser.“ (173-179). An sich selbst stellt er keine Vorurteile gegenüber anderen Musiken fest: „Ich hab diese Urteile nicht, also ich beweg mich halt relativ urteilsfrei.“ (Z. 190 -191). Wenn er eine Musik ablehnt, wie beispielsweise Meditationsmusik, dann hat es mit einem analytischen Hörverhalten zu tun: „Meditationsmusik ist so kalkulierte Musik, die mit ganz geplanten Methoden und Mitteln arbeitet. Die kenn ich alle, ich kenn die Sounds, ich kenn, ich hör diese Musik analytisch und ich weiss, wozu sie gemacht wird und ich find das schrecklich.“ (Z. 95-97). 5.2.8 Handwerk und Ansätze Für DJ besteht als wichtigster Ansatz, Musik zu vermitteln, darin, Musik unter Beibehaltung der Emotion partiell erfassen zu lernen: „Dann versuch ich bei der Vermittlung von Musik drauf zu achten, dass jemand verschiedene Ebenen erfassen kann, dass er beim analytischen Hören nicht seine Emotionen raus lässt, das geht gar nicht, du hörst Musik immer subjektiv, aber dass man versucht, Musik zu verstehen, auf verschiedenen Ebenen, das sind klangliche Ebenen, das sind rhythmische strukturelle Ebenen, harmonische Ebenen, Produktionstechnik, etc.“ (Z. 201-206). Beispielsweise lehrt er, Musik gefiltert zu hören: „ Ich finde die Musikstudenten sollten lernen, dass sie gefiltert hören können, dass sie gewisse Sachen ausblenden können und sagen können, ich hör jetzt mal nur auf den Klang, auf die Mischung, ich hör mal nur auf die Räumlichkeit, oder 22 ich höre nur auf die dynamische Gestaltung, und so weiter.“ (Z. 215-218). Denn erst ein geschultes Ohr kann Musik auch bewerten: „Du kannst nicht ein Musikstück hören und wenn du kein geschultes Gehör hast, alle Faktoren gleichzeitig erfassen und bewerten, das geht gar nicht.“ (Z. 231- 232). Dafür muss man sich aber zuerst die Zeit nehmen, um Musik anzuhören: „Es liegt an der Haltung der Leute selbst, die sich sehr stark verändert hat, weil man sich nicht mehr die Zeit nimmt, Musik sehr oft und sehr lange zu hören, also die meisten glauben, wenn sie ein Stück zwei- oder dreimal gehört haben, dass sie das dann erfasst hätten.“ (Z. 222- 224). Ein weiterer zentraler Ansatz ist für DJ das Handwerk des Analysierens und Imitierens: „Es ist viel missionarische Arbeit dort zu leisten und viel Aufklärungsarbeit, denk ich, indem man versucht, klassische Musik mit Popmusik zu konfrontieren und das analysieren zu lassen, nachmachen zu lassen, um zu zeigen, wie schwierig es ist, gute Popmusik oder Jazz zu machen.“ (Z. 183-186). Seine eigenen Präferenzen versucht DJ bei der Vermittlung möglichst raus zu halten: „Also erstens mal versuche ich meine Vorlieben, meine persönlichen Vorlieben raus zu lassen, aus der Vermittlung, und ich finde, es hat dort keinen Platz. Ich kann irgendwann schon mal sagen, welche Musik mir besonders gut gefällt, aber dass ich das dauernd zum Thema mache, das find ich völlig falsch.“ (Z. 198-201). DJ legt grossen Wert auf die Vermittlung des gesellschaftlichen Kontextes einer Musik: „Ich versuch auch zu vermitteln, dass Musik immer dann, wenn sie neu entsteht, das ist immer ein Ausdruck von gesellschaftlichen Veränderungen, oder wie ein Spiegel von gesellschaftlichen Veränderungen. Du kannst an Musik ablesen, was sich grade abspielt in der Gesellschaft. Und ich versuch beim Vermitteln von Musik eben diese Zusammenhänge klar zu machen, wie sich die Technik entwickelt, wie sich unsere Umwelt entwickelt, und die Haltung der Leute auch sich dadurch zeigt.“ (Z. 206-212). 6 Versuch einer Analyse drei verschiedener Musikauffassungen Um gewisse Begriffe für die Beschreibung von Faktoren für eine Musikauffassung zu generieren, versuchte ich mithilfe einer von Andreas C. Lehmann übernommenen Skala zum Hörverhalten, 23 eine kleine Analyse von drei unterschiedlichen Musikauffassungen zu machen. Diese Analyse bildet die Grundlage für die spätere Betrachtung des Musikvermittlungs-Handwerks. 6.1 Hörverhaltenskonsistenz nach Lehmann Bevor ich zum Versuch einer Analyse der Musikauffassung meiner beiden Fälle komme, möchte ich in einem kleinen Selbstversuch aufzeigen, wie eine Faktorenbildung und -definition für eine Musikauffassung aussehen könnte. Ich beziehe mich dafür auf die Theorie der Hörverhaltenskonsistenz von Andreas C. Lehmann (LEHMANN 1993). In seiner Studie zur habituellen und situativen Rezeptionsweise beim Musikhören stellt er die These auf, dass Hörer versuchen, Musik immer wieder gleich zu erleben und habituelle Rezeptionsmuster sich dementsprechend als überdauernde Verhaltensmerkmale ansehen lassen, „die in einer konkreten Hörsituation modifiziert werden können, wobei eine Tendenz des Hörens zu seinem gewohnheitsmässigen Verhalten besteht. Mit dem Ziel, Musik immer wieder gleich erleben zu können, versucht der Hörer, sie in ähnlicher Weise zu rezipieren. Erleben und Präferenz sind untrennbar miteinander verbunden, da man in der Präferenzentscheidung nicht nur eine Bewertung des klingenden Objektes sondern auch eine Evaluation des Hörprozesses selbst sehen kann.“ (S. 89). Bei Lehmann geht es zwar anders als bei meinem Thema um Musikpräferenz (und eine Musikauffassung unterscheidet sich insofern wesentlich von einer Musikpräferenz, als sie nicht, wie ich weiter unten ausführen werde, an einen bestimmten Musikstil gebunden ist), aber ich wage trotzdem den Versuch, seine These auf die Musikauffassung zu übertragen, da gerade die von mir untersuchten Fälle deutliche Hinweise auf diese Interpretationsmöglichkeit aufzeigen. Als Beispiel dafür hier ein Zitat von DK auf die Frage, ob sich ihre Musikauffassung im Verlaufe des Lebens geändert habe: „Es war im Prinzip schon immer da, aber es hat sich klarer definiert insofern, dass ich jetzt, also früher war es einfach eine grosse Begeisterung für fast alle Komponisten, zumindest für alle grösseren ja, als Jugendliche so, diese Entdeckung, diese Welt und diese Werke. Jetzt ist mir klarer, was mir liegt, wo ich mich wirklich vertraut fühle, es gibt auch Komponisten, die ich jetzt besser verstehe als früher, deren Grösse ich erst 24 später erkannt habe, beziehungsweise die ich über die Jahre und Jahrzehnte neu wieder erkannt habe. Und im Prinzip ist die Inspiration, diese Begeisterung, diese Liebe zur Musik schon gleich geblieben, also das, wie ich schon vorhin sagte, das trägt mich so durch die ganzen Schwierigkeiten des Musikerdaseins auch.“ (Z. 70-77). Auch DJ weist klar darauf hin, dass seine Musikauffassung, für die Gestaltungsfreiraum und Selbstbestimmung charakteristisch ist, schon immer da war: „(…) dass ich gemerkt habe, welche Gestaltungsräume mir zur Verfügung stehen und wie ich die nutzen kann und damit ne eigene persönliche Musiksprache zu finden. Aber ansonsten, das Bewusstsein um den Gestaltungsfreiraum, da, ehm, das hat sich nicht verändert.“ (Z. 40-43). Lehmanns Theorie der Hörverhaltenskonsistenz würde also für die Musikauffassung bedeuten, dass unsere musikalische Identitätskarte sich im Verlaufe des Lebens im Kern nicht wesentlich ändert. Es kann zwar sein, dass sich das Spektrum an rezipierter Musik mit den Jahren je nach Person wesentlich erweitert (was beispielsweise auf den Fall DJ zutrifft, der in seiner Musikauffassung konsistent bleibt, aber stilistisch von Klassik zu Jazz und später zu Pop wechselt ), dass aber in der Musik gewohnheitsmässig immer nach dem gleichen Prinzip, nach der gleichen Funktion gesucht wird. 6.2 Dimensionen des Musik-Erlebens (nach Lehmann) In Erweiterung der Hörertypologie von Klaus-Ernst Behne (BEHNE 1990) erstellte Lehmann für seine Studie eine Skala von 15 verschiedenen habituellen und situativen Rezeptionsweisen beim Musikhören. Ich bin nicht mit allen Begriffen gleich glücklich, da mir einige wertend erscheinen (beispielsweise „Regression“ und „Sentimentaliät“), und mir einige fehlen (beispielsweise ein Begriff für die wichtige Funktion der Synchronisierung oder Gemeinschaftsbildung), übernehme sie aber konsequenterweise genau so, wie von Lehmann verwendet. Ein für die spätere Vermittlungsfrage wichtiges Detail: Die Begriffe sind in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für das Musik-Erleben der Befragten (Nicht-Musiker) der Lehmannschen Studie aufgelistet (vgl. Lehmann, S. 81): „Sensualismus“ (Hören auf Klangsinnliches) „Ausdruck“ (musikalischer Ausdruck) 25 „Emotion/Laune“ (Stimmungsverbesserung) „Motorischer Mitvollzug“ (Mitsingen, -klopfen, -bewegen) „Zeitempfinden“ (Raffung/Dehnung der erlebten Zeit) „Ruhe/Entspannung“ (Beruhigung und Entspannung) „Sentimentalität“ (Denken an Vergangenes) „Aufführungsaspekte“ (musikalische Effekte, Aufmerksamkeit) „Kompensation/Eskapismus“ (Abkehr von der Realität) „Background“ (diffuses Hören) „Aktivation“ (vegetatives Hören) „Coping“ (Lebensbewältigung) „Struktur“ (kognitives, strukturierendes Hören) „Identifikation“ (Identifikation mit Musikern oder Gleichgesinnten) „Regression“ (Geborgenheitsgefühle) Mit diesen 15 Begriffen operiere ich nun, um im Sinne einer oben beschriebenen Strategie der Selbst-Involviertheit zuerst mich selbst und dann meine zwei Fälle zu analysieren. Die Lehmannschen Begriffe verwende ich sowohl für Zuschreibungen als auch für Abgrenzungen gegenüber einem Gegenstand, den ich „die individuelle Musikauffassung“ nenne (also alles, was die betreffende Person unter „Musik“ versteht, was letztere für sie bedeutet, welche Funktion sie ihr zuschreibt, etc.). Aufgrund der Zuschreibungen lassen sich hypothetische Schnittmengen zu bestimmten Musikstilen oder anderen Musikauffassungen, aufgrund der Abgrenzungen lassen sich hypothetische Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Musikauffassungen und in Vermittlungsprozessen benennen. 6.3 Analyse der Musikauffassung von BBW: „Flucht“ Für BBW hat Musik als wichtigstes Element die Funktion und Bedeutung von „Zufluchtsort“ (Lehmann: Eskapismus). Das hat biographische Gründe in der Jugend und in der Persönlichkeitsstruktur (Neigung zum Träumen und Drang nach Abenteuer und Erforschung). Die Rezeption und Ausübung bestimmter Musik verhilft also BBW zu einer Art (Über)lebensraum, der den Problemen des Alltages übergeordnet ist (Lehmann: Coping). Um das 26 zu gewährleisten, muss für BBW eine Musik gewissen zentralen Anforderungen entsprechen: eine Musik muss so gemacht sein, dass BBWs Aufmerksamkeit genügend in Anspruch genommen wird, ohne sie aber emotional zu überwältigen (Lehmann: Abgrenzung zu „Sentimentalität“). Dafür sind bei BBW viele Formen von möglichst radikaler Musik geeignet, also zb extrem reduzierte Musik, extrem komplizierte Musik oder extrem ungewohnte oder noch nie gehörte Musik. Die geeignete Musik kann dabei auch nur über gewisse für BBW ungewohnte Elemente verfügen, beispielsweise in der Struktur, der Rhythmik oder der Harmonik (Lehmann: Struktur), der Botschaft (Lehmann: Ausdruck) oder der Inszenierung (Lehmann: Aufführungsaspekte). Ungeeignet als Zufluchtsort ist für BBW Musik, die ihr in durchwegs allen Elementen absehbar erscheint (Lehmann: Abgrenzung zu Regression, Aktivation, Background, Entspannung) und dadurch ihre Aufmerksamkeit nicht genügend zu fesseln vermag. Für eine Musikvermittlungs-Tätigkeit relevant könnten folgende Deutungen dieser kleinen Analyse sein: Zusammenhang mit dem gewählten Musikgenre: Da der musikalische Zufluchtsort auf keinen Fall langweilen darf, um seinen Zweck zu erfüllen, muss er BBWs Bedürfnis nach Entdeckung und Experimentieren entsprechen- der Zufluchtsort muss also immer den Charakter einer zum ersten Mal geöffneten Türe aufweisen. So lässt sich erklären, warum BBW am meisten musikalische Nahrung in der Neuen Musik findet, da es dort immer neuen Nachschub an noch Un-Gehörtem und es noch viele quasi ungelöste Hör-Rätsel zu finden gibt. Hypothetische Schnittstellen zu anderen Musikgenres und Musikauffassungen: Zugänge zu anderen Musikauffassungen und Musikstilen könnten sich über die Präferenz für Eskapismus, Struktur, Coping, Ausdruck und Aufführungsaspekte herstellen. Hypothetisch könnte aber darunter auch alles fallen, das möglichst radikal auf einen einzelnen Typus der Lehmannschen Skala ausgerichtet ist. Beispiel: BBW kann sich für den von ihrem 13-jährigen Sohn konsumierten Dubquest begeistern, auch wenn die von ihr präferierten Aspekte der Lehmannschen Skala nicht vorkommen (hingegen Aktivation und Sensualismus in radikaler Form). Hypothetische Schwierigkeiten mit anderen Musikauffassungen: Probleme können sich bei der Kombination mit Musikauffassungen ergeben, wenn in Kombination von Ausdruck 27 Regression, Background, Entspannung oder Sentimentalität dominieren. Beispiel: deutsche Schunkel-Schlager. 6.4 Analyse der Musikauffassung von Fall DK: „Rhetorik“ Für DK bedeutet Musik vor allem „Beziehungskunst“ (Lehmann: Identifikation): über die Musik stellt DK Verbindung her zu einerseits den „grossen“ Komponisten der Klassik, deren Geist sie durch intensive Auseinandersetzung mit dem Instrument zu erfassen und wiederzugeben versucht, und andererseits stellt sie über die Musik eine Verbindung zu Mitmusikerinnen und musikern oder zum Publikum her, was sie als wichtigste Motivation für ihr eigenes Konzertieren angibt. Für DK geht es hat also bei Musik in allererster Linie um die Funktion von „Sprache“ (Lehmann: Ausdruck) und dementsprechend wichtig sind ihr Rhetorik, Atmen, Sprechen und Gesang, was sie insgesamt Ausdruck von als „Lebendigkeit“ und „Liebe“ empfindet. Das Bedürfnis nach grösstmöglicher Differenziertheit in der Rhetorik wird von einer bestimmten Musik durch die Kombination von „Expressivität“ (Lehmann: Ausdruck) und „Vielschichtigkeit“ (Lehmann: Struktur) geleistet. Nebst der „Kommunikation“ hat die Musik für sie eine zusätzlich sehr wichtige Rolle, wenn es darum geht, sie oder ihr Publikum dem „Alltag zu entreissen“ (Lehmann: Eskapismus) oder die „Ewigkeit spüren“ zu lassen (Lehmann: Zeitempfinden). Musik, die den Anforderungen von Atmen und Rhetorik nicht entspricht, empfindet sie als mechanisch und „tot“ (Lehmann: Abgrenzung zu Aktivation und Background). Das gleiche gilt für Musik, die aus anderen Gründen als aus dem Bedürfnis nach Kommunikation gemacht wird (Lehmann: Abgrenzung zu Regression, Aufführungsaspekte, Sentimentalität). Zusammenhang mit dem gewählten Musikgenre: Musik verstanden als singende, atmende Rhetorik findet DK als Geigerin am treffendsten in der Wiener Klassik repräsentiert. Ihre Vorliebe für differenzierte motivisch-thematische Arbeit lässt sich in dieser Musik zwischen Haydn und Schubert besonders gut ausleben. Hypothetische Schnittstellen zu anderen Musikgenres und Musikauffassungen: da für DK nach Lehmannscher Terminologie Ausdruck und Struktur zwingend vorhanden sein müssen, kommen hier ausserhalb ihrer präferierten Musik vor allem Formen von differenziert strukturiertem Gesang in Frage. Beispiel: DK selbst nennt Renaissance-Musik, Kurtag und Cesaria Evora. 28 Hypothetische Schwierigkeiten mit anderen Musikauffassungen: Da die Möglichkeiten einer Musikfunktion bei DK durch das Bedürfnis nach Kommunikation dominiert sind, ist sie relativ eingeschränkt, auf andere Musikauffassungen einzusteigen, sobald der Faktor „Ausdruck“ (Sprache) nicht gegeben ist (beispielsweise Motorischer Mitvollzug, Sensualismus, Ruhe/Entspannung, Coping, etc.). Beispiel: DK selbst erzählt von ihrem grossen Unverständnis, wenn beispielsweise Kinder oder Studierende nicht auf einen musikalischen Dialog einsteigen können. 6.5 Analyse der Musikauffassung von Fall DJ: „Selbstbestimmung“ Das grosses Thema für DJ ist die Selbstbestimmung- und die Musik ist der Ort, an dem er nach Belieben selbst das Steuer in der Hand hat. Für DJ ist Musik „gestaltbares Medium“, mithilfe dessen er sich „als Mensch erkennbar machen kann“. Das heisst, in erster Linie hat Musik für ihn die Funktion von Sprache (Lehmann: Ausdruck), mit der er „seine eigene Emotionalität oder eigene Ästhetik“ ausdrücken und bestimmen kann (Lehmann: Emotion), aber auch in Dialog mit anderen Musikern treten kann. Die Freiheit, aus dem Moment heraus etwas zu gestalten, ist für DJ zentral und dementsprechend hat Musik für ihn sehr viel mit Ordnen und Bauen zu tun, da er mit „Akkordstrukturen, Melodiestruktur, formalen, kompositorische Strukturen“, die aus seinem Inneren sprechen, beschäftigt ist (Lehmann: Struktur). Musik hat aber für DJ auch eine ganz wichtige Funktion als Spiegel von gesellschaftlichen Prozessen und als Spiegel eines anderen Denkens, in das sich DJ nach Belieben hineinbegeben kann (Lehmann: Identifikation). Vor gut gemachter oder virtuos gespielte Musik hat er grossen Respekt (Aufführungsaspekte), auch wenn sie ihn nicht berührt (Lehmann: Ausdruck/Emotion). Hingegen grenzt er sich ausdrücklich ab gegenüber Musik, die „nur gefallen will“ (Lehmann: Abgrenzung zu Sensualismus) oder die ihn „steuern will“ (Lehmann: Abgrenzung zu Background und Aktivation) . Zusammenhang mit dem gewählten Musikgenre: Weil im Jazz viel mehr Raum für Improvisation und Komposition ist als in der Klassik, und weil dort die Musik, „in fast allen Bereichen gestaltbar ist“ und er seine eigene Emotionalität oder seine Ästhetik selbst „bestimmen“ kann, hat sich DJ von seinem klassisch geprägten Elternhaus sehr bald dem Jazz zugewandt und sieht sich ganz klar dort zugehörig. 29 Hypothetische Schnittstellen zu anderen Musikgenres und Musikauffassungen: Grundsätzlich kommt für DJ sicher alles, was mit Struktur zu tun hat, in Frage. Noch besser ist die Ausgangslage für einen Zugang, wenn es sich um die Kombination von Struktur und Ausdruck handelt: Stilistisch sind in dem Fall bei DJ keine Abgrenzungen ausmachbar. Beispiel: Obwohl er sich nach seiner Kindheit von der Klassik abgewandt hat, setzt er sich beispielsweise aktiv intensiv mit Bach auseinander. Hypothetische Schwierigkeiten mit anderen Musikauffassungen: Nach DJs eigener Aussage grenzt er sich stark ab gegenüber jeglicher Musik, die ihn „steuern“ will, deren Funktion ihm zu offensichtlich ist oder die ihm zu oberflächlich erscheint. Als Beispiel nennt er Meditationsmusik (Lehmann: Ruhe/Entspannung) oder Dieter Bohlen (Aufführungsaspekte/Identifikation). Hypothetisch könnte darunter alles fallen, das (ausser im Falle von „Struktur“) zu einseitig und eindeutig ausgerichtet ist (Lehmann: Sensualismus, Coping, Eskapismus, Background, Sentimentalität, etc.). 7 Faktoren einer Musikauffassung Wenn wir die zwei (resp. teilweise drei) Fälle betrachten und vergleichen, zeigen sich mögliche Prägungen und Konsistenzen von Musikauffassungen, werden Zusammenhänge zu Funktion und individueller Definition von Musik sichtbar und zeichnen sich Zusammenhänge für die Vermittlungstätigkeit ab. Bei allen sich manifestierenden Faktoren werden aber auch Fragen aufgeworfen, die in diesem Rahmen teilweise nicht abschliessend beantwortet werden können und weiterführender Untersuchung bedürfen. 7.1 Musikauffassung als Identitätskarte Wie schon erwähnt, können alle Fälle ein zentrales Element der persönlichen Musikauffassung benennen, das „schon immer da war“ und das sich im Verlaufe des Lebens nicht geändert hat. Bei DK ist das die Begeisterung und die Liebe („Musik als Beziehungskunst“), bei DJ das Bewusstsein um den Gestaltungsfreiraum („Musik als Selbstbestimmung“), bei BBW der Halt durch Extreme („Musik als Zufluchtsort“). 30 Was Lehmann im Sinne einer Wirkungserwartung bei der Musikpräferenz beobachtet, scheint also auf die Musikauffassung auch zuzutreffen: „Auch negativ besetzte Musik wird in gewisser Weise vom Hörer konsistent behandelt/verarbeitet. Alltagsbeobachtungen in bezug auf musikalische Vorurteile scheinen anzudeuten, dass Hörer bei nichtpräferierter Musik bestimmte Wahrnehmungs- und Wirkungserwartungen enttäuscht sehen (z.B. „Neue Musik hat keine Melodie“ oder „Rockmusik ist nur laut und rhythmisch“). Man kann allgemeiner vermuten, dass die Ablehnung einer bestimmten Musik aufgrund fehlender Kategoriensysteme, unzureichend ausgebildeter kognitiver „Werkzeuge“ zur angemessenen Verarbeitung, falscher Wahrnehmungserwartungen oder wegen misslungener Funktionalisierung des Gehörten erfolgt. Die o.g. Aspekte geben hinreichend Anlass für die -zugegebenermassenprovokative These, dass der Hörer versuche, immer gleich zu hören.“ (S. 80). Es könnte also durchaus treffen, die Musikauffassung als eine Art Identitätskarte zu betrachten, an der Persönlichkeitsstrukturen abgelesen werden können. Da der Kern einer Persönlichkeit gemeint ist, wenn es um das Thema Musikauffassung geht, stellt sich dementsprechend dringend die Frage danach, wie mit der differenten Musikauffassung eines Gegenübers (beispielsweise von Rezipientinnen und Rezipienten im Falle eines Bildungsauftrages) umgegangen werden kann. 7.2 Familiäre Prägung einer Musikauffassung Die beiden untersuchten Fälle unterscheiden sich deutlich, zumindest was das Erleben und die Bewertung des familiären Umfelds auf die Musikauffassung anbelangt. Beide haben zwar keine Musiker-Eltern, erleben aber den Einfluss der zuhause präsenten Musik ganz unterschiedlich. DJ wird familiär geprägt durch eine Musikauffassung (wenig gestaltbar), die nicht seiner eigenen (gestaltbar) entspricht. Er lernt das „Andere“ von Beginn an kennen (hat keine „Berührungsängste“), setzt sich aktiv damit auseinander, löst sich im Verlaufe der Jugend davon, um sehr viel später wieder dazu zurück zu kommen (zur Klassik). 31 DK erkennt keine familiäre Prägung und erlebt ihre musikalische Geschichte und ihre Musikauffassung als eine aus sich selbst heraus stattfindende. Sie betont dabei das NichtMusiker-Sein ihrer Eltern. Sie sucht sich ihre musikalischen Anregungen und Inspirationen gezielt selber. Mit einer anderen Musik als der von ihr gesuchten kommt sie kaum in Kontakt oder erlebt sie als nicht relevant. Es stellt sich die Frage, ob sich im Umgang mit dem musikalischen familiären Umfeld schon eine grundsätzliche Haltung im Umgang mit dem „Anderen“ zeigt. Im einen Fall (DJ) wird die nicht der eigenen Auffassung entsprechende Musik „durchgemacht“, untersucht, kennengelernt, um sich davon lösen und später wieder darauf zurück kommen zu können; im andern Fall wird auf die Existenz einer anderen Auffassung nicht weiter eingegangen, d.h. es findet keine Auseinandersetzung statt dort, wo es nicht der eigenen Musikauffassung entspricht. Auffällig ist die Tatsache, dass in beiden Fällen die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Musiksparte verbunden ist mit der als eigenständig erlebten Eroberung einer eigenen Welt. Ob dies eine Grundvoraussetzung ist für eine starke emotionale Bindung an ein bestimmtes Genre von Musik, bleibt abzuklären. 7.3 Einfluss auf die Musikauffassung durch die Ausbildung In beiden Fällen zeigt sich in dieser Lebensphase der Kontakt mit anderen (angehenden oder sie unterrichtenden) Berufs-Musikern als prägend, resp. inspirierend- sowohl mit Lehrern als mit Musizierpartnern. Dabei unterscheiden sich aber die Art der Prägung und des Umgangs mit den Neubegegnungen recht deutlich. Bei DK steht vor allem die Entdeckung der „grossen“ Komponisten im Zentrum und der Prozess, sich deren individueller Sprache anzunähern- ein Prozess, der ihr Leben bis heute unveränderlich begleitet. Ein weiterer zentral wichtiger Punkt, der sich ebenso bis heute hinzieht, ist das Zusammenspiel mit anderen Musikern, mit denen sie sich auf einer nonverbalen Ebene „von selbst“ versteht. Begegnungen mit „Anderem“ (beispielsweise an Kursen) bringen sie während der Ausbildung sehr durcheinander und empfindet sie im nachhinein als „Umweg“. Ausgesprochen prägend ist für DK vor allem das Anhören von Musik (Konzerte und CDs), die ihr Bedürfnis nach (selber) Entdecken unterstützen. 32 Bei DJ steht die Begegnung mit den Stilen verschiedener Musiker-Persönlichkeiten im Zentrum. Zuerst entdeckt er in der Begegnung mit Jazzmusikern, dass diese Art, zu improvisieren, seinem Bedürfnis nach Freiheit und Selbstbestimmung entspricht. Er erlebt danach das Reproduzieren von anderen Spielauffassungen als Mittel, um andere Denksysteme zu knacken. DJ empfindet diese Auseinandersetzung als Inspiration und kann sich nach einer gewissen Zeit jeweils auch ganz oder teilweise wieder davon (vom anderen System) lösen. Grundsätzlich beginnt aber mit der Ausbildung sein Weg auf der Suche nach einer eigenen, unverkennbaren Sprache als Musiker. Es fragt sich, ob die Suche nach einer eigenen und eigenständigen Sprache (Improvisation) und die Suche nach dem Verstehen einer ganz bestimmten anderen Sprache (Interpretation) schon Ausdruck einer sehr unterschiedlichen Musikauffassung sein könnte. Eine Lesart wäre hier allerdings auch, dass beide Haltungen grundsätzlich ähnlich und vor allem bei Berufsmusikern anzutreffen sind, da es von Musik als Form von Sprache ausgeht. Diese Tatsache könnte wiederum für die Vermittlung sehr interessant sein, da bei Nicht-Musikern der Lehmannsche Typus des „Ausdrucks“ an zweitoberster Stelle für Dimensionen des Erlebens von Musik (LEHMANN S. 81) steht: hier könnte eine erfolgversprechende Möglichkeit liegen, eine unbekannte Musik mit der Musikauffassung eines Rezipienten über den Faktor „Ausdruck“ herzustellen. 7.4 Zusammenhang von Musikauffassung und Genre-Zugehörigkeit Alle Fälle sehen sich einem bestimmten, klar benennbaren Musikgenre zugehörig: Klassik im Fall von DK, Jazz im Fall DJ, Neue Musik im Fall von BBW. DK grenzt den Raum innerhalb der Klassik noch enger ein, indem sie sich als vor allem der Wiener Klassik angehörig sieht, während DJ den Jazz nicht genauer definiert, sondern von einer „Auffassung“ spricht („Jazzauffassung“). Bei beiden Fällen erscheinen die entscheidenen Begriffe zur persönlichen Musikauffassung bereits bei der Beschreibung der Genre-Zugehörigkeit: Rhetorik bei DK, Selbstbestimmung bei DJ. Grosse Unterschiede bestehen bei den Kenntnissen über andere musikalische Genres (kaum Kenntnisse bei DK, breites Wissen bei DJ) und dementsprechend über die Vorurteile gegenüber dem eigenen Musikgenre (keine bei DK, klar benennbare bei DJ). 33 Es stellt sich die Frage, ob die Wahl des Musikgenres bereits als Aussage über eine persönliche Musikauffassung gesehen werden kann („angeboren“)- oder ob es sich genau umgekehrt verhält, nämlich, dass eine bestimmte Musikauffassung sich innerhalb eines bestimmten Musikgenres einen Weg sucht („suchend“). Die Beantwortung dieser Frage ist insofern entscheidend für die Musikvermittlung, weil sie je nachdem Grenzen innerhalb eines Musikgenres, resp. (im andern Fall) Grenzen innerhalb der Persönlichkeit aufzeigt, die den Zugang zu einer „anderen“ Musik erleichtern, resp. erschweren. Berufsmusikerinnen und musiker, die grundsätzlich die Wirksamkeit von Musikvermittlung bezweifeln, nehmen in dieser Frage die Haltung „angeboren“ ein (Fall DK). Diejenigen, die Musik für grundsätzlich vermittelbar halten, nehmen hier die Haltung „suchend“ ein (Fall DJ). Lehmann nimmt in dieser Frage eine Art Mittelposition ein, indem er die Frage offen, resp. zur weiteren Untersuchung offen lässt: „Wie die unterschiedlichen Rezeptionsmuster von Musikern und NichtMusikern zeigen, ist zumindest musikalische Vorbildung eine Variable, die einen Einfluss auf das Hörverhalten hat. Somit scheint eine Veränderung des Rezeptionsmuster durch Musikunterricht möglich. Ob mit einer Veränderung des Hörverhaltens auch eine Steigerung des Erlebens und damit verbunden eine grössere Wertschätzung für sonst nicht-präferierte Musik einhergeht, bedarf einer weiteren Untersuchung.“ (S. 91). 7.5 Musikauffassung und „Definition“ von Musik In beiden Fällen wird Musik als Sprache definiert. Bei DK stellt sie die einzige, also zentrale Definition dar (Musik als „Beziehungskunst“), hingegen bei DJ ist die Definition von Musik als Sprache nur eine von mehreren Möglichkeiten. Er nennt noch die Musik als gestaltbares und immer neu entstehendes (innovatives) Medium, Musik als von Menschen geordnete Klangereignisse, Musik als immer neu Entstehendes und Musik als Spiegel der Gesellschaft. Das Interesse für das „Andere“ spiegelt sich in der Auswahl an Definitions-Möglichkeiten für „Musik“. Dort, wo es nur eine einzige Möglichkeit gibt, ist auch kein Interesse für das „Andere“ vorhanden. Es könnte aber auch so verstanden werden, dass die 34 Definitionsmöglichkeiten von „Musik“ gesteigert werden, wenn sich jemand (wie Fall DJ) mit anderen Musikgenres aktiv auseinandersetzt. 7.6 Musikauffassung und Bewertung von Musik In beiden Fällen wird anfänglich betont, dass man Musik nicht unbedingt bewerten möchte und offen ist für alles, aber es zeigen sich dann doch in beiden Fällen klare Meinungen darüber, was „gute“ und was „schlechte“ Musik sei. Beide Fälle gehen anders mit diesem Widerspruch um. DK bezieht unumwunden Stellung zu ihrer persönlichen Musikauffassung und begründet ihre Bewertung von anderer Musik mit den Massstäben, die sich vor allem auf ihre bevorzugte Musik anwenden lassen („vielschichtig“, „atmend“ ). So findet sie denn auch „gute Musik“ vor allem in der Klassik, und dort wiederum vor allem bei ihren Lieblingskomponisten verortet. DJ hingegen verfügt, um einer offiziellen Bewertung zu entgehen, über eine Art Werkzeug, indem er Musik in drei Kategorien unterteilt: „beeindruckende“, „gut gemachte“ und „berührende“ Musik. Er vermeidet es, selber Massstab für den Wert einer Musik zu sein, indem er nicht das Emotionale in den Vordergrund stellt, sondern den Respekt vor dem Handwerklichen betont. In beiden Fällen zeigen sich Bewertungen vor allem in der Abgrenzung, beide können spontan Beispiele nennen und genau beschreiben, die bei ihnen starke Ablehnung und die Bewertung „schlecht“ hervorrufen. In beiden Fällen erscheinen auch hier wieder die Begriffe, die auf die je eigene Musikauffassung hinweisen: bei DJ ist es die Selbstbestimmung (d.h. er lehnt Musik vehement ab, die ihn auf eine billig gemachte Art „steuert“) und bei DK die Rhetorik (d.h. sie lehnt das „absolut Mechanische“ von gewisser anderer Musik, die nicht „lebendig“ ist, ab). Offizielle Bewertungen von Musik scheinen Berufsmusikerinnen und -musiker vermeiden zu wollen, auch wenn sie bei genauerem Nachfragen eindeutige Regeln aufstellen können darüber, was eine Musik „gut“ und was eine Musik „schlecht“ macht. Diese Hemmung in der öffentlich gemachten Bewertung könnte ein Hinweis sein darauf, dass sich gerade Berufsmusiker der Problematik bewusst sind, dass zwischen dem subjektivem Erleben einer bestimmten Musik und einer gesellschaftlich und beruflich geforderten Toleranz gegenüber dem „Anderen“ eine oft schwer überwindbare Schranke besteht, dass sie selbst aber noch keine Lösung dafür gefunden haben, wie man mit diesen unvereinbaren Tatsachen (eigene Musikdefinition versus differente Definition) umgehen könnte. 35 Interessant ist die Abwertung von „funktionalisierter“ Musik (DJ)- es könnte ein Hinweis sein darauf, dass Musik (ähnlich wie Religion oder Liebe) als eine Art persönliches „Heiligtum“ nicht mit einem neutralen (profanen) „Zweck“ verbunden werden darf. 7.7 Musikauffassung und die Funktion von Musik Musik hat für beide Fälle in erster Linie die Funktion von Sprache im Sinne eines Mediums, um sich oder einen Komponisten auszudrücken. Für DJ ist Musik vergleichbar mit einer Muttersprache oder einem Dialekt und dient dazu, sich als Person erkennbar machen zu können. Für DK bezieht sich die Funktion der Sprache eher auf die nonverbale Kommunikation, die beim gemeinsam Musizieren entsteht. Sie nennt zusätzlich noch die die Möglichkeiten von Musik für die Flucht aus dem Alltag, für die Herstellung von Transzendenz und für die Bildung von Gemeinschaft. Interessant ist, dass derjenige Fall (DJ), für den Musik ganz besonders stark die Funktion einer eigenen Stimme hat, also besonders stark mit der eigenen Persönlichkeit verbunden ist, mit mehr Aufwand nach Möglichkeiten sucht, sich nicht von allzu persönlichen Werturteilen oder Massstäben leiten zu lassen im Umgang mit dem„Anderem“. Im anderen Fall (DK), bei dem vor allem die Stimmen von „Anderen“ (Komponisten) wiedergegeben werden und zudem auch noch andere Musik-Funktionen existieren, scheint weniger Bemühen um eine wertfreie, resp. von der eigenen Persönlichkeit unabhängige Meinung über Musik vorhanden zu sein. Es fragt sich in dem Zusammenhang allerdings auch, ob dahinter allenfalls geschlechtsspezifische Verhaltensweisen stehen könnten (Gefühle zeigen, resp. nicht zeigen). Lehmann verweist ausdrücklich darauf, dass das musikalische Erleben und die Funktion von Musik kausal miteinander verbunden sind: „Das musikalische Erleben ist aus der Sicht des Hörers kausal mit dem musikalischen Objekt verbunden. Musik und Erleben erfüllen zusammen im Alltag des Hörers bestimmte Funktionen: So kann Musik z.B. belohnen, instrumentelle Reaktionen hervorrufen, Werte repräsentieren usw., wobei die Funktionen vielfältig sind und sowohl an die Situation als auch an die gehörte Musik gebunden sind. (…). Es ist kaum übertrieben zu behaupten, dass Musik nie 36 funktionslos rezipiert wird. Die Bewertung einer spezifischen Musik bzw. des Erlebens dieser Musik enthält daher auch immer eine Aussage darüber, wie gut die Musik der vom Hörer intendierten Wirkung/Funktion gerecht geworden ist.“ (S. 79). 8 „Musik“ dürfte kein Singular sein (Kaden) Der Musiksoziologe Christian Kaden stellt in seinem Artikel „Was ist Musik? Begriffsgeschichtliche Beobachtungen, Ketzereien, Paraphrasen“ (KADEN 1993) in 13 Schritten die These auf, dass unsere westeuropäische Kultur den Begriff „Die Musik“ zu einer Mehrzahl umwandeln sollte, um den Horizont öffnen und das Nicht-Normative fördern zu können. Für meine Arbeit ist diese These- übertragen auf die Musikauffassung im Kontext von Vermittlungsfragen- von zentraler Bedeutung und ich möchte ihr deshalb hier in einem kleinen Exkurs nachzugehen versuchen, bevor ich auf den Zusammenhang von Musikauffassung und Vermittlung komme. Ausgehend von dem Befund Georg Kneplers, dass wir zwar seit Jahrhunderten Musikgeschichtsbücher verfassen, dabei aber über keine allgemein akzeptierte Definition von „Musik“ verfügen und dazu neigen, unter „Musik“ einfach das zu verstehen, was wir zu hören gewohnt seien (vgl. Knepler, Georg: „Geschichte als Weg zum Musikverständnis“ 1982), geht Kaden mit der abendländischen Tradition der Musikgeschichtsschreibung hart ins Gericht: „Ganz allgemein nämlich gibt sich abendländische Tradition absolut nicht grüblerisch und skrupulös bei der Frage, was „Musik“ sei, was sie im Tieferen bedeute. Konversations- aber auch Fachlexika sind mit Antworten schnellstens zur Hand: Sie reden von „Tonordungen“, „Tonrelationen“, „Tonsystemen“. (…). Verwerflich wird die Selbstsicherheit allein dort, wo wir diese sehr spezielle Musik-Konzeption mit der Sache der Musik schlechthin identisch setzen, wo wir den (…) Begriff „Tonkunst“ auf die Kultur anderer Zeiten und Völker zwanghaft projizieren. Ebenso aber geschieht es von Tag zu Tag; und es geschieht mit Vorsatz, Wissenschaft, mit Plan.“ ( S. 11). 37 Kaden verweist also auf ein soziologisches Thema, das hinter der scheinbar banalen Tatsache steht, dass alles Klingende in einen einzigen, von einer kleinen Menschgruppe der übrigen Welt unhinterfragt verordneten Begriff vereinheitlicht wird. Er verweist auf ein Verhalten, das auf scheinbar logischen Grundsätzen beruht, das sich aber bei genauerem Hinsehen als unhaltbar erweist: „Wer bei einem Konzept der Tonordnungen ansetzte und für solche Tonkunst den logischen Allgemeinbegriff zu eruieren suchte, müsste allenthalben nach vergleichbaren Tatbeständen Ausschau halten und auch auf höherer, abstrakterer Ebene zu etwas Tonkunst-Ähnlichem gelangen bzw. zu gelangen hoffen. Er schlösse- quod erat demonstrandum- gedanklich a priori vom EigenständigBegrenzten auf das Allgemeinheitlich-Universelle, von sich aus auf DIE ANDEREN, vom Ego auf die Welt; so rundet sich der Kreis.“ (S.12). Dass Allgemeinbegriffe nie der Gesamtheit dessen gerecht werden, was die Welt an real existierenden Formen zu bieten hat, wäre eigentlich eine einfache Einsicht, und „Musikgeschichte zu begreifen als Geschichte der Musik, bliebe von vornherein eine Simplifikation“ (S.12). Kaden schlägt deshalb vor, Musikgeschichte nicht als Entfaltung eines Logisch-Allgemeinen zu denken, sondern als eine Abstammungsgeschichte von nebeneinander stehenden „Musiken“, die in der grossen Mehrzahl beispielsweise nichts mit „Tonkunst“ zu tun haben: „Damit soll keinem veräusserlichten Relativierungsstreben das Wort geredet werden. Statt des Singulars von „Musik“ ein Plural zu wählen, ist freilich die alles entscheidende Vorausbedingung, um Eigen-Stereotypien und Ego(=Euro)Zentrismen zu überwinden. Auch dürfte sich auf diese Weise der Sinn für Differenz, für Mannigfaltigkeit methodologisch und motivotional von Beginn an schärfen. So wird, wer aus den Fesseln der Allgemeinbegriffe sich befreit, sehr rasch und ohne Widerstand bemerken, wie selten Musiken in aller Welt sensu stricto mit Tonkunst und Tongebung zu schaffen haben.“ (S.14). Kaden sieht einen Hinweis auf seine These auch darin, dass zwischen Wortsprache und Musik eine charakteristische Differenz besteht: Sprache scheint sich geschichtlich jeweils zu einem frühen Zeitpunkt schon zu vereinheitlichen und sogar zu verengen, während Musik diese 38 Normierung und Standardisierung nicht erfährt, sondern von vornherein komplementär, mehrwertig und mehrstufig bleibt. „Begriffshistorisch eine spannende Geschichte ist daher das Erscheinen jener Kategorie, die unserer neuzeitlichen „Musik“ die Wortwurzel leiht. Ich meine die antike musiké. Wenn nicht alles täuscht nämlich, operierten die Alten Griechen zunächst absolut nicht mit einer Musik. Sie kannten, ohne entsprechende Terminierung, deren mindestens zwei: eine Kunst der Bändigung, der Ruhe (=hesychia), der Disziplin- und eine der Entfesselung, des Orgiastischen, des frühlingshaften Rauschs; sie kannten (…) eine Musikausübung, kurz also, des Apollon und des Dionysos.“ (S. 21). Der Ursprung unseres eigenen Begriffs für eine Vereinheitlichung einer unvereinbaren Vielfalt beruht also eigentlich auf dem Widerstreit von (mindestens) zwei Prinzipien, die heute noch genauso existieren wie damals. Die musiké als „Kunst der Musen“ (also ein Plural!), eint somit ursprünglich ein Sammelsurium an unvereinbaren Gegensätzen. Erst später erreichte dann die musiké jene kategoriale Verschärfung, die für die abendländische Neuzeit Vorbild und Richtschnur wurde: Musik als Kunst der phoné, der Stimme, des Tons. Eine Geschichte der Musik zu schreiben, als einem Singular, als einer Normalität, könnte sich also aus einer terminologischen Aufgabe in eine soziologisch-diagnostische verwandeln: „Denn wo auch die Vorstellung von der Musik sich klein macht und auf „unsere“, unsere eigene abendländische Musik sich zurückzieht (Eggebrecht), ist mit der Selbstbescheidung wenig nur gebessert. Erst wo wir lernen, dass die Musik im Grossen und Ganzen der Kulturen so nicht existiert- und dass dafür Lebensprinzipien, Vervielfältigungsprinzipien die Vorkehrung treffen-, erst dort werden wir an der eigenen Musik unsicherer werden und sie, vielleicht eines Tages, zur Mehrzahl verflüssigen können.“ (S. 23). Die provokante These, dass „die Musik“ gar nicht existiert, möchte ich meinen folgenden Überlegungen zur Vermittlungstätigkeit von Berufsmusikerinnen und -musikern insofern zugrunde legen, als ich davon ausgehe, dass es einen Singular hier auch nicht geben kann und darf, dass es keine allgemein verbindliche „Musikauffassung“ gibt, sondern nur individuelle „Musikauffassungen“. 39 9 Musikauffassung und Vermittlungstätigkeit Beide untersuchten Fälle stehen in einem vielfältigen beruflichen Umfeld, in das sie sich als Vermittlerin/ Vermittler einbringen. Sie übernehmen dabei ebenso vielfältige Verantwortungen gegenüber Studierenden, Konzertpublikum, Musikschülerinnen und -schülern, etc. einerseits und gegenüber der Musik, dem Musikbetrieb und der Kulturpolitik andererseits. 9.1 Orte der Vermittlung Beide Fälle sehen als Orte ihrer Vermittlungstätigkeit die pädagogischen Tätigkeiten und die Konzertbühne (Fall DJ spricht zusätzlich noch von CD-Aufnahmen). DK unterscheidet dafür zwischen verbaler (pädagogischer) und nonverbaler (konzertierender) Vermittlung. DJ erkennt Auswirkungen seiner persönlichen Musikauffassung zudem innerhalb der eigenen Familie, insbesondere auf seine Kinder. Interessant ist die Beobachtung, dass sich für Berufsmusikerinnen und -musiker Vermittlung ganz klar auch auf nonverbaler Ebene abspielen kann und dass die „bewusst“ gemachte Vermittlung als pädagogisch empfunden wird. Es scheint also ein Unterschied zu sein, ob eine Musikauffassung in Worte gefasst werden muss oder ob sie beispielsweise durch instrumentales Spielen vorgelebt wird. 9.2 Umgang mit dem „Anderen“ In beide Fällen dominiert die Strategie der Hierarchisierung unvereinbarer Musikauffassungen, allerdings unterscheiden sie sich relativ stark im Bewusstsein, resp. im Umgang damit. DK nimmt die eigene Musikauffassung als Massstab, um Werturteile abzugeben und zieht das als Methode auch nicht in Zweifel. Sie gibt an, „andere“ Musik zu schätzen, solange sie sich mit ihrer eigenen Musikauffassung deckt und sie abzulehnen, wenn das nicht der Fall ist. DJ hingegen behauptet von sich, über andere Musik nicht zu urteilen. Er beobachtet Klassifizierungen von verschiedener Musik zwar bei anderen Menschen (die sich nicht genügend mit einer Materie auseinandergesetzt haben), nicht aber bei sich selbst. Bei derjenigen Musik, die 40 er selbst „runter klassifiziert“, gibt er an, es aufgrund der fundierten Kenntnis über diese Musik zu tun. DK verweist zudem auch darauf, dass sie selbst sich unter Umständen ändern kann, wenn sie anderen Einflüssen ausgesetzt ist. Zudem erkennt sie den Kampf, der sie manchmal bei vermittelnder Tätigkeit zur Verzweiflung treibt („Lebendigkeit“ versus „Perfektion“), auch bei sich selbst als eine professionelle Grundproblematik. Es stellt sich die Frage, wieweit die Vermittlung einer Musik, die nicht der eigenen Musikauffassung entspricht, überhaupt möglich ist, wenn es um den emotionalen Gehalt der zu vermittelnden Musik geht. Interessant ist die Tatsache, dass das Prinzip einer Umgangsweise mit dem Anderen (zb „Runter klassifizieren“) offenbar nicht erkannt wird, wenn es von der eigenen Person angewendet wird. Es könnte also sein, dass jeder seine Grenzen hat, wenn es um einen sozial vertretbaren Umgang mit dem „Anderen“ geht. Hier könnte ein in der Ausbildung erworbenes Handwerk Sinn machen, das einen Weg aufzeigt, um aus diesem Dilemma herauszukommen. 9.3 Handwerk/ Ansätze Bei beiden Fällen zeigen sich auffallende Unterschiede in den Lösungsansätzen zur Vermittlung einer bestimmten Musik oder Musikauffassung. Einziger gemeinsamer Aspekt ist derjenige der Zeit: beide sind der Meinung, dass der Zugang zu einer Musik sehr viel Zeit und Auseinandersetzung in Anspruch nimmt. Es könnte für Berufsmusikerinnen und -musiker ein Hindernisfaktor in der als erfolgreich erlebten Vermittlung darstellen, dass der verstehende Zugang zu Musik unabdingbar mit viel Zeitaufwand verbunden ist (da es sich vor allem um eine Auseinandersetzung mit den Strukturen einer Musik handelt). Es stellt sich die Frage, ob es hier nicht hilfreich wäre, schon in der Ausbildung auf Formen von Vermittlung hinzuweisen, die explizit nicht von der Vermittlung von „Struktur“ dominiert sind. Ansonsten verfügen beide über ein anderes Handwerk: DK findet, dass grundsätzlich eine bestimmte Musik nicht an jemanden vermittelt werden kann, der nicht schon einen Zugang dazu 41 hat. Sie reagiert eher frustriert auf erfolglose Vermittlungsversuche und sieht den Grund dafür eher beim Rezipienten (der nicht versteht, was sie meint). Erfolgreicher sieht sie sich als Interpretin, wo sie ihren Auftrag darin erfüllt findet, durch ihre intensive Auseinandersetzung mit einem bestimmten Stil den Rezipienten eine Sternstunde zu bescheren. DJ verfügt über ein Handwerk zur Vermittlung von Musik, das ihm erlaubt, seine eigenen Präferenzen „draussen“ zu halten. Wichtigstes Element dafür ist für ihn das „Filtern“, d.h. das Hören auf verschiedene Aspekte und Ebenen eines Musikwerks. Wichtig ist ihm dabei, dass alle Aspekte des Rezipierens von den Emotionen des analysierenden Rezipienten begleitet sind. Auch legt er Wert darauf, dass die zu vermittelnde Musik immer intensiv und aktiv nachvollzogen werden können muss („Imitieren und Analysieren“), bevor eine Bewertung abgegeben werden darf. DJ stellt eine zu vermittelnde Musik zudem immer in einen allgemeinen gesellschaftlichen Kontext, was einen Zugang für die jeweiligen Rezipierenden quasi automatisch ermöglicht, da sie sich als Teil dieser Gesellschaft betroffen fühlen. Über ein Vermittlungshandwerk zu verfügen, das die eigenen Präferenzen ausklammert, scheint also eher zu Gefühlen von Erfolg zu führen als der Kampf um die Durchsetzung der eigenen Musikauffassung. Die eigene Musikauffassung ausklammernd, könnte ein Vermittlungs-Handwerk also, am Beispiel von DJ gesehen, folgendermassen aussehen: klare Anweisungen für gezieltes Hören auf verschiedenen Ebenen zu geben; Unterscheidungen zwischen den Emotionen des Vermittlers (die draussen bleiben) und den Emotionen der Rezipienten (die einbezogen werden müssen); Erreichen von Respekt einer bestimmten Musik gegenüber dadurch, dass die zu vermittelnde Musik aktiv nachvollzogen werden muss; Positionierung der zu vermittelnde Musik in einen gesellschaftlichen Kontext, um den Bezug zum Rezipienten herzustellen. 10 Strategien im Umgang mit dem „Anderen“ (Barth) Die Kontrastierung der beiden Fälle DJ und DK zeigt, dass mit der persönlichen Musikauffassung ganz verschieden umgegangen werden kann: im einen Fall (DK) wird versucht, die eigenen Musikauffassung zu vermitteln, resp. durchzusetzen gegenüber Rezipierenden. Im andern Fall (DJ) wird versucht, die eigene Musikauffassung gegenüber den Rezipierenden zu 42 verbergen. Im einen Fall (DK) wird die differente Musikauffassung des Gegenübers wahrgenommen (wird aber als Hindernis empfunden und bekämpft). Im andern Fall (DJ) wird das Gegenüber gar nicht zum Thema, weil die Musikauffassung von vornherein ganz ausgeklammert wird. Um eine weitere Möglichkeit für einen Umgang mit differenten Musikauffassungen in Vermittlungsprozessen aufzuzeigen, möchte ich den interkulturell orientierten Ansatz der Musikpädagogin Dorothee Barth heranziehen. Sie geht in ihrer Arbeit „Ethnie, Bildung oder Bedeutung?: Zum Kulturbegriff in der interkulturell orientierten Musikpädagogik” (BARTH 2008) davon aus, dass einer Musik zugeschriebene Bedeutungen keine dem musikalischen Objekt immanente Qualitäten sind, sondern dass diese in einem immer neuen dynamischen Prozess herausgebildet werden: „Der Kulturbegriff dient als Erklärung für menschliches Handeln und verweist auf die geteilten Sinndeutungen der Akteure. Die kollektiven Sinnsysteme, die symbolischen Ordnungen, das geteilte Wissen bilden den Hintergrund für bestimmte Überzeugungen oder Handlungen. Sie werden von den Akteuren nicht explizit für wahr gehalten, sondern angewendet. Es sind Selbstverständlichkeiten, die in der Regel nicht thematisiert werden müssen, sondern den Handlungen und Überzeugungen – bewusst oder unbewusst, absichtlich oder unabsichtlich- zu Grunde liegen. Befinden sich verschiedene Akteure in einem kulturellen Konsens, d.h. teilen sie dasselbe kollektive Wissen, dann teilen sie auch die Prozesse der Bedeutungszuweisung und Bedeutungsgenerierung. Erst vor diesem Hintergrund ist eine Verständigung über Inhalte, ja auch eine auf Inhalte bezogene Kontroverse überhaupt möglich. Dies ist für die Bestimmung des bedeutungsorientierten Kulturbegriffs wesentlich: Menschen gehören derselben Kultur an, wenn sie die Prozesse der Bedeutungsgenerierung und Bedeutungszuweisung teilen.“ (S. 41). Kurz gesagt also: „An die Stelle der oft gestellten Frage, was eine bestimmte Musik „an sich“ bedeutet, tritt die Frage, welche Bedeutung eine bestimmte Musik für mich (und andere) hat.” (S. 40). Angewendet auf die Musikvermittlung- ich wage die Übertragung, eine bestimmte (zu vermittelnde) Musik als eine Art „Kultur“ zu betrachten- müsste für eine gemeinsame 43 Betrachtung eines Gegenstandes zuerst klargestellt werden, mit was für einer Person, genauer: mit was für einer Musikauffassung eine Musikvermittlerin oder ein Musikvermittler es beim Rezipienten überhaupt zu tun hat. Das heisst, eine Grundvoraussetzung, um sich in einem Vermittlungsprozess einem Musikwerk zu nähern, wäre die Herstellung einer Art gemeinsamen Vokabulars aller beteiligten Akteure. Unumgänglich, um gemeinsame Bedeutungszuweisungen machen zu können, wäre deshalb die Kenntnis über die im Vermittlungsprozess involvierten Musikauffassungen: diejenige des Vermittlers auf der einen, diejenige der Rezipienten auf der anderen Seite. Was im folgenden Barth für die Gruppe der Jugendlichen beschreibt, lässt sich ebenso von anderen Gruppen von Rezipierenden in einem Vermittlungsprozess behaupten: „Das, was Lehrende hören und sehen, ist nicht dasselbe, was die Teilnehmer einer Jugendkultur sehen und hören- selbst wenn es sich scheinbar um das gleiche Musikstück handelt. Denn die ästhetisch-musikalischen Praxen in Jugendkulturen sind durch im weitesten Sinne existentielle Bedeutungszuschreibungen geprägt“ (S. 42). Eine mögliche Strategie, eine bestimmte Musik einer bestimmten Rezipientengruppe zu vermitteln, wäre also, den Vermittlungsprozess als etwas Gemeinsames zu betrachten, für den die involvierten Musikauffassungen beider Seiten weitmöglichst bekannt sind, um von einem gemeinsamen Vokabular ausgehen zu können, was mit „Musik“ gemeint ist. Selbstverständlich kann es sich hier nur um eine Haltung handeln, da ja von einer ganzen Gruppe oder einem ganzen Konzertsaal nicht jede einzelne Musikauffassung analysiert werden kann. Wen es aber ernsthaft interessiert, welche Musikauffassung seine Rezipienten wohl haben, findet das mit der Zeit auch allmählich heraus, entwickelt Methoden und kann gewisse Typologien für Gruppen von Rezipierenden erstellen. 11 Schlusszusammenfassung 11.1 Fazit Die anfangs gestellte Frage nach dem Wesen und der Manifestation einer Musikauffassung und dem Zusammenhang zur Vermittlungstätigkeit von Berufsmusikerinnen und –musikern lässt sich nach dieser Untersuchung zusammenfassend folgendermassen beantworten: 44 Mithilfe von Begriffen aus der Musikpsychologie liessen sich exemplarisch Faktoren für eine Musikauffassung beschreiben und für die Fallbeispiele individuelle Analysen erstellen. In der Analyse konnten einzelne Faktoren der jeweiligen Musikauffassung und die Hauptfunktion von Musik für die betreffende Person eruiert und benannt werden. Die Analyse zeigte Möglichkeiten auf, über welche Faktoren Verbindungen zu „anderer“ Musik oder zu anderen Musikauffassungen hergestellt werden und wo Potentiale für Probleme liegen können. Es hat sich herausgestellt, dass Berufsmusikerinnen und -musiker, die sich nicht darüber bewusst sind, dass ihre persönliche Musikauffassung nur eine von vielen ist, ihre Vermittlungsversuche öfter als frustrierend erleben als andere, weil sie beim Rezipienten eine bestimmte Musikauffassung (nämlich ihre eigene) zu vermitteln und damit die Musikauffassung des Rezipienten zu verändern versuchen. Da eine Musikauffassung aber mit der Persönlichkeit eines Menschen untrennbar verbunden und zudem relativ konsistent ist, stellt ein solcher Versuch eine Art Übergriff dar und muss zwingendermassen scheitern. Für die Musikvermittlung müsste nach dieser ersten Untersuchung in einem weiteren Schritt die Lehmannsche Typologie um zusätzliche Faktoren erweitert/ergänzt und gewisse Begriffe umbenannt werden, um eine Art „Mapping der Musikauffassungen“ für die Handhabung in der Praxis zu erreichen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch darauf hinweisen, das es sich bei dieser Untersuchung um zwei Einzelstudien handelt, und dass das Resultat im Hinblick auf verallgemeinernde Schlüsse entsprechend realtiviert werden muss. In dem Zusammenhang sei erwähnt, dass es hier weiterer Untersuchungen bedarf, um in der Typologisierung von Musikauffassungen fundierte Ergebnisse vorweisen zu können. 11.2 Anwendungsmöglichkeit des Ergebnisses für die Praxis Wenn eine Musikvermittlerin oder ein Musikvermittler die eigene Musikauffassung analysiert hat und sich für die Musikauffassung der Rezipierenden grundsätzlich interessiert, sind die Voraussetzungen vorhanden, um für ein zu vermittelndes Musikwerk von allen Akteuren gemeinsam geteilte Bedeutungszuschreibungen zu entwickeln und über die Schnittmengen von Musikauffassungs-Faktoren Verbindungen zwischen Rezipienten und Musikwerk herzustellen. 45 Angehenden Berufsmusikerinnen und -musikern sollten deshalb in der Ausbildung Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie sie Vermittlung ausgehend von der Musikauffassung des Gegenübers gestalten und Brücken zu einzelnen Aspekten von differenten Musikauffassungen bauen könnten, statt ihre eigene Musikauffassung der Vermittlung zugrunde zu legen. Im Falle des eingangs geschilderten Studenten könnte ein Ansatz zu einer Vermittlung der Musik von Michael Jarrell an Jugendliche beispielsweise folgendermassen aussehen: Als erstes müsste der Student seine eigene Musikauffassung analysieren und eine Hauptfunktion benennen können, die Musik für ihn persönlich hat. Mit den Begriffen von Lehmann operierend, kämen wir im Falle des Studenten wohl auf „Emotion/Laune“ (Hauptfunktion: Stimmungsverbesserung). Ausgerüstet mit der Haltung, dass es in den folgenden Schritten NICHT um Stimmungsverbesserung geht, gälte es, als nächstes die Musikauffassung der Rezipierenden zu ermitteln. Im Sinne einer Erleichterung für einen unerfahrenen angehenden GymnasialMusiklehrer würde ich diese Aufgabe zuerst stark eingrenzen auf eine Teilgruppe innerhalb einer Klasse von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, beispielsweise die Gruppe, die sich vor allem über „Motorischen Mitvollzug“ charakterisieren liesse. Daraufhin käme die Analyse der Musik auf den Aspekt des „Motorischen Mitvollzugs“ hin: wie und wo lässt sich in dieser Musik zu diesem Aspekt eine Schnittmenge herstellen? Im Rahmen dieser Analyse entstünden bereits erste anwendbare musikalische Ideen, die dann in einem weiteren Schritt zu konkrete Übungen im Sinne eines aktiven Nachvollzugs der Musik für die Jugendlichen ausgearbeitet werden könnten. Auf die gleiche Weise könnte mit anderen Teilgruppen der Rezipierenden verfahren werden, so dass am Schluss mehrere Übungen zu der Musik von Jarrell bereitstünden. Damit wäre die Grundlage gebildet, um über diese jetzt schon praktisch nachvollzogene Musik gemeinsam nachzudenken: über Bedeutungszuschreibungen für dieses einzelne Musikwerk könnte man schrittweise in einen grösseren musikalischen oder gesellschaftlichen Kontext gelangen. Der betreffende Student, resp. Musiklehrer, könnte (erst!) zu diesem Zeitpunkt seine eigene Musikauffassung ins Spiel bringen und die Stellung, die sie zu der Musik von Jarrell einnimmt, aufzeigen. Damit könnte er den Jugendlichen eine Haltung gegenüber einer „anderen“ Kultur vormachen, die von grundsätzlichem Respekt und Neugier/Interesse geprägt ist, auch wenn ihm diese Musik nicht in erster Linie „gefällt“. 46 11.3 Schlusswort An den Anfang meiner Arbeit habe ich ein Zitat von Andreas C. Lehmann zur Funktionalität von Musik gestellt. Die Funktion von Musik ist, wie sich gezeigt hat, ein zentraler Baustein einer Musikauffassung. Wie sich in der Untersuchung herausgestellt hat, kann das bewusste Ansprechen einer grundsätzlichen Funktionalität von Musik für Berufsmusikerinnen und musiker aber auch zu einem zentralen Stein des Anstosses werden, da damit einhergehend unbequeme Fragen nach Bedeutung und Autonomieanspruch einer bestimmten Musik aufgeworfen werden. Ich möchte deshalb mit einem dahingehenden Zitat aus dem gleichen Artikel von Lehmann aufhören und hoffe, dass meine Antwort darauf für angehende Muikvermittlerinnen und -vermittler eine Ermutigung sein kann: „Sollte oder könnte es ein Ziel eines musikpädagogischen Bemühens sein, aktiv oder passiv zu einer Modifizierung der Rezeptionsweisen und damit zu einer Veränderung des musikalischen Erlebens beizutragen?“ (LEHMANN S. 90). Meine Antwort darauf wäre weder ja noch nein, sondern: Wenn eine Musikvermittlerin oder ein Musikvermittler es herauszufinden versteht, welche Funktion Musik für ihr, resp. seine Rezipierenden hat und die entsprechende Brücke zu einer bestimmten Musik zu bauen versteht, dann ist eine Veränderung des Erlebens der Rezipierenden nicht nötig. 47 12 Literaturverzeichnis Barth, Dorothee: Ethnie, Bildung oder Bedeutung?: Zum Kulturbegriff in der interkulturell orientierten Musikpädagogik. Augsburg: Forum Musikpädagogik, Bd. 78, 2008 Barth, Dorothee: „Kulturgeschichten. Same old stories oder ein Fortsetzungsroman mit offenem Ende?“ In: Musik und Bildung (Band 6), S.2-8. Mainz: Schott Musikverlag, 2000/2001 Barz, Gregory (Hg.): Shadows in the field: new perspectives for fieldwork in ethnomusicology. Oxford: Oxford University Press, 2008 Behne, Klaus-Ernst: Globale Typologie des Musikgeschmacks. Regensburg: Verlag Gustav Bosse, 1990 Hahn, Christina: Innensichten. Aussensichten. Einsichten. Eine Rekonstruktion der Emic-Etic-Debatte. Aachen: Shaker Verlag, 2005 Kaden, Christian: „Was ist Musik? Begriffsgeschichtliche Beobachtungen, Ketzereien, Paraphrasen“. In: Zwischen Aufklärung und Kulturindustrie, S.11-25. Hamburg: von Bockel Verlag, 1993 Kaden, Christian: „Das ANDERE als kosmologische Regulationsinstanz in der Musik“. In: Soziale Horizonte von Musik (Hg. Christian Kaden und Karsten Meckensen), S. 120-136. Kassel: Bärenreiter Studienbücher Musik, 2006 Knepler, Georg: Geschichte als Weg zum Musikverständnis. Leipzig: Verlag Philipp Reclam,1982 Lehmann, C. Andreas: „Habituelle und situative Rezeptionsweisen beim Musikhören oder: Versuchen wir, immer gleich zu hören!“. In: Musikvermittlung als Beruf (Hg. Maria Luise Schulten), Essen: Verlag die Blaue Eule, 1993 Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. 11., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Weinheim: Beltz-Verlag, 2010 Nettl, Bruno: „Was ist Musik? Ethnomusikalische Perspektive“. In: Musik- zu Begriff und Konzepten (Hg. Riethmüller, Albrecht und Beiche, Michael). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2006 Riethmüller, Albrecht: „Stationen des Begriffs Musik“ in: Ideen zu einer Geschichte der Musiktheorie Bd1 (Hg. Zaminer, Frieder), S.59- 95. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985 48 Wimmer, Constanze: Musikvermittlung im Kontext. Impulse-Strategien-Berufsfelder. Regensburg: Con Brio Verlag, 2010 Wimmer, Constanze: Exchange. Die Kunst, Musik zu vermitteln. Qualitäten in der Musikvermittlung und Konzertpädagogik. Salzburg: Internationale Stiftung Mozarteum, 2010