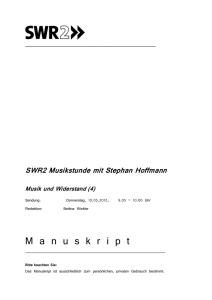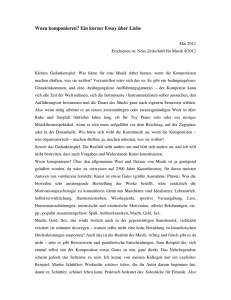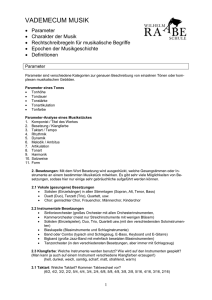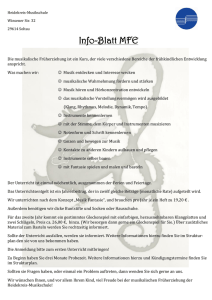Referat - Musik und Mensch
Werbung

1 FREIHEIT UND MACHT Musik & Mensch Konzert- und Kolloquiumsreihe Zyklus 2006/2007 – „MACHT“ Pädagogische Hochschule FHNW, Kasernenstraße 20 (ehemalige Reithalle), Aarau Donnerstag, 2. November 2006 Musik, Macht und Politik oder „Mit Musik wird Politik gemacht“ Ein Referat von Anton Haefeli, Musikwissenschaftler, Hochschule für Musik, Basel Bevor ich zu meinem eigentlichen Thema komme, möchte ich zuerst einige grundsätzliche Tatsachen zur Musik im menschlichen Leben rekapitulieren, die eine wichtige Voraussetzung für ihr Machtpotential sind. „Das Gehör [ist] der erste Sinn, welcher im Mutterleibe vollständig ausgebildet wird“; Alltagsgeräusche, Sprache und Musik haben wir schon als Embryos gehört und auf sie reagiert, und es könnte sein, „dass das Kind nach der Geburt seine Mutter nicht erkennen würde, wenn diese nicht zu ihm spräche und diese Stimme ihm nicht erlauben würde, [sie] anhand der schon vorher im Uterus gehörten und vertrauten Stimme wiederzuerkennen“1. Keine der künstlerischen Fähigkeiten, die ein Mensch entwickeln kann, wird so früh (und ab und zu so früh auf so hohem Niveau) manifest wie die musikalische. Und Werke von zeichnenden oder schreibenden Wunderkindern haben (gemessen an den Standards der Erwachsenen, zu denen ich natürlich ein Fragezeichen mache!) keinen Bestand, wohl aber manchmal die von komponierenden. Die „musikalische Intelligenz“ gehört unter Howard Gardners sieben hauptsächlichen „multiplen Intelligenzen“ zu den bedeutenden, und diese „hartnäckig beibehaltene zentrale Stellung [bedeutet] in der menschlichen Erfahrung ein faszinierendes Rätsel, gerade weil sie nicht ausschließlich der Kommunikation vorbehalten ist. Der Anthropologe [Claude] Lévi-Strauss ist nicht der einzige Wissenschaftler, der behauptet, dass wir möglicherweise den Hauptschlüssel zum menschlichen Denken fänden, wenn wir Musik erklären könnten – oder umgekehrt ausgedrückt, dass jede 2 Untersuchung der Bedingungen des menschlichen Lebens scheitern wird, die Musik nicht ernst genug nimmt.“2 Musik ist in Wechselbeziehung zu solchen Befunden ein Urphänomen menschlicher Gesellschaft und gehört zu den ältesten Elementen menschlicher Kultur überhaupt. Verschiedene Autoren postulieren, „dass man den Menschen – als Spezies – durch seine musikalische Aktivität definieren muss“3, dass die ästhetische Dimension, vorab die musikalische, also „keine zusätzliche Dimension des Menschen [ist], sondern das definitorische Merkmal der Gattung Mensch, durch das sich der 4 Mensch von anderen Lebewesen unterscheidet“ ; dass es „in der uns bekannten Geschichte keine Gesellschaft ohne Musik“ gegeben habe und „eine Gesellschaft ohne Musik humanbiologisch“ deshalb in hohem Masse unmöglich sei.5 Zudem sei „allgemein bekannt, [dass Musik] der intensivste emotionale Ausdruck, den sich die Menschen mit ihrer Kultur geschaffen haben, [ist], und es ist für ihre humane Existenz lebensnotwendig, Musik […] zu erleben. Daher kann man am Verhalten zur Musik ebenso den emotionalen Ausdruck des Menschen wie ein Defizit in der Ausdrucksfähigkeit beobachten.“6 Musik in einem ursprünglichen, nichtelitären Verständnis (die Ethnologen/innen sprechen von „sonischen Ordnungen“) gibt es (im sogenannten Urbesitz in Instrumentenfunden nachgewiesen) seit mindestens 150'000 Jahren, aber sehr wahrscheinlich noch viel länger. Ganz anders, als ich es in meiner Jugend noch gelernt habe (Herder, Rousseau und zuletzt Spencer bezeichneten Sprache als Voraussetzung für die Entstehung von Musik!), steht heute fest, dass das Instrumentalspiel dem artikulierten Gesang vorausging, Rhythmen den Melodien (Hans von Bülow behauptete: „Am Anfang war der Rhythmus!“) und das Geräusch dem Klang. Instrumentalspiel, Lallen und Gesang (in dieser Reihenfolge) kommen also vor der Wortsprache, die, pointiert gesagt, reduzierte und abstrahierte Musik ist (und wieder zu Musik wird oder zumindest als Musik gehört werden kann). Außer den Elektrophonen, zu denen aber auch schon im 18. Jahrhundert die ersten Versuche gemacht wurden, sind alle heutigen instrumentalen Geräusch- und Klangerzeugungsprinzipien spätestens vor 50'000 Jahren erfunden worden. Das nötigt mir allerhöchsten Respekt ab, und ich werde wütend, wenn ich auch in neuesten Lexika im Zusammenhang mit den Anfängen der Musik immer noch von „Primitivkulturen“7 lese. In früheren Gesellschaften war den Herrschenden bzw. ihren Beratern die bislang geschilderte Bedeutung der Musik und ihres Machtpotentials – Sie sehen, ich komme nun explizit zu meinem Thema – sehr bewusst. Vom mindestens 5'000 Jahre alten Ischtar-Mythos über das alte China bis zu den „Posaunen von Jericho“ gibt es unzählige Belege darüber. Tammuz, der altsumerische 3 Frühlingsgott, spielte im Totenreich vor dessen Herrscherin Ereschkigal, damit diese die von ihr gefangengesetzte Göttin der Liebe und zugleich Schwester Ischtar freilasse. Das gelang ihm mit der Macht der Musik bzw. mit Liedern voller Sehnsucht und Schmerz. Der Orpheusmythos ist nur ein 2'000 Jahre jüngerer Abklatsch davon, geschweige denn deren Nachwehen im christlichen Mythos. In China, wo schon vor 6'000 Jahren hochentwickelte Instrumente gebaut wurden, die in Europa in einer ähnlichen Bauweise erst 4'000 Jahre später anzutreffen sind (die Mundorgel Sheng, Glocken usw.), wurden Musik und Tanz früh als Mittel zur Beherrschung der Naturgewalten eingesetzt (wie in anderen Kulturen auch), bald aber auch zur Domestizierung der Menschen und zur Stabilisierung von Herrschaft, und bereits vor 4'000 Jahren begann der Brauch, dass fremde ‚Staaten’ Musikerensembles als Tributgeschenke an die chinesischen Könige und später Kaiser übergaben. Die Musiktheorie inklusive der Tonsysteme erreichte mehr als 2'000 Jahre vor Pythagoras (und als die Menschen im Raume der heutigen Schweiz nur zu eigentümlichen Lauten fähig waren ...) ein hochkomplexes Niveau. Und wie im späteren Griechenland wurde Musik als angeblich vorzügliches Erziehungs- und Führungsmittel zu nutzen versucht; Hunderte von Beamten unter einem Musikminister (!) sorgten ab der Zhou-Dynastie (1'050 bis 249 v. u. Z.) dafür. Dabei war man in der sogenannten „klassischen“ Zeit der Überzeugung, dass die Riten „Disziplinierung und Ordnung“ im hierarchischen Gefüge gewährleisten, Musik dagegen „Anpassung und Ausgeglichenheit“ in der menschlichen Psyche. In der Tang-Dynastie (ab 618 n. u. Z.) waren 30'000 Musiker am Kaiserhofe angestellt; Musik und Musikpflege wurden also in toto vereinnahmt und kontrolliert, notabene auch die Musik fremder Völker, und die Hofmusik zu einem erstrangigen Statussymbol für den Herrscher. ja, in gewissen Abschnitten der chinesischen Geschichte herrschte die Überzeugung, dass Musik selbst das Gesetz bilde und eigentliche Gesetze überflüssig mache. Und um meinem Diskussionspartner Material zu liefern: Militärmusiken existierten in China bereits vor ca. 3'000 Jahren; sie pushten die Soldaten indes nicht in die Schlacht und in den Tod, sondern spielten nur bei Siegesfeiern und anderen repräsentativen Anlässen zur Verherrlichung von Heldenmut und männlicher Tapferkeit auf und zogen dafür auch Sänger bei (eine Anregung für die schweizerischen Armeemusiken ...). Die „Posaunen von Jericho“ endlich, nochmals ein militärisches Beispiel, müssen nicht nur unbedingt symbolisch verstanden werden, sondern könnten auch real für die Gewalt der Musik als puren zielgerichteten Schalls stehen, denn wie Laserstrahlen vermögen gebündelte und starke Schallwellen Materie zu zerstören, was als militärische Waffe und zu Folterzwecken schon seit längerem genutzt wird. 4 Die europäische Musikgeschichte und der Begriff „Musik“ wurzeln indes im griechischen Altertum. Damals umfasste „Musik“ – eigentlich = „die Musische Kunst“ oder „die den Menschen von den Musen geschenkte Kunst“ – ein größeres Spektrum, als unser heutiger Wortgebrauch es suggeriert, und stand für die Einheit von Wort, Ton, instrumentaler Untermalung und Bewegung. Auch wenn sich in der christlichen Musik die instrumentale und tänzerische Ebene bald davon lösen sollten und mussten, war ein Komponist aber noch bis weit in die Renaissance hinein zugleich auch Dichter und als solcher oft berühmter denn als Tonschöpfer (etwa Guillaume de Machaut). Im Weltbild und Bildungssystem des antiken Griechenlands kam dieser breit verstandenen „musikè“ ein hoher Stellenwert zu. Sie, die in den Mythen als von göttlichem Ursprung ausgewiesen wurde, begründete Pythagoras von Samos im 6. Jahrhundert v. u. Z. als naturwissenschaftliche und kosmologische Disziplin, die als solche bis in die europäische Neuzeit Gültigkeit hatte und auch im Bildungskanon lange eine erstrangige Stellung einnahm. Dabei überstrahlte die Musiktheorie die Musikpraxis bei weitem, und noch um 1'000 n. u. Z. beschimpfte Guido d’Arezzo Sänger (Instrumentalisten galten sowieso als des Teufels), die nicht wüssten, was sie tun, wenn sie singen, das heißt die Musiktheorie und die Gesetze der Musik nicht beherrschten, als auf der Ebene von Tieren sich Befindende. Sokrates, Platon und Aristoteles wollten das erzieherische Potential der „musikè“ für das staatliche und private Leben nutzen. In der Politeia lesen wir hierzu erstaunliche Thesen. Die musikalische Erziehung müsse sehr früh beginnen und der gymnastischen vorangehen, dann aber mit ihr zusammen den senkrechten Staatsbürger formen. Im optimalen Zusammenspiel der eben genannten Parameter der „musikè“ entstehe das Ethos, das in die Seele der Hörer (von den Frauen ist bei Platon nur negativ die Rede, und Aristoteles bezweifelte ja allen Ernstes, ob Frauen überhaupt zum menschlichen Geschlecht gezählt werden könnten ...) eindringe und sie bilde. Dafür kämen eigentlich nur die (für simple einstimmige Melodien taugende! AH) männlich-besonnenen und maßvollen Lyra und Kithara (Harfentypen) sowie die dazugehörige Tonart Dorisch in Frage. (Ich verwende etwas ahistorisch den modernen Begriff Tonart, Dorisch hingegen im altgriechischen Verständnis, was etwas ganz anderes bedeutet als das viel spätere byzantinisch-kirchentonartliche Dorisch!) Der aufreizende und überaus laute Klang des Doppelaulos, oft von wilden Bacchantinnen gespielt, und die damit korrespondierende barbarische Tonart Phrygisch werden von Sokrates/Platon als ungriechisch und geradezu unsittlich verworfen. Und dann folgt der ‚Hammer’ oder ein krasses Exempel für die apriorisch gesetzte Macht der Musik: Die althergebrachten Tonarten und ihre Instrumente zu verändern bedeute, die staatliche Ordnung zu gefährden. Der angebliche Revolutionär Sokrates (oder doch wohl eher Platon, der seinem Lehrer vielleicht seine eigenen reaktionären Haltungen in den Mund legte, denn wie Pythagoras und Christus hat ja Sokrates kein 5 einziges Wort schriftlich festgehalten), Platon also erweist sich als Innovationsverächter sowie als philosophischer Propagator und Bewahrer der herrschenden Verhältnisse. Im Wortlaut und als Conclusio nach einem langen sokratischen Scheindialog lesen wir in der Politeia (ich übersetze): „Daran müssen die Leiter der Stadt festhalten und dürfen es nicht in Vergessenheit und Verfall geraten lassen, sondern müssen unbedingt darüber wachen, dass keine gegen die Ordnung verstoßende Neuerung eingeführt werde in Bezug auf die musikè, sondern dass es bei dem Bestehenden verbleibe. Denn eine neue Art von musikè einzuführen, muss man sich hüten, weil es das Ganze gefährdet. Denn nirgends werden die Arten der musikè verändert, ohne die wichtigsten staatlichen Gesetze zu verändern.“ Seit der Politeia sollten solche Mahnrufe übrigens immer wieder erschallen, in den letzten hundert Jahren beim Aufkommen des Jazz, der atonalen Musik, des „Rock and Roll“ oder des „Hip-Hop“. Inwieweit Musik als Macht- und Disziplinierungsmittel im griechischen Alltag indes tatsächlich funktionierte, ist umstritten. Es handelte sich wohl eher um eine akademischphilosophische Diskussion ohne praktischen Nutzen. Über die reale Musik in jener Zeit wissen wir herzlich wenig; was auf uns gekommen ist, sind Fragmente, die alle zusammen ca. fünfzig Minuten dauern. Der römische Gelehrte und Staatsmann Varro (116–27 v. u. Z.), wichtiger Vermittler des griechischen Wissens an sein Land, setzte die „musica“ als Teil der „artes liberales“ durch, der Disziplinen, die zu studieren eines freien Römers würdig waren. Ebenso in der griechischen Tradition standen in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten Ptolemaios, Boëthius und Augustinus, der explizit vorschlug, Musik als Erziehungsmittel in den Dienst der Katholischen Kirche zu stellen. Und das machte diese auch bald mit z. T. durchschlagendem Erfolg: Europäische Kunstmusik entwickelte sich in der Folge als rein katholische Kirchenmusik mit außerordentlich rigiden Vorschriften und verteidigte ihre Position als solche bis zur Reformation. Diese Aussage bezieht sich auch auf die musikalische Ausbildung: „Soweit Musik durch Unterricht kontrolliert, entwickelt und vermittelt wurde, geschah dies unter ihrer exklusiven Inanspruchnahme ‚ad maiorem gloriam dei‘ – et ecclesiae.“8 Einige Stichworte zu den kirchlichen Musikvorschriften: Musik darf allein das Wort Gottes unterstützen, hat also keine autonome Dimension und dient wie immer schon dem Kult und der Repräsentation. Musik ist idealiter einstimmig, unbegleitet, einfach und freirhythmisch sich dem Wort anschmiegend: der sogenannte „Gregorianische Choral“, der nach kirchlicher Lehre Papst Gregor direkt vom Heiligen Geist ins Ohr gesungen wurde; aufschreiben musste diese Gesänge aber ein Mönch, denn Päpste und Könige pflegten lange Zeit nicht lesen und schreiben zu können geschweige denn die Notenschrift zu beherrschen, die allerdings zur 6 Zeit von Gregor dem Großen noch gar nicht erfunden war ... In Tat und Wahrheit hatte Gregor (wie weiland David mit den sogenannten „Psalmen Davids“) mit dem Choral schöpferisch gar nichts zu tun; dieser war eine gigantische Kollektivleistung anonymer Mönche und Nonnen mit weltlichen Einflüssen und vor allem Wurzeln, die allesamt vorchristlichen mediterranen (jüdischen, syrischen, hellenistischen usw.) Kulturen entsprossen. Instrumente, an Tanz erinnernde Rhythmen und die Beteiligung der Frauen sind in der Kirchenmusik strikt verboten. Sie werden nur in der auf tiefstem Niveau stehenden und von der Elite verachteten Volks- und Tanzmusik geduldet. Damit wird die Einheit der „musikè“ aufgegeben und die jahrtausendlange zentrale Musikausübung von Frauen sistiert. Die Frauenverachtung kommt wie gesagt philosophisch von Aristoteles her, nicht etwa von Paulus, der allerdings ebenfalls ein armer Sexualneurotiker war („mulier taceat in ecclesia“); aber auch alle Kirchenväter warnten vor der Süße der Frauenstimmen, die nichts weniger als das Lob Gottes im Sinne hätten, sondern einzig die frommen und sittsamen Männer verführen wollten mit Hilfe der mächtigen Musik ... Die Angst vor der Frau führte später zum Kastratenunwesen, denn auf hohe Töne wollte man mit der permanenten Ausweitung des Tonraumes nicht verzichten; damit wurde das Verbrechen an den Frauen zum Verbrechen an Knaben ausgedehnt. In Italien wurden zwischen ca. 1500 und 1871 (erst in diesem Jahr wurde es endlich verboten) mehr als hunderttausend Knaben kastriert, meistens nur auf Vorrat, weil sie ihre schöne Knabenstimme nicht ins Erwachsenenalter hinüber retten konnten, und Frauen durften ebendort erst im 20. Jahrhundert in den Kirchenchören mitsingen. Nur die Kirchentonarten sind gestattet, ihre Veränderung ist strikte verboten (Platon lässt grüßen), Chromatik und Transposition sind ebenso des Teufels wie bestimmte Intervalle (Tritonus = „Diabolus in musica“!); die Melodien dürfen eine Oktave nicht überschreiten usw. usf. Unbotmäßige Komponisten standen immer unter dem Damoklesschwert der Exkommunikation als mildester Strafe. Die erste Mehrstimmigkeit entwickelte sich pointiert gesagt aus der Angst der Mönche vor dem Teufel bzw. eben vor dem Tritonus, denn die ersten Gesetze zur echten Mehrstimmigkeit behandeln nur Stimmführungen, mit denen der Tritonus vermieden werden kann. Bis Ende des 16. Jahrhunderts musste alle große Musik zudem mit perfekten Intervallen beginnen und schließen, im Ganzen wie in Teilabschnitten. Wiederum lässt Pythagoras grüßen. Die fortlaufende Verfeinerung der Musik lässt sich übrigens als gewaltige Sublimierungsleistung der Mönche deuten, denen außer exzessivem Essen fast alles 7 verboten war, was Genuss bereitet, und die ihre Wünsche und überschüssigen Energien deshalb in prächtigster Musik und Illumination der Handschriften realisierten und auslebten. Interessanterweise kamen aber Eingriffe in die Kirchenmusik nicht nur von Päpsten, sondern auch von weltlichen Herrschern. Es ging immer darum, den künstlerischen Wildwuchs zu beschneiden und auszurotten, um mit einer einheitlichen Liturgie samt Kirchenmusik auch die Einheit in Kirche und Reich zu gewährleisten (Gregor, Karl der Große, Karl V., Konzil von Trento usw.). Karl der Große etwa war von größtem Einfluss auf die Entwicklung der europäischen Musik, weil er alle damals existierenden gregorianischen Dialekte verbot und einen einzigen zur musikalischen Hochsprache erhob – eigentlich ein Verbrechen, aber auch die Grundlage für eine europaweit ausstrahlende geballte Entwicklung der Musik. Zudem ermöglichte seine Schriftreform letztlich auch die Erfindung der Notenschrift, die erste von nur zwei zentralen Revolutionen in der europäischen Musikgeschichte. Vereinheitlichung und Einschränkung provozieren immer auch ein Neuschaffen, eine Anstachelung der kompositorischen Phantasie durch den Widerstand von und gegen Regeln und Grenzen. Regeln im Verein mit Notationsmöglichkeiten bilden zudem die Voraussetzung für die Verbreitung und das Erlernen von Standards, wie sie gleichzeitig dazu herausfordern, gebrochen zu werden! In der Praxis wurde deshalb trotz der Verbote immer transponiert, chromatisiert, wurden Instrumente einbezogen, was durch ihre sporadische Verdammung in päpstlichen Bullen belegt wird, und die strikten Intervallvorschriften durchbrochen. Die größten Komponisten/innen, die allesamt bis in die Neuzeit geistlichen Standes waren (Frauen durften natürlich nicht komponieren, mit einer Ausnahme: wenn sie Nonnen waren; nach der großen Hildegard von Bingen war es aber auch damit vorbei, denn sie wurde den Männern zu mächtig), zeichneten sich dadurch aus, dass ihnen die Quadratur des Zirkels gelungen ist, nämlich Kirchenmusik zu schreiben und dennoch ihre künstlerische Autonomie zu wahren. Längst war der Ton nicht mehr die gehorsame Tochter des heiligen Worts, sondern die Differenzierung und Verkomplizierung der musikalischen Strukturen ließen den Text bis zur Nichtverstehbarkeit in den Hintergrund treten. Die Päpste, nicht immer dumm, haben die subtil-häretischen Absichten gemerkt – oder hatten gute Berater – und pfiffen die Verwegenen immer wieder zurück (z. B. durch die berühmte Bulle Johannes‘ XXII. „Docta sanctorum“ von 1322 als Bannstrahl gegen die sogenannte „ars nova“). Es fruchtete jeweils nur kurze Zeit etwas und galt nur für Italien, denn je näher beim Papst, desto gehorsamer die Komponisten! Erst mit dem Konzil von Trento im 16. Jahrhundert gelang es der Kirchenhierarchie, ihre Vorstellungen von Kirchenmusik auf Dauer durchzusetzen, weil in der Reformationszeit einmal mehr Musik und Liturgie für die 8 Vereinheitlichungstendenz und als Bollwerk gegen die neuen Religionen herhalten mussten. Mehr als 5'000 „Sequenzen“, das größte wirklich neue Répertoire innerhalb der katholischen Einstimmigkeit, das sich über 600 Jahre aufgebaut hat, wurden damals verboten, nur vier zugelassen – ein ungeheuerliches Verbrechen an der menschlichen Phantasie und Individualität. Resultat der rigiden Tridentiner Reform: Die katholisch-approbierte Kirchenmusik, bislang Trägerin des trotz aller Eingriffe kompositorischen Fortschritts über Jahrhunderte, vor allem in der Entwicklung der Mehrstimmigkeit, einer einmaligen, wenn auch elitären Kulturleistung, die als solche von Petrarca neben die gotischen Kathedralen gestellt wurde – diese an sich großartige Kirchenmusik koppelte sich sofort von der weiteren Entwicklung ab und sank schnell in die Bedeutungslosigkeit, in der sie bis heute verharrt. Die Lockerung der strengen Tridentiner Norm wurde erst im Vaticanum II möglich, der neue Papst Ratzinger von Altötting – Sie konnten es kürzlich lesen – will hingegen die Schraube wieder anziehen – alle Reaktionäre innerhalb der Kirche freuen sich schon jetzt. Was hier anhand der Katholischen Kirche vorgebracht wurde, gilt auch für andere institutionalisierte Religionen. Martin Luther, „einer der bedeutendsten Ahnherren deutschen Musikunterrichts“9, erkannte wie die bislang genannten Philosophen und Theologen die volkserzieherischen Möglichkeiten der Musik und bezog sie geschickt in seine Arbeit ein: „Musica ist eine halbe Disziplin und Zuchtmeisterin, so die Leute gelinder und sanftmüthiger, sittsamer und vernünftiger machet. […] Musicam habe ich allzeit lieb gehabt. Man muss Musicam von Noth wegen in Schulen behalten. Ein Schulmeister muss singen können, sonst sehe ich ihn nicht an.“10 Ob in der Kirche oder später in der Volksschule: Musik wurde bis vor kurzem nicht als autonome Kunst und autonomer Bildungswert gelehrt, sondern als „Zuchtmeisterin“ eingesetzt und, in der Lutherischen Kirche, auf die Unterweisung im Kirchengesang als einem wichtigen Mittel sowohl für die Ausbreitung der Reformation wie für die sonntägliche Liturgie reduziert. Mit Musik kämpfte man also sowohl für die Reformation wie für die Gegenreformation! Und die Legitimation für den Musikunterricht im schulischen Fächerkanon heute folgt immer noch der lutherischen Argumentation: Musik mache sozialer, friedfertiger, intelligenter, konzentrierter und weiß der Kuckuck was noch alles. In der „Schule der Nationalerziehung und volkstümlichen Bildung“ im 19. Jahrhundert wurde die kirchliche Indoktrination mittels Musik von der ebensolchen politischen abgelöst oder ergänzt. Der einstmals aufgeklärte und revolutionär gesinnte Ehrenbürger der Französischen Republik, Johann Heinrich Pestalozzi, wie Luther von ähnlich großem Einfluss auf den Musikunterricht, schrieb mit lerntheoretisch moderner, aber gesinnungsmäßig reaktionärer Stoßrichtung: „Dass die Jahrtausende der Kunst uns noch nicht einmal dahin gebracht haben, an den Ammengesang für den Säugling eine 9 Stuffenfolge von Nationalgesängen anzuketten, die auch in den Hütten des Volks sich vom sanften Wiegengesang bis zum hohen Gesang der Gottesverehrung erheben würden. Doch ich kann diese Lüke nicht ausfüllen, ich muss sie nur berühren.“11 Eine andere Tatsache, die mit der Schweiz zu tun hat: Alphornblasen war um 1848 überall in der Schweiz praktisch ausgestorben wie bald darauf die Steinböcke. Trotz langen Suchens auf Geheiß der ersten Bundesräte fand man nur noch sechs Spieler in der ganzen Eidgenossenschaft. Als schweizerisches Identifikationsmittel wurde das Alphorn im jungen Bundesstaat sofort planmäßig gefördert, von Staates wegen und mit Hilfe der sechs letzten Mohikaner gelehrt und so allmählich wieder hochgekurbelt. (Die Franzosen hatten im Mittelalter die komplexeste Musik aller Nationen, die Schweizer die einfachsten Töne und Melodien, die des Alphorns – Musik also als Spiegel des Entwicklungsstandes eines Volkes oder einer Nation ... Und dazu passt, dass sich Bundesräte bis heute gerne im Umfeld banalster Musik feiern lassen.) Oder: In der deutschen Volksschule sollten gegen Ende des 19. Jahrhunderts mehr und mehr mit Hilfe von ‚Volks’- und (neu) Militärliedern patriotische Untertanen herangezüchtet werden. Es hat offenbar nicht viel gefruchtet: Im Sommer des Kriegsjahres 1915 veröffentlichte der österreichische Landesschulrat einen Erlass über den Gesang beim Heere. Es heißt darin: „Während des Kriegszustandes ist von allen Seiten die betrübende Wahrnehmung gemacht worden, dass gerade die deutsch-österreichischen Soldaten im Vergleiche zu denen anderer Länder liederarm genannt werden müssen. Es sind nur wenige Lieder, die sie anstimmen können, und selbst bei diesen wenigen versagt die Kenntnis des Textes schon bei der zweiten und dritten Strophe. Daher singt überhaupt nur ein kleines Häuflein unter den marschierenden Truppen, und auch dies verstummt bald oder hilft sich durch Anstimmen von Gassenhauern, die zur Stimmung, in welcher die Soldaten marschieren, durchaus nicht passen. Die Tatsache ist darauf zurückzuführen, dass der Gesangsunterricht in den Volks- und Bürgerschulen nicht überall planmäßig und zielbewusst betrieben wird. Die Bezirksschulräte werden daher angewiesen, [...] einen sorgsam ausgewählten Schatz von Volks-, insbesondere von Marsch- und Soldatenliedern festzustellen und dahin zu wirken, dass von diesen Liedern alle Strophen [...] gesungen und fest eingeprägt werden.“12 Der Erlass kam zu spät, denn bekanntlich ging der Krieg für Deutschland-Österreich verloren ... In der Schweiz wurden solche Positionen begeistert aufgenommen und auch lange praktiziert; ich selbst habe an einer aargauischen Bezirksschule zwei Jahre lang mit wenigen Ausnahmen im Singunterricht die ewiggleichen Soldatenlieder, meistens in Nazideutschland komponiert, singen müssen. Jede Woche (ich übertreibe nicht) „Lasst hören aus alter Zeit“ und „Heißt ein Haus zum 10 Schweizer Degen“ u. ä. singen zu müssen kann aber nur mit systematischer Folter verglichen werden. Nun, ich habe trotz dieses zugunsten systematischer Indoktrinierung nichtstattgefundenen Singunterrichts geschweige denn Musikunterrichts später dennoch Musik studiert ... Militärmusik und -lieder habe ich genannt. Nun, es gab schon früh Instrumente, die als Militärinstrumente in höchstem Ansehen standen und durch Handel nicht erworben werden konnten, sondern nur als Geschenk bei Staatsbesuchen oder als Beute in einer Schlacht die Landesgrenzen überquerten. Ein Beispiel dafür sind die alten Tuben, die bereits im alten Persien bekannt waren, ein anderes ab dem Mittelalter die Trompeten bzw. die früheren Äquivalente, die nur im Krieg oder bei Repräsentationsveranstaltungen eingesetzt werden durften und bald strengen Zunftregeln unterworfen wurden. Übrigens: Die Orgel, im alten Rom alles andere als ein kirchliches Instrument, bekam Pippin der Kleine, der Vater Karls des Großen, bei einem Besuch vom oströmischen Kaiser geschenkt und brachte sie heim ins Frankenreich, von wo sie sich sofort in ganz Europa ausbreitete und zum einzigen von der Kirche geduldeten Instrument wurde. Wurden im „circus maximus“ einst zu Orgelklängen Christen zu Tode gebracht, erfreute das Instrument jetzt die Christen in der sonntäglichen Liturgie. Pointiert kann man sagen, dass Musik und Instrumente jahrtausendlang entweder von religiösen oder staatlichen inkl. militärischer Institutionen oder von beiden vereinnahmt wurden. Um eine persische oder hebräische Tuba blasen zu dürfen, musste man deshalb Priester oder Offizier sein! Germanische und eidgenössische Soldaten waren bekannt für ihr markerschütterndes Geschrei; sie haben die Feinde manchmal bereits damit in die Flucht geschlagen, bevor sie mit der Waffe zulangen mussten. Militärmusik begann hier auf einem tiefen Niveau und (Achtung: Provokation) blieb meistens auf diesem sitzen! (Ich möchte nicht missverstanden werden: Auch wenn ich gegen jegliche Militärmusik bin, und spiele sie in der friedlichen Schweiz, schätze ich natürlich gewisse Musik für zivile Blasorchester!) Kunstcharakter hingegen reklamierten Schlachtenmusiken, die seit der berühmten La Bataille (oder La Guerre de Marignan) von Clément Janequin (sie wird im ersten Konzert zu dieser Reihe aufgeführt und lobpreist den Sieg von François I. über die Schweizer Söldner bei Melegnano, fälschlicherweise als Marignano bekannt) – die seither also formal alle gleich aussehen: 1) Beschreibung des Anlasses, Nennung der Kontrahenten, deren Aufzug, 2) Nachahmung der Schlacht und des Schlachtenlärms (bei Janequin mit rein vokalen Mitteln, bei Ludwig van Beethoven und Pëtr Il’ič Čajkovskij mit echten Gewehr- und Kanonenschüssen), 3) Siegeshymne. Bei Janequin hört man allerdings ganz am Schluss noch das Wimmern der verletzten Söldner in verballhorntem Schweizerdeutsch, dem ersten in der Kunstmusik und lange Zeit einzigen bis zur Engelberger Talhochzeit. Eine ungemeine kunstvolle Chanson (allem, was danach kommt, haushoch 11 überlegen) und dennoch eine höchst fragwürdige, denn vielleicht haben Sie gemerkt, dass ich jeden Missbrauch der Musik, jede Missachtung ihrer Autonomie, jede Inanspruchnahme und jedes Ausnützen ihrer großartigen biophilen Kraft für das Gottes- oder Herrscherlob, für die Aufstachelung der Soldaten im Krieg, für die Lenkung der Menschen generell ablehne, wenn ich es auch historisch nachvollziehen kann und wenn es auch Beispiele gibt, die gerechtfertigt sein mögen, aber das ist gefährliches Terrain. Den stumpfsinnigen und die Soldaten als Schlachtvieh in den Krieg und den Tod treibenden Militärmärschen ist es auf der anderen Seite zu verdanken, dass sie auf hohem Niveau in die Kunstmusik eindrangen und bei Mahler und Berg mit negativen Vorzeichen zu erschütternden Anklagen gegen Gewalt, Krieg und Unterdrückung mutierten. Ich habe bislang allerdings auch Fragezeichen zur behaupteten direkten Macht der Musik als Erziehungs- und Disziplinierungsmittel gemacht, obwohl sie in der Katholischen Kirche nachweislich lange Zeit so funktioniert hat. Die direkte Auswirkung eines einzigen Liedes (das Geheul der Schweizer Söldner wollen wir mal nicht als Lied oder wohlgeordnete Musik bezeichnen, auch nicht die späten Ableger davon in den Anfeuerungsrufen bei Fußballgesängen, die zeigen, wie schnell mit Hilfe der gefährlichen Musik – gefährlich, weil sie ohne Text semantisch undefinierbar bleibt und deshalb leicht zu Manipulationszwecken eingesetzt werden kann – der Verstand ausgeschaltet werden kann und Zehntausende von Menschen in kurzer Zeit zu einem Kollektiv zusammengeschweißt werden können) – die direkte Auswirkung also mindestens eines Liedes, eines Marschliedes gar, vor den Liedern in der Arbeiterbewegungen steht für die Marseillaise fest. Sie gehört zu jener raren Musik, die widerständig und revolutionär wirken konnte, aber hier leider aus Zeitgründen nicht behandelt werden kann, obwohl ich mich für sie besonders interessiere. (Ein Auszug aus meinem großen Aufsatz über die Marseillaise findet sich am Schluss des Referatstextes.) Die weltliche Kunstmusik, die sich in Europa maßgeblich erst nach der Reformation entwickeln konnte, war bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert im wesentlichen eine Angelegenheit der schmalen weltlichen Herrschaftsschicht, der in Musik oft mit Erfolg dilettierenden Aristokratie, die immer das Neueste hören wollte und dieses meistens auch als solches wahrnehmen konnte. Tausende von Eingriffen in die kompositorische Arbeit sind indes auch hier belegt; die Knebelung der menschlichen Phantasie und künstlerischen Arbeit ging also munter weiter. Die Komponisten, nun meistens nicht mehr geistlichen Standes, hatten zwar wie die Mönche früher eine gesicherte Existenz, mussten sich aber wie diese genauso immer wieder unterordnen und Eingriffe in ihre künstlerische Autonomie gefallen lassen und versuchten dennoch immer wieder, dagegen anzuschreiben. Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn und Wolfgang Amadé Mozart sind hier die wichtigsten Beispiele. Einige kamen bei Dienstvergehen ins Gefängnis (z. B. Bach) und wurden gar zum Tode 12 verurteilt. Ausübenden Musiker (z. B. Trompetern) wurden gelegentlich die Zähne herausgeschlagen ... Die Verachtung der Frauen und ihr Ausschluss von der Musikausübung ging in allen anderen Religionen und gesellschaftlichen Systemen munter weiter (die französische Aristokratie war allerdings relativ liberal; so zählte der „Sonnenkönig“ in seinem fast nur mit China zu vergleichenden Musikapparat eine Komponistin zu seinen Lieblingstonschöpfern/innen). Die aufgeklärten Engländer haben zwar gegen das Kastratenwesen gekämpft, setzten aber in der Kirche und im Konzertsaal Knabensoprane und falsettierende Altisten ein, sicher aber keine Sängerinnen. Das Kastratenunwesen griff auf die Oper über, und der absolute Star auf der Bühne war bis zu Gioacchino Rossini und Gaetano Donizetti der Kastrat mit Honoraren, die sich durchaus mit denen der heutigen Superstars messen können. Die freie Existenz des Künstlers nach der Französischen Revolution war nur eine scheinbare; der bürgerliche Geschmack, von keiner Fachkenntnis getrübt, regredierte, das Musikmuseum wurde erfunden und die wichtigsten lebenden Komponisten daraus verbannt. Oder anders gesagt: Die Bourgeoisie ließ sie in Freiheit zugrunde gehen. Mozart ist kein gutes Beispiel dafür, denn er hat als freier Komponist Unsummen verdient, sie aber für Unsinn ausgegeben und verspielt. Franz Schubert hingegen ist vielleicht der betrüblichste Fall dafür, wie ein großer Komponist auf dem ‚freien’ Markt unterliegen konnte, gerade weil er nicht den Massengeschmack befriedigte, sondern mit seiner Musik hohe Ansprüche stellte und die herrschenden Verhältnisse attackierte. Georg Friedrich Händel stellte im Gegensatz dazu das erfolgreichste und früheste Beispiel für einen freien Komponisten dar. Ausnahmen waren auch Beethoven und Richard Wagner, die großen Schnorrer (im jiddischen Sinne) und Pumpgenies: Sie lehnten Aristokratie und Bourgeoisie zwar vehement ab (Beethoven sympathisierte mit der jakobinischen Revolution, Wagner war lange Zeit Bakunin-Anhänger und hat 1848 gemeinsam mit ihm auf den Barrikaden Dresdens gekämpft), ließen sich aber ungeniert von ihnen aushalten. Dann kam die zweite zentrale Musikrevolution, die Elektrifizierung der Musik und der Übergang zur ihrer massenmedialen Verwertung. Musik wurde zur Ware und den Marktgesetzen unterworfen. Und als solche hat sie nun seit einigen Jahrzehnten die größte Macht, seit es Menschen überhaupt gibt. Mit Musik lässt sich sehr viel Geld verdienen, und das Geschäft mit der Musik gehört zu den wichtigsten in den kapitalistischen Ländern. Mit Musik kann man heute die Menschen indes auch äußerst subtil gängeln, beeinflussen, lenken, abdämpfen, ruhig halten, entpolitisieren, unterdrücken. (Das schildert beeindruckend die große kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood in ihrem Report der Magd). 13 Und immer noch greifen Herrschaftssysteme direkt in die Musik ein, maßregeln die Komponisten/innen, verordnen den Musikgeschmack. Sei es die Musikpolitik im Dritten Reich, der Sozialrealismus der Sovjetunion oder die Bestrebungen in der chinesischen Kulturrevolution: Überall wurden abweichende, autonome, kühne Komponisten/innen gemaßregelt, auf den staatlichen Kurs gebracht, zur Emigration gezwungen oder gleich eingesperrt oder getötet. Musikalischer Unverstand, Populismus, Kitsch triumphierten; ich bringe kein Beispiel von erlaubter Musik aus diesen Diktaturen, weil ich Ihnen und mir diese Ungeheuerlichkeit nicht zumuten will. Aber Achtung: Der sogenannte ‚freie’, in Wahrheit vom Markt geregelte Musikgeschmack in den ach so freien Demokratien ist der gleiche wie der in den genannten Diktaturen. So kennt pratisch niemand im Westen die radikale Vierte Symphonie von Dmitrij Šostakovič, für die er fast zum Tode verurteilt worden wäre, wenn er sie nicht zurückgezogen hätte, aber sehr viele hören sich im Westen mit größter Begeisterung seine Fünfte an, die „Antwort eines Sovjetkünstlers auf berechtigte Kritik“, die auch Stalin über alles gefiel, der dem eben Gemaßregelten für sie den höchsten Orden verlieh. Und was einflussreiche Musikpolitiker in der Schweiz wie Paul Sacher und Willy Schuh nach dem Zweiten Weltkrieg mit Komponisten machten, die zwölftönig schrieben, ist absolut vergleichbar mit den Eingriffen in den bekannten Diktaturen und beruht auf dem gleichen Geschmack, der komplexe Musik als „entartet“ bezeichnete und verdammte. Immer noch dient Musik Repräsentationszwecken bei Staats- und Sportanlässen, dem Militär, der Selbstdarstellung der Herrschenden. Die Oper ist seit vierhundert Jahren die teuerste musikalische Ideologie-, Herrschaftsbehauptung- und Selbstdarstellungsmaschine überhaupt. (Siehe die eben zu verfolgende Diskussion um die absurd hohe Subventionierung des Zürcher Opernhauses, das ganz und gar den bürgerlichen Massengeschmack widerspiegelt, widerspiegeln muss, sollen die Sponsoren weiter für ihre Selbstdarstellung und den ehemaligen Olivetti-Verkäufer Pereira zahlen. Das Opernhaus Hannover hat hingegen aufrüttelnd-kritische Inszenierungen vor vier oder fünf Jahren zu produzieren begonnen und verlor danach in kurzer Zeit Tausende von Abonnenten/innen!) Politiker wie unsere Bundesräte haben, wenn überhaupt, indes einen simplen Musikgeschmack und freuen sich ungemein, wenn sie einen eigenen Marsch bekommen und das Armeespiel dann noch selbst dirigieren dürfen. Die Zeiten, wo ein Herrscher wie Friedrich der Große viel von Musik verstand und auch ab und zu ein anspruchsvolles Buch las, sind längst vorbei, aber jene Zeiten waren auch nicht besser, die Unterdrückung nicht geringer ... Ich könnte endlos weiterfahren, muss aber schleunigst zum Schluss kommen. Musik ist heute die stärkste ästhetische und sozioökonomische Wirklichkeit und betrifft alle Menschen – einerseits durch die vielfältigen Möglichkeiten aktiven Musizierens, bewussten Hörens 14 von Musik verschiedenster Art und anderer Verhaltensweisen, andererseits durch ihre stetige Verfügbarkeit, massenmediale Allgegenwart und ihre manipulativen13 Möglichkeiten. Wir sind, ob wir wollen oder nicht, fast überall von Musik umgeben und begleitet: von der Wiege bis zur Bahre, vom täglichen Erwachen bis zum Einschlafen, im Einkaufszentrum, bei der Arbeit, im Flugzeug und beim Zahnarzt; wir sind gezwungen, im Restaurant mit Musik zu essen, und müssen sie gar auf dem stillen Örtchen hören – und die meiste Musik konsumieren wir bei Fernsehsendungen, Werbespots und Spielfilmen. Das läppert sich für die überwiegende Mehrheit der Menschen jeden Tag zu einigen Stunden bewusster und insbesondere unbewusster Musikaufnahme zusammen. Nur wer in seinen eigenen vier Wänden bleibt und die Apparate ausschaltet, kann ihr entfliehen, es sei denn, die Wände seien so dünn, dass sie die Musik der Nachbarn durchlassen ... Man könnte weiterfahren: Mit Musik, vorwiegend von Antonio Vivaldi oder Mozart, geben Kühe angeblich mehr Milch, und, wie Frances Rauscher herausgefunden haben will, lernen Ratten, vorausgesetzt, sie werden schon pränatal mit Mozart beschallt, als Babys schneller und orientieren sich besser als Artgenossen, die in den ersten Lebenswochen ohne Musik waren usw. Die mehrdeutige musikalische Realität, ästhetisches, intellektuelles und sinnliches Potential der Musik hier, gigantische Manipulationsmöglichkeiten durch Musik dort, begründet geradezu ein Menschenrecht auf Fremdbestimmung musikalische zu bekämpfen, Bildung, Freiheit auf Unterricht in der Wahl gewinnen und zu Musik, um musikalische differenzierte Auseinandersetzung mit und selbstbestimmten Genuss von Musik in vielen bewusst ausgeübten Formen zu fördern. Die meisten von Ihnen haben mit Bildung zu tun; ich kann Sie nur dazu aufrufen, dafür zu kämpfen, dass die Musik im Bildungskanon aus autonomen und humanen Gründen wichtig bleibt bzw. wird, damit sie ihre biophile Kraft für alle entfalten kann und mit ihr, abgesehen von der Urzeit der Menschheit, endlich nicht mehr manipuliert und unterdrückt werden kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. ANHANG: Zur Marseillaise14 „Hymnen, das sind jene abscheulichen Ausflüsse nationaler Borniertheit, jene musikalischen Inkarnationen reaktionärer Gemeinschaftlichkeit, wie sie in beinahe allen Ländern der Erde bei offiziellen Anlässen zum höheren Lobe niederen gesellschaftlichen Bewusstseins zelebriert werden. Kaum eine ist darunter, die musikalisch von Interesse wäre, kaum eine, die nicht an den Stumpfsinn, dem sie sich verdankt, auch musikalisch appellieren würde.“ An diesem von Konrad Boehmer trefflich gegeißelten Hymnenunwesen15 hat die Marseillaise wenig teil: Sie ist die einzige historische Nationalhymne, die spontan – wohl in der Nacht vom 25. zum 26. April 1792, kurz nach der 15 Kriegserklärung Frankreichs an das die Invasion vorbereitende Österreich – entstanden war, nicht irgendeiner Obrigkeit huldigte, sondern die Sache des Volkes vertrat, deshalb auch sofort ‚von unten‘, von breitesten Volksschichten übernommen, verändert und zum Ausdruck der eigenen kollektiven Bedürfnisse gemacht wurde sowie in Text und Musik einen aufrührerischen Impetus hatte, der heute noch nachempfunden werden kann. Musikalisch von (für Hymnen ebenfalls rarem) hohem Rang, war sie also nicht nur das säkularisierte Te Deum, sondern, um Ernst Blochs Wort über das Trompetensignal im Fidelio abzuwandeln, weit mehr „Dies irae“ für die Mächtigen und „Tuba mirum spargens sonum“ für die Unterdrückten und Freiheitsdurstigen. Endlich eröffnete sie – wie Georg Knepler festgestellt hat – als „genialer Entwurf“ die Entwicklung zu einem neuartigen leidenschaftlich-pathetischen Ton in den französischen Revolutionsliedern und in der europäischen Musik des 19. Jahrhunderts. Ihre begeisternde Kraft war gewaltig, und ihre anstachelnde Funktion, äußerlich offenbar nur mit dem Schlachtgebrüll z. B. der Schweizer in grauer Vorzeit vergleichbar, muss von militärischer Bedeutung gewesen sein. Im Lied „La Veuve du Républicain“ heißt es, dass durch den Gesang der Marseillaise „das Donnern der Kanonen übertönt“ worden sei, und ein preußischer Offizier schrieb im Herbst 1792: „Die französischen [Soldaten] begrüßten die Morgendämmerung – mit der schrecklichen Hymne der Marseiller. Die Wirkung dieser Hymne zu schildern, gesungen von Tausenden von Stimmen [und in so furchterregender Art begleitet], ist menschenunmöglich.“ Viele Zeugnisse woben an der Legende, dass während der Abwehrkämpfe der jungen Republik gegen die konterrevolutionären Armeen halb Europas und dann leider auch während der Kriege, die Napoléon I. zum Herrscher über Europa werden ließen, die Marseillaise mitgeholfen habe, die französischen Heere von Sieg zu Sieg zu führen. Lazare Carnot jedenfalls versicherte dem Wohlfahrtsausschuss: „La Marseillaise a donné 100'000 défenseurs à la patrie“, und andere Generale schrieben von der Front nach Hause: „Senden Sie tausend Mann Verstärkung oder tausend Exemplare der Marseillaise. […] Ohne die Marseillaise werde ich mich mit einem doppelt, mit der Marseillaise mit einem viermal so starken [Feind] schlagen. […] Wenn es nottat, eine feindliche Batterie im Sturm zu nehmen; wenn es galt, ein palisadenbewehrtes und mit Kanonen bestücktes Vorwerk zu stürmen; wenn unsere Regimenter vom Feuer der feindlichen Geschütze zerschlagen waren; wenn die Reihen der Infanterie zu wanken […] oder sogar zu weichen begannen, stellte sich ein Abgeordneter mit der Trikolore um den Leib oder ein General, [den Hut auf den Degen gespiesst], an die Spitze und stimmte mit starker Stimme die bekannte Strophe an: Allons enfants de la patrie oder die Strophe […] Amour sacré de la patrie. Und die Soldaten, von wilder Begeisterung gestärkt, 16 wiederholten das Lied, schlossen wieder die Reihen, warfen sich in den Kampf und eroberten die feindlichen Bastionen.“ Als Rouget de Lisle, der Schöpfer der Marseillaise, 1797 nach Hamburg kam, fühlte Friedrich Klopstock sich veranlasst zu fragen, warum ein so „schrecklicher Mann wie Rouget“ Deutschland betreten dürfe, da „sein Gesang doch 50'000 Deutsche erschlagen hat“, und prophezeite, dass die Sensenschneide der französischen Revolutionshymne als Schnitterin Tod „noch keineswegs abgestumpft“ sei. Ähnlich klagte August von Kotzebue den Marseillaise-Autor an: „Er ist ein grausamer Barbar, der mit seinem Lied unzählige meiner deutschen Brüder umgebracht hat.“ Die Tendenz, die Marseillaise zu instrumentalisieren und zu personalisieren, wird in den folgenden Zitaten noch deutlicher. So rapportierte Napoléon als junger General dem Direktorium ebenso stolz wie differenziert: „J'ai gagné la bataille, la Marseillaise commandait avec moi.“ Das hinderte ihn allerdings nicht daran, sie einige Jahre später zu verbieten! Napoléon III. fürchtete sie geradezu, erinnerte sich aber 1870 an ihre aufreizende Wirkung und ließ sie, um ihre Macht für seine Armee zu nutzen, vor dem deutsch-französischen Krieg wieder zu. Die oppositionellen Sozialisten jener Zeit reagierten mit Recht enttäuscht und verbittert, wenn auch etwas irrational: „Man lässt die Marseillaise singen, wie man vor der Schlacht Schnaps verteilt, um die Soldaten betrunken zu machen. Sollen sie doch die Marseillaise singen, wir wollen sie nicht mehr. Sie ist zum Feind übergelaufen.“ Ebenso entsetzt schrieb der Schriftsteller Jules Vallès: „Sie erfüllt mich mit Abscheu, Eure Marseillaise von heute. Sie ist zum Lobgesang des Staates geworden. Sie reißt keine Freiwilligen mit, sie führt Truppen an. Das ist nicht das Sturmläuten der wahren Begeisterung, das ist das Gebimmel am Halse des Schlachtviehs.“ Mit den Hinweisen auf Napoléon I. und III. ist schon angedeutet, was am Anfang der Republik der Musiksachverständige im Rat der Fünfhundert, Leclerc, ahnungsvoll voraussagte: „Die Marseillaise und das Lied Ça ira werden unsterblich bleiben, ganz gleich, welches Schicksal die Musik erfahren und welche Revolutionen sie erleben sollte. […] Gewiss, der Usurpator, der in zwanzig Jahren die gegenwärtige Regierung zu stürzen beabsichtigt, wird – sofern er auch nur das geringste Geschick besitzt – damit beginnen, die erwähnten elektrisierenden Gesänge ihrer Lebenskraft zu berauben, und, um sie besser ins ewige Vergessen zu tauchen, die Prinzipien umwerfen, nach denen sie komponiert wurden.“ Leclerc bekam gleich doppelt recht: Diktatoren wollten die Marseillaise ausradieren oder mit ihr ihre Herrschaft affirmieren lassen; ab und zu wurde sie auch von bürgerlich-konservativen Reaktionären 17 für chauvinistische Zwecke missbraucht; 1879 mauserte sie sich unter Berufung auf ein Gesetz von 1795 endgültig zur französischen Nationalhymne – und blieb trotz dieser Vereinnahmungen tönendes Symbol für den Kampf der Unterdrückten gegen ihre Unterdrückung. Auch das hat Goethe schon erkannt, wenn er es auch etwas salopp ausdrückte, „dass das Lied Allons, enfants etc. in keiner Sprache wohlhabenden Leuten ansteht, sondern bloß zum Trost und Aufmunterung der armen Teufel geschrieben und komponiert ist“. Zwar war die Marseillaise als einigender Kriegsgesang entstanden; sie rief aber zur Gegengewalt, zur Verteidigung der Freiheit gegen die Söldnerheere europäischer Monarchien auf, und als solche richtete sie sich an die vom Verlust der jungen Souveränität bedrohten Massen selber, die in ihrem eigenen Interesse sich zum Volksheer zusammenschließen sollten: Aux armes, citoyens! Zu den Waffen, Bürger! Formez vos bataillons! Bildet eure Bataillone! Marchez, marchez! Marschiert, marschiert! Es ging also letztlich nicht um männliche Kriegslust und männliches Auftrumpfen, sondern um den Drang aller nach Freiheit, und das spürte Napoléon I., erst einmal an der Macht, ganz genau, als er mit vielen Errungenschaften und Symbolen der Revolution auch die Marseillaise abschaffen und durch eine andere Hymne ersetzen wollte. Mit Ausnahme einer kurzen Zeit unter dem „Bürgerkönig“ Louis-Philippe und eben 1870 war es bis 1879 in Frankreich unter Androhung strenger Strafen verboten, die Marseillaise in der Öffentlichkeit zu singen. Auch diejenigen Menschen, die beim Begräbnis von Rouget de Lisle dessen Marseillaise vortrugen, machten etwas Gesetzwidriges! Nur in den Revolutionsjahren 1830, 1848 und 1871 (hier zusammen mit der ähnlich spontan entstandenen, künstlerisch wertvollen und symbolträchtigen Internationalen) wurde das Verbot bezeichnenderweise durchbrochen und die Marseillaise ebenso erneut zum Symbol der aufbegehrenden Französinnen und Franzosen, wie sie ihren Kampfgeist anzufachen wusste. Eduard Hanslick fasste die Wellenbewegung in ein treffendes Bild: „Von allen Regierungen niedergehalten, schnellte das Lied mit verdoppelter Federkraft bei jeder neuen Revolution empor, um dann mit dieser Revolution selbst wieder gemaßregelt zu werden.“ Berlioz erzählt in seinen Mémoires, wie er in der Julirevolution 1830 einmal auf der Straße einige Menschen aufforderte, die Marseillaise zu singen, und wie alsbald eine tausendköpfige Volksmenge mit solchem Enthusiasmus einstimmte, dass er selbst, von dem Eindruck überwältigt, ohnmächtig (sic!) zu Boden gefallen sei. Sein hypertrophes, aber kongeniales Arrangement der Marseillaise für großes Orchester, Solisten und Doppelchor ließ er mit der Aufforderung „Tout ce qui a une voix, un 18 cœur et du sang dans les vains“ und der Widmung „À l'auteur de cet hymne immortel“ wenige Wochen nach der Julirevolution in Paris drucken. Hanslick wiederum erlebte 1878 persönlich mit, wie das Volk das Singen der Marseillaise sich buchstäblich erzwang: „Die Blechmusik auf dem Wagen intonierte die Marseillaise, und das Volk, (zu Tausenden) Kopf an Kopf dichtgedrängt, singt sie begeistert mit. Jubelnder Hurrahruf nach jeder Strophe – ich weiss nicht, wie oft die Hymne wiederholt wurde. Auf anderen Plätzen dasselbe Schauspiel bis in die tiefe Nacht hinein.“ Oder ein anderer Augen- und Ohrenzeuge: „Die Wirkung war unbeschreiblich! Es war, als ginge ein einziger, mächtig magnetischer Strom durch die vielen hunderttausend menschlichen Wesen; als hätten mit einem Male nur die Gefühle der Freude, des Glücks und Entzückens Raum in ihrer Brust, als Alt und Jung, Groß und Klein in den Refrain mit einstimmten. Es war ein entzückendes Chaos jubelnder, schluchzender, einander umarmender, küssender Wesen; Männer und Frauen im Festkleid und Bluse, Greise und Jünglinge – umarmten sich im Übermaße ihrer Freude, als seien sie von nun an von dem furchtbaren Alpe der Reaktion und Tyrannei befreit.“ Weitere Belege dafür, dass die Botschaft der Marseillaise von den Herrschenden gefürchtet wurde und schwerlich für ihre Zwecke umfunktioniert werden konnte, aber auch dafür, dass ihr subversiver Sinn supranational und (bislang) zeitlos ist, sind ihre unzähligen Kontrafakturen weit über Frankreich hinaus. Unter den Hunderten von Neutextierungen – nur schon bis 1804 sind mehr als zweihundert nachgewiesen – gibt es kaum reaktionäre oder gar faschistische, dafür umso mehr Adaptionen der Arbeiterbewegungen verschiedener Länder. In Deutschland, wo das Singen der Marseillaise wie in Österreich bis 1848 auch untersagt war, entstanden so beispielsweise 1849 die Reveille („Frisch auf, zur Weise von Marseille“) von Ferdinand Freiligrath, 1864 die Arbeitermarseillaise von Jakob Audorf und ungefähr in der gleichen Zeit die Achtstunden-Marseillaise von Arbeiterdichter Ernst Klaar. Diese Textautoren mögen dabei vielleicht den Gedanken von Heinrich Heine aufgegriffen haben, der in Die Tendenz, dem dreizehnten seiner Zeitgedichte, 1842 aus Paris die deutschen Dichter mahnte: Deutscher Sänger! sing und preise Deutsche Freiheit, dass dein Lied Unsrer Seelen sich bemeistre Und zu Taten uns begeistre, In Marseillerhymnenweise! Girre nicht mehr wie ein Werther Welcher nur für Lotten glüht – 19 Was die Glocke hat geschlagen, Sollst du deinem Volke sagen, Rede Dolche, rede Schwerter Sei nicht mehr die weiche Flöte, Das idyllische Gemüt – Sei des Vaterlands Posaune, Sei Kanone, sei Kartause, Blase, schmettre, donnre, töte! Blase, schmettre, donnre täglich, Bis der letzte Dränger flieht – Singe nur in diese Richtung, Aber halte deine Dichtung Nur so allgemein als möglich. Anmerkungen 1 F. Schneider: Üben – was ist das eigentlich? (= Wege – Musikpädagogische Schriftenreihe, Bd. 3), Aarau 1992, Kapitel 1 (o. S.). 2 H. Gardner: Abschied vom IQ. Die Rahmen-Theorie der vielfachen Intelligenzen (Originalausgabe New York 1983/1985), Stuttgart 1991, S. 99/119f. 3 T. Volek 1971 (nach A. P. Merriam 1964), zit. nach M. Jenne: Musik Kommunikation Ideologie. Ein Beitrag zur Kritik der Musikpädagogik, Stuttgart 1977, S. 13. 4 P. Faltin, zit. nach R. Schneider: „Wert, Wertung, Werturteil im Musikunterricht“, in: Zeitschrift für Musikpädagogik, Heft 20/November 1982, S. 21–30, hier S. 27. 5 G. Picht 1972, zit. nach M. Jenne: a. a. O. (Anm. 4), S. 13. 6 F. Klausmeier: Die Lust sich musikalisch auszudrücken. Eine Einführung in sozio-musikalisches Verhalten, Reinbek 1978, S. 13f. (Hervorhebung AH) – ein Buch, das ich nur bedingt empfehlen kann. 7 Z. B. im dtv-Atlas zur Musik, neubearbeitete Ausgabe von 2003, S. 159. 8 M. Jenne: a. a. O. (Anm. 4), S. 127. 9 H. Hopf: „Zur Geschichte des Musikunterrichts“, in: Neues Handbuch der Schulmusik, hrsg. von E. Valentin u. a., Regensburg 1975 (= Bosse Musik Paperback, Bd. 6), S. 9–36, hier S. 9. Diesem Aufsatz ist dieser historische Rückblick in vielem verpflichtet. 10 Zit. nach H. Hopf: ebd., S. 9. 11 J. H. Pestalozzi: Sämtliche Werke, hrsg. von A. Buchenau u. a., Bd. 13: Schriften aus der Zeit von 1799 bis 1801, bearb. von H. Schönebaum u. a., Berlin und Leipzig 1932, S. 109 (aus: Die Methode. Eine Denkschrift Pestalozzi‘s, S. 101–125). Den Hinweis auf diese Schrift habe ich von H. Hopf: a. a. O. (Anm. 10), S. 10, bekommen. – Vgl. ähnliche Positionen in J. W. Goethes Wilhelm Meisters Wanderjahre, 2. Buch/1. Kapitel, wo eine Romanfigur den Gesang „als erste Stufe der Bildung“ bezeichnet und behauptet, Musikerziehung 20 erleichtere das Lernen in allen anderen Gebieten – eine Auffassung, mit der heute noch um die Erweiterung des Musikunterrichts gekämpft wird! 12 H. Löbmann: Volkslied und musikalische Volkserziehung, Leipzig 1916, S. 1 (Hervorhebung AH). C. Kehr kam 1871 noch zu einem genau umgekehrten Ergebnis: „Die poetische Gewalt des Gesanges der deutschen Stammesgenossen [sic!] hat sich besonders im letzten französischen Kriege gezeigt, den das französische Volk [sic!] liedlos geführt» (zit. nach H. Hopf: a. a. O. [Anm. 10], S. 14f.; vgl. auch S. 18) und, darf man wohl im Sinne Kehrs ergänzen, deshalb verloren hat ... 13 Vgl. M. Horkheimer/Th. W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente (Originalausgabe New York 1944), Frankfurt a. M. 1969, S. 272f. („Propaganda“) und passim; R. Fehling: Manipulation durch Musik. Das Beispiel ‚Funktionelle Musik’, München 1976; F. K. Prieberg: Musik und Macht, Mainz 1991 (= Fischer Taschenbücher, Bd. 10954); M. Geck: „Musik – ein dienstbarer Geist?“, in: Musik & Bildung, 24. Jg./Heft 5–September/Oktober 1992, S. 5–11 (dieses Heft ist zur Gänze dem Thema „Manipulation“ gewidmet und empfehlenswert, z. B. K.-E. Behne: „Musik im Kontext – Musik als Kontext“, S. 13–17/33, oder B. Becker: „Gegensteuern. Kann Schule einen Antikurs zur Medienmanipulation leisten?“, S. 31–33). 14 Anton Haefeli: „Zwischen absolutistischem Signal und revolutionärem Signet: Die Marseillaise und ihre Folgen“, in: Musik/Revolution Bd. 2 (= Festschrift für Georg Knepler zum 90. Geburtstag, hg. von Hans-Werner Heister), Hamburg 1997, S. 63–113, hier S. 63–70. Der Nachweis aller Zitate sind im Originalaufsatz zu finden. 15 Die zwingendste Kritik mit rein musikalischen Mitteln am Hymnenunwesen (und natürlich auch an einer verbrecherischen Politik) dürfte wohl Jimi Hendrix in seinem sensationellen Stück The Star-Spangled Banner mit der Zerfetzung der USA-Hymne geübt haben.