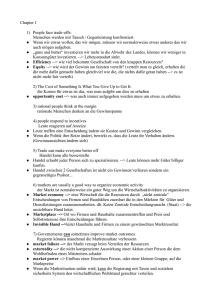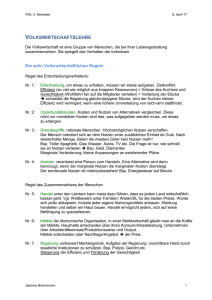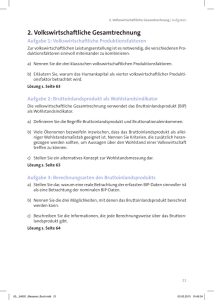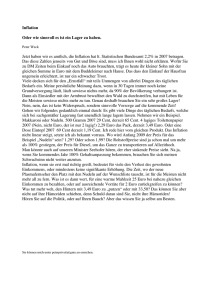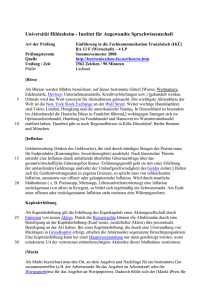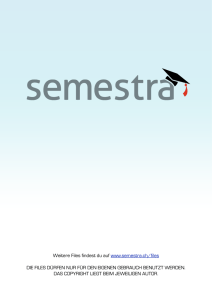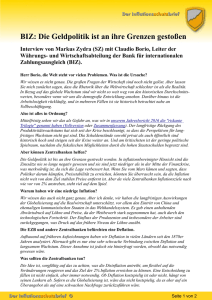Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES
Werbung

Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. -1- VWL III: Wirtschaftspolitik -2- A. EINFÜHRUNG UND ZIELE DER WIRTSCHAFTSPOLITIK............................................ 3 A.1. Ziele der Wirtschaftspolitik: ....................................................................................... 3 B. WIRTSCHAFTSPOLITISCHES ZIEL „EFFIZIENZ UND WACHSTUM“ ......................... 4 B.1. Konzeptionelle Einführung ........................................................................................ 4 B.2. Externe Effekte und Fallbeispiel Umweltpolitik .......................................................... 5 B.3. Monopolmacht, Fallbeispiel Schweizer Kartellpolitik und Öffentliche Güter ............. 10 B.4. Wirtschaftswachstum .............................................................................................. 15 C. WIRTSCHAFTSPOLITISCHES ZIEL „TIEFE ARBEITSLOSIGKEIT“ .......................... 21 C.1. Formen der Arbeitslosigkeit und wirtschaftspolitische Instrumente.......................... 21 C.2. Fallbeispiel Schweizer Arbeitsmarktpolitik............................................................... 25 D. WIRTSCHAFTSPOLITISCHES ZIEL „TIEFE INFLATION“.......................................... 29 D.1. Entstehung und Messung der Inflation .................................................................... 29 D.2. Kosten der Inflation und der Bekämpfung ............................................................... 31 D.3. Instrumente der Geldpolitik ..................................................................................... 32 D.4. Fallbeispiel Geldpolitik der SNB .............................................................................. 34 D.5. Geldpolitik und Wechselkurse ................................................................................. 35 E. WIRTSCHAFTSPOLITISCHES ZIEL „GERECHTE EINKOMMENSVERTEILUNG“ .... 37 E.1. Einkommensverteilung............................................................................................ 37 E.2. Sozialwerke in der Schweiz..................................................................................... 39 E.3. Altersvorsorge in der Schweiz................................................................................. 40 E.4. Working Poor in der Schweiz .................................................................................. 41 F. ÖFFENTLICHE FINANZEN .......................................................................................... 43 F.1. Staatsausgaben, Staatseinnahmen und Verschuldung ........................................... 43 G. AUSSENWIRTSCHAFTSPOLITIK................................................................................ 46 G.1. Effekte der Handelsliberalisierung und europäische Integration .............................. 46 G.2. Monetäre Integration und Fallbeispiel Schweizer Integrationspolitik........................ 49 -3A. EINFÜHRUNG UND ZIELE DER WIRTSCHAFTSPOLITIK A.1. Ziele der Wirtschaftspolitik: • Verteilung Knappes Angebot an Produktionsfaktoren Von den Unternehmen hergestellte Güter und Dienstleistungen Frage: Bringt es die Marktwirtschaft tatsächlich fertig gerecht zu verteilen? • Optimalität Pareto-Effizienz Effizienz Die freie Marktwirtschaft ist effizient, muss aber nicht gerecht sein (den Kuchen maximieren, Verteilungsfragen ausser acht lassen) • Unsichtbare Hand Führt unter gewissen Bedingungen zu Effizienz, welche jedoch unter Umständen von der Mehrheit der Bevölkerung als ungerecht empfunden wird. • Der Staat Schafft die Voraussetzungen und sorgt für Gerechtigkeit. • Voraussetzungen Eigentumsrechte festlegen und Institutionen, welche diese durchsetzen. Transparenz (Bsp. Abgepacktes Fleisch: Verdorben – OK?) Staatliche Lebensmittelkontrolle Wettbewerb (Keine Monopole, Oligopole) Korrektur von Externalitäten Korrektur bei Öffentlichen Gütern Makroökonomische Stabilität (Stichworte: Inflation, Arbeitslosigkeit) Vollkommene Märkte Gegenbegriff: Marktversagen -4- B. Wirtschaftspolitisches Ziel „Effizienz und Wachstum“ B.1. Konzeptionelle Einführung • Wohlfahrtstheorie • Volkswirtschaftliche Rente: Differenz zwischen dem Realeinkommen eines Wirtschaftssubjektes und seinen Opportunitätskosten • Konsumentenrente: P 100 I 80 II III 70 Q I+II Gewinn Konsument mit Zahlungsbereitschaft 100 III Gewinn Konsument mit Zahlungsbereitschaft 80 I+II+III Gesamtgewinn bei einem Preis von 70 = Konsumentenrente P I p1 II III p2 D q1 q2 Q KRp1 = I KRp2 = I+II+III „Gewinn an KR bei p2“ = (p1-p2) q1 + ½ ((p1-p2) (q2-q1)) KR hängt von der Elastizität der Nachfrage ab. Bei elastischer Nachfrage gibt es mehr KR, bei einer unelastischen Nachfrage weniger. -5- B.2. Externe Effekte und Fallbeispiel Umweltpolitik B.2.1. Theorie: Def: Einflüsse der Handlungen eines Akteurs auf einen anderen, die nicht über das Preissystem laufen. • Verursacher – Geschädigter • Negative Externalitäten – Positive Externalitäten Verursacher Geschädigter Beispiel Produzent Produzent Stahlfirma produziert Abwässer, Fischer hat weniger Ertrag Produzent Konsument Fabrik steht neben einem Garten und verschmutzt die Luft Konsument Konsument Jemand hört Radio und stört den Nachbarn beim lesen Konsument Produzent Haushaltsabwässer mindern den Ertrag eines Fischers Negative Externalität: P MSC P* MC P1 D q* q1 Q -6- Positive Externalität: P MC p1 MSC P* D q1 Q q* Ineffizienz bei Externalitäten: P C MC B Gesamter Nutzen: 0ABC Kosten: 0AB D 0 A Q q* P C MSC E MC B D 0 A F Q Zusätzlicher Nutzen: ABDF Zusätzliche Kosten: ABEF Zusätzlicher Nutzen < Zusätzliche Kosten Gesamte Rente:Nutzen – Kosten = 0CB -7- Technologische versus pekuniäre Externalitäten: Pekuniäre Externalitäten zeichnen sich durch Auswirkungen aus, welche über Preise gehen. Zum Beispiel ist ein Metzger in einem kleinen Dorf, welcher zum ersten Mal Konkurrenz bekommt definitiv externen Effekten ausgesetzt. Über die Preise wird dies jedoch signalisiert und stellt deshalb keinen Effizienzverlust dar. Ein anderes Beispiel sind Computer, die Schreibmaschinen vom Markt verdrängen. B.2.2. Mögliche Lösungsansätze Freiwillige Internalisierung: Die Firmen berücksichtigen die zusätzlichen Kosten und setzen ihre Grenzkosten von sich aus gleich den MSC. Mögliche Gründe sind: • Moral • Zusammenarbeit (/-schluss) • Vertrag (Coase-Theorem) Staatliche Regulierung: Die Mengen werden vom Staat gleich den Gleichgewichtsmengen der MSC gesetzt (Gebote, Verbote). Staatlich geförderte Internalisierung: Die MC-Kurve wird durch Steuern oder Lenkungsabgaben soweit verschoben, bis sie der MSC-Kurve entspricht (Marktwirtschaftliche Instrumente). B.2.3. Allgemeine Beispiele Freiwilliger Umweltschutz: Informationen über umweltschädigende Wirkungen bestimmter Tätigkeiten. • Informationen über die Konsequenzen der Umweltbelastung • Informationen über Umweltverträglichkeit von Firmen, Tätigkeiten • Umwelterziehung • Vorbildliches Verhalten des Staates. Bsp. Berücksichtigen von Firmen mit guter Umweltpolitik Bsp. Label Bravo-Kampagne. Wie soll man sich verhalten Staatliche Nachsorge: Aufräumen vom Staat nach der Verschmutzung • Gemeinlastprinzip • Verursacherprinzip End of pipe Ansatz Bsp. Kläranlagen, Kehrichtverbrennung Polizeilicher Umweltschutz: Der Staat reguliert die umweltschädigende Tätigkeit 1. Immissionsgrenzwerte festlegen (quantitative Ziele) Ozon, Lärm, NOx 2. Emmissionsgrenzwerte festlegen (Wie erreicht man die quantitativen Ziele?) Abgasgrenzwerte 3. Regulatorischer Eingriff Katalysatorpflicht -8Grundsätzliche Probleme des polizeilichen Umweltschutz: 1. Ineffizienz erreichen Firmen haben unterschiedliche Kosten um die Umweltziele zu 2. Keine Anreize, die vorgegebenen Grenzwerte zu unterschreiten 3. In einer wachsenden Wirtschaft steigt die gesamte Emmissionsmenge, wenn die Grenzwerte nicht angepasst werden Marktwirtschaftliche Instrumente: Vorteile: • Effizienz • Anreiz die Grenzwerte zu unterschreiten • Innovationsanreize Volle Internalisierung (Pigou-Steuer): Man setzt eine Steuer fest, welche die MC-Kurve genau soweit verschiebt, dass sie auf der MSC-Kurve zu liegen kommt. Es bleiben die Fragen der Informationsbeschaffung und wie man die Steuereinnahmen verwendet. Lenkungsabgabe: Die Lenkungsabgabe entspricht der Pigou-Steuer ohne den Anspruch die MSC-Kurve genau zu treffen. Man will die Kurve in die richtige Richtung „lenken“. Problematisch ist die Elastizität der Nachfrage. Wenn die Nachfragekurve elastisch ist hat man wenig Steuereinnahmen, jedoch einen grossen Mengeneffekt. Bei einer unelastischen Nachfrage ist es genau umgekehrt. Die beiden Ziele Umweltschutz und Steuereinnahmen stehen im Gegensatz. Was macht man mit den Einnahmen? • Staatskasse • Rückerstattung (Ökobonus) • Zweckbindung (Verursacherprinzip; Bsp. Flaschenpfand) Umweltzertifikate: • Handelbares Recht auf Verschmutzung • Menge der Verschmutzung wird festgesetzt und für diese Zertifikate ausgestellt, welche auf einem Markt für solche Papiere gehandelt werden Dieses Prinzip setzt genau an der Menge an Elastizität der Nachfrage spielt keine Rolle Ist effizient, da die Papiere gehandelt werden -9- Zusammenfassung: B.2.4. Ökologische Wirksamkeit, Effektivität Nutzen – Kosten, Effizienz Politische Durchsetzbarkeit Freiwilliger Umweltschutz TIEF MITTEL/TIEF HOCH Staatliche Nachsorge TIEF/MITTEL TIEF MITTEL Polizeilicher Umweltschutz MITTEL/HOCH MITTEL HOCH Martwirtschaftliche Instrumente HOCH HOCH TIEF Beispiele aus der Schweiz Freiwilliger Umweltschutz: • Umweltmanagementsysteme (ISO 14001) Freiwillig • Sonst „Drohung“ mit polizeilichen Massnahmen: Branchenvereinbarung in der Zementindustrie. Wenn der Deal nicht eingehalten wird gibt es Restriktionen. Funktioniert nur, wenn die Branche gut organisiert ist. Sonst gibt es zu viele Trittbrettfahrer. End of pipe Ansatz kombiniert mit dem Verursacherprinzip: • Abfallsackgebühren auf Gemeindeebene. Frage: Ist dies nicht schon eine Lenkungsabgabe? Nein. Gemäss BUWAL produzieren die Leute nicht weniger Abfall, sondern sie sortieren mehr, um Abfallsäcke zu sparen. • Vorgezogene Entsorgungsgebühren (Flaschen, Aludosen, PET) Marktwirtschaftliche Instrumente: • Lenkungsabgaben auf VOC, auch auf Schwefelgehalt in Heizöl • Differenzierte Besteuerung von Bleifrei und Super (Lenkungsabgabe) • LSVA (Lenkungsabgabe) Freiwillig Marktwirtschaftlich: • CO2-Gesetz: Es handelt sich um eine globale Verschmutzung. Einzelne Massnahmen zeigen kaum Wirkung • Kyoto-Protokoll verpflichtet Teilnehmer den jeweiligen CO2-Ausstoss bis 2010 zu senken. In der Schweiz um 10% • In der Schweiz hat man bis 2004 Gelegenheit für freiwillige Massnahmen. Wenn die Senkungen vom Plan abweichen wird eine CO2-Steuer eingeführt (Lenkungsabgabe) • Probleme der Durchsetzbarkeit wegen dem Ausstieg der USA -10- B.3. Monopolmacht, Fallbeispiel Schweizer Kartellpolitik und Öffentliche Güter B.3.1. Ineffizienzen bei Monopolen Vollständiger Wettbewerb: P MC p* D q* Q Es gilt immer derselbe Preis. Alle Firmen sind Preisnehmer. Niemand macht Gewinn. Der Preis wird durch die Kosten aufgehoben. Nachdem alle entschädigt sind (Löhne, Dividenden etc.) bleibt kein Gewinn übrig. Monopol: P MC p* D MR q* Q Monopol kann den Preis frei wählen d.h. es kann seinen Gewinn optimieren. Beim Cournot-Punkt MR = MC liegt die optimale Menge. Daraus folgt, dass zuwenig zu einem zu hohen Preis produziert wird. Wie stark dieser Effekt ist hängt von der Elastizität der Nachfrage ab. -11- Ineffizienz: P p* MC D MR q* 1 2 Q 3 1 Konsumentenrente 2 Produzentenrente 3 Deadweight loss Keinen Deadweight loss gibt es nur bei vollständiger Preisdiskriminierung. Dabei setzt der Produzent für jeden Konsumenten genau den Preis, welcher seiner Zahlungsbereitschaft entspricht. In diesem Fall gibt es jedoch ausschliesslich Produzentenrente. Dies ist zwar effizient, jedoch schlecht verteilt. Weitere Kosten der Monopolmacht: B.3.2. • Ineffizientes Management • Wenig Anreize zu Innovationen • Rent seeking gesucht Markteintrittsschranken werden von den Produzenten politisch Markteintrittsschranken Da bei einer Monopolstellung Gewinne zu holen sind wollen neue Produzenten in diesen Markt eindringen. Deshalb können Monopole nur mit Hilfe von Markteintrittsschranken bestehen. Langfristig ist dies kaum möglich. Aus diesem Grund ist es auch für ein Monopol langfristig besser, Konkurrenz zuzulassen weil man nach einiger Zeit nicht mehr anpassungsfähig ist. Bsp. Das OPEC-Kartell schaffte in den 70er Jahren Anreize teure Förderungsmethoden im Westen zu realisieren. Deshalb ist das Kartell heute nicht mehr so mächtig. Zudem sind Kartelle von Natur aus instabil (Gefangenendilemma). Gründe für zu wenig Markteintritte: 1. Skaleneffekte (natürliches Monopol) 2. Staatliche Regulierungen Technologisch gegeben Künstlich geschaffen 3. Strategische Eintrittsschranken (Marketing, Preisverhalten) geschaffen Künstlich -12- Natürliches Monopol: • Sehr hohe Fixkosten (Telefonnetz, Schienennetz) • Extrem fallende Durchschnittskosten. Man muss viele Einheiten verkaufen bis es sich lohnt • Relativ tiefe Grenzkosten (Bsp. Last minute Flugticket) P p* ATC MC D MR q* Q C = a + bx C/x = a/x + b AC = a/x + b MC = b AC > MC Wenn vollständiger Wettbewerb eingeführt wird, macht die Firma auf jeden Fall Verlust. Durch das Monopol kann man höheren Gewinn machen. Ohne diesen Spielraum würde gar nicht produziert werden, da die Fixkosten zu hoch sind (ATC werden nie unter den MC zu liegen kommen). Die einzige Lösung ist ein Anbieter, der den Monopolpreis verlangt. Staatliche Regulierung: • Der Staat reduziert den Markteintritt aus verschiedenen Gründen • Öffentliche Gesundheit (Zulassungsbestimmungen für Ärzte) • Sicherheit (Zulassungsbestimmungen für Anwälte) • Technischer Fortschritt, Innovation (Patente) • Strukturerhaltung (unangenehmer Druck sich anpassen zu müssen Protektionismus (Zölle, Quoten) Strategische Eintrittsschranken: • Preiskampf (Preisdumping). Aggressive Preissenkungen um Eintritt unattraktiv zu machen. Schon die Drohung mit Preisdumping ist sehr effektiv • Zu grosse Kapazitäten. Man sendet damit ein Signal an potentielle Konkurrenten. Falls jemand in den Markt eintritt würde man die Produktion ausweiten und die Preise senken -13- B.3.3. Wettbewerbspolitik Wirtschaftspolitik bei natürlichen Monopolen: • Verstaatlichen (bis vor kurzem sehr populär) • Regulieren Das Telefonnetz ist ein natürliches Monopol, die Dienstleistung als Serviceprovider jedoch nicht. Es ist möglich einzelne Teile zu privatisieren. Man versucht, dass der Preis ein wenig über den ATC zu liegen kommt, was jedoch schwierig zu berechnen ist. Wirtschaftspolitik bei künstlichen Monopolen: • Staatliche Garantie für den Markteintritt (Wettbewerbsbehörde) Öffnung der Wirtschaft: P MC pm pw D MR qm q* Q • Wo Importe und Exporte einfach möglich sind gibt es selten Monopole/Kartelle • Dies ist eine gute Strategie bei Industrieprodukten. Bei (persönlichen) Dienstleistungen ist dies schwierig zu realisieren Durch Öffnung der Wirtschaft wird das inländische Monopol wieder Preisnehmer des Weltmarktpreises. Daraus folgt das effiziente Gleichgewicht (pw/q*) B.3.4. Schweizerische Wettbewerbspolitik • Die Schweiz hat eine sehr hohe Kartelldichte im internationalen Vergleich • Bisher hatte die Schweiz eine sehr lockere Kartellpolitik • Sie weist vergleichsweise hohe Preise auf. Die Kaufkraft ist tiefer obwohl wir ein sehr hohes pro Kopf Einkommen haben Arten von Kartellen: • Preiskartell (Preisabsprache) • Konditionenkartell (Es gibt nur zwei Variationen eines Gutes statt 100 möglichen) • Mengenkartell (Der Zielpreis der OPEC wird durch die angebotene Menge erreicht) • Marktsegmentierungskartelle (Ein Gebiet wird unter Firmen aufgeteilt Bsp. Kantone. Es muss jedoch gewährleistet sein, dass dem Konsumenten das Produkt in einem anderen Kanton verweigert wird) -14Schweizerisches Kartellgesetz: Bis 1995 „altes“ Kartellgesetz (Kartelle sind nicht verboten. Besonders schädliche Kartelle können jedoch sanktioniert werden, wenn man ihnen die Schädlichkeit nachweist) Ab 1995 „neues“ Kartellgesetz (Besonders schädliche Kartelle sollen verboten werden. WEKO hat jedoch sehr beschränkte Sanktionsmöglichkeiten) Ab ca. 2002 Revision des neuen Kartellgesetzes Altes KG: Funktioniert nach der Saldomethode. Abwägen von positiven (Qualitätssicherung, Versorgungssicherheit, Verhinderung von Arbeitslosigkeit, Öffentliche Gesundheit, Integrität des Landes), negativen (Ineffizienzen, Monopol) Aspekten. Die meisten positiven Aspekte sind heute längst überholt. Neues KG: Verbieten von besonders schädlichen (harten) Kartellen. Dies sind Preis-, Mengenund Gebietskartelle . Schädlichkeitsvermutung (Die Firmen müssen bei Verdacht der WEKO das Gegenteil beweisen). Revision des neuen KG: Bis jetzt kann die WEKO nicht direkt Strafen aussprechen. Sie müssen die Unternehmen zuerst verwarnen und können nur bei einer Wiederholungstat im selben Stil Sanktionen verhängen. Dies ist im internationalen Vergleich sehr mild. Beim Vitaminkartell von weltumspannenden Pharma-Konzernen kamen Manager in den USA ins Gefängnis, in Europa erhielten sie beträchtliche Geldstrafen und in der Schweiz wurden sie verwarnt. Durch die Revision soll die WEKO mehr Kompetenzen zur sofortigen Bestrafung erhalten. Ein weiterer Vorteil wäre eine Bonus-Regel, welche einem Kartellmitglied, welches das Kartell anzeigt Strafmilderung bis Straffreiheit zugesteht („Kronzeugenregelung“). Dadurch wären Kartelle noch instabiler und man könnte ihnen schneller auf die Spur kommen. Diese Idee ist in der Schweizerischen Politik sehr umstritten. B.3.5. Öffentliche Güter Eigenschaften: • Öffentliche Güter ≠ vom Staat produzierte Güter • Grad der Rivalität im Konsum • Grad der Ausschliessbarkeit im Konsum Eigenschaft • Private Güter • Öffentliche Güter Technische Eigenschaft Technische und institutionelle Rivalisierend und ausschliessbar Nicht rivalisierend und nicht ausschliessbar (Feuerwerk) -15- Ausschliessbar Nicht ausschliessbar Rivalisierend Private Güter (Apfel) Common Pool Güter (Fischgründe) Nicht rivalisierend Clubgüter (Golfplatz, PayTV) Öffentliche Güter (Feuerwerk) Marktversagen: • Summe der Zahlungsbereitschat > Kosten • Zahlungsbereitschaft des Einzelnen < Kosten • Analogie zu den positiven externen Effekten P S D Q „Freeriding“: Ein einziger hat eine Zahlungsbereitschaft, welche jedoch zu tief ist. Das Gut wird nicht produziert, da es nicht nachgefragt wird. Selten hat ein einzelner eine genügend hohe Zahlungsbereitschaft. In diesem Fall wird er jedoch eventuell noch warten, ob jemand anderes nicht doch eine ähnlich hohe Zahlungsbereitschaft hat und das Gut vor ihm bezahlt. Falls das Gut tatsächlich nachgefragt wird, wird es eine Menge „Freerider“ geben, da der (zahlende) Konsument diese nicht ausschliessen kann. Lösungsansätze B.4. • Staatliche Bereitstellung (Berufsarmee) • Freiwillige Bereitstellung (Freiwilligen Armee) • „Dienstverpflichtung“ (Milizarmee) • Staatliche Kontrakte an Private (Der Staat finanziert das Gut, Private stellen es her) Der Staat schreibt vor, dass alle sich beteiligen Wirtschaftswachstum B.4.1. Bedeutung von Wachstum: Bsp. USA: -161870-1990 Hypothese 1: Hypothese 2: Wachstumsrate pro Jahr 1.75% Pro Kopf Einkommen (real) 2‘200$ 18‘300$ Wachstumsrate pro Jahr 0.75% Pro Kopf Einkommen (real) 2‘200$ 5‘500$ Wachstumsrate pro Jahr 2.75% Pro Kopf Einkommen (real) 2‘200$ 60‘800$ Der Grund für diese Diskrepanz sind Zinseszinseffekte. Wachstum ist unerlässlich zur finanziellen Bewältigung der Bevölkerungsalterung und es gibt weniger Konflikte bei Verteilungsfragen. B.4.2. Unterschied zwischen Wachstum und Konjunktur: Wachstum kann nur von der Angebotsseite her kommen. Bei Konjunkturschwankungen kann man bei der Nachfrage ansetzen. Gesamtwirtschaftliches Angebot: Input Output Kapital Arbeit BIP Technologie (Art und Weise wie Arbeit und Kapital eingesetzt werden) Kurzfristig sind alle drei Faktoren fix. D.h. es gibt einen maximal produzierbaren Output und eine Kapazitätsgrenze. Langfristig benötigt man mehr K, L oder Technologie um wachsen zu können. Jemand muss die produzierte Menge nachfragen, sonst werden die Firmen in der nächsten Periode ihre Produktion anpassen. Da sie die Art wie sie produzieren kaum ändern werden sparen sie bei L und K. Gesamtwirtschaftliche Nachfrage: Setzt sich aus folgenden Elementen zusammen • Güter und Dienstleistungen werden von Haushalten gekauft (Konsum) • Firmen (Investitionsnachfrage) • Staat (Staatsausgaben) • Ausland (Exporte – Importe = NX) AS Preisniveau (LIK) 3 2 1 AD Kap. grenze Output „BIP“ -17Einfaches Makromodell: 1. Depression: Bei schwacher Auslastung der Ressourcen tritt eine zu kleine Nachfrage auf um die Kapazitäten auszulasten. Bei zusätzlicher Nachfrage erhöht sich der Output, die Preise ändern sich jedoch kaum oder gar nicht. In diesem Fall lohnt es sich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stimulieren. Diese Aufgabe übernimmt die Nationalbank. 2. Normale Situation. Die Politik muss je nach Elastizität der Nachfrage angepasst werden. 3. Boom: Bei starker Auslastung der Kapazitäten folgt auf eine Nachfrageerhöhung lediglich eine Preiserhöhung. Eine Mengenänderung bleibt aus. In dieser Situation bewirkt eine expansive (Geld-)Politik nur eine Inflation und kein Wachstum. Um langfristiges Wachstum zu erreichen, muss man die Kapazitätsgrenze nach aussen verschieben. Wie oben erwähnt bewirkt die Verschiebung der Nachfragekurve lediglich konjunkturelle Effekte. AS 1 Preisniveau (LIK) KG 1 AS 2 KG 2 Output “BIP” In der wirtschaftspolitischen Diskussion werden die Begriffe Wachstum und Konjunktur oft verwechselt. BIP pro Kopf 1960 2000 2010 Jahr Die Kurve stellt das Wachstum des BIP pro Kopf in Abhängigkeit der Zeit dar. Die Gerade steht für den Trend. Die Steigung dieses Trends wird vom Angebot bestimmt und kann durch dieses beeinflusst werden (Wachstum). Die (kurzfristigen) Schwankungen der Kurve hängen von der Nachfrage ab (Konjunkturschwankungen). -18- Wirtschaftspolitik Quellen des Wachstums: Mehr Erwerbstätige Mehr Arbeitsstunden pro Erwerbstätigen Mehr Arbeitsstunden Mehr Realkapital (Ma, Immobilien usw.) Mehr Humankapital (Weiterbildung usw.) Pro Arbeitsstunde mehr Produktion = Arbeitsproduktivität Wachstum BIP pro Kopf Mehr Know-How (Technologie) Das Know-how hat dabei den Vorteil, dass man unter Umständen nichts investieren muss und trotzdem die Produktivität steigern kann (Verbesserung durch die Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag). Zudem stösst man bei der Ausweitung der Technologie im Gegensatz zu den anderen Punkten an keine Grenzen (Man kann zum Beispiel nur so viele Arbeiter einstellen, wie auf dem Arbeitsmarkt vorhanden sind). Das „Gut“ Technologie: 100% Rivalisierend Nicht rivalisierend Humankapital Grad der Ausschliessbarkeit Patentierte Forschung 0% Grundlagenforschungs-ergebnisse -19- Wirtschaftspolitische Wachstumsdeterminanten: ... und Wachstum Eindeutig positiv Offenheit des Landes X Bildung X Eher positiv Tiefe Inflation Kein Zusammenhang X Tiefe Staatsquote X Wettbewerb im Inland X Forschung und Entwicklung X Demokratie Politische Stabilität X X „Gerechte“ Einkommensverteilung X c Wie hoch ist der Grad an Markteingriffen des Staates. d Ist relativ schwierig zu messen. Schwachpunkte dieser Erhebung: B.4.3. • Diese Darstellung weist eine Korrelation der angegebenen Punkte aus. Wie sie kausal zusammenhängen (ob eine stark wachsende Marktwirtschaft sich mehr Bildung leisten kann, oder ob mehr Bildung zu mehr Wachstum führt) ist jedoch eine andere Frage. • Man hat nur von etwa 100 Ländern diese Daten zur Verfügung. Der Stichprobenumfang ist ziemlich klein (Signifikanz). Das Schweizer Wirtschaftswachstum Bericht ab 7. Mai auf der Website vom Seco erhältlich. • Hohes Einkommensniveau • Geringes Wachstum seit längerer Zeit • Im Gegensatz zu den G7 und der EU kam das Schweizer Wirtschaftswachstum in den 90er Jahren praktisch zum erliegen • Die Schweiz ist sehr stark was die Arbeitsstunden angeht. Viele Leute sind erwerbstätig (höchste Quote der OECD Staaten). Da dieser Anteil so hoch und -20das Potential endlich ist, kann man kaum mehr Wachstum durch Steigerung der Arbeitsstunden erreichen (siehe Schema). • Die Arbeitsproduktivität ist jedoch eher schwach. • Ein Grund dafür ist die tiefe Arbeitslosigkeit. Leute mit einer weniger guten Ausbildung (kleinere Produktivität), welche in anderen Ländern arbeitslos sind, sind in der Schweiz berufstätig. Dadurch wird die durchschnittliche Arbeitsproduktivität geschmälert. Dies vermag jedoch nur einen Teil des fallenden Wachstums der Arbeitsproduktivität zu erklären. Bemerkung: Die OECD ist ein Zusammenschluss der reichsten Industriestaaten und einigen Schwellenländern mit ca. 30 Mitgliedern. Wirtschaftspolitische Determinanten der Arbeitsproduktivität: • Wettbewerbspolitik (im weitesten Sinn) Das Preisniveau ist aufgrund zu wenig Wettbewerb sehr hoch (siehe B.3.4.). Dies beeinflusst die Arbeitsproduktivität negativ. • Bildungspolitik Das Bildungssystem ist zwar sehr gut, jedoch haben nur wenige Leute eine Tertiärausbildung. Der Grund dafür ist das stark ausgebaute Lehrlingssystem, welches für die Leute eine grosse Bedeutung hat. Man kann sich fragen, ob in einer Wissensgesellschaft dieses System nicht angepasst werden sollte, damit mehr Leute Fach- und Hochschulabschlüsse erhalten. Dadurch würde die Arbeitsproduktivität (unter Umständen) steigen. • Öffentliche Finanzen (Staatsquote, Struktur der Steuern) Die Schweiz weist hier im Bezug auf die Arbeitsproduktivität keine Defizite auf. In den letzten Jahren sind die Staats- und Steuerquoten jedoch relativ stark gewachsen. • Aussenwirtschaftspolitik Da wir nicht in der EU sind könnte sich ein mangelnder Innovationsdruck durch eine fehlende Liberalisierung negativ auswirken. Dies ist jedoch kein entscheidendes Problem. • Forschung und Entwicklung (Innovationspolitik) Die Schweiz ist bei allen Erhebungsarten vorne mit dabei. Deshalb ist dieser Punkt sicherlich kein Nachteil gegenüber den anderen Staaten. • Gesamtwirtschaftliche Stabilität (Stabilisierungspolitik) Abgesehen von den Turbulenzen in der Mitte der 90er Jahren eigentlich stabil. -21- C. Wirtschaftspolitisches Ziel „Tiefe Arbeitslosigkeit“ C.1. Formen der Arbeitslosigkeit und wirtschaftspolitische Instrumente C.1.1. Definition der Arbeitslosigkeit Arbeitslos sind alle Personen, die zum Marktlohnsatz keine Beschäftigung finden, obwohl sie möchten. Bei vollständig flexiblen Preisen und Löhnen gibt es deshalb theoretisch keine Arbeitslosigkeit. Reallohn w/p S w/p* D1 D2 q* neu q* Anzahl Beschäftigter AL Bei vollständig flexiblen Preisen stellt sich bei einer Änderung der Nachfrage nach Arbeitskräften (Firmen) ein anderes Gleichgewicht ein (w*, q*). Da die Leute (Anbieter), welche von dem Beschäftigungsrückgang zu diesen Löhnen gar nicht mehr arbeiten wollen, ist die Arbeitslosigkeit gleich Null. Die Annahme, dass die Preise vollständig flexibel sind ist jedoch unrealistisch. Der Lohn wird oft für ein oder mehrere Jahre festgelegt (Bsp. Gesamtarbeitsvertrag) und ist deshalb zumindest kurzfristig fix. Da zu diesen Löhnen noch Leute arbeiten wollen, wegen der zu kleinen Nachfrage aber nicht können entsteht Arbeitslosigkeit (AL). Gesamtarbeitsverträge können deshalb problematisch sein. Statt dass der Lohn für alle sinken würde und nur diese keine Beschäftigung mehr haben, welche dies nicht mehr wollen, wird die ganze Last der zurückgehenden Nachfrage auf die Arbeitslosen abgewälzt. Das heisst man arbeitet entweder weiter zu genau demselben Lohn, oder man wird arbeitslos. Man könnte nun diskutieren, ob Gesamtarbeitsverträge wirklich so sozial sind, wie die Befürworter behaupten. -22- C.1.2. Formen der Arbeitslosigkeit Konjunkturelle Arbeitslosigkeit: S Preisniveau Das BIP sinkt. Dies kann nur durch einen Rückgang von Arbeit, Kapital oder Technologie erklärt werden. Es gibt weniger offene Stellen als Arbeitslose. Strukturelle Arbeitslosigkeit: Die Art und Weise wie produziert wird verändert sich (Technologischer Wandel). Ein Teil der Arbeitsuchenden weist Humankapital auf, welches in dieser Form nicht mehr nachgefragt wird. Dieser Teil muss sich anpassen und findet während dieser Zeit keinen Job. Die Strukturelle Arbeitslosigkeit ist, unabhängig von der Kapazitätsgrenze, immer vorhanden (auch während eines Booms). Es gibt gleich viele offene Stellen wie Arbeitslose. Friktionelle Arbeitslosigkeit: Sucharbeitslosigkeit. Man ist während einer gewissen Zeit arbeitslos, da man den richtigen Job sucht, welcher jedoch vorhanden ist. Es gibt gleich viele offene Stellen wie Arbeitslose. Beveridge-Kurve: Offene Stellen C A B D Arbeitslose A: Ausschliesslich strukturelle und friktionelle Arbeitslosigkeit B: Konjunkturell schwierige Situation -23C: In der Schweiz war dies nach dem zweiten Weltkrieg eine gewöhnliche Situation. Überbeschäftigung. Ausländische Arbeitskräfte wurden als Konjunkturpuffer benutzt. D: In diesem Punkt gibt es keine Arbeitslosigkeit. Dies ist das Optimum (Effizient). In der Schweiz steigt die strukturelle Arbeitslosigkeit tendenziell an (S. BeveridgeKurve unten). Trotzdem ist sie im internationalen Vergleich noch sehr tief. Sie spielte Offene Stellen Arbeitslose in den 90er Jahren eine wichtige Rolle. Denn auch ohne Konjunkturschwäche wäre durch sie die Arbeitslosigkeit in der Schweiz gestiegen. Offene Stellen und Arbeitslosigkeit, 1977-2000: -24- C.1.3. Wirtschaftspolitische Instrumente zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Konjunkturelle Arbeitslosigkeit: • Zu tiefe gesamtwirtschaftliche Nachfrage • Wirtschaftspolitik zur Steigerung der aggregierten Nachfragen Ausgangslage: S Preisniveau Komponenten der Nachfrage C + G + I + NX 1. Der Konsum hängt positiv vom verfügbaren Einkommen ab. Fiskalpolitik (Finanzverwaltung) C = C(Yv), Yv = Y – T T Yv C In der Schweiz lässt sich eine Steuersenkung jedoch nur schwer umsetzen, weil diese in der Verfassung verankert werden müsste. 2. Staatsausgaben 3. Investitionen hängen negativ von den Zinsen ab. Geldmenge Geldpolitik (SNB) i I(i) i = Zinssatz 4. Nettoexporte Geldmenge Wert CHF Exporte steigen, Importe sinken NX Das Stimulieren der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage durch expansive Geld- bzw. Fiskalpolitik. Keynes war der erste Ökonom, der auf die Idee kam bei einer schweren Rezession mit diesen Instrumenten die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stimulieren. Oft wird an diesen Instrumenten Kritik geübt, weil sie nur kurzfristige Konjunkturschwankungen bekämpfen und nicht langfristig wirken. Doch Keynes entwickelte diese Instrumente damit die Wirtschaft aus sehr schweren Rezessionen (Depressionen) herausfinden kann. Wenn man die Massnahmen der Börsencrashs 1930 und 1987 vergleicht und die Auswirkungen dieser untersucht, kommt man zum Schluss, dass die Instrumente -25von Keynes in diesen Situationen sehr geeignet sind. In einer normalen Situation sollte jedoch die SNB die Nachfrage nur durch eine expansive Geldpolitik stimulieren, wenn man davon ausgehen kann, dass die Kapazitäten im Moment nicht ausgelastet sind da sonst eine starke Inflation entstehen würde. Die Aufgabe der SNB ist es also Inflation zu verhindern und wenn dies erfüllt ist eventuell Massnahmen zur Stimulierung der Nachfrage zu ergreifen. Strukturelle Arbeitslosigkeit: • „Falsche“ Struktur des Arbeitsmarktes • Anpassung des Arbeitsangebots 1. Bildung (Weiterbildung, Umschulung) 2. Deregulierung der Arbeitsmärkte • Flexible Arbeitszeiten • Tiefe „hire and fire“ Kosten • Reduktion der Lohnnebenkosten (Bsp. AHV) Natürlich sind diese Massnahmen politisch sehr umstritten und schwierig umzusetzen. Trotzdem ist es eine Tatsache, dass auf einem solchen Arbeitsmarkt die Unternehmen eher bereit sind jemanden einzustellen, welcher nicht genau den Qualifikationen für einen bestimmten Job entspricht. Sie lassen sich darauf ein, weil sie ihn auch wieder loswerden können, wenn sie einen qualifizierteren gefunden haben. Wiederum geht es hier um eine Verteilungsfrage. Mit starren, generellen Gesamtarbeitsverträgen erreicht man zwar, dass die Leute die Arbeit haben gut verdienen, jene, welche jedoch keinen Job haben, sind praktisch ohne Chance eine Stelle zu finden. Friktionelle Arbeitslosigkeit: • C.2. Transparenz im Arbeitsmarkt zu klein Fallbeispiel Schweizer Arbeitsmarktpolitik C.2.1. Entwicklung und Struktur der Schweizer Arbeitsmarktpolitik • Die Deutschschweiz hatte immer eine tiefere Arbeitslosenquote als die Romandie und das Tessin. • Die Arbeitslosenquote von Schweizer Arbeitern war immer tiefer als diejenigen von ausländischen Beschäftigten. • Die Arbeitslosenquote nach dem Alter gegliedert weist keine systematischen Unterschiede zwischen den Altersgruppen auf (Einzigartig im Internationalen Vergleich) Lehrlingssystem • Auch das Geschlecht spielt bei den Arbeitslosenquoten kaum eine Rolle. • Es gibt in der Schweiz zwei Stellen, welche Arbeitslosenquoten veröffentlichen: 1. Seco: Monatliche Vollerhebung auf der Basis von gemeldeten Arbeitslosen bei den RAV 2. Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE): Jährliche Stichprobe nach OECD Richtlinien. Geeignet für den internationalen Vergleich. • Trotz verschiedener Erhebungskriterien gibt es zwischen diesen kaum Differenzen. -26- C.2.2. Erklärungsfaktoren Warum ist unsere Arbeitslosenquote so tief? Flexibler Arbeitsmarkt: • Dezentrale Lohnverhandlungen (Trotz GAV). Der Lohn richtet sich eher nach der Produktivität als bei generellen GAV wie in Deutschland (Effizienzkriterien) • Keine generellen Mindestlöhne (nur auf Branchenebene) • Wenig Restriktionen bei Entlassungen • Wenig Restriktionen bei der Arbeitszeit Dies sind wiederum hoch politische Punkte und wenn sie in der Schweiz nicht historisch bedingt wären, könnte man sie kaum umsetzen, weil man dafür keine Wähler mobilisieren kann. Restriktionen bei der Arbeitszeit: Warum ist das bekämpfen der Arbeitslosigkeit durch senken der Arbeitszeit problematisch? • Historisch: Der Strukturwandel führt mittelfristig zu einer höheren Beschäftigung, da das Wachstum mit diesem eng verbunden ist. Obwohl zum Beispiel durch die Einführung von PCs in der Schreibmaschinenbranche zuerst Arbeitsplätze verloren gingen, entwickelten sich letztlich viel mehr Stellen in einem weitaus grösseren Markt. • Ökonomisch: Techn. Fortschritt Produktivität Einkommen Zudem ist die Annahme einer fixen Arbeitsmenge unrealistisch. In Tat und Wahrheit wächst diese (Bsp. Frauenerwerbsquote stieg in den letzten Jahren massiv ohne Auswirkungen auf die Männererwerbsquote.) Einkommen Arbeiter Lohn Konsumenten Preis Nachfrage Produktion Nachfrage nach Arbeitskräften Kapitalisten Gewinn -27- C.2.3. Arbeitslosenversicherung • Passiver Ansatz: Wenn man nicht arbeitslos ist zahlt man Geld ein, bei Arbeitslosigkeit wird bedingungslos während einer gewissen Zeit Geld ausgehändigt. • Aktiver Ansatz: Man zahlt ebenfalls Geld ein und bekommt bei Arbeitslosigkeit eine Rente. Nach einer gewissen Zeit muss man jedoch gewisse Auflagen (Weiterbildung, Umschulung, Beschäftigungsprogramme) erfüllen. • Die OECD befürwortet eine aktive Arbeitslosenversicherung vor allem wenn die Länder eine hohe strukturelle Arbeitslosigkeit aufweisen. Die Ziele einer Arbeitslosenversicherung: C.2.4. • Milderung des „Schicksals“ Arbeitslosigkeit • Automatischer Stabilisator (Die Existenz einer Arbeitslosenversicherung verhindert grosse Konjunkturschwankungen. Auch in einer Rezession können arbeitslose Leute während einer gewissen Zeit ihren Lebensstandard und somit den Konsum auf dem selben Niveau halten. Würde der Konsum zurückgehen würde die Rezession noch verstärkt werden. Auf der anderen Seite minderen die Abgaben der Erwerbstätigen deren Einkommen und somit wird ein Boom durch die Arbeitslosenversicherung gedämpft (D.h. die Arbeitslosenversicherung wirkt antizyklisch zu den Konjunkturschwankungen.) • Kosten der Arbeitslosenversicherung (Bei einer gut ausgebauten Arbeitslosenversicherung hat man tendenziell einen tieferen Anreiz sofort einen neuen Job anzunehmen. Man wird wählerischer, was die Art der Stelle und die Entlöhnung angeht. Fallbeispiel Schweizer Arbeitsmarktpolitik Bis zu den 90er Jahren war die Arbeitslosenversicherung in der Schweiz kaum ausgebaut. Es gab jedoch auch kaum Arbeitslosigkeit wegen bereits genannten Gründen. • Leistung (Zahl der Tage während deren Taggeld bezahlt wird): 1984-1992 250 Tage ab 1.1.1993 300 Tage ab 1.4.1993 400 Tage ab 1.1.1996 400-520 Tage Im Vergleich mit dem Ausland waren die Zahlungen Anfangs 90er Jahre relativ mager. Mit der letzten Änderung ist die Schweiz jedoch führend unter den OECD Staaten. Die Summe, welche Ausbezahlt wird beträgt zwischen 70% und 80% des versicherten Einkommens. Aus diesem Grund manövrierte sich die Arbeitslosenkasse zu Beginn der 90er Jahren in kürzester Zeit in ein beträchtliches Defizit. • Ertrag (Beiträge der Arbeitnehmer in % vom Lohn): 1973 0.8% 1980 0.5% 1991 0.4% 1993 2.0% 1994 3.0% Das Problem bei der Erhöhung der Beiträge in den 90er Jahren ist, dass man sich in einer Rezession befand und durch das verminderte verfügbare -28Einkommen diese noch verstärkte. Die bessere Taktik ist, in einer Rezession Schulden zu machen und diese dann in einem Boom zurückzubezahlen. Dadurch werden starke Konjunkturschwankungen zum Teil ausgeglichen. Revision der Arbeitslosenversicherung 2002: 1. Konjunkturabhängige Finanzierung Automatische Stabilisatoren 2. Reduktion der Beiträge von 3% auf 2% Jahr. 3. Verlängerung der Beschäftigungszeit von 6 auf 12 Monate (Dauer, welche man arbeiten muss um eine Auszahlung zu bekommen) Bilaterale lassen wegen der Öffnung des Arbeitsmarktes kaum etwas anderes zu. 4. Senkung der Dauer der Taggeldzahlungen von 520 auf 400 Tage mit sozialer Abfederung (Gilt weder für Leute über 55, noch für IV-, UV-Rentner, noch für Kantone mit sehr hoher Arbeitslosigkeit) Differenz von etwa 2 Mrd. CHF pro Aufgrund Punkt 4 wird sehr wahrscheinlich das Referendum ergriffen. Dies sind nur die wichtigsten Punkte der Revision. Aktive Massnahmen: Ab 1995: Kombination aus Zahlungen und obligatorischen Qualifizierungsmassnahmen. Bei Konjunktureller Arbeitslosigkeit reichen passive Massnahmen. Bei struktureller Arbeitslosigkeit sind Weiterbildung und Umschulung sehr wichtig. • Weiterbildung, Umschulung • Beschäftigungsprogramme (Damit die Leute im Arbeitsprozess bleiben und es ihnen leichter fällt wieder ins Berufsleben einzusteigen) • Ausbildungs- und Einarbeitungszuschüsse (Die Leute arbeiten in einem Betrieb und lernen einen neuen Beruf. Da sie in dieser Zeit nicht sehr produktiv sind, zahlt der Staat einen gewissen Betrag) -29- D. Wirtschaftspolitisches Ziel „Tiefe Inflation“ D.1. Entstehung und Messung der Inflation Demand Pull: Preisniveau S Die Nachfrage bewirkt eine Inflation Cost Push: S2 Preisniveau S1 Jeder Output geht mit einem höheren Preis einher (Erdölschock-Situation). Der Demand Pull hat am Anfang einen angenehmen Nebeneffekt. Denn man rückt näher an die Kapazitätsgrenze und somit wird das Wachstum angeheizt. Dagegen wird beim Cost Push das Preisniveau gesteigert und der Output nimmt dabei sogar ab (Stagflation). Dies ist ein wichtiger Spezialfall in der Makroökonomie. Inflation: Bei einem einmaligen Preisanstieg handelt es sich eigentlich nicht um Inflation. Erst wenn das Preisniveau über einen gewissen Zeitraum hinweg ansteigt spricht man von Inflation. Jedoch ist es so, dass ein einmaliger Preisanstieg kaum vorkommt, da ein solcher meist eine Preis-Lohn-Spirale auslöst. -30- Preisniveau t P w/(p ) w P etc. W ist kurzfristig fix, da die Löhne nicht jeden Tag angepasst werden. Man wird dadurch bei Lohnverhandlungen eher einen höheren Lohn verlangen, da man von einer Inflation und nicht von einer einmaligen Preissteigerung ausgeht. Dadurch werden die Firmen wiederum die Preise erhöhen müssen. In der Graphik sieht man die einmalige Preissteigerung (durchgezogene Linie) und wie diese durch die PreisLohn-Spirale zu einer Inflation führt. Keynesianismus vs. Monetarismus: Keynesianer nehmen an, dass man sich in einer Lage befindet, wo die Kapazitätsgrenze noch lange nicht ausgelastet ist. In diesem Fall kann man durch Stimulierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage einen grösseren Output ohne bedeutende Inflation erreichen. Monetaristen dagegen gehen von einer Situation aus, wo eine Stimulierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ausschliesslich zu Inflation führt, da die Kapazitätsgrenze bereits erreicht ist. In Wirklichkeit sind dies nur Ausnahmefälle und man befindet sich irgendwo dazwischen. Quantitätstheorie: Nominelles Sozialprodukt = P*Q ≡ M*V ≡ Per Definition P Preisniveau M Geldmenge V Umlaufgeschwindigkeit Q reales BIP Je höher V ist, desto kleiner die Geldmenge. Mit der Geldmenge kann die SNB die restlichen Grössen steuern. Bei expansiver Geldpolitik: M , V=const. P oder Q oder beides Der Monetarist glaubt das P steigt, und Q konstant bleibt. Der Keynesianer glaubt das Q steigt, und P konstant bleibt. Messung der Inflation: • Der Preisindex wird mit Hilfe eines Warenkorbes erstellt. • LIK: Der Landesindex der Konsumentenpreise enthält etwa 300 Güter und Dienstleistungen (ohne Versicherungen und Steuern). Problematisch ist dessen mangelnde Objektivität im Bezug auf Produkte die einem starken technischen Fortschritt ausgesetzt sind (Bsp. Computer). Der Preis steigt zwar unter Umständen, die Produktivität und Qualität sind jedoch auch höher. Im LIK wird nur die Preissteigerung berücksichtigt und nicht die unter Umständen bedeutsamere Qualitätssteigerung. -31- D.2. Kosten der Inflation und der Bekämpfung D.2.1. D.2.2. Kosten der Inflation: • Hyperinflation (>50% pro Monat) kommt häufig in Kriegssituationen vor. Es lohnt sich sehr rasch das Geld in Güter umzusetzen. Man wird Geld in der Landeswährung kaum lange halten. • Auch relativ tiefe Inflationen haben Kosten. Man kann sie als Steuern auf Leute beschreiben, welche Geld halten. Die Kaufkraft der Leute bleibt zwar (in der Theorie) gleich, da die Löhne ebenfalls steigen. Das Problem sind eher Verzerrungen der relativen Preise. Da die Preise von Gütern mit unterschiedlichen Frequenzen angepasst werden entsprechen diese nicht mehr den Preisen im effizienten Marktgleichgewicht (Bsp. Eine Monatszeitschrift wird erst nach einem Monat teuerer, Aktien jedoch sofort). Die Preissignale sind dadurch gestört und man verliert Rente. Diese Verzerrungen treten vor allem bei tiefen Inflationen auf, da die Leute diese nicht sofort erkennen und somit keinen Handlungsbedarf haben. Dies ist ein Problem, welches in der Theorie nicht besteht, in der Praxis jedoch deutliche Effekte verursacht. • Transaktionskosten: Da die Leute viel öfter Geld wechseln oder in Güter umsetzen als sie dies normalerweise tun würden entstehen erhebliche Transaktionskosten • Schädigung der Kreditgeber: Ein Kredit lautet auf einen nominellen Betrag. Nach einer Inflation zahlt man real weniger zurück. Es werden folglich keine Investitionen mehr getätigt, da sich keine Kreditgeber mehr finden, welche sich darauf einlassen. • Schädigung der Geldhalter. • Kalte Progression: Bei einem progressivem Steuersystem sind die Steuersätze an das nominelle Einkommen gebunden. Bei einer Inflation erhält man nominell mehr Lohn und kommt so in eine höhere Stufe. Man zahlt deshalb eigentlich zu viel Steuern. Für den Staat kommt somit ein wenig Inflation gelegen. Inflationssteuer Kosten der Inflationsbekämpfung: Wie bereits in einigen Graphiken ersichtlich wurde verursacht eine restriktive Geldpolitik ein tieferes Preisniveau und zudem einen tieferen Output. Deshalb werden die Produzenten zwangsläufig an Kapital und Arbeit sparen. Folglich verursacht eine Inflationsbekämpfung immer Kosten. Die Phillips-Kurve: Inflation Natürliche/ Strukturelle AL Arbeitslosigkeit -32- D.3. • Die Phillips-Kurve ist abgeleitet aus gemessenen Daten und kein theoretisches Konstrukt. Es geht hervor, dass ein Trade-Off zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit besteht. Wenn durch eine expansive Geldpolitik die Arbeitslosigkeit verringert wird, entsteht Inflation und umgekehrt. • Daraus folgt, dass die Inflationsbekämpfung hohe Kosten verursacht. • Samuelson und Solow haben dieses Modell in den 60er Jahren zur Beratung der US-Regierung verwendet. Ein Grund ist sicher, dass es einfach zu erklären ist und auch die Intuition anspricht. • Langfristig sollten die beiden Grössen Inflation (nomineller Effekt) und Arbeitslosigkeit (realer Effekt) jedoch unabhängig sein. In der Theorie hat die Verringerung der Inflation keinen Einfluss auf die Arbeitslosigkeit, da alle Leute die Löhne, die Preise und ihre Inflationserwartungen perfekt anpassen. • In der Praxis existiert jedoch (zumindest kurzfristig) ein Zusammenhang. Der Effekt der Phillips-Kurve entsteht, da die Leute ihre Inflationserwartungen eben nicht perfekt anpassen und deshalb Verzerrungen entstehen. Dies erkannte man in den 80er Jahren als in den USA ein neuer Chef der Zentralbank auftrat, welcher verkündete, die Inflation in einem bestimmten Zeitraum auf ein bestimmtes Niveau zu drücken. In der Theorie stellte man sich vor, dass durch dass öffentliche Auftreten und das Vertrauen der Bevölkerung die Leute ihre Inflationserwartungen anpassen würden. In Wirklichkeit wurde dies jedoch überschätzt und die USA kamen in eine Rezession. • Man kann den Effekt jedoch Wirtschaftspolitisch nicht ausnutzen (d.h. je nach Bedürfnis einen Punkt auf der Phillips-Kurve wählen), da die Menschen sich alles merken und entsprechend ihre Erwartungen ändern. Somit kann es zu einer Rechts- oder Linksverschiebung der Phillips-Kurve kommen, wobei die strukturelle Arbeitslosigkeit erhöht respektive vermindert wird. • Monetaristen verwenden einen anderen Ansatz. Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass man bei einer Punktewolke die sich etwa über dieselbe Distanz in x- wie auch in y-Richtung erstreckt, keinen Zusammenhang mehr erkennen kann. Die Phillips-Kurve wäre nach dieser Theorie eine Senkrechte auf die xAchse. • Beide Interpretationsmöglichkeiten einer solchen Punktewolke sind wiederum Extreme, welche in der Praxis wohl kaum in reiner Form vorkommen. In der Regel wird ein Gemisch aus beiden auftreten. Man kann sagen, dass die PhillipsKurve kurzfristig negativ geneigt ist, langfristig jedoch eine Senkrechte auf die xAchse darstellt. Instrumente der Geldpolitik Definition: „Geld ist alles, was als generelles Zahlungsmittel akzeptiert wird“ • Geld wird von allen akzeptiert und verursacht somit weniger Transaktionskosten als dies zum Beispiel in einer Tauschwirtschaft der Fall wäre. • Geld sind nicht nur Noten und Münzen (Bsp. Kreditkarten) Geldmengendefinitionen (Nach Liquidität geordnet): 1. Noten und Münzen (CH: 33 Mia.) 2. M1 = Bargeld + Sichtguthaben + Transaktionskonti (CH: 200 Mia.) (Sichtguthaben sind Konten der Geschäftsbanken bei der SNB; Transaktionskonti sind normale, kurzfristige Konten) 3. M2 = M1 + Spareinlagen (CH: 390 Mia.) (Spareinlagen sind weniger liquide als Transaktionskonten. D.h. die vorzeitige Auflösung ist oft mit Kosten verbunden.) -334. M3 = M2 + Termineinlagen (CH: 500 Mia.) (Termineinlagen sind nur an einen bestimmten Termin in Bargeld umzuwandeln) Wie schaffen Geschäftsbanken Geld? 10 (Reserve) 100 Bank 1 90 (Kredit) 9 (Reserve) 90 Bank 2 81 (Kredit) etc. Die Banken müssen einen Teil den sie (von der SNB) bekommen in Reserven anlegen. Den Rest geben sie in Form von Krediten aus. Früher oder später gelangt das Geld des ersten Kredits an eine andere Bank, welche wiederum Reserven bildet und den Rest ausleiht. Theoretisch können also aus 100 Geldeinheiten 1000 werden, wenn die Banken keine Reserven bilden. Das Problem ist, dass mehr Geld entsteht, als in liquider Form überhaupt vorhanden ist. Wenn nun also alle (oder viele) Leute ihr Geld abheben wollen kann es zu einer Bankenkrise kommen, da die Reserven nur einen Bruchteil des geforderten Betrages ausmachen. Aus diesem Grund muss der Bankensektor stark reguliert sein. Instrumente der Geldpolitik: A. Offenmarktpolitik • SNB kauft am Markt Assets mit neuen Noten • SNB verkauft am Markt Assets und behält die Noten Bilanz der SNB (vereinfacht) AKTIVEN Gold Devisen Wertpapiere PASSIVEN Noten u. Münzen Girokonten Reserven Die SNB kann die Position der Noten und Münzen, welche im Umlauf sind beliebig verändern. N, M N, M Devisen (o.a.) SNB kauft Devisen, Geld wird geschaffen Wertpapiere (o.a.) SNB verkauft Wertpapiere, Geld wird vernichtet Gefahren: Die SNB kann theoretisch alles kaufen, was auf dem Markt ist, indem sie einfach immer mehr Geld druckt. Langfristig führt dies jedoch zu einer starken Inflation und zu einer extremen Bilanzverlängerung. B. Diskontpolitik Der Diskontsatz ist ein Zinssatz, welcher für Geschäftsbanken verbindlich ist, wenn sie sich bei der SNB verschulden. Die SNB gewährt also eigentlich einen Kredit an die Geschäftsbanken. Bei einem hohen Diskontsatz ist es kostspielig sich zu verschulden, was die Banken dazu bewegt mehr Reserven zu bilden und so weniger Geld zu schaffen. Um eine expansive Geldpolitik zu betreiben wird man den Diskontsatz tief ansetzten, damit die Banken möglichst wenig Reserven bilden und so die Geldmenge erhöhen. -34C. Mindestreservenpolitik Kraft Gesetz müssen die Banken eine gewisse Menge an Reserven bilden. Wenn man nun diesen Reservensatz erhöht entspricht dies einer restriktiven Geldpolitik und umgekehrt. D.4. Fallbeispiel Geldpolitik der SNB D.4.1. D.4.2. D.4.3. Institution: • Bank der Banken • 1907 gegründet • Unabhängig von der Wirtschaftspolitik. Die SNB ist nicht ein Teil der Bundesverwaltung, d.h. der Bundesrat kann keine Anweisungen geben. Dieser wählt jedoch das Direktorium und bildet einen wirtschaftspolitischen Ausschuss, welcher sich regelmässig mit den Direktoren der SNB trifft. • Aufgabe: „Gewährleistung der Preisstabilität unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ • Die Preisstabilität wird im Gegensatz zur im Leitmotiv des Federal Reserve (Zentralbank der USA) verankerten Nachfragepolitik betont. Geldpolitische Strategie: • Erste Phase: Bretton/Woods-Phase (Konferenz nach dem 2. Weltkrieg). Man beschloss fixe Wechselkurse einzuführen, also alle Währungen an den Dollar zu binden. Mit dieser Massnahme wollte man einer Wiederholung eines Abwertungswettlaufs wie in der Zwischenkriegszeit entgegenwirken. • Zweite Phase: Ab 1973 flexible Wechselkurse. Die USA hatten zu dieser Zeit eine starke Inflation und rissen dadurch alle anderen mit, bis diese beschlossen, ihre Währungen wieder abzukoppeln. Phasen der Schweizer Geldpolitik: 1. Wechselkursziel (bis 1973) Wegen der Bindung des Schweizer Frankens an den Dollar musste man bei einer Auf- bzw. einer Abwertung Gegensteuer durch restriktive respektive expansive Geldpolitik geben. Dadurch konnte man die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nicht mehr steuern (vgl. EU-Währungsunion). Auch die Verfolgung eines Inflationsziels war damit ausgeschlossen. Wenn man die Geldmenge trotzdem erhöht hätte, wäre der Zins gefallen, die Anleger hätten Devisen im Ausland gekauft, da es kein Wechselkursrisiko mehr gab (d.h. alle Währungen veränderten sich im selben Masse), wodurch die Geldmenge wieder gefallen wäre. Der Effekt dieser Massnahme hätte sich also gleich wieder selbst ausgelöscht. 2. Geldmengenziel (1974-1999) Beeinflusst durch den Monetarismus. Wie wir schon gesehen haben vertreten Monetaristen die Auffassung, dass man die Inflation wirtschaftspolitisch am einfachsten über die Geldmenge steuern kann. In den 70er und 80er Jahren erzielte man mit dieser Methode gute Erfolge. Später jedoch erkannte man dass die Umlaufsgeschwindigkeit nicht wie angenommen konstant ist, sondern sich durch Ereignisse wie zum Beispiel der Einführung von Kreditkarten oder e-banking extrem verändert. 3. Inflationsziel (ab 1999) Das Inflationsziel ist mittlerweile die wichtigste Komponente in der Geldpolitik der Schweiz. Man versucht direkt die Inflation zu beeinflussen. Es treten jedoch Schwierigkeiten auf durch die Verzögerung der Wirkung von Massnahmen, da -35sich die Leute derer zuerst „bewusst“ werden müssen, um ihre Inflationserwartungen zu ändern. Die Strategie besteht aus drei Komponenten: D.5. • ∅ Inflation < 2% pro Jahr • Halbjährliche Inflationsprognose für die nächsten zwei Jahre. Die Prognose bezieht sich auf die Situation in zwei Jahren, falls die Politik sich nicht verändert. Wenn die Prognose voraussagt, dass die Inflation mehr als 2% betragen wird, werden Massnahmen ergriffen. • Indirekte Steuerung über den 3-Monate LIBOR (kurzfristiger Geldmarktzinssatz. Auf diesem Markt geben sich Banken gegenseitig Kredite.). Die SNB kann diesen Zinssatz durch Repos (Kredite an Banken mit einer Dauer von ein bis zwei Wochen) indirekt steuern. Diese werden zu einem günstigeren Zinssatz angeboten als dies am Geldmarkt der Fall ist um diese Kredite für Banken attraktiver zu machen. Dies ist möglich, da die Banken für solche Kredite Sicherheiten in Form von Wertpapieren hinterlegen müssen. Die SNB verändert nun je nach Ziel der Massnahme den Zinssatz der Repos und erreichen damit, dass sich der LIBOR tendenziell in dieselbe Richtung bewegt. Da sich der LIBOR natürlich nicht 1:1 zu den Repos verändert, gibt die Nationalbank ein Zielband an, wo der LIBOR zu liegen kommen soll. Je nach Massnahme wird dieses Zielband höher (restriktiv) oder tiefer (expansiv) angelegt sein. Auf diese Weise wird die Diskontpolitik realisiert. Geldpolitik und Wechselkurse D.5.1. Einführung: Intuition: Eine expansive Geldpolitik führt zu einer Abwertung der Währung, da sich die Geldmenge erhöht. Nomineller Wechselkurs (Bekannt aus den Medien) Realer Wechselkurs (Weniger bekannt, für ökonomische Zwecke jedoch weitaus bedeutender) Konzept der Kaufkraftparität („law of one price“ 1kg Zucker sollte überall gleich viel Kosten; KKP) e x p* = p e: nomineller Wechselkurs CHF/$ p*: Preis(niveau) im Ausland $ p: Preis(niveau) im Inland CHF Bei dieser Gleichung wird die KKP vorausgesetzt. Bei einer expansiven Geldpolitik steigt demnach p und somit auch e. In der Realität treten dabei jedoch zwei Grundsätzliche Probleme auf 1. KKP gilt wenn überhaupt nur langfristig Der Reale Wechselkurs ist bestimmt durch (e x p*)/p (Nomineller Wechselkurs, korrigiert mit den Preisunterschieden) Falls nun KKP gilt, ist der reale Wechselkurs gleich eins (Anmerkung: Wenn der reale Wechselkurs kleiner eins ist, kann man daraus schliessen, dass ein Land relativ wettbewerbsfähiger ist) Warum gilt KKP kurzfristig nicht? e (nomineller Wechselkurs) reagiert im Gegensatz zum Preis sofort auf Veränderungen der Geldpolitik. Deshalb beeinflusst eine expansive (oder restriktive) Geldpolitik kurzfristig sowohl den nominellen als auch den realen Wechselkurs. -36Kurzfristig: e Abwertung der Währung. (e x p*)/p Abwertung des realen Wechselkurses wenn p und p* konstant bleiben. Keynesianismus Langfristig: e Abwertung der Währung. (e x p*)/p Unveränderter realer Wechselkurs. Kein Unterschied in der Interpretation der beiden Wechselkursen (Monetarismus) Daraus folgt, dass eine Stimulierung der Nachfrage nur durch eine Verzögerung der Angleichung des Preises an den Wechselkurs funktioniert. Sonst wäre eine expansive Geldpolitik (wie Vollblut-Monetaristen behaupten) wirkungslos. Daraus folg zudem, dass eine expansive Geldpolitik keinen Einfluss auf langfristiges Wachstum haben kann. 2. KKP gilt nur für handelbare Güter Verschieden Güter weisen verschiedene Grade der Handelbarkeit auf. Vor allem Dienstleistungen sind so gut wie gar nicht handelbar und weisen deshalb oft zu hohe oder zu tiefe reale Preise auf. Zusätzlich kann die Handelbarkeit mit Zöllen oder ähnlichen Massnahmen reduziert werden. Ein gutes Beispiel für ein nicht handelbares Gut ist ein Big Mac. Diese Eigenschaft und weil man ihn auf der ganzen Welt in einer vergleichbaren Qualität beziehen kann, führte dazu, dass nun eine Zeitschrift jedes Jahr einen Big Mac-Index aufstellt um herauszufinden, welche Währungen gegenüber dem Dollar um wieviel unter- beziehungsweise überbewertet sind. Beispiel: Preis in CHF 6.30; p Preis in USD 2.45; p* CHF/USD 1.66; e Realer Wechselkurs: p/(e x p*) = 6.3/(1.66 x 2.45) = 6.3/4.13 = 1.53 Umgerechnet kostet demnach ein Big Mac in New York 4.13 CHF Der Franken ist also gegenüber dem Dollar um 53% überbewertet. Bei perfekt handelbaren Gütern würde bei einem solch eindeutigen Unterschied Arbitrage (Billigeres Gut wird gekauft und an dem Ort wo die Preise höher sind wieder verkauft, da Gewinn zu holen ist) auftreten, und so wären die Preise wieder gleich. Der eindeutig überteuerte CHF weist auf einen systematischen Unterschied in der Wettbewerbsstruktur hin. Dieses Problem kann man nicht mit der Geldpolitik beheben, da dies nur kurzfristige Effekte zur Folge hätte. Langfristig würden diese Effekte durch Inflation wieder aufgehoben werden. In der Schweiz haben die Exporteure zur Zeit grosse Schwierigkeiten, da sie die Löhne in überteuerten CHF zahlen müssen. Die Erträge bleiben jedoch gleich, da sich der reale Preis im Ausland nicht ändert. Das heisst sie haben höhere Kosten bei gleich bleibenden Erträgen. Die geforderte Reaktion der SNB ist aber nur für die Überbrückung einer Phase sinnvoll. Langfristig müsste man wie schon gesagt beim Wettbewerb ansetzten. -37- E. Wirtschaftspolitisches Ziel „Gerechte Einkommensverteilung“ E.1. Verteilung E.1.1. Verteilung vs. Effizienz: • Die Politik interessiert sich vor allem für Verteilungsfragen • Aus ökonomischer Sicht muss man die Effizienz immer berücksichtigen, wenn man Verteilungsziele verfolgt • Die Aufgabe eines Ökonomen ist es, die Effizienz der jeweiligen Ziele zu beurteilen und nicht die Ziele an sich Bsp. P S KR pm PR D MR qm Q Durch die Einführung eines Mindestpreises wird die Konsumentenrente kleiner und die Produzentenrente wird grösser. Wenn man den Preiseingriff aufhebt verteilt man die Rente von den Produzenten zu den Konsumenten um und die gesamtwirtschaftliche Rente ist maximiert. Wenn man ein Verteilungsziel verfolgt ist es unter Umständen besser, die Umverteilung direkt (und nicht über die Preise) vorzunehmen. Es erweist sich jedoch als sehr schwierig dies umzusetzen, da diejenigen, welche vom Preiseingriff profitieren, ihren Vorteil nicht hergeben wollen, selbst wenn man sie auf den nachfolgenden Direkteingriff verweist. Hier spielt eine Unsicherheit mit, ob man danach trotzdem noch gleich gut gestellt ist wie mit Preiseingriff. Verteilungsziele sind selbstverständlich nötig in einer freien Marktwirtschaft. Eine vollständige Gleichverteilung wäre jedoch nicht von Vorteil, da dadurch Anreize um Leistung zu erbringen eliminiert würden. -38- E.1.2. Einkommensverteilung: Messung der Einkommensverteilung: Die Lorenz-Kurve 45° Einkommen % 100 % A B C Bevölkerung % 100 % Auf der 45° Kurve herrscht eine perfekte Gleichverteilung (10 % der Bevölkerung haben 10 % des Einkommens etc.) Gini-Koeffizient = (Schraffierte Fläche / ABC) x 1000 Bei perfekter Gleichverteilung: Gini-Koeffizient = 0 Bei perfekter Ungleichverteilung: Gini-Koeffizient = 1000 Gini-Koeffizient der nationalen Armutsstudie 1990: Schweizer Ausländer 282 223 Selbständige Angestellte Nicht erwerbstätige 395 246 321 Alleinstehende Frauen Alleinstehende Männer Paare mit Kindern Alleinerziehende 260 309 258 230 GK total Einkommen GK total Vermögen 273 713 Viele Ausländer mit tiefem Lohnniveau Höhere Sicherheit für Angestellte Dieser Unterschied ist in den meisten Ländern zu beobachten Im Vergleich mit den anderen OECD Ländern sind die Einkommen in der Schweiz sehr gleich verteilt. Der Grund dafür ist der sehr gut ausgebaute Sozialstaat. -39- E.1.3. Dimensionen der Verteilung: • Typische Diskussion von Einkommen und Vermögen • Wichtige sonstige Dimensionen: • E.2. - Personelle (Altersvorsorge, Gesundheitswesen, Ausbildung) - Sektorale (Landwirtschaftspolitik, Ausländerpolitik) - Regionale (Finanzausgleich, Bergbauernförderung, Tourismus) Staatsausgaben: - Leistungsstaat Produktion öffentlicher Güter - Umverteilungsstaat „Sozialpolitische Massnahmen“ Sozialwerke in der Schweiz E.2.1. Prinzipien Sozialer Sicherung: • Ohne Verteilungsziel • Mit Verteilungsziel Normale Versicherung Sozialversicherung Versicherungsprinzip Sozialversicherungs- Fürsorgeprinzip prinzip Beiträge oder Leistungen Hausratsversicherung AHV, ALV Fürsorgeleistung Ergänzungsleistung AHV Verantwortung Äquivalenz Prämien , Erstattung Äquivalenz + Sozialer Ausgleich Sozialer Ausgleich Ja Steht nicht zur Diskussion, da beitragslos Obligatorium E.2.2. Nein Zweige der Sozialversicherungen Zweig Wichtigste Leistungen Kosten in CHF im Jahr 2000 1. • Altersrente 27.7 Mrd. • Witwen-/Waisenrente AHV (I Säule) 2. (Obligatorische) Krankenversicherung (KVG) • • • Leistungen im Krankheitsfall Prävention Mutterschaft 15.9 Mrd. 3. Berufliche Vorsorge (II Säule; Pensionskassen; BVG) • • Altersrente Witwen-/Waisenrente 13.4 Mrd. 4. IV (Invalidenversicherung) • • Invalidenrenten Eingliederungsmassnahmen 8.7 Mrd. 5. Arbeitslosenversicherung (AVIG) • • Arbeitslosenentschädigung Eingliederungsmassnahmen 5.2 Mrd. -40- E.3. 6. Unfallversicherung (SUVA) • • 7. Familienzulage 8. 9. Entschädigungen Pflegeleistungen 4.6 Mrd. • Kinderzulagen 4.4 Mrd. Ergänzungsleistungen AHV/IV • Auszahlung der Differenz zum Existenzminimum 2.3 Mrd. Erwerbsersatzordnung • • Grundentschädigung Kinderzulage 0.8 Mrd. • Kosten der Sozialversicherungen in der Schweiz 2000: 82.2 Mrd. (ca. 20% vom BIP) • Finanzierung durch Beiträge (Lohnprozente 52.1 Mrd. und Kopfbeiträge 12.7 Mrd.) Altersvorsorge in der Schweiz E.3.1. Finanzierung der Altersvorsorge: 1. Umlageverfahren Die Einzahlungen der Erwerbstätigen werden bei diesem Verfahren direkt an die momentanen Altersvorsorgeempfänger ausbezahlt (AHV) 2. Kapitaldeckungsverfahren Die Erwerbstätigen sparen Kapital an, welches ihnen später als Renten ausbezahlt wird (BVG) • 3 Säulen-Prinzip I. Säule: AHV (Sicherung des Existenzminimums) II. Säule: BVG III. Säule: Privates (steuervergünstigtes) Sparen (Notwendig um die gewohnte Lebensweise weiterführen zu können) • Die Überalterung der Bevölkerung macht das Umlageverfahren problematisch, da der Altersquotient steigt. • Lebenserwartung nach 65 Jahren in der Schweiz Frauen Männer 1950 12.4 14 1995 16 20.5 2010 17.5 22.3 2025 19 23.5 • Altersquotient (Quotient zwischen der Anzahl Leuten über 65 und der Anzahl Leute zwischen 20 und 64) 1950 0.16 1 „Alter“ auf 6 potentielle Arbeiter 2000 0.25 1:4 2010 0.29 1:3.5 2025 0.39 1:2.5 • Grosser Mehrbedarf der Leute bei gleichbleibenden Leistungen. Schätzung der Zusätzlichen Kosten in MWSt. AHV KVG ... Total 2000-2010 +1.2 +1.5 +3.4 2010-2025 +3.1 +2.0 +5.5 +8.8 • Drei Ansatzpunkte zur Lösung des Finanzierungsproblems 1. Höhere Finanzierungsbeiträge 2. Tiefere Leistungen 3. Höheres Rentenalter -41- E.3.2. 11. AHV-Revision: Konzentration auf die Finanzierung bis 2010: E.3.3. • Finanzierung: 2003: MwSt. +1.5% 2006: MwSt. +1.0% • Rentenalter: Für Frauen Erhöhung auf 65 Flexibilisierung der frühzeitigen Pensionierung zwischen 62 und 65 Entspricht einer Subventionierung für tiefe Einkommen • Leistungen: Witwenrente wird nur noch ausbezahlt, wenn abhängige Kinder vorhanden sind BVG-Revision: 1. Anpassung des Umwandlungssatzes (Prozentsatz des angesparten Kapitals, der als jährliche Rente ausbezahlt wird) Heute: 7.2% Vorschlag: 6.65% jährliche Rente würde um 8% erhöht werden 2. Finanzierung Heute: Frauen 42-51 52-62 Männer 45-54 55-65 Neu: 45-65 E.4. 15% des Einkommens 18% des Einkommens 18% des Einkommens Working Poor in der Schweiz E.4.1. Einführung: • „Man sollte vom Lohneinkommen leben können“ • Poor vs. Working Poor • Bei einem stark integrativen Arbeitsmarkt wie in der Schweiz werden unter Umständen Leute beschäftigt, welche relativ unproduktiv sind. Ihr Einkommen ist entsprechend tief. • Relative Armut vs. absolute Armut. In der Schweiz gibt es nur relative Armut. • Die SKOS legt in der Schweiz Richtlinien fest, wer als arm gilt und wer nicht. Diese setzen sich aus Einkommen, Steuern und Krankenversicherungsbeiträgen zusammen. • Armutsgrenzen für Stadtbewohner (Einkommen pro Monat) 1 Person 1950.— 2 Personen 2700.— 3 Personen 3250.— 4 Personen 3620.— • Zahlen CH 1999: 250’000 Erwerbstätige sind arm. -42• E.4.2. Besonders betroffen sind Frauen, Ausländer, junge Familien mit Kindern und Alleinerziehende Lösungsansätze der Wirtschaftspolitik: • Arbeitsmarktpolitik Mindestlöhne (politisch umstritten aus bereits besprochenen Gründen) • Sozialpolitik Direkte Subjekthilfe am Betroffenen Earned Income Tax Credit (Bei tiefen Einkommen gibt es „negative“ Steuern. In den Staaten funktioniert dies ganz gut, in der Schweiz ist es kaum durchzusetzen.) -43- F. Öffentliche Finanzen F.1. Staatsausgaben, Staatseinnahmen und Verschuldung F.1.1. Staatsausgaben: 1. Ordnungsaufgaben Bereitstellung öffentlicher Güter 2. Versorgungsaufgaben Bereitstellung öffentlicher und meritorischer Güter (An sich private Güter, welche vom Staat wegen eines Qualitätsanspruchs bereitgestellt werden; Bsp. Post) 3. Verteilungsaufgabe Sozialwerke 4. Stabilisierungsaufgabe F.1.2. Konjunkturpolitik mit Staatsausgaben Staatseinkommen: Geldschöpfung: Staaten, welche in Kriege verwickelt sind finanzieren ihre Ausgaben durch Bezüge bei der Zentralbank. Im Prinzip beziehen sie einen Kredit, welcher jedoch kaum jemals wieder zurückbezahlt wird. Durch diese Massnahme kann der Staat zwar seine Ausgaben decken, jedoch entsteht auch (Hyper-)Inflation. Dadurch wird diese Art der Geldbeschaffung eigentlich durch diese Leute bezahlt, welche trotz Inflation Geld halten (Inflationssteuer). Steuern: • Direkte Steuer Setzten bei „persönlichen Merkmalen der Zahlenden an. Meist progressive Systeme (Verteilungsaspekt berücksichtigt) • Indirekte Steuern Sind „unpersönlich“ (Bsp. Bei Kauf von Gütern und Dienstleistungen). Proportionale Systeme • Gebühren: Gehören eigentlich nicht zu den Steuern, da die Höhe der Zahlung von der Art und Menge einer bezogenen Leistung abhängt. In gewissen Situationen sind Gebühren den Steuern vorzuziehen, da man durch diese eine Signal- und Lenkungswirkung erzielen kann (Man realisiert wie viel zum Beispiel die Abfallentsorgung kostet) Steuern verursachen auch Kosten. Durch den Eingriff in den effizienten Marktpreis entsteht ein Deadweight-Loss. Bei unelastischer Nachfrage ist dieser jedoch kleiner als bei einer elastischen. Deshalb sollte man eigentlich tendenziell jene Güter besteuern, welche nicht substituiert werden können oder unbedingt benötigt werden (Bsp. Tabak). Relativ effizient wäre es auch unqualifizierte Arbeit zu besteuern, was jedoch politisch sehr schwierig zu vertreten ist. Ein Lösungsansatz besteht darin, alles etwa gleich zu besteuern. Dadurch werden alle relativen Preise erhöht und dadurch besteht kein Grund zu substituieren. F.1.3. Finanzföderalismus: Steuereinnahmen sind in der Schweiz auf den unteren Ebenen vergleichsweise hoch: • Bund 46 Mrd. • Kantone 58 Mrd. • Gemeinden 40 Mrd. -44• Vorteil: Wettbewerb zwischen Gemeinden und Kantonen (Mobilität der Leute zwischen Gemeinden und Kantonen ist sehr hoch). Dies verhindert zu hohe und zu ungerechte Steuern • Nachteil: Vermehrt fehlender Zusammenhang zwischen der Zahlung der Steuer und der Leistung (Bsp. Ein Ticket für die Oper in Basel wird vom Kanton mit einem ziemlich hohen Betrag subventioniert. Es dürfen aber auch Leute von ausserhalb diese Vorstellungen besuchen) Finanzausgleich: 1. Beteiligung der Kantone an den Bundeseinnahmen. Die Kantone erhalten Geld, weil gewisse Steuern wie die Mehrwertsteuer nicht kantonal verwaltet werden könnten. 2. Freier Finanzausgleich. Die Kantone erhalten Geld aus Umverteilungsgründen. Es erfolgt ein Ausgleich nach der Finanzkraft der Kantone (Problematisch, da „ineffiziente“ Kantone „belohnt“ werden) 3. Zweckgebundener Finanzausgleich. Ziel ist es die Effizienz zu erhöhen (Bsp. Opernhaus) und Spillovers zu finanzieren (positive Externalitäten internalisieren) F.1.4. Effekte von Budgetdefiziten: Ersparnis des Staates: SG = T – G Ersparnis der Privaten: SP = Y – T – C Gesamte Ersparnis: S = Y – G – C Y = C + I + G + NX S = I + NX Daraus kann man ableiten, dass wenn durch ein Budgetdefizit S fällt entweder I oder NX oder beides fallen muss. Das heisst das Budgetdefizit hat etwas mit dem Leistungsbilanzdefizit zu tun (NX) Das Budgetdefizit (T – G < 0) muss über Verschuldung finanziert werden. Die Steuereinnahmen reichen offensichtlich nicht aus (T zu klein). 1. Inlandsverschuldung: Die Kreditnachfrage des Staates steigt (Crowding-Out Effekt) i I 2. Auslandsverschuldung: Ausländisches Kapital fliesst ins Inland, die Nachfrage nach CHF steigt, der CHF wird aufgewertet, NX fallen F.1.5. Vor- und Nachteile der Staatsverschuldung: Vorteile: 1. Intertemporaler Finanzierungsausgleich: Die Investitionen des Staates sollen von den jeweiligen Nutzniesser bezahlt werden. Das heisst, dass ein grosses Projekt, welches erst für nachfolgende Generationen einen Nutzen bringt nicht von der gegenwärtigen Gesellschaft bezahlt werden soll. Problematisch ist, dass diese Generationen nicht mitentscheiden können. 2. Steuerglättung: Es ist extrem schwierig ein Budget exakt zu planen. Da es immer wieder Abweichungen gibt müssten diese, wenn ein Budgetdefizit nicht in Betracht käme allein durch Steuern finanziert werden. Das heisst die Steuersätze würden ständig krass wechseln. 3. Makroökonomische Stabilisierung (siehe Keynesianismus). Problematisch ist, dass nicht nur Rezessionen, sondern auch Booms gedämpft werden. -45Nachteile: 1. Crowding-Out Effekt. Das Wachstum wird durch steigendes i beeinträchtigt. 2. Schneeballeffekt. Wenn die Schulden steigen, werden auch die Zinslasten grösser. Dadurch werden mehr Mittel erforderlich um diese zu decken, welche wiederum durch Schulden finanziert werden etc. 3. Verlust an Handlungsspielraum. Andere Ausgaben müssen reduziert werden 4. Verlockung zur Monetisierung der Schulden (Notenpresse anwerfen). Dies erreicht man entweder durch Geldschöpfung oder man kann die Schulden auch „weginflationieren“ (Subtilere Methode). Da die Schulden in nominellen Grössen geschuldet werden, heizt die Regierung die Inflation an und muss somit real weniger zurückbezahlen. F.1.6. Gründe für Schuldenwachstum: Politisch-Ökonomische Gründe: • Politische Attraktivität der Verschuldung • Trennung zwischen Ausgabenbeschluss und Finanzierung. Das Parlament muss sich keine Gedanken machen, wie ein Projekt finanziert wird, dies ist die Aufgabe des Bundesrates. • Durchsetzung von Sonderinteressen. Viele Parlamentarier sichern sich ihre Projekte durch Stimmentausch ab. Somit werden mehr Anträge angenommen. Dem wird durch den Mechanismus der Schuldenbremse entgegengewirkt. -46- G. Aussenwirtschaftspolitik G.1. Effekte der Handelsliberalisierung und europäische Integration G.1.1. Freihandel vs. Protektionismus: • Eine Öffnung der Wirtschaft ist aus ökonomischer Sicht wegen erhöhter Effizienz gut. • Es besteht ein Unterschied zwischen absoluten Vorteilen und komparativen Vorteilen. Ein Land hat einen absoluten Vorteil, wenn es ein Produkt besser als alle anderen herstellen kann (Spezialisierung). Dies heisst jedoch nicht, dass ärmere Länder bei einer Öffnung der Wirtschaft nicht profitieren könnten. Denn diese haben komparative Vorteile. Da sich die reichen Länder auf High Tech spezialisiert haben, fehlen diesen die Ressourcen zur Produktion anderer Güter. Obwohl ein reicheres Land das Gut eventuell effizienter herstellen könnte, kommt das andere Land zum Zug. Deshalb lohnt es sich aus Effizienzsicht immer den Markt zu öffnen. Wie dieser Rentenzuwachs verteilt wird ist eine andere Frage. P S pw p* D q* Q Export Sobald ein Markt geöffnet ist werden die Firmen Preisnehmer des Weltmarktpreises. Die Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente (schraffierte Flächen) ist grösser, als im (geschlossenen) Marktgleichgewicht (p*, q*). Bei einem Weltmarktpreis über dem Gleichgewichtspreis ist die Produzentenrente höher als die Konsumentenrente. Zudem werden die Überschüssigen Güter, welche vom heimischen Markt nicht mehr aufgenommen werden könnten exportiert. Bei einem tieferen Weltmarktpreis würden die Konsumenten gewinnen und es würde mehr importiert werden. • Internationaler Handel hat folglich eine Umverteilung zur Folge. Wer begünstigt respektive benachteiligt wird hängt vom Weltmarktpreis ab. • Theoretisch gibt es also bei jeder Marktöffnung immer mehr Gewinner als Verlierer. Trotzdem ist es schwierig eine solche durchzusetzen, da es immer kurzfristige Verlierer gibt. -47- Wohlfahrtsverluste durch Protektionismus: P S Pw(1+t) pw D Q Import Durch eine Steuer auf Importe steigt der Weltmarktpreis um den Faktor 1+t. Dadurch sinkt die Konsumentenrente um die Fläche zwischen pw, pw(1+t) und der Nachfragekurve. Diese Rente wird nun umverteilt. Die längsschraffierte Fläche geht an die Produzenten. Das schraffierte Viereck stellt die Zolleinnahmen des Staates dar. Die zwei karierten Dreiecke sind verlorene Rente, also deadweight loss. Verschiedene Formen des Protektionismus: G.1.2. • Zölle • Nichttarifarische Handelshemmnisse. Zum Beispiel Quoten, Subventionen, Technische Vorschriften (Durch das Cassis de Dijon Prinzip in der EU entschärft; eine Zulassung in einem EU-Land gilt in allen Mitgliedsstaaten), Öffentliche Aufträge (10%-20% des BIP), gespaltene Wechselkurse. Wohlfahrtseffekte der Integration: Integration bedeutet selektiver Freihandel. Einige Länder schliessen sich zusammen um untereinander Freihandel zu betreiben. Dies läuft eigentlich der Idee der Globalisierung zuwider. Jedoch ist es wahrscheinlich eine notwendige Zwischenetappe, da ein vollständig offener Weltmarkt nie politisch nie in einem Schritt realisierbar wäre. -48- Markt im Land A P pB + T pC + T 3 4 pB 5 pC D Q Import vor Integration (von C) Import nach Integration (von B) Die Graphik zeigt ein Land A ohne eigene Produktion (alle Güter werden Importiert; keine Produzentenrente). Vor der Integration kauft A alle Güter bei C, da der Preis plus Zoll (T) tiefer ist als derjenige von B. Danach wird B integriert und der Zoll auf die Güter von B fällt weg. Deshalb bezieht A nun alles bei B. Dies jedoch zu einem höheren Preis, als dies C ohne Zoll anbieten würde (Der Zoll gegenüber C bleibt jedoch bestehen). Dadurch steigt die Konsumentenrente um 3 und 4. Der Staat verliert jedoch Zolleinnahmen von 3 und 5. Es stellt sich die Frage, ob 4 oder 5 grösser ist. Dies hängt von der Höhe des Unterschiedes zwischen pB und pC ab. Je grösser die Differenz ist, desto grösser ist 5. Je mehr Länder integriert sind, desto höher ist die Chance, dass derjenige dabei ist, welcher ein bestimmtes Gut am effizientesten herstellen kann. Dieses Argument spricht also für die Osterweiterung der EU. Bei einer Integration stellt sich also immer die Frage, ob der Handelsumlenkungseffekt, oder der handelschaffende Effekt grösser ist. Somit kann man sagen, dass aus Effizienzsicht der weltweite Freihandel first best wäre. Die Integration bezeichnet man deswegen als second best. Die Autarkie schliesslich ist der am wenigsten anzustrebende Zustand. G.1.3. Formen der Integration: Freihandel zwischen Mitgliedern Gemeinsame Aussenzölle Mobilität der Produktionsfaktoren Gemeinsame Währung und koordinierte WIPO Freihandelszone (EFTA) X Zollunion (EG vor 1985) X X Binnenmarkt (EG 92) X X X Währungsunion (EU) X X X X Vollständige wirtschaftliche Union X X X X Gemeinsame WIPO X -49Mobilität der Produktionsfaktoren beinhaltet freier Verkehr von Personen, Kapital, Güter und Dienstleistungen. Seit der Mitte der 80er Jahre beschleunigte die Integration der EU extrem. Die Schweiz ist im Moment in einer Freihandelszone mit zusätzlichen bilateralen Verträgen (Personenverkehr). G.1.4. G.2. Entwicklung der europäischen Integration: Ziel Verträge/Institutionen Beteiligte Länder • Europäischer Wiederaufbau nach WK II Marshall-Plan 1947 Westeuropa • Einbindung BRD EGKS (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) 1952 BRD, F, I, NL, B, Lux EG • Ökonomische und politische Integration. Binnenmarkt Römer Verträge 1957 EWG, Euratom E6 • Gegenposition zur EWG EFTA 1959 Freihandelszone CH, A, DK, Portugal, S, UK, IL, NL, FIN, Island • EWG-Erweiterung Beitrittsabkommen UK, DK, IL, 1972 GR, 1981 E, Portugal, 1989 • Wechselkursstabilität Europäisches Währungssystem EWS 1979 EG12 • Realisierung des Binnenmarktes Weissbuch 1985 Einheitliche Europäische Akte 1986 EG12 • Öffnung gegenüber EFTAMitgliedern EWR 1993 EG12, A, NOR, S, FIN • Europäische Währungsunion EWU Maastricht 1992 „Gründung“ EU 1993 Einführung EURO 1999 EU • Erweiterung EU Beitrittsabkommen A, FIN, S 1995 EU15 • Osterweiterung Weissbuch 1995 EU15, Osteuropäische Länder EG Monetäre Integration und Fallbeispiel Schweizer Integrationspolitik G.2.1. Europäisches Währungssystem: Wechselkurse: Europa hatte seit den 70er Jahren immer eine Tendenz zur Fixierung der Wechselkurse. Diese Präferenz zur Wechselkursstabilisierung hat zwei Gründe. Zum einen haben die Länder Europas bedingt durch die Integration eine starke Aussenhandelsverflechtung. Deshalb will man diese nicht durch starke -50Wechselkursschwankungen belasten. Zum anderen ist man von den kompetitiven Abwertungen in den 30er Jahren vorbelastet. Nach der Gleichung p = e x p* gleichen sich die Inflationsraten der beiden Länder an, wenn e fix ist (mittelfristig). Es stellt sich nun die Frage ob man den CHF an den EURO binden soll. Zwar könnte man dadurch die Inflation in der Schweiz an diejenige der EU angleichen. Der Nachteil ist jedoch, dass man keine eigenständige Inflationspolitik mehr betreiben kann und man könnte auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nicht mehr beeinflussen. Was passiert, wenn man den Wechselkurs in einem Land (Bsp. Osterweiterung) von einem Moment auf den anderen fixiert? Dadurch, dass sowohl der Wechselkurs, als auch der Preis im Ausland fix sind, die Inflation aber typischerweise höher ist als in den anderen Ländern würde man die Wirtschaft (besonders die Exportwirtschaft) ruinieren. Der Gleichung p = e x p* (wobei e und p* fix sind) kann man entnehmen, dass bei steigendem p das Land weniger wettbewerbsfähig wird. In der Praxis löst man dieses Problem so, dass man e immer wieder anpasst, bis sich auch die Inflationserwartungen der Leute angepasst haben und dann wird der Wechselkurs definitiv fixiert. Zinsen: Nach dem Zinsparitätsprinzip gilt i = i* + x wobei i den Zins im Inland, i* den Zins eines anderen Landes und x die Abwertungserwartung der inländischen Währung darstellen. Die Abwertungserwartung bezieht man aus dem Grund ein, dass sonst die Leute bei abweichenden Zinsen nur noch in dem Land investieren würden, das den höheren Zins aufweist. Die Tatsache, dass dem nicht so ist, führt man darauf zurück, dass die Leute Kursgewinne erwarten, wenn eine Aufwertungstendenz bei einer Währung besteht. Zum Beispiel ist der Nominalzins in der Schweiz sehr tief. Trotzdem investieren viele Leute in CHF, da sich der Franken ständig aufwertet. Durch die Fixierung der Wechselkurse sinkt die Abwertungserwartung und somit gleichen sich die Zinsen an. Dieser Effekt ist ein grosser Benefit, welcher den Staaten der geplanten Osterweiterung der EU zugute kommen würde. Gründe für europäische Währungskrisen: G.2.2. • Fixe Wechselkurse sind sehr schwierig aufrechtzuerhalten • Abweichungen der Inflationsraten zwischen Ländern mit fixierten Wechselkursen können dazu führen, dass die Leute in dem Land mit hoher Inflation in die Währung des anderen Landes investieren, da sie nicht mehr an die Fixierung glauben und eine Abwertung erwarten. • Starke konjunkturelle Unterschiede können dazu führen, dass das von einer Rezession geprägte Land die Fixierung aufhebt um wieder in der Lage zu sein, Geldpolitik (Anheizen der Nachfrage) zu betreiben. Denn die zwangsläufig einheitliche Geldpolitik von Ländern mit fixierten Wechselkursen kann nicht auf die jeweils unterschiedliche Situation der beiden Ländern eingehen. Wiederum investieren die Leute in die andere Währung, da sie eine Abwertung nach der Aufhebung der Fixierung erwarten. Europäische Währungsunion: Vorteile: • Eliminierung des Wechselkursrisikos (Im Gegensatz zu einer Fixierung der Wechselkurse) • Beseitigung der Transaktionskosten die mit Währungstausch verbunden sind -51• Erhöhung der Preistransparenz (Kombiniert mit der heutigen Vernetzung ein deutlicher Vorteil) Wettbewerbsdruck Nachteile: • Instrument der Geldpolitik geht verloren (makroökonomische Stabilisierung ist erschwert Problematisch bei unterschiedlichen Konjunkturzyklen) Eine Währungsunion ist vor allem für „ähnliche“ Länder vorteilhaft. „Optimale Wirtschaftsräume“: Fragestellung: Welche Staaten sind für eine Währungsunion geeignet? • Flexible Löhne • Mobile Arbeitskräfte • Starker Finanzausgleich Ausgleichsmechanismen für asymmetrische Schocks Diese Bedingungen können die Geldpolitik zum Teil ersetzen, jedoch hat letztere deutlich niedrigere Kosten Bsp. US-Bundesstaaten sind optimale Wirtschaftsräume. Zwar treten oft asymmetrische Schocks auf, jedoch erfüllen sie die ersten zwei der obigen Voraussetzungen. Bsp. Die EU erfüllt diese Kriterien nur bedingt (gerade noch ein wenig Finanzausgleich). Deshalb waren auch viele Ökonomen skeptisch was das EWS anging. Trotz der (erfolgreichen) Einführung bestehen immer noch Zweifel. Die Europäische Zentralbank kann aus bereits genannten Gründen nur die Inflation bekämpfen, da sie sonst immer jemanden stark belasten würde. Eine richtige Geldpolitik bezüglich der Nachfrage in der EU gibt es deshalb nicht. Konvergenzkriterien: Ziel ist es die Mitgliedstaaten so „ähnlich“ wie möglich zu machen Maastrichter-Vertrag: • Preisstabilität • Haushaltsdisziplin • Staatsverschuldung • Zinsen • Währungsstabilität Diese Kriterien für die Aufnahme in die Währungsunion haben unterschiedliche Bedeutung. Die Preis- und Währungsstabilität, sowie die Zinsen können eigentlich sowieso als erfüllt betrachtet werden, da in Europa diese Werte durch die Fixierung der Wechselkurse angeglichen wurden. Brisanter sind die Punkte Haushaltsdisziplin und Staatsverschuldung. Man argumentierte, dass durch die ähnlichen Werte in diesen Positionen auch die Konjunkturzyklen ähnlich werden (heikle Argumentation). Auf jeden Fall schränkte man dadurch die Fiskalpolitik der Mitglieder entscheidend ein. Einige Staaten bekamen deswegen schon Probleme (Deutschland, Portugal, Frankreich). G.2.3. Schweizerische Integrationspolitik: Ist die Schweiz ein optimaler Wirtschaftsraum? • Zentrale Lage in Europa • Flexibler Arbeitsmarkt -52• Eigentlich immer im selben Konjunkturzyklus wie Deutschland (aufgrund ausgeprägtem Aussenhandel) • Daher wäre die Schweiz aus makroökonomische Sicht gut geeignet um der Währungsunion beizutreten und stellt somit einen Sonderfall in Europa dar. Geschichte der Schweizerischen Integration: • 1960 Gründung EFTA • 1972 Freihandelsabkommen der EFTA mit der EG • 1989/90 EWR-Verhandlungen • 1992 EWR-Nein • Seit 1992 Bilaterale Verhandlungen • Seit 2002 7 Bilaterale Verträge Dossier Personenfreizügigkeit in den bilateralen Verträgen: • 2004-2007 Übergangsfrist • ab 2007 Einführung des Personenverkehrs „auf Probe“ • ab 2014 Volle Freizügigkeit • 2009 Abstimmung ob dieser Vertrag beibehalten werden soll (Schrittweise Einführung mit Notbremse) Bilaterale II: • Leftovers (Nicht abgeschlossene Punkte aus den bestehenden bilateralen Verträgen) • Zinsbesteuerungsdossier (Informationsaustausch über Bankkonti) • Zollbetrug • Schengen/Dublin (Zusammenarbeit der Polizei; Abweisung eines Asylbewerbers von einem EU-Land, in jedem EU-Land gültig) In 4 von 10 Dossiers geht es um das Bankgeheimnis. Nach dem Entgegenkommen im Personenverkehrsdossier und weil die EU schwierige Verhandlungen um die Osterweiterung führt ist diese wahrscheinlich kaum noch lange bereit mit der Schweiz über Sonderabkommen zu verhandeln.