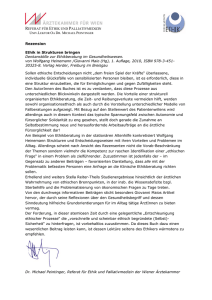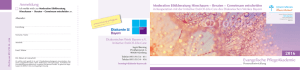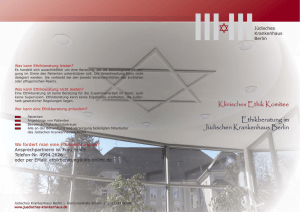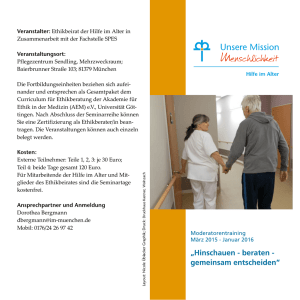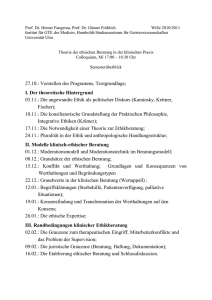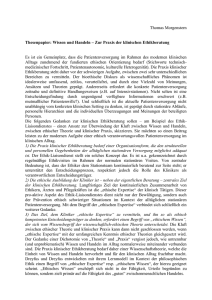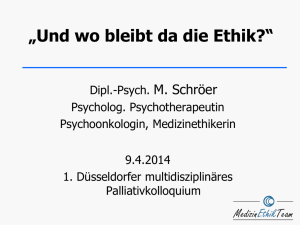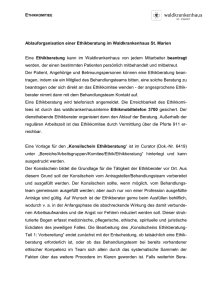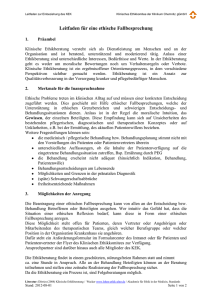Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Friedrich
Werbung

Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Professur für Ethik in der Medizin Prof. Dr. med. Andreas Frewer, M.A. Der Ethikkreis der Medizinischen Klinik 4 im Klinikum Nürnberg Evaluation der Beratungsfälle von 1999 bis 2011 im Kontext der historischen Entwicklung einer patientenzentrierten Medizin Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vorgelegt von Stephan Kolb aus Wilhelmshaven Gedruckt mit Erlaubnis der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Dekan: Prof. Dr. Dr. h.c. J. Schüttler Referent: Prof. Dr. A. Frewer Korreferent: Prof. Dr. F. Erbguth Tag der mündlichen Prüfung: 27. November 2012 Meinen Eltern Margret und Gerhard Kolb Medizin, das ist eine Weise des Umgangs des Menschen mit dem Menschen Viktor von Weizsäcker (1886 – 1957) Aus den Gesammelten Schriften Viktor von Weizsäckers, Band 9, S. 19, Einleitung zu „Fälle und Probleme. Anthropologische Vorlesungen in der Medizinischen Klinik“ (1947) Im Verständnis des Verfassers meint der Begriff „Medizin“ im umfassenden Sinne die Heilkunde an sich und schließt Ärzte wie Pflegende ein. Inhaltsverzeichnis I. Zusammenfassung 1 II. Summary 2 1. Einleitung 3 2. Einführung – historische und theoretische Bezugspunkte 10 2.1. „Medizin ohne Menschlichkeit“ 10 2.2. Informierte Zustimmung 14 2.3. Autonomie des Patienten 22 2.4. Ärztliches Rollenverständnis 28 2.5. Patientenzentrierte Medizin 32 2.6. Partizipative Entscheidungen 37 2.7. Zusammenfassung des Kapitels 44 3. Entwicklung, Modelle und Kontext Klinischer Ethikberatung 45 3.1. Internationale Entwicklung 45 3.2. Entwicklung in Deutschland 49 3.3. Modelle und Methoden Klinischer Ethikberatung 52 3.3.1. Beratungsmodelle 52 3.3.2. Voraussetzungen erfolgreicher Ethikberatung 54 3.3.2.1. Zugang zur Ethikberatung 55 3.3.2.2. Qualifizierung der Beratenden 56 3.3.2.3. Ablauf der Beratungsgespräche 58 3.3.2.4. Dokumentation der Beratung 66 3.3.2.5. Evaluation der Beratung 68 3.3.3. Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission 70 3.4. Das Krankenhaus als Ort Klinischer Ethikberatung 71 3.4.1. Strukturen, Entwicklung, Trägerschaft 71 3.4.2. Ethische Konflikte im Krankenhaus 74 3.5. Zusammenfassung des Kapitels 76 4. Rahmenbedingungen am Klinikum Nürnberg 77 4.1. Allgemeine Rahmenbedingungen des Klinikums 77 4.1.1. Strukturen und Entwicklung 77 4.1.2. Vergütung und Leistungszahlen 79 4.2. Spezifische Rahmenbedingungen der Ethikberatung 82 4.2.1. Ethikprojekt als Organisationsentwicklung 82 4.2.2. Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 88 4.2.3. Medizinische Klinik 4 für Nieren- und Hochdruckkrankheiten 93 4.3. Zusammenfassung des Kapitels 95 5. Mitarbeiterbefragung zu ethischen Fragen in der Med. Klinik 4 96 5.1. Befragungskollektiv 97 5.2. Befragungsinstrument 97 5.3. Ergebnisse 98 5.3.1. Teilnehmer, Berufsgruppen, Funktion 98 5.3.2. Ethik-Konflikte in den letzten zwölf Monaten 99 5.3.3. Persönliche Belastung durch ethische Konflikte 99 5.3.4. Häufigkeit und Wichtigkeit ethischer Konflikte 101 5.3.5. Ethische Probleme und Personengruppen 108 5.3.6. Ursachen ethischer Konflikte 109 5.3.7. Wichtigkeit ethischer Konflikte in den Berufsgruppen 111 5.3.8. Anerkennung der Bedeutung am Arbeitsplatz 112 5.3.9. Gesprächspartner für ethische Konflikte 112 5.3.10. Klinikinterne Ansprechpartner für ethische Konflikte 114 5.3.11. Wichtige Ethikangebote in der Klinik 115 5.4. Diskussion 117 5.4.1. Gemeinsamkeiten der Berufsgruppen 118 5.4.2. Unterschiede der Berufsgruppen 121 5.4.3. Lösungsstrategien der Berufsgruppen 124 5.5. Zusammenfassung des Kapitels 126 6. Evaluation der Ethikberatungen des Ethikkreises von 1999 bis 2011 127 6.1. Der Ethikkreis der Medizinischen Klinik 4 127 6.1.1. Entstehungsgeschichte 127 6.1.2. Selbstverständnis 129 6.1.3. Strukturen 129 6.1.4. Abläufe 130 6.1.5. Entscheidungshilfen 132 6.2. Evaluationsmethode 133 6.2.1. Anzahl und Form der Beratungsprotokolle 133 6.2.2. Auswertungsbogen 134 6.3. Ergebnisse 135 6.3.1. Geschlecht und Alter der Patienten 135 6.3.2. Fragestellungen in der Ethikberatung 136 6.3.3. Teilnehmende Gesprächspartner 137 6.3.4. Orientierung und Kontaktfähigkeit 138 6.3.5. Kenntnis des Patientenwillens 139 6.3.6. Patientenverfügungen 140 6.3.7. Anzahl der Beratungsgespräche 140 6.3.8. Gesprächsverlauf 140 6.3.9. Konsensbildung 143 6.3.10. Empfehlungen 145 6.4. Diskussion 149 6.4.1. Datengrundlage 149 6.4.2. Methode der Untersuchung 151 6.4.3. Zugang, Teilnehmende, Initiative 155 6.4.4. Qualifikation 157 6.4.5. Gesprächsverlauf 157 6.4.5.1. Themen und Fragestellungen 157 6.4.5.2. Kontroverse oder Konsens 158 6.4.5.3. Empfehlungen 162 6.4.5.4. Rat oder Beratung 163 6.4.5.5. Modell „Ethikkreis“ 165 6.4.6. Dokumentation 167 6.4.7. Evaluation und Entwicklungspotenzial 169 6.4.8. Entwicklung von Vergleichen und Kennzahlen 173 6.5. Zusammenfassung des Kapitels 176 7. Schlussfolgerungen 177 8. Literatur 179 9. Anhang 196 9.1. Allgemein 9.1.1. Hippokratischer Eid 196 9.1.2. Nürnberger Kodex 1947 197 9.1.3. Nürnberger Kodex 1997 199 9.2. Klinikum Nürnberg 9.2.1. Ethik-Code Klinikum Nürnberg 205 9.2.2. Mitglieder des Ethikforums 206 9.2.3. Zum Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden 207 9.2.4. VaW-Anordnung (Verzicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen) 211 9.3. Medizinische Klinik 4 9.3.1. Informationsschreiben zur Mitarbeiterbefragung 213 9.3.2. Fragebogen der Mitarbeiterbefragung 214 9.3.3. Auswertungsbogen zur Ethikberatung 216 9.3.4. Beispielprotokolle im Original 217 9.3.5. Informationstexte zum Ethikkreis für Mitarbeiter 222 9.3.6. Informationsblatt zum Ethikkreis für Patienten 225 I. Zusammenfassung Hintergrund und Ziele: Die rasante Entwicklung der Medizin, insbesondere der Intensivmedizin, verlangt von Patienten, Angehörigen, Ärzten und Pflegenden gerade am Ende des Lebens häufig schwierigste Entscheidungen. Um diese oft ambivalent erlebten Situationen im Sinne aller Beteiligter zu tragfähigen Lösungen zu führen, verbreitet sich seit den 1990er Jahren das Instrument der Ethikberatung. Sie fördert gemeinsame Entscheidungsfindungen mit professioneller Moderation. Seit 1997 arbeitet in der Medizinischen Klinik 4 im Klinikum Nürnberg eine der ersten Ethikberatungen Deutschlands. Die vorliegende Studie untersucht die Beratungen des sogenanten „Ethikkreises“ im Kontext der historischen Entwick lung einer patientenorientierten Medizin mit ihren spezifisch Nürnberger Bezügen. Methoden: Für den Zeitraum von 1999 bis 2011 liegen 257 Beratungsprotokolle vor, die deskriptiv-quantitativ analysiert wurden – einer der größten international publizierten Datenbestände. Ergänzt wird die Analyse durch die Auswertung einer im Jahr 2007 in der Medizinischen Klinik 4 ebenfalls vom Autor durchgeführten Mitarbeiterbefragung (N=105) zum Erleben ethischer Themen im Klinikalltag. Ergebnisse und Beobachtungen: 57% der Beratungen fanden mit dem Patienten statt, 43% ohne ihn; er war zu 43% kontaktfähig, zu 19% eingeschränkt und zu 26% nicht kontaktfähig (12% unklar). Der Patientenwille war in 58% direkt oder indirekt bekannt und eindeutig, in 19% ambivalent, bei 23% unklar. 89% der Beratungen erzielten einen Konsens, in 96% erfolgte eine Empfehlung. Der „Ethikkreis“ gab 331 Empfehlungen. Von 163 zur Dialyse votierten 81 für deren Fortsetzung, 82 für eine Beendigung; ein bemerkenswertes Ergebnis, das die Ausgewogenheit der Beratungen bestätigt. Die Mitarbeiterbefragung bestätigt die Relevanz ethischer Konflikte für Ärzte wie Pflegende. Beide bewerten deren Anlässe, Häufigkeit und Schwere sehr ähnlich. Auch bei der Diskrepanz zwischen Beratungsbedarf und der Anforderung einer Ethikberatung stimmen beide überein. Schlussfolgerungen: Ethikberatungen stärken partizipative Entscheidungen und wirken patienten- und lösungsorientiert. Die enge Anbindung an die Klinik scheint erfolgversprechend. Aufgrund ihrer Ergebnisse sollte die Klinische Ethikberatung weiter ausgebaut sowie kontinuierlich wissenschaftlich evaluiert werden. 1 II. Abstract Objective. Clinical ethics consultation is still a relatively new service within german hospitals. Facing the fast technological progress in medicine, especially within intensive care, and the increasing legal pressure, it was established to strengthen the systematic process of ethical and shared decision making and to assist viable and sustainable clinical decisions among doctors, nurses, patients and families. Reflecting the principle of informed consent and the historical development of patient-orientation within medicine, the purpose of this study was to review one of Germany´s most experienced ethics consultation services at a department of nephrology and hypertension of a tertiary care community hospital. Methods. Retrospective and descriptive analysis of the documentation of 257 clinical ethics consultations between 1999 and 2011, which represents one of the largest published databases in literature. This analysis was complemented by a questionnaire in 2007 among doctors and nurses concerning ethical conflicts. Results. 57% of the consultations involved patients. 43% of all patients were oriented and able to communicate, 19% were only partially oriented, 26% not orientated (12% not documented). The patient´s will was known in 58% of all cases, in 19% it was ambivalent and uncertain, in 23% unknown. 89% of the consultations ended with a consensus, in 96% one ore more recommendations were given. The consultation team gave 331 recommendations, 70% delt with endof-life decisions. Of 163 recommendations concerning dialysis, 81 favored to continue, 82 to withdraw dialysis – a remarkable result showing the very balanced consultations of the ethics-team. The questionnaire underlined the relevance of ethical conflicts, and it showed among doctors and nurses common attitudes and estimations concerning ethical issues, frequency and severity. It also showed for both groups the gap between their demand for ethics consultation and the use of it. Conclusions. Ethics consultations strengthen patient-orientation and viable solutions within ethical conflicts. The model of a department-based ethics-team shows an accepted strategy to implement a consultation service within a large hospital. Ethics consultations should be spread widely and evaluated scientifically. 2 1. Einleitung „Die Zeugnisse sind über alle menschlichen Maße furchtbar geblieben. Keine Zeit wird sie je mildern können. Heute wie zur Zeit des Prozesses, der die Vorgänge der Welt offenbar machte, müssen wir die Frage stellen, wie man diese Ungeheuerlichkeiten in unser aller wirkliche Erfahrung einordnen kann.“1 Mit diesen Zeilen leiten Alexander Mitscherlich und Fred Mielke 1960 ihre Dokumentation des Nürnberger Ärzteprozesses 1946/47 ein, die diesmal unter dem Titel „Medizin ohne Menschlichkeit“ auch verbreitet wurde. Im Ärzteprozess hatten deutsche Ärzte wegen ihrer Menschenversuche in KZs, dem „Euthanasie“Programm und der Massensterilisation vor einem US-Militärgericht gestanden. Die Absicht der Dokumentation, so die Herausgeber, berühre nicht die Ebene des Juristischen. Sie zeigte vielmehr die „wissenschaftliche Arbeitsweise“, „den ärztlichen Stil im Umgang mit Kranken oder Versuchspersonen“ und das „Milieu, in dem sich diese ärztlichen oder wissenschaftlichen Tätigkeiten abspielten“. Am Ende des Ärzteprozesses sprachen die Richter nicht nur ihr Urteil. Sie formulierten auch zehn ethische Grundsätze für zulässige medizinische Versuche am Menschen, den Nürnberger Kodex. Darin betonten sie den „informed consent“, die informierte und freiwillige Einwilligung des Patienten nach bestmöglicher Aufklärung, und ermahnten die Forscher „zu mehr Achtung gegenüber dem unveräußerlichen Recht und Interesse ihrer Versuchspersonen“, so Jay Katz 1996 auf dem Nürnberger Kongress „Medizin und Gewissen – 50 Jahre nach dem Nürnberger Ärzteprozess“. Dieses Ziel aber, resümiert damals der amerikanische Medizinethiker, sei ein bis heute „unabgegoltenes Vermächtnis“ der Richter.2 Das Prinzip des „informed consent“ bildet damit den historischen, normativen, aber auch ideell-persönlichen Hintergrund der vorliegenden Arbeit. Sie untersucht ein klinisches Beratungsangebot, den „Ethikkreis“ der Medizinischen Klinik 4 am Klinikum Nürnberg, das vom Kongress „Medizin und Gewissen“3 inspiriert wurde und seit 1997 zu den ältesten und aktivsten Ethikberatungen in Deutschland zählt. Die Arbeit schlägt daher den Bogen vom „informed consent“ medizinischer Forschung zum „shared-decision-making“ der täglichen Krankenversorgung – insbesondere in den schwierigen Entscheidungssituationen am Ende des Lebens, dem häufigsten Ausgangspunkt Klinischer Ethikberatungen. 1 Mitscherlich/Mielke (1947), (1949), (1960), S. 7. Die Erstauflage wurde vielfach verschwiegen. Katz (1998), S. 241. 3 Kolb/Seithe (1998). 2 3 Eine Untersuchung zur Klinischen Ethikberatung mit einem Verweis auf den Nürnberger Ärzteprozess einzuleiten, mag auf den ersten Blick überraschen. Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber, dass ein solcher Ansatz weit mehr ist als eine Referenz an den Prozess und an eine Stadt, die sich heute in beispielhafter Weise ihrer nationalsozialistischen Geschichte stellt und die Idee der Menschenrechte vielfältig fördert. Der Verweis auf den Nürnberger Ärzteprozess ist vor allem inhaltlich begründet, weil sich damit die folgenreiche Entwicklung der Medizin als Naturwissenschaft aufzeigen und zuspitzen lässt; eine Entwicklung, die das Wesen der Beziehung von Arzt und Patient grundsätzlich veränderte. In gewisser Hinsicht verdinglichte die Medizin den Patienten zum Objekt – zum Objekt eines auf der experimentellen Empirie basierenden medizinischen Denkstils. 4 In Bezug auf diese Entwicklung der Medizin im 19. und 20. Jahrhundert und auch auf die vor über 60 Jahren in Nürnberg verhandelten ärztlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit entwickelte der „Vater der Psychosomatik“, Viktor von Weizsäcker, seine Vision einer Medizin, die sich vor allem durch eines definiert: Den Umgang des Menschen mit dem Menschen. Von Weizsäcker arbeitete in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts an der Universitätsklinik in Heidelberg, wo „auch die Einbeziehung nicht-wissenschaftlicher Methoden in das klinische Denken sowie eine Offenheit für die Erkenntnisse der Psychoanalyse das allgemeine Klima kennzeichneten“, so schreibt der Journalist Rainer Appel in einer Würdigung Viktor von Weizsäckers zu dessen hundertstem Geburtstag. Unter der Leitung des Internisten Ludwig von Krehl sei eine „Heidelberger Schule der Medizin“ entstanden, „die das Scheitern einer rein naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin auf die einfache Formel brachte: Krankheiten als solche gibt es nicht, es gibt nur kranke Menschen.“ 5 Den „wichtigsten und originellsten Beitrag dieser Heidelberger Schule“, so Rainer Appel habe von Weizsäcker als Begründer der Anthropologischen Medizin geleistet. „Im Rahmen seiner klinischen und physiologischen Studien ist er zu dem Ergebnis gelangt, dass die objektivierenden Verfahren der Naturwissenschaft die lebendige Wirklichkeit verfälschten“.6 Seine Kritik habe sich daher stets gegen die cartesianische Subjekt-Objekt-Spaltung gewandt, die er durch das, was er Umgang mit dem Patienten nannte, zu überwinden versuchte. 4 In Anlehnung an die Wissenschaftstheorie von Thomas S. Kuhn. Vgl. Rainer Appel in der FAZ am 21. April 1986, S. 27, unter dem Titel „Geduldeter Fremdling“. 6 Ebd. 5 4 Vor diesem Hintergrund bezieht sich die vorliegende Arbeit auf die Idee einer Medizin, in der weder allein der Patient noch der Arzt im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr die Beziehung beider. Diesen beziehungstheoretischen Ansatz, der bei Viktor von Weizsäcker auch vom dialogischen Prinzip Martin Bubers inspiriert wurde, greifen später weitere Vordenker der psychosomatischen Medizin wie etwa Thure von Uexküll und Wolfgang Wesiack auf und entwickeln ihn weiter. Für sie ist die Medizin ihrem Wesen nach immer „gemeinsame Angelegenheit“ beider: eine Sache von Patienten und Ärzten. Es ist wohl kein Zufall, dass ein solches Grundverständnis der Medizin ausgerechnet von Ärzten formuliert wurde, die sich selbstkritisch auch mit dem Nürnberger Ärzteprozess und seinen wissenschaftstheoretischen und historischen Voraussetzungen beschäftigt hatten, insbesondere mit der Entwicklung der Medizin als Naturwissenschaft. In ihrem Sinne war das Wohl des Patienten weniger mit dem Wohl der Volksgesundheit oder einem „schillernden Begriff der Gesundheit“ 7 verbunden, sondern vielmehr mit dem Anspruch einer Stärkung der Autonomie und Selbstverantwortung des Patienten. Für diese Stärkung wiederum war das Prinzip des „informed consent“ des Nürnberger Kodex von wegweisender Bedeutung. Für das Humanexperiment gedacht, lässt es sich nicht nur auf die Forschung anwenden, sondern auch auf den klinischen Alltag. In diesem Sinne beziehen sich die folgende Untersuchung von Ethikberatungen und insbesondere das Kapitel der Einführung auch auf die Begründer der psychosomatischen Medizin, auf Viktor von Weizsäcker, seinen Schüler Alexander Mitscherlich – den Leiter der offiziellen Beobachterkommission im Nürnberger Ärzteprozess – und auf Thure von Uexküll, der als ein weiterer „Vater der Psychosomatik“ in Deutschland gilt. Neben ihnen basieren die Bezugspunkte dieser Arbeit auch auf Arbeiten der Psychiater und Psychoanalytiker Klaus Dörner, Robert Lifton, Horst Eberhard Richter und Alice von Platen-Hallermund. Wie schon der Verweis auf den Nürnberger Ärzteprozess mag auch der Bezug auf das Fach Psychosomatik und ihre Vertreter in einer Untersuchung von Ethikberatungen überraschen. Bei näherer Betrachtung der spezifischen Rahmenbedingungen und Herausforderungen von Psychosomatik und Klinischer Ethikberatung finden sich allerdings zahlreiche Parallelen: in Fragen der theoretischen Konzeption wie auch der praktischen Umsetzung. 7 Uexküll/Wesiack (1991), S. 610. 5 Beide, Psychosomatik wie Ethikberatung, basieren auf einem ähnlichen Verständnis einer ganzheitlichen Betrachtung des kranken Menschen. Beide wirken auch als Vermittler und Katalysatoren der Arzt-Patienten-Beziehung; beide agieren in einem klinischen Umfeld, das einer umfassenden medizinischen, psychischen und sozialen Begleitung von Patienten noch immer zu wenig Aufmerksamkeit schenkt; und beide, Psychosomatik wie Ethikberatung, benötigen angemessene Strategien der Implementierung, um ihre Kompetenzen und Dienste im klinischen Alltag nachhaltig verorten zu können. Selbstverständlich geht es um sehr unterschiedliche Dimensionen – einerseits um die Anerkennung und Einführung eines komplexen Fachgebietes, andererseits um die Akzeptanz einer einzelnen „Dienstleistung“. Aber angesichts ähnlicher Ziele und Rahmenbedingungen ist eine vergleichende Betrachtung beider naheliegend und aufschlussreich. Die Erfahrungen der vergangenen drei Jahrzehnte aus der Implementierung psychosomatischer Dienste können für die weitere Entwicklung der Klinischen Ethikberatung auch als umschriebener einzelner Dienstleistung hilfreich, wenn nicht wegweisend sein. Angesichts dieser Parallelen überrascht es vielleicht nicht mehr, dass im interdisziplinären Team des „Ethikkreises“ der Medizinischen Klinik 4 im Klinikum Nürnberg seit seinem Beginn auch die psychosomatische Klinik des Klinikums integriert ist. Da die in dieser Arbeit herausgestellten Zusammenhänge von Psychosomatik und Ethikberatung bisher in der wissenschaftlichen Literatur – weder damals noch heute – explizit thematisiert wurden, müssen andere Gründe in Nürnberg diese frühe Zusammenarbeit befördert haben: vielleicht war es die bereits bestehende Kooperation zwischen Nephrologie und Psychosomatik, eine entsprechende Intuition der Beteiligten oder purer Zufall? Die Voraussetzungen im Klinikum Nürnberg waren jedenfalls günstig. Schon 1980 hatte das Klinikum Nürnberg als eines der ersten Krankenhäuser in Deutschland eine eigenständige psychosomatische Abteilung eingerichtet, die eine 16-Betten-Station unterhielt, einen Liaison- und Konsultationsdienst betrieb, sich an der Weiterbildung von Ärzten für die Zusatzbezeichnung „Psychotherapie“ beteiligte sowie eine psychosomatische Zusatzausbildung für das Pflegepersonal organisierte.8 Vor allem der Liaison- und Konsultationsdienst, für den das Klinikum bundesweit bekannt wurde, spielt für diese Arbeit eine wichtige Rolle. 8 Pontzen (1990). 6 Die Klinische Ethikberatung ist national wie international im Rahmen der stationären Versorgung eine vergleichsweise junge „Dienstleistung“. In Form moderierter Gespräche soll sie Ärzten, Pflegenden, Patienten und Angehörigen dabei helfen, bei schwierigen Entscheidungen gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden. Seit 2006 wird die Einrichtung einer Ethikberatung von der Zentralen Ethikkommission an der Bundesärztekammer explizit empfohlen. Der „Ethikkreis“ der Medizinischen Klinik 4 im Klinikum Nürnberg praktiziert sie bereits seit 1997. Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Frage, ob und wie eine solche Ethikberatung dazu beiträgt, patientenorientierte Entscheidungen herbeizuführen, an denen im besten Fall ein informierter Patient mitwirkt oder sein mutmaßlicher Wille Berücksichtigung findet. Dazu wurden 257 Beratungsprotokolle des „Ethikkreises“ aus der Zeit von 1999 bis 2011 ausgewertet sowie eine Mitarbeiterbefragung aus dem Jahr 2007, die in der Medizinischen Klinik 4 das persönliche Erleben und Bewerten ethischer Fragen von Ärzten und Pflegenden erhoben hatte. Inzwischen bietet bundesweit etwa jedes fünfte Krankenhaus Ethikberatungen an bzw. entwickelt diese. Wenige Kliniken verfügen allerdings über mehrjährige Erfahrungen oder umfangreiche Dokumentationen. Deshalb ist die Zahl von 257 Protokollen der zweitgrößte bisher untersuchte Datenbestand. Die Protokolle, vor allem aus den ersten Jahren, erfüllen zwar nicht sämtlich die seit 2010 in Deutschland empfohlenen Dokumentationsstandards, aber sie stellen einen besonders umfangreichen Erfahrungsschatz zur Praxis der Ethikberatung dar. Vor diesem Hintergrund ist das primäre Ziel der vorliegenden Arbeit, den Mitgliedern des Ethikkreises und dem Klinikum Nürnberg anhand der Protokolle, der Mitarbeiterbefragung und des aktuellen Forschungsstandes eine Auswertung ihrer bisherigen Beratungen zu liefern und sie in der weiteren Entwicklung ihres Angebotes zu bestärken. Zunächst vermittelt das zweite Kapitel die zentralen Bezugspunkte der Arbeit. Es sind dies: die geschichtlichen Hintergründe, die in Nürnberg verhandelt wurden; der Nürnberger Kodex mit seinem prägenden Prinzip der informierten Zustimmung; die patientenzentrierte und integrierende Theorie der Medizin der Psychosomatik; das Selbstverständnis der Heilberufe, Experten und Partner ihrer Patienten zu sein; die Patientenautonomie als moralisches Recht mit ihren Konsequenzen für Individuen und Institutionen, sowie das Konzept partizipativer gemeinsamer Entscheidungsfindungen, das sogenannte „shared-decision-making“. 7 Das dritte Kapitel führt in die Grundlagen Klinischer Ethikberatung ein. Es beschreibt die historische Entwicklung international wie national, schildert die Modelle und Methoden etablierter Ethikberatungen und benennt wesentliche Voraussetzungen einer erfolgreichen Beratung wie etwa Qualifikation, Zugang oder Gesprächsverlauf. Dabei wird deutlich, dass sich im Zuge der Entwicklung von Ethikberatungen sehr unterschiedliche Modelle herausgebildet haben – vom Einzelberater, dem kleinen Konsil-Team bis zum umfangreichen Ethikkomitee. Ergänzend dazu werden die allgemeinen Rahmenbedingungen und Rationalitäten von Krankenhäusern aufgezeigt, dem institutionellen Ort Klinischer Ethikberatung. Hier hat die Einführung der Abrechnung nach diagnosebezogenen Fallpauschalen (DRG-System) in den vergangenen Jahren zu einem erheblichen Kostendruck, zur Veränderung von Strukturen und Prozessen und zu einer Verdichtung der Arbeit geführt. Daran anschließend stehen im Mittelpunkt des vierten Kapitels die spezifischen Rahmenbedingungen des Kommunalunternehmens Klinikum Nürnberg sowie seiner Medizinischen Klinik 4 mit dem Schwerpunkt Nieren- und Hochdruckkrankheiten. Sowohl das Gesamtklinikum als auch die Einzelklinik nehmen auf dem Gebiet der Klinischen Ethik in Deutschland eine Vorreiterrolle ein – die Klinik seit 1997 mit dem „Ethikkreis“ und seinen Ethikberatungen, das gesamte Klinikum seit 1999 mit einem umfangreichen „Ethikprojekt“, dem bundesweit ersten dieser Art an einem Krankenhaus der Maximalversorgung. Auch mit der Etablierung einer eigenständigen Klinik für Psychosomatik beschritt das Klinikum Nürnberg Anfang der 1980er Jahre bundesweit Neuland – eine Innovation, die wie erwähnt, auch für die Klinische Ethik von Bedeutung ist. Das fünfte Kapitel ist dem ersten Schwerpunkt der Arbeit gewidmet. Es stellt die Ergebnisse der Befragung zu ethischen Themen im Berufsalltag aller Mitarbeiter in der Medizinischen Klinik 4 dar, die im Sommer 2007 erhoben wurde. Die Befragung erfolgte anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Ethikberatung des „Ethikkreises“ und liefert aufschlussreiche Einblicke in die Einschätzung ethischer Themen von Ärzten und Pflegenden. Sie zeigt dabei nicht nur Unterschiede, sondern vor allem viele Gemeinsamkeiten. Dabei wird allerdings auch eine Diskrepanz zwischen theoretischen Wünschen und praktischer Nutzung sichtbar, selbst in Bezug auf das bereits bekannte und etablierte Angebot der klinikinternen Ethikberatung. 8 Darauf aufbauend folgt im sechsten Kapitel der zweite Schwerpunkt der Arbeit, die Auswertung der insgesamt 257 Protokolle des Nürnberger „Ethikkreises“. Die Protokolle zeigen einen Fokus in der Begleitung schwieriger Entscheidungen am Lebensende, insbesondere bei Fragen zum Beginn, zur Fortführung oder zur Beendigung einer Dialyse. Im Hinblick auf den Ruf und die Akzeptanz des „Ethikkreises“ ist dabei vor allem die ausgewogene Verteilung der Empfehlungen bei Entscheidungen zur Fortsetzung oder Beendigung von Dialysen interessant. Bei den übrigen Entscheidungen am Lebensende zeigt sich eine gewisse Tendenz zur Beendigung bzw. zum Überdenken von Therapiezielen (Palliativtherapie). Auch das spezifische Modell des „Ethikkreises“ wird bewertet, das sich vor allem durch eine besondere Nähe zum stationären Alltag auszeichnet. Zudem werden die Unterschiede von „Rat“ und „Beratung“ hinterfragt. Den Rahmen der Diskussion im sechsten Kapitel bilden die im zweiten Kapitel dargelegten Bezugspunkte, insbesondere der Nürnberger Kodex und die Frage, inwiefern Ethikberatungen dazu beitragen, den im Kodex formulierten Anspruch einer informierten Zustimmung und Selbstbestimmung der Patienten zu fördern. Dabei zeigt sich, dass es dem Klinikum Nürnberg und dem „Ethikkreis“ der Medizinischen Klinik 4 mit diesem Angebot gelungen ist, institutionelle und personelle Voraussetzungen zu schaffen, die eine situationsbedingte Patientenautonomie fördern und gemeinsame Entscheidungsfindungen von behandelnden Ärzten und Pflegenden sowie Patienten, Angehörigen und Betreuern ermöglichen. Ergänzend folgt eine Reihe von praktischen Anregungen für die Dokumentation von Ethikberatungen sowie für die Entwicklung von Kennzahlen, die sich klinikübergreifend im Sinne der Klinischen Ethik für das Qualitätsmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit eignen. Das siebte Kapitel zieht Schlussfolgerungen für den „Ethikkreis“ und die weitere Entwicklung bzw. Evaluation von Ethikberatungen am Klinikum Nürnberg und andernorts. Im Blick auf Erfahrungen des Nürnberger „Ethikkreises“, andere Modelle von Ethikberatung und die Erfahrungen der Psychosomatik schlage ich abschließend vor, eine Art Ethischer-Liaison-Dienst zu favorisieren und weiter zu verbreiten, da dieser – anders als ein reiner Konsildienst – eine enge Einbettung der Ethikberatung und ihrer Akteure in den Klinik- und Stationsalltag vorsieht und so die vermutlich größte Nachhaltigkeit verspricht. 9 2. Historische und theoretische Bezugspunkte 2.1. Medizin ohne Menschlichkeit Der Nürnberger Ärzteprozess bildete 1946/47 den bedrückenden und leider nur vorläufigen Schlusspunkt einer langen Entwicklung. Im Jahrhundert hatte sich die Medizin mitsamt ihren Methoden immer stärker als Naturwissenschaft verstanden und zu einem dynamischen und teilweise wenig kontrollierten Experimentierfeld entwickelt. Auch wenn bahnbrechende Entdeckungen, etwa auf dem Gebiet der Bakteriologie, die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung rapide und nachhaltig verbesserten, gehörten auch fragwürdige und gesundheitsgefährdende Menschenversuche zum weithin tolerierten und publizierten Repertoire der Medizin – darunter viele Versuche an Menschen ohne jede Form der Information oder freien Zustimmung der jeweils beteiligten Probanden oder Patienten. 9 Diese Entwicklung mündete in der Zeit des Nationalsozialismus in die menschenverachtenden, grausamen und nicht selten tödlichen Experimente an KZGefangenen: z.B. Höhenexperimente, Unterkühlungsversuche, Versuche mit den Erregern von Malaria, Gelbsucht oder Fleckfieber sowie Sterilisationsexperimente. Diese und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden ab Oktober 1946 vor dem Amerikanischen Militärgericht im Nürnberger Ärzteprozess verhandelt. 23 Personen waren angeklagt: 20 Ärzte (darunter eine Frau) und drei Mitarbeiter. 10 Am 20. August 1947 schloss das Gericht den Prozess nach 139 Gerichtstagen mit der Verkündung des Urteils ab. Es verurteilte sieben Angeklagte zum Tode, fünf zu lebenslanger Haft, drei zu langen Haftstrafen und sprach sieben Beschuldigte von der Anklage frei. Der Medizinhistoriker Richard Toellner stellt hierzu fest, „dass im Nürnberger Ärzteprozess zum ersten Mal der Umfang der Verbrechen, das Ausmaß der Greuel, die deutsche Ärzte an wehr- und hilflosen Menschen verübt hatten, sowie die Reichweite der menschenverachtenden Mordtaten unwidersprechlich der Weltöffentlichkeit in ihren Umrissen sichtbar wurden, auch da, wo die Verbrechen, weil von Deutschen an Deutschen verübt, nicht Gegenstand der Anklage des amerikanischen Militärgerichtshofes waren, wie im Falle der Aktion T4, der sogenannten Euthanasie-Aktion, durch die allein in ihrer offiziellen Phase (1939-1941) über 70.000 geistig und körperlich behinderte Menschen von Ärzten heimtückisch und grausam ermordet wurden, durch die methodisch und organisatorisch der Genozid, der Holocaust, eingeübt wurde.“11 9 Hohendorf/Magull-Seltenreich (1990),Annas/Grodin (1992), Gerst (1994), Baader (1980), (1998), Böhme (2008), Bruns/Frewer (2008), Dörner (1999), Winau (1998), Eckart (2009), Frewer (2000) und (2007), Schmidt/Frewer (2008). 10 Mitscherlich/Mielke (1960), Weindling (2006). 11 Toellner (1998), S. 289. 10 Ohne dem ärztlichen Berufsstand in Deutschland eine kollektive Schuld und Beteiligung an diesen Verbrechen zu unterstellen, ist dennoch hinreichend belegt, dass eine weitaus größere Zahl von Ärzten als die in Nürnberg Angeklagten einem medizinischen oder wissenschaftlichen Denkstil anhingen, der weder die Versuche an Menschen noch die Praxis der „Euthanasie“ verhindert hatte. Im Gegenteil: Das ärztliche Selbstverständnis und die medizinischen Methoden hatten sich im Laufe des 19. Jahrhunderts so geändert, dass Ärzte nicht selten zu Forschenden wurden und ihre Patienten zum naturwissenschaftlichen Objekt ihres Handelns. Nach dem Studium der Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses, die seine Schüler Alexander Mitscherlich, Fred Mielke und Alice von Platen-Hallermund gesammelt und kommentiert hatten, kam auch der Heidelberger Lehrstuhlinhaber und Begründer der Psychosomatik Viktor von Weizsäcker 12 in seiner Arbeit „Euthanasie und Menschenversuche“ zu dem Schluss: „[…] es kann wirklich kein Zweifel darüber bestehen, dass die moralische Anästhesie gegenüber den Leiden der zu Euthanasie und Experimenten Ausgewählten begünstigt war durch die Denkweise einer Medizin, welche den Menschen betrachtet wie ein chemisches Molekül oder einen Frosch oder ein Versuchskaninchen.“13 Dieser Denkweise setzte von Weizsäcker ein Verständnis von Natur, Wissenschaft und letztlich auch Medizin entgegen, das integrierend und menschlich wirkt: „Die Einführung des Subjekts hat nicht etwa die Bedeutung, dass die Objektivität eingeschränkt würde. Es handelt sich weder um die Subjektivität allein noch um Objektivität allein, sondern um die Verbindung beider. Eben darum ist nun hier doch eine Veränderung des Wissenschaftsbegriffes zu bemerken. Wissenschaft gilt nämlich hier nicht als objektive Erkenntnis schlechthin, sondern Wissenschaft gilt als eine redliche Art des Umgangs von Subjekten mit Objekten. Die Begegnung, der Umgang, ist also zum Kernbegriff der Wissenschaft erhoben.“14 Die wissenschaftstheoretische Kritik, die sich hier ankündigt – immerhin hatten die Revolutionen der Physik am Beginn des 20. Jahrhunderts die Vorstellungen der Biologie und Medizin nicht erschüttern können – soll hier nicht weiter vertieft werden. Für die später zu erörternde Rolle der Psychosomatik als Vorbild der Ethikberatung erscheint mir aber schon jetzt der Hinweis wichtig, dass Biologie und Medizin eher die Integration als die Aufspaltung suchen müssten. 12 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Rolle Viktor von Weizsäckers in der NS-Zeit seit den 1970er Jahren durchaus kontrovers diskutiert wird. Vgl. u.a. Kütemeyer (1973), WuttkeGroneberg (1980), Roth (1986), Dörner (1988), Rimpau (1990), Peter (1996), Böhme (2008). 13 Weizsäcker (1985-2005) Bd. 5, S. 134. 14 Ebd. 11 In diesem Zusammenhang weist der Psychiater Horst Eberhard Richter darauf hin, dass im Nürnberger Ärzteprozess die Verteidigung die Frage aufgeworfen hatte, „ob man dem Forscherarzt nicht die Befolgung des hippokratischen Eides in der strengen Form erlassen können, wie diese den praktizierenden Arzt binde“.15 Für diesen Vorschlag habe die Verteidigung teilweise sogar Verständnis erhalten. Zwei der Prozessbeobachter für die Westdeutschen Ärztekammern, Alexander Mitscherlich und Fred Mielke, hätten dagegen argumentiert, „dass die Trennung in Forscher und Helfer mit verschiedenem Moralkodex nicht allein den Begriff des Arzttums sprenge, sondern zu zwei verschiedenen Humanitätsbegriffen führt.“16 Richter spricht in diesem Zusammenhang von einem Selbstbetrug, dem Ärzte erliegen könnten. Kompliziert, so der Begründer der Psychosomatik an der Universität Gießen, werde das Problem dadurch, dass dem Arzt seine „professionelle Spaltung leicht entgehen kann, wenn er eine nämlich eine gewisse fachliche Partialmoral als die eigentliche erlebt, zum Beispiel die penible Einhaltung von Sauberkeit und Exaktheit in der naturwissenschaftlichen Methodik“.17 Versuche an Menschen seien zum Teil von Ärzten vorgenommen worden, die dabei mit „aller gebotenen fachlichen Gründlichkeit und Sorgfalt“ vorgegangen seien. Es gebe, so Richter, demnach auch eine „gewissenlose Gewissenhaftigkeit, mit der man sich selbst trügerisch beschwichtigen könne“. Und so entstünde die „Gefahr einer moralischen Korruption, die mit dem Kunststück zusammenhängt, dass der Arzt täglich zwei grundverschiedene Sichtweisen vom Menschen in sich verbinden soll. Da ist einerseits die verdinglichende, naturwissenschaftliche [Art], in der er Daten analysiert und ingenieurhaft reparierend in körperliche Funktionen eingreift. Andererseits ist da die personale Sichtweise, die Viktor von Weizsäcker mit der Formel gemeint hat: ,Medizin ist die Weise des Umgangs des Menschen mit dem Menschen‘. Darin ist der Arzt der sich Einfühlende, der Zuhörende, der am Schicksal und an den Konflikten des Anderen Anteilnehmende. Aber der laufend zunehmende Aufwand für das naturwissenschaftliche Sehen und Denken kann für den Arzt bedeuten, dass die vergegenständlichende Betrachtungsweise in ihm überhand gewinnt. Daß er im beruflichen Handeln seine Gefühle weitgehend abschaltet und sie nur noch kompensatorisch im Privatbereich unterzubringen versucht.“18 Dieses Bild der Spaltung und Verdrängung wird Mitte der 1980er Jahre durch eine viel beachtete Arbeit bestärkt und auf die Ärzte im „Dritten Reich“ angewandt. 15 Richter (1997), S. 24. Ebd. 17 Ebd. 18 Ebd. 16 12 Auf der Grundlage hunderter Interviews mit Tätern, Opfern und sogenannten Mitläufern sowie der umfangreichen Analyse tausender Prozessdokumente aus Nürnberg beschäftigte auch den amerikanischen Psychiater und Psychologen Robert J. Lifton letztlich die Tatsache, „dass gerade Mediziner, dazu berufen, zu helfen und zu heilen und Leben zu retten, in großer Zahl dafür gewonnen werden konnten, das Vernichtungsgeschäft der Nationalsozialisten mitzumachen oder gar voranzutreiben. Angefangen bei der biologisch-medizinischen Argumentationshilfe für die Rassenideologie über die immer umfangreicher werdenden ,Euthanasie‘Projekte bis hin zu den sadistischen Experimenten und der perfekt laufenden Tötungsmaschinerie in den Konzentrationslagern finden wir Ärzte, die das Gegenteil dessen tun, was sie einst mit dem Hippokratischen Eid schworen.“ 19 Der Mitbegründer der Ärzteorganisation „Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges“ (IPPNW) hat in seiner weithin rezipierten Studie „Ärzte im Dritten Reich“ derartige Prozesse der Spaltung und Verdrängung beschrieben, als deren Ergebnis sonst normal empfindende Menschen im professionellen Bereich denken und handeln, als wären ihre mitmenschlichen Empfindungen abgestorben. Lifton stellt die Hypothese auf, dass bei Ärzten eine Spaltung ihrer psychischen Einheit im Sinne einer Verdopplung des Bewusstseins vorgelegen habe, d.h. einer Aufteilung des Selbst in zwei selbständig funktionierende Ganze, so dass jedes der beiden wie ein ganzes Selbst handle. Mit diesen Überlegungen schließt der hier nur skizzenhaft geschilderte Weg zum Nürnberger Ärzteprozess ab. Er zeigt insgesamt die Entwicklung einer Medizin, die nicht zuletzt mit ihrem reduktionistischen Denkstil und dem tradierten cartesianischen Modell der Maschine eine tiefgreifende Krise erfuhr. In den Worten des Psychosomatikers Thure von Uexküll: „Die Krise der Medizin begann mit dem Sieg des Maschinenparadigmas – als eine Krise der Humanität. Mit diesem Sieg war eine Medizin ohne Menschlichkeit möglich geworden.“20 19 Lifton (1996), S. 25. Im Vorwort der deutschen Ausgabe weist Robert Lifton 1987 auch auf die mangelnde Rezeption des Nürnberger Ärzteprozesses hin: „Unglücklicherweise hat sich ein großer Teil der deutschen Ärzteschaft den von Mitscherlich und seinen Nachfolgern aufgedeckten harten Wahrheiten verschlossen. Während ich an dieser Einleitung schreibe, bekämpfen die höchsten Gremien der deutschen Ärzteverbände die mutigen Versuche des jungen Arztes Hartmut Hanauske-Abel, seine Kollegen zum Lernen aus den Verfehlungen der Medizin im Dritten Reich anzuhalten (Deutsches Ärzteblatt, Bd. 84, Nr. 18, 1987). Hanauske-Abel hat seinen Finger auf die unverheilte Wunde des moralischen Versagens vieler Ärzte in der Nazi-Zeit gelegt, als er dazu aufrief, die von der Bundesregierung anberaumten Spezialausbildungen in ,Katastrophenmedizin‘ und ,nuklearen Notfällen‘ zu boykottieren: Dieses Mal sollten die deutschen Ärzte ihre Fähigkeit zum Widerstand gegen offiziellen Druck unter Beweis stellen (The Lancet, II, 1986, S. 271 ff; Die Zeit, 6. Nov. 1987, S. 45f.)“. Vgl. auch Hanauske-Abel (1998). 20 13 2.2. Informierte Zustimmung Vor dem Hintergrund der von Ärzten verübten grausamen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und angesichts des offensichtlichen Fehlens bzw. Wirkens entsprechender Richtlinien 21 verlautbarten die Richter des amerikanischen Militärgerichtshofes Nr. 1 am 20. August 1947 mit dem Urteil im Ärzteprozess zugleich zehn Prinzipien für die künftige medizinische Forschung am Menschen. Unter dem Titel „Zulässige Humanexperimente“ gliederte sich der Kodex in zehn Punkte. Das erste und wichtigste Prinzip ist der Notwendigkeit gewidmet, die Zustimmung des Teilnehmers für die beabsichtigte Forschung auf der Basis einer ausreichenden Information zu erhalten. „Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Das heißt, dass der Betreffende die gesetzmäßige Fähigkeit haben muss, seine Einwilligung zu geben; in der Lage sein muss, eine freie Entscheidung zu treffen, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Beeinflussung oder des Zwanges; und genügend Kenntnis von und Einsicht in die Bestandteile des betreffendes Gebietes haben muss, um eine verständnisvolle und aufgeklärte Entscheidung treffen zu können. Diese letztere Bedingung macht es notwendig, dass der Versuchsperson vor der Annahme ihrer bejahenden Entscheidung das Wesen, die Länge und der Zweck des Versuches klargemacht werden; sowie die Methode und die Mittel, welche angewendet werden sollen, alle Unannehmlichkeiten und Gefahren, welche mit Fug zu erwarten sind, und die Folgen für ihre Gesundheit oder ihre Person, welche sich aus der Teilnahme ergeben mögen. Die Pflicht und Verantwortlichkeit, den Wert der Zustimmung festzustellen, obliegt jedem, der den Versuch anordnet, leitet oder ihn durchführt. Dies sind persönliche Pflichten und persönliche Verantwortungen, welche nicht ungestraft auf andere übertragen werden können.“ 22 Die humane Haltung und Verpflichtung, die in diesem ersten Abschnitt sowie im gesamten Kodex zum Ausdruck kommen und eingefordert werden, sollen dazu beitragen, den Probanden oder Patienten als Subjekt zu stärken, d.h. seine eingangs beschriebene Reduzierung auf ein wissenschaftliches Objekt überwinden helfen. Der Nürnberger Kodex wurde im Hinblick auf die unvermeidliche und notwendige Forschung am Menschen formuliert. Er gibt dem forschenden Arzt eine besondere Verantwortung und dem ihm Anvertrauten einen besonderen Schutz. Letztlich lässt sich der Kodex aber auch auf die Alltagsmedizin mit ihren Entscheidungen übertragen und damit auch auf die Praxis der Ethikberatung. 21 Es sei darauf hingewiesen, dass es seit 1931 aus dem Reichsinnenministerium entsprechende Richtlinien gab. 22 Mitscherlich/Mielke (1960), S. 273. Vgl. auch Anlage 9.1.2. 14 Es mag überraschen, eine Arbeit zur Ethikberatung mit einem Exkurs zum Ärzteprozess und dem Nürnberger Kodex zu beginnen, aber das dort bekräftigte Prinzip des „informed consent“ ist ein so grundlegendes Prinzip der Medizin, dass es sich als Referenz für schwierige Entscheidungssituationen anbietet. Schließlich könnte der Nürnberger Kodex von 1947 bis heute weit mehr sein als die historische relevante Grundlage „zulässiger Humanexperimente“. 23 In diesem Sinne stellt sich die Frage, inwieweit der Kodex nicht nur für die Forschungspraxis, sondern auch für Fragen des ärztlichen Alltags national und international rezipiert und genutzt wurde. Haben seine Grundsätze, vor allem der zentrale Aspekt der informierten Zustimmung („informed consent“), auch Eingang gefunden in die allgemeine Debatte um das ärztliche Selbstverständnis und die Arzt-Patienten-Beziehung? Wie wurde der Nürnberger Kodex als Bestandteil des Ärzteprozesses überhaupt verbreitet und innerhalb der Ärzteschaft bekannt? Die Antwort auf letztere Frage ist ernüchternd, wenn nicht beschämend. Die Dokumentation zum Nürnberger Ärzteprozess, die Alexander Mitscherlich und Fred Mielke umgehend unter dem Titel „Diktat der Menschenverachtung“ veröffentlichen wollten, wurde von ehemaligen NS-Ärzten juristisch bekämpft und erschien erst 1949 in relevantem Umfang als „Wissenschaft ohne Menschlichkeit“ und 1960 in einer Neuauflage als „Medizin ohne Menschlichkeit“. Auch die Publikation der dritten Beobachterin, von Alice von Platen-Hallermund, wurde weitgehend verschwiegen. 24 Sie erinnert sich 50 Jahre später: „Nach langen Verhandlungen wurde damals für die als wichtig anerkannte Aufgabe eine sechsköpfige Kommission zusammengestellt, die ausführliche Berichte verfassen sollte. Die Begeisterung der Auftraggeber, aber auch der anderen Mitglieder der Kommission kann nicht sehr groß gewesen sein. Drei der ernannten Mitglieder tauchten lediglich am Anfang unserer Tätigkeit und dann nur noch selten auf. Übrig blieben Dr. Mitscherlich als Leiter, der Medizinstudent Fred Mielke und ich, die ich damals als Volontärassistentin an der psychosomatischen Universitätsklinik in Heidelberg bei Professor Viktor von Weizsäcker arbeitete. Es stelle sich bald heraus, daß in Wirklichkeit große Widerstände, besonders bei den westdeutschen Ärztekammern und bekannten Medizinprofessoren, gegen unsere Kommission und besonders gegen Dr. Mitscherlich, einen bekannten Widerständler, vorherrschten.“ 25 23 Wunder (2002). Platen-Hallermund (1948). 25 Ricciardi-von Platen (1998), S. 13. Auf Anregung des Psychiaters Klaus Dörner nahm Alice Ricciardi-von Platen im Oktober 1996 als Kongresspräsidentin am Nürnberger Kongress „Medizin und Gewissen – 50 Jahre nach dem Nürnberger Ärzteprozess“ teil. Ihre weithin beachtete Teilnahme mündete in eine breite internationale Berichterstattung, auch über die Wiederauflage und Rezeption ihres Werkes „Die Tötung Geisteskranker in Deutschland“ aus dem Jahr 1948. Mit engen Verbindungen nach Nürnberg starb Alice Ricciardi-von Platen 2008 mit 98 Jahren in Italien. 24 15 Der Medizinhistoriker Richard Toellner hat für das Verhältnis der deutschen Ärzteschaft zum Nürnberger Ärzteprozess das Bild des „blinden Spiegels“ 26 benutzt: Uns müsse die Frage interessieren, „ob die deutsche Medizin, ob die deutsche Ärzteschaft den Nürnberger Ärzteprozess als Chance begriff, sich im Spiegel der Angeklagten, im Spiegel von deren Verhalten und Taten im Dritten Reich selbst zu prüfen, ja selbst zu erkennen“. Das freilich, so Toellner, hätte bedeutet, „die eigene Mittäterschaft, die Duldung und Zulassung des Unrechts und der Verbrechen eingestehen und bekennen zu müssen. Von einer solchen Wirkung, geschweige denn von einer kathartischen Wirkung des Ärzteprozesses“ könne jedoch keine Rede sein. Richard Toellner zitiert in diesem Zusammenhang auch eine Klage Alexander Mitscherlichs, für den der Abschlussbericht ohne jede Wirkung und Resonanz geblieben sei: „Nahezu nirgends wurde das Buch bekannt, keine Rezensionen, keine Zuschriften aus dem Leserkreis; unter Menschen, mit denen wir in den nächsten zehn Jahren zusammentrafen, keiner, der das Buch kannte. Es war und blieb ein Rätsel – als ob das Buch nie erschienen wäre.“ 27 Der Spiegel, so resümiert Richard Toellner, „in dem man sich selbst und seine Schuld hätte erkennen können, blieb blind. Alle Einsicht blieb aus. Im Gegenteil: Noch bevor der Prozess überhaupt begonnen hatte und die Anklageschrift bekannt war, wußten deutsche medizinische Fakultäten schon, was der Prozess zu leisten habe“28: Laut Toellner erwarteten etwa die Göttinger und Freiburger Fakultäten eine große Entlastung der deutschen Ärzteschaft. Während der Nürnberger Ärzteprozess innerhalb der Ärzteschaft demnach zunächst wenig bis keine Wirkung hinterließ, wurden der Nürnberger Kodex und die bereits im Ärzteprozess geführte Debatte zum Prinzip der Information und Zustimmung von Probanden durchaus rezipiert. 29 Das Primat der Aufklärung des Patienten, das als „informed consent“ im oben zitierten Sinne der erste und entscheidende Grundsatz des Nürnberger Kodex war, fand bereits vor der Urteilsverkündung im Ärzteprozess im sogenannten „Bad Nauheimer Gelöbnis“ Berücksichtigung, einem ärztlichen Gelöbnis, das die Delegierten der Ärztekammern in Westdeutschland im Juni 1947 in Bad Nauheim quasi „präventiv“ verabschiedeten. 30 Darin heißt es: 26 Toellner (1998), S. 289. Ebd., S. 290. 28 Ebd., S. 290. 29 Klee (2001). 30 Frewer (2009). 27 16 „Gegen seinen Willen und auch nicht mit seinem Einverständnis werde ich weder am gesunden noch am kranken Menschen Mittel oder Verfahren anwenden oder erproben, die ihm an Leib, Seele oder Leben schaden oder Nachteil zufügen können.“31 Die Aussagen sind deutlich. Doch das allgemeine Desinteresse innerhalb der Ärzteschaft und die Ignoranz gegenüber dem Nürnberger Ärzteprozess und seiner Dokumentation lassen es fraglich erscheinen, ob sich die Verfasser mit diesem Gelöbnis bewusst auf den Nürnberger Kodex und sein Prinzip des „informed consent“ bezogen. Ausdrückliche Verweise darauf sind mir jedenfalls nicht bekannt. Der Medizinethiker Andreas Frewer verweist in diesem Zusammenhang auf das „nicht unerhebliche Pathos“, mit dem im Bad Nauheimer Gelöbnis bereits im Sommer 1947 von der deutschen Ärzteschaft erneut Werte für das ärztliche Ethos beschworen würden – das „wahre Arzttum“ und die „reine Menschlichkeit“ –, die wenige Jahre zuvor noch in ganz anderem Zusammenhang benutzt worden seien. 32 Insgesamt kam dem Bad Nauheimer Gelöbnis nur geringe Bedeutung zu. Wenig später sollte es bereits hinter einem anderen Dokument in den Hintergrund rücken. Auch die Gründer des 1946 geschaffenen Weltärztebundes beabsichtigten die Formulierung einer verbindlichen Eidesformel, die schon 1948 als Genfer Gelöbnis verabschiedet und auch für den ärztlichen Berufsstand in Deutschland wichtig werden sollte. Denn erst als das Genfer Gelöbnis im Jahr 1951 zum offiziellen Bestandteil der ärztlichen Berufsordnung wurde, sollte auch die ärztliche Standesvertretung Deutschlands international anerkannt und als Mitglied in den neu gegründeten Weltärztebund aufgenommen werden. Selbst wenn es Hinweise dafür gibt, dass die Initiatoren des Genfer Gelöbnis den Eid des Hippokrates als nicht mehr zeitgemäß empfanden, zeigt eine Lektüre des Textes, dass er die Kernaussagen des Nürnberger Kodex unberücksichtigt lässt, damit selbst hinter den Text aus Bad Nauheim zurückfällt und erneut den durchaus umstrittenen medizinischen Mythos der Antike aufgreift. Um unter Ärzten erneut eine vertraut bedeutungsschwere Identitätsstiftung zu leisten, knüpfte das als „neuer hippokratischer Eid“ bezeichnete Genfer Gelöbnis explizit an der antiken Eidesformel an, auf die sich immerhin auch angeklagte Ärzte im Nürnberger Ärzteprozess berufen hatten. 31 32 Frewer (2009), S. 63. Frewer/Bruns (2004), Frewer (2009). 17 Im Genfer Gelöbnis33 heißt es: „Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Ich werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und Würde ausüben. [...] Ich werde mit allen meinen Kräften die Ehre und die edle Überlieferung des ärztlichen Berufsstandes aufrechterhalten. […] Dies alles verspreche ich feierlich auf meine Ehre.“ Die eingangs gestellte Frage nach der Bedeutung zentraler Prinzipien des Nürnberger Kodex für die allgemeine Debatte um das ärztliche Selbstverständnis und die Arzt-Patienten-Beziehung muss angesichts dieser Entwicklung für die unmittelbare Nachkriegszeit eher negativ beantwortet werden. Das Prinzip der informierten Zustimmung geriet bereits 1948 wieder aus dem Blick. Das Genfer Gelöbnis, auch als „Serment d´Hippocrate, Formule de Geneve“ bezeichnet, beschwört eher rückwärtsgerichtet und nostalgisch die „Ehre“ und die „edle Überlieferung des ärztlichen Berufs“. Dem Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven zufolge habe sich damit der viel beschworene Mythos des Hippokrates erneut als ein „fester Bestandteil der ärztlichen Selbstwahrnehmung erwiesen“ 34 und belege das Bedürfnis nach einer besonderen Begründung oder gar Bestimmung der ärztlichen Profession. Dieses Bedürfnis beginne bereits mit der „Erfindung des Hippokrates“, und es halte trotz aller wissenschaftlichen Zweifel an der Echtheit und Autorenschaft dieser Texte von der Antike bis in die Gegenwart an. Dabei sei der historische Hippokrates nach den Arbeiten des Philologen Ludwig Edelstein nicht nur ein „Name ohne Werk“ und seine Beteiligung am Corpus Hippocraticum schon in der Antike umstritten, sondern auch der „Eid des Hippokrates“ könne diesem nicht zweifelsfrei zugeordnet werden. Aber, so Leven, als idealisierter Stammvater der Medizin gelte Hippokrates bis heute. Während die Aufarbeitung von Ärzteprozess und Kodex und deren Bedeutung für die alltägliche Medizinpraxis weiter auf sich warten ließ, beeinflusste der Nürnberger Kodex von 1947 die Debatte um die Rahmenbedingungen medizinischer Forschung durchaus. Der Medizinhistoriker Eduard Seidler bemerkt dazu 50 Jahre später: 33 34 Frewer/Kolb/Krasá (2009), S. 309. Leven (1997). 18 „Im Binnenraum der Medizin – und zunächst im wesentlichen außerhalb Deutschlands – war indessen seit den späten fünfziger und frühen sechziger Jahren eine Diskussion über die Prinzipien von Nürnberg in Gang gekommen und hatte 1962 zur ersten, später mehrfach redigierten Deklaration von Helsinki durch die World Medical Association geführt. Diese hat erkennbar den Nürnberger Code und dessen Richtlinien für den Heilversuch und das wissenschaftliche Experiment am Menschen fortgeschrieben und ist unter anderem zur Grundlage der Arbeit von Ethikkommissionen geworden.“ 35 Die Wortwahl Seidlers ist aufschlussreich, spricht er doch von einem „erkennbaren Fortschreiben“ des Kodex und deutet damit indirekt die Kontroversen um den Nürnberger Kodex an. In der Tat wurde der Kodex auch in der medizinischwissenschaftlichen Welt der USA verzögert und kontrovers wahrgenommen. Eine wegweisende Abhandlung zu Fragen des medizinischen Rechts beschrieb ihn erst ein Jahrzehnt später in einer Publikation im Jahr 1956. In den Folgejahren entwickelte sich eine Kontroverse um die Stringenz und Praxistauglichkeit des Kodex, die 1959 in einem vielbeachteten Artikel des Forschers Henry Beecher gipfelte. Beecher lobte zwar den Geist des Nürnberger Kodex, stellte die Durchführbarkeit insbesondere seiner Einwilligungsvorschriften aber schlichtweg in Frage und widersprach der Vorstellung, aus dem Kodex die Regeln der amerikanischen Forschung ableiten zu wollen. 36 So hat denn die Deklaration von Helsinki, die drei Jahre später vom Weltärztebund verabschiedet wurde, den Nürnberger Kodex nicht im Wortlaut übernommen, sondern gerade im Hinblick auf die Einwilligung entscheidend verändert. Die amerikanischen Medizinethiker Todd L. Krause und William J. Winslade fassen diese Veränderung, die auf eine Unterscheidung der Einwilligungsforderung nach verschiedenen Forschungsgruppen hinauslief, 1997 rückblickend wie folgt zusammen: „Forschung, die ‚mit professioneller Betreuung einherging‘ (d.h. klinische Forschung), forderte vom Arzt, nur dann eine Einwilligung einzuholen, wenn dies ‚möglich‘ und ‚mit der Psychologie des Patienten vereinbar‘ war. Die Auflagen für die nicht-klinische Forschung waren strenger und forderten in allen Fällen eine freiwillige aufgeklärte Einwilligung. Spätere Revisionen der Deklaration in den Jahren 1975, 1983 und 1989 verfeinerten diese Ideen, sie gestanden den Ärzten jedoch im Hinblick auf die Einwilligungsforderung größere Freiheiten zu als der Nürnberger Kodex.“ 37 35 Seidler (1998), S. 310. Beecher (1959). Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Henry Beecher zu dieser Zeit parallel in geheime Humanexperimente der CIA eingebunden war. 37 Krause/Winslade (1997), S. 199. 36 19 Die Dokumentation von zwei internationalen Tagungen zur Kodifizierung medizinischer Ethik seit 1947, die im Jahr 1996 an der Universität Freiburg stattfand, zeigt die internationale Rezeption des Nürnberger Kodex und seine weltweite Bedeutung für die Formulierung medizinethischer Kodices. Seit dem Nürnberger Kodex ist die Zahl entsprechender standesrechtlicher Leitlinien, Eide oder Gelöbnisse stark gestiegen. Sie thematisieren nicht nur die Anforderungen an den „guten Arzt“ und ein gelingendes „Arzt-Patienten-Verhältnis“, sondern auch wichtige ethische Grundfragen am Anfang und Ende des Lebens oder gesellschaftlich umstrittene Themen wie die Gendiagnostik und die Organtransplantation. Die Herausgeber resümieren dabei kritisch: „Findet die Kodifizierung von Ethik in der Medizin der letzten 50 Jahre bei den Berufsangehörigen im allgemeinen Zustimmung, so stößt sie doch in der Öffentlichkeit auch auf Kritik. Man sieht in den von Standesvertretern geschaffenen Dokumenten im Zeitalter der Demokratie eine Tendenz zur Festigung eines Monopols, eine Verstärkung eigener Zielsetzungen und der Selbstregulation. Gleichzeitig werden die darin enthaltenen Forderungen nach Idealen als zu vage abgetan, und die Verdrängung philosophischer und religiöser Wertsysteme durch die professionelle und säkularisierte Organisation der Ethik in der Medizin wird beklagt.“ 38 Demgegenüber sei hier auf eine zwar überregional eher unbedeutende, aber inhaltlich alles andere als vage zu bezeichnende Initiative einer „Nürnberger Erklärung“ hingewiesen, die 1996 im Zuge des Nürnberger Kongresses „Medizin und Gewissen“ entstand, und in der es heißt: „Das gesundheitliche Wohl des Individuums ist für uns Ärztinnen und Ärzte ein unbedingt zu schützendes Gut. Deshalb dienen wir in unserer Praxis vorbehaltlos den gesundheitlichen Interessen des einzelnen Menschen und verteidigen diese gegen alle Ansprüche von anderer Seite. Wir unterstützen den Patienten in seiner eigenverantwortlichen Sorge für sein gesundheitliches Wohlergehen. […] Beim ärztlichen Handeln ist die Achtung vor den autonomen Entscheidungen des Patienten nach seiner bestmöglichen Aufklärung für uns Gebot. Ist er nicht einwilligungsfähig, gilt für uns die Zustimmung eines informierten gesetzlichen Vertreters oder im Notfall der begründet gemutmaßte Wille des Patienten. Vor fremdnütziger Forschung muss er geschützt sein. (...) Wir setzen uns für die öffentliche Transparenz medizinischer Forschungsprojekte ein, weil in der gesellschaftlichen Akzeptanz ein notwendiges Korrektiv zur Einschätzung der Verantwortbarkeit der Vorhaben liegt. In der Beachtung ihres gesundheitlichen Schutzes dürfen Versuchspersonen hinter Patienten nicht zurückstehen. Es gibt nicht zweierlei Humanitätsbegriffe für die forschende und praktische Medizin.“ 39 38 39 Tröhler/Reiter-Theil (1997), S. 13. Kolb/Seithe (1998), S. 468. 20 Ausgehend von dieser „Nürnberger Erklärung“ entstand zwischen Oktober 1996 und August 1997 in einem mehrmonatigen überregionalen Diskussionsprozess unter Mitwirkung namhafter Ärzte, Medizinhistoriker und Medizinethiker 40 ein „Nürnberger Kodex ´97“. Er sollte sich ausdrücklich auf die Prinzipien des Nürnberger Kodex von 1947 beziehen, diese auf die ethischen Herausforderungen der modernen Medizin anwenden und am 20. August 1997, dem 50. Jahrestag des Nürnberger Kodex, veröffentlicht werden. Im „Nürnberger Kodex ´97“ heißt es u.a. : „Die freiwillige und informierte Einwilligung des Patienten nach bestmöglicher Aufklärung (,informed consent‘) ist eine prinzipielle Grundlage aller Behandlungen im Gesundheitswesen, aller Heilversuche und aller medizinischen Experimente am Menschen. Nur im Falle von Notfallbehandlungen kann diese Zustimmung nachträglich eingeholt werden.“ 41 Angewendet auf aktuelle Kontroversen der Medizin, z.B. Gendiagnostik, Fortpflanzungsmedizin, Transplantation oder Sterbebegleitung, werden der Anspruch dieser Prinzipien deutlich: Für eine Organentnahme etwa bräuchte es demnach die ausdrückliche Zustimmung des Organspender, ein Widerspruch genügte nicht. Um die Zustimmung zu erhalten, könnte – wie inzwischen vom Gesetzgeber auf den Weg gebracht – eine Thematisierung beim Führerscheinerwerb erfolgen. In diesem Sinne hat der Nürnberger Kodex bis heute Bedeutung. Dabei geht es weniger um jedes einzelne Wort, sondern vielmehr um die patientenorientierte Haltung, die er vermittelt. Ein solche ärztliche Haltung wird in den folgenden Abschnitten dieser Einführung immer wieder anklingen, ob im Bezug auf die Autonomie von Patienten, die Vorstellungen vom ärztlichen Rollenverständnis, oder das Prinzip gemeinsamer Entscheidungsfindungen. Insofern geben die Aufarbeitung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Ärzteprozess und der Kodex mit seinem „informed consent“ der Medizin bis heute Orientierungspunkte. 40 An den Diskussionen nahmen u.a. teil: Theresia Adelfinger (Erlangen), Prof. Dr. Klaus Dörner (Hamburg), Dr. Alfred Estelmann (Nürnberg), Prof. Dr. Helfried Gröbe (Nürnberg), PD Dr. Bernd Höffken (Nürnberg), Prof. Dr. Regine Kollek (Hamburg), Prof. Dr. Hans Mausbach (Frankfurt), Prof. Dr. Eduard Seidler (Freiburg), Dr. Horst Seithe (Nürnberg), Prof. Dr. Renate Wittern-Sterzel (Erlangen) und Dr. Michael Wunder (Hamburg). Der einjährige Prozess der Diskussion und Redaktion wurde vom Verfasser dieser Arbeit moderiert. Erstunterzeichnende waren u.a.: Prof. Dr. Gerhard Baader (Berlin), Dr. Winfried Beck (Offenbach), Prof. Dr. Elisabeth Beck-Gernsheim (München), Prof. Dr. Karl Bonhoeffer (München), Prof. Dr. Hans-Ulrich Deppe (Frankfurt), Dr. Torsten Lucas (Berlin), Prof. Dr. Dietmar Mieth (Tübingen), Prof. Dr. Norbert Paul (Düsseldorf), Prof. Dr. Walter Pontzen (Nürnberg), Prof. Dr. Udo Schagen (Berlin), Dr. Eva Schindele (Bremen), Prof. Dr. Manfred Stauber (München), Dr. Hilde Steppe (Frankfurt), Dr. Waltraud Wirtgen (München) und Prof. Dr. Jörg Wiesse (Nürnberg). 41 Siehe Anlage 9.1.3. 21 2.3. Autonomie des Patienten Nach den beiden historischen Bezugspunkten mit ihren Verweisen auf die heutige Medizin, steht in diesem Abschnitt der Patient selbst im Mittelpunkt. Patienten gelten heute vielfach nicht mehr als unwissende Laien oder „hilfsbedürftige Mündel ärztlicher wie pflegerischer Fürsorge“ 42, sondern sie gelten immer häufiger auch als „selbstbestimmte Kundinnen und Kunden“ eines wachsenden Gesundheitsmarktes. Je stärker die Gesundheitspolitik das bisherige Verständnis eines von der Daseinsfürsorge geprägten Gesundheitswesens konterkariert und einer auf Profit orientierten Gesundheitswirtschaft den Weg bereitet, umso mehr rückt in den Hintergrund, dass Patienten nicht selten verletzliche oder existenziell bedrohte Menschen mit Bedürfnissen, Rechten und Ansprüchen sind. Gerade diejenigen Patienten, die eine Ethikberatung erfahren, sind oft in einer vulnerablen Situation und nur selten dürften sie sich als uneingeschränkt souveräne Subjekte empfinden. Viel eher erfahren sie sich als beratungsbedürftige Objekte eines komplizierten und unübersichtlichen Gesundheitsapparates – und stehen dabei nicht selten unter einem erheblichen Entscheidungsdruck. Jede anzustrebende Norm einer Autonomie von Patienten wird diese Annahme also zu berücksichtigen haben, will sie nicht an den Realitäten kranker Menschen vorbeizielen. 43 In diesem Zusammenhang bezeichnet die Philosophin Sigrid Graumann die Stärkung der Patientenautonomie in Medizinethik und Gesundheitspolitik als „historische Errungenschaft“44, zuerst als Abwehr- später auch als Anspruchsrecht. Als Abwehrrecht gründe sie auf den Erfahrungen einer paternalistischen Medizin, bei der – wie beschrieben – im 19. und 20. Jahrhundert die naturwissenschaftliche Entwicklung der Medizin mitsamt dem Humanexperiment den Konflikt zwischen wissenschaftlichem Interesse und ärztlichem Heilauftrag verschärft habe und „das Vertrauen in die ärztlichen Tugenden zerstörte“. Bis in die Nachkriegszeit habe ein paternalistisches Selbstverständnis die Beziehung von Ärzten und Patienten geprägt, so dass sich vor diesem geschichtlichen Hintergrund das Verständnis einer Autonomie von Patienten als eines der Paradigmen moderner Medizinethik entwickelte, aber zunächst eben als als Abwehr- und Schutzrecht.45 42 Graumann (2008), S. 415. Vgl. Kühn (1996), Brunner (2000), Gold et al (2000), Sachverständigenrat (2002) und (2003). Dörner (2004), Huber/Langbein (2004), Dierks (2006), Deppe (2008), Rosenbrock (2008). 44 Graumann (2008), S. 416. 45 Graumann (2004), Katz (1998). 43 22 Angestoßen durch den Nürnberger Kodex und die kontroversen Diskussionen um das Prinzip der freiwilligen und informierten Zustimmung in der Deklaration von Helsinki erlangte das Gebot der Patientenautonomie immer größere Bedeutung – zunächst in der Bürgerrechtsbewegung der USA,46 später auch in Deutschland im Zuge der wachsenden Basisbewegungen im Gesundheitswesen. In dieser Zeit entstanden und prägten einige Klassiker der medizinkritischen Literatur die gesundheitspolitische Debatte, nicht zuletzt „Die Nemesis der Medizin“.47 In den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts bildeten sich an vielen Orten alternative Gesundheitsläden, Selbsthilfegruppen und Patientenvertretungen, die im Mai 1980 in Berlin im ersten „Deutschen Gesundheitstag“ mit mehreren tausend Teilnehmern gipfelte. Die Gegenveranstaltung zum jährlich stattfindenden Deutschen Ärztetag war auch insofern bemerkenswert, als ihr Selbstverständnis von zwei Hauptanliegen geprägt wurde: den Forderungen nach einer stärkeren Patientenzentrierung in der Medizin und der Aufarbeitung der medizinischen Verbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus. Der damalige Wortführer der kritischen Ärztebewegung, Ellis Huber, fasste das Selbstverständnis so zusammen: „Im Gesundheitswesen helfen fachkundige Menschen anderen Menschen, die hilfsbedürftig sind. Gesundheitlicher Forts chritt und die Bewältigung von Krankheit und Leid sind eine Beziehungsleistung von Arzt und Patient, ein gemeinsames Produkt. Arzt und Patient sind Partner, Ärzteschaft und Bevölkerung bilden eine dialogische Partnerschaft. Dies zu erkennen, ist für uns Ärztinnen und Ärzte in sozialer Verantwortung ein politisches Programm: Gesundheitspolitik statt Standespolitik.“48 Damals, im Mai 1980, war nicht vorherzusehen, dass es Ellis Huber nur sieben Jahre später gelingen sollte, mit diesem ungewöhnlichen Selbstverständnis auch die Mehrheit der Berliner Ärzteschaft für seine Wahl zum Präsidenten der Berliner Ärztekammer zu gewinnen. Mit seinen unkonventionellen Thesen wurde Huber für lange Zeit zum Sprachrohr vieler Anhänger einer patientenzentrierten Medizin. Während Patientenautonomie damals besonders als Abwehrrecht gegenüber ärztlicher und staatlicher Bevormundung verstanden wurde, gilt es heute mindestens ebenso stark als Anspruchsrecht. Patienten verhalten sich innerhalb des Gesundheitswesens auch als Kunden. In bestimmten Situationen kommt ihnen damit eine gewisse Wahlfreiheit zu – allerdings nicht ohne Einschränkung. 46 Schöne-Seifert (1996). Illich (1995) Die erste Auflage erschien 1975 unter dem Titel „Die Enteignung der Gesundheit“. 48 Huber (1998), S. 439. 47 23 Mit der Einführung der Kundenperspektive in die Heilkunde stößt dieses Recht eben auch an Grenzen. Eine Beschränkung der Patientenautonomie auf das Prinzip der Wahlfreiheit würde den Patienten in unverantwortlicher Weise die Risiken und Belastungen medizinischer Behandlungen aufbürden und „gerade schwerkranke, bedürftige und von medizinischer Versorgung existentiell abhängige Patientinnen und Patienten“, so die Philosophin Sigrid Graumann, würde dies „überfordern und benachteiligen“.49 Die Philosophin und langjährige wissenschaftliche Begleiterin der Gesundheits- und Behindertenbewegung unterscheidet daher zwischen einer „situationsbezogenen Handlungsautonomie“ und einer „Patientenautonomie als moralisches Recht“. Graumann postuliert, dass erstere „durch den aktuellen Krankheitszustand und die Umgebungsbedingungen eingeschränkt sein [kann], und ihre Ausprägung von ärztlichem und pflegerischem Handeln sowie von institutionellen und gesellschaftlichen Bedingungen abhängt.“50 „ Dieser situationsbezogenen Selbstständigkeit steht ein Verständnis von Autonomie als moralisches Recht mit Regulierungsfunktion für das ärztliche und pflegerische Handeln und für die Gestaltung des Gesundheitswesens gegenüber. Aus der Patientenautonomie als moralisches Recht folgt, das Patientinnen und Patienten ein Recht auf Bewahrung, Förderung und Wiederherstellung ihrer Autonomie haben. Daher müssen sich sowohl ärztliches und pflegerisches und als auch die politische Gestaltung des Gesundheitswesens daran orientieren, die situationsbezogene Handlungsautonomie von Patientinnen und Patienten nicht zu behindern, sondern zu fördern und zu stärken.“51 Ein solches emanzipatorisches Verständnis von Patientenautonomie, das sich nach Graumann „sowohl gegen paternalistische Bevormundung als auch gegen neoliberale Vereinnahmung richtet und für das sich die Gesundheits- und Behindertenbewegung in den letzten 30 Jahren eingesetzt“ habe, entspräche gesundheitspolitischen Folgerungen, zu denen „die Inklusion aller Menschen, die hier leben, in eine solidarische Gesundheitsversorgung“ mit guter Versorgungsqualität gehöre sowie die Stärkung der Patientenbeteiligung. 52 Im Hinblick auf die Klinische Ethikberatung ergeben sich daraus Schlussfolgerunen sowohl für die Mitglieder des professionellen Teams als auch für das Krankenhaus als Ganzes. 49 Graumann (2008), S. 420. Ebd. 51 Ebd., S. 421. 52 Ebd., S. 422, Vgl. auch Dörner (2004) und (2005). 50 24 Beiden, Individuen wie Institutionen, kommt die Verantwortung zu, den erforderlichen Rahmen für eine Förderung der situationsbezogenen Handlungsautonomie in den schwierigen ethischen Entscheidungssituationen zu schaffen. Damit wird das eher abstrakte und theoretische Konstrukt der Patientenautonomie durch seine praktische Umsetzung im klinischen Alltag überprüf- und bewertbar. In diesem Zusammenhang sind auch die Vorstellungen von Thure von Uexkülls zum Wohl des Kranken und seinem Verständnis von der Autonomie des Patienten aufschlussreich, die er in seiner „Theorie der Humanmedizin“ gemeinsam mit Wolfgang Wesiack dargelegt hat. Uexküll versteht unter Autonomie, die er als das „Fundament der Freiheit des Menschen“ bezeichnet, stets zweierlei: Selbstverwirklichung und Selbstbeschränkung – wobei letztere dem Begriff der Selbstverantwortung der gegenwärtigen Debatte sehr nahe komme. Uexküll versteht sie beide nicht als gegensätzliche, sondern als sich polar ergänzende Begriffe. Eines sei ohne das andere nicht denkbar. „So gesehen ist Gesundheit (bzw. genauer gesagt, der Weg zur Gesundheit) gleichbedeutend mit dem Weg zu einer größeren bzw. größtmöglichen Autonomie. Therapie jedweder Art wäre dementsprechend Hilfe für Selbsthilfe bzw. Hilfe für den Mitmenschen einen Zuwachs an Autonomie zu erreichen. Zu diesem Zweck ist es nötig, alles, was die Autonomie des Patienten einschränkt, so weit als möglich zu beseitigen.“ 53 In diesem Sinne hat sich auch der erfahrene Internist und Klinker Linus S. Geisler praktisch und theoretisch mit der Idee der Patientenautonomie befasst und eine „kritische Begriffsbestimmung“ vorgelegt, in der er einen möglichen Paradigmenwechsel vom Prinzip der Fürsorge zum Prinzip der Autonomie beschreibt. Geisler war viele Jahre Mitglied der Ethik-Kommission der Ärztekammer Nordrhein und wiederholt von Enquête-Kommissionen des Bundestages als Sachverständiger zu ethischen und rechtlichen Fragen der modernen Medizin bestellt. Für Geisler ist ärztliches und pflegerisches Ethos „von seinen Wurzeln her“ ein Ethos der Fürsorge: „Fürsorge findet ihren Grund in der Natur des Menschen: in seinem Angewiesensein auf die Zuwendung anderer“. 54 Auch fänden sich bereits im hippokratischen Eid zwei der vier Prinzipien der modernen Prinzipienethik, nämlich beneficence und nonmaleficence; Autonomie, so Geisler, komme hingegen nicht vor. 53 54 Uexküll/Wesiack (1991), S. 611. Geisler (2004). 25 Linus Geisler verweist auf die Herkunft der Idee der Autonomie und die Philosophie Immanuel Kants, wie er auch auf den Nürnberger Kodex von 1947 und auf die Bedeutung der Zustimmung des autonomen Patienten verweist sowie auf die vier die Medizinethik maßgeblich prägenden „Principles of Biomedical Ethics“, die 1979 von Tom L. Beauchamp und James F. Childress reformuliert wurden: die Achtung der Autonomie, das Nicht-Schaden, das Wohltun und die Gerechtigkeit. 55 Letztlich resümiert der erfahrene Arzt: „Die ständig wachsende medizinische Verfügbarkeit über menschliche Gesundheit und menschliches Leben, aber auch die zunehmende Individualisierung der Werte und Lebenskonzepte erhoben in den vergangenen drei Jahrzehnten den Willen des selbstbestimmten Patienten immer stärker in den Rang einer Lex suprema. Das Prinzip der Fürsorge hingegen erfuhr unter dem Vorwurf des Paternalismus eine stetige Abwertung, ein Prozess, der als Paradigmenwechsel vom ,beneficence model‘ zum ,autonomy model‘ beschrieben wurde.“ 56 Angesichts dieser Entwicklung fragt der Arzt nach den inhaltlichen „Auffüllungen und Ausfächerungen“ des heutigen Autonomiebegriff und nach dem Stellenwert, der ihm unter den ethischen Prinzipien der Biomedizin zukomme, und wie Autonomie bei einem Kranken verwirklicht werden könne, wenn dieser sie überhaupt nicht mehr wahrnehmen könne? In seinen Antworten folgt Geisler zunächst der Psychologin Monika Bobbert, die in Bezug auf „Patientenautonomie und Pflege“ 57 eine „Begründung und Anwendung eines moralischen Rechts“ vorgelegt hat. Bobbert ordne der Patientenautonomie dabei verschiedene Rechte zu wie „das Recht auf Zustimmung oder Ablehnung, auf Information, Festlegung des Eigenwohls, auf Alternativenauswahl sowie auf möglichst milde Einschränkung des Handlungsspielraums durch die im Gesundheitssystem unumgänglichen institutionellen Strukturen“. 58 Kurzum: Patientenautonomie versteht sich – wie schon bei Graumann – nicht nur als Widerstandsbegriff, sondern auch als Formulierung von Anrechten. Sie kann eher eng verstanden werden („Ich will informiert sein“) oder auch sehr weit gefasst sein („Ich erwarte umfassende Hilfestellungen“). Wesentlich für Geisler ist die Unterscheidung eines Autonomiebegriffs, der entweder eher vom Individuum her oder eher unter dem Aspekt der Beziehung gedacht ist. 55 Beauchamp (2009). Geisler (2004), S. 453. 57 Bobbert (2002). 58 Geisler (2004), S. 453. 56 26 Eine Ethik der Fürsorge betone dabei stets die Perspektive der Beziehung und des „menschlichen Eingebundenseins in Beziehungen“ und sei daher – auch dem Verständnis des Ethikers George J. Agich nach – mit ständigen Prozessen der Interpretation und Aushandlung verbunden. „In scheinbarer Paradoxie zu einem Autonomiebegriff, der von einer von jeden äußeren Einflüssen unabhängigen Selbstbestimmtheit ausgeht, schält sich immer mehr heraus, dass Patientenautonomie Sinn und Tragfähigkeit erst durch Relationalität und Kontextualität gewinnt. Damit entstehen quasi Schnittmengen mit anderen ethischen Prinzipien, wie beispielsweise der Ethik der Fürsorge. Patientenautonomie imponiert dann nicht mehr als monolithisches ethisches Prinzip mit der Gefahr der Distanzbildung zwischen Arzt und Patient und einer möglicherweise fragwürdigen Verlagerung von Verantwortung auf den Patienten.“59 Geisler verweist auch auf die aus der feministischen Ethik kommende „relationale Autonomie“, die eine „gegenseitige Verwiesenheit von Arzt und Patient, die Fragilität der Autonomie und die Notwendigkeit der Autonomieförderung“ betone. „Eine nicht paternalistische Fürsorge erlaubt dem Kranken Möglichkeiten einer autonomen ,Selbstsorge‘. Der Patient trifft seine Entscheidung selbst, aber nicht einsam und allein, sondern intersubjektiv, d.h. im Dialog oder Gespräch. Auch hier wird wieder die grundlegende Bedeutung kommunikativer Prozesse für die Umsetzung ethischer Prinzipien in der Medizin deutlich.“ 60 Wenn in diesem Sinne Fürsorge und Autonomie einander bedingten, erübrige sich die Frage nach ihrer Rangordnung, sie stünden gleichwertig nebeneinander. Die Fürsorge der Ärzte brauche die Selbstbestimmtheit der Patienten und umgekehrt. Dies gelte umso mehr, als das Autonomiebedürfnis sehr unterschiedlich sein könne: Krankheit schränke die Fähigkeit zur Selbstbestimmung nicht nur grundsätzlich ein. Mit der Schwere der Krankheit nehme der Wunsch nach autonomen Entscheidungen nachweislich ab und auch je nach Phase der Behandlung gäbe es ein größeres Interesse direktiver Fürsorge des Arztes. Letztlich, so Geisler, ginge es um ein „Ernstgenommenwerden“ durch den Arzt – ein Anspruch, der für die Situationen der Ethikberatung besonders gelten dürfte. „Sich ernsthaft auf die Selbstauslegung der Krankheit eines Patienten einlassen zu können, wurzelt vorwiegend in der Empathiefähigkeit des Arztes. Sie zu vermitteln und zu entwickeln wird im derzeitigen Ausbildungssystem allerdings nicht angestrebt.“61 59 Geisler (2004), S. 455. Ebd., S. 455. 61 Ebd., S. 456. 60 27 2.4. Ärztliches Rollenverständnis Wie soeben deutlich wurde, berühren Überlegungen zur Patientenautonomie oder einer Ethik der Fürsorge nicht zuletzt das ärztliche Selbstverständnis. Deshalb frage ich nunmehr in Anlehnung an Thure von Uexküll und Wolfgang Wesiack, wie sich das ärztliche Rollenverständnis im Laufe der Geschichte entwickelt und verändert hat. „Grundlagen des ärztlichen Denkens und Handeln“ lautet die Schrift, in der die beiden ihr Programm einer Medizin vorlegen, die den ganzen Menschen in den Blick nimmt. Auf der Suche nach ihren tragenden Phänomenen tasten sie sich zurück an die Anfänge der menschlichen Stammesgeschichte. Von den ersten vorgeschichtlichen Spuren über die geschichtliche Entwicklung aller Epochen mit ihren spezifischen Ausprägungen stoßen sie dabei auf ein wiederkehrendes Muster: die geradezu existenzielle Bedeutung der Beziehung zwischen dem immer von Krankheit bedrohten Menschen und seinem „Arzt“ – ob in der Rolle des Medizinmannes, Priesters, Pädagogen oder medizinischen Experten. Uexkülls ganzheitlicher Sicht folgend, erscheint ihm sehr wichtig die Phase der Einheit von Mensch und umgebender Natur mit ihrer „participation mystique“, 62 abgebildet bis heute in der Mutter-Kind-Beziehung, gewissermaßen dem „Archetypus“ der Beziehung zwischen dem Hilfebedürftigen und seinem „Heiler“. „Die ontogenetische Wurzel des suggestiven Heilzaubers ist offenbar die primäre, auch symbiotisch genannte Mutter-Kind-Beziehung. Sie ist das Urbild jeder Arzt-Patient-Beziehung. Die Mutter, die das Kind durch beruhigende Worte und Streicheln tröstet, die ihm Sicherheit gibt und hilft, Not und Schmerzen zu ertragen, ist der Archetyp des auf der magischen Ebene heilenden Medizinmannes oder Arztes.“63 Die Heilkunst in den frühen Hochkulturen des Vorderen Orient, besonders die in Ägypten, stellt einen großen Fortschritt gegenüber dem magischen Zauber der archaischen Welt dar. Dazu zählt, dass der Mensch nicht mehr naturhaftunbewusst existiert, sondern sich als Person wahrnimmt, die für ihr Tun verantwortlich ist. Er weiß um die Normen, und deshalb kennt er auch das Gefühl der Schuld, wenn er sie verletzt – wenn er die Götter beleidigt hat, in deren Hand sein Schicksal liegt. Auch er braucht den Heiler und den Helfer, aber zum Zauberritual treten Gebet und Opfer, neben den Magier tritt der Priester-Arzt. Seine Rolle wurde als so bedeutend eingeschätzt, dass es zum ersten Mal „Sitten-und Pflichtenlehren für Ärzte“ gibt, die dessen Verhalten regeln. 62 63 Den Begriff prägte der französische Philosoph und Ethnologe Lucien Lévi-Bruhl. Uexküll/Wesiack (1991), S. 579. 28 Den vorläufigen Höhepunkt in der Geschichte der medizinischen Kunst bewirken die Griechen. Sie fügen der Rolle des Arztes den Aspekt des Lehrers und Erziehers hinzu. Der „gelehrte“, der kundige Arzt verfügt über das Wissen. Er weiß, was dem Kranken nützt und was ihm Schaden zufügen könnte; deshalb übernimmt er die Rolle des Erziehers. Inzwischen ist die Medizin über die bloße Anwendung von Erfahrung hinausgewachsen in eine Wissenschaft vom Körper, von seinen Kräften und Säften, mit der die Griechen auf lange Zeit Maßstäbe setzten. Aber mehr noch. Was den Ruhm Sokrates' und Platons begründete, ihre Dialoge, das, so Uexküll, spielte auch für die Heilkunst eine besondere Rolle: „Sokrates aber entwickelte eine Form der Dialogführung, die er selbst maieutiké techne (d.h. Hebammenkunst) nannte, und schuf damit eine bis heute gültige psychotherapeutische Methode. […] Sokrates ist ebenso wie der gute Psychotherapeut von heute nur Geburtshelfer, der dem Gesprächspartner bzw. dem Patienten nicht seine eigene Meinung aufzwingt, sondern wartet, bis sich bei diesem aus Erlebnissen und Assoziationsreihen neue Erkenntnisse bilden und neue Verhaltensweisen einstellen. […] Platon dokumentiert erstmals mit der Sokratischen maieutike´techne eine interpersonelle Kommunikationsform, die nicht nur zu neuen Interpretationen und Erkenntnissen, sondern auch zu Veränderungen der Menschen führt. Im Gegensatz zur Illusion einer objektiven Erkenntnis´, wie sie der immer noch in der Medizin wirksame Positivismus des 19. Jahrhunderts vertritt, zeigt Platon, wie Erkenntnis durch Interaktion mehrerer Partner entsteht.“64 Schließlich verbindet sich im landläufigen Verständnis mit dem griechischen Namen Hippokrates die Vorstellung einer von hoher Ethik getragenen Sorge um den kranken Menschen, bestimmt von der philantrophia, der Liebe zum Menschen. Der Arzt als Freund – eine weitere Spielart der Rolle, die Uexküll als wesentlich für den Arzt entdeckt und ihm zuweist. Dass hohe Ideale bisweilen in der gesellschaftlichen Wirklichkeit an Grenzen stoßen, gilt allerdings auch für die geforderte Menschenliebe: Vor allem die Reichen unter den freien Bürgern Griechenlands waren Nutznießer der hoch entwickelten Heilkünste; für die weniger Begüterten und erst recht für die Sklaven galten andere Sitten. „Neben der ,tyrannischen‘ Medizin, die bei Sklaven angewandt wurde, und der ,pädagogischen‘ Medizin für die Reichen beschreibt Plato noch eine dritte Art der Krankenbehandlung, die seine besondere Sympathie findet und die ihm vor allem für die armen freien Bürger (wie z.B. Handwerker) besonders geeignet erscheint. Es ist eine Art ,Radikalkur‘, die entweder im günstigsten Fall zur Wiederherstellung der Gesundheit (und Arbeitsfähigkeit), im ungünstigen Falle aber zum Tode führt.“65 64 65 Uexküll/Wesiack (1991), S. 582. Ebd., S. 585. 29 In diesem Zusammenhang bedeutet vor allem das christliche Mittelalter einen Fortschritt in seiner Betonung der Nächstenliebe, seinem Verständnis des Arztes als Samariter, das dann für lange Zeit prägend wurde. Anders als in der Antike standen für den Arzt weniger die Wissenschaft der Heilkunde als vielmehr Tröstung und Sorge der unheilbar Kranken und Armen als christliches Gebot im Mittelpunkt. Die Erfahrungsheilkunde spielte wieder eine größere Rolle, während ein Teil des medizinischen Wissens der Antike auf diese Weise verloren ging. Mit der Aufklärung setzt erneut eine Gegenbewegung ein. Hat sich die Wissenschaft bisher nur im Rahmen des geltenden Weltbildes bewegt, so kommen nun vor allem die Naturwissenschaften auf dem Weg des Experiments – ohne „dogmatische“ Vorfestlegungen – zu völlig neuen, teilweise umstürzenden Ergebnissen, die alte Gewissheiten nicht nur infrage stellen, sondern am Ende auch beseitigen. Der heftige Widerstand der herrschenden Autoritäten, vor allem der Kirche, kann diese Entwicklung auf Dauer nicht aufhalten; er trägt letztlich sogar dazu bei, die eigene Glaubwürdigkeit zu mindern. Mit dem immer erfolgreicheren Aufstieg der naturwissenschaftlichen Disziplinen verliert gleichzeitig die überkommene metaphysische Verankerung der Menschen zunehmend an Überzeugungskraft. Stattdessen richtet sich der Blick des Menschen auf seine Welt, von der er ja Teil ist und für die er in einem neuen Sinn Verantwortung trägt. Forscherdrang führt zu einem ungeahnten Aufstieg der Wissenschaft von Natur, völlig neue Möglichkeiten eröffnen sich durch neue technische Entwicklungen ihrer Anwendung. Uexküll spricht davon, dass die Rolle des Arztes als Lehrer gerade in dieser Zeit „zu neuem Leben erwacht“, an Bedeutung sogar zunimmt. Allerdings gilt das in einem neuen Sinn, denn die Medizin sieht sich zum ersten Mal in der Lage, über das Wohl des einzelnen Patienten hinaus, gesundheitsfördernd oder Krankheit vermeidend in die Gesellschaft hinein zu wirken. Mit der Wahrnehmung dieser Möglichkeit aber wächst der Arzt in eine Rolle hinein, die auf einen Konflikt zusteuert: ist er weiterhin der unbedingte Anwalt eines Kranken, seines Patienten, oder ist er in erster Linie dem Gemeinwohl verpflichtet? Der Patient steht in der Gefahr, zum Anwendungsfall im Hinblick auf das Ganze zu werden. Dass gleichzeitig mit der starken Differenzierung innerhalb der Medizin der einzelne Arzt immer mehr zum Experten in einem immer begrenzteren Gebiet seines Faches wird, verändert das Verhältnis zwischen Arzt und Patient grundlegend. 30 „Durch die Modellvorstellung des Organismus als Maschine haben sich zwangsläufig auch das Selbstverständnis des Arztes und die Arzt-PatientenBeziehung grundlegend geändert. Der Arzt ist jetzt in erster Linie naturwissenschaftlicher Experte, und der Patient ist Objekt seiner diagnostischen und therapeutischen Bemühungen. An die Stelle des leibseelischen Physisbegriffes der Hippokratiker ist das Maschinenmodell des Organismus getreten. Die alten Begriffe der philanthropia, der philotechnia und der physiophilia, aber auch der caritas haben in den nüchternen Modellen der objektivierenden naturwissenschaftlichen Medizin keinen Platz.“ 66 Es ist ein Verdienst Thure von Uexkülls und Wolfgang Wesiacks, dass sie in ihrem exemplarischen historischen Exkurs nicht einfach Fakten zusammentragen, sondern wesentliche Grundlinien ärztlichen Handelns aufspüren und damit auch ihre Gültigkeiten für ärztliches Handeln heute verdeutlichen. Auch in unseren Tagen läuft die Medizin Gefahr, Wissen und Handeln des Experten in den Vordergrund zu stellen und das Bedürfnis des Kranken nach partnerschaftlicher Kommunikation und Begleitung geringer zu achten oder gar ganz zu übersehen. 67 Für die hier vorliegende Arbeit zur Klinischen Ethikberatung zählen diese – vorrangig an den Vorstellungen der beiden Psychosomatiker angelehnten – punktuellen und exemplarischen Reflektionen der verschiedenen Rollen von Ärzten und die damit verbundene Reflektion der Beziehung von Ärzten und ihren Patienten zu einem weiteren wichtigem Bezugspunkt. Gerade in den schwierigen klinischen Entscheidungssituationen, in denen Ärzte, Patienten und Angehörige die „Dienstleistung“ einer professionellen Ethikberatung in Anspruch nehmen, sind auch auf ärztlicher Seite die hier skizzierten Rollen des Experten, Partners und Samariters von Nöten. Die Ethikberatung kann diese allenfalls ergänzen, ersetzen kann sie diese nicht. Insofern ist für die Klinische Ethikberatung, aber auch für die Medizin im Allgemeinen, ein Selbstverständnis – oder eine Theorie der Medizin – notwendig, das diese Rollen systematisch integriert und damit das Verständnis der Medizin deutlich weiter fasst, als dies herkömmlich geschieht. Eine solche Theorie liegt dem bio-psycho-sozialen Modell der psychosomatischen Medizin zugrunde, weshalb dieses Modell im folgenden Kapitel kurz vorgestellt wird. Das Selbstverständnis der Psychosomatik kann schliesslich als wegweisend auch für die Praxis der Ethikberatung angesehen werden. 66 67 Uexküll/Wesiack (1991), S. 593. Engelhardt et al. (2001). 31 2.5. Patientenzentrierte Medizin Im folgenden Kapitel möchte ich die theoretischen Grundlagen der Psychosomatik skizzieren sowie Ideen und Erfahrungen bezüglich ihrer Institutionalisierung in der Organisation Krankenhaus beschreiben. Mit der Psychosomatik rückt ein Modell ganzheitlicher Betrachtung in den Blick, das zwar als eigenes Fachgebiet ungleich komplexer ist, aber für die klinische Implementierung dennoch interessante Verbindungen zur Klinischen Ethikberatung aufweist. Nicht ohne Absicht gründet das vorangegangene Kapitel ausdrücklich auf den Vorstellungen Thure von Uexkülls, einem der Väter der modernen Psychosomatik. Mit der „Theorie der Humanmedizin“ schufen er und Wolfgang Wesiack etwas, das dem Fach Humanmedizin im Grunde fehlt: eine theoretische Basis, eine Theorie der Heilkunde. Uexküll und Wesiack gaben ihrem Werk den Untertitel „Grundlagen ärztlichen Denkens und Handelns“, wobei ihre Theorie weit über die Belange des ärztlichen Berufes hinausgeht und eigentlich allen heilkundlich Tätigen als Grundlage dienen kann. Uexküll und Wesiack liegt von Anfang an viel daran zu verdeutlichen, was das Fehlen einer eigenen Theorie im Grunde bedeutet. „Wir sind in der Vorstellung aufgewachsen, daß Medizin eine angewandte Wissenschaft – und das meint – letzten Endes gar keine Wissenschaft sei, sondern eine Disziplin, welche die Theorien und Methoden von sogenannten Grundlagenwissenschaften für praktische Zwecke der Ärzte verwende. Höchstens die Regel, was und wie dieses, was angewendet werden muß, um die angestrebten Ziele zu erreichen, seien Eigentum und Eigenverantwortung der Medizin; alles andere bleibe Eigentum und Eigenverantwortung der Physik, der Chemie, der Biologie, der Physiologie oder der Anatomie.“68 Dieser Vorstellung, so die beiden, entspräche auch das übliche medizinische Curriculum. In ihm, so die beiden theoretischen Visionäre, lernten künftige Ärzte die Theorien für den Aufbau des menschlichen Körpers und die komplizierten Mechanismen in seinem Inneren, ehe sie in den klinischen Semestern mit kranken Menschen in Berührung kämen. „In diesen Semestern lernen sie dann die Praxis, d.h. die Regeln, nach denen man die in der Vorklinik erworbenen Theorien in Diagnostik und Therapie umsetzt. Medizinstudenten und Ärzte haben daher Schwierigkeiten zu sehen, in welchem Ausmaß die Praxis, die sie erlernen und ausüben, von Theorien durchtränkt ist. Sie glauben, die Realität der Krankheiten habe die Theorien der Medizin geschaffen und sehen nicht, wie weit die Theorien fremder Fächer die Realität der Krankheiten bestimmen, welche die Medizin diagnostiziert und behandelt.“69 68 69 Uexküll/Wesiack (1991), S. 3. Ebd. 32 Die beiden Herausgeber Thure von Uexküll und Wolfgang Wesick beginnen denn auch das bis heute führende Lehrbuch der Psychosomatik mit dem treffenden Satz: „Medizinische Lehrbücher verzichten für gewöhnlich auf eine theoretische Einführung. Sie kommen gleich zur ,Sache‘ “.70 Die „Sache der Medizin“ im Sinne der psychosomatischen Lehre ist – ganz im Gegensatz zu den mechanistischen Vorstellungen der traditionellen Medizin – ein integriertes Medizinmodell. Die psychosomatische Lehre bedeutet daher im Kuhn‘schen Sinne einen grundlegenden Paradigmawechsel hin zu einem biopsycho-sozialen Medizinmodell. Dieses ist u.a. charakterisiert durch eine Reihe von Grundannahmen. Grundannahmen Beschreibung Im Sinne des sogenannten Situationskreises, eines Offensein Modells der systematischen Integration von Wechselbeziehungen des Individuums zu seiner Umgebung. Eine Ursache zeigt nicht immer die gleiche Folge, Indeterminiertheit sondern wird durch den Zustand des komplexen Organismus und seine Programme mitbestimmt. Emergenz Das Auftreten neuer Eigenschaften beim Zusammenschluss von Subsystemen zu Suprasystemen. Lebende Systeme neigen immer dazu, sich zu immer Selbstorganisationstendenz Einbau der Lebensgeschichte komplexeren Strukturen zu organisieren. Die psychische und soziale Anamnese ist wesentlicher Bestandteil. Tabelle 1: Grundannahmen des bio-psycho-sozialen Modells. Nicht zuletzt setzt das bio-psycho-soziale Modell die Beteiligung des Arztes voraus, der in den oben genannten Situationskreis eingeschlossen ist. Wenn überhaupt, orientiert sich dieses integrative Medizinmodell eher an den Erkenntnissen der Quantentheorie als an denen der Mechanik und statischen Thermodynamik und hat damit die starren Deutungsmuster des Positivismus längst hinter sich gelassen. 70 Uexküll/Wesiack (2011), S. 3. 33 Um die Psychosomatik und ihr integriertes Medizinmodell in der hier gebotenen Kürze zu beschreiben, gehe ich im Folgenden lediglich skizzenhaft auf ihren Gegenstand, ihre Methode sowie ihre Verbreitung und Lehre ein. Ich beziehe mich dabei vor allem auf die Psychosomatiker Karl Köhle und Peter Joraschky. Dann folgt die in diesem Zusammenhang wesentliche Frage der Institutionalisierung. Die Psychosomatik versteht sich nicht als neue Subdisziplin im Kanon der übrigen Fachgebiete und ihrer Ausdifferenzierungen wie Nephrologie, Kardiologie oder Neurochirurgie. Sie versteht sich eher als „spezifische Betrachtungsweise“, als eine psychosomatische Betrachtung oder Perspektive, die sich den übrigen klinischen Fächern als Ergänzung ihrer jeweiligen Arbeitsansätze anbietet. 71 Dieser systemische Ansatz der Psychosomatik erfordert ein ärztliches Verständnis für die Teilsysteme, seien sie biologisch, psychologisch oder sozial; er erfordert aber auch Verständnis für die Wechselwirkungen dieser Systeme. Um ihrem Gegenstand – dem ganzheitlichen Phänomen von Gesundheit wie Krankheit – gerecht zu werden, müsse die Psychosomatik, so Köhle und Joraschky, auch solche Grundlagenfächer in die Heilkunde integrieren, die in unserer traditionellen Sicht nur bedingt zur Medizin gehörten: Kommunikations- und Sozialwissenschaft, Psychologie und auch die Lehre von der Systemtheorie. In den vergangenen 30 Jahren hat die Psychosomatik Eingang gefunden in die ambulante wie die stationäre Versorgung, sie wird an den medizinischen Fakultäten gelehrt und sie hat den Status eines eigenen Facharztgebietes erlangt. In der Praxis des Niedergelassenen wie in der Klinik kommt besondere Bedeutung dem ärztlichen Gespräch, der Anamnese und der Interviewtechnik (auch der körperlichen Untersuchung) sowie den verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren zu, ob im Rahmen von Einzel-, Gruppen- oder Familientherapien. In der „psychosomatischen Betrachtungsweise“, so Köhle und Joraschky, könnten „Kranker und Krankheit nicht mehr unabhängig von den Interaktionsprozessen verstanden werden, die zwischen dem Kranken und seiner medizinischen Umwelt“ 72 abliefen. Die Einbeziehung der Wechselwirkungen zwischen Subjekt und Objekt verändere den Wissenschaftsbegriff. „Von der Art des Umgangs zwischen Arzt und Patient hängt es ab, was von der Krankheit in Erscheinung tritt. Mit dem Beginn ihrer Beziehung gehören Arzt und Patient jeweils der Umwelt des anderen Partners an.“73 71 Köhle/Joraschky (1990). Ebd., S. 418. 73 Ebd., S. 417. 72 34 Köhle und Joraschky folgern, dass nicht die „additive Einbeziehung psychologischer Gesichtspunkte in eine biologisch orientierte Medizin“ die „psychosomatische Betrachtungsweise“ ausmache, sondern die konsequente Pflege und Benutzung dieses Umgangs zwischen Arzt und Patient; diese Begegnung nehme zunächst vor allem im Gespräch selbst Gestalt an. Selbstverständlich kann es nicht das Ziel der Psychosomatik sein, dass die im Krankenhaus arbeitenden Ärzte solche ganzheitlichen Gespräche lediglich an andere Therapeuten, Psychosomatiker oder Psychotherapeuten delegieren. Uexküll bezieht deshalb alle Ärzte wie Pflegenden ausdrücklich ein, indem er schreibt: „Das Ziel muß sein, den Ärzten und dem Pflegepersonal des Krankenhauses die psycho-soziale Kompetenz zu vermitteln, die sie in die Lage versetzt, die Beziehungen zu ihren Patienten unter diagnostischen und therapeutischen Gesichtspunkten zu reflektieren und mit den von ihnen betreuten Patienten die Gespräche zu führen, die ein vertieftes Vertrauensverhältnis begründen.“ 74 Einige der organisatorischen Voraussetzungen sind aktueller, als gedacht. 75 „Dafür ist eine Änderung der Arbeitsorganisation unerlässlich, die den Ärzten und dem Pflegepersonal die für die Gespräche mit den Patienten und für die eigene Weiterbildung erforderliche Zeit zur Verfügung stelle. Ferner ist auch eine Umstellung des Pflegesystems von der sogenannten Funktionspflege auf die Zimmerpflege erforderlich, bei der jeweils eine Schwester für die Betreuung weniger Patienten zuständig ist.“76 Auch den psychosomatischen Vordenkern war klar, dass derartige Veränderungen Zeit und Überzeugung brauchen und nur „in kleinen Schritten“ erreicht werden können. Im Hinblick dieser Arbeit, die Etablierung der Ethikberatung, ist es daher aufschlussreich, welche der vier Schritte bzw. Modelle Thure von Uexküll und Wolfgang Wesiack Ende der 1980er Jahre für die Integration der Psychosomatik im Kontext des Krankenhauses vorschlugen: Sie unterscheiden eine volle Integration; Team-Integration; Integration im Rahmen eines Liaison-Dienstes und den Konsultationsdienst. Zum Abschluss dieses Kapitel und als Grundlage für die spätere Diskussion werden diese vier Modelle kurz beschrieben. 77 74 Uexküll/Wesiack (1991), S. 643. Interessant sind in diesem Zusammenhang Modelle der fallverantwortlichen Pflege oder des primary nursing, bei denen die Kontinuität und Intensität der Beziehung von verantwortlichen Pflegenden und Patienten ausdrücklich erhöht werden. Im Klinikum Nürnberg ist im Rahmen einer konzertierten Reorganisation („Struktur- und Prozessoffensive“) im Jahr 2010 ein vergleichbares System theoretisch erarbeitet worden, das nach entsprechender praktischer Vorbereitung seit 2011 in fünf Fachkliniken erprobt wird. 76 Uexküll/Wesick (1991), S. 643. 77 Uexküll/Wesiack (1991), S. 643. 75 35 Die volle Integration des psychosomatischen Konzepts einer patientenzentrierten Medizin beschreibe quasi den Idealzustand: Alle an der Behandlung der Patienten beteiligten Berufsgruppen – Ärzte, Pflegende, Physiotherapeuten, Sozialarbeiter u.a. – könnten die psychosomatische Lehre in ihre Alltagsarbeit integrieren und konkret praktizieren. Sie würden dafür psychosomatisch fort- und weitergebildet, und es stehe ihnen die erforderliche Zeit zur Verfügung. Die Arbeitsorganisation sei so weiterentwickelt, dass kontinuierlich ein umfassender Informationsaustausch zwischen den Beteiligten gewährleistet werde. Außerdem stelle das Krankenhaus den Mitarbeitern entsprechende Hilfesysteme bereit, die angesichts der intensiven Beziehungen zwischen Personal und Patienten und der damit einhergehenden Belastungen notwendig seien. Kurzum: Die volle Integration erscheint tatsächlich wie ein unerreichbarer Idealzustand. Aber auch der ist möglich. Die sogenannte Team-Integration, so Uexküll und Wesiack, bezeichne die Organisation einer stationären psychosomatischen Versorgung, bei der die Klinik oder Abteilung durch einen psychosomatisch oder psychotherapeutisch geschulten Oberarzt supervidiert werde. Wie im Modell der vollen Integration, müssten auch hier veränderte Abläufe die Notwendigkeiten einer patientenzentrierten Medizin und Pflege berücksichtigen. Eine intensive Fort- und Weiterbildung des Teams in fachlich-somatischer und psychosozialer Kompetenz sei zu gewährleisten. Im Modell des Liaison-Dienstes ist gerade letzterer Aspekt deutlich geringer ausgeprägt. Den beiden Vordenkern zufolge, nehme der psychosomatische oder psychotherapeutische Supervisor zwar regelmäßig an den Team- oder Stationsbesprechungen teil, er gäbe aber sein Wissen und seine Kompetenz nur eingeschränkt weiter. Er berate Patienten und konzentrierte sich einerseits auf die Beziehung zwischen Patienten und Team, andererseits auf die Beziehungsdynamik innerhalb des Teams. Er bemühe sich darum, ein Mitglied des Teams zu werden und kontinuierlich die dafür erforderliche Nähe aufzubauen. Sehr viel geringer sind Nähe und Integration beim Modell des sogenannten reinen Konsiliardienstes. Hier werden dem Konsiliarius entsprechende Patienten vorgestellt. Die Wirkung des Konsiliardienstes hängt daher in hohem Maße von der Kompetenz und dem Interesse der verantwortlichen Ärzte ab. Vor dem Hintergrund der hier vorgestellten Arbeit zur Ethikberatung zeigt sich, dass der Liaison-Dienst in gewisser Weise als Vorbild für die Ethikberatung bedenkenswert ist: inhaltlich wie pragmatisch. 36 2.6. Partizipative Entscheidungen In den ersten fünf Abschnitten dieser Einführung ist die Vorstellung einer partnerschaftlichen Beziehung und Entscheidungsfindung von Ärzten und Patienten immer wieder angeklungen. Im Sinne einer Fortsetzung der vorangegangenen Überlegungen zur Patientenautonomie, dem ärztlichen Rollenverständnis und einer integrativen Medizin geht es im letzten Bezugspunkt dieser Arbeit um das Prinzip partizipativer Entscheidungsfindungen und das daran anknüpfende Modell des „shared-decision-making.“ Auch hier setzt sich der Bezug auf Thure von Uexküll fort. Gemeinsam mit Wolfgang Wesiack schreibt er über die Konsequenzen ihrer Theorie der Humanmedizin für die Interaktion zwischen Kranken und Arzt: „Unsere Auffassung von Krankheit als Autonomieeinschränkung bzw. -verlust hat Konsequenzen für die Interaktion mit dem Patienten. In einer durch das Maschinenparadigma geprägten Medizin ist der Patient (naturwissenschaftliches) Objekt ärztlichen Handelns. Nach dem neuen Paradigma wird er zum Partner, dessen Autonomie respektiert und gestärkt werden muß. Das schließt natürlich nicht aus, daß der Körper des Kranken auch im Rahmen dieses Paradigmas vorübergehend, etwa während einer Operation, zum ,Objekt‘ wird, das verändert werden muß. In der Vorbereitungs- und Nachbehandlungszeit ist der Kranke aber wieder Patient und Partner.“ 78 Den beiden Autoren zu Folge gehörten zu einer Partnerschaft vor allem zwei Qualitäten: Wahrhaftigkeit und Respekt. Darüberhinaus müsse der Patient aufgeklärt werden: über die Krankheit, ihre Folgen und ihre Behandlung. Eine Forderung, die weniger durch rechtliche Erwägungen getrieben sei als vielmehr durch den Anspruch an die Bewahrung der Würde und Autonomie des Patienten und das partnerschaftliche Verhältnis beider. Seitdem die Pioniere der Psychosomatik ihre Theorie der Humanmedizin formuliert haben, ist über ein Vierteljahrhundert vergangen und die Ansprüche von Patienten an die Form von Entscheidungsfindungen in der Medizin sind weiter gestiegen. Mit dem Trend zu größerer Patientenautonomie, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung sind auch die Erwartungen vieler an eine transparente ArztPatienten-Beziehung gewachsen. Die Informationsmöglichkeiten im Internet und anderen Medien werden durch alle Generationen hindurch zunehmend genutzt, und viele Patienten nehmen das Gesundheitswesen auch als einen wirtschaftlichen Bereich war, in dem sie im eigenen Interesse bestmöglich informiert sein sollten. 78 Uexküll/Wesiack (1991), S. 612. 37 Um daher das hier – später auch für die Klinische Ethikberatung – propagierte Modell einer gemeinsamen Entscheidungsfindung besser einordnen zu können, folgt zunächst eine Darstellung anderer Modelle der Arzt-Patienten-Beziehung. Die amerikanischen Ethiker Ezekiel und Linda Emanuel haben 1992 vier bis heute gültige Modelle79 beschrieben, von denen jedes seine Berechtigung hat. 1. Das paternalistische Modell Der Arzt entscheidet mit Wissen und Erfahrung für den Patienten. Er informiert ihn eher selektiv, um ihn zur Zustimmung seines Vorgehens zu bewegen. Die Zustimmung ist oft eine Formsache. Das Verhalten des Arztes kann von Fürsorge geprägt sein. Vom Patienten wird Dankbarkeit erwartet.80 2. Das informative Modell Auch als wissenschaftliches oder Konsumenten-Modell bezeichnet. Der Patient entscheidet selbst, nachdem der Arzt ihm alle Informationen zur Verfügung gestellt und erklärt hat. Die Abwägung der Chancen und Risiken wird allein durch den Patienten geleistet und verantwortet. Der Arzt folgt dem, was der Patient entschieden hat. Er erfüllt eher die Rolle eines Technikers. 81 3. Das interpretative Modell Hier werden durch den Arzt die Vorstellungen und Werte des Patienten ermittelt, um diesen bei seiner Entscheidung beraten zu können. Im Gegensatz zum informativen Modell bleibt der Patient mit seinen Informationen nicht allein, bei den notwendigen Interpretationen wird ihm durch den Arzt geholfen. 4. Das deliberative (abwägende) Modell Auch hier sollen Vorstellungen und Werte des Patienten seine Entscheidungen leiten. Arzt und Patient beziehen dabei in einem gemeinsamen Prozess die objektiven und subjektiven Aspekte der Entscheidung mit ein. Damit geht es in diesem Modell um das gegenseitige Informieren, sowie ein gemeinsames Abwägen und Entscheiden. Das Modell entspricht im Grunde dem Modell des „shared-decision-making“.82 79 Emanuel/Emanuel (1992). Engel (1996). 81 Charles (1999). 82 Edwards (2001), Scheibler (2003), Scheibler (2004). 80 38 Wichtig erscheint mir an dieser Stelle der Hinweis, dass sich in Bezug auf diese Modelle gegenwärtig allenfalls Tendenzen aufzeigen lassen. Die Erwartungen von Patienten und Angehörigen an Ärzte und Pflegende bleiben selbstverständlich unterschiedlich. Nicht wenige der Patienten vertrauen sich lieber einer direktiven ärztlichen Führung an, als dass sie sich in der Rolle eines gleichberechtigten Gesprächspartners wohl fühlen und diese einnehmen könnten und wollten. Im Hinblick auf die spätere Einordnung und Bewertung der Ethikberatung ist es aufschlussreich, sich die einzelnen Prozessschritte der partizipativen Entscheidungsfindung zu vergegenwärtigen. Die folgenden Schritte wurden im Rahmen eines Förderschwerpunktes „Der Patient als Partner im medizinischen Entscheidungsprozess“ entwickelt, den das Bundesministerium für Gesundheit im Jahr 2001 eingerichtet hatte. 83 Der Prozess der Entscheidungsfindung umfasst insbesondere die in der folgenden Tabelle dargestellten Schritte:84 1 Übereinkunft zwischen Arzt und Patient über das Anstehen einer Entscheidung 2 Angebot seitens des Arztes, die Entscheidung zu den Optionen gleichberechtigt zu entwickeln 3 Aufzeigen verschiedener gleichwertiger, möglichst evidenzbasierter Behandlungsoptionen durch den Arzt 4 Gegenseitige Information und Diskussion der Optionen, Evidenzen, Alternativen sowie deren Vor- und Nachteile 5 Rückmelden über das Verständnis der Optionen bzw. das Erfragen weiterer Optionen aus der Sicht des Patienten 6 Ermitteln der Präferenzen von Patient und Arzt 7 Aushandeln der Entscheidungsmöglichkeiten 8 Gemeinsame Entscheidung oder einseitiges Entscheiden des Patienten, auch gegen den Willen des Arztes 9 ggf. das Erstellen und Verabreden eines Plans zur Umsetzung Tabelle 2: Schritte der Entscheidungsfindung 83 An diesem Projekt nahm auch das Institut für Präventive Medizin an der Universität Erlangen Nürnberg mit Sitz am Klinikum Nürnberg teil. Im Rahmen seiner Tätigkeit für das Institut hat der Verfasser dieser Arbeit im Jahr 2001 den Förderantrag zum Thema „Hypertonie und Shared Decision Making“ formuliert. Das Projekt wurde für zwei Jahre bewilligt und später verlängert. 84 Siehe auch: www.patient-als-partner.de. 39 Eine Reihe von Gründen spricht für eine konsequente Anwendung und Verbreitung des Prinzips partizipativer Entscheidungsfindung und der dafür erforderlichen Handlungsschritte. Einige von ihnen seien hier kurz genannt: Viele Patienten nutzen heute die vielfältigen Möglichkeiten des Internets und sollten Gelegenheit haben, die dort gefundenen Informationen offen in den Entscheidungsprozess einbringen zu können. Nur so können die mit der eigenen Beschaffung von Information verbundenen Erwartungen, Ängste und Wünsche in die Entscheidung und die folgende Behandlung sinnvoll eingebunden werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich die entstehenden Gefühle in Bezug auf die Erkrankung negativ auf die innere Haltung gegenüber einer getroffenen Entscheidung zu Diagnostik oder Therapie auswirken. Die Forschung zur „Compliance“ als Befolgung ärztlicher Therapieanweisungen oder „Concordance“ als Konsens zwischen Arzt und Patient hinsichtlich der Therapie zeigt eindrucksvoll, welche Auswirkungen gelungene Entscheidungsfindungen auf die Behandlungsqualität und den Therapieerfolg haben können. Zudem sei darauf hingewiesen, dass ein hoher Informationsstand des Patienten und seine Beteiligung an der Entscheidung dazu beitragen können, auf Seiten der Ärzte möglichen Prägungen von Entscheidungen durch persönliche Präferenzen und Wertmaßstäbe entgegenzuwirken – zumal bei vielen Entscheidungen in der Medizin keine eindeutigen evidenzbasierten „Königswege“ definiert sind und es nicht selten um eine Abwägung im besten Sinne des Patienten geht. Was die genannten Unterschiede der Vorstellungen und Erwartungen von Patienten und Angehörigen betrifft, so zeichnet sich seit etwa 20 Jahren ein zunehmender Wandel in den Einstellungen ab. Viele der im Folgenden genannten Forschungsergebnisse haben die Gesundheitswissenschaftler David Klemperer und Melanie Rosenwirth im Auftrag der Bertelsmann Stiftung im sogenanten Gesundheitsmonitor zusammengestellt. 85 Während früher die Mehrheit der Patienten keine aktive Beteiligung im Behandlungsprozess wünschten, möchten heute viele an den Entscheidungen beteiligt werden. Die empirische Forschung belegt dies nicht nur in Deutschland: 85 Der Gesundheitsmonitor der Bertelsmann Stiftung liefert seit 2001 Erfahrungen mit der ambulanten Versorgung in Deutschland aus der Perspektive von Versicherten und Ärzten. Die Befragung der Versicherten erfolgt zweimal jährlich. Die Grundgesamtheit ist die deutschsprachige Bevölkerung in Deutschland im Alter von 18 bis 79 Jahren. Die Nettostichprobe jeder Befragung umfasst mindestens 1.500 Personen. 40 So gaben im Jahr 2004 in zwei größeren Befragungen mit über 8.000 Befragten in acht europäischen Ländern 23% der Befragten an, selbst über die Behandlung entscheiden zu wollen, 26% wollten lieber den Arzt entscheiden lassen und 51% wollten mit dem Arzt gemeinsam über die Behandlungsmethode entscheiden. 86 Zu ähnlichen Ergebnissen kam 2004 eine Erhebung des Gesundheitsmonitors, bei dem ca. 10.000 Bundesbürger zu ihrer Einstellung zu Entscheidungen in der Medizin befragt worden waren. Hier wollten 58% der Befragten eine gemeinsame Entscheidungsfindung, während nur 14% eine autonome Entscheidung und 28% eine alleinige Entscheidung des Arztes bevorzugen würden. 87 Und auch eine Befragung von 1.100 Patienten zur Patienteninformation in der Allgemeinmedizin kam zu dem Ergebnis, dass die überwiegende Mehrheit von 77% eine Teilhabe an Therapieentscheidungen wünschte. 88 Der Gesundheitsmonitor belegt, dass die Bereitschaft, an Entscheidungen zu Behandlungen mitzuwirken, erwartungsgemäß nicht nur alters-, sondern auch schicht- und bildungsabhängig ist. Unter den befragten Patienten stimmten mehrheitlich die Jüngeren sowie Versicherte mit höherer Schulbildung für eine gemeinsame Entscheidungsfindung. Es zeigte sich dagegen kein Unterschied zwischen Gesunden, akut leicht Erkrankten und chronisch Kranken. Mit jeweils 57% präferierten alle drei Gruppen eine gemeinsame Entscheidungsfindung. Gerade in Zusammenhang mit der hier untersuchten Ethikberatung sind eine Reihe von Befunden bemerkenswert: Da die von einer Ethikberatung betroffenen Patienten meist 65 Jahre oder älter sind, ist die altersbezogene Einstellung zur partnerschaftlichen Entscheidungsfindung wichtig. Hier zeigt der Gesundheitsmonitor, dass sich bei den über 65-Jährigen 41% der Befragten lieber auf die Entscheidung ihres Arztes verlassen – gegenüber 16% der 35 - 44-Jährigen. Ebenfalls bemerkenswert: Im Gesundheitsmonitor wurde in der Rubrik „Wünsche und Erwartungen der Patienten an die Arzt-Patienten-Beziehung“ den Erklärungen des Arztes am meisten Bedeutung beigemessen (99%). Die Aussage „Ich möchte, dass der Arzt das Problem gut erklärt“ hatten mit großem Abstand die meisten Befragten mit „stimme sehr stark zu“ bewertet. Im Rahmen dieser Arbeit wäre demnach zu prüfen, inwieweit das spezifische Setting des Nürnberger Ethikkreises diesem Wunsch nach fachlicher Erklärung nachkommt. 86 Coulter/Magee (2003). Böcken (2004). 88 Isfort (2004), PIA-Studie. Siehe auch www.emgs.de/en/meetings/pat2004/04pat28.shtml. 87 41 Neben der Einstellung von Patienten ist auch die Haltung von Ärzten gegenüber dem Konzept partizipativer Entscheidungen bzw. „shared-decision-making“ (SDM) relevant. 89 Zwei Studien aus den USA und Kanada zeigen, dass 81% der Befragten SDM als potenziell hilfreich zur Veränderung von Lebensstilen der Patienten einschätzen und 80% in Bezug auf das Management chronischer Erkrankungen. 90% der Befragten vermuten, SDM könne potentiell die Einnahme von verordneten Medikamenten verbessern helfen. Entgegen diesen positiven Einschätzungen gibt es aber auch eine deutliche Skepsis in Bezug auf die tatsächliche Wirkung von SDM sowie die zahlreichen Barrieren, die viele Ärzte vom Praktizieren partizipativer Entscheidungen offensichtlich abhalten, allen voran die mangelnde Zeit und finanzielle Honorierung. Eine deutsche Publikation aus dem Jahr 2007,90 die sich auf zehn internationale Übersichtsarbeiten mit insgesamt 256 randomisiert kontrollierten Studien bezieht, bestätigt die positiven Effekte einer stärkeren Involvierung von Patienten, da diese für die Patienten u.a. bewirkten: – eine Zunahme des Wissens – eine realistischere Erwartung des Behandlungsverlaufs – eine aktivere Beteiligung am medizinischen Behandlungsprozess – eine Verringerung von Entscheidungskonflikten und Unentschlossenheit In der Übersichtsarbeit wurden drei verschiedene Partizipationsstrategien unterschieden, die alle der Stärkung einer partnerschaftlichen Entscheidungsfindung dienen sollen. Die Maßnahmen fokussieren nicht nur auf die beteiligten Patienten, sondern auch auf die betroffenen Ärzte: – Fort- und Weiterbildungen zur Förderung der Kommunikationsfähigkeiten von Medizinstudierenden und Ärzten – Medizinische Entscheidungshilfen – sogenannte „Decision Aids“ – als gedruckte oder audiovisuelle Materialien für eine umfassende Information der Patienten vor dem eigentlichen Arzt-Patienten-Gespräch – Patienten- und Multiplikatoren-Schulungen zur Förderung der Gesprächs- und Handlungskompetenz von Patienten und Angehörigen 89 90 Vgl. auch Michel/Moss (2005) und Mendick et al. (2010). Loh et al. (2007). 42 Es liegt nahe, dass für die Förderung einer gemeins amen und gleichberechtigten Entscheidungsfindung unterstützende Maßnahmen sowohl auf der Seite der Patienten wie auch der Ärzte hilfreich sind. Eines dieser Instrumente ist das sogenannte OPTION-Instrument zur Messung der Arzt-Patienten-Kommunikation. Der Name „observing patient involvement“ verweist auf die Tatsache, dass in vielen medizinischen Entscheidungssituationen mehrere Optionen bestehen, wobei eine der Möglichkeiten auch das beobachtende Abwarten sein kann. „Das OPTION-Instrument beschreibt die einzelnen Schritte und ärztlichen Kompetenzen, die zur Beteiligung des Patienten am Entscheidungsfindungsprozess erforderlich sind. Das Instrument misst die Fähigkeit des Arztes, dem Patienten das medizinische Problem und die Behandlungsoptionen zu erklären, sein Verständnis zu überprüfen, in Abwägungsprozessen seine subjektive Sicht einzubeziehen, sich seiner persönlichen Präferenzen zu vergegenwärtigen und ihn in dem Ausmaß an der Entscheidung zu beteiligen, wie er es wünscht.“ 91 Aus der Sicht der Patienten haben Auswertungen des OPTION-Instrumentes gezeigt, dass 88% der deutschen Patienten angeben, „ihr Arzt könne ihnen medizinische Sachverhalte verständlich erklären“. Ebenfalls interessant ist der Befund, dass aber nur jeder zweite Patient vom Arzt zu den persönlichen Vorstellungen zum bestehenden Gesundheitsproblem gefragt und nur jeder dritte Patient ausdrücklich zu eigenen Fragen aufgefordert wurden. Aus der Sicht der Ärzte finden partnerschaftliche Entscheidungen zwar generell Zustimmung, im Alltag empfinden viele Ärzte aber einen Mangel an eigenen kommunikativen Fertigkeiten und an ausreichender Zeit, um Patienten angemessen in eine komplexe Entscheidung einbeziehen zu können. Kommunikative Kompetenzen, so Klemperer und Rosenwirth, sind notwendig. Sie allein reichten aber längst nicht aus. Partizipative Entscheidungsfindungen erforderten letztlich eine „Bereitschaft des Arztes, dem Patienten partnerschaftlich, zugewandt, akzeptierend und empathisch gegenüberzutreten“. Im Hinblick auf die Analyse der Ethikberatungen stellt sich daher die Frage, welche der hier genannten Aspekte partizipativer Entscheidungsfindung für Entscheidungsprozesse im Bereich der Ethikberatung hilfreich sein können – wohl wissend, dass es sich gerade dort um eine oftmals ältere Patientenklientel handelt, in deren Betreuung allerdings häufig die Generation der Kinder oder Enkel involviert ist. 91 Klemperer/Rosenwirth (2005), S. 18. Mit Jan Böcken (Bertelsmannstiftung) und Bernard Braun (Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen) geben die Autoren das Chartbook „Shared Decision Making“ heraus. 43 2.7. Zusammenfassung des Kapitels Mit dem einführenden Kapitel und seinen sechs Bezugspunkten ist die Grundlage der Arbeit definiert. Ich stellte damit die mir wichtigen historischen und medizintheoretischen Bezüge her, von denen aus ich die Entwicklung der Klinischen Ethikberatung sowie die Evaluation des „Ethikkreises“ in der Medizinischen Klinik 4 beschreibe und bewerte. Die Einführung verfolgt das Ziel, diese Bezugspunkte transparent und damit nachvollziehbar zu machen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Nürnberger Ärzteprozess zu und den von Ärzten verübten Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie stellen einen unvergleichlichen Tiefpunkt in der Geschichte der deutschen Medizin dar und sind einzuordnen in eine Entwicklung der Medizin im 19. Jahrhundert, in der sich diese immer stärker als Naturwissenschaft verstand und ein teilweise unkontrolliertes Experimentierfeld wurde. Dies, so Viktor von Weizsäcker, habe eine „moralische Anästhesie“ und eine Denkweise begünstigt, welche den Menschen betrachte wie ein „chemisches Molekül oder einen Frosch oder ein Versuchskaninchen“. 92 Mit dem Urteil im Ärzteprozess verlautbarten die Richter den Nürnberger Kodex zur Forschung am Menschen, der trotz seiner verzögerten Rezeption einen wichtigen Meilenstein auch auf dem Weg zur Patientenautonomie als Paradigma der modernen Medizinethik markiert. Das Prinzip der informierten Zustimmung („informed consent“) unterstreicht einen wesentlichen Aspekt jedweder ArztPatienten-Beziehung und erlangt damit auch Bedeutung für die Alltagsmedizin. Vor diesem Hintergrund hat sich die Patientenautonomie als Abwehr- und Anspruchsrecht entwickelt und wird hier als situationsbezogene Handlungsautonomie und Autonomie als moralisches Recht beschrieben. Das Modell einer „relationalen Autonomie“ betont die gegenseitige Verwiesenheit von Arzt und Patient, die Fragilität der Autonomie und die Notwendigkeit ihrer Förderung. So verstanden, stehen Fürsorge und Autonomie gleichwertig nebeneinander. In diesem Sinne hat sich die Arzt-Patient-Beziehung historisch gewandelt und die ärztlichen Rollen des Experten, Pädagogen, Samariters oder Partners hervorgebracht. Letzterer passt zum Verständnis einer integrativen Medizin wie der Psychosomatik mit ihrem bio-psycho-sozialen Modell. Abschließend bleibt festzustellen: Im Liasiondienst von Psychosomatik und Klinischer Ethikberatung zeigen sich nicht nur theoretische Bezüge, sondern auch organisatorische Parallelen. 92 Weizsäcker (1947)., S. 134. 44 3. Entwicklung, Modelle und Kontext Klinischer Ethikberatung 3.1.Internationale Entwicklung Nicht nur die Ökonomie, auch die Ethik beginnt bisweilen mit dem Mangel. Denn ein Mangel kann schwierigste oder gar dramatische Entscheidungen bedeuten, die beide Disziplinen in ihrer theoretischen und praktischen Relevanz herausfordern. Ökonomie und Ethik kommen sich dabei bisweilen sehr nah und ergänzen sich, wenn sich Verteilungsszenarien zu quasi „ökonom-ethischen“ Problemen – wie in der modernen Transplantationsmedizin – dramatisch verschränken und verdichten: Wer bekommt die sechs Organe des Hirntoten – einer oder sechs Patienten? Die Geschichte der Klinischen Ethikberatung beginnt tatsächlich dramatisch, aber weniger als theoretischer Diskurs einer wissenschaftlichen Publikation, sondern vielmehr als praktische Diskussion über Leben und Tod im Auftrag eines Krankenhauses. Sieben „Auserwählte“, die aber lieber unerkannt und anonym bleiben wollten, mussten Anfang der 1960er Jahre im amerikanischen Seattle immer wieder darüber entscheiden, welche Patienten mit Nierenversagen in den seltenen „Genuss“ einer Nierenersatztherapie kommen sollten – und damit mit großer Chance überlebten – und wer nicht. 93 Bei einem Faktor von etwa 1 zu 100 bedeutete der Platz auf der Warteliste der Dialyse für viele Nierenkranke nichts anderes als den baldigen Tod. Insofern ist nachvollziehbar, dass die sieben Mitglieder des offiziellen „Kidney Dialysis Selection Committee“, besser bekannt als „Life and Death Commitee“, in Seattle keinen Wert darauf legten, namentlich erwähnt zu werden und öffentlich entscheiden zu müssen. Dennoch erlangte die kleine Gruppe (ein Chirurg, ein Pfarrer und fünf Bürger, darunter nur eine Frau) als „God Commitee“ in der amerikanischen Öffentlichkeit schon bald eine zweifelhafte Berühmtheit. 94 Auch wenn das Seattle-Komitee nicht mit der heutigen Klinischen Ethikberatung vergleichbar ist: Die hier bereits anklingenden organisatorischen Fragen der Besetzung, Transparenz und Entscheidungsbefugnis von Ethikkomitees und ähnlichen Beratungsgremien werden bis heute auch in der Debatte um Methoden und Modelle der Klinischen Ethikberatung kontrovers diskutiert. Die Frage der Verteilungsgerechtigkeit spielt dabei bislang eine weniger wichtige Rolle.95 93 Frewer (2008). Alexander (1962). 95 Vgl. auch Sass (1989). 94 45 Gerade in den 60er und 70er Jahren warfen die rasanten Fortschritte der Medizin immer schwierigere ethische Fragen auf, ob am Anfang oder am Ende des Lebens. Die Intensiv- und „Apparatemedizin“, die Organtransplantation und auch die Reproduktionsmedizin stellten die Ärzte und letztlich die Gesellschaft vor neue ethische Herausforderungen: Sollte das, was technisch möglich war, auch gut sein? Oft entstand der Eindruck, die Gesellschaft könne mit ihren Versuchen einer ethisch-moralischen Bewertung den technologischen Möglichkeiten der Medizin nurmehr hinterherlaufen. Nicht zuletzt an der Hirntod-Diagnostik scheiden sich bis heute die Geister. Obwohl die medizinischen Kriterien zur Feststellung des Hirntodes seit langem bekannt, überprüft und als weitgehend unstrittig definiert sind, entstehen in der Bevölkerung immer wieder Zweifel und Unsicherheiten gegenüber dem Konzept des Hirntodes. 96 Im Zusammenhang mit den rasant fortschreitenden Möglichkeiten der Organverpflanzung war es 1968 das „Ad-hocCommittee to Examine the Definition of Brain Death“ an der Harvard Medical School in Boston, das erstmals verbindliche Kriterien für den Hirntod festlegte und damit eine Grundlage für die Entnahme von Organen definierte, die weltweit eine anhaltend kontroverse Diskussion entfachte. 97 In doppelter Hinsicht unterscheiden sich das eingangs erwähnte „Kidney Dialysis Selection“-Gremium und das hier genannte Harvard-Komitee. Das Gremium in Seattle war multiprofessionell und nicht überwiegend von Ärzten besetzt und es hatte über individuelle Patienten in einer konkreten Mangelsituation zu entscheiden. Das Bostoner Gremium hingegen war ausschließlich von Fachleuten besetzt und diente eher der Entwicklung von Grundlagen und Richtlinien für die Entscheidungen anderer. Gemeinsam ist beiden Gremien allerdings, dass sie für die Etablierung der Klinischen Ethikkomitees und der Klinischen Ethikberatung eine besondere Rolle spielten. Da an dieser Stelle die geschichtliche Entwicklung der Ethikberatung von Interesse ist, seien einige ihrer Etappen kurz skizziert. Ich beziehe mich dabei insbesondere auf den bereits zitierten Aufsatz des Medizinethikers Andreas Frewer. Dort zeigt er, dass zunächst unterschiedliche politische und weltanschauliche Hintergründe dazu führten, Gremien zur Reflektion schwieriger Entscheidungen im Kontext der Medizin bzw. in der Klinik zu etablieren. 96 97 Müller (2010). Ad-hoc-Committee of the Harvard Medical School on Brain Death (1968), Beecher (1968). 46 So bildeten sich während der amerikanischen Eugenikbewegung in den 1920er Jahren mit dem „Sexual Sterilization Act“ sogenannte „Eugenic Boards“, die dafür genutzt wurden, die Unfruchtbarmachung nicht-einwilligungsfähiger Patienten in Kliniken zu legitimieren. 98 Etwa zeitgleich entstanden an katholischen Krankenhäusern „Catholic Medico-Moral Committees“, die zwar klinische Bedeutung hatten, aber eher zur Durchsetzung bestimmter Werthaltungen dienten. 99 In der ersten Hälfte der 1970er Jahre war es erneut die Stadt Boston, in der sich erstmals Ethikkomitees gründeten, die den heutigen Gremien der Klinischen Ethikberatung vergleichbar sind und bei denen die Unterstützung und Begleitung klinischer Teams in schwierigen Entscheidungssituationen im Mittelpunkt stand. Am Boston Massachusetts Hospital entstand das erste dauerhaft verankerte Ethikkomitee, das „Optimum Care Committee“, welches interdisziplinär und multiprofessionell besetzt war und zwischen 1974 und 1986 über 70 Fälle begleitete – meist zu Entscheidungen am Lebensende – und diese auch schriftlich dokumentierte. 100 Die Reichweite der Verantwortung dieses Komitees für die endgültige Entscheidungsfindung war damals höchst umstritten; ein Aspekt, der bis heute in der wissenschaftlichen Begleitung der Klinischen Ethikberatung kontrovers diskutiert wird. Damals gelang es erstmals, die individuelle ärztliche Entscheidung auf eine breitere Basis zu stellen und um nicht-ärztliche Perspektiven zu bereichern. Die Frage der Besetzung und Entscheidungskompetenz eines solchen Komitees wurde auch in den Folgejahren kontrovers diskutiert, nicht zuletzt ausgelöst durch den Fall von Karen Ann Quinlan, die 1975 als 21jährige Frau nach einem Alkoholexzess bei stabilem Kreislauf in ein sogenanntes Wachkoma fiel und durch den Konflikt zwischen Ärzten und Angehörigen um die Frage der Beendigung ihrer Therapie weltweit für Aufsehen sorgte. 101 Der Fall ging vor Gericht, und die beteiligten Richter regten die Einrichtung eines klinischen Entscheidungsgremiums an, das nicht nur mit Ärzten, sondern auch mit Sozialarbeitern, Juristen und Seelsorgern besetzt sein sollte, worüber eine kontroverse Debatte entstand. Befürwortet wurde eine interprofessionelle Besetzung auch von den beteiligten Ärzten. Entschieden wurde allerdings anders. 98 Grekul (2004). Levine (1984). 100 Brennan (1988). 101 Colen (1976). 99 47 Gerade diesem Aspekt folgten die Richter nicht. Sie forderten schließlich ein Komitee, das ausschließlich ärztlich besetzt sein sollte, um nicht nur beraten, sondern auch entscheiden zu können. In der Folge entstanden in den 1970er Jahren in vielen Kliniken der USA zunächst die „Health Care Ethics Committees“ (HEC), bis es Anfang der 1990er Jahre im Rahmen von Klinikzertifizierungen fast flächendeckend zur Einführung Klinischer Ethikberatung an amerikanischen Krankenhäusern kam. Zwei wichtige Fragen, die im Verlauf dieser Zeit nie abschliessend erörtert wurden, galten der Zusammensetzung dieser Gremien und ihrer Entscheidungsbefugnisse: „For experts only?“ 102 und „Who decides?“.103 Auch in Europa entstanden seit den 1980er Jahren Klinische Ethikdienste in Krankenhäusern, ob als Ethik-Komitee oder als Ethikberatung. Sie widmeten sich ähnlichen Aufgaben – Fallberatung, Leitlinien und Fortbildung – und waren mit vergleichbaren Diskussionen konfrontiert, wie ihre Vorläufer in den USA.104 In Japan wird ab 2006 über erste Gremien berichtet. 105 Dagegen begann in der Schweiz das erste Clinical Ethics Committee (CEC) im Jahr 1988, die meisten Ethik-Komitees gründeten sich aber erst nach dem Jahr 2000. Gerade in der kulturell sehr heterogenen Schweiz sind diese Gremien regional sehr unterschiedlich ausgerichtet, werden aber insgesamt von der Schweizer Akademie der Medizinischen Wissenschaften unterstützt und gefördert. 106 In Großbritannien waren Klinische Ethikkomittees vor Mitte der 1990er Jahre weitgehend unbekannt, zeigen dann aber eine kontinuierliche Verbreitung, so dass im Jahr 2000 ca. 5% aller Krankenhäuser und im Jahr 2004 bereits 19% aller Kliniken über ein solches Gremium verfügen. Auch hier ist eine Bewegung erkennbar, die eher dem Prinzip des „bottom-up“ entspricht, wo einzelne engagierte Kliniker daran mitwirken, multidisziplinäre Gremien ins Leben zu rufen. Diese Gremien sind in Großbritannien oft mit Laien besetzt, von denen in unterschiedlichem Ausmaß eine Fortbildung in ethischen Fragen verlangt wird. Seit dem Jahr 2000 werden die Verbreitung und Förderung dieser Institutionen durch ein eigens zuständiges Netzwerk unterstützt, das UK Clinical Ethics Network. 107 102 Agich/Youngner (1991). Lo (1987). 104 Pellegrino (1988), Pantilat (1999), Hurst (2005), (2007), Meulenbergs (2005). 105 Nagao (2005), Fukuyama (2008). 106 Salathe (2003). 107 Slowther (2001), (2004). 103 48 Ebenfalls Mitte der 1990er Jahre starten erste Clinical Ethics Committees in Norwegen, wo im Jahr 2003 offiziell empfohlen wird, dass alle Health Care Trusts – die Träger öffentlicher Krankenhäuser – bis 2004 ein solches CEC für Krankenhäuser eingerichtet haben sollten. 108 Auch für Italien wird von den ersten Ethik-Gremien ab Ende der 1990er Jahre berichtet. Sie beginnen zunächst ehrenamtlich und sind regional unterschiedlich stark verortet. Im Veneto beispielsweise verfügt seit 2004 jede lokale Gesundheitseinrichtung über ein Ethik-Gremium, das zur Hälfte von Ärzten besetzt ist, Leitlinienarbeit und Fortbildungen leistet und auch in dringenden Fällen eine akute Fallberatung anbietet.109 3.2. Entwicklung in Deutschland In Deutschland ist der wichtigste Impuls zur Bildung Klinischer Ethikkomitees der im Jahr 1997 veröffentlichte Bericht „Ethik-Komitee im Krankenhaus“ der beiden großen konfessionellen Krankenhausverbände: dem „Deutschen Evangelischen Krankenhausverband“ und dem „Katholischen Krankenhausverband Deutschland“. Beide empfehlen die Gründung multiprofessioneller Komitees mit Mitarbeitern aus ärztlichem Dienst, Pflegedienst, Sozialdienst, Verwaltung, Seelsorge und Personen von außerhalb des Krankenhauses wie Juristen oder aufgeschlossenen Bürgern. Damit folgen die beiden Krankenhausverbände in ihren Grundvorstellungen der internationalen Entwicklung und befürworten eine interdisziplinäre und multiprofessionelle Besetzung der Beratung. Im Text heißt es dazu: „Die von Erfahrung und Berufspraxis geprägten Ärzte und Pflegenden können ihre Standpunkte und berufsethischen Überzeugungen in den Diskurs um die Richtigkeit dieser oder jener ethischen Entscheidung aktiv in den Entscheidungsfindungsprozess einbringen, ohne ‚ideologische Zensur’ ihrer Weltanschauung befürchten zu müssen. Im Spiegel der Standpunkte anderer Teilnehmer lernen sie ihren eigenen Standpunkt besser verstehen und artikulieren. Ethik wird dabei weniger als Wissen um früher entstandene Normen und Werte erfahren, denn als Normfindungsprozess im konkreten Berufs- und Alltagsleben. Der Respekt vor dem anderen und die prinzipielle Gleichheit der an ethischen Diskursen beteiligten Personen wird praktisch eingeübt, in einer Situation, in der es auch Hierarchie und Machtverhältnisse gibt.“110 108 Pedersen/Foerde (2005), Foerde et al (2008), Pedersen et al. (2008). Wray (2000), Hurst (2007). 110 DEKV/KKVD (1997). 109 49 Der Bericht beschreibt die Implementierung bzw. auch Arbeits- und Funktionsweisen Klinischer Ethikkomitees und Klinischer Ethikberatung und stellt zur Entscheidungsfindung und insbesondere der damit verbundenen wichtigen Rolle der Moderation fest: „Des weiteren fällt dem Moderator zu, die vorgebrachten Argumente und Argumentationsketten auf ihre Kohärenz und Widerspruchsfreiheit hin zu überprüfen. In diesem Zusammenhang wird er unausgesprochene Prämissen oder uneingestandene Überzeugungen verdeutlichen. Er wird weitere Betroffene zum Gespräch dazuladen, damit alle möglichen Standpunkte zur Sprache kommen. In diesem Forum der Entscheidungsfindung wird er dem Entscheidungsträger bei der Formulierung seiner Entscheidungen behilflich sein. Er wird selbst jedoch keine Entscheidung treffen, auch nicht indem er vorschnell abstimmen lässt. Das abgegebene Votum eines ,klinischen EthikKomitees‘ versteht sich als eine Argumentationshilfe für die Entscheidungsträger. Es macht das Gewicht der verschiedenen Argumente durchsichtig, die in eine ethische Diskussion eingebracht worden sind, und weist auf deren Konsequenzen hin. Ob und inwieweit die Entscheidungsträger sich das Votum zueigen machen oder es aufgrund ihres Standpunktes und ihrer persönlichen Überzeugungen ablehnen, um zu einer anderen Entscheidung zu kommen, bleibt in ihrer Verantwortung.“ 111 Damit liegt die letzte Entscheidung über die weitere Behandlung des Patienten unmissverständlich beim verantwortlichen Arzt. Aufgabe des Ethik-Gremiums bzw. seiner Moderation ist es, im reflektierenden Diskurs gemeinsame tragfähige Entscheidungen herbeizuführen. Die Initiative der beiden Krankenhausverbände zeigte Wirkung, und in der Folge entstanden erste Klinische Ethikkomitees in Deutschland, einige auch jenseits konfessioneller Häuser. Zu diesem Zeitpunkt, 1997, nahm auch der hier untersuchte Ethikkreis der Medizinischen Klinik 4 am Klinikum Nürnberg seine Arbeit auf. Er zählt damit zu den ersten und ältesten Institutionen Klinischer Ethikberatung in Deutschland. Drei Jahre später, im Jahr 2000, fand eine erste bundesweite Umfrage zur Einrichtung Klinischer Ethikkomitees statt, an der knapp 800 konfessionelle Krankenhäuser teilnahmen. Wie sich zeigte, gab es zum damaligen Zeitpunkt unter den befragten Häusern nicht mehr als 30 Krankenhäuser mit einem Klinischen Ethikkomitee oder einer anderen Form der Ethikberatung und nur siebzehn Krankenhäuser, die sich in der Gründungsphase eines solchen Gremiums befanden.112 111 112 DEKV/KKVD (1997), S. 11. Schaefer (2000), Simon (2001), Dörries (2007). 50 Eine Umfrage bei Ärztlichen Direktoren und Pflegedirektoren der 36 deutschen Universitätskliniken zeigte 2002, dass die Institution „Klinisches Ethikkomitee“ noch fast unbekannt war. Nur die beiden Universitätskliniken in Erlangen und Hannover hatten ein solches Gremium gegründet, fünf weitere Hochschulen befanden sich in Gründung. 113 Ein Jahr später ergab eine bundesweite explorative Telefonumfrage insgesamt 59 Krankenhäuser mit Klinischer Ethikberatung: 28 davon katholisch, 23 evangelisch und 8 in kommunaler Trägerschaft. 114 Die erste bundesweite Umfrage stammt aus dem Jahr 2005. Sie wandte sich an die Geschäftsführungen von 2.275 Krankenhäusern mit einem 23 Themen umfassenden Fragebogen zum Krankenhaus, seiner Ethikberatung und ihrer Implementierung. 235 Krankenhäuser bestätigten daraufhin die feste Einrichtung einer Klinischen Ethikberatung, 77 Klinken befanden sich im Aufbau einer solchen. Die Grafik zeigt Gründe für die Initiierung: die Klinikzertifizierung nach KTQ oder procumCert, konkrete ethische Konflikte oder andere.115 Grafik 1: Anlässe für die Einführung einer Ethikberatung 116 Demnach hatten auch 2005 erst ca. 10 – 15 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland eine Ethikberatung etabliert oder geplant, meist in größeren und konfessionellen Kliniken. Viele von ihnen hatten dabei ähnliche Widerstände erfahren: die Sorge um die ärztliche Entscheidungshoheit, Fragen zum Berufungsverfahren oder der allgemeine Zeitmangel. Bestätigt sah sich die Studienautorin und Medizinethikerin Andrea Dörries darin, dass die Einführung von Ethikberatung nur mit der Unterstützung der Geschäftsführung gelingen kann. 113 Vollmann (2004), Wernstedt (2005). Kettner/May (2002). 115 Bauer (2007) Die genannten Zertifizierungsverfahren verlangen explizit Ethikprojekte. 116 Dörries (2007). 114 51 3.3 Modelle und Methoden Klinischer Ethikberatung 3.3.1. Beratungsmodelle Da sich seit Ende der 1990er Jahre in Deutschland eine Vielfalt von Formen Klinischer Ethikberatung entwickelt hat, werden hier zur späteren Einordnung der Aktivitäten am Klinikum Nürnberg in Anlehnung an den Medizinethiker Gerald Neitzke die wichtigsten Modelle kurz dargestellt.117 Ausgangspunkt der hier beschriebenen Modelle ist ein etabliertes Ethik-Komitee, das entweder selbst in die Beratungen involviert ist oder mit diesen ihre eigenen Mitglieder oder andere Personen bzw. Funktionen beauftragt. Expertenmodell Ethik-Komitee berät separat und „unter sich“. Delegationsmodell Ethik-Komitee berät sich mit der anfragenden Person. Prozessmodelle Gesamtes Ethik-Komitee berät auf der Station. Ethik-Komitee entsendet Berater auf die Station. Ethik-Fallbesprechung durch geschulte Moderatoren. Ethik-Konsil durch Einzelpersonen. Offene Modelle Dezentrale Arbeitsgruppen (z.B. Ethik-Cafe, Ethik-AK). Fallbezogene Stationsrunden. Mischformen. Tabelle 3: Modelle von Ethikberatungen (in Anlehnung an Neitzke 2008) Im Expertenmodell gibt die ratsuchende Person, Gruppe oder Organisationseinheit den Fall zur Lösung an den Expertenkreis ab. Den Mitgliedern des Ethik-Komitees wird der Fall gemeldet, notwendige Unterlagen werden zusammengestellt, das Ethik-Komitee tagt für sich und sucht nach einer wohl begründeten Lösung, die als Entscheidung bzw. Rat festgehalten und mitgeteilt wird. Vorteil dieses Modells kann die Akzeptanz sein, die das Gremium und seine Urteile erfahren – sofern seine Mitglieder fachlich anerkannt und geschätzt sind. Zudem kann das Modell dem Wunsch entsprechen, in schwierigen Fällen die zeitintensive Entscheidungsfindung auf der Station zu entlasten. Als nachteilig wird dagegen empfunden, dass die Aktenlage allein selten ausreicht, um einen Fall in seinen meist komplexen Dimensionen darzustellen und nachvollziehbar zu machen. Außerdem, so Neitzke, verhindere das Expertenmodell, dass die „moralische Urteilsbildung und Konsensfindung“ der Beteiligten weiter eingeübt und entwickelt werde. 117 May (2004), Vollmann (2006), Kettner (2008), Neitzke (2005), (2008), Dörries (2010). 52 Beim Delegationsmodell übernimmt ebenfalls das Ethik-Komitee die Aufgabe der Problemlösung, allerdings stellt eine delegierte Person aus der anfragenden Gruppe, Station oder Klinik den entsprechenden Fall persönlich vor und nimmt an der Beratung und der Entscheidungsfindung stellvertretend für das gesamte Team teil. Diese delegierte Person kann zwar nicht die Perspektiven und Interessen aller im betreffenden Fall Beteiligten gleich gut vertreten, sie kann aber die Entscheidung bzw. Empfehlung des Gremiums gegenüber den Kollegen im Stationsteam oder der eigenen Organisationseinheit unmittelbar vermitteln und persönlich erläutern. Die Vorteile des Delegationsmodells werden auch im Organisatorischen gesehen. Die Erörterung kann – falls möglich und zeitlich passend – im Rahmen der üblichen Sitzungen stattfinden, und es müssen keine gesonderten Termine und Räumlichkeiten gefunden werden. Dies mag auf den ersten Blick marginal erscheinen, stellt aber im klinischen Alltag oft eine schwierige Hürde dar. Gerade während der Einführung der Ethikberatung, so Neitzke, werde das Delegationsmodell oft genutzt. Auch für die Erarbeitung von Leitlinien scheint es gut geeignet zu sein. Unter Prozessmodellen werden diverse Varianten beschrieben, von denen hier die „Fallberatung auf der Station“ und das „Konsilmodell“ näher erläutert werden. Der wesentliche Unterschied zu den anderen Modellen liegt darin, dass Analyse und Lösung des jeweiligen Falles dort erfolgen, wo er auftritt, nämlich vor Ort. Im Auftrag des Ethik-Komitees initiieren und begleiten in einer Fallberatung vor Ort mehrere seiner Mitglieder oder andere ethisch geschulte Experten gemeinsam mit den Beteiligten – Ärzten, Pflegenden, Patienten, Angehörigen oder auch juristischen Vertretern – einen Beratungsprozess, indem sie eine gemeinsame Reflexion des Konfliktes und eine Entscheidungsfindung anstreben. In diesem Fall wird das bereits beschriebe Prinzip des „shared decision making“, der gemeinsamen Entscheidungsfindung, am stärksten realisiert. Ein wesentlicher Vorteil dieser Fallberatung ist die Einübung von Reflexionskompetenz vor Ort. Alle Aspekte des Falls, so Gerald Neitzke, könnten unmittelbar berücksichtigt werden, auch unausgesprochene Probleme wüürden leichter sichtbar und nicht zuletzt der „Tribunal“-Charakter einer Fallbesprechung fernab der Station werde vermieden. Die Fallberatung auf der Station scheint am ehesten dazu geeignet zu sein, eine schwierige Entscheidung nicht nur gemeinsam herbeizuführen, sondern dann auch dauerhaft gemeinsam zu tragen. 53 Varianten der Fallbesprechung vor Ort sind insofern gegeben, als entweder das gesamte Ethik-Komitee (bei kleiner Anzahl) oder von ihm beauftragte Personen die Fallberatung anbieten. Im Nijmwegener Modell von Steinkamp und Gordijn 118 beauftragt das Ethik-Komitee damit speziell geschulte Moderatoren, die besonders flexibel und kurzfristig auf Anfragen reagieren können. Als weiteres Prozessmodell wird das Konsilmodell angeboten, in dem eine einzelne, ethisch besonders kompetente Person eine Einzelberatung anbietet: als Konsil, Visite, Liaisondienst oder – laut Neitzke – im Sinne eines „diensthabenden Ethikers“.119 Der Vorteil der Flexibilität ist hier abzuwägen gegenüber einer eventuell eindimensionalen Sicht, die erst in einem Team aus mehreren Personen überwunden werden kann. Neben diesen dezidierten Beratungsmodellen existieren an vielen Krankenhäusern auch offene Strukturen, in denen betroffene Ärzte, Pflegende, Seelsorger oder andere Mitarbeiter und nicht zuletzt Patienten oder Angehörige ihre Anliegen vortragen können. Diese eher informellen Angebote können dazu beitragen, spätere explizite Beratungsformen vorzubereiten oder diese zu ergänzen. Eine Fallberatung im eigentlichen Sinn kann hier nicht stattfinden, wohl aber die Einübung einer moderierten Reflexion und damit die Sensibilisierung für die Relevanz und Vorteile gemeinsamer ethischer Diskurse. Die offenen Formen werden oft als Ethik-AG, Ethik-Café, oder gar EthikSalon bezeichnet und haben eine wichtige Funktion im Sinne der Fort- und Weiterbildung in ethischer Kompetenz. Sie eignen sich aber auch als Gelegenheit und Ort, um an ethischen Fragen interessierte Mitarbeiter anzusprechen und für eine spätere Mitarbeit im Rahmen von Ethik-Projekten zu gewinnen. 3.3.2. Voraussetzungen erfolgreicher Ethikberatung Nach der Darstellung der verschiedenen Modelle Klinischer Ethikberatung stellt sich die Frage: Welche Erkenntnisse und Vorstellungen gibt es zu den grundsätzlichen Voraussetzungen einer erfolgreichen Ethikberatung? Nach welchen Prinzipien sollten Ethikberatungen organisiert, moderiert, dokumentiert und letztlich auch evaluiert werden? Wer sollte zur Beratung mit welcher Qualifikation berechtigt sein? Und letztlich: Wann ist eine solche Ethikberatung überhaupt erfolgreich? Wann hat sie ihren Zweck erfüllt? 118 119 Steinkamp/Gordijn (2000) und (2005). Gerdes/Richter (1999), Richter (2001) und (2008). 54 Diesen Fragen, die auch den Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gaben, sind die folgenden Ausführungen gewidmet. Sie greifen in ihrer Struktur den Vorschlag von zwei amerikanischen Medizinethikern auf, die 1994 fünf Aspekte von Ethikberatungen vorschlugen, die durch Standards geregelt sein sollten: den Zugang zur Ethikberatung, die Qualifizierung der Beratenden, den Ablauf des Beratungsprozesses, die Dokumentation des Ergebnisses und die Evaluation. 120 3.3.2.1. Zugang zur Ethikberatung In den Empfehlungen der beiden konfessionellen Krankenhausverbände aus dem Jahr 1997 heißt es: „Jeder betroffene Mitarbeiter und jeder Patient des Hauses kann sein ethisches Problem vorbringen, um sich für seine eigene Entscheidung eine Gewichtung der Argumente und Gegenargumente in Form eines Votums als Orientierungshilfe einzuholen. Der Vorsitzende des Komitees entscheidet, ob über vorgebrachte Probleme verhandelt wird.“ 121 Diese Empfehlung für die Geschäftsordnung eines Klinischen Ethik-Komitees als Träger der Klinischen Ethikberatung enthält zur Frage des Zugangs zwei Aussagen, die je nach Modell von Ethikberatung heutzutage vermutlich differenziert würden: Neben Mitarbeitern und Patienten werden in zahlreichen Publikationen zur Ethikberatung ausdrücklich auch Angehörige und die juristischen Vertreter von Patienten genannt. 122 Außerdem ist die Entscheidung über die Annahme des „vorgebrachten Problems“ im klinischen Alltag meist eine gemeinsame Entscheidung des Ethik-Komitees oder – im Fall einer Mobilen Ethikberatung – eine Entscheidung des „diensthabenden Beraters“ nach entsprechendem (meist telefonischem) Erstkontakt. Der grundsätzliche Zugang zu einer Ethikberatung wird heute in aller Regel eher weit gefasst, wobei der Klärung des Anliegens eine wichtige Bedeutung zukommt, um die Beratung nicht der Gefahr zu vieler Fälle oder einer Instrumentalisierung auszusetzen – etwa um Konflikte innerhalb eines Behandlungsteams oder in Verbindung mit Führungsfragen zu bearbeiten. In solchen Fällen bietet es sich eher an, ein passenderes Instrument zu empfehlen und ggf. zu vermitteln, etwa eine Supervision, Mediation oder ein Coaching. 120 Fletcher/Hoffmann (1994). DEKV/KKVD (1997), S. 17. 122 ASBH (1998), Simon (2008), AEM (2010). 121 55 3.3.2.2. Qualifizierung der Beratenden Die Qualität einer Beratung hängt generell nicht zuletzt von der Qualifikation der Beratenden oder Moderatoren ab. Dies gilt selbstverständlich auch für die Ethikberatung und hat in den letzten Jahren eine Reihe von Kompetenzprofilen und Schulungskonzepten entstehen lassen wie auch erste theoretische Arbeiten zur Didaktik medizinethischer Fortbildungen.123 Während die konfessionellen Krankenhausverbände ihre Empfehlungen zur Qualifikation von Mitgliedern eines Ethik-Komitees bzw. Klinischen Ethikberatern 1997 noch vergleichsweise allgemein hielten: „Bei der Auswahl seiner Mitglieder ist darauf zu achten, dass diese sich selbst, ihre Sachkenntnis und ihr Urteil in einen Prozess einbringen können“, entwickelten sich schon bald differenzierte Vorstellungen von den notwendigen Qualifikationen für eine erfolgreiche Ethikberatung. International fanden vor allem die 1998 von der American Society for Bioethics and Humanities (ASBH) verabschiedeten Kernkompetenzen für Ethikberatung 124 weithin Beachtung. Sie definieren zwölf Fähigkeiten und neun Kenntnisse, die der ASBH zufolge je nach Beraterrolle in unterschiedlicher Ausprägung vorliegen sollten. Demnach müssten Ethikberater grundsätzlich in der Lage sein, einen ethischen Konflikt als solchen identifizieren und analysieren zu können. Sie sollten – eine multiprofessionelle Gruppe in ihrer Diskussion ergebnisoffen und zugleich zielorientiert moderieren können sowie mit wichtigen medizinethischen Fragen gerade am Anfang und Ende des Lebens vertraut sein. – unterschiedliche religiöse Vorstellungen zu Sterben und Tod kennen und über Grundkenntnisse zu einschlägigen rechtlichen Themen verfügen. – eine offene wie respekt- und vertrauensvolle Atmosphäre schaffen und gerade auch in kontroversen Gesprächssituationen vermitteln können. Die Gründung einer Arbeitsgruppe „Ethikberatung im Krankenhaus“ in der bundesweiten Fachgesellschaft Akademie für Ethik in der Medizin intensivierte 2003 die Diskussion um Standards in der Qualifikation von Ethikberatern und mündete 2005 in die Publikation eines offiziellen Curriculums der Akademie. 125 123 Aulisio (2000), Fahr (2008), Vgl. AEM-Curriculum oder cekib-Fernlehrgang Ethikberater/in. ASBH (1998), (2011). 125 Dörries (2005), (2010). 124 56 In diesem Curriculum werden die ASBH-Kompetenzen bestätigt und im Hinblick auf die Initiierung und Implementierung ethischer Beratungsangebote ergänzt und weiterentwickelt. Das offizielle Curriculum der Akademie soll dazu befähigen, „den Bedarf und die Bedeutung von Ethikberatung für die eigene Organisation zu erkennen und zu reflektieren sowie am Aufbau und an der Weiterentwicklung geeigneter Strukturen (z.B. regelmäßige Ethikfortbildung, Ethikarbeitsgruppen, Klinisches Ethikkomitee, Ethikkonsil) mitzuwirken.“ 126 Damit sind neben Fähigkeiten und Kenntnissen für die Beratungssituation selbst auch Kompetenzen im Bereich der Organisationsentwicklung gefordert, die dazu beitragen können, den aufzubauenden Ethik-Strukturen die erwünschte Nachhaltigkeit zu sichern. Seit dem Beginn dieses Qualifikationsprogramms im Jahr 2003 haben an ihm allein bis zum Februar 2010 schon insgesamt 367 Personen teilgenommen. 127 Eine sinnvolle Verbindung aus Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz mit Kompetenzen zur Organisationsentwicklung vermittelt auch der Fernlehrgang „Ethikberater/in im Gesundheitswesen“, den das Centrum für Kommunikation Information Bildung (cekib) am Klinikum Nürnberg seit 2005 in Zusammenarbeit mit der Akademie für Ethik in der Medizin und u.a. dem Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität Erlangen-Nürnberg anbietet. Der etwa ein Jahr dauernde Fernlehrgang ist ausdrücklich an das Curriculum der Akademie angelehnt und umfasst dreißig Lehrbriefe und vier Präsenztage. Bis 2011 haben am Nürnberger Fernlehrgang insgesamt 656 Personen teilgenommen. 128 Die Entwicklung emotionaler Kompetenzen scheint bislang in didaktischer Hinsicht im Zusammenhang mit der Ethikberatung und ihrer Qualifizierung unterrepräsentiert zu sein. Emotionales Lernen wird dabei verstanden als die Fähigkeit, eigene und fremde Emotionalität zu verstehen und ausdrücken zu können. Erste Arbeiten aus der Perspektive der Erwachsenenbildung gehen daher der Frage nach, „wieweit es gelingt, ein Lernumfeld zu etablieren, das den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglicht, emotionale und kognitive Elemente fruchtbar in die eigene Persönlichkeitsentwicklung zu integrieren.“129 126 Dörries (2005). Das Hannoveraner Programm ist das weltweit größte Qualifizierungsprogramm für Klinische Ethik. 128 Davon waren 562 externe Teilnehmende und 94 Beschäftige im Klinikum Nürnberg. Angabe cekib, Klinikum Nürnberg. 129 Fahr (2008). 127 57 Das Konzept des emotionalen Lernens für die Erwachsenenpädagogik erst entwickelt wurde, spielt es für die Anwendung im Rahmen medizinethischer Fortbildungen bislang noch kaum eine Rolle. Angesichts der oft existenziellen Fragen im Rahmen einer Klinischen Ethikberatung, so der Medizinethiker Uwe Fahr, erscheint es naheliegend, auch die Eigeninteressen und Motivationen, oder anders gesagt: die „Deutungs- und Emotionsmuster“ der beteiligten Beratenden in ihrer Fort- und Weiterbildung konzeptionell zu berücksichtigen und zu nutzen – ein Ansatz, der laut Fahr explizit die Kritik an einer Wissensfixierung medizinethischer Fortbildungen aufgreife und den Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung und praktischer Kompetenzen stärke. Gegenüber der ausschließlichen Wissensvermittlung – in der Pädagogik als „erzeugungsdidaktischer Ansatz“ verstanden – ergänzen, so Uwe Fahr, „ermöglichungsdidaktische Ansätze“ 130 die Vermittlung von Fach- und Methodenkompetenz, indem sie die Sozial- und Selbstkompetenz der Berater als Schlüsselkompetenzen fördern. Da gerade in Ethikberatungen auch die Emotionen der Berater stark angesprochen würden, komme ihrer pädagogischen Berücksichtigung im Hinblick auf das implizite und explizite Lernen eine besondere Bedeutung zu. Denn gelernt werde in jedem Fall. Der Fort- und Weiterbildung von Ethikberatern komme auch insofern eine besondere Bedeutung zu, als sie selbst während der Beratung auch zu Lehrenden würden. Ethikberatungen könnten als „einzelfallbezogene Lernarrangements“ gedeutet werden, in denen der Berater auch Erwachsenenbildner werde, „ob er sich dies bewusst macht oder nicht.“ 131 3.3.2.3. Ablauf der Beratungsgespräche Für den Ablauf des eigentlichen Beratungsgespräches gibt es eine Vielzahl publizierter Vorschläge, die sich meist auf die folgenden Grundprinzipien konzentrieren: Jedes Beratungsgespräch sollte in der einen oder anderen Form eine Eröffnung, Informationssammlung, Formulierung des ethischen Konfliktes, Diskussion der ethischen Fragestellung und einen Abschluss enthalten. Die verschiedenen Modelle setzen dabei lediglich eigene Akzente bzw. Schwerpunkte oder sie unterscheiden sich durch die chronologische Anordnung der genannten Gesprächsteile. 130 131 Fahr (2008), S. 27. Ebd., S. 30. 58 Ethische Fallbesprechungen werden meist als kommunikativer Prozess bezeichnet, dessen Auslöser und Inhalt ethische Konflikte bzw. deren Lösung darstellen. Daher ist neben der kommunikativen Kompetenz die inhaltlich-fachliche sowie die methodische Expertise der Prozessgestaltung wichtig. Gerade der Moderation – wie auf Seite 50 dargelegt – kommt im Gespräch eine zentrale Rolle zu. Dabei unterscheidet sich das Gespräch im Rahmen einer Ethikberatung deutlich von den ansonsten üblichen Besprechungsformen im Krankenhaus oder auf der Station. Es verlangt, so der Medizinethiker Jochen Vollmann, Haltungs- und Wertevermittlung statt Information und Wissensvermittlung, einen geschickten Fragestil statt Handlungsanweisungen und Anordnungen. 132 Angesichts der Emotionen und moralischen Intuitionen, die im Rahmen der Ethikberatung oftmals aufeinander treffen, sei es häufig die Aufgabe der Moderation, so Vollmann, buchstäblich Lenkung und Mäßigung zu betreiben: „Eine kompetente Fragetechnik kann Gesprächsblockaden auflösen, stille Teilnehmer in den Diskussionsprozess einbeziehen, Missverständnisse klären und den aktuellen Stand der Diskussion in der Gruppe sichtbar machen.“ 133 Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, die Moderation nicht einem Beteiligten und Mitglied der Gruppe zu überlassen, sondern durch eine externe Person zu besetzen, wie in einigen der oben bereits geschilderten Modelle etabliert. Diese Person sollte selbstverständlich über die zuvor genannten Qualifikationen verfügen. Zum besseren Verständnis von Gesprächsverläufen in der Ethikberatung sind hier drei publizierte und weit verbreitete Verfahren beispielhaft skizziert: Der „Bochumer Fragebogen zur medizinethischen Praxis“ aus dem Jahr 1987, 134 die „Nijmwegener Methode für ethische Fallbesprechung“ 135 von 2005 sowie der „Basler Leitfaden zur Klinischen Ethikkonsultation“,136 ebenfalls aus dem Jahr 2005. Der Bochumer Fragebogen versteht sich als Leitfaden für die konkrete medizinethische Einzelfallanalyse. Seine Autoren bringen den Zweck der Methode auf die einfache Formel: „In Diagnose, Therapie und Prognose ist das ,Wertbild‘ des Patienten ebenso wichtig wie das ‚Blutbild‘.“ 132 Vollmann (2008). Vollmann (2008), S. 88. 134 Sass/Viefhues (1988). 135 Steinkamp/Gordijn (2005). 136 Reiter-Theil (2005). 133 59 Der Leitfaden ist in folgende drei Abschnitte gegliedert, die chronologisch bearbeitet werden und zu denen zur Anregung und Anleitung eine Reihe von Fragen formuliert sind. Zunächst die drei Abschnitte in der Übersicht: 1. Klärung der medizinische Befunde 2. Diskussion der medizinethische Befunde 3. Zusammenfassung und Beschluss Zusätzlich zu diesem dreistufigen Vorgehen enthält der Bochumer Arbeitsbogen auch eine Reihe spezieller Fragen zu besonderen ethischen Konstellationen, so bei „Fällen von langandauernder Behandlung“, bei „Fällen von erheblicher sozialer Relevanz“ oder auch bei „Fällen therapeutischer oder nicht-therapeutischer Forschung“. Die Nijmwegener Methode für ethische Fallbesprechungen versteht sich ebenfalls als Hilfe zur Strukturierung der Gespräche, folgt aber einem vierstufigen Verfahren. Es beginnt mit der gemeinsamen Formulierung des ethischen Problems und nicht mit der Faktensammlung. Diese erste Problemformulierung verstehen die Autoren nicht als endgültig – sie lässt sich im Laufe der Beratung auch verändern oder präzisieren, aber als unmissverständlichen gemeinsamen Ausgangspunkt des dann folgenden Beratungsgesprächs. Dieses gliedert sich dann wie folgt: 1. Benennen des ethischen Problems 2. Zusammentragen der verschiedenen Aspekte (med./pfleg./soz.) 3. Diskussion und Bewertung 4. Beschlussfassung Da sich dieses Vorgehen auf viele, aber nicht auf alle klinischen Situationen anwenden lässt, hält auch die Nijmwegener Methode für drei besondere ethische Situationen weitere Fragen bereit, so für „Patienten ohne Einwilligungsfähigkeit bzw. Entscheidungsfähigkeit“, „Kinder und die Einwilligungsfähigkeit“ und ebenfalls „Situationen langandauernder Behandlung“. Zum besseren Verständnis der Leitfäden und des konkreten Gesprächsablaufs dokumentiere ich exemplarisch auf den hier folgenden drei Seiten die Nijmwegener Methode ausführlich.137 137 Nach einer Darstellung von Jochen Vollmann (2008), S. 99-101. 60 1. PROBLEM Wie lautet das ethische Problem? 2. FAKTEN Medizinische Gesichtspunkte Wie lautet die Diagnose des Patienten, wie ist seine Prognose? Welche Behandlung kann vorgeschlagen werden? Hat diese Behandlung einen günstigen Effekt auf die Prognose? In welchem Maße? Wie ist die Prognose, wenn von dieser Behandlung abgesehen wird? Welche Erfolgsaussicht hat die Behandlung? Kann die Behandlung dem Patienten gesundheitlich schaden? Wie verhalten sich die positiven und negativen Auswirkungen zueinander? Pflegerische Gesichtspunkte Wie ist die pflegerische Situation des Patienten zu beschreiben? Welcher Pflegeplan wird vorgeschlagen? Inwieweit kann der Patient sich selbst versorgen? Ist Unterstützung von außen verfügbar? Welche Vereinbarungen sind über Aufgabenverteilungen in der Pflege getroffen worden? Lebensanschauliche und soziale Dimensionen Was ist über die Lebensanschauung des Patienten bekannt? Gehört der Patient einer Glaubensgemeinschaft an? Wie sieht er selbst seine Krankheit? Wie prägt die Weltanschauung des Patienten seine Einstellung gegenüber der Krankheit? Hat er das Bedürfnis nach seelsorglicher Begleitung? Wie sieht das soziale Umfeld des Patienten aus? Wie wirken sich Krankheit und Behandlung auf seine Angehörigen, seinen Lebensstil und seine soziale Position aus? Übersteigen diese Auswirkungen die Kräfte des Patienten und seiner Umgebung? Wie können persönliche Entfaltung u. soziale Integration des Patienten gefördert werden? Organisatorische Dimension Kann dem Bedarf an Behandlung und Pflege des Patienten nachgekommen werden? Tabelle 4: Die Nijmwegener Methode für ethische Fallbesprechungen. (Die Fortsetzung der Tabelle folgt auf der folgenden Seite.) 61 3. BEWERTUNG Wohlbefinden des Patienten Wie wirken sich Krankheit und Behandlung auf das Wohlbefinden des Patienten aus? (Lebensfreude, Bewegungsfreiheit, körperliches und geistiges Wohlbefinden, Schmerz, Verkürzung des Lebens, Angst u.a.) Autonomie des Patienten Wurde der Patient umfassend informiert und hat er seine Situation verstanden? Wie sieht der Patient selbst seine Krankheit? Wurde der Patient bis dato ausreichend an der Beschlussfassung beteiligt? Wie urteilt er über die Belastungen und den Nutzen der Behandlung? Welche Werte und Auffassungen des Patienten sind relevant? Welche Haltung vertritt der Patient gegenüber lebensverlängernden Maßnahmen? Ist es richtig, dem Patienten die Entscheidung zur Behandlung zu überlassen? Verantwortlichkeit von Ärzten, Pflegenden und anderen Betreuenden Gibt es zwischen Ärzten, Pflegenden, anderen Betreuenden, dem Patienten und seinen Angehörigen Meinungsverschiedenheiten darüber, was getan werden soll? Kann dieser Konflikt gelöst werden durch die Auswahl einer bestimmten Versorgung? Gab es genügend gemeinsame Beratung unter Ärzten, Pflegenden und Betreuenden? Sind ihre Verantwortlichkeiten deutlich genug abgegrenzt worden? Wie wird mit vertraulichen Informationen umgegangen (Vertraulichkeit)? Ist das vorgeschlagene Vorgehen im Hinblick auf andere Patienten zu verantworten (Gerechtigkeit)? Müssen Interessen Dritter mitberücksichtigt werden? Welches sind die relevanten Richtlinien der Einrichtung? 4. BESCHLUSSFASSUNG Wie lautet nun das ethische Problem? Sind wichtige Fakten unbekannt? Kann so ein verantwortlicher Beschluss gefasst werden? Kann das Problem miteinander in Konflikt stehender Werte formuliert werden? Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Welche Handlungsalternative steht am meisten in Übereinstimmung mit den Werten des Patienten? Welche weiteren Argumente spielen bei der Entscheidung eine Rolle? Welche Handlungsweise verdient den Vorzug auf der Basis der genannten Argumente (Behandlung, Änderung der Pflege, Konsultation, Überweisung, Zuwarten etc.)? Welche konkreten Verpflichtungen gehen die Betroffenen ein? Welche Fragen blieben unbeantwortet? In welchen Fällen muss die Entscheidung aufs Neue überdacht werden? Für besondere Fallkonstellationen ergänzt das Nijmwegener Modell wie folgt: 62 5. BESONDERE SITUATIONEN Patienten ohne Willensfähigkeit Wie und durch wen wird festgestellt, dass der Patient nicht zu einem eigenen Willen fähig ist? In welcher Hinsicht ist er/sie nicht entscheidungsfähig? Wird die Willensunfähigkeit als zeitlich begrenzt oder dauerhaft angesehen? Welche Aussicht besteht auf Wiederherstellung der Willensfähigkeit? Können die jeweils zu treffenden Entscheidungen so lange aufgeschoben werden? Was weiß man über die Werte des Patienten? Gibt es einen Vertreter der Interessen des Patienten? Kinder Wurde dem Kind ausreichend Gehör geschenkt? Kann das Kind in Hinsicht auf die Behandlung selbst entscheiden? Welche Behandlungsalternative steht am meisten in Übereinstimmung mit den Werten der Eltern? Was bedeutet es für das Kind, falls der Auffassung der Eltern entsprochen bzw. gerade nicht entsprochen wird? Lange andauernde Behandlung In welchen Situationen muss das Vorgehen der Pflege überdacht und eventuell verändert werden? Welche Haltung vertritt der Patient gegenüber Veränderungen des Vorgehens in der Pflege? Tabelle 5: Ergänzung zur Nijmwegener Methode nach Steinkamp und Grodijn.138 Die Nijmwegener Methode betont in besonderer Weise den intuitiven Zugang zu moralischen Fragen und unterstellt den Beteiligten ein hohes Maß an moralischem Alltagswissen und ethischer Sensibilität.139 Sie betont zugleich die Unterscheidung von Fakten und Werten sowie die Annahme, dass auch klinische Fakten interpretiert werden müssen. In diesem Sinne beruht die Methode letztlich auf einem an der Hermeneutik orientierten Modell der Ethikberatung. 140 138 Nach einer Darstellung von Jochen Vollmann (2008), S. 101. Steinkamp/Grodijn (2005). 140 Fahr (2008). 139 63 Ein weiteres Verfahren zur Strukturierung ethischer Fallberatungen enthält das Basler Modell 141 der „klinischen Ethikkonsultation“, das ebenfalls eine m ethodische Orientierung zur ethischen Beratung am Krankenbett gibt. Es orientiert sich an psychologischen Beratungsmodellen und betont vor allem den systematischen Wechsel der Perspektiven nach folgendem Modell: ICH-PERSPEKTIVE Bedürfnisse der beteiligten Individuen, persönliche Werte, professionelles Selbstverständnis, Grenzen der Belastbarkeit, Rechte des Patienten u.a. ICH-DU-PERSPEKTIVE Beziehungsebene zwischen Patient und Arzt/Betreuer bzw. Bezugsperson: Erwartungen, Versprechen, Vertrauen, Überforderung u.a. PERSÖNLICHE WIR-PERSPEKTIVE Beziehungskontext des Patienten, vor allem Familie und Angehörige, Beziehungskontext des Arztes/Betreuers, hier vor allem das Team INSTITUTIONELLE PERSPEKTIVE Leitbild, Wertorientierung, Hierarchie, Entscheidungs- und Handlungsraum, Gewissensfreiheit des Einzelnen in der Institution, Einschränkungen, z.B. Rationierung PROFESSIONELLE PERSPEKTIVE Standards des Fachgebietes, rechtliche Rahmenbedingungen, professionelle Ethik KOLLEKTIVE PERSPEKTIVE Wertehorizont, z.B. Religionsgemeinschaft, persönliche Verantwortung in der Gesellschaft Tabelle 6: Perspektivenwechsel im Basler Model (Reiter-Theil) 142 Die Medizinethikerin Stella Reiter-Theil aus Basel führt dazu aus: „Mit Hilfe einer systematischen Variation der Perspektiven, unter denen die aktuelle Problematik betrachtet wird, sollten die relevanten Bedürfnisse, Rechte und Pflichten der Beteiligten erfüllt werden. Wir streben damit eine Annäherung an ein ideales Modell der Unparteilichkeit – oder auch der abwechselnden Mehrparteilichkeit – an, das sich an das Gerechtigkeitsprinzip von John Rawls anlehnt.“143 141 Reiter-Theil (1999), (2000), (2001), (2003) und (2005). Reiter-Theil (2005), S. 349. 143 Ebd., S. 349. 142 64 Als Orientierung im Beratungsverlauf wird der Vier-Prinzipien-Ansatz von Beauchamp/Childress144 genutzt mit der systematischen Berücksichtigung der folgenden vier Dimensionen: 1. Respekt vor der Autonomie des Patienten 2. Vermeidung von Schaden 3. Wohltun/Gutes tun 4. Gerechtigkeit Zum Vergleich mit dem Bochumer Fragebogen oder der Nijmwegener Methode folgt hier der Basler „Leitfaden zur Klinischen Ethikkonsultation“. 1. VORBEREITUNG Klärung des Rahmens und des Vorgehens Problemzentrierter Bericht aus dem klinischen Team Gelegenheit für Rückfragen und Ergänzungen 2. SPONTANE FALLDISKUSSION DER DIREKT BETEILIGTEN (nach Bedarf) Ethische Prinzipien, Werte, Normen Systematischer Perspektivenwechsel Pro und Contra der Optionen ggf. Identifikation und Schliessen von Lücken oder Korrektur von Fehleinschätzungen 3. FOKUSSIERTE ERGEBNISSE – EXPLIZITE FORMULIERUNG Entscheidung(en) und ethische Begründung Weiteres Vorgehen, Dokumentation 4. FEEDBACK, EVALUATION, BEGLEITFORSCHUNG (wenn möglich) Tabelle 7: Basler Leitfaden zur Klinischen Ethikkonsultation (Reiter-Theil) 145 In der Literatur wird in diesem Zusammenhang auf die Prägung des Basler Modells durch die „aktive Rolle der Beraterin“ 146 verwiesen. Gegenüber anderen Verfahren von Ethikberatung, etwa dem Nijmwegener Modell, scheint dem Berater im Basler Modell eine stärkere Bedeutung zuzukommen. 144 Beauchamp/Childress (2009). Reiter-Theil (2005), S. 350. 146 Fahr (2008). 145 65 3.3.2.4. Dokumentation der Beratung Dass jede Klinische Ethikberatung schriftlich dokumentiert werden sollte, bestätigen alle Stellungnahmen und Publikationen der vergangenen Jahre.147 Wie dies im Detail geschehen soll, ist allerdings unklar und daher Gegenstand einer weiteren wissenschaftlichen Diskussion.148 Gerade im Hinblick auf eine künftige Qualitätssicherung der Ethikberatung erscheint es notwendig, die oft vage gehaltenen Begriffe „angemessen“ (z.B. ZEKO) oder „geeignet“ (z.B. AEM Curriculum) zu präzisieren, vor allem zu Inhalt und Form einer Dokumentation. Insofern tragen die aktuellen „Empfehlungen für die Dokumentation von EthikFallberatungen“ der Arbeitsgruppe „Ethikberatung im Krankenhaus“ der Akademie für Ethik in der Medizin (AEM) dazu bei, ein lange bestehendes Vakuum zu füllen. Die Empfehlungen wurden 2011 publiziert 149 und bieten eine hilfreiche Orientierung für die unterschiedlichen hier dargestellten Formen von Ethikberatung. Grundsätzlich unterscheiden die Empfehlungen der „Akademie für Ethik in der Medizin“ zwischen einer externen Dokumentation im Sinne von Ergebnisberichten und einer internen Dokumentation als Aufzeichnung des Beraters. Auf der Basis grundsätzlicher Einordnungen zu Fallberatungen allgemein, der angestrebten „Konsensorientierung der Ethikberatung“, dem „Schutz von Beratungen“ und der Definition möglicher „Ratsuchender“, nennen die Empfehlungen die Ziele einer Dokumentation: „Orientierung und Erinnerungsfunktion“, „Absicherung“, „Qualitätssicherung“, „Ausbildung von Ethikberatern“ und „Tätigkeitsnachweis“ – und geben konkrete Anhaltspunkte für den „Ergebnisbericht“. Dieser solle Angaben enthalten zu – Datum, Ort und Dauer der Beratung – Namen und Funktion der Teilnehmer – Ethische Fragestellung(en) – Aktuelle medizinische, pflegerische, psychosoziale Situation – Wünsche, Wertvorstellungen, erklärter/mutmaßlicher Wille des Patienten – Ergebnis der Beratung/Begründung (erzielter Konsens oder Divergenzen) 150 147 DEKV/KKVD (1997), ASHB (1998), ZEKO (2006), Bramstedt (2009) und Fahr (2011). Freedom (1993), Fahr (2009). 149 Fahr (2011). 150 Ebd. 148 66 Die AEM-Empfehlungen betonen die Vertraulichkeit der Dokumentation und stufen sie als „Bestandteile der Krankenunterlagen“ ein. „Als solche wenden sie sich an alle, die an der Behandlung/Versorgung beteiligt sind und entsprechende Einsichtsrechte in die jeweiligen Unterlagen haben.“151 Daher sei die Vertraulichkeit der Beratung zu wahren und in der Dokumentation auf solche Zitate zu verzichten, die einzelnen Personen eindeutig zugeordnet werden könnten. „Eine wichtige Ausnahme stellten Äußerungen über den mutmaßlichen Patientenwillen dar.“ Es wird den Beratern empfohlen, die Dokumentation selbst zu erstellen und vor allem Ergebnisse mit praktischen Konsequenzen für die Versorgung des Patienten ausdrücklich schriftlich festzuhalten. Der Ergebnisbericht sollte den Beteiligten „zur Kenntnis“ gegeben werden, bevor er den Krankenunterlagen hinzugefügt wird. Und es wird empfohlen, den Bericht durch den Protokollanten unterschreiben zu lassen. Für die Form regt die Arbeitsgruppe der AEM gegliederte Erhebungsbögen (Dokumentationsbögen) an, die durch ihre Struktur eine Arbeitserleichterung bieten könnten und ggf. schon eine erste Bestätigung des Berichtes direkt im Anschluss an die Beratung ermöglichen. Auch Aufbewahrung, Datenschutz und Einsichtsrecht thematisiert die Arbeitsgruppe ausdrücklich. Hier betonen die Empfehlungen die Einhaltung der Schweigepflicht, eine Aufbewahrung analog den ärztlichen Aufzeichnungen von zehn Jahren und das Einsichtsrecht betroffener Patienten bzw. Betreuer oder Bevollmächtigter. Insgesamt sind die Empfehlungen der Akademie ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Standardisierung von Ethikberatungen. Einige der eher allgemeinen Vorschläge dürften aber noch eine Erörterung nach sich ziehen, z.B. die Frage der Vertraulichkeit 152 bzw. die Ablage der Protokolle in den Krankenakten.153 Für die weitere Untersuchung Klinischer Ethikberatungen bedarf es einer Dokumentation, die mehr als das Ergebnis wiedergibt. Nur eine differenzierte Analyse der Beratung aufgrund detaillierter Protokolle von Gesprächsverläufen kann die „black box“ der Ethikberatung154 transparenter machen. 151 Fahr (2011) In Anlehnung an den Medizinrechtler Erwin Deutsch (2008). Neitzke (2007), Frewer/Fahr (2007), Schmidt/Frewer (2007). 153 Fahr (2009). 154 Frewer (2008). 152 67 3.3.2.5. Evaluation der Beratung Als letzter, aber nicht minder wichtiger Aspekt der Standardisierung Klinischer Ethikberatung sei die Evaluation genannt: die systematische Überprüfung und Bewertung der Beratung und ihrer Auswirkungen. Eine Evaluation wird allgemein für wichtig erachtet, in ihren Zielen häufig näher beschrieben155 und nur selten realisiert – jedenfalls nur begrenzt im Sinne wissenschaftlicher Studien. Am Ende dieses Abschnitts wird dieser Aspekt nochmals aufgegriffen. Zunächst stehen die Ziele einer Evaluation und ein prominent publiziertes Beispiel im Vordergrund. 156 Sinnvoll und notwendig ist die Evaluation von Ethikberatung aus mindestens zwei Gründen: sie kann die Veränderungen und Effekte aufzeigen, die das Angebot der Beratung bewirkt; und sie kann zum Ausgangspunkt von Verbesserungen werden. Obgleich der beabsichtigte Beleg messbarer Effekte eine methodische Herausforderung darstellt (u.a. Vorher-Nachher-Vergleiche), können die qualitativen und quantitativen Methoden der empirischen Sozialforschung genutzt werden, um die Wahrnehmung und das Erleben der Beteiligten näher zu erforschen. Damit könnte beispielsweise sichtbar werden – ob die Beratung von Patienten und Angehörigen kurz- und mittelfristig als ein hilfreiches Angebot für Entscheidungen und Verarbeitung empfunden wird. – ob Ethikberatung bei den beteiligten Mitarbeitern zu einer größeren Sensibilität und Sicherheit im Umgang mit ethischen Fragen führt. – ob die Beratung bei den beteiligten Mitarbeitern einen „Lerneffekt“ bewirkt und sie nach anfänglich starker Inanspruchnahme immer weniger genutzt wird. – ob Ethikberatung zu einer neuen Kommunikations- und Kooperationsroutine im Stationsalltag führt, in der regelhaft zwischen den Berufsgruppen und weiteren Beteiligten schwierigste Entscheidungen gemeinsam herbeigeführt werden und damit für alle Akteure tragfähiger werden. – ob Ethikberatung sich positiv auf die generelle Kooperation und Kommunikation der großen Berufsgruppen auswirkt und hier eine Verstärkerfunktion ausüben kann. – ob die Beratung sich tendenziell auf die Entscheidungen am Anfang und Ende des Lebens auswirkt – und beispielsweise zu einer Zunahme oder Abnahme der Fortführung von Therapie führt. 155 156 White (1997), Simon (2008), Bruns/Frewer (2010), (2011). Vg. auch Alfred Simon (2008), S. 176. 68 Die Perspektive von Patienten und Angehörigen sollte im Grunde im Vordergrund stehen, da die Klinische Ethikberatung ihre Legitimation vor allem aus einer Verbesserung der Patientenversorgung – und in der Folge auch der Verbesserung der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter – erfährt. Jede Evaluation sollte diesen Aspekt berücksichtigen und für die weitere Verbesserung der Beratung nutzen. Während es seit etwa zehn Jahren eine Reihe von Veröffentlichungen zum methodischen und organisatorischen Vorgehen von Ethikberatungen und Ethikkonsilen an universitären, konfessionellen und kommunalen Krankenhäusern gibt, fehlt es nahezu vollständig an wissenschaftlichen Studien zur Wirkung von Ethikberatung. Eine der wenigen – und daher oft zitierten – Arbeiten stammt aus dem Jahr 2003 und konnte hochrangig im Journal of the American Medical Association (JAMA) publiziert werden.157 Untersuchungsziel, so der Medizinethiker Alfred Simon, waren die Auswirkungen von Ethikberatung auf Entscheidungen zu lebenserhaltenden Maßnahmen auf Intensivstationen. 158 Über zwei Jahre wurden 551 Patienten an sieben US-Krankenhäusern in die Studie eingeschlossen. Bei ihnen war davon auszugehen, dass sie die Behandlung nicht überleben. Per Zufallsprinzip wurden die Patienten in zwei Gruppen eingeteilt: den Patienten der einen Gruppe wurde eine Ethikberatung angeboten, den Patienten der anderen Gruppe nicht. Im Ergebnis wirkte sich die Beratung nicht auf die prozentuale Sterblichkeit der Patienten aus, wohl aber lagen die Patienten mit einer Beratung durchschnittlich kürzer in der Klinik bzw. auf einer Intensivstation und erhielten weniger lebenserhaltende Maßnahmen. Die Mehrheit des befragten Personals fand die Beratung hilfreich, um Entscheidungskonflikte anzusprechen. Die Autoren folgerten daraus, dass Ethikberatung dazu beitragen könne, nutzlose oder vom Patienten nicht gewollte Intensivmedizin zu vermeiden. Vielleicht fehlt es auf diesem Gebiet auch deshalb an „harten“ Studien, weil diese ausdrückliche Verbindung von Ethikberatung und Ökonomie dem Angebot und seiner Akzeptanz schaden könnte. Es scheint vielen Beteiligten wichtig zu sein, die Ethikberatung aus den üblichen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen möglichst herauszuhalten. Zu diesem Aspekt folgen zum Abschluss der Arbeit einige Vorschläge zu weiteren Forschungsansätzen bzw. erste Überlegungen für die strategische Entwicklung von Kennzahlen zur Ethikberatung. 157 158 Schneiderman et al. (2003). Vgl. aber auch Dowdy et al. ( 1998). Simon (2008), S. 177. 69 3.3.3. Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission Womöglich angeregt durch die bundesweite Untersuchung zur Ethikberatung an Krankenhäusern hat Anfang 2006 auch die Bundesärztekammer durch ihre Zentrale Ethikkommission (ZEKO) eine Stellungnahme zur „Ethikberatung in der klinischen Medizin“159 veröffentlicht, in der sie die Entwicklung der Ethikberatung begrüßt und zur Einrichtung solcher klinischen Angebote ausdrücklich aufruft. Die ZEKO stellt fest, dass in Deutschland „bisher keine Empfehlungen oder Standards für die Implementierung und die Arbeit klinischer Ethikberatung“ existieren. Sie betont den hohen „Informations- und Professionalisierungsbedarf“ und nimmt ausführlich zu den Zielen, Strukturen, Aufgaben, Organisationsfragen, Modellen und den häufig wiederkehrenden Problemen bei der Implementierung von Ethikberatung Stellung. Die Stellungnahme der ZEKO mündet in acht Empfehlungen, in denen sie die besondere Aufgabe der Klinischen Ethikberatung im konkreten Einzelfall betont. Ausdrücklich begrüßt sie die „Mitarbeit von Ärzten in den multiprofessionell zusammengesetzten Klinischen Ethikkomitees und in der Klinischen Ethikberatung. Hierdurch können die ethische Sensibilisierung, Argumentations- und Entscheidungskompetenz bei allen Beteiligten verbessert und ärztliche Entscheidungen transparenter gemacht werden.“ Die ZEKO bekräftigt: „Eine ethische Fallberatung darf die Entscheidungsbefugnis und die Verantwortung des jeweils Handelnden nicht aufheben. Vielmehr muss der jeweils Zuständige, insbesondere auch der behandelnde Arzt, weiterhin verantwortlich entscheiden und handeln.“160 In diesem Zusammenhang bewertet die ZEKO auch die Beratungsmodelle: - - die klinische Einzelfallberatung durch das gesamte Ethikkomitee (Modell 1) - - die Beratung durch einen einzelnen professionellen Ethikberater (Modell 2) - - und die dezentralen Modelle klinischer Ethikberatung (Modell 3) Dem dezentralen Modell der Ethikberatung wird der Vorrang gegeben, da es nicht Gefahr laufe, „Tribunalcharakter“ (Modell 1) zu entfalten, keine „Einzelkämpfer“ (Modell 2) produziere sowie besonders flexibel und praxisnah operieren könne. 159 160 ZEKO (2006). Ebd. Beide Zitate stammen von S. 1707. 70 3.4. Das Krankenhaus als Ort Klinischer Ethikberatung 3.4.1. Strukturen, Entwicklung, Trägerschaft Die Klinische Ethikberatung wird per definitionem vorwiegend an größeren Krankenhäusern praktiziert. Gerade in der stationären Krankenversorgung treten diejenigen Konflikte auf, für deren Lösung die Ethikberatung hilfreich sein kann. Aber auch das Krankenhaus selbst, eine der wichtigsten Säulen im deutschen Gesundheitswesen, ist in den letzten zehn Jahren zu einem Ort tiefgreifender Veränderungen und den damit verbundenen Konflikten geworden.161 Für ein besseres Verständnis der institutionellen Rahmenbedingungen, in denen sich die Klinische Ethikberatung entwickelt, werden hier die Dynamik und Strukturprozesse dieser Veränderung dargestellt. Politisch gewollt geht die Zahl der Krankenhäuser auch in Deutschland zurück, von 2.263 Krankenhäusern 1998 auf 2.083 Häuser im Jahr 2008. Dies entspricht einer Reduzierung um ca. 10% bzw. einem Rückgang um etwa 70.000 Betten. Die Zahl der Belegungstage sank im gleichen Zeitraum von 171,8 Millionen auf 142,5 Millionen, die Fallzahlen dagegen stiegen von 16,8 Millionen auf 17,5 Millionen. Die Verweildauer der Patienten sank für alle Krankenhäuser im Durchschnitt von 10,1 Tagen im Jahr 1998 auf 8,1 Tage im Jahr 2008.162 Hinzukommt eine erzwungene Sparpolitik, die eine Personalausweitung verhindert. Kurzum: In immer weniger Betten müssen in immer kürzerer Zeit immer mehr Patienten behandelt werden. Deshalb verwundert es nicht, dass die Personalproduktivität an deutschen Kliniken im europäischen Vergleich über alle Funktionen hinweg gut ist. Eine Studie von McKinsey zeigt: Bei den klinischen Diensten, im „weißen Bereich“, liegt Deutschland auf Platz 2 hinter Österreich; bei den nicht-klinischen Diensten liegt es sogar an erster Stelle. Im ärztlichen Dienst kommen hierzulande auf jeden Klinikarzt im Durchschnitt 146 Entlassungen; der Median der Vergleichsländer liegt bei 103. Nur Österreich schneidet mit 154 Entlassungen je Arzt noch produktiver ab. Beim Pflegepersonal weisen Deutschland und Österreich mit 52 Entlassungen je Pflegekraft gemeinsam die höchste Personalproduktivität auf. Beim medizinisch-technischen Dienst und Funktionsdienst liegen die deutschen Kliniken international eher auf Durchschnittsniveau.163 161 Vgl. auch Kühn (1996). Homepage der Deutschen Krankenhausgesellschaft 2010, Quelle: destatis 2010. (20.01.2012) 163 Nach einer Studie von McKinsey zu OECD Vergleichszahlen aus dem Jahr 2008. 162 71 Ausgelöst wurde dieser Prozess der Produktivitätssteigerung nicht zuletzt durch ein neues Abrechnungssystem von Krankenhausleistungen, das nicht mehr nach tagesgleichen Sätzen, sondern nach diagnosebezogenen Fallpauschalen, den DRGs (diagnosis-related-groups), vergütet. Das DRG-System wurde 2003 in Deutschland eingeführt und umfasst inzwischen über 1.200 verschiedene Fallgruppen, die das gesamte Leistungsspektrum der Medizin abbilden sollen. Es erfordert daher eine aufwändige und personalintensive Dokumentation der erbrachten Leistung. Entsprechend der Logik des Systems sind die Krankenhäuser implizit angehalten, ihre Patienten möglichst zügig zu versorgen, um den bestmöglichen Erlös zu erzielen. Angetrieben durch dieses System ändern viele Krankenhäuser ihre Strukturen und Prozesse, einige ihre Trägerschaft, andere verschwinden ganz. 164 Die verstärkte Übernahme von Krankenhäusern durch private Träger zeigt sich besonders deutlich an den absoluten Zahlen. So gingen die Häuser in öffentlicher Trägerschaft zwischen 2004 und 2008 von 671 auf 571 zurück, frei-gemeinnützige von 712 auf 673, während die privaten Häuser von 444 auf 537 Häuser anstiegen. 2008 waren in Deutschland 32% der Kliniken in öffentlicher, 38% in freigemeinnütziger und 29% in privater Hand. Aufgrund verstärkter Aquise im Jahr 2008 sind 2009 erstmals mehr Klinken in privater als in öffentlicher Trägerschaft. 165 Das deutsche Krankenhauswesen, das traditionell aus einer Vielfalt öffentlicher, freigemeinnütziger und privater Träger besteht, könnte sich binnen kurzer Zeit gravierend verändern, auch in Bezug auf sein grundsätzliches Selbstverständnis. Im Zuge des politisch gewollten Wandels von einem bislang durch die öffentliche Daseinsfürsorge geprägten Gesundheitswesen zu einer stärker marktwirtschaftlich orientierten Gesundheitswirtschaft, halten vermehrt Aspekte der Profitorientierung Einzug in die Organisation und Führung von Krankenhäusern. Mit den privaten Klinikketten „Helios“, „Rhön“, „Sana“, „Asklepios“ und „Mediclin“ beteiligen sich inzwischen zahlreiche börsennotierte Unternehmen an der Krankenversorgung und streben dabei ausdrücklich jährliche Renditen im Bereich von bis zu 12% an.166 Auf diese Entwicklung hier deshalb hinzuweisen, weil sie die grundsätzlichen Unternehmensziele beeinflusst und damit potenziell auch die Ziele und Wertmaßstäbe der in ihnen Beschäftigen. 164 DKI (2010), Kolb/Missbach (2006), Klauber et al. (2007), Salfeld et al. (2009). Vgl. Homepage Deutsche Krankenhausgesellschaft, www.dkgev.de. (20.01.2012) 166 Vgl. Hompepage Helios-Konzern, www.helios-kliniken.de. (20.01.2012) 165 72 „Das Rückgrat der stationären Gesundheitsfürsorge bilden aber nach wie vor die überwiegend in öffentlicher und freigemeinnütziger Trägerschaft befindlichen Krankenhäuser der Maximalversorgung und die Universitätskliniken. Sie richten ihre Strukturen nicht primär am Profit aus, sondern an den langfristigen Versorgungsbedürfnissen der Bevölkerung. Hierzu gehört sowohl die Vorhaltung zur Behandlung von Notfällen als auch die personalund kostenintensive Ausbildung des ärztlichen und pflegerischen Nachwuchses.“167 Weiterhin stellt das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) in seinem ausführlichen Forschungsgutachten „Das erfolgreiche kommunale Krankenhaus“ zur Bedeutung kommunaler Kliniken zusammenfassend fest: „Grundsätzlich gilt, dass die stationäre Versorgung schwerer und teurer Fälle in den größeren und großen Kliniken stattfindet. Hier verfügen kommunale Krankenhäuser – abgesehen von den Universitätsklinika – über die größte Erfahrung und auch über die positivsten Kennziffern für die Patientenversorgung in Deutschland. Jede zweite Klinik dieses Typs befindet sich in kommunaler Trägerschaft. Eine kommunale Klinik in Deutschland verfügt im Durchschnitt über 342 Betten und ist damit fast um die Hälfte größer als das durchschnittliche deutsche Krankenhaus‘ (261 Betten). Die durchschnittliche Bettenzahl eines privaten Klinikbetriebes in Deutschland liegt bei 128 Betten. Acht von zehn deutschen Privatkliniken verfügen über weniger als 200 Betten.“ 168 Für die vorliegende Arbeit sind diese Strukturen und Entwicklungen insofern von Bedeutung, da kommunale Kliniken nicht nur die meisten Patienten und Fälle in Deutschland behandeln, sondern vor allem für die intensivmedizinische Behandlung der Patienten unverzichtbar sind. Das DKI stellt dazu fest: „85% aller Betten auf Intensivstationen in Deutschland befinden sich in primär nicht-gewinnorientierten Kliniken, davon fast die Hälfte in kommunalen Häusern. Nur 14,7% dieser besonders kostenaufwändigen und personalintensiven Betten stehen in privaten Kliniken.“ 169 Gerade intensivmedizinisch zu versorgende Patienten geben aber häufig Anlass zu einer Klinischen Ethikberatung und entsprechend zeitintensiver Begleitung. Vielleicht ist es daher kein Zufall, dass sich viele der institutionellen Ethikdienstleistungen an deutschen Krankenhäusern auch in Kliniken öffentlicher oder freigemeinnütziger Trägerschaft befinden und damit eines der Merkmale darstellen, an denen die öffentliche Daseinsfürsorge sichtbar wird. 167 Deutsches Krankenhausinstitut (2010), S. 9. Ebd., S. 8. 169 Ebd., S. 8. 168 73 3.4.2. Ethische Konflikte im Krankenhaus Die vorgenannten Themen und Herausforderungen können ethische Konflikte im Krankenhaus hervorbringen oder verstärken, sie sind aber von den eigentlichen Themen der Klinischen Ethikberatung ausdrücklich abzugrenzen. Während sich die Unternehmensethik etwa mit Fragen der Betriebskultur und Zusammenarbeit befasst, sind die Aufgabenfelder der Klinischen Ethikberatung deutlicher klinisch und am Patienten orientiert sowie auf die Grundlagen der Moraltheorie bezogen. Die klassischen ethischen Konflikte im Krankenhaus betreffen Fragen am Anfang des Lebens (z.B. Pränataldiagnostik, Spätabbrüche, Neonatologie), Fragen mitten im Leben in krankheitsbedingten Krisen (z.B. Amputation, Nierenversagen, Heimeinweisung) oder am Ende des Lebens (z.B. Beatmung, PEG-Ernährung, Patientenverfügung). Diese Themen, insbesondere die Fragen am Anfang und Ende des Lebens, provozieren in den meisten Ethikberatungen den Großteil der Anfragen. Je nach Krankenhaus und Fachabteilung kann es spezifische Schwerpunkte geben, beispielsweise im Fach Geburtshilfe oder Neonatologie. Für eine dauerhafte Akzeptanz der Ethikberatung im Krankenhaus ist es erforderlich, Themen und Grenzen der Beratung klar zu definieren und sie nicht instrumentalisieren zu lassen. Viele denkbare Konflikte, auch ausgelöst durch die oben geschilderten Rahmenbedingungen, können sich auf den Stationsalltag und konkrete Einzelfälle auswirken, sollten methodisch aber hinterfragt und ggf. getrennt werden. Ansonsten kann die Ethikberatung in die zweifelhafte Situation geraten, organisatorische oder ökonomische Aspekte bzw. Fragen der Führung zu bearbeiten, die eigentlich zur Verantwortung anderer Akteure gehören. Gerade Team- und Führungsfragen werden oft mit Themen der Ethikberatung vermischt, was die Unzufriedenheit der Beteiligten eher vergrößert als Lösungen herbeiführt. Für Auftraggeber wie Auftragnehmer ist es daher wichtig, mittels einer genauen Auftragsklärung das eigentliche Thema eindeutig zu identifizieren. Täglich werden im Krankenhaus in den genannten Konfliktfeldern schwierige Entscheidungen getroffen. Manchmal sind es Entscheidungen im Einvernehmen aller Beteiligten, manchmal spalten sie auch die Gruppe der Beteiligten, führen zu gegenseitigem Unverständnis zwischen Ärzten und Pflegenden oder zwischen dem Behandlungsteam und den Patienten und Angehörigen. Nicht selten sind aber auch Patienten und Angehörige in wesentlichen Grundfragen nicht einer Meinung. 170 170 Ley (2005). 74 Klinische Ethikberatung bedeutet in diesen Fällen die praktische Anwendung der Ethik als einer Disziplin, mit deren Hilfe sich moralische Konflikte analysieren und klären lassen. Als Teilgebiet der Philosophie befasst sich die Ethik mit den Fragen der Moral. Sie orientiert sich an denen in einer Gesellschaft geltenden Normen und Werten, etwa den geltenden Maßstäben für soziales Verhalten. „Die Ethik“, so die Medizinethiker Alfred Simon und Gerald Neitzke, „beginnt im Grunde dort, wo moralische Normen nicht mehr fraglos hingenommen werden, sondern nach rationalen Begründungen für menschliches Handeln gesucht wird.“ 171 Dann wende die Ethik bestimmte Diskurstechniken an, in deren Verlauf sie „zu rationalen und einvernehmlichen Lösungen“ zu kommen suche. Angesichts der Methoden oder Prinzipien der allgemeinen Ethik, so die beiden Klinischen Ethiker, ließen sich für eine solchermaßen normative Ethik zwei Theorien unterscheiden, die moralische Normen auf diametral unterschiedlichem Wege begründeten, und die beide in den entsprechenden Diskursen wichtig seien: die teleologischen und die deontologischen Theorien. „Teleologische Theorien beurteilen eine Handlung nach dem Ziel, das der Handelnde verfolgt, bzw. nach den Folgen, die für diese Handlung zu erwarten sind. Deontologische Theorien wiederum leiten konkrete moralische Normen aus bestimmten grundlegenden Pflichten oder Werten ab.“172 Zu den teleologischen Theorien gehörten etwa utilitaristische Moraltheorien, welche den moralischen Wert einer Handlung in den außermoralischen Werten begründen, die durch die Handlung geschaffen werden: etwa dem Glück und Wohlstand oder der Gesundheit. Die deontologischen Theorien begründeten dagegen eine Handlung immer mit grundlegenden Prinzipien und würden sie aus diesen ableiten. Es werden nicht die Folgen von Handlungen beurteilt, sondern von bestehenden Regeln und Prinzipien. Die Folgen sind damit zwar relevant, aber nicht Ausgangspunkt der Beurteilung. In diesem Sinne hat sich die Klinische Ethik als ein Gebiet etabliert, das nicht eigene moralische Theorien entwickelt, sondern die Methoden und Prinzipien der allgemeinen Ethik auf den Bereich klinischer Fragestellungen anwendet – für das Fach der Nierenheilkunde etwa so: Soll bei einem Schwerstkranken noch eine Dialyse begonnen werden? Kann dem Wunsch eines Patienten entsprochen werden, der sich trotz guter Prognose nicht dialysieren lassen möchte? 171 172 Simon, Neitzke (2008), S. 29. Ebd., S. 30. 75 3.5. Zusammenfassung des Kapitels Die Historische Entwicklung der Klinischen Ethikberatung zeigt, wie sich diese „Dienstleistung“ ausgehend von den USA und im Zuge der rasanten Fortschritte der Medizin im Verlauf von vierzig Jahren entwickelt hat und auch in Deutschland an inzwischen 300 – 400 Krankenhäusern etabliert sein dürfte. Dabei begleitet diese Entwicklung von Anfang an die kontroverse Diskussion um Zusammensetzung und Befugnisse entsprechender Komitees und Gremien. In Deutschland haben die beiden konfessionellen Krankenhausverbände 1997 mit einem Bericht zum „Ethik-Komitee im Krankenhaus“ die hiesige Entwicklung angestoßen, dem zunächst vor allem konfessionelle Kliniken folgten. Langsam stieg die Zahl der aktiven Ethik-Komitees und Ethikberatungen an. Seit 2006 wirbt auch die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer für eine solche Einrichtung. Da sich in Deutschland eine Vielfalt von Beratungsformen entwickelt hat, wird die Unterscheidung in Experten-, Delegations-, Prozess- und offene Modelle dargestellt, wobei meist eine der Varianten des Prozessmodells genutzt wird, etwa die Beratung im gesamten Ethik-Komitee, die Konsultation mit einem Ethik-Team oder der einzelne Ethikberater. Die wissenschaftliche Diskussion zeigt, dass insbesondere der Zugang zur Ethikberatung, die Qualifizierung der Beratenden, der Ablauf des Beratungsprozesses, seine Dokumentation und Evaluation zu den wichtigsten Voraussetzungen einer erfolgreichen Beratung zählen. Für den Gesprächsverlauf haben sich verschiedene Modelle etabliert, so der „Bochumer Fragebogen“, die „Nijmwegener Methode“ oder der „Basler Leitfaden“. Sie variieren jeweils den Verlauf von Benennen des ethischen Problems, Zusammentragen diverser Aspekte, Diskussion und Bewertung sowie Beschlussfassung. Für die Dokumentation einer Ethikberatung hat eine Arbeitsgruppe der Akademie für Ethik in der Medizin 2010 eigens eine Empfehlung herausgegeben. Zur Evaluation Klinischer Ethikberatung gibt es bis heute auch international nur wenige größere Studien, wenngleich dies angesichts der Ausbreitung dringend erforderlich wäre. Für die übergeordnete Einschätzung ist es wichtig zu wissen, dass sich die Klinische Ethikberatung in einer Zeit entwickelt, in der die Krankenhäuser durch die Einführung der diagnosebezogenen Fallpauschalen vor allem zu einer Entwicklung gezwungen sind: in immer weniger Betten in immer kürzerer Zeit immer mehr Patienten zu behandeln. 76 4. Rahmenbedingungen am Klinikum Nürnberg 4.1. Allgemeine Rahmenbedingungen des Klinikums 4.1.1. Strukturen und Entwicklung Mit seiner mehr als 100jährigen Geschichte173 – gegründet 1894 – firmiert das ehemals „Städtische Krankenhaus“ seit 1998 als selbstständiges Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg und damit als hundertprozentige Tochter der Stadt Nürnberg. Als Krankenhaus der Maximalversorgung betreut das Klinikum mit seinen ca. 5.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 36 Fachkliniken und Instituten mit insgesamt 2.200 Betten an den beiden Standorten im Norden und Süden der Stadt jährlich über 90.000 Patienten voll- und teilstationär sowie weitere ca. 90.000 Patienten ambulant. Das Klinikum Nürnberg ist heute allein mit den über 2.000 Pflegekräften, 900 Ärzten und knapp 400 Auszubildenden nicht nur einer der größten Arbeitgeber und Ausbildungsanbieter in der Region, sondern auch eines der größten kommunalen Krankenhäuser Europas.174 Angesichts der allgemeinen demografischen und epidemiologischen Entwicklung ist auch das Klinikum Nürnberg in Bezug auf sein Leistungsangebot sowie seine Organisation einem kontinuierlichen Veränderungsprozess unterworfen. Um gegenüber den Patientinnen und Patienten seine umfassende Kompetenz als Krankenhaus der maximalen Leistungsstufe effektiv und effizient zu bündeln, baut das Klinikum kontinuierlich eigene Netzwerke für bestimmte häufige Krankheitsbilder auf. Damit sollen Früherkennung, Behandlung und Nachsorge optimiert und eine enge Kooperation zwischen dem ambulanten und stationären Bereich gewährleistet werden. 175 Mit diesem Ziel entstanden im vergangenen Jahrzehnt neben sieben Tageskliniken insgesamt 18 interdisziplinäre Zentren: ein Brustzentrum, Darmzentrum, Kontinenzzentrum, Lungentumorzentrum, Perinatalzentrum, Prostatazentrum, Schilddrüsenzentrum, Schlafmedizinisches Zentrum sowie u.a. die Zentren für Schwerbrandverletzte, Altersmedizin, Kraniofaciale und Spaltanomalien, Operative Kurzeingriffe oder Plastisch-rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie. 173 Windsheimer (1997). Klinikum Nürnberg (2009). Vgl. auch www.klinikum-nuernberg.de. (14.12.2011) 175 Maly/Estelmann (2007). 174 77 Im Zuge der gesetzlichen Veränderungen im deutschen Gesundheitswesen und insbesondere im Hinblick auf die deutlichen Veränderungen der Finanzierung von Krankenhäusern, hat sich das Klinikum Nürnberg parallel zu seiner medizinischen Weiterentwicklung auch strukturell fortentwickelt. Seit der Umwandlung in ein Kommunalunternehmen hat das Klinikum eine Konzernstruktur entwickelt, in der es eine Reihe eigener Tochterunternehmen führt: die Klinikum Nürnberg Service GmbH (KNSG), die Klinikum Nürnberg GmbH (KNG), das Ambulante Reha Zentrum (ARZ) sowie die Kliniken Nürnberger Land GmbH. Mit dem Kauf der Krankenhäuser in Altdorf, Hersbruck und Lauf legte das Klinikum einen Grundstein für die Sicherung der wohnortnahen akutstationären Grundversorgung in Stadt und Land sowie auf für die Wettbewerbsfähigkeit der fünf Krankenhausstandorte. Da zahlreiche Erkrankungen, die früher im Krankenhaus behandelt wurden, heute nur noch ambulant abgerechnet werden dürfen, bietet das Klinikum mittlerweile verschiedene Leistungen in seinen Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) an. Im Sinne der Patienten vermeidet dies unnötige Lücken zwischen stationärer und ambulanter Behandlung und nutzt zugleich die vorhandenen personellen und technologischen Ressourcen des eigenen Hauses. Die Zahl der ambulant behandelten Patienten steigt damit im Sinne des Gesetzgebers auch im Klinikum Nürnberg von Jahr zu Jahr deutlich an. Den größten Anteil der allein 5.800 Beschäftigten im Klinikum stellt mit 33% der Pflegedienst, gefolgt vom ärztlichen Dienst mit 17%, dem medizin-technischen Dienst mit 15% und dem Funktionsdienst, z.B. in der Anästhesie, mit 10%. Damit arbeiten drei Viertel der Klinikumsmitarbeiter in der direkten Krankenversorgung. Die Anzahl der Klinikumsmitarbeiter in den einzelnen Berufsgruppen ist in den vergangenen Jahren nahezu konstant geblieben. Gegen den bundesweiten Trend wurden im Klinikum Nürnberg nahezu keine Stellen abgebaut, im Jahr 2008 stieg die Zahl der Pflegenden im Vergleich zum Jahr 2007 sogar etwas an. Von weiteren Neueinstellungen profitierte vor allem der medizinisch-technische Dienst, aber auch die Zahl der Ärztinnen und Ärzte ist leicht angestiegen. Inzwischen muss sich das Klinikum wie viele andere Krankenhäuser auch auf einen drohenden Personalmangel sowohl im Pflegedienst als auch im ärztlichen Dienst vorbereiten und rechtzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen treffen. 176 176 Klinikum Nürnberg (2009), S. 7. Vgl. auch www.klinikum-nuernberg.de (14.12.2011) 78 Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist das Klinikum Nürnberg bis heute eine der größten Ausbildungsstätten in der Metropolregion. Seit 1920 werden Jahr für Jahr mehrere hundert Pflegende ausgebildet, das Centrum für Pflegeberufe gilt seit vielen Jahren als eines der größten Ausbildungszentren in Deutschland. Großen Wert legt das Klinikum auch auf die Fort- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Das klinikumseigene Centrum für Kommunikation Information Bildung (cekib) hat sich seit 2001 zu einem überregional und bundesweit tätigen Bildungsanbieter für Gesundheitsberufe entwickelt und für den gesamten deutschsprachigen Raum ein umfangreiches Angebot an Fernlehrgängen entwickelt, nicht zuletzt den Fernlehrgang „Ethikberater/in Gesundheitswesen“ in Kooperation mit der Akademie für Ethik in der Medizin in Göttingen und dem Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität Erlangen-Nürnberg. In Zusammenarbeit mit der Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg ist das Klinikum Nürnberg auch Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät in Erlangen und darüber hinaus mit Universität wie Fakultät in verschiedenen Forschungsvorhaben und anderen Aktivitäten verbunden (z.B. im Transplantationszentrum Erlangen-Nürnberg). Zudem sind zwei der Nürnberger Chefärzte zugleich Lehrstuhlinhaber für Innere Medizin 2 (Geriatrie) und Innere Medizin 4 (Nephrologie) an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. 4.1.2. Vergütung und Leistungszahlen Die Einführung des Fallpauschalensystems (DRG-System) zur Abrechnung von Krankenhausleistungen hat wie beschrieben seit 2003 gravierende Folgen für die Organisation, Abrechnung und letztlich auch die Leistungsentwicklung in Krankenhäusern und damit auch im Klinikum Nürnberg. Mit dem Ziel bestmöglicher Diagnostik, Therapie und Pflege verbindet sich zunehmend – und vom Gesetzgeber so gewollt – das Ziel optimierter interner Aufbau- und Ablaufstrukturen, um die Patienten in möglichst kurzer Zeit in den kostenintensiven stationären Strukturen versorgen zu können. Die durchschnittliche Verweildauer ist dabei zum Gradmesser für die Qualität der klinikinternen Prozesse geworden. Sie ist eines der wesentlichen Kriterien für die Vergütung der erbrachten stationären Leistungen und damit für die wirtschaftliche Existenzfähigkeit eines Krankenhauses. 79 Kann ein Patient in der sogenannten „mittleren Verweildauer“ entlassen werden, erzielt das Krankenhaus den größtmöglichen Erlös; bei längerer oder kürzerer Verweildauer ist dagegen mit Auf- oder Abschlägen zu rechnen. Damit rechnen sich gute Strukturen und Prozesse, organisatorische Friktionen kosten dagegen das Krankenhaus viel Geld. Denn was sich auf den einzelnen Patienten bezogen als geringer Betrag darstellt, summiert sich pro Jahr für eine Fachabteilung bzw. das gesamte Krankenhaus schnell auf sechs- oder siebenstellige Beträge. Im Klinikum Nürnberg ist, wie in den meisten anderen deutschen Krankenhäusern, die durchschnittliche Verweildauer in den vergangenen Jahren daher nochmals deutlich gesunken. Innerhalb von nur fünf Jahren sank zwischen 2006 und 2011 die Verweildauer von 7.2 auf 6.8 Tage, eine Verkürzung um 0.4 Tage. Verglichen mit der durchschnittlichen Verweildauer von 12 Tagen im Jahr 1995 nähert sich das Klinikum allmählich einer Halbierung der durchschnittlichen Verweildauer innerhalb von zwanzig Jahren, ein nur vermeintlich langer Zeitraum. Im Hinblick auf das Thema dieser Arbeit, ist auch die Schwere der im Klinikum behandelten Erkrankungen von Interesse. Während die Patienten des Klinikums nicht nur zügiger versorgt werden müssen, werden sie nämlich tendenziell auch kränker. Die Verteilung der Schweregrade auf die Anzahl der behandelten Patienten belegt dies. Der „Patient Clinical Complexity Level“ (PCCL) zeigt den Gesamtschweregrad eines Krankenhausfalles. Dabei gilt die Regel: Je höher der Schweregrad, desto höher der PCCL. Im Jahr 2008 etwa fallen rund 36% der Patienten des Klinikums Nürnberg durch die Art ihrer Erkrankung sowie der Nebenerkrankungen in die beiden höchsten Schweregrade PCCL 3 und PCCL 4.177 Auch ein Vergleich der Altersstruktur der Patienten belegt, dass im Klinikum Nürnberg, wie in vielen anderen kommunalen Häusern, durchschnittlich ältere Patienten behandelt werden als in konfessionellen oder privaten Kliniken. Damit unterscheidet sich das Patientenkollektiv im Klinikum Nürnberg deutlich von dem anderer Krankenhäuser – auch in der Region. Dies begründet nicht zuletzt den wachsenden Bedarf an einem kompetenten Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Patienten – einer der wichtigsten Zielgruppen für die hier untersuchte Klinische Ethikberatung in der Medizinischen Klinik 4 am Klinikum Nürnberg. Aber nicht nur der Schweregrad der Patienten verändert sich über die Jahre und steigt an. Auch die Zahl der Patienten steigt kontinuierlich. 177 Klinikum Nürnberg (2009), S. 9. Vgl. auch www.klinikum-nuernberg.de (14.12.2011) 80 Während die Patienten zügiger versorgt werden müssen und kränker werden, steigt auch die Zahl der Patienten von Jahr zu Jahr an. Allein im Zeitraum von 2008 bis 2011 stieg die Zahl der DRG-Fälle im Klinikum Nürnberg um über 6.000 Fälle an. Grafik 2: Entwicklung von DRG-Fallzahlen und Vollkräfte Ärzte (2008 – 2010) AD VK (ohne Psychiatrie) DRG Fallzahl Fälle pro VK pro Monat 2008 2009 2010 786 806 814 HR 2011 (Jan – Ok) 849 82.656 85.710 87.715 88.854 105,1 106,3 107,7 104,7 Tabelle 8: Entwicklung DRG-Fallzahlen, VK Ärzte, VK/Monat (2008 – 2010) Zusammenfassend lässt sich feststellen: Steigende Fallzahlen, sinkende Verweildauern und erhöhte Schweregrade prägen heute den Alltag vieler Ärzte und Pflegekräfte im Klinikum Nürnberg wie in anderen Krankenhäusern der Maximalversorgung auch. Im Klinikum Nürnberg ist diese Entwicklung allerdings mit einem bemerkenswerten Personalaufbau verbunden. Von 1986 bis 2011 ist die Zahl der Ärzte um 90% und der Pflegenden um 15% gestiegen. 178 Letztere Entwicklung läuft dem Bundestrend diametral entgegen, wo der Pflegedienst im selben Zeitraum um 15% reduziert wurde. 178 Die Angaben zur Entwicklung von DRG-Fallzahlen und Vollkräften stammen von H. Röttenbacher, Zentrales Controlling, Klinikum Nürnberg, 2011. 81 4.2. Spezifische Rahmenbedingungen der Ethikberatung 4.2.1. Ethikprojekt als Organisationsentwicklung Die im Folgenden beschriebenen ersten Aktivitäten zur Unternehmensethik und klinischen Ethik am Klinikum entstanden lange vor der oben skizzierten Dynamik durch die Einführung des DRG-Systems. Fallzahlsteigerung, Verweildauer, PCCL oder Casemix waren noch kein gebräuchliches Alltagsvokabular, als sich die Leitung des Klinikums 1998 entschloss, ein eigenes Ethikprojekt zu initiieren, d.h. zunächst eine umfassende qualitative Mitarbeiterbefragung in Auftrag zu geben. Die Ergebnisse der Befragung begründeten in den Folgejahren eine Reihe von Maßnahmen und Initiativen, mit denen das Klinikum die Debatte moralischer Fragen und damit auch die ethische Kompetenz seiner Mitarbeiter systematisch fördern wollte. Von Anfang an war damit eine Initiative gemeint, „die nicht nur die klassischen Fragen der Medizin- und Pflegeethik betraf, sondern auch Aspekte der Unternehmenskultur wie Führung, Kommunikation und Transparenz.“ 179 Ein erster Meilenstein war 1999 die Entwicklung eines Ethik-Codes180 für das Klinikum, der die Würde des Patienten und seine stets individuelle Situation in den Mittelpunkt stellte und zum Maßstab des Handelns machte. Vor dem Hintergrund der historischen Bedeutung Nürnbergs in der Medizingeschichte verweist der Ethik-Code auf den Nürnberger Kodex von 1947 mit seinem ersten und prägenden Prinzip des „informed consent“; dem Prinzip, dem auch in dieser Arbeit eine besondere Bedeutung zukommt, da es eines der Kernprinzipien der Ethikberatung und der von ihr geförderten gemeinsamen Entscheidungsfindung darstellt. Der Ethik-Code, so heißt es in seiner Präambel, wurde im Klinikum in einem „offenen Diskussionsprozess“ erarbeitet. Seine ethischen Grundsätze stellten keine endgültigen Festlegungen dar, sondern blieben einer „lebendigen Überprüfung und Weiterentwicklung“ unterworfen. Damit stelle der Code eine Art „öffentliche Selbstverpflichtung“ dar und schaffe verbindliche Grundlagen aller Handlungen und Entscheidungsprozesse im Arbeitalltag. Ergänzt werde der Ethik-Code durch einen Verhaltenskodex für alle Mitarbeiter, der nicht nur den angestrebten Umgang mit Patienten und Angehörigen betreffe, sondern auch den Umgang der Beschäftigten untereinander und vor allem das Verhalten der Führungskräfte. 179 180 Erbguth et al (2007), S. 157. Wehkamp (1999) und (2001). Ethik-Code Klinikum Nürnberg – siehe Anhang unter 9.2.1. 82 Neben dem Verhaltenskodex brachten der Vorstand und die Personalvertretung des Klinikums auch eine gemeinsame Vereinbarung zur Konfliktvermeidung und Konfliktbewältigung auf den Weg, eine für Krankenhäuser bis dahin unübliche Form der Selbstverpflichtung in Fragen der Unternehmenskultur. Neben der ambitionierten Initiierung derartiger Dokumente und Leitbilder waren es vor allem die praktischen Konsequenzen und Aktivitäten des Ethikprojektes, die für den Alltag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spürbar und relevant wurden: Ethische Themen wurden fortan systematisch in die pflegerischen Fort- und Weiterbildungen (z.B. Stationsleitungslehrgänge) aufgenommen; eigene Ethikseminare für Mitarbeiter aller Berufsgruppen wurden veranstaltet, zwei berufsgruppenübergreifende Lehrgänge für Führungskräfte organisiert sowie das Angebot von Supervision, Coaching und Teamentwicklung personell verstärkt und ab 2002 als dauerhaftes internes Dienstleistungsangebot des „Centrums für Kommunikation Information Bildung“ etabliert. Ziel der Aktivitäten war es, mit dem Ethikprojekt auch die Unternehmenskultur im beschriebenen Sinne positiv zu beeinflussen. Um die bisherigen und zukünftigen Aktivitäten zur Ethik im Klinikum nachhaltig sicherzustellen und weiterzuentwickeln, berief der Klinikumsvorstand in der Folge ein klinikübergreifendes Ethikkomitee, das „Ethikforum“. Laut seiner Geschäftsordnung setzt sich das vierzehnköpfige Gremium nicht nur aus internen Mitarbeitern unterschiedlicher Hierarchien aus Medizin, Pflegedienst, Zentralen Diensten und den Servicebereichen zusammen, sondern bindet auch externe Expertise sein. So wirken eine pensionierte Richterin und ein Vorstandsmitglied der AOK-Mittelfranken seit seiner Gründung im Ethikforum des Klinikums mit. 181 Entsprechend der international üblichen Arbeitsweisen solcher Gremien, sind auch in Nürnberg die wichtigsten Aufgaben des sich vierteljährig treffenden Forums die Veranstaltung von Fort- und Weiterbildungen zu ethischen Themen, die Entwicklung klinikumseigener ethischer Empfehlungen und Richtlinien sowie die Initiierung und Begleitung ethischer Angebote, wie der Ethikberatung oder der Ethik-Cafés. Das unabhängige Forum kann darüber hinaus von Beschäftigten, Patienten und Angehörigen involviert und um die Befassung bzw. Stellungnahme zu vorgebrachten Themen gebeten werden, es wird aber auch selbst initiativ, bestimmt eine eigene Agenda und setzt entsprechende Prioritäten. 181 Klinikum Nürnberg (2007) – siehe Anhang unter 9.2.2. 83 So ist das Ethikforum z.B. von niedergelassenen Ärzten zum klinikumsinternen Umgang mit dem Thema „PEG-Magensonde“ angefragt worden, es hat die Initiativen am Klinikum zur Einrichtung und Gestaltung von Sterbezimmern unterstützt und sich gegenüber der Klinikumsleitung um eine offene Diskussion des wachsenden Spannungsfeldes zwischen Ethik, Ökonomie und Mitarbeiterzufriedenheit eingesetzt. In der Anfangszeit wurde das Ethikforum irrtümlich von Seiten verschiedener Kliniken um die Genehmigung von Studien und Forschungsvorhaben ersucht. Dies ist ausdrücklich nicht sein Aufgabengebiet, sondern Tätigkeitsbereich entsprechender Ethik-Kommissionen. Insgesamt befindet sich das Ethikforum damit in jenem inhaltlichen Rahmen, den die internationale Literatur für Klinische Ethikkomitees seit Jahren vorschlägt. Dem Grunde nach kann sich auch das Ethikforum im Klinikum Nürnberg mit sehr verschiedenen Themen befassen, sofern dabei Fragen behandelt werden, die im weitesten Sinne der klinischen Ethik zuzordnen sind. Da es bis heute keine verbindlichen Kriterien einer wissenschaftlichen Untersuchung Klinischer Ethikkomitees gibt, fehlt es an überprüfbaren Kriterien für ihre Evaluation. Letztlich müssen sich sämtliche Einrichtungen im Umfeld eines Krankenhauses – und damit auch eine solche Institution – daran messen lassen, ob und wie sie sich auf die Qualität der Krankenversorgung positiv auswirken. Geleitet wird das Ethikforum derzeit von zwei Vorsitzenden und organisiert von einer Geschäftsführung. Nach einer intensiven Aufbauphase in den ersten Jahren hat das Ethikforum wieder verstärkt seit Ende 2009 verschiedene inhaltliche Impulse gesetzt, so eine Veranstaltung zur Unternehmenskultur, die Überarbeitung interner Handlungsempfehlungen sowie zwei große öffentliche Informationsveranstaltungen zum Patientenverfügungsgesetz von 2009 und den Urteilen des Bundesgerichtshofes im Jahr 2010. Um neben der klinikspezifischen Ethikberatung in der Medizinischen Klinik 4, dem hier untersuchten Ethikkreis, auch eine klinikumsweite und zentral erreichbare Ethikberatung aufzubauen, beauftragte das Ethikforum 2003 zunächst eine Befragung von Ärzten und Pflegenden zum Thema „Patientenbetreuung und Entscheidungen am Lebensende“ durch die Medizinethikerin Stella ReiterTheil.182 An der schriftlichen Befragung nahmen Beschäftigte aus den Bereichen Intensivmedizin, Onkologie, Palliativ-medizin, Geriatrie und Neurologie teil. 182 Reiter-Theil (2003). Es handelt sich um einen internen Ergebnisbericht im Klinikum Nürnberg. 84 Im Ergebnis zeigte die Befragung über alle Abteilungen und Berufsgruppen hinweg eine Unzufriedenheit bezüglich folgender Aspekte: - - Fehlen schriftlicher hausinterner Leitlinien - - Fehlen von Ansprechpartnern - - Befürchtung von rechtlichen Konsequenzen - - Personalknappheit und Zeitmangel - - Kommunikationsschwierigkeiten der Berufsgruppen Im Hinblick auf die hier benannten Defizite entwickeln das Ethikforum und die Klinikumsleitung im Jahr 2004 in Anlehnung an die Vorschläge der Bundesärztekammer gemeinsam mit der Nürnberger Hospizakademie und der Seelsorge am Klinikum Nürnberg die „Empfehlungen zum ethischen Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden“. Nach diesen vorbereitenden Aktivitäten initiierte das Ethikforum 2004 auch die Einführung der klinikumsweiten Ethikberatung, mit der die Rahmenbedingungen und letztlich die Qualität gemeinsamer Entscheidungsfindungen in schwierigen akuten Versorgungssituationen verbessert werden soll. Mit seiner Zentralen Mobilen Ethikberatung (ZME) hat das Ethikforum für das Klinikum Nürnberg eine Ethikberatung auf den Weg gebracht, die klinikumsweit und kurzfristig, wenn nötig auch binnen weniger Stunden, stattfindet und in der speziell geschulte Mitarbeiter aus Medizin, Pflege, Seelsorge und Sozialdienst aktiv sind. Die zentralen Ethikberater sind an beiden Standorten jeweils über eine feste Telefonnummer bzw. einen bekannten Funkpiepser erreichbar. Sie können von Mitarbeitern, Patienten und Angehörigen eingeschaltet werden, klären nach Kontaktaufnahme zunächst Beratungsanlass bzw. Ausgangssituation und initiieren dann eine Ethikberatung, an der im Regelfall zwei Berater teilnehmen. Einer von beiden dokumentiert die Beratung anschließend als Ergebnisprotokoll. Sämtliche Aufgaben rund um die Ethikberatung – vom ersten Telefonkontakt, über die inhaltliche Vorbereitung der Beratung, die Moderation und Gesprächsführung bis zur Nachbereitung im Sinne des Protokolls und/oder abschließender oder weiterführender Gespräche – werden zwar in der Regel während der Kernarbeitszeit, formal aber außerhalb der Dienstzeit erbracht und eigens vergütet. Damit bestätigt das Klinikum die Bedeutung, die es diesem Engagement beimisst. 85 Die zentralen Ethikberater des Klinikums wurden entweder durch die geförderte Teilnahme am Fernlehrgang „Ethikberater/in im Gesundheitswesen“ oder durch eine mehrtätige Schulung durch die Medizinethikerin Stella Reiter-Theil von der Universität Basel für diese Aufgabe vorbereitet. Damit sind einige der Ethikberater/innen konzeptionell im Sinne des oben geschilderten Basler Modells für Ethikberatung geschult worden. In den ersten Jahren wurde die zentrale Ethikberatung pro Jahr zu etwa 10 bis 15 Fällen hinzugezogen. Bis heute ist diese Zahl leicht gestiegen und entspricht damit den Erfahrungen anderer vergleichbarer Kliniken in Deutschland, wie im sechsten Kapitel der Arbeit noch gezeigt wird. Bei jährlich über 90.000 voll- und teilstationären Patienten weist dies auf die institutionellen und womöglich auch „kulturellen Hürden“ hin, die einer breiteren Nutzung vielerorts noch im Wege stehen. Oft fehlt es bereits an der notwendigen Zeit, die Beteiligten (Mitarbeiter, Angehörige, Patienten) zu einem gemeinsamen und ungestörten Termin zusammenzubringen. Daneben erfordert es Selbstbewusstsein, Standvermögen und eine gewisse Unabhängigkeit, um als ärztliches oder pflegerisches Mitglied eines Stationsteams eine Ethikberatung im Kollegenkreis trotz der nicht seltenen Bedenken und Widerstände vorzuschlagen bzw. durchzusetzen. Und drittens bleibt die Zentrale Mobile Ethikberatung ungeachtet ihrer Informationsbroschüre und der Informationen im hauseigenen Intranet zunächst ein weitgehend anonymes Angebot, dessen Akteure in einem Krankenhaus von der Größe des Nürnberger Klinikums nur langsam bekannt werden. Dass vereinzelt Mitarbeiter aus Bereichen wie der Palliativmedizin als Ethikberater eine vergleichsweise große Nachfrage bestätigen, kann durch eine Vermengung von klassischem palliativmedizinischen Konsil und Ethikberatung bedingt sein. Im klinischen Alltag wird das „Palliativ-Konsil“, das etwas grundsätzlich anderes darstellt, nicht selten für eine Ethikberatung gehalten und auch als solche bezeichnet. Die Diskussion um das bestmögliche Modell einer Klinischen Ethikberatung wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit fortgesetzt, zumal das Modell des Ethikkreises der Medizinischen Klinik 4 in mancher Hinsicht ein Sondermodell der Klinischen Ethikberatung darstellt. Die folgende Übersicht stellt abschließend die vom Ethikforum ausgehenden Aktivitäten am Klinikum Nürnberg dar. 86 Vorstand Leitungskonferenz Ethikforum 14 interne und externe Mitglieder vom Vorstand berufen Aus Medizin, Pflege, Seelsorge, Zentralen Diensten u.a. 1. und 2. Vorsitzender Geschäftsordnung und Geschäftsführung ca. vier Treffen im Jahr bearbeitet und begleitet u.a. folgende Schwerpunktthemen ZME Ethikcafé Grundsätze Bildung Initiativen Zentrale Mobile Ethikberatung KNN/KNS Angebot für den Erfahrungsaustausch Empfehlungen z.B. zum Umgang mit Sterbenden Vorträge oder Fernlehrgang Ethikberater Sterberaum PEG Betriebsethik etc. Gemeinsame Veranstaltungen von Vorstand und Ethikforum 2010: Zwischen Ethik und Monetik 2011: Führung und Mitarbeitergespräche Abbildung 1: Übersicht der Aktivitäten des Ethikforums am Klinikum Nürnberg 87 4.2.2. Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie Da zwischen der Einrichtung der Psychosomatik als klinischem Fach und der Einführung der klinischen Ethikberatung als einzelner ethischer „Dienstleistung“ – wie eingangs erwähnt – zum Teil gewisse Parallelen bestehen, werden hier die Phase der Einrichtung der Psychosomatik und ihre Aktivitäten im Bereich der Liaisontätigkeiten beschrieben und dann die heutige Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie mit ihren Forschungsschwerpunkten dargestellt. Als eines der ersten Krankenhäuser in Deutschland richtete das damalige Städtische Krankenhaus in Nürnberg 1980 eine eigenständige psychosomatische Fachabteilung ein und berief zu deren Leitung den Psychiater Prof. Dr. Walter Pontzen. Ähnlich der Klinischen Ethikberatung, wenngleich ungleich umfassender, entstand damit am Städtischen Krankenhaus ein neues klinisches Angebot, das für viele ungewohnt und exotisch war und das mit einer jahrelangen Überzeugungs- und Aufbauarbeit verbunden war. Zehn Jahre später erinnert sich der damalige Chefarzt Pontzen in einer Publikation: „Als ich 1980 ankam, gab man mir ein ziemlich heruntergekommenes Zimmer, wie ich später erfuhr, eine Kostbarkeit in der Raumenge des Krankenhauses, einen ähnlichen Schreibtisch und die Aussicht auf eine Bettenstation. Der Verwaltungsdirektor fragt mich, ob ich Arzt sei und betrachtet mich, als ob ich in ihn hineinschauen könnte, in seine dunklen Ecken natürlich. Die meisten ärztlichen Kollegen empfingen mich nicht gerade enthusiastisch, was mich nicht wunderte. Die Medizin ist nun einmal biologisch orientiert. Das Erkennen von psychosozialen Faktoren wird häufig als eine Kunst angesehen, die man sich leicht aneignen kann, und es herrscht die Meinung vor, der Arzt benötige keine besondere psychologische Schulung, da er diese Voraussetzung mit der Berufswahl mitbringe. Ich wurde daher von meinen Kollegen nicht zur Kenntnis genommen, freundlich begrüßt und nicht mehr beachtet, mit inneren Zwiespältigkeiten und spitzen Fingern angefaßt und auch, was mich sehr freute, von einigen leitenden Ärzten, mit denen dann eine Zusammenarbeit in schöner Art und Weise möglich war, ohne wesentliche Vorbehalte begrüßt.“183 In seinem für die Implementierung neuer „inner-klinischer“ Angebote aufschlussreichen Rückblick betont der langjährige Leiter Walter Pontzen die besondere Bedeutung der Aufgeschlossenheit der jeweiligen leitenden Ärzte. Die Frage habe daher weniger gelautet, in welchen medizinischen Fachgebieten und bei welchen Krankheitsbildern eine psychosomatische Versorgung besonders wichtig und hilfreich sein könne, sondern welche Abteilung, bzw. welcher Chefarzt dafür überhaupt aufgeschlossen sei und sich eine Zusammenarbeit vorstellen könne. 183 Pontzen (1990), S. 347. 88 „Eine Konsequenz ist, dem ambulanten Bereich, dem Bereich der Konsultation und Liaison, ein Übergewicht zu geben gegenüber dem stationärpsychosomatischen Bereich. Denn mit einem im Vordergrund stehenden stationären Bereich ist eher eine Isolierung als eine Integration erreichbar. Sehr überspitzt ausgedrückt heißt das, die beste psychosomatische Abteilung ist die ohne Betten, wobei mir in der derzeitigen Situation der medizinischen Versorgung in der Institution Krankenhaus durchaus klar ist, daß eine Bettenstation eine erforderliche Erleichterung darstellt, weil eine klinische Abteilung ohne Betten im Krankenhaus wenig zählt, eine integrierte stationärpsychosomatische Behandlungsmöglichkeit im Rahmen anderer Abteilungen in der Regel nicht durchführbar ist und der Psychosomatiker seine Identität, mit deren Entwicklung er sich zwischen Organiker, Psychosomatiker und oft Psychoanalytiker sehr schwertut, im ausschließlich ambulanten Bereich nur schwer wird finden können.“184 Ohne Unterstützung in einer eigenen Abteilung, so Pontzen pointiert, sei er aber als „missionarischer Einzelkämpfer“ verloren. Wenn der langjährige Chefarzt der Nürnberger Psychosomatik davon schreibt, sein Fach wolle und könne nicht „Alibi für eine medizinisch-technische Institution“ sein, die sich einen Psychosomatiker quasi als „Hofnarren halte“, wird die Anfangszeit der Psychosomatik lebendig. Pontzen wollte daher eher einen Liaisondienst als einen Konsildienst aufbauen, da letzterer oft zu Missverständnissen und falschen Erwartungen führe. Vor diesem Hintergrund förderte die neue psychosomatische Abteilung vor allem den kontinuierlichen Aufbau eines Liaisondienstes, um „die Behandlung möglichst in der Hand des Arztes der jeweiligen Station zu belassen, aber in schwierigen Fällen die psychotherapeutische Betreuung des Patienten zu übernehmen“ und generell eine regelmäßige Fortbildung des Teams aus Ärzten und Pflegenden zu gewährleisten. Neben Psychotherapie und Fortbildung, so der Chefarzt, sollte vor allem die fachliche Beratung der behandelnden Ärzte im Vordergrund stehen, „um nach und nach neben der Organpathologie ein Verständnis für die Bedeutung der Beziehungspathologie etablieren zu können. Dafür ist nach meiner Auffassung die persönliche Präsenz des psychosomatischen Mitarbeiters, zumindest in der Halbtagstätigkeit, auf der jeweiligen Abteilung oder Station erforderlich.“185 Der Aufbau eines Liaisondienstes könne vier bis sechs Jahre dauern, schreibt Pontzen 1990. Seitdem sind 20 Jahre vergangen; eine Zeit, in der sich die Klinik für Psychosomatik im oben beschriebenen Sinne konsequent weiterentwickelt hat. 184 185 Pontzen (1990), S. 347. Ebd., S. 348. 89 Heute bietet die Klinik unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Söllner laut Qualitätsbericht eine wachsende Zahl ambulanter und stationärer Angebote: „Das Spektrum der Klinik im stationären Bereich umfasst eine Bettenstation mit 26 vollstationären und 25 tagesklinischen Plätzen, wo Patienten mit psychosomatischen Störungen und Erkrankungen über eine Zeit von 2-10 Wochen behandelt werden.“ 186 In fünf Behandlungsgruppen werden stationäre und tagesklinische Patienten mit somatoformen oder posttraumatischen Störungen, mit akuten psychischen Belastungen und Krisen, mit burnout-Syndrom oder als ältere Patienten mit psychischen und psychosomatischen Problemen behandelt. Daneben wirkt die Klinik bei verschiedenen tagesklinischen Zentren mit: so der interdisziplinären Schmerztagesklinik oder der geriatrischen Tagesklinik. In der Selbstbeschreibung der Klinik im Internet heißt es weiter: „Neben dem stationären Bereich spielt die Zusammenarbeit mit und in anderen Abteilungen des Klinikums Nürnberg im Rahmen eines ausgedehnten Konsiliar- und Liaisondienstes eine wichtige Rolle und ist eine wesentliche Aufgabe Mitarbeiter unserer Klinik. Dabei können Patientinnen und Patienten anderer Abteilungen neben der erforderlichen körperlichen Diagnostik und Therapie ihrer Erkrankung psychotherapeutisch durch Mitarbeiter der Klinik begleitet werden. Es handelt sich vor allem um Patientinnen und Patienten mit somato-psychischen Erkrankungen bzw. Anpassungsstörungen, bei denen nach einer einschneidenden Lebensveränderung, nach einem belastenden Lebensereignis oder nach einer schweren körperlichen Erkrankung psychosoziale Funktionen und Leistungen behindert sind oder eine schwere Belastung zu einem Selbstmordversuch geführt hat.“187 Die psychotherapeutische Behandlung durch die Klinik für Psychosomatik dient daher der Behandlung der seelischen Störung und fördert ihre Bewältigung. Aus diesem Grund ist der psychosomatische Konsiliar- und Liaisondienst auch in die Behandlungen von onkologischen Zentren, Schmerzzentrum und Palliativstation integriert.188 Vom psychosomatischen Konsiliar- und Liaisondienst im Klinikum Nürnberg werden so jährlich über 4.500 Patientinnen und Patienten mitbehandelt. 189 186 Von den 26 Betten sind 18 in einem eigenen Gebäude untergebracht und 8 in eine internistischonkologische Station integriert. Diese integrierten psychosomatisch-internistischen Betten stellen das Bindeglied zwischen dem Konsil-Liaisondiest und der stationären Psychosomatik dar und setzen den Gedanken einer integrierten Psychosomatik in einem weiteren Schritt in der Praxis um. 187 Siehe unter www.klinikum-nuernberg.de (20.01.2012) 188 Vgl. auch Söllner/Stein (2011). 189 Siehe Qualitätsbericht Klinikum Nürnberg (2010) und unter www.klinikum-nuernberg.de. 90 Neben der Krankenversorgung und den abteilungsbezogenen Fortbildungen im Rahmen des Konsiliar- und Liaisondienstes betreibt die Klinik für Psychosomatik eine Reihe von Forschungsvorhaben, von denen hier die Arbeiten zur Förderung der kommunikativen Kompetenz von Ärzten näher vorgestellt werden. Die Arbeiten, so Wolfgang Söllner, knüpften an Belegen an, wonach Krankenhausärzte häufig nicht in der Lage seien, psychische Belastungen und Störungen ihrer Patienten frühzeitig zu erkennen und dass sie Schwierigkeiten damit hätten, Probleme in der Kommunikation mit ihren Patienten und deren Angehörigen selbst wahrzunehmen. Wenn so die Kommunikation zwischen Arzt und Patient im Alltag misslinge, könne dies negative Auswirkungen in mehrerer Hinsicht haben: Die Arzt-Patienten-Beziehung als solche verschlechterte sich, die Zufriedenheit und Compliance des Patienten sinke und zugleich steige die Arbeitsunzufriedenheit des Arztes. Demgegenüber zeigten einige Studien,190 dass und wie eine Verbesserung der ärztlichen Gesprächsführung trainiert und erreicht werden könne. Wolfgang Söllner und Kollegen fassen diese wie folgt zusammen: „Ihre Ergebnisse legen nahe, einen patientenzentrierten, nichtdirektiven Kommunikationsstil zu entwickeln, der den Patienten zu einem Partner im Behandlungsgeschehen macht, seine aktive Mitarbeit an der Behandlung fördert und sowohl dem Arzt wie auch dem Patienten ein Gefühl der Kontrolle über die Behandlung vermittelt.“ 191 Für einen solchen Kommunikationsstil, der an den Konzepten der partizipativen Entscheidungen anknüpft, sollte das Medizinstudium die angehenden Ärztinnen und Ärzte möglichst früh sensibilisieren und vorbereiten. Das eigentliche Training, so die Auffassung der Nürnberger Psychosomatiker, könne aber erst während der praktischen klinischen Tätigkeit mit ihren konkreten Alltagserfahrungen nachhaltig wirksam werden. Deshalb haben die Nürnberger in Anlehnung an bestehende Trainingskonzepte an den Universitätskliniken in Basel, Maastricht und Innsbruck seit 2003 ein „Nürnberger Modell“ entwickelt, dass bei einer Kursgröße von zehn bis zwölf Teilnehmenden insgesamt 30 Unterrichtsstunden an zwei ganzen und zwei halben Tagen innerhalb eines Monats umfasst, von zwei erfahrenen Liaison-Praktikern betreut wird und sich in zwei Trainingsphasen über ca. vier Monate erstreckt. Der Kurs verfolgt das Ziel, Ärztinnen und Ärzte besser in die Lage zu versetzen, 190 Maguire (1999), Fallowfield (2003) (2004), Razavi (2003), Kiss/Söllner (2006), Langewitz (2006), Wulsin (2006). 191 Söllner et al. (2007), S. 145. 91 „eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung herzustellen; neben den somatischen auch die psychosozialen Aspekte des Menschen zu erfassen; die subjektive Perspektive und das emotionale Befinden des Patienten zu erkunden und zu beachten; nach emotional belastenden konfliktreichen Gesprächen die Handlungsfähigkeit als Arzt nicht zu verlieren; Patienten über seine Erkrankungen und die Behandlung besser zu informieren; gemeinsam mit dem Patienten Entscheidungen bezüglich der Behandlung abzuwägen und zu finden; das Vertrauen in die eigene kommunikative Kompetenz im Gespräch mit dem Patienten zu erhöhen; die aus mangelhafter Kommunikation resultierenden Belastungen für den Patienten, die Angehörigen und den Arzt verringern.192 Um den Kurs und das Erreichen dieser Ziele besser einschätzen zu können, erfolgt zu jedem Seminar eine systematische Evaluation mit einer Selbsteinschätzung des Lernerfolges und einer Beurteilung der Unterrichtsmethoden. Eine erste Auswertung von acht der 20 seit 2004 stattgefundenen Kurse bzw. von 78 der 122 teilgenommenen Ärzten zeigt: „Vor dem Seminar fühlten sich 21% der Teilnehmer sicher im Umgang mit ihren subjektiv „schwierigen“ Patienten; 37% häufig unsicher oder sehr unsicher und bei den übrigen 42% hielten sich Sicherheit und Unsicherheit die Waage.“ 193 Nach dem Kurs fühlten sich die Teilnehmer „in allen erhobenen Bereichen der kommunikativen Kompetenzen“ sicherer. „Dieser Effekt hielt bis zum Follow-up-Zeitpunkt nach drei Monaten nicht nur an, sondern verstärkte sich noch. 94% der Teilnehmer konstatierten am Ende des Kurses und 70% noch nach drei Monaten einen ‚sehr großen‘ oder ‚großen‘ Lernzuwachs. Video-Analysen wurden am Kursende von 94% und Rollenspiele von 91% der Teilnehmer als ‚hilfreich‘ oder ‚sehr hilfreich‘ empfunden.“194 Die Klinik für Psychosomatische Medizin leistet mit diesen Kursen einen wichtigen Beitrag bei der Förderung der kommunikativen Kompetenz der Krankenhausärzte und verstärkt damit die eingangs geschilderte ganzheitliche biopsycho-soziale Sichtweise der Medizin. Ein solches Angebot, so Wolfgang Söllner, wird gerade dann gut aufgenommen, wenn die Kursleiter den Ärzten aus der regelmäßigen Kooperation bekannt seien, d.h. „idealerweise können Mitarbeiter eines psychosomatischen Liaisondienstes diese Aufgabe übernehmen.“ Gerade diese Verschränkung einer Zusammenarbeit im Stationsalltag und in der Schulung ist auch für die weitere Implementierung von Ethikberatungen hilfreich. 192 Söllner et al (2007), S. 149. Ebd. (2007), S. 152. 194 Ebd. (2007), S. 154. 193 92 4.2.3. Medizinische Klinik 4 für Nieren- und Hochdruckerkrankungen Der hier untersuchte Ethikkreis ist in der Medizinischen Klinik 4 im Klinikum Nürnberg beheimatet. In der Klinik werden grundsätzlich alle internistischen Erkrankungen behandelt, der Schwerpunkt liegt allerdings auf dem Gebiet der Nephrologie und Hypertensiologie, d.h. unter anderem der Diagnostik und Therapie aller Nieren- und Hochdruckerkrankungen, der intensivmedizinischen Therapie von akutem Nierenversagen und Multiorganversagen, der Dialyse (Nierenersatztherapie) sowie der Vorbereitung zur Organtransplantation und Behandlung nach Organverpflanzung- und übertragung. Zu den Schwerpunkten zählen auch die Behandlung und Betreuung von Patienten mit Diabetes mellitus, die Ernährungsmedizin oder die Kreislaufdiagnostik Die Medizinische Klinik 4 zählt zu den größten nephrologischen Abteilungen in Deutschland. Für das genannte Aufgabenspektrum verfügt die Klinik zur Zeit der Untersuchung über 124 Betten, eine zusätzliche Dialysestation mit 24 Plätzen und eine Intensivstation mit 14 Beatmungsplätzen. Pro Jahr werden mehr als 5.000 Patienten behandelt und über 10.000 Hämodialysen durchgeführt. Die durchschnittliche Verweildauer lag im Jahr 2009 bei 6,7 Tagen. Sowohl die Fallzahlen der Klinik als auch der Casemix steigen seit Jahren kontinuierlich an. Dieser beschreibt die durchschnittliche Schwere der Patientenfälle. Die folgenden Angaben entsprechen der Darstellung der Klinik im Qualitätsbericht und im Internet: „Seit über 40 Jahren wird in der Klinik die Nierenersatztherapie durchgeführt. Die Klinik hatte für den Aufbau einer adäquaten Dialyseversorgung im nordbayerischen Raum eine wesentliche Pionierfunktion, sowohl für die Patienten mit akutem Nierenversagen als auch mit einer chronischen Nierenerkrankung. Für Patienten, die noch keine Dialysebehandlung benötigen, ist die Prävention, das heißt das Aufhalten des Fortschreitens der Nierenerkrankung das wichtigste Ziel. In diesen Fällen soll der Beginn einer Nierenersatztherapie so weit wie möglich hinausgezögert oder im besten Fall verhindert werden. Gelingt dies nicht, werden den Patienten im Bereich der Dialyse alle heute gängigen Behandlungsverfahren angeboten. Dazu werden die Patienten in der therapiebegleitenden Dialyseberatung möglichst rechtzeitig vor dem Eintritt der Dialysepflichtigkeit über alle für sie in Frage kommenden Nierenersatzverfahren informiert und beraten. Die Medizinische Klinik 4 bietet dabei sowohl die verschiedenen Verfahren der Hämodialyse als auch der Peritonealdialyse an.“195 195 Klinikum Nürnberg (2010), vgl. auch www.klinikum-nuernberg.de. (05.11.2011) 93 Die Hämodialyse umfasst folgendes Leistungsprofil:196 Chronische Hämodialyse o Hämodialyse (HD) o Hömofiltration (HF) Auffangdialyse o Für ambulante oder stationäre Dialysepatienten mit besonderen Problemen Plasmaseparation und Immunadsorption o Bei immunologisch bedingten Erkrankungen Lipidapharese o Bei Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie Entgiftungsverfahren und Hämoperfusion Die Peritonealdialyse umfasst dieses Leistungsprofil: Kontinuierliche ambulante Perionealdialyse (CAPD) Kontinuierliche zyklische Peritonealdialyse (CCPD) Intermittierende Peritonealdialyse (IPD) o Training der genannten Verfahren nach Katheter -implantation sowie Vor- und Nachschulung Seit der Etablierung der CAPD, der sogenannten Bauchfelldialyse, im Jahre 1989 sind ständig etwa 45 Patienten in Betreuung. Die Dialysen der Medizinischen Klinik 4 beschränken sich also nicht auf die klassischen Verfahren der Hämodialyse. Das Angebot der Klinik bedingt letztlich ein oft multimorbides Krankenkollektiv, das mit schwerwiegenden Diagnosen und damit auch mit schwerwiegenden Entscheidungssituationen konfrontiert ist. Insofern verwundert es nicht, dass in dieser Klinik die Dialyseberatung zum Ausgangspunkt der späteren Klinischen Ethikberatung der Medizinischen Klinik 4, dem sogenannten Ethikkreis wurde. Hier wirkten mehrere Faktoren positiv zusammen: Die Offenheit der ärztlichen und pflegerischen Klinikleitung, das Interesse und Engagement einzelner Kollegen aus Medizin, Pflege und Seelsorge sowie nicht zuletzt die gute Zusammenarbeit mit der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie. 196 Klinikum Nürnberg (2010), vgl. auch www.klinikum-nuernberg.de. (05.11.2011) 94 4.3. Zusammenfassung Als Krankenhaus der maximalen Versorgungsstufe mit allen Fächern der Medizin erfährt auch das Klinikum Nürnberg den von Jahr zu Jahr wachsenden Leistungsdruck auf die großen Krankenhäuser. Steigende Fallzahlen, sinkende Verweildauern und erhöhte Schweregrade der Krankheiten prägen den Alltag vieler Ärzte und Pflegende am kommunalen Großklinikum. Die Rahmenbedingungen im Klinikum Nürnberg für die Etablierung einer Klinischen Ethikberatung waren vergleichsweise gut. Die Verantwortlichen standen dem Thema Ethik von Anfang an aufgeschlossen gegenüber und haben schon 1998 innerhalb des Klinikums ein umfassendes Ethikprojekt angeregt, aus dem viele Aktivitäten hervorgingen, u.a. eine Mitarbeiterbefragung, ein EthikCode, regelmäßige Ethik-Fortbildungen, ein Fernlehrgang Ethikberater sowie ein regelmäßiges Ethik-Cafe als Diskussionsforum für die Beschäftigen. Auslöser einiger dieser Aktivitäten war 2003 eine interne Befragung zum Thema „Patientenbetreuung und Entscheidungen am Lebensende“, die u.a. das Fehlen schriftlicher Leitlinien und Ansprechpartner, rechtliche Unsicherheiten und Kommunikationsprobleme der Berufsgruppen zeigte. 2004 wurde daher eine Zentrale Mobile Ethikberatung etabliert, die an beiden Standorten – Klinikum Nord und Südklinikum – über eine zentrale Vermittlung angerufen und aktiviert werden kann. Initiiert und begleitet werden viele dieser Aktivitäten vom Ethikforum, dem 14 Mitglieder verschiedener Berufsgruppen und Hierarchieebenen angehören und das einmal pro Quartal zusammenkommt. Im Klinikum Nürnberg ist in einem gewissen Sinne die Klinik für Psychosomatik für die Klinische Ethikberatung interessant: bei der Etablierung des Faches bzw. der Dienstleistung bestehen teilweise Parallelen – der Liaisondienst kann als strukturelles Vorbild für die Ethikberatung dienen; die hiesige Psychosomatik fördert und erforscht in eigenen Seminaren einen patientenzentrierten, nichtdirektiven Kommunikationsstil und eine Mitarbeiterin der Psychosomatik war beim Ethikkreis der 4. Medizinischen Klinik von Anfang an dabei. Die Medizinische Klinik 4 ist eine der größten Kliniken für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, u.a. mit der gesamten Bandbreite der Intensivmedizin und Nierenersatztherapie. Sie bietet mit den damit verbundenen schwierigen Entscheidungen über Einleitung oder Beendigung einer Nierenersatztherapie den passenden Ort für die Initiative zu einer Ethikberatung, dem „Ethikkreis“. 95 5. Mitarbeiterbefragung zur Klinischen Ethik in der Medizinischen Klinik 4 Seit der Gründung der Ethikberatung durch den internen Ethikkreis im Jahr 1997 hat in der Medizinischen Klinik 4 keine umfassende und systematische Befragung zum Umgang mit moralischen Fragen im Berufsalltag stattgefunden. Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des Ethikkreises im Jahr 2007 und als begleitendes Element zur späteren Untersuchung der bisher stattgefundenen Ethikberatungen entstand die Idee einer Umfrage aller Mitarbeiter, deren Ergebnisse hier dargestellt werden. Die Umfrage zum Thema „Klinische Ethik“ verfolgte unterschiedliche Ziele: In Bezug auf die Mitarbeiter ging es um die: - Sensibilisierung der Mitarbeiter und Berufsgruppen für ethische Themen - Ermittlung von Belastungen durch ethische Konflikte - Kenntnis über das Kommunikationsverhalten zu ethischen Konflikten - Ermittlung der Bedürfnisse zur Unterstützung bei ethischen Konflikten - Kenntnis der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Berufsgruppen - Datengrundlage für eine Rückmeldung und Diskussion des Themas in der Klinik In Bezug auf die Beratungen des Ethikkreises und ihre Evaluation ging es um die: - Ermittlung von Übereinstimmungen und Widersprüchen zur Beratungspraxis - Kenntnis über subjektive Einschätzungen zur Nutzung des Ethikkreises - Unterstützung des Ethikkreises in der Klinik und Förderung seiner Nutzung Insgesamt sollen die Ergebnisse dieser Mitarbeiterbefragung in Korrespondenz mit der Evaluation der eigentlichen Ethikberatungen konkrete Anregungen generieren für die Weiterentwicklung von Ethikdiensten in der Medizinischen Klinik 4 und im Klinikum Nürnberg. Die Ergebnisse der Befragung wurden den Mitarbeitern der Klinik im Rahmen einer eigenen Veranstaltung vorgestellt und haben nachweislich bereits eines der genannten Ziele erreicht: eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Angebot der Ethikberatung und eine – zumindest für zwei Jahre – deutlich stärkere Nutzung. 96 5.1. Befragungskollektiv Als Ergänzung zu den genannten Rahmenbedingungen der Klinik werden hier das Befragungskollektiv beschrieben sowie die etablierten „Kommunikationswege“ der Klinik. Zum Zeitpunkt der Befragung von Mai bis Juli 2007 waren in der Medizinischen Klinik 4 insgesamt 196 Mitarbeiter beschäftigt; 144 (73%) von ihnen im Pflegedienst, 46 (23%) im ärztlichen Dienst und sechs (3%) in anderen Berufen bzw. Funktionen. 197 Im Pflegedienst waren 38 Mitarbeiter (26%) in leitender Position als Pflegedienst-, Stations-, Gruppen- oder Bereichsleitung tätig, im ärztlichen Dienst arbeiteten neun Mitarbeiter (20%) in leitender Position als Chefarzt oder Oberarzt. 198 Im Pflegedienst ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Informationsforum eine monatliche Besprechung der Stationsleitungen etabliert, im ärztlichen Dienst sind es tägliche Morgenbesprechungen und wöchentliche Fortbildungsveranstaltungen, zu denen viele Mitarbeiter zusammenkommen. In unregelmäßigen Abständen finden zusätzlich berufsgruppenspezifische bzw. -übergreifende Klausuren oder größere Besprechungen statt. In den regelmäßig stattfindenden Foren wurde auf die Ethik-Befragung hingewiesen, bevor die Fragebogen mit einem Begleitschreiben 199 in die Postfächer der Mitarbeiter bzw. auf den Stationen verteilt wurden. 5.2. Befragungsinstrument Für die vom Verfasser der Arbeit initiierte und mit dem Ethikkreis gemeinsam organisierte Befragung der Mitarbeiter der Medizinischen Klinik 4 zum Thema „Ethische Themen im Berufsalltag“ wurde ein an der Medizinischen Hochschule Hannover bereits erprobter Fragebogen zur Ethik im Klinikalltag verwendet,200 der in ausgewählten Fragen an die spezifische Situation in Nürnberg angepasst wurde.201 Der Fragebogen wurde an der MHH bereits getestet. Er enthält zehn geschlossene Fragen zu ethischen Aspekten im eigenen Arbeitsbereich sowie drei Fragen zu persönlichen Angaben. Die Fragen mit Gewichtungscharakter enthalten eine Skala von 1 bis 10. 197 Für die Auswertungen in dieser Arbeit gilt grundsätzlich, dass die angegebenen Prozentangaben z.T. gerundet sind und sich daher eine geringfügige Abweichung von der Gesamtsumme 100 ergeben kann. 198 Interne Information Klinikum Nürnberg. 199 Siehe Anhang 9.3.1. 200 Neitzke (2007). 201 Fragebogen zur Mitarbeiterbefragung 2007. Siehe Anhang 9.3.2. 97 Inhaltlich erhebt der Fragebogen sowohl die Überzeugung der Befragten hinsichtlich der Häufigkeit wie auch Intensität und Anlässe ethischer Konflikte bei den involvierten Personengruppen. Es werden die erlebte und erwünschte Relevanz ethischer Gesichtspunkte am Arbeitsplatz sowie potenzielle Ansprechpartner bzw. Ethik-Angebote ermittelt. Im Rahmen der Angaben zur Person werden Geschlecht, Altersgruppe, Berufsgruppe und die Tätigkeit in leitender Funktion erhoben. Aufgrund der zum Teil unvollständig beantworteten Fragebögen wurde jede Antwort in Bezug gesetzt zur jeweiligen Gesamtzahl der vorliegenden Antworten pro Frage. Analog zur Auswertung der Ethikberatungen erfolgte auch diese Auswertung quantitativ-deskriptiv. In den Antworten wird aufgrund der geringen Fallzahlen keine hierarchiespezifische Differenzierung vorgenommen. 5.3. Ergebnisse 5.3.1. Teilnehmer, Berufsgruppen, Leitungsfunktion Der Fragebogen zur „Ethik im Arbeitsalltag“ wurde in der Medizinischen Klinik 4 Mitte Mai 2007 an alle Mitarbeiter verteilt, was zum damaligen Zeitpunkt einer Gesamtverteilung von 196 Fragebögen entsprach. Insgesamt wurden bis Ende Juli 105 Fragebögen (54%) ausgefüllt zurückgegeben: 16% aus dem ärztlichen Bereich, 75% von Pflegenden, 3% aus anderen Berufsgruppen. Sechs Fragebögen (6%) enthielten hierzu keine Angaben. Zu einem geringen Teil waren die Fragebögen unvollständig ausgefüllt. Bezogen auf die Gesamtzahl der Mitarbeiter haben damit 55% der Pflegekräfte und 37% der Ärzte der Medizinischen Klinik 4 an der Befragung teilgenommen. In leitender Funktion in der Medizin waren 3% der insgesamt Befragten tätig bzw. 18% der antwortenden Ärzte; in leitender Funktion in der Pflege waren es 11% der insgesamt Befragten bzw. 15% der antwortenden Teilnehmenden aus dem Pflegedienst. Die teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren mit 78% mehrheitlich weiblich, 22% waren männlich. Die meisten Befragten gehörten zur Altersgruppe zwischen 20 und 29 Jahren (37%), gefolgt von den Altersgruppen zwischen 40 und 49 Jahren (27%) sowie zwischen 30 und 39 Jahren (26%). Sechs Mitarbeiter waren zwischen 50 und 59 Jahren (6%) alt. Fünf Befragte machten keine Angabe. 98 5.3.2. Ethische Konflikte in den letzten zwölf Monaten Die Frage nach dem Erleben ethischer Konflikte am eigenen Arbeitsplatz innerhalb des letzten Jahres wurde von 99 der 105 Teilnehmenden (94%) zustimmend beantwortet, nur vier (4%) verneinten ethische Konflikte in diesem Zeitraum, und zwei Befragte (2%) machten keinerlei Angabe. Von den 99 Zustimmungen entfallen 16 auf Ärzte, 75 auf Pflegende, acht weitere Antworten waren nicht eindeutig zuzuordnen. Jeder vierte Arzt gibt an, ethische Konflikte eher täglich zu erleben, die Hälfte erlebt sie eher wöchentlich, 19% eher monatlich und 6% seltener. Bei den Pflegenden erleben 14% ethische Konflikte eher täglich, 42% eher wöchentlich, 28% eher monatlich und 16% seltener. Ethische Konflikte in den letzten Eher eher eher Täglich wöchentlich monatlich Seltener Ärztinnen und Ärzte 25% 50% 19% 6% Pflegende 14% 42% 28% 16% 12 Monaten Tabelle 9: Ethische Konflikte in den vergangenen 12 Monaten 5.3.3. Persönliche Belastung durch ethische Konflikte Die Frage „Wie stark belasten diese ethischen Konflikte Sie persönlich in Ihrem Arbeitsbereich?“ war auf einer Skala von 1 (keine Belastung) bis 10 (sehr starke Belastung) zu beantworten. Für die Auswertung wurden die Antworten zu drei Gruppen gebündelt: „keine bzw. leichte Belastung“ (1-3), „mittlere Belastung“ (4-7) und „starke Belastung“ (8-10). Insgesamt antworteten 91 Befragte: 16 Ärzte (drei von ihnen in leitender Funktion), 73 Pflegende (zehn davon in leitender Funktion) und zwei Angehörige einer weiteren Berufsgruppe. Danach gaben jeweils 19% der Ärzte und Pflegenden an, dass sie „keine bzw. eine leichte Belastung“ empfinden, während 68% der Pflegenden und 65% der Ärzte eine „mittlere Belastung“ nannten, sowie 13% der Pflegenden und 16% der Ärzte eine „starke Belastung“. 99 Persönliche Belastung durch Keine bis leichte Mittlere Starke Belastung Belastung Belastung (1-3) (4-7) (8-10) Ärztinnen und Ärzte 19% 68% 13% Pflegende 19% 65% 16% ethische Konflikte Tabelle 10: Persönliche Belastung durch ethische Konflikte Die Aufteilung der Ergebnisse nach Altersgruppen zeigt, dass ein Erleben ethischer Konflikte am Arbeitsplatz im Bereich „mittlerer Belastung“ zumindest im Rahmen der vorliegenden Befragung mit dem Alter ansteigt – von 51% in der Altersgruppe zwischen 20 und 29 Jahren über 72% in der Gruppe zwischen 30 und 39 Jahren auf 78% in der Altersgruppe zwischen 40 und 49 Jahren. Neben dieser Beobachtung zeigt sich eine Abnahme der Empfindung „starke Belastung“ von 20% in der Altersgruppe zwischen 20 und 29 Jahren über 16% in der Altersgruppe zwischen 30 und 39 Jahren auf 4% in der Altersgruppe zwischen 40 und 49 Jahren. Die Altersgruppe zwischen 50 und 59 Jahren ist hier aufgrund der geringen Zahl der Befragten nicht berücksichtigt. Eine „starke Belastung“ geben insgesamt 15% der Befragten an, wobei der Anteil der Frauen hier bei 86% liegt sowie der Anteil der Altersgruppe von 20-29 Jahren bei 50%. Alle Befragten, die im Alter zwischen 20-29 Jahren eine „starke Belastung“ angaben, waren weiblich. Beim Vergleich der Geschlechter zeigte sich zudem, dass 15% der Frauen eine „leichte“, 63% eine „mittlere“ und 16% eine „starke Belastung“ angaben, während 20% der Männer eine „leichte“, 70% eine „mittlere“ und 10% eine „starke“ Belastung angaben. Bereits bei dieser Frage werden erste Übereinstimmungen zwischen den beiden Berufsgruppen der Pflegenden und Ärzten sichtbar, die sich bei den folgenden Fragen fortsetzen. 100 5.3.4. Häufigkeit und Wichtigkeit ethischer Konflikte Zur Einschätzung der Häufigkeit und Wichtigkeit ethischer Konflikte wurden die Mitarbeiter gefragt, welche inhaltlichen Bereiche in ihrem Arbeitsalltag zu ethischen Konflikten führen und für wie schwerwiegend sie diese halten. Dabei wurde im verwendeten Fragebogen bewusst darauf verzichtet, den Begriff „ethischer Konflikt“ näher zu definieren. Die Befragten sollten, wie schon bei der Nutzung des Fragebogens an der Medizinischen Hochschule Hannover, unbeeinflusst von vorgegebenen Definitionen jedes als ethisches Problem wahrgenommene Thema benennen können.202 In diesem Sinne hatten die MHHAutoren den Fragebogen für eine Bestandsaufnahme ethischer Problem- und Konfliktfelder entworfen, und in diesem Sinne sollte er auch im Nürnberger Kontext genutzt werden. Zur Auswahl gestellt wurden folgende Themen, die durch „Sonstige“ ergänzt werden konnten: – Therapiebegrenzung/Therapieabbruch – Verzicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen – Leben künstlich verlängern – Patientenwille (Selbstbestimmung) – Aufklärung von Patienten – Aufklärung von Angehörigen – Schweigepflicht – Allgemeiner/alltäglicher Umgang mit Patienten – Wahrung der Menschenwürde – Ethische Probleme in der Pflege – Apparatemedizin – Aufteilung knapper Mittel – Qualität med. Versorgung (z.B. Behandlungsfehler) – Umgang mit alten und dementen Menschen Für die Dimension „Häufigkeit“ wurde zwischen den Antwortmöglichkeiten „nie“, „eher selten“ und „eher häufig“ unterschieden, bei der Dimension „Wichtigkeit“ zwischen „leichtere Konflikte“ und „schwerwiegende Konflikte“. Zunächst folgen die Ergebnisse zur Dimension „Häufigkeit“. 202 Neitzke (2007). 101 Wegen der geringen Zahl „sonstiger Mitarbeiter“ (3%), werden hier nur die Ergebnisse für Mitarbeiter aus Medizin und Pflege wiedergegeben. Häufigkeit ethischer nie eher selten eher häufig Konflikte für Ärzte/innen Therapiebegrenzung/ nicht angekreuzt 0% 29% 65% 6% Verzicht auf Wiederbelebung 0% 23% 71% 6% Dialyseabbruch 12% 59% 18% 12% Leben künstlich verlängern 6% 65% 24% 6% 6% 59% 24% 12% Aufklärung von Patienten 6% 41% 53% 0% Aufklärung von Angehörigen 6% 35% 59% 0% Schweigepflicht 23% 53% 18% 6% 18% 41% 41% 0% Wahrung der Menschenwürde 12% 35% 53% 0% Ethische Probleme in der Pflege 29% 41% 23% 6% Apparatemedizin 23% 59% 12% 6% Aufteilung knapper Mittel 18% 23% 53% 6% 18% 65% 18% 0% 6% 35% 59% 0% Therapieabbruch Patientenwille/ Selbstbestimmung Allgemeiner, alltäglicher Umgang mit Patienten Qualität der medizinischen Versorgung/Behandlungsfehler Umgang mit alten und dementen Menschen Tabelle 11: Häufige ethische Konflikte im Krankenhaus – für Ärzte/innen 102 Häufigkeit ethischer Konflikte für Pflegende nie nicht eher selten eher häufig 5% 49% 46% 0% Verzicht auf Wiederbelebung 5% 42% 51% 3% Dialyseabbruch 13% 65% 23% 0% Leben künstlich verlängern 6% 45% 49% 0% 10% 49% 40% 1% Aufklärung von Patienten 10% 51% 37% 2% Aufklärung von Angehörigen 9% 51% 35% 5% Schweigepflicht 51% 27% 20% 1% 15% 52% 30% 2% Wahrung der Menschenwürde 11% 38% 51% 0% Ethische Probleme in der Pflege 16% 70% 13% 1% Apparatemedizin 23% 54% 19% 4% Aufteilung knapper Mittel 39% 39% 19% 2% 21% 67% 10% 1% 5% 35% 59% 0% Therapiebegrenzung und -abbruch Patientenwille/ Selbstbestimmung Allgemeiner, alltäglicher Umgang mit Patienten Qualität der medizinischen Versorgung/ Behandlungsfehler Umgang mit alten und dementen Menschen angekreuzt Tabelle 12: Häufige ethische Konflikte im Krankenhaus – für Pflegende Um die beiden großen Berufsgruppen vergleichen zu können, wurden auch die prozentualen Mittelwerte bestimmt und jeweils tabellarisch gegenübergestellt. 103 Häufige ethische Konflikte Rang Rang Rang insgesamt Medizin Pflege 1 1 2 (61%) (71%) (51%) 2 3 1 (59%) (59%) (59%) 3 2 4 (55,5%) (65%) (46%) 4 4 2 (52%) (53%) (51%) 5 3 8 (4%) (59%) (35%) 6 4 7 (45%) (53%) (37%) 7 6 3 (36,5%) (24%) (49%) Verzicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen Umgang mit dementen Patienten Begrenzung und/oder Abbruch einer Therapie Wahrung der Menschenwürde Aufklärung von Angehörigen Aufklärung von Patienten Leben künstlich verlängern Tabelle 13: Häufige ethische Konflikte im Krankenhaus – Rang 1 bis 7 Siehe S. 102 (Tabelle 11) und S. 103 (Tabelle 12) In der Übersicht zeigt sich eine Reihe von Übereinstimmungen in der Wahrnehmung der Häufigkeit bestimmter ethischer Konflikte aus der Perspektive der Befragten aus Medizin und Pflege. Es sind hier die sieben meist genannten Themen aufgeführt. Gerade ethische Konflikte und Entscheidungen am Lebensende bzw. im Bezug auf das mögliche Lebensende werden offensichtlich von beiden Berufsgruppen gleich häufig erlebt Nach den Ergebnissen zur Dimension „Häufigkeit“ sind im Folgenden die Ergebnisse zur Dimension „Wichtigkeit“ im Sinne der persönlichen Belastung wiedergegeben. Hier standen die Antwortmöglichkeiten „leichtere Konflikte“ und „schwerwiegende Konflikte“ zur Verfügung. Aufgrund der geringen Anzahl „sonstiger Mitarbeiter“ (3% der Befragten), werden auch hier nur die Ergebnisse der Mitarbeiter aus dem medizinischen Dienst und der Pflege genannt, die im Anschluss wiederum miteinander verglichen werden. 104 Wichtigkeit bzw. Belastung durch ethische leichter Konflikte – für Ärzte/innen schwer- nicht wiegender angekreuzt Therapiebegrenzung/Therapieabbruch 23% 76% 0% Verzicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen 53% 47% 0% Dialyseabbruch 18% 65% 18% Leben künstlich verlängern 18% 70% 12% Patientenwille (Selbstbestimmung) 59% 29% 12% Aufklärung von Patienten 70% 12% 18% Aufklären von Angehörigen 65% 18% 18% Schweigepflicht 76% 0% 23% Allgemeiner alltäglicher Umgang mit Patienten 76% 6% 18% Wahrung der Menschenwürde 65% 23% 12% Ethische Probleme in der Pflege 65% 0% 35% Apparatemedizin 59% 23% 18% Aufteilung knapper Mittel 35% 41% 23% Qualität med. Behandlung/Behandlungsfehler 41% 47% 12% Umgang mit alten und dementen Menschen 59% 23% 18% Tabelle 14: Wichtige und belastende ethische Konflikte – für Ärzte/innen Nach der Darstellung der Ergebnisse für die befragten Ärztinnen und Ärzte folgt die tabellarische Darstellung der Ergebnisse für die Gruppe der Pflegenden. 105 Wichtigkeit bzw. Belastung durch ethische leichter schwer- nicht wiegender angekreuzt 39% 56% 4% 50% 44% 5% Dialyseabbruch 45% 50% 4% Leben künstlich verlängern 28% 69% 3% Patientenwille (Selbstbestimmung) 51% 45% 4% Aufklärung von Patienten 63% 29% 8% Aufklären von Angehörigen 68% 23% 9% Schweigepflicht 71% 8% 21% Allgemeiner alltäglicher Umgang mit Patienten 70 % 19% 11% Wahrung der Menschenwürde 46% 43% 11% Ethische Probleme in der Pflege 63% 27% 10% Apparatemedizin 67% 16% 16% Aufteilung knapper Mittel 63% 19% 18% Qualität med. Behandlung/Behandlungsfehler 49% 35% 15% Umgang mit alten und dementen Menschen 65% 30% 4% Konflikte – für Pflegende Therapiebegrenzung/Therapieabbruch Verzicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen Tabelle 15: Wichtige und belastende ethische Konflikte – für Pflegende Folgende Übersicht zeigt eine weitere Übereinstimmung der beiden Berufsgruppen in der Gewichtung der Schwere und Belastung durch diese ethischen Konflikte. 106 Schwerwiegende ethische Konflikte Leben künstlich verlängern Begrenzung und/oder Abbruch einer Therapie Dialyseabbruch Verzicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen Qualität med. Behandlung/Behandlungsfehler Patientenwille (Selbstbestimmung) Wahrung der Menschenwürde Rang Rang Rang insgesamt Medizin Pflege 1 2 1 (69 .5%) (70%) (69%) 2 1 2 (66%) (76%) (56%) 3 3 3 (57.5%) (65%) (50%) 4 4 4 (45.5%) (47%) (44%) 5 4 5 (41%) (47%) (35%) 6 7 5 (36.5%) (29%) (45%) 7 (8) 6 (33%) (23%) (43%) Tabelle 16: Schwerwiegende ethische Konflikte im Krankenhaus. Rang 1 – 7 Siehe S. 105 (Tabelle 14) und S. 106 (Tabelle 15) Wie bereits beim Vergleich der Einschätzung von Häufigkeiten ethischer Konflikte im Krankenhaus zeigen sich auch bei der Frage nach der Schwere oder Wichtigkeit ethischer Konflikte bzw. der damit verbundenen Belastung deutliche Gemeinsamkeiten der großen Berufsgruppen. Auch hier sind es die Themen am Lebensende, die Fragen zur Begrenzung oder zum Fortführen von Behandlungsmaßnahmen, die von Ärzten wie Pflegenden als besonders schwerwiegend und damit belastend eingeordnet werden. Alle weiteren Themen werden in deutlichem Abstand und damit vergleichsweise als weniger schwerwiegend eingestuft. Als „leichtere Belastungen“ stuften Pflegende die Themen „Schweigepflicht“, „Allgemeiner und alltäglicher Umgang mit Patienten“ und „Aufklärung von Angehörigen“ ein, bei den Ärzten waren es ebenfalls die „Schweigepflicht“ sowie der „Allgemeine und alltägliche Umgang mit Patienten“, bei der „Aufklärung“ allerdings die der Patienten. Bis auf diesen Unterschied wählen demnach Ärzte wie Pflegende auch bei den „leichteren Belastungen“ aus einer umfangreichen Liste dieselben Themen aus. 107 5.3.5. Ethische Probleme und Personengruppen Mit welcher Frequenz entstehen mit welchen Personengruppen ethische Konflikte? Ethische Konflikte... Täglich wöchentlich Monatlich seltener nie ...mit Kollegen/innen aus der eigenen Berufsgruppe 6% 23% 23% 41% 6% ...mit Kollegen/innen aus anderen Berufsgruppen 12% 29% 29% 18% 12% ...mit Vorgesetzten aus der eigenen Berufsgruppe 18% 24% 24% 24% 11% ...mit Vorgesetzten aus anderen Berufsgruppen 6% 13% 6% 38% 38% ...mit Patienten/innen 25% 19% 19% 38% 0% ...mit Angehörigen von Patienten/innen 24% 29% 29% 18% 0% ...mit der Verwaltung 18% 6% 12% 35% 29% ...mit anderen (Krankenkasse) 8% 15% 23% 46% 8% Tabelle 17: Mit welchen Personengruppen erleben Ärzte ethische Konflikte? Ethische Konflikte... Täglich wöchentlich Monatlich Seltener nie ...mit Kollegen/innen aus der eigenen Berufsgruppe 3% 13% 19% 52% 13% ...mit Kollegen/innen aus anderen Berufsgruppen 4% 17% 25% 44% 10% ...mit Vorgesetzten aus der eigenen Berufsgruppe 0% 3% 22% 49% 26% ...mit Vorgesetzten aus anderen Berufsgruppen 3% 8% 21% 42% 27% ...mit Patienten/innen 6% 14% 19% 45% 14% ...mit Angehörigen von Patienten/innen 4% 17% 38% 29% 13% ...mit der Verwaltung 0% 0% 6% 24% 69% ...mit anderen (Krankenkasse) 2% 0% 14% 36% 48% Tabelle 18: Mit welchen Personengruppen erleben Pflegende ethische Konflikte? 108 Bei der Benennung derjenigen Personengruppen, mit denen ethische Konflikte erlebt werden, zeigen sich zwar Gemeinsamkeiten im Hinblick auf die genannten Gruppen, aber auch Unterschiede hinsichtlich der Ausprägung. Pflegende wie Ärzte erleben an erster Stelle ethische Probleme mit Angehörigen von Patienten und den Patienten selbst – fast jeder vierte befragte Arzt (24%) erlebt ethische Konflikte mit Angehörigen und den Patienten sogar täglich. Jeder zweite Arzt erlebt ethische Konflikte mit diesen beiden Gruppen mindestens wöchentlich. Bei den Pflegenden stehen ethische Konflikte mit Patienten oder Angehörigen ebenfalls im Fokus, allerdings erlebt sie hier nur jede fünfte Pflegekraft wöchentlich. Mindestens wöchentlich erleben Ärzte ethische Konflikte auch mit den Vorgesetzen der eigenen Berufsgruppe (42%) und mit Kollegen aus anderen Berufsgruppen (41%). Hiervon unterscheiden sich die Antworten der Pflegenden deutlich. So erleben wöchentlich nur 3% der Pflegenden ethische Konflikte mit den eigenen Vorgesetzen. Beide Berufsgruppen erleben am wenigsten, d.h. seltener als monatlich oder nie, ethische Konflikte mit der Verwaltung: 93% sind es bei den Pflegenden und 64% bei den Ärzten. Auch Konflikte mit den Vorgesetzten der anderen Berufsgruppen erleben beide seltener bis nie: Ärzte jeweils 38% und Pflegende 42% bzw. 27%. Im Hinblick auf ethische Konflikte „mit anderen (Krankenkasse)“ findet sich erneut ein Unterschied. Während sich bei 84 % der Pflegenden seltener als monatlich oder nie Konflikte finden, sind es bei den Ärzten nur 54%, die dies so bestätigen. 5.3.6. Ursachen für ethische Konflikte Auf die Frage „Was halten Sie für die Ursachen dieser Konflikte?“ waren die folgenden Antworten möglich. Es wurde dabei vorgegeben, nur die wichtigsten Ursachen anzugeben. Auch hier werden nur die Angaben der großen Berufsgruppen wiedergegeben. Die Tabelle stellt die Ursachen für ethische Konflikte dar, einerseits unterteilt für Ärzte und Pflegende, andererseits in eine gemeinsame Rangliste gebracht. Die für beide Berufsgruppen wichtigsten vier Themen, wenn auch in unterschiedlicher Reihenfolge sind: „Zeitmangel“, „Arbeitsüberlastung“, „Mangelnde oder schwierige Kommunikation mit Patienten/Angehörigen“ und die „Unterschiedliche Wahrnehmung bzw. Einschätzung von Situationen“. 109 Ursachen ethischer Konflikte Rang Rang Rang insgesamt Medizin Pflege 1 1 3 (72.5%) (88%) (57%) 2 2 2 (59%) (59%) (59%) Mangelnde oder schwierige Kommunikation mit 3 3 1 Patienten/Angehörigen (56%) (47%) (65%) Unterschiedliche Wahrnehmung/Einschätzung 4 4 4 von Situationen (47%) (41%) (53%) 5 4 6 (43%) (41%) (45%) 6 3 11 (39%) (47%) (31%) Unklares Vorgehen, 7 6 5 wie Entscheidungen getroffen werden (37%) (24%) (49%) Mangelnde oder schwierige Kommunikation im 8 5 7 Behandlungsteam (36%) (29%) (42%) Probleme durch Ablauf und Organisation 9 3 12 der Krankenversorgung (33%) (47%) (19%) 10 6 8 (30%) (24%) (36%) Zu wenig Einfühlungsvermögen/ 11 8 9 Sensibilität von Beteiligten (23%) (12%) (34%) Bestimmte Anforderungen stehen im Konflikt 11 6 12 mit dem eigenen Gewissen (23%) (24%) (22%) Ungenügende Ausbildung und Schulung 12 8 10 im Umgang mit ethischen Fragen (22%) (12%) (32%) 13 5 16 (19%) (29%) (9%) 14 7 15 (17%) (18%) (16%) 15 9 14 (12%) (6%) (18%) 16 10 17 (3%) (0%) (6%) Zeitmangel Arbeitsüberlastung Personalmangel Hierarchie-Konflikte Fehlende Übernahme von Verantwortung Budgetmangel/Geldmangel Religiöse oder kulturelle Unterschiede Mangelndes Wissen Fehlendes Vertrauen Tabelle 19: Rangliste der Ursachen ethischer Konflikte im Krankenhaus 110 5.3.7. Wichtigkeit ethischer Konflikte in den Berufsgruppen Neben der Benennung der Ursachen ethischer Konflikte, waren die Befragten im Sinne einer Selbst- und Fremdeinschätzung aufgefordert, jeweils für die eigene und die andere Berufsgruppe einzuschätzen, wie wichtig bzw. ernst ethische Gesichtspunkte am eigenen Arbeitsplatz von beiden großen Berufsgruppen derzeit genommen werden. Dazu wurde erneut eine Skala von „sehr unwichtig“ (1) bis „sehr wichtig“ (10) genutzt, die für die Auswertung wiederum in „unwichtig“ (1-3), „indifferent“ (4-7) und „wichtig“ (8-10) gruppiert wurde. 203 Wichtigkeit ethischer Konflikte unwichtig indifferent wichtig in den Berufsgruppen – (1-3) (4-7) (8-10) Ärzte schätzen Ärzte ein 6% 53% 41% Ärzte schätzen Pflegende ein 0% 59% 41% aus der Ärzteperspektive Tabelle 20: Wichtigkeit ethischer Konflikte – aus der Perspektive der Ärzte Wichtigkeit ethischer Konflikte unwichtig indifferent wichtig in den Berufsgruppen – (1-3) (4-7) (8-10) Pflegende schätzen Pflegende ein 1% 50% 49% Pflegende schätzen Ärzte ein 20% 72% 8% aus der Pflegeperspektive Tabelle 21: Wichtigkeit ethischer Konflikte – aus der Perspektive der Pflegenden So gaben von 17 befragten Ärzten 41% an, ethische Konflikte würden derzeit von Ärzten und Pflegenden gleich „wichtig“ genommen; 53% der Ärzte meinten, dass ethische Konflikte von Ärzten und 59%, dass sie von Pflegenden „indifferent“ erlebt werden; 6% der Ärzte gaben an, dass sie von Ärzten als „unwichtig“ eingestuft würden. Dies wurde bei Pflegenden in keinem Fall vermutet. 203 „Indifferent“ verstehe ich nicht als negative Bewertung, sondern als quasi „mittelwichtig“. 111 Aus Sicht der Pflege schätzen von 75 Pflegenden 8%, dass Ärzte ethische Konflikte als „wichtig“ ansehen, wohingegen dies knapp die Hälfte (49%) von der eigenen Berufsgruppe vermuteten. 72% der Pflegenden sind der Ansicht, dass Ärzte eher „indifferent“ eingestellt seien, gegenüber 50% der eigenen Berufsgruppe. Die Pflegenden meinen, dass 20% der Ärzte ethische Konflikte als „unwichtig“ betrachten, gegenüber nur 1% der Pflegenden. 5.3.8. Anerkennung der Bedeutung ethischer Konflikte am Arbeitsplatz Nach der Erhebung der bloßen Beschreibung vermuteter Einstellungen galt die folgende Frage einer normativen Festlegung: Auf die Frage „Wie wichtig sollten ethische Konflikte an Ihrem Arbeitsplatz von allen genommen werden?“ antworten insgesamt 105 Befragte, wobei 17 ärztlich Tätige, 78 Pflegende und drei sonstige Mitarbeiter ihre Berufsgruppenzugehörigkeit angaben. Von den 105 Antworten gaben insgesamt 6% an, dass ethische Gesichtspunkte an ihrem Arbeitsplatz „unwichtig“ sein sollten, 10% gaben „indifferent“ an, 83%, dass sie „wichtig“ genommen werden sollten und 1% machte zu dieser Frage keine Angabe. Für 95 Antworten ist eine Aufteilung nach Berufsgruppen (siehe oben) möglich. Dabei zeigt sich, dass keiner der befragten Ärzte die Kategorie „unwichtig“ gewählt hat, 18% der Ärzte „indifferent“ bleiben und 82% der Ärzte der Meinung sind, dass ethische Gesichtspunkte am Arbeitsplatz „wichtig“ genommen werden sollten. Bei den Pflegenden gaben 6% „unwichtig“ an, „indifferent“ (8%) und „wichtig“ (86%). 5.3.9. Berufliche und private Gesprächspartner für ethische Konflikte Im Hinblick auf den zweiten Teil der vorliegenden Arbeit, die Analyse der Ethikberatungen in der Medizinischen Klinik 4 zwischen 1999 und 2011, ist die folgende Frage besonders relevant. Unter dem Punkt „Psychosozial bzw. Ethikkreis“ stellt die Frage ausdrücklich eine Verbindung zum konkreten Angebot der Ethikberatung in der eigenen Klinik her, da dieses Angebot dort seit vielen Jahren offiziell unter dem Begriff „Ethikkreis“ bekannt ist. Gefragt nach den Personen, mit denen ethische Konflikte im Alltag besprochen werden, zeigen sich wiederum Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Berufsgruppen. Die Tabellen geben die Ergebnisse nach Berufsgruppen getrennt wieder. 112 Ansprechpartner für ethische Konflikte Täglich wöchentlich monatlich Seltener nie Kollegen/-innen der eigenen Berufsgruppe 47% 29% 12% 12% 0% Andere Kollegen/-innen im Team 41% 24% 18% 18% 0% Vorgesetzte 19% 19% 13% 38% 13% Privat in der Familie/ mit Freunden 6% 41% 29% 18% 6% Fachleute, z.B. Seelsorger 0% 19% 13% 25% 44% Psychosozial/Ethikkreis 0% 6% 25% 50% 19% Andere, z.B. Krankenkassen nicht gewertet ... ... ... ... Tabelle 22: Mit wem besprechen Ärzte ethische Konflikte? (Die letzte Frage wurde nicht gewertet, da sie nur von einem Befragten beantwortet wurde). Ansprechpartner für ethische Konflikte Täglich wöchentlich monatlich Seltener nie Kollegen/-innen der eigenen Berufsgruppe 35% 33% 16% 13% 3% Andere Kollegen/-innen im Team 10% 31% 24% 27% 8% Vorgesetzte 4% 14% 21% 44% 17% Privat in der Familie/ mit Freunden 10% 25% 16% 33% 15% Fachleute, z.B. Seelsorger 0% 1% 4% 51% 44% Psychosozial/Ethikkreis 0% 4% 11% 42% 43% Andere, z.B. Krankenkasse nicht gewertet ... ... ... ... Tabelle 23: Mit wem besprechen Pflegende ethische Konflikte? (Die letzte Frage wurde nicht gewertet, da sie nur von elf Befragten beantwortet wurde.) 113 Über ethische Fragen diskutieren mit den Kollegen der eigenen Berufsgruppe viele der befragten Ärzte vor allem täglich (47%), viele Pflegenden ebenfalls vor allem täglich (35%); mit anderen Kollegen im Team sprechen viele Ärzte ebenfalls vor allem täglich (41%), ein Drittel der Pflegenden dagegen vor allem wöchentlich (31%). Mit ihren Vorgesetzen sprechen ärztliche Mitarbeiter eher selten über ethische Konflikte. Die am häufigsten gewählte Kategorie „seltener“ – als monatlich – gaben 38% der befragten Ärzte an. Auch bei den Pflegenden fällt auf, dass diese Kategorie mit 44% der Pflegenden am häufigsten gewählt wurde. In der Familie und mit Freunden sprechen Ärzte vergleichsweise oft über ethische Konflikte an ihrem Arbeitsplatz. Zumindest wählten 41% der befragten Ärzte die damit am häufigsten gewählte Kategorie „wöchentlich“. Bei den Pflegenden war hier die am häufigsten (33%) gewählte Kategorie die „monatliche“ Besprechung. Dagegen sprechen sowohl Ärzte wie Pflegende „selten“ bis „nie“ mit Fachleuten, z. B. Seelsorgern. 25% der befragten Ärzte gaben an, „selten“, 44% „nie“ mit Fachleuten über ethische Konflikte zu sprechen; 44% waren es bei den Pflegenden, bei denen 51% angaben, dies seltener als monatlich zu tun. Die Frage nach der Nutzung psychosozialer Gesprächsangebote bzw. des „Ethikkreises“ war insofern interessant, da es zum Zeitpunkt der Befragung seit zehn Jahren eine etablierte Ethikberatung in der Medizinischen Klinik 4 gab, deren Evaluation im nächsten Kapitel folgt. Bei den Ärzten rangierten die Antworten hier zwischen „monatlich“ (25%), „seltener“ (50%) und „nie“ (19%); bei den befragten Pflegenden gleichermaßen zwischen „monatlich“ (11%), „seltener“ (42%) und „nie“ (43%). Es ist bemerkenswert, dass die Antwortkategorie „nie“ sowohl bei Ärzten als auch bei Pflegenden ausgerechnet am häufigsten für die potenziellen Ansprechpartner „Fachleute“ und „Psychosozial/Ethikkreis“ genannt wird. Keine anderen Gesprächspartner werden so wenig genutzt wie diese professionellen bzw. kollegialen und innerklinischen Dienstleistungen. 5.3.10. Klinikinterne Ansprechpartner für ethische Fragen Nach den beruflich oder privat genutzten Ansprechpartnern schließt sich die Frage an, ob in der Medizinischen Klinik 4 überhaupt genügend Ansprechpartner für ethische Fragen vorhanden sind. In den folgenden Antworten bestätigen sich einerseits die oben dargestellten Bedürfnisse, andererseits zeigt sich auch die Kenntnis über die existierenden Angebote der eigenen Institution. 114 Ansprechpartner Ärzte/innen Pflegende Ja, es gibt genügend kompetente Ansprechpartner/innen in der Klinik 94% 76% Nein, ich vermisse kompetente Ansprechpartner/-innen in der Klinik 0% 20% Ich benötige keine Ansprechpartner/-innen in der Klinik 6% 4% Tabelle 24: Ansprechpartner/-innen für ethische Konflikte Wenn sowohl Ärzte als auch Pflegende die professionellen Ansprechpartner für ethische Konflikte innerhalb der Medizinischen Klinik 4 nicht nutzen, liegt dies nicht an der mangelnden Kenntnis der Möglichkeiten. Beide Berufsgruppen bestätigen mit großer Mehrheit – bei den Ärzten sind es 16 von 17 Befragten –, dass es genügend kompetente Ansprechpartner in der Klinik gäbe. Nur ein einziger von 17 befragten Ärzten gab an, er benötige keine Ansprechpartner in der Klinik. Bei den Pflegenden ist das Ergebnis ähnlich deutlich. Hier benötigen 4% keine Ansprechpartner, 20% vermissen solche und 76% bestätigen ihre Existenz in der Klinik. Bemerkenswert ist, dass immerhin jede fünfte befragte Pflegekraft feststellt, dass sie kompetente Ansprechpartner in der Klinik vermisse. Ob diese Aussage nach zehnjährigem Bestehen des klinikeigenen Ethikkreises ein Zeichen fehlender Information oder mangelnder Wertschätzung ist, bleibt an dieser Stelle offen. 5.3.11. Wichtige Ethikangebote in der Klinik Abschließend wurde im Fragebogen erhoben, welche Ethikangebote für Ärzte und Pflegende im klinischen Alltag wichtig sind. Die möglichen Antworten umfassten die in der folgenden Tabelle stehenden Themen. Mehrfachantworten waren dabei ausdrücklich möglich. Dazu wurde erneut eine Skala von „sehr unwichtig“ (1) bis „sehr wichtig“ (10) genutzt, die für die Auswertung wiederum in „unwichtig“ (1-3), „indifferent“ (4-7) und „wichtig“ (8-10) gruppiert wurde. 115 Welche Ethikangebote sind Ärzten/innen wichtig? wichtig Indifferent unwichtig Leitlinien für häufige ethische Probleme in der Krankenversorgung 35% 41% 24% Möglichkeit, bei aktuellen ethischen Entscheidungskonflikten eine ethisch kompetente Person als Berater zu nutzen 53% 47% 0% Möglichkeit, zurückliegende Fälle unter ethischen Gesichtspunkten im Team mit einer ethisch kompetenten Person zu besprechen 29% 59% 12% Regelmäßige Weiterbildungen zu medizinethischen Fragen 29% 47% 24% Tabelle 25: Welche Ethikangebote sind für Ärzte/innen wichtig? Welche Ethikangebote sind Pflegenden wichtig? wichtig Indifferent unwichtig Leitlinien für häufige ethische Probleme in der Krankenversorgung 46% 46% 8% Möglichkeit, bei aktuellen ethischen Entscheidungskonflikten eine ethisch kompetente Person als Berater zu nutzen 78% 16% 6% Möglichkeit, zurückliegende Fälle unter ethischen Gesichtspunkten im Team mit einer ethisch kompetenten Person zu besprechen 47% 37% 16% Regelmäßige Weiterbildungen zu medizinethischen Fragen 52% 40% 8% Tabelle 26: Welche Ethikangebote sind für Pflegende wichtig? Auch im Hinblick auf die vorangegangenen zwei Fragen und die Klinische Ethikberatung des Ethikkreises, die im folgenden Kapitel vorgestellt wird, sind die Ergebnisse der Fragen nach wichtigen Ethikangeboten aufschlussreich. 116 Insgesamt vermitteln sie den Eindruck, dass Pflegende den Ethikangeboten aufgeschlossener und interessierter gegenüberstehen. In der Kategorie „wichtig“ liegen ihre Werte in allen Punkten über denen der Ärzte. Gerade Pflegende schätzen die Möglichkeit der aktuellen Beratung als „sehr wichtiges“ Angebot, das von einer deutlichen Mehrheit gewünscht wird (78%). Die Reflektion zurückliegender Fälle gewichten Pflegende dagegen erst an dritter Stelle, aber immer noch mit fast der Hälfte der Befragten. Die Bedeutung regelmäßiger Fortbildung zu medizinethischen Fragen wird von Pflegenden als noch wichtiger angesehen. Auch hierfür gibt jede zweite Befragte die Antwort „wichtig“ an. Ärzte werten in der Tendenz ähnlich, wenn auch weniger deutlich. 53% der befragten Ärzte halten die Möglichkeit der aktuellen Beratung für „wichtig“, kein einziger der befragten Ärzte hält dieses Angebot für „unwichtig“. 29% der Ärzte wünschten sich eine professionelle Reflektion zurückliegender Fälle, wobei sich die Ärzte hier mehrheitlich (59%) indifferent zeigten. Die Kategorie „indifferent“ ist insofern zu beachten, da sich dahinter die Unentschlossenen verbergen, die sich – womöglich aus Gründen sozialer Erwünschtheit – nicht für die Antwort „unwichtig“ entscheiden, aber auch keine Wichtigkeit feststellen. Diese Gruppe sollte bei der Planung von Maßnahmen zur Akzeptanzsteigerung im Fokus sein. Insgesamt lässt sich zeigen, dass – mit Ausnahme der aktuellen Beratung – jeweils nahezu ein Drittel der Ärzte und nahezu die Hälfte der Pflegenden die zur Auswahl gestellten Ethikangebote für „sehr wichtig“ hielten. 5.4. Diskussion der Mitarbeiterbefragung Mit einem Rücklauf von 54% zeigt die Befragung in der Medizinischen Klinik 4 insgesamt eine gute Beteiligung. Mit 75% war der Rücklauf bei den Pflegenden besonders gut, was auch dem eben geschilderten Interesse der Berufsgruppe an Ethikangeboten entspricht. Für beide großen Berufsgruppen lassen sich damit aus der Befragung relevante Tendenzen in Fragen der Wahrnehmung und Haltung gegenüber ethischen Konflikten und deren Bearbeitung ableiten. Entgegen den nicht selten geäußerten Differenzen zwischen den beiden großen Berufsgruppen im Krankenhaus, dem ärztlichen und dem pflegerischen Dienst, belegen die Ergebnisse der vorliegenden Befragung neben allen Unterschieden auch ein hohes Maß an Übereinstimmung beider Seiten in Bezug auf das Erleben und die Bewertung ethischer Fragen im Berufsalltag. 117 Diese Übereinstimmung könnte im Sinne der Förderung und Weiterentwicklung der gegenseitigen Anerkennung und Kooperation ausdrücklich genutzt werden. Daher arbeitet die Diskussion die zu findenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede explizit heraus, vergleicht sie mit dem aktuellen Forschungsstand, stellt Verbindungen her zur Evaluation der Ethikberatungen und sucht nach Anhaltspunkten, um die ärztliche und pflegerische Kompetenz im Umgang mit ethischen Konflikten weiter stärken zu können. 5.4.1. Gemeinsamkeiten der Berufsgruppen Insgesamt bestätigen die Ergebnisse, dass ethische Konflikte zum Alltag der beiden großen Berufsgruppen gehören, d.h. von Ärzten zu 75% und von Pflegenden zu 55% Woche für Woche als solche erlebt werden. Diese hohe Relevanz übertrifft die Ergebnisse vergleichbarer Untersuchungen,204 wo „nur“ jeder dritte Arzt eine wöchentliche Belastung angab und nur neun Prozent der Ärzte eine tägliche Belastung. Besonders bemerkenswert erscheint daher, dass in dieser Befragung jeder vierte Arzt angab, ethische Konflikte täglich zu erleben – ein Umstand, der vielleicht nicht nur das spezifische Patientenkollektiv der Nephrologie widerspiegelt, sondern auch auf einige allgemeine, aktuelle und bereits geschilderte Entwicklungen im Krankenhaus zurückzuführen sein könnte. Auch wenn dieser Aspekt nicht ausdrücklich abgefragt und in den offenen Antwortmöglichkeiten nicht explizit erwähnt wurde: die Verkürzung der Verweildauern könnte sich auch auf das Erleben ethischer Konflikte auswirken. Bei stationären Aufenthalten von durchschnittlich weniger als einer Woche auch bei Patienten mit komplexen internistischen Erkrankungen, kann schnell ein erheblicher Zeitdruck nicht nur auf Diagnostik und Therapie entstehen, sondern auch auf gravierende existenzielle Entscheidungen, etwa über das Fortsetzen oder den Abbruch einer Therapie. Im Zuge der Abrechnung nach diagnosebezogenen Fallpausschalen kommt es im Krankenhaus nicht nur zu einer hohen zeitlichen Verdichtung ärztlicher, pflegerischer und sonstiger Leistungen, sondern vermutlich auch zu einem höheren Zeitdruck bei medizinischen Entscheidungen – selbst wenn diese ethisch kontrovers sind und vor allem eines bräuchten: ausreichend Zeit. 204 Neitzke (2007). 118 In diesem Zusammenhang sei bereits darauf hingewiesen, dass sich im Rahmen der nachfolgend untersuchten Ethikberatungen viele der Beratungsprozesse des „Ethikkreises“ über mehrere Gespräche erstrecken und damit vermitteln, dass gerade im Rahmen der Dialysebehandlung noch oft die Möglichkeit besteht, sich den existenziellen Entscheidungen in mehreren Schritten langsam zu nähern. Insofern ist die hier erwähnte Vermutung zur Verkürzung der Verweildauern und dem Einfluss auf das Erleben ethischer Konflikte sicher nicht zu verallgemeinern. Nicht nur die tägliche Relevanz, sondern auch die persönliche Belastung durch ethische Konflikte zeigt zwischen Medizin und Pflege mehr Übereinstimmung als Unterschiede: Eine deutliche Mehrheit der Befragten (65% der Ärzte bzw. 68% der Pflegenden) empfindet eine „mittlere Belastung“, und auch die Angaben zu einer „leichten“ oder „schweren“ Belastung zeigen bei den Beschäftigten eine hohe Übereinstimmung. Die hier genannten Ergebnisse liegen geringfügig über denen der vergleichbaren Befragung an der Medizinischen Hochschule Hannover, die sich allerdings auf das gesamte Universitätsklinikum und nicht nur auf ein spezifisches Fachgebiet bzw. eine einzelne Klinik bezog. Die Altersverteilung bei der Angabe der „mittleren“ und „starken“ Belastung zeigt mit zunehmendem Alter eine Abnahme der „starken“ Belastung zugunsten einer gleichzeitigen Zunahme der „mittleren“ Belastung. Während jeder fünfte Befragte zwischen 20 und 29 Jahren noch eine „starke“ Belastung angegeben hatte, sank der Wert auf 4% in der Gruppe zwischen 40 und 49 Jahren. Dies könnte darauf hindeuten, dass ethische Belastungen mit steigendem Alter und wachsender Berufserfahrung besser gelöst und verarbeitet oder aber stärker verdrängt werden. Auch hinsichtlich der Einschätzung von „Häufigkeit“ und „Wichtigkeit“ ethischer Konflikte finden sich bei den beiden großen Berufsgruppen sehr ähnliche Bewertungen, die sich mit internationalen Ergebnissen decken.205 Grundlage war hier die Auswahl von insgesamt 15 Themen aus dem stationären Berufsalltag. Als „eher häufig“ erlebt werden von beiden Berufsgruppen der „Verzicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen“ (VaW), der „Umgang mit dementen Patienten“ und die „Therapiebegrenzung/Therapieabbruch“ genannt. Diese Themen zählten für beide Berufsgruppen zu den drei ethisch relevantesten Themen. 205 Hurst (2007). 119 Dabei ist festzustellen, dass sowohl der Verzicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen als auch die Begrenzung oder der Abbruch einer Therapie von Ärzten noch deutlich häufiger als ethisch konfliktreich erlebt wird als von Pflegenden (71% vs. 51% bzw. 65% vs. 46%). Die stärkere Ausprägung bei Ärzten könnte darin begründet sein, dass in entsprechenden Fällen allein ihnen die letzte Entscheidung und damit auch die letzte Verantwortung obliegt. Bemerkenswert ist die Bewertung der Maßnahme „Abbruch einer Dialyse“: Hier findet sich auch „in umgekehrter Richtung“ eine hohe Übereinstimmung zwischen Medizin und Pflege. Der Abbruch wird von 59% der befragten Ärzte und 65% der befragten Pflegenden als „eher selten“ ethisch problematisch erlebt. Entweder zeigt sich hier eine Inkongruenz zur vorangegangenen Frage, bei welcher der Abbruch einer Therapie noch eher häufig als ethisch konfliktreich erlebt wurde, oder die Entscheidungen rund um den Beginn, das Fortsetzen oder den Abbruch einer Dialyse werden tatsächlich als weniger belastend empfunden. Im Idealfall könnten sich hier bereits Entlastungseffekte durch die stattgehabten Ethikberatungen zeigen. Immerhin hat eine Mehrheit der Beratungen zum Thema Dialyse stattgefunden. Dies könnte im besten Fall bereits eine spürbare Entlastung oder auch einen Lerneffekt der beteiligten Mitarbeiter im Umgang mit den oft schwierigen Entscheidungen rund um die Nierenersatztherapie bewirkt haben. Bei den Ergebnissen zur „Wichtigkeit“ bzw. „Schwere“ ethischer Konflikte zeigt sich eine noch weitergehende Übereinstimmung von Ärzten und Pflegenden. Auch hier sind es Entscheidungen am Lebensende, die als sehr schwerwiegend und belastend erlebt werden. Ärzte wie Pflegende nennen übereinstimmend vier von fünfzehn Themen als vorrangig, wobei nur der Rang der Themen wechselt. Insgesamt waren für beide Gruppen die Themen „Leben künstlich verlängern“, „Therapiebegrenzung/Therapieabbruch“, „Dialyseabbruch“ und „Verzicht auf Wiederbelebung“ in dieser Reihenfolge die schwerwiegendsten Probleme. Auch in der Einschätzung der Ursachen ethischer Konflikte sind sich ärztlich und pflegerisch Tätige einig. Aus den weiter oben genannten 17 verschiedenen Ursachen sind für beide Berufsgruppen „Zeitmangel“, „Arbeitsüberlastung“ und „mangelnde oder schwierige Kommunikation mit Patienten/Angehörigen“ die drei am häufigsten genannten Ursachen. Dabei wird der Zeitmangel von Ärzten stärker erlebt, die Arbeitsbelastung von beiden Gruppen gleich stark und die eher kommunikativen Ursachen stärker von den Pflegenden. 120 Letztere Ergebnisse bestätigen die geschilderte Arbeitsverdichtung in der stationären Versorgung, und sie unterstreichen die von Pflegenden vielfach geäußerte Erfahrung, durch ihre alltägliche Nähe zum Patienten die entstehenden Defizite in der Kommunikation deutlicher rückgemeldet zu bekommen. Angesichts der dargestellten Entwicklung, insbesondere von Krankenhäusern der Maximalversorgung, im Hinblick auf Fallschwere, Fallzahlerhöhung und Verweildauerverkürzung, ist das Erleben dieser Ursachen nachvollziehbar. Die genannten Aspekte wirken bereits für sich, bedingen sich aber auch gegenseitig. Vergleichsweise niedrig gewertet wurde von beiden Berufsgruppen, dass „bestimmte Anforderungen in Konflikt stehen mit dem eigenen Gewissen.“ Nur 24% der Ärzte und 22% der Pflegenden sahen hierin Ursachen von ethischen Konflikten in ihrem Berufsalltag. Vor allem in der grundsätzlichen normativen Bewertung des Themas „Ethik im Krankenhaus“ sind sich Medizin und Pflege einig. Gefragt nach der Bedeutung, die ethische Konflikte am Arbeitsplatz haben sollten, sagen insgesamt 83% der Befragten, dass sie „wichtig“ genommen werden sollten, wobei die Pflegenden mit 86% die Ärzte mit 82% nur leicht übertreffen. Selbst wenn sich dieser gemeinsame Wunsch und Anspruch in der Realität anders darstellen sollte, so bleibt er doch ein potenziell nützlicher gemeinsamer Ausgangspunkt für entsprechende Maßnahmen der ethischen Sensibilisierung und allgemeinen Teamentwicklung. 5.4.2. Unterschiede zwischen den Berufsgruppen Unterschiede zwischen den Berufsgruppen finden sich allerdings auch, z.B. bei der Benennung von Ursachen ethischer Konflikte: So sehen 47% der Ärzte „Probleme durch Ablauf und Organisation der Krankenversorgung“ entgegen 19% bei den Pflegenden. Umgekehrt nehmen 49% der Pflegenden ein „unklares Vorgehen, wie Entscheidungen getroffen werden“ wahr, was nur von 24% der Ärzte geteilt wird. Entscheidungsfindung und Organisation scheinen eher unterschiedlich bewertet zu werden, was die anekdotenhaften Alltagsschilderungen vieler Betroffener bestätigt und Anlass zu weiterer Klärung gibt: Ist die ärztliche Kritik an Organisation und Abläufen eher eine selbstkritische Haltung der eigenen Berufsgruppe gegenüber oder eine Kritik am pflegerischen Partner oder an der Verwaltung? Schließlich übernimmt der Pflegedienst oft auch organisatorische und steuernde Aufgaben. 121 Jeder zweite der Pflegenden wiederum scheint eine größere Transparenz von Entscheidungen zu wünschen, was Rückschlüsse auf die verbesserungsfähige Kommunikation und ggf. auch Kooperation zwischen den Berufsgruppen zulässt und damit ebenfalls keinen ganz unerwarteten Befund darstellt. 206 In diesem Zusammenhang ist gerade die „Visitenkultur“ von Bedeutung: Die gemeinsame Visite wird von vielen Pflegenden als ideale Gelegenheit beschrieben, um die Kommunikation und Kooperation der Berufsgruppen von Ärzten und Pflegenden zu verbessern. 207 Daher stellt sich für die stationäre Versorgung allgemein die Frage, ob gemeinsame Visiten von Ärzten und Pflegenden regelmäßig und zu verlässlichen Zeiten stattfinden und diese der Klärung weiterer medizinischer oder pflegerischer Maßnahmen bzw. Entscheidungen dienen, oder ob die Visiten nur unregelmäßig und eher als Gelegenheit zur ärztlichen Fortbildung genutzt werden. Mit der praktischen und symbolischen Bedeutung der Visite ist in jedem Fall sensibel und sorgsam umzugehen, da sich in ihr allzu leicht ein arztfixiertes Verständnis von Pflege als ausführender und zuarbeitender Hilfstätigkeit manifestieren kann. Diese Zuspitzung mag dazu dienen, den Empfindlichkeiten gerecht zu werden, die sich in den vergangenen Jahrzehnten mehr oder weniger stark entwickelt haben und die vielerorts einer konstruktiven Kommunikation und Kooperation von beiden Seiten entgegenstehen. Bei der Benennung derjenigen Personengruppen, mit denen ethische Konflikte erlebt und ausgetragen werden, zeigen sich neben einigen Gemeinsamkeiten auch deutliche Unterschiede zwischen den beiden großen Berufsgruppen: Pflegende wie Ärzte erleben danach an erster Stelle ethische Probleme mit Angehörigen von Patienten – allerdings unterschiedlich stark. Fast jeder vierte Arzt gibt an, ethische Konflikte sowohl mit Patienten als auch mit Angehörigen täglich zu erleben, was nur 6% bzw. 4 % der Pflegenden gleichermaßen so einschätzen. Dies könnte darin begründet sein, dass die Erwartungen von Patienten und Angehörigen an Erreichbarkeit, Zeit und Mitteilungsbereitschaft von Ärzten besonders groß ist und sich mehr oder weniger täglich zeigt. 206 Sachverständigenrat zur Begutachtung im Gesundheitswesen (2005), Lecher et al. (2002). Im Klinikum Nürnberg findet seit Anfang 2009 ein umfassendes Reorganisationsprojekt statt, die „Struktur- und Prozessoffensive“ (SPO). In diesem Rahmen wurde von März bis September 2010 ein Rahmenkonzept für die Weiterentwicklung der „Interprofessionellen Zusammenarbeit – Teil 1: Organisation Pflege und pflegenahe Dienste“ erarbeitet. In mehreren Workshops wurden von Pflegenden und Ärzten auf die wichtige Bedeutung der Visite hingewiesen. 207 122 Auch in Bezug auf die Kollegen aus der je anderen Berufsgruppe zeigt sich ein Unterschied zwischen Medizin und Pflege. Während nur jede fünfte Pflegekraft (21%) „täglich“ oder „wöchentlich“ ethische Konflikte mit ärztlichen Kollegen erlebt, sind es umgekehrt 41% der Ärzte, die „tägliche“ oder „wöchentliche“ ethische Konflikte mit Pflegenden angeben. Dies bestätigt, dass Ärzte diese Konflikte insgesamt öfter erleben, lässt allerdings Raum für Vermutungen, weshalb sich dieser Unterschied in der gegenseitigen Wahrnehmung darstellt. Die Antwort könnte auch sein: Pflegende haben – oder sehen – schlichtweg seltener ethische Probleme und dies eben auch mit den ärztlichen Kollegen der Station. Hinsichtlich der eigenen Vorgesetzten unterscheiden sich die Ergebnisse ebenfalls: Pflegende erleben hier ethische Probleme weder täglich (0%) noch wöchentlich (3%), Ärzte dagegen sowohl täglich (18%) als auch wöchentlich (24%). Diese Unterschiede könnten erneut darauf hindeuten, dass der ärztliche Dienst ethische Probleme insgesamt häufiger erlebt oder dass sich die Kommunikation von Ärzten mit ihren Vorgesetzen, ob Oberärzten oder Chefarzt, stärker auf medizinische Fragen und Entscheidungen zu einzelnen Patienten bezieht, während sich die Präsenz der Vorgesetzen im Bereich der Pflege weniger auf primär fachliche, also pflegerische wie ethische Belange bezieht, sondern stärker auf organisatorische Aufgaben des Managements. In der Einschätzung der Wichtigkeit ethischer Konflikte für die eigene und die andere Berufsgruppe nehmen Ärzte von sich und der Gruppe der Pflegenden an, ethische Konflikte in gleicher Intensität und Ausprägung zu erleben. Dies gilt für die Einschätzung von „wichtig“ ebenso wie für die Einschätzung „indifferent.“ Die befragten Pflegenden dagegen sehen durchaus Unterschiede in der Gewichtung der beiden großen Berufsgruppen: Aus ihrer Perspektive würden Ärzte sehr viel seltener ethische Konflikte als „wichtig“ ansehen (8% Medizin vs. 49% Pflege) und jeder fünfte Arzt würde ethische Konflikte sogar als „unwichtig“ betrachten (20% Medizin vs. 1% Pflege). Diese abweichende Selbst- und Fremdeinschätzung der beiden Berufsgruppen von Ärzten und Pflegenden deckt sich mit den Beobachtungen der bereits genannten Mitarbeiterbefragung zu ethischen Fragen an der Medizinischen Hochschule Hannover.208 208 Neitzke (2007), S.7. 123 Ein weiterer Aspekt unterschiedlicher Sichtweise zeigt sich bei der Einschätzung und dem Erleben der ökonomischen Rahmenbedingungen der stationären Versorgung – konkret beim Erleben ethischer Konflikte hinsichtlich der „Aufteilung knapper Mittel“. Während 78% der Pflegenden dieses Thema als „nie“ oder „eher selten“ problematisch erleben – was angesichts der steigenden ökonomischen Zwänge in der Klinik bemerkenswert erscheint – gilt dies nur für 41% der ärztlichen Mitarbeiter. In der ähnlichen Befragung an der Medizinischen Hochschule Hannover war die Frage der Ressourcenverteilung häufiger als wichtig eingestuft worden.209 Die Nürnberger Ergebnisse aus dem Jahr 2007 bestätigen damit die bereits erwähnten Beobachtungen einer Befragung am Klinikum Nürnberg von 2003, nach denen finanzielle Einschränkungen noch nicht allgemein als erschwerender Umstand bei Entscheidungen wahrgenommen wurden. Mit der Ökonomisierung der Klinik und der Verkürzung der Verweildauern zur Erzielung bestmöglicher Erlöse werden Fragen der Mittelaufwendung künftig stärker auf die Mikroebene der Station und des einzelnen Patienten wirken. Die Erzielung von Erlösen bzw. das Vermeiden von Verlusten und Verschwendung wird präsenter, was dem Einzelnen die Verantwortung auferlegt, ökonomische und medizinische bzw. pflegerische Fragen sinnvoll und gewissenhaft zu verbinden.210 5.4.3. Lösungsstrategien beider großer Berufsgruppen In der Wahrnehmung ethischer Konflikte im Stationsalltag finden sich also neben zahlreichen Gemeinsamkeiten auch deutliche Unterschiede. Abschließend geht es im Folgenden um gemeinsame oder unterschiedliche Lösungsstrategien von Ärzten und Pflegenden. Über die Kommunikation der beiden Berufsgruppen zeigen die vorliegenden Befragungsergebnisse, dass Ärzte wie Pflegende ethische Konflikte vor allem mit den Kollegen der eigenen Berufsgruppe besprechen, in vielen Fällen auch täglich, wobei Ärzte dabei stärker auch das Gespräch mit den Pflegenden suchen. Dies bestätigt eine gute regelmäßige Gesprächskultur im unmittelbaren Kollegenkreis, bedenklich erscheint aber, dass beide Berufsgruppen „seltener“ (als monatlich) bis „nie“ das Gespräch mit den Vorgesetzen suchen, sondern ethische Konflikte eher – 209 210 Neitzke (2007). Blum et al. (2008), Isfort/Weidner (2009). 124 und dann vor allem wöchentlich – im privaten Umfeld besprechen. Dies kann für Ärzte wie Pflegende gezeigt werden, ist bei letzteren aber weniger ausgeprägt. Auch wenn es verständlich und gut ist, dass ethische Konflikte nicht an der Stationstür zurückgelassen werden, sondern in angemessener (vertraulicher) Weise auch mit den nächsten Angehörigen besprochen und verarbeitet werden, lassen sich hierzu durchaus Fragen formulieren: Sind die eigenen Vorgesetzen für die Erörterung ethischer Konflikte ausreichend verfügbar und werden sie als fachlich kompetente Ansprechpartner erlebt? Besonders bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Ethikkreis der eigenen Klinik: Gefragt nach wichtigen Ethikangeboten für den klinischen Alltag, nennen beide Berufsgruppen mit Abstand als wichtigstes Angebot die „Möglichkeit, bei aktuellen ethischen Entscheidungssituationen eine ethisch kompetente Person als Berater hinzuzuziehen“. Gefragt nach den tatsächlich genutzten Ansprechpartnern werden ausgerechnet die beiden professionellen Ansprechpartner, die Klinikseelsorge und der hier untersuchte Ethikkreis, sowohl von Ärzten wie auch von Pflegenden eher „seltener“ (als monatlich) bis „nie“ genutzt. Dass sich auch hier wieder die beiden großen Berufsgruppen ähnlich verhalten, lässt das inhaltliche Ergebnis nicht positiver erscheinen. Das Ergebnis wirft Fragen auf, auch wenn es die geringe Kommunikation mit den eigenen Vorgesetzen wiederum relativiert: Gibt es organisatorische, inhaltliche, atmosphärische, gruppendynamische oder andere Gründe, die dem Einschalten des Ethikkreises entgegenstehen? Sind die Existenz und das Vorgehen des eigenen Ethikkreises trotz der internen Werbung auf der Ebene der Assistenzärzte nicht hinlänglich bekannt? Empfinden Ärzte die Beratung der Patienten und die gemeinsame Entscheidungsfindung doch als alleinige ärztliche Aufgabe? Wird die Initiative zum Hinzuziehen des Ethikkreises womöglich mehr oder weniger ausdrücklich abgelehnt oder gar unausgesprochen sanktioniert? „Das haben wir doch nicht nötig!“ Im Hinblick auf den Ausbau und die weitere Förderung des Ethikkreises sollte der gezeigte Befund Anlass sein, diese und weitere Fragen ausdrücklich zu diskutieren, um nicht mögliche Hemmnisse zu übersehen, die einer intensiveren Nutzung der Ethikberatung möglicherweise im Wege stehen. 125 5.5. Zusammenfassung des Kapitels Insgesamt lässt sich das Ergebnis der Mitarbeiterbefragung in der Medizinischen Klinik 4 am Klinikum Nürnberg im Sommer 2007 wie folgt zusammenfassen: - Ethische Konflikte gehören für Ärzte und Pflegende zum Alltag. - Sie werden mehrheitlich als „mittlere Belastung“ erlebt. - Beide Berufsgruppen nennen ähnliche Themen als häufig und schwerwiegend. - Diese Themen sind u.a. der Therapieabbruch oder Verzicht auf Wiederbelebung. - Ärzte haben vor allem Konflikte mit Angehörigen, Patienten und Vorgesetzen. - Pflegende erleben deutlich seltener ethische Konflikte mit anderen. - Ärzte wie Pflegende wollen, dass ethische Konflikte ernst genommen werden. - Beide Berufsgruppen beklagen Zeitmangel, Arbeitsbelastung, Kommunikation. - Ärzte sprechen über ethische Konflikte vor allem mit Kollegen und dem Team. - Pflegende sprechen eher mit den eigenen Kollegen über ethische Konflikte. - Ärzte und Pflegende thematisieren ethische Konflikte auch oft in der Familie. - Ärzte und Pflegende sprechen darüber kaum mit ihren Vorgesetzen. - Ärzte und Pflegende wissen durchaus von Experten in der eigenen Klinik. - Beide Gruppen suchen selten bis nie bei Konflikten Kontakt zu diesen Experten. - Ärzte und Pflegende finden theoretisch die aktuelle Fallberatung wichtig. Die ärztlichen und pflegerischen Mitarbeiter der Medizinischen Klinik 4 zeigen insgesamt eine ausgeprägte Wahrnehmung ethisch-moralischer Konflikte und diskutieren diese nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Umfeld. Dieses Interesse deckt sich mit der vergleichsweise großen Beteiligung an der Befragung selbst. Viele der hier genannten Ergebnisse zeigen große Übereinstimmung mit der Mitarbeiterbefragung an der MHH im Jahre 2005. In der Medizinischen Klinik 4 finden sich deutliche Gemeinsamkeiten bei Ärzten und Pflegenden in der Bewertung ethischer Konflikte in der Krankenversorgung. Erstaunlich ist allerdings die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Was theoretisch gewusst, begrüßt und gewünscht wird, wird praktisch nicht nachgefragt und genutzt. Diese Diskrepanz kann unterschiedlich begründet sein. Vielleicht stehen die Ursachen ethischer Konflikte – Zeitmangel, Arbeitsdruck, Kommunikationsdefizite etc. – zugleich ihrer Lösung im Weg. Wie eine solche Lösung aussehen könnte, zeigt die jetzt folgende Evaluation der Ethikberatung durch den Ethikkreis. 126 6. Evaluation der Ethikberatungen des Ethikkreises: 1999 bis 2011 6.1. Der Ethikkreis der Medizinischen Klinik 4 Mit seiner Entstehung und Geschichte bildet der Ethikkreis der Nephrologie auch die Entwicklung der modernen Medizin und Intensivmedizin ab, insbesondere der Nierenersatztherapie. Gerade die Möglichkeiten der Dialyse bedeuteten von Anfang an neben hilfreichen Therapieoptionen auch schwerwiegende Konflikte – in den 1960er Jahren zunächst die eingangs genannten Entscheidungen über wenige Dialyseplätze, heute etwa die heiklen Entscheidungen über das Fortführen oder Beenden einer Therapie. Diese für beide Seiten, Patienten und Angehörige wie Ärzte und Pflegende, belastende Situation hat im Klinikum Nürnberg ein Beratungsangebot hervorgebracht, das durch das Engagement der Mitarbeiter und die Befürwortung der ärztlichen bzw. pflegerischen Leitung möglich wurde und inzwischen seit fünfzehn Jahren aktiv ist. Als Würdigung der beteiligten Personen, sind diese im Folgenden namentlich genannt. 6.1.1. Entstehungsgeschichte Bereits 1989 initiierte der Oberarzt Dr. Bernd Höffken das Dialyseberatungsteam, das er gemeinsam mit der Krankenschwester Heidi Stephan sukzessive aufbaute und das 1991 um eine Mitarbeiterin der Seelsorge, Pfarrerin Ulrike Klein, einen Mitarbeiter des psychosozialen Dienstes, Sozialarbeiter Roland Haselbauer, und eine Mitarbeiterin der Klinik für Psychosomatik, Dr. Perdita Dobe-Tauchert, erweitert wurde. Ab dem Jahr 1999 kam Pfarrer Richard Schuster dazu. Aufgabe der Dialyseberatung war es, bei schwierigen Entscheidungen allen Beteiligten beratend und begleitend zur Seite zu stehen. Die verantwortliche Pflegekraft hatte mit einer speziellen Weiterbildung zur Beratung von Patienten die dafür notwendige Qualifikation erworben. Mit dem Ausscheiden von Bernd Höffken im Jahr 2002 übernahm Oberarzt Dr. Michael Leidig dessen Aufgaben, später kamen mit Hannelore Kraska-Junker und Pflegemanager Christof Oswald zwei weitere Pflegekräfte hinzu. Schon damals umfasste die Dialyseberatung folgende Aufgaben: - Medizinische Information - Aufklärung über die verschiedenen Nierenersatzverfahren - Berufliche Beratung - Psychosoziale Fragen 127 In den Jahren 1992 und 1995 gaben zwei besonders schwierige und belastende Einzelfälle den Anlass für ein außerordentliches Beratungsgespräch, zu dem die Dialyseberatung jeweils auch Ärzte, Pflegende, Patienten und Angehörige einlud. Über das erste Gespräch, das eine besondere Rolle auf dem Weg zur dauerhaften Ethikberatung spielte, berichtet die Krankenschwester Heidi Stephan: „1992 führten wir in unserer Klinik erstmals eine Ethikberatung in großem Kreise durch. Der Patient mit allen diabetischen Spätfolgen (Amputationen, schwere Einschränkung der Herzleistung, starke Sehschwäche und Kreislaufprobleme an der Dialyse) war ausgelaugt durch mehrere Jahre Dialyse und hatte keine Kraft mehr, er wollte die Behandlung beenden und äußerte diesen Wunsch bei jeder Dialyse. Trotz mehrerer Gespräche war er nicht von diesem Wunsch abzubringen. In einer Beratung mit Angehörigen, Ärzten und Pflegenden von Station und Dialyse sowie unserem Dialyseberatungsteam konnten wir uns zur damaligen Zeit aus Angst vor juristischen Konsequenzen nicht zu einem klaren Abbruch der Behandlung entscheiden. Der Beschluss dieser Besprechung (Ethikberatung) war die Entscheidung, eine ,Dialyse nach Laborwerten‘ durchzuführen.“211 Die „Dialyse nach Werten“ begann oft dann, wenn eine Dialyse für die Patienten zur kaum erträglichen Belastung geworden war. Zunächst wurden einzelne Dialysen ausgelassen, was bereits zum starken körperlichen Abbau und zum Tod führen konnte. Bei akuter Überwässerung oder zu hohem Kaliumgehalt folgte eine verkürzte Dialyse, dann wurde erneut ausgesetzt. Zur juristischen Absicherung der verantwortlichen Ärzte wurden fortlaufend Laborparameter bestimmt. Die „Dialyse nach Werten“ war aus vielen Gründen problematisch: Den Patienten wurde nur vordergründig geholfen. Sie erhielten zwar weniger Dialysen, erholten sich aber kaum und litten unter einem verlängerten Leiden und Sterben. Angeregt durch den Kongress „Medizin und Gewissen“ im Oktober 1996 unterstützten schließlich der damalige Chefarzt Prof. Dr. Bernd Sterzel und der Pflegedienstleiter Werner Ruder einen Vorschlag der Dialyseberatung, bewilligten die notwendigen Ressourcen und schafften damit die Voraussetzung dafür, neben der Dialyseberatung auch eine dauerhafte Klinische Ethikberatung einzurichten. So entstand 1997 der Ethikkreis der „4. Med.“, der sich vor allem den schwierigen Entscheidungen bei akuten und chronisch Kranken widmete und dabei nicht nur zu Fragen der Dialyse hinzugezogen wurde. 211 Aus der unveröffentlichten Abschlussarbeit Heidi Stephans im Fernlehrgang Ethikberater im Gesundheitswesen: „Kritische Betrachtung der Vorgeschichte, Entwicklung und Arbeitsweise des Ethikkreises der Medizinischen Klinik 4 am Klinikum Süd in Nürnberg“. Mit freundlicher Genehmigung der Autorin. 128 6.1.2. Selbstverständnis Zum Start der neuen Ethikberatung formulierten die Beteiligten ein klinikinternes Informationsblatt zur „Zielsetzung des Ethikkreises“,212 in dem es 1997 heißt: „Die langjährigen Erfahrungen von einigen Arbeitskollegen im Dialysebereich und auf der Intensivstation wollten wir auch anderen Stationen der Medizinischen Klinik 4 anbieten. Als Konfliktfelder kristallisierten sich an unserer Klinik heraus: Dialyseabbruch, Dialysebeginn, Beendigung intensivmedizinischer Maßnahmen.“ Die Gruppe legt damit Anliegen und Themen offen. Ihrem Selbstverständnis nach beschreibt sie sich als ein Beraterkreis, der gerufen werden kann, wenn es um eine Hilfestellung in Konfliktfällen geht, um die Vermittlung bei Entscheidungsfindungen oder um einen Beistand in schwierigen Situationen. Weiter heißt es: „Nur auf Anfrage einer Station werden wir aktiv. Wir sind kein übergeordnetes Gremium, das Entscheidungen trifft, sondern wir machen ein Gesprächsangebot, damit die Situation geklärt wird und eine getroffene Entscheidung von allen getragen werden kann. Wir bieten eine konfliktzentrierte Beratung an. Die letzte Entscheidung bleibt bei den Behandlern.“ Mit dem wichtigen letzten Satz war auch die Frage der Verantwortung geklärt. 6.1.3. Strukturen Der Ethikkreis ist interdisziplinär zusammengesetzt und bewusst hierarchiefrei. Zwei Jahre nach dem Start gehören ihm seit 1999 Jahren sieben Mitarbeiter an, - die verantwortliche Pflegekraft der Dialyseberatung - ein Pfarrer der evangelischen Klinikseelsorge - eine Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin/Psychosomatik - ein Internist und Oberarzt - zwei weitere Mitarbeiter/innen aus dem Pflegedienst - eine Diabetesberaterin Die ersten vier der Kollegen beraten regelmäßig. Der Ethikkreis trifft sich einmal im Monat zu inhaltlichen, organisatorischen und fallbezogenen Klärungen, und einmal pro Woche lädt die Dialyseberatung zu einer Fallbesprechung ein, an der auch Kollegen des Ethikkreises teilnehmen und sich gegenseitig supervidieren. 212 Dies umfasst ein vierseitiges Leitbild, das neben einer Standortbestimmung auch die Schwerpunkte der bisherigen Beratungsarbeit nennt und das Thema Behandlungsabbruch näher erläutert. Das Papier mit den Piepser-Nummern der Beteiligten diente als klinikinterne Information. 129 6.1.4. Abläufe Das Angebot des Ethikkreises steht allen Personen offen, die am Behandlungsund Betreuungsprozess beteiligt sind (u.a. Patienten, Angehörigen, Pflegenden, Ärzten). Es wird innerhalb der Klinik mit einem Faltblatt beworben. 213 Darin heißt es zum Ablauf: „Wie gehen wir vor? Nachdem wir gerufen werden, kommen wir normalerweise zu zweit und nehmen Kontakt auf mit dem, der uns gerufen hat; mit dem verantwortlichen Arzt; mit den zuständigen Pflegekräften; mit dem Patienten; bei Bedarf mit den Angehörigen.“214 Ein besonderes Charakteristikum des Nürnberger Ethikkreises ist seine große Nähe zum Stationsalltag. Die Schwester der Dialyseberatung besucht täglich sowohl die Dialysestation als auch die Normalstationen und steht damit in regelmäßigem Kontakt zu den pflegerischen und ärztlichen Kollegen. Die hier typischen Krankheiten (z.B. Diabetes mellitus, chronisches Nierenversagen) bringen es mit sich, dass sie viele Patienten bereits seit Jahren persönlich kennt, begleitet und ihren Krankheitsverlauf eng mitverfolgt. Die Initiative zu einer Ethikberatung entsteht oft während der täglichen Visiten der Dialyseberaterin, wenn diese von Ärzten oder Pflegenden darauf hingewiesen wird, dass sich bald die Notwendigkeit einer Ethikberatung abzeichnen könnte. Dabei sprechen sie häufiger Ärzte als Pflegende an, insbesondere Stationsärzte. Pflegende werden ebenfalls aktiv, zeigen aber in der Regel eher Zurückhaltung, u.a. aus Unsicherheit. Bei vielen Kontakten wird deutlich, dass die Möglichkeit einer Ethikberatung im Rahmen der Visite erörtert worden ist. 215 Wenn die konkrete Anfrage einer Ethikberatung erfolgt ist, kontaktiert die Schwester der Dialyseberatung zunächst eine weitere Person aus dem Ethikkreis. Sofern die Patienten nicht längst bekannt sind, informieren sich beide im Sinne der Auftragsklärung vorab bei den jeweiligen Ärzten und Pflegenden nach dem medizinischen und pflegerischen Stand der Patienten, den Handlungsoptionen, ihren Prognosen und dem sozialen Umfeld. Das Beratungsgespräch selbst, das meist ohne die verantwortlichen Ärzte und Pflegenden stattfindet, führen oft zwei Berater – möglichst unterschiedlichen Geschlechts – und in einer möglichst ungestörten Atmosphäre. 213 Siehe Anhang 9.3.5. Es handelt sich um ein sechsspaltiges mehrfarbiges Faltblatt, das regelmäßig auf Stationen ausgelegt wird und in größeren Abständen aktualisiert wird. 215 Persönliche Mitteilung der Dialyseberaterin im Rahmen eines Interviews im November 2010. 214 130 Bei bettlägerigen Patienten in Zweibettzimmern werden die jeweils anderen Patienten für den Zeitraum des Gesprächs in ein anderes Zimmer oder auf den Gang gefahren. Wenn die Patienten mobil sind, findet das Gespräch gesondert in einem anderen Raum statt. Zu Beginn des Gesprächs stellen sich die Berater zunächst in ihrer Rolle vor, wobei die Institution und der Begriff „Ethikkreis“ immer explizit genannt werden, um allen Beteiligten den Rahmen des Gesprächs transparent zu machen. Eine eindeutige Rollenverteilung der Beratenden gibt es nicht, im Gegenteil: Beide Berater ergänzen sich im Verlauf des Gesprächs, indem sie es der Situation überlassen, zu wem der beiden der Patient oder die Angehörigen schneller einen Kontakt und die notwendige Nähe aufbauen. Gerade bei Patienten, die nur noch mühsam kommunizieren können, eher müde oder geschwächt sind und am Gespräch eventuell nur mit geschlossenen Augen teilnehmen können, spielt selbst der Klang der Stimme der Berater eine wichtige Rolle, vor allem in der persönlichen Kontaktaufnahme und den ersten Gesprächsmomenten. „Wir vergessen da auch oft unsere eigentliche Profession“, so die Dialyseberaterin Heidi Stephan über ihre Gesprächsführung im Rahmen der Ethikberatung. Beide Berater sind durch die entsprechende Vorinformation von Ärzten, Pflegenden und der Krankenakte in der Lage, den Patienten und ihren Angehörigen oder Betreuern medizinische Fragen und Fragen zur Prognose zu beantworten. Häufig berühren die Fragen den Sterbeprozess und das Sterben selbst: „Wie lange wird es dauern?“ – „Wird es Schmerzen machen?“ – „Was werde ich davon mitbekommen?“ Das Gespräch des Ethikkreises endet meist mit einer ausdrücklichen Empfehlung. Der Ethikkreis spricht zunächst mit dem behandelnden Team, um ihm nach der Beratung eine konkrete Empfehlung zu geben, die auch schriftlich in der Akte dokumentiert wird. Im Anschluss daran, in der Regel noch am selben Tag, wird ein Protokoll verfasst, das vom Protokollanten und grundsätzlich auch vom zweiten Berater unterzeichnet und in der Krankenakte abgeheftet wird. In der Regel wird das Ethikprotokoll auch im Entlassungsbrief ausdrücklich erwähnt. Die Ethikberatung im Rahmen des Ethikkreises kann damit gelegentlich den Charakter eines „Ethik-Konsils“ erhalten, was dem eigentlichen Selbstverständnis des Ethikkreises allerdings weniger entspricht, da so die gemeinsame Reflektion aller Beteiligten eher weniger befördert wird. 131 Im Sinne der Empfehlung heißt es in der schriftlichen Mitarbeiterinformation: „Wir können Hilfestellung in Konfliktfällen mit Patienten geben; als Außenstehende die unterschiedlichen Sichtweisen eines Problems wahrnehmen; durch Gespräche mit den Beteiligten zu einer Entscheidung beitragen; Beistand in schwierigen Situationen leisten; die juristischen Aspekte einbringen und Ihnen eine Empfehlung für das weitere Vorgehen mit dem Patienten geben.“216 Damit, so der Ethikkreis weiter, spare das behandelnde Team aus Ärzten und Pflegenden „Zeit und Energie durch die Klärung einer Situation“, „können zeitraubende Gespräche mit Patienten und Angehörigen“ abgenommen werden, „aufreibende, wiederkehrende Einzeldiskussionen wegfallen“ und somit patientenorientierte Entscheidungen das Behandlungsteam entlasten. Der Ethikkreis der Medizinischen Klinik 4 strebt ausdrücklich eine Entlastung des übrigen Personals an, was Vor- und Nachteile mit sich bringt und im weiteren Verlauf der Arbeit noch diskutiert wird. Diese Funktion der Entlastung der Mitarbeiter und in gewisser Weise auch „Burn-out“-Prophylaxe wurde bei der Befragung von Ärzten und Pflegenden an der Medizinischen Hochschule Hannover ebenfalls bestätigt. 6.1.5. Standardisierte Entscheidungshilfen Hier sei auch die Erarbeitung von Leitlinien erwähnt, die zu den klassischen Aufgaben217 Klinischer Ethikkomitees gehört und auch vom „Ethikkreis“ geleistet wurde. Der Einsatz einer „Anordnung zum Verzicht auf Wiederbelebung“ (VaW), angelehnt an ein Verfahren am Erlanger Universitätsklinikum, wurde vom Pflegemanager Christof Oswald 2004 für die Medizinische Klinik 4 adaptiert und im Rahmen eines Projektes eingeführt. Nach einer neunmonatigen Erprobung der VaW-Anordnung und einer anschließenden Evaluation wurde sie ab 2005 in der Regelversorgung der Klinik etabliert.218 Die Entwicklung praxisrelevanter Standards und Entscheidungshilfen ist für die nachhaltige Unterstützung der eigentlichen Ethikberatung hilfreich. Ihre Bekanntgabe und Vermittlung im Zuge von Fortbildungen und Informationsveranstaltungen dient zugleich der internen Öffentlichkeitsarbeit für das eigentliche Angebot der Ethikberatung. 216 Aus der Mitarbeiterinformation, Siehe Anhang 9.3.5. McGee (2001). 218 Oswald (2008) sowie Oswald (2009) als Evaluationsstudie. 217 132 6.2. Evaluationsmethode 6.2.1. Anzahl und Form der Beratungsprotokolle Die systematische Auswertung der Ethikberatungen in der Medizinischen Klinik 4 am Klinikum Nürnberg bezieht sich auf den Zeitraum zwischen Januar 1999 und September 2011. Für diesen Zeitraum liegen 262 schriftlich dokumentierte Protokolle vor, wobei zum Teil ein einzelnes Protokoll mehrere Beratungen bzw. Einzelgespräche dokumentiert. Die Beratungen des Ethikkreises wurden in den ersten beiden Jahren 1997 und 1998 nicht schriftlich festgehalten und erst ab 1999 dokumentiert, wenn auch zunächst nur uneinheitlich. Die ersten beiden Protokolle stammen vom Januar und April 1999 und wurden auf einem offiziellen Formular der Medizinischen Klinik 4 geschrieben, bezeichnenderweise einem Konsilantrag. Sie sind handschriftlich verfasst, etwa zehn Zeilen lang und namentlich unterschrieben. Name und Vorname der Patienten sind genannt, allerdings ohne weitere Angaben zu Geburtsdatum oder Haupt- und Nebendiagnosen. Für die hier vorgestellte Untersuchung wurde jeweils das Geburtsdatum, sofern es fehlte, aus den Krankenakten nachermittelt. Das erste nicht-handschriftliche Protokoll stammt vom Oktober 2000 und wurde auf einem Blankopapier dokumentiert, d.h. auf keinem offiziellen Briefbogen oder Formular der Klinik oder des Klinikums. Die Wahl des Formblattes bleibt zunächst uneinheitlich, bis der Ethikkreis seit 2003 mit nur wenigen Ausnahmen den Briefbogen der „Medizinischen Klinik 4“ benutzt und darauf ausdrücklich als „Ethikkreis“ firmiert. Für die Wiedererkennung der Protokolle im klinischen Alltag und für ihre Akzeptanz sind diese Aspekte der Dokumentation von Bedeutung und deshalb ausdrücklich erwähnt. Die Protokolle wurden überwiegend von vier Personen geschrieben, etwa die Hälfte von der verantwortlichen Pflegekraft der Dialyseberatung. Nahezu alle 262 Protokolle wurden handschriftlich von den teilnehmenden Kollegen des Ethikkreises unterschrieben. Keines der Protokolle trägt eine Unterschrift anderer Gesprächsteilnehmer. Die Protokolle verteilen sich entsprechend der folgenden Tabelle ungleichmäßig auf die untersuchten Jahre. Zu Beginn fanden vergleichsweise wenige Beratungen statt oder wurden als solche dokumentiert, in den Jahren 2007 und 2008 bewirkte vermutlich die klinikinterne, im vorangegangenen Kapitel beschriebene Befragung den deutlichen Anstieg der Beratungen. 133 60 48 50 46 40 33 29 30 Anzahl der Beratungen 24 18 20 10 7 2 4 5 21 20 5 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 0 Abbildung 2: Anzahl der Protokolle pro Jahr (2011 bis 30.09.2011) In die Untersuchung wurden diejenigen Protokolle einbezogen, die ein stattgefundenes Beratungsgespräch dokumentieren. Fünf Protokolle geben lediglich den Klärungsprozess der Vorbereitung der Beratung wieder, z.B. ein Informationsgespräch mit Ärzten oder Pflegenden. Das eigentliche Beratungsgespräch mit Mitgliedern des Ethikkreises fand dann nicht statt, da die Patienten unmittelbar nach dem Vorbereitungsgespräch verstarben. Diese Protokolle wurden daher nicht berücksichtigt. Andere Gründe für einen abgebrochenen Beratungsprozess fanden sich nicht. Vor diesem Hintergrund schließt die vorliegende Untersuchung des Ethikkreises der Medizinischen Klinik 4 von den 262 Protokollen insgesamt 257 Protokolle ein. 6.2.1. Auswertungsbogen Für ihre Auswertung wurden die weitgehend unstrukturierten Protokolle zunächst chronologisch nummeriert und auf der Grundlage eines für die Untersuchung entworfenen Auswertungsbogens 219 analysiert. Der Bogen umfasst neben dem Jahr der Protokollierung drei Kategorien von Angaben: 219 Auswertungsbogen siehe Anhang 9.3.3. 134 Kategorien Personenbezogen Einzelaspekte Geschlecht und Alter Fragestellung der Beratung, Orientierungsfähigkeit des Patienten, Fallbezogen Gesprächsbezogen Patientenwille, Patientenverfügung, Teilnehmende, Gesprächsanzahl Gesprächsverlauf, Konsensbildung, Empfehlungen Tabelle 27: Aufbau des Auswertungsbogens Die Unterscheidung in fallbezogene und gesprächsbezogene Angaben erfolgt zur besseren Beurteilung des Gespräches selbst. Wegen des begrenzten Umfangs vieler Protokolle war eine etwa semantische Untersuchung der Beratungen nicht möglich. Um dennoch einen differenzierten Eindruck von den Protokollen zu ermöglichen, werden sie auszugsweise zitiert. Um inhaltliche Verfälschungen zu vermeiden, wurden die Auszüge redaktionell nicht bearbeitet. 6.3. Ergebnisse 6.3.1. Geschlecht und Alter der Patienten Die Verteilung der Geschlechter ist nahezu ausgewogen. 51% der Patienten waren männlich, 49% weiblich. In der Altersverteilung ergibt sich folgendes Bild: 39% der Patienten gehörten zur Altersgruppe zwischen 80 und 89 Jahren, gefolgt von 30% der Patienten zwischen 70 und 79 Jahren. Lediglich 5% der Patienten waren 49 Jahre alt oder jünger, 7% der Patienten allerdings auch über 90 Jahre alt. Abbildung 3: Anzahl der Ethikberatungen je Altersgruppe 135 6.3.2. Fragestellungen in der Ethikberatung Zur quantitativen Erfassung der wesentlichen Fragestellungen wurden nach einer Sichtung der Protokolle zunächst sechs inhaltliche Schwerpunkte gebildet, wobei auch mehrfache Zuordnungen zu diesen Schwerpunkten möglich waren. Ihre Festlegung orientierte sich am untersuchten Patientenkollektiv. Es ergaben sich dabei folgende Themen: - Fragen zur Dialyse - Allgemeine Therapiefragen - Verzicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen (VaW) - Ernährung bzw. Anlegen einer Magensonde (PEG) - Fragen der Pflege bzw. Unterbringung in Heim oder Hospiz - Sonstige Themen Zu den 257 untersuchten Protokollen wurden anhand des Auswertungsbogens insgesamt 312 thematische Zuordnungen und Anlässe getroffen, allein 181 (d.h. 70% der Protokolle) zum Thema „Dialyse“, gefolgt von 52 Zuordnungen zu „Allgemeine Therapiefragen“, 25 zu „Ernährung/PEG“, 22 zu „Verzicht auf Wieder-belebungsmaßnahmen/VaW“, 17 zum Thema „Pflege, Heim, Hospiz“ und 15 weitere Zuordnungen zu „sonstigen Themen“. Sonstige 15 Heim/Hospiz 17 VaW 22 Ernährung/PEG 25 Allg. Therapie 52 Dialyse 181 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Abbildung 4: Anzahl der Fragestellungen pro Themenschwerpunkt 136 6.3.3. Teilnehmende Gesprächspartner Die Ethikberatungen des Ethikkreises finden wie beschrieben zweigeteilt statt: Zunächst führen die Ethikberater ein Informations- oder Vorgespräch mit den involvierten Ärzten und Pflegenden, von denen in vielen Fällen auch die Initiative zur Ethikberatung ausgeht. Dann folgt das eigentliche Beratungsgespräch, das entsprechend der Protokolle von beiden Seiten in unterschiedlichen Besetzungen geführt wird. Die häufigsten Konstellationen auf Seiten der Anfragenden sind: - Patient und Angehörige (z.T. als Betreuer) 33% - allein Angehörige (z.T. als Betreuer) 27% - allein Patient 14% - Patient, Angehörige und Mitarbeiter 10% - allein Mitarbeiter (von der Station) 5% - Angehörige und Mitarbeiter 7% - andere Settings 4% Gesehen wird jeder Patienten und an mehr als der Hälfte der Ethikberatungen (57%) nimmt der Patient auch selbst teil. Die dabei ermittelten Einschränkungen sind Gegenstand des nächsten Abschnitts. Auf Seiten des Ethikkreises verteilt sich die Teilnahme für den Zeitraum von Januar 1999 bis September 2011 auf insgesamt sieben Personen (vier Ärzte, zwei Pflegekräfte und ein Seelsorger), von denen eine der Pflegekräfte, der Seelsorger und zwei Ärzte ca. 90% der Ethikberatungen durchgeführt haben. Über die größte Erfahrung verfügt die für Dialyseberatung verantwortliche Pflegekraft. Sie ist in 230 der 257 Protokolle (89%) als Teilnehmende genannt und hat viele der Gespräche dokumentiert, wobei sehr viele Protokolle gemeinsam verfasst werden. Die Teilnahme des Ethikkreises an den 257 untersuchten Ethikberatungen gliedert sich wie folgt. Die Ärzte des Ethikkreises sind dabei nicht als Behandler, sondern als Ethikberater tätig. Die Gespräche finden fast immer zu zweit statt. - Pflegekraft/Seelsorger 46% der Beratungen - Pflegekraft/Arzt 32% der Beratungen - Seelsorger/Pflegekraft/Arzt - Arzt/Seelsorger - andere Konstellationen 9% der Beratungen 10% der Beratungen 137 3% der Beratungen 6.3.4. Orientierung und Kontaktfähigkeit der Patienten Da an mindestens jeder zweiten Ethikberatung auch die Patienten selbst teilnehmen, ist eine mögliche körperliche oder geistige Einschränkung ihrer Teilnahme in Betracht zu ziehen. Aus den Protokollen ist erkennbar, dass die Fähigkeit zu Orientierung und Kontaktaufnahme in 43% der Fälle gegeben war. Diese Fähigkeit wurde entweder ausdrücklich erwähnt oder konnte aus den Gesprächsschilderungen indirekt geschlossen werden: „Am Anfang war Frau B. noch kontaktfähig und örtlich und zeitlich orientiert.“ (Protokoll 17) In 19% der Fälle waren laut Protokollen die Orientierung und Kontaktfähigkeit der Patienten nur eingeschränkt vorhanden: „Sie selbst ist kontaktierbar, kann sich aber nicht mehr äußern.“ (Protokoll 57) „Herr B. wirkte urämisch und teilweise auch desorientiert.“ (Protokoll 62) „Wir versuchten zunächst Kontakt mit dem Patienten aufzunehmen, der sich jedoch sehr schwierig gestaltete, weil Herr M. sehr schwerhörig und weil er in seiner geistigen Beweglichkeit sehr eingeschränkt ist. Er äußerte jedoch seine Zufriedenheit, forderte energisch Kaffee und Kuchen und bot keinerlei Anzeichen, dass er keine Dialyse wollte.“ (Protokoll 92) In 26% der Gespräche waren laut Beratungsprotokollen die Orientierung und Kontaktfähigkeit der Patienten nicht gegeben bzw. nicht möglich: „Der Patient war zu diesem Zeitpunkt schon dement.“ (Protokoll 71) „[...]führten wir ein ausführliches Gespräch mit dem Ehemann von Frau E. (zugleich ihr Betreuer) über das weitere medizinische Vorgehen bei seiner Frau. Sie selbst war nicht mehr kontaktfähig. Auf einfache Aufforderungen, z.B. die Augen zu öffnen, hat sie nicht eindeutig reagiert.“ (Protokoll 40) „Hier war der Patient nicht kontaktfähig. Wiederholt war es bei versuchter Kontaktaufnahme zu einem scheinbaren Wahrnehmen der Gesprächspartner gekommen. Nach kurzer Zeit hat der Patient aber jeweils die Augen geschlossen. Eine augenblickliche Willensäußerung war nicht zu eruieren.“ (Protokoll 29) In weiteren 12% der Fälle fanden sich in den Protokollen zu den Aspekten Orientierung und Kontaktfähigkeit keine eindeutig verwertbaren Aussagen. Sie fehlten entweder vollständig oder waren missverständlich und zu einem kleineren Teil auch widersprüchlich formuliert. 138 6.3.5. Kenntnis des Patientenwillens In Ergänzung der Frage nach Orientierung und Kontaktfähigkeit der Patienten stellte sich die Frage nach dem Vorliegen bzw. der Kenntnis eines ausdrücklichen Patientenwillens. Dieser galt bei der Auswertung der Protokolle dann als bekannt, wenn er durch den teilnehmenden Patienten im Gespräch selbst geäußert, von den Angehörigen oder Betreuern indirekt geschildert und gemutmaßt wurde oder wenn er in Form einer Patientenverfügung vorlag – mit der Einschränkung, dass weder der mutmaßliche Wille noch eine Äußerung im Rahmen einer Patientenverfügung stets mit der vorliegenden Situation eindeutig übereinstimmen muss, was in vielen Gesprächen wiederum zu Kontroversen führen kann. In mehr als der Hälfte der untersuchten Protokolle (58%) wird der Patientenwille im hier genanten Sinne als „bekannt“ und „eindeutig“ beschrieben: „Heute führten wir mehrere Gespräche mit Frau T. hinsichtlich weiterer medizinischer Maßnahmen bei fortgeschrittener pAVK durch. Frau T. äußerte mehrfach klar, dass sie keine weiteren Maßnahmen (diagnostischer oder operativer Art) wünscht und umgehend wieder ins Pflegeheim zurückverlegt werden möchte. Hingegen wünscht sie die weitere Durchführung ihrer chronischen Dialysebehandlung.“ (Protokoll 102) In 19% der Fälle galt der Patientenwille als „ambivalent“ und „uneindeutig“: „Herr D. schwankt in seinen Aussagen sehr. So äußerte er, dass er nicht mehr könne, er auf keinen Fall in das von der Nichte avisierte Heim gehen wolle. Zu einer exakten Aussage jedoch, die Dialyse zu beenden, konnte sich der Patienten nicht durchringen. Diese Ambivalenz ist dem Patienten jedoch bewusst. Sein letzter Satz war die Bitte um Entschuldigung, dass er sich nicht entscheiden könne.“ (Protokoll 11) „Herr H. ist uns schon seit mehreren Wochen bekannt und es wurden [...] viele Gespräche geführt, in denen er schon immer sehr schwankend war und konkrete schon gefasste Entscheidungen mehrmals änderte.“ (Protokoll 184) „In dem heutigen Gespräch zeigte sich der Patient aggressiv und uneinsichtig, er äußerte nur immer wieder den Wunsch, dass er sterben wolle, dazu sollten wir ihm auch verhelfen, wenn er aus dem Krankenhaus entlassen werde, werde er sich sofort aufhängen. Er leide, könne nicht mehr laufen, nicht mehr schlafen und keinen Urin lassen. Sein Sohn bestätigte, dass der Vater sterben wolle, sie stünden auch hinter dem Wunsch des Vaters, damit ist auch der Bruder gemeint und die Ehefrau, die auch schwer herzkrank ist. Auffallend war, dass der Patient immer wieder die gleichen Worte gebrauchte, so dass der Schluss nahe liegt, dass der Patient urämisch so verändert ist, dass eine Einschätzung seiner Geschäftsfähigkeit sehr schwer fällt, trotzdem schien der Patient am Schluss nachdem ihm mehrfach erklärt worden war, dass sein Zustand reversibel sein könnte, ins Nachdenken gekommen zu sein.“ (Protokoll 79) 139 In 23% der Fälle wird der Patientenwille als „unbekannt“ festgehalten oder es fehlten in den Protokollen entsprechende Angaben bzw. Informationen: „Ein schriftlicher Wille des Patienten liegt nicht vor. Die Patientenverfügung wurde laut Aussage der Familie von seinen Angehörigen verfasst. Der Patient war zu diesem Zeitpunkt schon dement. Ein mutmaßlicher Wille zum Dialyseabbruch wurde vom Patienten nicht geäußert. Auch in anderen Dingen überließ er die Entscheidungen seiner Ehefrau.“ (Protokoll 71) 6.3.6. Patientenverfügungen Lückenhaft sind die Protokolle bezüglich der Angaben zum Vorliegen einer Patientenverfügung. Erst seit der Überarbeitung des Dokumentationsbogens „Ethikkreis“ im Jahr 2009 wird das Vorliegen einer Patientenverfügung im Protokoll systematisch abgefragt und festgehalten. Insgesamt findet sich daher in 67% der Fälle keine Erwähnung einer Verfügung oder einer Vorsorgevollmacht und nur in 16% der Fälle wird das Vorliegen einer Patientenverfügung ausdrücklich bestätigt. In 17% der Fälle wird das Fehlen einer Verfügung erwähnt. 6.3.7. Anzahl der Beratungsgespräche In der überwiegenden Zahl der Fälle (64%) hat die eigentliche Ethikberatung innerhalb eines einzigen Gesprächs stattgefunden, in fast jedem dritten Fall (29%) waren es zwei bis drei Gespräche und in 7% der Fälle mehr als drei Beratungsgespräche. Der umfangreichste Beratungsprozess fand im Sommer 2011 statt mit insgesamt neunzehn Einzelgesprächen innerhalb von acht Wochen. Schätzungsweise beziehen sich die hier ausgewerteten 257 Protokolle auf etwa 430 einzelne Beratungsgespräche. Grundsätzlich versuchen die Ethikberater, den Kontakt auch nach dem Beratungsprozess in geeigneter Form zu halten. 6.3.8. Gesprächsverlauf Der Gesprächsverlauf kann den Charakter und das Grundverständnis der Beratun g widerspiegeln, sofern er sich aus den Protokollen angemessen nachvollziehen lässt. Angesichts der zum Teil sehr kurzen und prägnanten Protokolle, die weniger Verlaufs- als Ergebnisprotokolle darstellen, ist dies – wie oben beschrieben – nur eingeschränkt möglich. Dennoch enthalten die vorliegenden Protokolle hilfreiche Informationen und weiterführende Hinweise: In der Mehrheit (59%) vermitteln sie einen unstrittigen Gesprächsverlauf, 36% der Beratungen verliefen dagegen kontrovers und 5% waren nicht eindeutig zuzuordnen. 140 Unstrittig meint hier einen Verlauf der Beratung, in dem sich bei den Beteiligten weder intra- noch interpersonelle Konflikte oder Ambivalenzen zeigen, die das Gespräch prägen und einer gemeinsamen oder vom Patienten gefällten Entscheidung entgegenstehen. Bei unstrittigen Gesprächsverläufen scheint die Beratung eher der Bestätigung bzw. Vergewisserung und/oder Dokumentation vorliegender Haltungen zu dienen, wie auch in den folgenden drei Fällen: „Wie schon in vorherigen Kontakten angesprochen, empfand Frau R. die Dialyse immer als Belastung. Im Rückblick scheint Frau R. in den Wochen vor ihrer Einlieferung ins Krankenhaus von Bekannten und der Familie Abschied genommen zu haben. Sie wollte nie ein Pflegefall sein. Es wurde deutlich, dass Frau R. in ihrem augenblicklichen Zustand keine weiteren lebensverlängernden Maßnahmen und keine Dialyse mehr will. Die Familie bittet auch ausdrücklich darum, nur noch schmerzstillende und ihr Leid lindernde Medikamente zu verabreichen.“ (Protokoll 47) „Nachdem die Dialyse am Vortag wegen schlechten Blutdrucks abgebrochen werden musste und sich der gesundheitliche Zustand weiter verschlechterte, wollten alle Beteiligten von weiteren Behandlungen und Dialysen absehen. Schon beim letzten Krankenhausaufenthalt sprach die Patientin zu ihrer Familie, dass es doch besser gewesen wäre, wenn sie hätte sterben können. Die Familie wünscht keine weitere Diagnostik und Therapie.“ (Protokoll 170) „Der Patient wurde uns als sehr selbstbestimmend beschrieben, was sich a uch in den klaren Festlegungen der Patientenverfügung zeigt. Alle Beteiligten (Ärzte, Familie und Ethikkreis) sind gemeinsam der Meinung, dass die in der Patientenverfügung beschriebene Situation eingetreten ist und die weitere Behandlung eingestellt werden sollte.“ (Protokoll 168) Gegenüber diesen unstrittigen Ethikberatungen verliefen 36% der protokollierten Gespräche bzw. Beratungen kontrovers. Unter kontroversen Gesprächen sind hier solche zu verstehen, in deren Verlauf unterschiedliche oder auch gegensätzliche Auffassungen der Beteiligten sowie ihre Ambivalenzen sichtbar wurden und teils bestehen blieben. In den als kontrovers bezeichneten Gesprächen: - zeigen sich gegensätzliche Vorstellungen: „Frau W. gab uns gegenüber an, dass ihr Exehemann, mit dem sie jedoch immer noch eine gute Beziehung hält, ihr gegenüber Todeswünsche ausgesprochen habe. Er wünsche auch nicht, reanimiert zu werden, so wie er nicht an irgendwelchen Schläuchen hängen wolle. [...] Nachdem mit Frau W. ein Gespräch geführt worden war, meldete sich der gemeinsame Sohn und sprach sich gegen eine VaW-Anordnung aus. Er befürwortete, dass bei seinem Vater alle möglichen Behandlungsmaßnahmen durchgeführt werden sollten, was im Gegensatz zu oben angeführten Willensäußerungen stand.“ (Protokoll 63) 141 - finden auffallende Themenwechsel statt: „Seit sie im betreuten Wohnen lebt und vermehrt in den letzten Wochen äußerte sie häufig, nicht mehr leben zu wollen. Dabei sprach sie nie von einem Dialyseabbruch. Im gemeinsamen Gespräch mit der Patientin fragten wir konkret nach einer VaW. Die Patientin reagierte unruhig und wechselte das Thema.“ (Protokoll 138) - wird ein besonderer Entscheidungsdruck aufgebaut: „Wir erhielten den Auftrag, mit dem Sohn und Bevollmächtigten der Patientin zu sprechen, weil der trotz einer aussichtslosen Situation auf eine weitere Dialyse und eine Verlegung auf eine Intensivstation gedrängt hatte. Wir führten ein Gespräch mit dem Sohn und anschließend mit der Patientin. Im dem Gespräch zeigte sich, dass der Sohn unter einem massiven Druck von Seiten der Mutter steht, sie zu retten.“ (Protokoll 160) - findet offensichtlich Verdrängung statt: „Wir wurden von der Station gerufen, um mit der Familie des Herrn S. über die Aussichtslosigkeit seiner Erkrankung und seinen mutmaßlichen Willen zu weiteren Dialysen zu eruieren. Zunächst hatten die vier Kinder des Patienten große Schwierigkeiten, die Verdrängung der schweren Erkrankungen aufzugeben. Im Laufe des Gespräches konnten sie sich mit dem Sterben des Vaters auseinander setzen und ihre Trauer zulassen.“ (Protokoll 139) - gibt es eine starke Zurückhaltung bzw. Abwehr des Patienten: „Frau E. gab an, dass der Patient mit ihr nicht sprach, so dass sie keine Informationen erhielt bezüglich des weiteren Vorgehens. Auch mit uns sprach der Patient wenig, er äußerte auf Nachfragen nur mit Ja und Nein, wobei eine große Aggressivität spürbar war.“ (Protokoll 180) - zeigen sich psychische Auffälligkeiten: „Inhalt der Beratung war ihre Ablehnung jeglicher Behandlung. In dem Gespräch hatten wir den Eindruck, dass Frau V. trotz ihrer starken Willensäußerungen, die Behandlung abzubrechen, nicht gefühlskongruent sei. Wir hatten die Vermutung, Frau V. sei depressiv und baten, einen Psychiater hinzuzuziehen und vorerst die Behandlung weiter zu führen.“ (Protokoll 154) - gibt es medizinische Verständnislücken: „Inhalt der Beratung war die Information zur Dialyse und die Frage des Dialysebeginns. Frau S. wehrte sich vehement gegen die Dialyse und ließ keine Argumente zu. Es war sehr schwer, einen Zugang zu ihr zu finden. Auch die Tochter war anfangs gegen die Dialyse, verstand aber im Laufe des Gespräches die Lebensbedrohung.“ (Protokoll 157) Da ein erheblicher Anteil der Ethikberatungen in diesem Sinne kontrovers verlief, stellt sich zwangsläufig die Frage, mit welchem Ergebnis die Gespräche endeten und ob es zu einer gemeinsamen Konsensbildung kam. 142 6.3.9. Konsensbildung In 89% der Fälle bestand den Protokollen zufolge in bzw. nach den Beratungen des Ethikkreises ein ausdrücklicher Konsens zwischen den Beteiligten oder konnte ein solcher im Verlauf mehrerer Gespräche erreicht werden. Konsens meint dabei am Gesprächsende eine übereinstimmende Einschätzung der Gesamtsituation – wie im diesem Fall, wo sich aber der Patient selbst aktuell nicht mehr äußern konnte. „Zu der konkreten Situation der Weiterbehandlung hier im Krankenhaus hat sich der Patient direkt nie geäußert, wie er auch sonst nie über Gefühle oder das Sterben sprach. Viele indirekte Hinweise in seinem Verhalten und seinem vorher gelebten Weltbild weisen aber darauf hin, dass er mit einer PEGAnlage, die zu einer Verlängerung seiner jetzigen Situation führen würde, nicht einverstanden wäre. Dies entspricht auch der einhelligen Meinung seiner Kinder und seiner Familie. Empfehlung: Keine PEG-Anlage. Verlegung ins Hospiz, Ziehen der Magensonde dort. Subcutane Gabe von Infusionen zur Durstlinderung.“ (Protokoll 29) Manchmal braucht Konsensbildung Zeit. Das folgende Protokoll dokumentiert zwei Ethikberatungen, durch die sich erst im Verlauf einer Woche eine gemeinsam getragene Entscheidung langsam entwickelte: „[...] führten wir ein Gespräch mit Herrn J. und mit seinem Neffen (Betreuer), Herrn B.. Zunächst wirkte der Patient müde und abwesend, auf Ansprache öffnete er die Augen und war ansprechbar, gab Angaben zum Befinden und antwortete auf unsere Fragen. Besonders stark reagierte er auf die Fragen zur Beziehung zu seinem Neffen. Er drückte sein Vertrauen ihm gegenüber deutlich aus. Wir sprachen die Dialyse an, zunächst schloss er die Augen und reagierte nicht. Überraschenderweise sagte er dann sehr klar, er könne sich nicht vorstellen, drei mal in der Woche zu dialysieren, wäre aber im Moment mit einem mal einverstanden, um es zu versuchen. Auch der Neffe stimmte dem Versuch einer Dialysebehandlung zu. Für ihn war es eine Entlastung, dass Herr J. selbst eine Aussage getroffen hat. Empfehlung: Herr J. wird weiter von uns begleitet. Der Betreuer kümmert sich um einen Hospizplatz. Je nach Zustand des Patienten sollte über die weitere Dialyse in den nächsten Tagen noch einmal beraten werden.“ (Protokoll 54) Im gleichen Protokoll ist eine acht Tage später erfolgte Beratung dokumentiert: „Wir führten heute ein erneutes Gespräch mit Herrn B. und Dr. NN. Übereinstimmend stellten wir fest, dass sich der Zustand und die Kontaktierbarkeit von Herrn J. im Vergleich zur letzten Woche deutlich verschlechtert hat. Nach unserem Eindruck zieht sich der Patient seit letztem Freitag immer mehr zurück, reagiert nicht mehr auf Ansprache. Schon in der letzten Woche berichtete uns der Neffe, dass Herr J. lebensverlängernde Maßnahmen sowie eine Magensonde oder PEG ablehne, wenn dadurch nur sein Sterbeprozess verlängert würde. Übereinstimmend fanden wir, dass jetzt der Zeitpunkt eingetreten ist, den der Neffe uns beschrieben hat.“ (Protokoll 54) 143 2% der Protokolle waren hier nicht beurteilbar, in 9% war eine Konsensbildung laut Dokumentation nicht möglich. Zur Illustration folgen hier drei Beispiele. Beispiel 1: 28jähriger geistig behinderter Patient. Entscheidung zur Dialyse „Zunächst wurde die Familie des Patienten über Ablauf der Dialyse, Shuntanlage (usw.) aufgeklärt. Die Mutter konnte die Bedenken der Klinik, dass die Dialyse aufgrund der Panik und Abwehr von J. (bei körperlichen Untersuchungen und Blutabnahme müssen ihn jedes Mal mehrere Personen festhalten) zum Wohl von J. nicht durchführbar sei, nachvollziehen. Der Vater wünscht dagegen einen Versuch mit der Dialyse. Auf mehrfache Anfrage konnte der Vater zustimmen, bei der nächsten Blutabnahme anwesend zu sein. Dabei musste J. von fünf Personen festgehalten werden, weil er sich stark sträubte. Der Vater meinte anschliessend, dass er die Situation nicht so schlimm empfunden hätte. Eine Pflegerin (des Heimes von J.) bestätigte uns, dass die Blutabnahmen auch dort regelmäßig so ablaufen würden und keinerlei Gewöhnungseffekt stattfände. Da es in diesem Gespräch nicht zu einer Einigung kam, wollten sich alle Beteiligten [...] zu einem neuen Termin treffen um zu einer Klärung zu kommen.“ (Protokoll 27) Beispiel 2: 57jähriger Patient, fragliche Fußamputation „Mit Herrn S. führten wir ein Gespräch. Es zeigte sich deutlich, dass Herr S. eine Einschränkung seiner geistigen Fähigkeiten hat. So kann Herr S. seinen jetzigen lebensbedrohlichen Zustand kognitiv nicht erkennen, sondern meint, dass sich der Zustand der Füße verbesserte, solange sie sich noch bewegen. Eine Amputation lehnt er strikt ab, durchgängig mehrfach, auch vor Zeugen. Der Betreuer stimmt der Amputation zu. Wir empfehlen: Kontaktaufnahme mit dem Vormundschaftsgericht, um diesen Widerspruch zwischen Patienten und Betreuerwillen klären zu lassen, inwieweit wir zur Akzeptanz des Patientenwillens verpflichtet sind oder ob der Betreuerwille zählt.“ (Protokoll 44) Beispiel 3: 87jähriger Patient, fraglicher Dialyseabbruch „Herr H. äußerte sich zufrieden über die Dialyse, erkundigte sich, wie er von zu Hause aus an die Dialyse gelange, wie lange er noch in der Klinik dialysieren müsse und wie häufig und lange er bei Dr. NN dialysieren müsse. Er habe die Dialyse gut vertragen, was auch die Dialysestation bestätigt. Nach dem Wochenende legte Herr H. ein Schreiben vor, in dem er nochmals auf seine Patientenverfügung aufmerksam machte, und im Gegensatz zu den Äußerungen der Vorwoche beschrieb, dass er die Dialysebehandlung körperlich nicht durchstehen könne. Dies sei im Einverständnis mit seiner Familie niedergeschrieben worden. [...] führten wir nochmals ein Gespräch mit Herrn H., in dem der Patient stereotyp und emotionslos seinen Wunsch, die Dialyse abzubrechen wiederholte. Gerade diese Emotionslosigkeit ist auffallend. Sie steht in deutlichem Gegensatz zu dem lebendigen Interesse an der Dialyse in der Vorwoche. Geradezu gebetsmühlenartig wiederholt der Patient seinen Abbruchwunsch. Der Patient wurde noch einmal über die Todesfolge bei Dialyseabbruch aufgeklärt. Da er jedoch bei vollem Bewusstsein ist und geschäftsfähig, muss seinem Willen entsprochen werden. (Protokoll 77) 144 6.3.10. Empfehlungen In fast allen Beratungen (96%) standen am Ende eine oder mehrere konkrete Empfehlungen. Wie in den Protokollauszügen zum Thema Konsens gezeigt, konnte auch in Fällen mangelnder Konsensbildung eine Empfehlung erfolgen. Nur in 4% der Beratungen ist eine solche Empfehlung nicht vermerkt. Zwei der Beratungen ohne Empfehlung seien hier als Beispiele erwähnt. Im ersten Fall handelt es sich um das zweite überhaupt dokumentierte Protokoll. Trotz eindeutiger Haltung des Patienten im Fall der fraglichen Fortsetzung einer Dialyse ist hier keine Empfehlung genannt – vermutlich war sie erfolgt, nur nicht explizit schriftlich festgehalten. Im zweiten Fall hatten sich ein Patient und seine Familie dafür entschieden, eine bestehende Dialysebehandlung abzubrechen, um trotz eindringlicher Informationen und Hinweise von Dialyseteam und Ethikkreis, nach Hause entlassen zu werden. Auch hier wurde keine Empfehlung dokumentiert. In Anbetracht der oft komplexen medizinischen, pflegerischen und psychosozialen Situation vieler Patienten enden nicht alle Beratungen mit einer einzigen Empfehlung. Daher sind in den 257 untersuchten Protokollen insgesamt 331 Empfehlungen enthalten. Diese Empfehlungen wurden für den Auswertungsbogen zu 16 Einzelthemen gebündelt, denen die Empfehlungen dann zugeordnet wurden. Abbildung 5: Empfehlungen in der Ethikberatung – Übersicht (N: 331) 145 Mindestens 287 der 331 Empfehlungen (87%) beziehen sich auf Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Lebensende – dies sind die Empfehlungen zum Beginnen, Fortführen oder Beenden einer Dialyse, zum Befürworten oder Ablehnen einer VaW-Anordnung zum Verzicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen, zum Legen einer Magensonde (PEG) zur künstlichen Ernährung, zur Überweisung in Hospiz oder Palliativmedizin bzw. zur Fortsetzung weiterer Gespräche bezüglich eines Therapieendes. Damit bestätigt der inhaltliche Schwerpunkt der Empfehlungen die beschriebenen Fragestellungen und korrespondiert mit den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung und bestätigt auch diese. Fragestellungen und Anlässe der Beratungen Anzahl der Anlässe Anzahl der Empfehlungen Dialyse 181 163 Verzicht auf Wiederbelebung (VaW) 22 27 Ernährung / PEG 25 20 Andere Therapien 52 46 Pflegeheim / Hospiz / Palliativstation 17 31 Sonstige 15 - Weitere Beratung bzw. Gespräche 30 Einschalten Vormundschaftsgericht 2 Andere Empfehlungen, z.B. Intensivstation 12 Gesamtzahl 312 Tabelle 28: Fragestellungen der Beratungen und ihre Empfehlungen 146 331 Die Differenz zwischen der Anzahl der Fragestellungen und der Anzahl der Empfehlungen pro Themenschwerpunkt ist darauf zurückzuführen, dass im Verlauf vieler Gespräche zu der eigentlichen Ausgangsfrage weitere relevante Aspekte hinzukamen und damit auch die Zahl der Empfehlungen beeinflussten. Von besonderem Interesse sind die insgesamt 163 Empfehlungen bezüglich der Dialyse, da sich hier bestimmte Entscheidungstendenzen des Ethikkreises i n Bezug auf das Fortführen oder Beenden von Behandlungen zeigen könnten. Das Ergebnis ist bemerkenswert ausgewogen: Es finden sich 81 Empfehlungen zur Fortsetzung oder dem Beginn einer Dialyse und 82 zum Abbruch. Im Sinne einer Empfehlung zur Fortsetzung von Behandlungen wurde eine VaW-Anordnung (Anordnung zum Verzicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen) in vier Fällen ausdrücklich abgelehnt, in 23 Fällen wurde die VaW-Empfehlung ausgesprochen. In 23 Fällen wurde eine Fortführung sonstiger Behandlungen empfohlen, in 23 Fällen wurde sie nicht empfohlen. Zweimal wurde die Anlage einer Magensonde (PEG) empfohlen, in 18 Fällen dagegen abgelehnt. Zu den Themen Dialyse, Verzicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen (VaW), Legen einer Magensonde (PEG) und sonstigen Therapien, bei den es eher um Fragen am Lebensende, d.h. um das Fortführen oder die Beendigung medizinischer oder pflegerischer Prozeduren ging, wurden wie erwähnt 287 Empfehlungen abgegeben. Davon sind mindestens 177 Empfehlungen (62%) eher einer Empfehlung zum Verzicht bzw. zur Beendigung einer Behandlung zuzuordnen, 110 Empfehlungen (38%) eher dem Fortführen von Therapiemaßnahmen. Insofern ist allgemein eine gewisse Tendenz erkennbar, bei Entscheidungen am Lebensende eher den Verzicht zu empfehlen, wobei dies speziell bei den Entscheidungen für oder gegen eine Dialyse gerade nicht gilt. Angesichts der häufig sehr dynamischen Krankheitsverläufe enden nicht alle Beratungsprotokolle mit einer abschliessenden Empfehlung der Ethikberater. In 30 Protokollen (12%) wird daher von den Beratern die Empfehlung für ein weiteres Gespräch ausgesprochen. Zur schnellen Orientierung zeigt abschließend die folgende Abbildung die wichtigsten der hier dargestellten Ergebnisse der Ethikberatungen des Ethikkreises in einer Übersicht. 147 46 % der EB durch Pflege & Seelsorge (45%) Weiblich 49% 32% der EB durch Pflege & Medizin (50%) Männlich 9% der EB durch Pflege/Seels./Med. (50%) 257 Ethikberatungen (EB) (1999 – 2011) 51% 3% der EB durch sonstige, z.B. allein (50%) 0-59 60-69 70-79 80-89 >90J. 12% 12% EB mit Patient 57% allein mit Patient 14% 10% der EB durch Seelsorge/Medizin (50%) 30% 39% 7% EB ohne Patient 43% mit Patient/Familie 33% Patient/Familie/Stat. 10% kontaktfähig (kf) 43% aller Patienten eingeschränkt kf 19% aller Patienten allein mit Familie 27% div. andere Settings 16% nicht kf 26% aller Patienten uneindeutig:12% mit Pat-Verfügung 16% ohne Pat-Verfügung 17% keine Angabe 67% Patientenwille bekannt/eindeutig 58% Ambivalent 19% unbekannt: 23% Gesprächsverlauf unstrittig (59%) Dialyse Fortsetzen: Abbruch: 81x 82x Wiederbelebung Nein zur VaW: 4x Ja zur VaW: 23x kontrovers (36%) Konsens 89% Empfehlungen 96% Anlegen einer PEG Ja: 2x Nein: 16x uneindeutig: 5% Therapie fortsetzen Ja: 23x Nein: 23x Weitere Beratung Ja: 30x Abbildung 6: Übersicht zu den wichtigsten Ergebnissen der Ethikberatungen 148 6.4. Diskussion der Protokollanalyse Vor dem Hintergrund des aktuellen Forschungsstandes bezieht sich die folgende Diskussion vorrangig auf die Analyse der Ethikberatungen, stellt aber auch Verbindungen mit der Auswertung der Mitarbeiterbefragung her. Zunächst erörtere ich die Anzahl der Beratungen und ihre spezifischen Rahmenbedingungen, anschließend orientiere ich mich an den in Kapitel 3.3.3. dargestellten Voraussetzungen erfolgreicher Ethikberatung – dem Zugang zur Beratung, der Qualifikation der Beratenden, dem Gesprächsverlauf, der Dokumentation und der Evaluation. In diesem Zusammenhang diskutiere ich auch die anlassgebenden Themen und untersuche die Rolle des Patienten und seiner Willensäußerung im Rahmen dieses Beratungsmodells. Wegen des zentralen Aspekts der Arbeit, der Verwirklichung einer gemeinsamen Entscheidungsfindung („shared-decision-making“) auf der Basis einer informierten Zustimmung („informed consent“), ist gerade der Gesprächsverlauf bzw. Beratungsprozess als solcher wichtig, um die Spezifika dieser Nürnberger Variante einer patienten- und mitarbeiterorientierten Ethikberatung aufzuzeigen. 6.4.1. Datengrundlage Die vorliegende Auswertung der 257 schriftlich dokumentierten Ethikberatungen aus den Jahren 1999 bis 2011 basiert auf einem vergleichsweise seltenen Datenbestand. National wie international liegen bislang fünfzehn Auswertungen Klinischer Ethikberatungen vor, allerdings zum Teil mit geringen Fallzahlen (N=22) wie die Tabelle 33 zeigt. Zwar wird eine steigende Zahl Klinischer Ethikinstitutionen und Ethikdienste an Krankenhäusern einschließlich klinischer Ethikberatung beschrieben, die Anzahl der Beratungen pro Institution und Jahr ist jedoch meist gering und die Dokumentation nur teilweise systematisch. Auch im Nürnberger Ethikkreis begann die Protokollierung der Beratungen erst zwei Jahre nach ihrem Beginn und ist bis heute nur teilweise zu Inhalt, Struktur oder Umfang standardisiert. Es ist nachvollziehbar, dass dieses neue Angebot nicht von Anfang an systematisch dokumentiert wurde, für eine künftige Qualitätssicherung ist eine Standardisierung aber unverzichtbar und daher empfehlenswert. Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über vergleichbare Arbeiten zu Klinischen Ethikberatungen aus den vergangenen 25 Jahren.220 220 Swetz (2007). 149 Untersuchung Beratungen Studienzeitraum La Puma (1987) 27 1985 – 1986 Brennan (1988) 73 1974 – 1986 La Puma et al. (1988) 51 1986 – 1987 Perkins (1988) 44 1984 – 1985 La Puma et al. (1992) 104 1988 – 1989 Andereck (1992) 44 1985 – 1991 Orr, Moon (1993) 46 1990 – 1991 Schenkenberg (1997) 150 1987 – 1996 Waisel et al. (2000) 39 1998 Schneidermann et al. (2003) 551 2000 – 2002 Forde et al. (2005) 31 1996 – 2002 Swetz et al. (2007) 255 1995 – 2005 Fukuyama et al. (2008) 22 2006 – 2007 Nilson (2008) 53 2002 Opel et al. (2009) 71 1996 – 2006 Aktuelle Arbeit (2011) 257 1999 – 2011 Tabelle 29: Übersicht zu Studien, Zeiträumen und Beratungsfällen 221 Viele dieser Studien analysieren lediglich einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren. Nur die Arbeiten zu Ethikberatungen einer pädiatrischen Klinik (Opel 2009) und in der Mayo Klinik (Swetz 2007) umfassen einen Zeitraum von einem Jahrzehnt. Insofern zeigt die Tabelle auch den vergleichsweise langen Untersuchungszeitraum in Nürnberg und den entsprechend großen Datenbestand. Obgleich die Anzahl der Nürnberger Beratungen vergleichsweise hoch ist, erscheint die Anzahl der Protokolle bzw. Beratungen pro Jahr eher niedrig. Im Studienzeitraum von 1999 bis 2011 wurden durchschnittlich 18 Ethikberatungen pro Jahr registriert. Sowohl die niedrigste Anzahl pro Jahr (zwei im Jahr 1999) als auch die höchste Anzahl (48 im Jahr 2008) stellen Ausnahmen dar. Insgesamt zeigt die von Jahr zu Jahr kontinuierlich steigende Anzahl der Protokolle, dass die Ethikberatung im achten Jahr nach Beginn ihrer Einführung mindestens einmal im Monat stattfand, im zehnten Jahr etwa alle zwei Wochen und während zwei Jahren sogar fast wöchentlich. 221 Vgl. Literaturliste. Alle genannten Arbeiten sind für die Diskussion ausgewertet und angeführt. 150 Den Angaben der Beteiligten zufolge sind in Nürnberg in den ersten Jahren einzelne Ethikberatungen nicht dokumentiert worden. Das Gesamtbild wird allerdings durch diese Einschränkung nicht wesentlich verändert. In den Jahren 2007 und 2008 nahm die Anzahl der Beratungen plötzlich zu und verdoppelte sich nahezu, vermutlich ausgelöst durch die klinikweite Befragung zum Umgang mit ethischen Themen im Stationsalltag im Sommer 2007. Diese Befragung rief besondere Aufmerksamkeit hervor und führte den Mitgliedern des Ethikkreises zufolge auch subjektiv zu steigenden Nachfragen. Der Effekt hat sich ab 2009 zwar wieder zurückgebildet, mittelfristig könnte sich das Niveau in der Medizinischen Klinik 4 bei jährlich 20 - 25 Beratungen etablieren. Die Anzahl der jährlichen Beratungen in Nürnberg liegt damit im Rahmen vergleichbarer Angebote in den USA oder Europa. 6.4.2. Methode der Untersuchung In Umkehrung der oft verwandten Methode, über qualitative zu quantitativen Analysen zu gelangen, basiert diese Arbeit zunächst auf einer quantitativdeskriptiven Methode, die durch offene Begleitinterviews und persönliche Mitteilungen ergänzt wurde. Da es bei der Ethikberatung an standardisierten und publizierten Evaluationsinstrumenten fehlt, stellt der hier benutzte Auswertungsbogen kein veröffentlichtes oder validiertes Instrument dar, sondern wurde eigens für die vorliegenden Protokolle konzipiert. Seine Struktur hat sich jedoch an den in der vorangegangenen Tabelle genannten Publikationen angelehnt. Insgesamt liefern die hier untersuchten Beratungen ein aufschlussreiches Bild über die bisherigen Beratungen durch den Nürnberger Ethikkreis und geben hilfreiche Hinweise für ihre Weiterentwicklung bzw. für das allgemeine Verständnis von Ethikberatungen. Auf der Grundlage des Analysebogens lassen sich gerade in Bezug auf die Beratungsmodelle, ihre Patientenorientierung und klinische Relevanz Erkenntnise sowie gewinnen und den eigentlichen Fragen für Beratungsverlauf wissenschaftliche zahlreiche Folgeprojekte formulieren. Eine wissenschaftliche Begleitung Klinischer Ethikberatung scheint dringend geboten, zumal die Verbreitung der Ethikberatung in Deutschland von Jahr zu Jahr zunimmt, eine angemessene systematische Evaluation dieses Angebotes aber – wie erwähnt – auch im deutschsprachigen Raum weiterhin fehlt. 151 Eine 2010 publizierte internationale Metaanalyse von Jan Schildmann zu Forschungsmethoden und Erfolgskriterien Klinischer Ethikberatung belegt die geringe Anzahl von Veröffentlichungen zu Evaluationsfragen und damit das weitgehende Fehlen einer differenzierten Grundlage für weiterführende wissenschaftliche Debatten.222 Die Arbeit ging der Frage nach, „which outcomes of evaluation studies on clinical ethics consultation have been published in the literature?“ Als Schlüsselbegriffe wurden „outcome“, „clinical ethics consultation“ und „evaluation studies“ definiert. Im Rahmen einer PubMed-Analyse für den Zeitraum von 1970 bis 2007 erfüllten von 159 Erstfunden letztlich nur 14 Arbeiten die Einschlusskriterien. Diese Arbeiten – einige sind in Tabelle 33 bereits erwähnt – lassen sich methodisch wie folgt unterscheiden. zwölf der gefundenen Arbeiten nutzten einen quantitativen Ansatz, zwei arbeiteten qualitativ in Form halb-strukturierter Interviews. Auch die Zielgruppen und Studienteilnehmer der 14 Arbeiten unterscheiden sich deutlich. Die beiden qualitativen Studien erkunden die Erfahrungen und Zufriedenheit von ärztlichen Mitarbeitern mit der Ethikberatung,223 fünf der zehn quantitativen Arbeiten ermitteln die Perspektiven von Patienten und Gesundheitspersonal,224 drei der quantitativen Studien nur die Sicht der Mitarbeiter 225 und eine der quantitativen Arbeiten befragte Patienten und Angehörige zu ihren Erfahrungen mit der Ethikberatung.226 Zwei der Arbeiten sind randomisiert-kontrollierte Studien, auf die bereits im dritten Kapitel hingewiesen wurde. Über die Darstellung und Begründung des methodischen Vorgehens innerhalb der 14 untersuchten Arbeiten zur Klinischen Ethikberatung – clinical ethics consultation (CEC) – stellt der Autor nüchtern fest: „The publications identified in this review neither provide information on the process of operationalizing the criteria to evaluate CEC nor do they indicate values regarding content validity or reliability of the instruments used in the studies.“227 222 Schildmann (2010). Perkins (1998), Forde (2005). 224 Schneidermann (2000), (2003) und (2006), Cohn (2007), McClung (2007). 225 La Puma (1988) und (1992), Orr/Moon (1993). 226 Orr (1996). 227 Schildmann (2010), S. 209. 223 152 Während Mitte der 90er Jahre bereits gezeigt werden konnte, dass national wie international vergleichsweise viele Arbeiten zu Implementierung, Arbeitsweisen und Häufigkeit – also zu strukturellen und prozessualen Aspekten – der Klinischen Ethikberatung veröffentlicht wurden,228 konzentrierte sich Schildmann in seiner hier zitierten Arbeit erstmals auf die konkreten klinischen Auswirkungen von Ethikberatungen. „The focus of this study on outcomes reflects the current awareness and interest in clinical medicine to judge the value of interventions on the basis of their impact on clinical practise. Moreover, outcomes are frequently used to justify the resources allocated to health care services. In this respect providers of CEC frequently are already, and probably increasingly will be, asked to present the practical impact of their work.“229 Auch wenn „practical impact“ begrifflich vage bleibt, ist der Bedarf an konkreten Aussagen über die Wirkung und die Relevanz von Ethikberatungen offensichtlich. Umso wichtiger erscheint es, angemessene Methoden zur Evaluation Klinischer Ethikberatung zu entwickeln und zu diskutieren. In den bisherigen Publikationen, so die Metaanalyse, könnten subjektive und objektive Kriterien zur Bewertung unterschieden werden. Subjektive Kriterien würden die Bewertung der Teilnehmenden wiedergeben, objektive Kriterien dagegen Parameter wie Intensivtage, Beatmungsstunden, Mortalität oder Kosten messen. Eine der Studien analysierte mögliche finanzielle Auswirkungen der Ethikberatung. 230 Die Frage, ob sich die Ethikberatung dieselben Kriterien auferlegen sollte, die im Sinne einer evidenz-basierten Medizin gelten, bleibt aus meiner Sicht zu diskutieren. Es gibt durchaus Gründe, die dagegen sprechen, weshalb ich das Thema in den Schlussfolgerungen am Ende der Arbeit noch einmal aufgreife. Auch die hier vorliegende Arbeit zeigt hinsichtlich ihrer Methodik eine Reihe von Limitationen. So untersucht sie weder die klinische Relevanz der Beratungen durch den Ethikkreis der Medizinischen Klinik 4, noch hinterfragt sie die Relevanz oder Wirkung der Beratung für die teilnehmenden Ärzte und Pflegende, wie Patienten, Angehörigen oder Betreuer. Hier bietet sich an, durch künftige Studien – etwa in Form retrospektiver qualitativer Interviews – das Gesamtbild der Beratungsanalyse noch abzurunden. Analog zu anderen Studien ist es hierzu erforderlich, die Beteiligten nach einer angemessenen Zeit erneut zu kontaktieren. 228 Tulsky/Fox (1996). Schildmann (2010), S. 211. 230 Schneidermann (2003). 229 153 Die folgende Übersicht von Schildmann zeigt beispielhaft derartige Erfolgskriterien, wie sie in den von ihm analysierten quantitativen Studien genutzt und von den Teilnehmern bewertet wurden. Einschätzung der Ethikberatung durch die Zahl der Studien, Teilnehmenden bezüglich: die dies erheben: Gesamtbewertung der Ethikberatung 9 Analyse/Klärung der ethischen Themen in der Beratung 7 Einfluss der Ethikberatung auf die medizinische Behandlung 7 Informations- und Fortbildungsgewinn durch die Beratung 6 Leistung einer (emotionalen) Unterstützung durch die Beratung 4 Lösung eines ethischen Konflikts durch die Beratung 3 Konflikthaftigkeit der Beratung selbst 3 Respekt gegenüber den Werten der Teilnehmenden 2 Fairness der Beratung 1 Hilfestellung durch die Meinungsbilder in der Beratung 1 Verbesserung der Kommunikation zwischen den verschiedenen Parteien 1 Einverständnis der Teilnehmenden mit der Entscheidung der Beratung 1 Möglichkeit, eigene Ansichten in der Beratung zu präsentieren 1 Tabelle 30: Erfolgskriterien für die Ethikberatung, nach Schildmann (2010)231 Dieser Metaanalyse zufolge verlangen eine Reihe ihrer Befunde nach weiterer Beobachtung bzw. Klärung: etwa die Tatsache, dass in den Evaluationen Klinischer Ethikberatung erst allmählich auch die Perspektive der nicht-ärztlichen Teilnehmenden berücksichtigt und untersucht wurde oder dass wiederholt eine Diskrepanz bestand zwischen einer positiveren Wahrnehmung und Akzeptanz der Ethikberatung durch das Gesundheitspersonal und durch Patienten und Angehörige. 232 Diesen Fragen auch für das Kollektiv der Ethikberatungen durch den Nürnberger Ethikkreis nachzugehen, könnte interessante weitere Erkenntnisse ergeben. 231 232 Übersetzung einer Tabelle aus der Arbeit von Schildmann (2010). Mc Clung (1996). 154 6.4.3. Zugang, Teilnehmende und Initiative Der Ethikkreis der Medizinischen Klinik 4 wurde inspiriert durch die Erfahrungen in der Dialyseberatung der Klinik, die sich Patienten mit drohender oder bestehender Dialysepflichtigkeit widmet und diese vor allem in ihrer Krankheitsbewältigung begleitet. In dieser Tradition steht auch die Ethikberatung der Klinik, die damit den Patienten – und seine Angehörigen – ausdrücklich in den Mittelpunkt stellt. Ausgehend von dieser Orientierung am Patienten und seinen Bedürfnissen, stellt sich für die Ethikberatung die Frage nach der konkreten Teilnahme des Patienten an der Beratung, nach seiner Orientierung und Kontaktfähigkeit und der direkten oder indirekten Kenntnis des Patientenwillens bzw. dem Vorliegen einer Patientenverfügung. Für die weitere Bewertung der Beratungen sind mir diese Aspekte wichtig, da ich die informierte Teilnahme bzw. Vertretung des Patienten als ein wesentliches Kriterium für den Erfolg und die Sinnhaftigkeit der Beratung erachte. Vor diesem Hintergrund ist positiv zu werten, dass an jeder zweiten Beratung des Ethikkreises auch der Patient selbst physisch teilgenommen hat – entweder allein, gemeinsam mit Familienangehörigen oder in Einzelfällen auch mit anderen Personen, z.B. einem Betreuungsbevollmächtigten. Den Protokollen zufolge waren die Patienten in fast jedem zweiten aller dokumentierten Fälle (43%) auch orientierungs- bzw. kontaktfähig und konnten so aktiv an den Beratungen teilnehmen sowie ihre Vorstellungen, Wünsche oder Ängste selbst artikulieren. In fast jedem fünften Fall waren die Patienten nur eingeschränkt kontaktfähig und in 26% der Fälle nicht kontaktfähig. Damit haben auch einige eingeschränkt kontaktfähige Patienten an einer Ethikberatung teilgenommen, was aber dem Selbstverständnis von Ethikberatungen und dem Ethikkreises entspricht: im Zweifelsfall eher die Einbindung der Patienten zu versuchen, als sie auszuschließen. Für die zentrale Frage dieser Arbeit ist entscheidend: In Dreiviertel aller untersuchten Fälle war der Wille der Patienten bekannt, auch wenn er in jedem fünften Fall ambivalent und uneindeutig war. Ambivalente wie eindeutige Präferenzen der Patienten waren daher sowohl durch die indirekte Schilderung von Angehörigen oder Betreuern als auch durch die persönliche Schilderung durch die Patienten selbst bekannt und konnten im Zuge der Beratung berücksichtigt werden. 155 Allerdings hat sich auch gezeigt, dass jede dritte Beratung nur mit Angehörigen und dem Team stattfinden konnte, so dass damit der Patientenverfügung oder Betreuungsvollmacht eine besondere Bedeutung zukommt. Bedenklich erscheint daher, dass in über 80% der Fälle eine Patientenverfügung oder Vollmacht nicht erwähnt oder vorhanden ist und nur in wenigen Fällen ausdrücklich bestätigt wird. Wenngleich im Einzelfall Patientenverfügungen oder Betreuungsvollmachten vorgelegen haben können und lediglich nicht ausdrücklich erwähnt wurden, verweist die große Zahl fehlender Dokumente doch auf ein weiterhin anhaltendes Defizit bezüglich ihrer Verbreitung und Anwendung. 233 Insgesamt zeigt die Auswertung der Protokolle, dass die Ethikberatungen in einem Rahmen stattfanden, der in vielen Fällen eine orientierte und bewusste Teilnahme der Patienten grundsätzlich ermögliche. Neben der Entlastungsfunktion für das ärztliche und pflegerische Personal stellt diese Orientierung an den Bedürfnissen von Patienten und Angehörigen ein wesentliches Merkmal der Beratungen durch den Nürnberger Ethikkreis dar. Hier wird der Teilnahme des Patienten und seines familiären Umfelds sowie der Ergründung und Umsetzung seines Willens besondere Bedeutung beigemessen. Damit versucht der Ethikkreis die Autonomie des direkt oder indirekt beteiligten Patienten und damit das „shared-decision-making“ auf der Basis eines „informed consent“ zu stärken. Die Initiative zur Beratung durch den Ethikkreis geht offensichtlich auch in Nürnberg vor allem von Ärzten aus. Diese subjektiven Beobachtungen der Berater wird gerade durch die Protokolle der letzten zwölf Monate (1. Oktober 2010 bis 30. September 2011) bestätigt. Demnach kam von 35 Beratungen in diesem Zeitraum die Initiative zu 80% von Ärzten. Dies bestätigt auch die bisherige Literatur, nach der einerseits eine ärztliche Skepsis gegenüber der Ethikberatung beschrieben wird, andererseits auch die oft mehrheitliche Initiative zur Beratung durch Ärzte.234 Dies gilt vor allem dann, wenn Ärzte in ihrer Ausbildung mit ethischen Fragen konfrontiert wurden oder sich in der Thematisierung ethischer Kontroversen geübt fühlen. 235 Weitere Hintergründe zu den Haltungen von Ärzten und Pflegenden werden unter dem Aspekt „Entwicklungspotenzial“ diskutiert. 233 Siehe aber auch die kritische Diskussion zur möglichen „vorauseilenden“ Therapielimitierung durch den Einsatz von Patientenverfügungen (self-fulfilling prophecy), vgl. dazu Erbguth (2008). 234 Fox (2007), Gill (2004), Schenkenberg (1997), La Puma (1987), (1988) und (1992), Nilson (2008). 235 Hurst (2007). 156 6.4.4. Qualifikation Ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Gelingen von Ethikberatungen ist die Qualifikation der Beratenden. Diese ist im Nürnberger Ethikkreis durch den Dreiklang aus Aus-, Fort- und Weiterbildung, Supervision und Erfahrung sichergestellt. Für den Mitarbeiter der Seelsorge gehört die Beratungskompetenz zur Grundausbildung, die Kolleginnen und Kollegen der Pflege und Medizin verfügen über verschiedene Fort- und Weiterbildungen, in denen die Beratungskompetenz einen wichtigen Stellenwert einnimmt, und insbesondere die Pflegekraft der Dialyseberatung, die an fast allen Ethikberatungen teilnimmt, hat eigens den Fernlehrgang „Ethikberater/in im Gesundheitswesen“ absolviert. Sie alle nehmen zudem regelmäßig an Fallsupervisionen teil und blicken auf eine nunmehr über zehnjährige Erfahrung zurück. Insofern verfügt der Nürnberger Ethikkreis bezüglich der Qualifikation über sehr gute Voraussetzungen, die er im Sinne der „Kernkompetenzen für Ethikberatung“ 236 kontinuierlich aufrecht erhält. 6.4.5. Gesprächsverlauf Die Diskussion des Gesprächsverlaufs berücksichtigt die anlassgebenden Themen der Beratung, den eigentlichen Verlauf der Gespräche bzw. den Beratungsprozess, den erzielten Konsens sowie die Empfehlungen. Auch die Unterscheidung von Rat und Beratung bzw. das Spezifikum des Nürnberger Ethikkreises wird hier erörtert. 6.4.5.1. Themen und Fragestellungen Die Auswertung der 257 Beratungsprotokolle des Nürnberger Ethikkreises zeigt, dass die Geschlechts- und Altersverteilung der Patienten erwartungsgemäß ist und auch das oft multimorbide Patientenkollektiv einer internistischen Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie widerspiegelt. Auch die Beratungsanlässe entsprechen den Erwartungen: 181 von 312 Anlässen beziehen sich auf das Thema Dialyse, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. Dieser Beratungsschwerpunkt ist einerseits auf das Fachgebiet der Klinik zurückzuführen, andererseits darauf, dass eine in der Ethikberatung sehr aktive Mitarbeiterin für die Dialyseberatung verantwortlich ist, woraus sich in positiver Hinsicht gewisse Synergie-Effekte ergeben dürften. Dennoch ist die Ethikberatung in der Medizinischen Klinik 4 keine „erweiterte Dialyseberatung“. 236 ASHB (1998), (2011). 157 Die Vielzahl der unterschiedlichen Beratungsanlässe spricht eher für einen breiten Einsatz des Ethikkreises. Seit seiner Entstehung hat sich die Beratung zu einem Angebot entwickelt, das nicht nur zu wenigen Themen und von wenigen „Insidern“ genutzt wird. Diese Einschätzung wird auch von den beteiligten Beratern geteilt, die auf Beratungsnachfragen aus dem Dialysebereich, von unterschiedlichen Allgemeinstationen und der Intensivstation berichten. 237 Auch die Themenvielfalt bestätigt den breiten Einsatz, etwa zu Fragen des „Verzichts auf Wiederbelebungsmaßnahmen“, der „Ernährung bzw. PEG“ oder der „Überweisung in Pflege, Heim oder Hospiz“. Insgesamt lässt sich feststellen, dass den Klinischen Ethikberatungen in der Mehrzahl konkrete und zeitkritische Anlässe zugrunde lagen, sie aber auch aufgrund sonstiger Therapiefragen und zu einer Vielzahl anderer Fragestellungen eingeholt wurden. Diese Erfahrungen werden auch international von nahezu allen in Tabelle 33 genannten Studien bestätigt. Entsprechend den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung aus dem Jahr 2007 stehen auch in der Analyse der Beratungen insgesamt Fragen zum Fortführen oder Einstellen von Behandlungen im Vordergrund. Ärzte wie Pflegende hatten sie als besonders häufig und besonders schwerwiegend wie auch belastend eingestuft. Dass diese Themen zum häufigsten Ausgangspunkt für die Anforderung einer Klinischen Ethikberatung werden, ist nachvollziehbar. Mitarbeiterbefragung und Protokollauswertung zeigen hier eine deutliche Übereinstimmung. Gerade in diesen Fällen scheint vielen an einer gemeinsamen Entscheidungsfindung gelegen zu sein – nicht zuletzt im Sinne der Patienten. 6.4.5.2. Kontroverse und Konsens Die Teilnahme des Patienten an den Beratungen und seine kognitiven Fähigkeiten sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass die Beratung ihre Funktion der gemeinsamen Entscheidungsfindung entfalten kann. In den Beratungsgesprächen selbst sind es dann vor allem ihr Verlauf, der Umgang mit Kontroversen und die Fähigkeit einer tragfähigen Konsensbildung, die über einen ersten Erfolg oder Misserfolg einer Beratung entscheiden; nachhaltige Erfolgskriterien bleiben hier vorerst unberücksichtigt. 237 Interview des Autors mit der Krankenschwester Heidi Stephan, November 2010. 158 An dieser Stelle sei noch einmal an den besonderen Charakter der Beratungen durch den Nürnberger Ethikkreis erinnert: Die zweiteilige Beratung sieht jeweils ein Informations- und Vorgespräch der Berater mit den verantwortlichen Ärzten und Pflegenden vor, bevor das eigentliche Beratungsgespräch folgt. Die Mehrzahl dieser eigentlichen Ethikberatungen (64%) fand innerhalb eines Kontaktes statt und die Gespräche verliefen dabei überwiegend (59%) unstrittig, wobei unstrittig einen Verlauf der Beratung bzw. des Gespräches meint, in dem sich im Gespräch weder intra- noch interpersonelle Konflikte wie die dargestellten Beispiele für Ambivalenzen, Verdrängung, Entscheidungsdruck, Themenwechsel, psychische Auffälligkeiten oder medizinische Unkenntnis zeigen, die einer gemeinsamen oder vom Patienten gefällten Entscheidung entgegenstanden. Der hohe Anteil der so gemeint unstrittigen Gesprächsverläufe könnte den Eindruck vermitteln, dass es einer Ethikberatung womöglich gar nicht bedurft hätte. Dem ist entgegenzuhalten, dass eine Beratung nicht notwendigerweise eine Meinungsverschiedenheit der Teilnehmenden oder eine Ambivalenz des Patienten und damit eine konflikthafte Situation oder Kontroverse zum Ausgangspunkt haben muss. Sie kann vielmehr auch der gemeinsamen Vergewisserung in einer schwierigen Entscheidungssituation dienen und die so getroffene Entscheidung dauerhafter und damit belastbarer machen. Kontrovers und konflikthaft verliefen dagegen 36% der Gespräche, was den Ergebnissen anderer Untersuchungen vergleichbar ist.238 Damit ist gemeint, dass die jeweiligen Protokolle einen Gesprächsverlauf dokumentieren, der – wie weiter oben beschrieben – sowohl inhaltliche Differenzen widerspiegelt als auch atmosphärische Störungen. Die angeführten Auszüge und Zitate aus den Beratungsprotokollen geben davon einen deutlichen Eindruck. Der folgende Auszug zeigt noch einmal beispielhaft eine solche Kontroverse und konflikthafte Beratungssituation sowie ihre weitere Entwicklung. Er setzt die Passage fort, die in Kapitel 6.3.9. zitiert wurde (S. 144). Dort wurde die Ethikberatung mit einem 87jährigen Patienten wiedergegeben, der dialysepflichtig geworden war, sich im Zustand einer voranschreitenden Urämie jedoch weigerte, die Dialyse – trotz Shuntanlage – tatsächlich zu beginnen und aufgrund verschiedener Beratungsgespräche dann offensichtlich „ins Nachdenken gekommen“ war. 238 Siehe u.a. Swetz (2007) und Nilson (2008). 159 „Dahingegen äußerte der Sohn immer wieder, dass der Vater sterben wolle und er es auch respektiere, der Sohn machte nicht den Eindruck, dass er verstünde, dass die Urämie sich verbessern könnte. Er fragte auch nicht nach, welche Chancen sein Vater habe, ob und wie lang man dialysieren müsste, bis man eine Besserung erkennen könnte, er wiederholte zu stereotyp, dass der Vater in einem schlechten Zustand sei und daher nicht mehr dialysieren könne und wolle. [...]“ Einen Tag später am Vormittag: „Erneutes Gespräch mit Herrn H., heute ist der Patient sehr zugänglich, so wie ich ihn vor vier Wochen kannte. Auf meine Frage, wie es ihm heute ginge, meinte er, nach den gestrigen Gesprächen musste er viel nachdenken. Er fragte mich nach den verschiedenen Details der Hämodialyse und meinte, am Nachmittag wollte er noch mal mit seinem Sohn sprechen und sich dann entscheiden.“ Am Nachmittag desselben Tages: „Bei unserem erneuten Kontakt erzählt Herr H., der Sohn sei schon weg, aber er selbst habe sich für die Hämodialyse entschieden und dies seinem Sohn und (telefonisch) seiner Ehefrau mitgeteilt. Herr H. wirkt ausgeglichen und erzählt, dass die Familie die Entscheidung begrüßt und froh ist, dass er noch bei ihnen bleiben will.“ (alle drei Auszüge aus: Protokoll 79) Die hier und bereits in Kapitel 6.3.9. zitierten Passagen der Beratung zeigen einige Aspekte, die in vielen der dokumentierten Beratungen sichtbar werden und den prozesshaften Charakter vieler Beratungen vom Ethikkreis unterstreichen: - eine Tendenzentscheidung ist seit längerem getroffen (hier: Shuntanlage) - Ambivalenzen und eine Abkehr von der Entscheidung kommen auf - krankheitsbedingte Veränderungen wirken sich auf den Patienten aus - Familienangehörige (hier der Sohn) bauen starken Entscheidungsdruck auf - medizinische Informationen sind für die Meinungsbildung oft wichtig - Entscheidung und Beratung benötigen mehrere Tage und Gespräche Im zitierten Fall führte das zunächst kontroverse Gespräch dazu, dass sich der Patient in einem Folgegespräch nachdenklich und interessiert zeigte, weitere Informationen zur Dialyse und zu seiner Prognose erbat und sich letztlich für den Versuch einer Dialyse entschied. Der kontroverse Verlauf erlaubt daher keine Prognose für die spätere Entscheidung – im Gegenteil: Kontroverse Gesprächsverläufe, sofern sie nicht zu anhaltenden Blockaden und Differenzen führen, können den Weg zu einem belastbaren Entschluss bahnen. 160 In diesem Fall war es dem Ethikkreis wichtig, die medizinische Prognose deutlicher sichtbar zu machen, um nicht voreilig dem aus ärztlicher Sicht fragwürdigen Patientenwillen zu folgen – viele Gesprächsverläufe belegen die Bedeutung einer engen Begleitung der Patienten und Angehörigen während der sich oft zuspitzenden Situation der Entscheidungsfindung. In diesem Sinne zeigen auch andere Studien die Bedeutung von Konflikten zwischen behandelndem Team und Familie bzw. innerfamiliäre Konflikte. 239 So erklärt sich auch, dass in jedem dritten Protokoll von mindestens zwei bis drei Gesprächen berichtet wird. Bei etwa zwei Drittel dieser mehrteiligen Beratungen lagen kontroverse Gesprächsverläufe zugrunde, bei einem Drittel war kein kontroverser Verlauf erkennbar. Die Tatsache, dass es im Verlauf der Ethikberatung zu einem ausdrücklichen Gesprächsergebnis und einer Konsensbildung gekommen ist, lässt Rückschlüsse auf den Prozess der Gesprächsführung zu. Eine Aussage zur argumentativen Stringenz und zur moralischen Bewertung des jeweiligen Konsenses ist nicht möglich. Im Extremfall können hypothetisch auch Konsensfindungen erfolgen, die den allgemein verbreiteten Werten und Normen der jeweiligen Gemeinschaft oder Gesellschaft diametral entgegenstehen. Die Konsensfindung allein ist damit kein Gütekriterium einer Ethikberatung. Sie sagt weniger aus über das Ergebnis der Beratung als über den Beratungsprozess und die stattgehabte Prozessqualität. Im Nürnberger Ethikkreis wird das eigentliche Beratungsgespräch nicht strikt standardisiert geführt, etwa mit der Einhaltung einer strengen Reihenfolge wie im eingangs geschilderten Nijmwegener Modell. Aber es werden dennoch alle dort genannten Dimensionen berücksichtigt bzw. zur Sprache gebracht und vor allem wird der Position bzw. dem Willen des Patienten ausreichend Raum gegeben und besondere Bedeutung beigemessen. Eines der Protokolle zeigt dies besonders anschaulich. Im Konflikt zwischen Patient und Familie legt das Beratungsteam in einem Vorgespräch mit Angehörigen ausdrücklich Wert darauf, den Willen des Patienten zum Ausgangspunkt der eigentlichen Ethikberatung zu machen: „Die Familie machte deutlich, den Willen des Vaters akzeptieren zu wollen. Zugleich machten sie aber deutlich, dass sie die Entscheidung nicht teilen könnten. Sie wünschten, dass wir sie unterstützen, den Vater zu weiteren Dialysen zu drängen. Wir vereinbarten, im Gespräch mit dem Patienten selbst, zuerst ihn zu Wort kommen zu lassen und ihm zuzuhören. [...] Herr K. betonte seine Verbundenheit mit der Familie und dass er trotzdem die Dialyse abbrechen werde.“ (Protokoll 214) 239 Swetz (2007). 161 6.4.5.3. Empfehlungen Fast alle Ethikberatungen (96%) endeten nicht nur mit einer Konsensbildung, sondern münden in eine oder mehrere Empfehlungen des beratenden Teams. Besondere Beachtung verdienen die Empfehlungen zur Dialyse, da es sich dabei um eine der häufigsten Behandlungsprozeduren der Klinik handelt. Daher stellt sich die Frage, ob bei den dialysebezogenen Empfehlungen des Ethikkreises bestimmte Tendenzen erkennbar sind: Ist die Verteilung zwischen eher zustimmenden und eher ablehnenden Empfehlungen ausgewogen oder berät der Ethikkreis auffallend häufig in eine bestimmte Richtung? Das Ergebnis interessiert nicht zuletzt die Mitglieder des Ethikkreises selbst, weil es nach über zehnjähriger Beratungspraxis hierzu allenfalls Vermutungen, aber keine objektiven Erhebungen gibt. Bemerkenswert ist, dass die untersuchten Protokolle im Ergebnis eine bemerkenswert gleiche Verteilung zwischen der Empfehlung zum Dialyseabbruch (82) und der Empfehlung zum Beginn oder zu einem Fortsetzen der Dialyse (81) zeigen. Diese Ausgewogenheit ist sekundär auch für den „Ruf“ bzw. das „Image“ des Ethikkreises wichtig, unterstreicht sie doch seine inhaltliche oder „ideologische“ Unabhängigkeit. Damit entspricht die Initiierung einer Beratung nicht der vorweggenommenen Entscheidung. Sie ist kein „Feigenblatt“ für den Therapieabbruch. Unabhängig von den Empfehlungen zur Nierenersatztherapie lässt sich aus den Protokollen des Ethikkreises insgesamt eine gewisse Tendenz hinsichtlich der Beendigung von Behandlungsmaßnahmen ableiten. Diese Tendenz ist allerdings nicht so deutlich, dass sie negative Auswirkungen auf das „Image“ des Kreises und seine Empfehlungen hätte. Die beschriebene Instrumentalisierung Klinischer Ethikberatung zur Herbeiführung und Übermittlung schwieriger Entscheidungen beim Therapieabbruch kann mit den vorliegenden Daten nicht bestätigt werden. Die hier gelebten partizipativen Entscheidungen entsprechen auch den Vorstellungen der Renal Physicians Association (RPA) und der American Society of Nephrology (ASN). Beide Verbände haben im Jahr 2000 in ihren Leitlinien „Shared Decision-Making in the Appropriate Initiation of and Withdrawl from Dialysis“ formuliert.240 Damals war das Instrument der Ethikberatung zu neu, als dass es explizit erwähnt worden wäre. Dem Geist und den Zielen der Klinischen Ethikberatung entsprechen die 2010 erneut überarbeiteten Leitlinien sehr wohl. 240 Renal Physicians Association and American Society of Nephrology (2000) und (2010). 162 6.4.5.4. Rat und/oder Beratung? Für den Nürnberger Ethikkreis wie auch für andere Ethikberatungen, ist es bislang nicht gelungen, das eigentliche Gespräch genauer zu evaluieren und zu analysieren. Hier könnten ausführliche Verlaufsprotokolle oder im Idealfall auch Tonmitschnitte eine differenzierte inhaltliche und sprachliche Analyse von Gesprächsverläufen erlauben. Aufgrund der vorliegenden Protokolle ist es kaum möglich, eine semantische Textanalyse durchzuführen, um etwa Hinweise auf das Beratungsverständnis der Beratenden („Patient ist uneinsichtig“) oder auch der Patienten und Angehörigen („Er möchte, dass die notwendigen Entscheidungen von den Ärzten getroffen werden“) und ihre darauf gründende Kommunikation zu erhalten. Insofern bleibt die Beratungssituation selbst eine – gelegentlich als „black-box“ 241 bezeichnete – „Unbekannte“. Letztlich stellen sich immer dieselben Fragen: Erfolgt eine Beratung oder wird ein Rat erteilt? Ist der gefundene Konsens das Ergebnis von Kommunikation im Sinne einer gemeinsamen Entscheidungsfindung („shared-decision-making“) oder eher von paternalistisch geprägten Gesprächssituationen? Werden Beratung und Begleitung durch den Ethikkreis und seine Empfehlungen von den Ratsuchenden – Patienten, Angehörige oder Teammitglieder – und den Beratenden selbst als eine Art nicht hinterfragbarer „Expertenrat“ oder aber Konsil empfunden? Oder ist das Beratungsangebot dem Grunde nach ergebnisoffen und hierarchiefrei?242 Sowohl die Protokolle als auch ergänzende mündliche Mitteilungen zeigen, dass es sich beim Nürnberger Ethikkreis um eine Mischung aus „Rat“ und „Beratung“ handelt. Von Seiten der Station (Ärzten wie Pflegenden) wird die Ethikberatung als eine Dienstleistung im Sinne eines Konsils erbeten – auch in den letzten Jahren wird immer wieder der offizielle Konsilantrag als Protokollbogen genutzt. Das eigentliche Beratungsgespräch dient dann der gemeinsamen Entscheidungsfindung mit Patienten und Angehörigen und nutzt das vorher erhobene Wissen sowie die Einschätzung der behandelnden Ärzte und Pflegenden. Persönlich nehmen diese aber nur in etwa jedem zehnten Fall an der Ethikberatung teil. Damit unterscheidet sich die Beratungsform des Ethikkreises von vielen anderen Formen der Ethikberatung, und die Vorteile dieses (Sonder-)Modells gilt es gegenüber den Nachteilen abzuwägen. 241 Frewer (2008), S. 59. Vgl. auch Scofield (2008). 242242 163 Als nachteilig erscheint die mangelnde Teilnahme der Ärzte und Pflegenden am eigentlichen Beratungsgespräch, da so ein wichtiger Bestandteil der ärztlichen und pflegerischen Versorgung – psychosoziale Begleitung und Beratung – an andere Personen delegiert wird. Dies könnte langfristig die Zuständigkeit der verantwortlichen Ärzte und Pflegenden auf die medizinischen und pflegerischen Aspekte der Versorgung reduzieren, die moralischen, psychischen und sozialen Aspekte vernachlässigen und damit das auf Vertrauen, Nähe und Empathie basierende Arzt-Patienten-Verhältnis verändern sowie letztlich auch wichtige kommunikative Lerneffekte in schwierigen Entscheidungssituationen verhindern. Dieser Tendenz könnte insofern Vorschub geleistet werden, da die beteiligten Ärzte – wie in der Befragung gezeigt – die schwierige und oft schlechte Kommunikation mit Patienten und Angehörigen als belastend beschreiben. Sollte sich hier eine Tendenz zur Vermeidung durchsetzen, könnte diese im schlechtesten Fall durch das Angebot der Ethikberatung noch verstärkt und verfestigt werden. Mit einer Delegation der Beratung und der oft als schwierig erlebten Kommunikation mit Patienten und Angehörigen an andere „klinische Experten“ könnte sich auch im psychosozialen Bereich die fachliche „Aufspaltung“ des Patienten und die damit einhergehende Spezialisierung fortsetzen. Dem Anspruch einer ganzheitlichen Betrachtung und Begleitung des Patienten, wie sie die psychosomatische Medizin beschreibt, und einer „sprechenden Medizin“ würde damit wohl entgegengewirkt. Die Vorteile des Modells der „geteilten Beratung“ sind aber ebenso offensichtlich: Unter den genannten Rahmenbedingungen des Krankenhauses findet diese Form der Ethikberatung nicht nur in der Theorie, sondern auch praktisch und in relevanter Anzahl statt. Denn die Vereinbarung einer Beratung setzt nicht nur die flexible und kurzfristige Verfügbarkeit der Beratenden voraus, sondern vor allem die der anderen Teilnehmer, nicht zuletzt der ärztlichen und pflegerischen Mitarbeiter. Gerade letztere finden aber auch wegen der geschilderten Arbeitsverdichtung im klinischen Alltag immer weniger Zeit für ausführliche Gespräche jenseits der Stationsroutine. Das zweiteilige Beratungsangebot entlastet dagegen spürbar (es wurde mit diesem Argument auch eingeführt) und liefert zugleich eine fundierte Empfehlung, die alle wesentlichen Dimensionen – medizinisch, pflegerisch, rechtlich, psychosozial – berücksichtigt. 164 6.4.5.5. Modell „Ethikkreis“ Im Sinne der eingangs vorgestellten Modelle von Ethikberatung entspricht der Nürnberger Ethikkreis damit am ehesten einem Prozessmodell wie dem Nijmwegener Modell, allerdings mit ständiger Zuordnung von Ethikberatern zu einer definierten Klinik. Gerade die Möglichkeit der engen Begleitung und direkten Verortung des Ethikkreises in der Medizinischen Klinik 4, die tägliche Nähe der Mitarbeiter des Ethikkreises zu den ärztlichen und pflegerischen Kollegen auf den Stationen sowie der informelle Kontakt („Man sitzt beim Essen zusammen“), tragen sehr dazu bei, dass der Ethikkreis bereits frühzeitig von potenziellen Patienten für eine Ethikberatung erfährt, um diese dann bei Bedarf eng und zeitnah begleiten zu können. Dies kommt einem Alleinstellungsmerkmal gleich, das den Ethikkreis von anderen Ethikberatungen unterscheidet und ihn gleichsam als ein Sondermodell erscheinen lässt. Hier zeigt sich auch die im Kapitel 3 beschriebene Nähe von Ethikberatung und Psychosomatik. Bei der Implementierung der Psychosomatik hat sich auch im Klinikum Nürnberg vor allem das Modell des Liaisondienstes als erfolgreich erwiesen, da es eine größtmögliche Nähe des Psychosomatikers zu „seiner“ zu versorgenden Klinik eröffnet. Ähnlich ist es in der Ethikberatung. Auch hier kann die dauerhafte Zuordnung klinischer Ethikberater zu definierten Kliniken oder Stationen die Barrieren gegenüber der Ethikberatung abbauen und eine alltägliche Nähe aufbauen helfen. Für die wissenschaftliche Diskussion um die Modelle der Ethikberatung ist der Vergleich mit der Psychosomatik hilfreich. Im Rahmen der Modelldiskussion stellte 2009 eine qualitative Analyse für die USA die grundsätzliche Frage, ob es „ein favorisiertes Modell Klinischer Ethikberatungen für Krankenhäuser“ geben solle.243 Die Medizinethikerin Eva Winkler interviewte dafür fünf Vorsitzende Klinischer Ethikkomitees an Lehrkrankenhäusern der Harvard Medical School in Boston, die jeweils über eine etwa 20jährige Erfahrung verfügten und drei verschiedene Beratungsmodelle nutzten: den einzelnen Ethikberater, das große Ethikkomitee und das Ethikkomitee mit Konsildienst. Den drei Modellen, so die Autorin, lagen sehr unterschiedliche Ziele zugrunde: vom „Patientenanwalt“ bis zum „Gewissen der Institution“. 243 Winkler (2009). 165 In Abhängigkeit von den Zielen bewertete die Wissenschaftlerin die Erfahrungen an den fünf Lehrkrankenhäusern u.a. aufgrund folgender Erfolgskriterien: 1. Verfügbarkeit und Effizienz 2. Einbeziehung aller Betroffenen 3. Repräsentation diverser Ansichten 4. Verantwortungszuschreibung 244 Eine der drei Beratungsformen, so resümiert die Autorin, vereine die Vorteile der anderen beiden Modelle auf sich, ohne unter deren Schwächen zu leiden. Sie gibt demnach dem kleinen Konsilteam als Beratungsdienst den Vorrang, 1. da dieses schnell verfügbar sei, 2. flexibel alle Beteiligten einbeziehen könne 3. die Verantwortung für seine Empfehlung nicht verwässere. „Das große Ethikkomitee hat zwar den Vorteil einer breiten Repräsentation, ist jedoch nicht flexibel genug und schwer zur Verantwortung zu ziehen. Die anderen beiden Modelle gleichen sich gegenseitig in ihren Stärken und Schwächen aus: In Bezug auf die Flexibilität sind sie gleichwertig. Im Hinblick auf die Attributierbarkeit von Verantwortung ist der einzelne Ethikberater überlegen und in der Frage der Qualität ist eher das Konsilteam mit zuschaltbarem Ethikkomitee überlegen, da die Qualität des ersten Modells ausschließlich von den Fähigkeiten des jeweiligen Ethikexperten abhängt.“ 245 Wenngleich diese Untersuchung lediglich fünf ausgewählte Interviews umfasst, erscheint sie doch schlüssig hinsichtlich der vorgeschlagenen Kriterien Klinischer Ethikberatung und ihrer Bewertung. Angewandt auf den Ethikkreis, lässt sich dieser am ehesten dem hier zitierten Modell des Konsilteams zuordnen, in gewisser Weise mit einer „übergeordneten“ Steuerungsgruppe, dem siebenköpfigen Ethikkreis, der auch Supervisionsfunktionen übernimmt. Dies entspricht zudem der eingangs erwähnten Empfehlung der Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer (ZEKO), die 2007 einem dezentralen Modell den Vorrang gab, das weder „Tribunalcharakter“ noch „Einzelkämpfer“ entwickle. 244 245 Winkler (2009), S. 316. Ebd., S. 319. 166 Für den Nürnberger Ethikkreis lässt sich vor diesem Hintergrund zusammenfassend festhalten, dass er sehr schnell verfügbar ist alle Beteiligten – zweistufig – einbezieht konträre Ansichten ausdrücklich berücksichtigt (kontroverse Verläufe) die Verantwortung für seine eigene Empfehlung trägt und dokumentiert die „eigentliche“ Verantwortung bei den Ärzten und Pflegenden belässt Auf der Grundlage dieser methodischen Einordnung des Ethikkreises bezüglich des Zugangs, der Qualifikation und des eigentlichen Gesprächsverlaufes, folgen nunmehr Überlegungen zur Dokumentation und Evaluation der Beratung. 6.4.6. Dokumentation Die Dokumentation der Beratungen durch den Ethikkreis ist im Hinblick auf den langen Zeitraum der Untersuchung bemerkenswert konsequent und vollständig. Die Protokolle erfüllen analog den AEM-Empfehlungen246 die Funktion einer externen wie internen Dokumentation. Sie liefern die geforderten konkreten Anhaltspunkte für einen „Ergebnisbericht“ und werden zur Qualitätssicherung sowohl im Büro des Ethikkreises als auch bei den Krankenunterlagen abgelegt. Die Form der Protokolle wurde über die Jahre weiterentwickelt. Heute enthalten die Protokolle in ihrem ersten Teil eine Check-Liste zur schnellen Erfassung wichtiger personen- und anlassbezogener Daten. In ihrem zweiten, dem Hauptteil, wird der Gesprächsverlauf – mehr oder weniger – ausführlich wiedergegeben. Dieser Teil endet mit einer ausdrücklichen Empfehlung bzw. der expliziten Bemerkung, dass keine Empfehlung erfolgte. Für die Zukunft könnte es sinnvoll sein, die Beschreibung der aktuellen medizinischen, pflegerischen und sozialen Situation stärker zu standardisieren, um der Darstellung der ethischen Fragestellung und des Gesprächsverlaufs größeren Raum zu geben. Gerade der Gesprächsverlauf, etwa die genaue Beschreibung einer konkreten Auflösung einer Kontroverse, ist für die Einschätzung dessen, was die Ethikberatung im Grunde gelingen lässt, aufschlussreich und sollte noch stärker betont werden. 246 AEM (2010). 167 Eine wichtige Konsequenz dieser Arbeit sollte auch die Weiterentwicklung der Dokumentation sein. Gemeinsam mit dem Ethikkreis und der Zentralen Mobilen Ethikberatung könnte am Klinikum Nürnberg eine möglichst einheitliche Dokumentationsform entstehen, die eine gemeinsame Evaluation der Beratung von ZME und Ethikkreis erlaubt. Für eine solche Dokumentation wird in Anlehnung an die Empfehlungen der Akademie Ethik in der Medizin vorgeschlagen, die in Tabelle 31 genannten Aspekte zu berücksichtigen und in einem späteren Evaluationsbogen ausdrücklich abzufragen. Die Herausforderung ist es dabei, eine angemessene Form zwischen einer narrativen Variante, die wichtige Zwischentöne vermittelt, und einem Formular zum schnellen Ankreuzen zu entwickeln. In jedem Fall sollte eine Dokumentation die folgenden Aspekte berücksichtigen: 1. Aspekte der Ethikberatung Detailfragen Initiierung der Beratung wann? wie? von wem? (Berufsgruppe, Hierarchie) Station/Dialyse/Intensiv/IMC 2. Zum Patienten Name, Geschlecht, Alter, Hauptdiagnose Wichtige Nebendiagnosen 3. Zur ethischen Fragestellung Um welche ethische Fragen geht es? 4. Zur aktuellen Situation medizinisch, pflegerisch psycho-sozial, rechtlich 5. Zu Wertvorstellungen, Willen und Patientenverfügung Wünschen des Patienten Vollm acht/Betreuung Mutmaßlicher Wille 6. Zum Gesprächsverlauf unstrittiger oder kontroverser Verlauf? Wie ließen sich Divergenzen auflösen? Gab es eine Wende im Gespräch? Wodurch wurde diese Wende ausgelöst? 7. Zum Gesprächsergebnis Konsens und Empfehlungen Sonstige Vereinbarungen 8. Bereitschaft für Interview ggf. am Ende des Gesprächs direkt kurz und angemessen nachfragen, ob Bereitschaft besteht, in nächster Zeit einige Fragen zu diesem Beratungsangebot zu beantworten. Tabelle 31: Vorschlag zur Dokumentation von Ethikberatungen 168 6.4.7. Evaluation und Entwicklungspotenzial Auch in Nürnberg entwickelte sich die Klinische Ethikberatung erst über Jahre zu einem anerkannten und regelmäßig genutzten Instrument, und selbst in der Medizinischen Klinik 4 könnte das Angebot noch stärker genutzt werden. Die dargestellte Mitarbeiterbefragung für Pflegende wie Ärzte liefert hier eine Reihe von Hinweisen: So wünschten sich beide Berufsgruppen mehrheitlich, „bei aktuellen ethischen Entscheidungskonflikten eine ethisch kompetente Person als Berater hinzuzuziehen“. Auch stellten die befragten Ärzte und Pflegenden die gleichen Ursachen ethischer Konflikte heraus: Nach den Faktoren „Zeitmangel“ und „Arbeitsüberlastung“ nannten sie als drittwichtigsten Auslöser ethischer Konflikte die „mangelnde oder schwierige Kommunikation mit Patienten und Angehörigen“. Es lässt sich darüber streiten, ob mangelnde Kommunikation für sich einen ethischen Konflikt darstellen kann – auslösen oder verstärken kann sie ihn in jedem Fall. Angesichts der genannten Einschätzungen ist es allerdings erstaunlich, dass 65% der befragten Ärzte und 85% der Pflegenden angeben, den Ethikkreis seltener als monatlich oder nie zu nutzen. Damit ist trotz eines formulierten Bedarfs ausgerechnet der Ethikkreis für die Befragten der am seltensten genutzte Ansprechpartner für ethische Konflikte. In dieser erstaunlichen Erkenntnis liegt aber auch eine Chance. Der Ethikkreis schöpft sein Potenzial noch nicht annähernd aus, was die Aufmerksamkeit auf diejenigen lenkt, die in der Mitarbeiterbefragung aus dem Jahr 2007 einer Beratung bei aktuellen Entscheidungskonflikten „indifferent“ gegenüberstanden. Bei den Ärzten waren es auch hier immerhin 47% der Befragten. Daher sollten künftig alle organisatorischen Möglichkeiten geprüft werden, die den Ethikkreis und sein Einschalten noch attraktiver machen. Es sollten sowohl für Ärzte wie für Pflegende solche Fortbildungen gefördert werden, die gerade für schwierige Gesprächssituationen Kompetenz und Souveränität vermitteln – etwa die genannten Kommunikationsseminare der Psychosomatik oder die sogenannten „breaking-bad-news“-Seminare.247 Schließlich steigt bei Ärzten die Nachfrage von Beratungen mit der eigenen Ethikkompetenz. 248 247 Diese Seminare werden vom Fortbildungsinstitut cekib am Klinikum Nürnberg und vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Erlangen-Nürnberg angeboten. 248 Du Val (2004), Hurst (2007). 169 Die Gründe für die gezeigte Diskrepanz zwischen ermitteltem Bedarf und tatsächlicher Nutzung können vielfältig sein. An einer mangelnden Kenntnis oder Information über das klinikeigene Angebot der Ethikberatung dürfte es jedenfalls weniger liegen. Schließlich besteht das Angebot seit vielen Jahren und ist damit insbesondere den langjährigen Oberärzten bekannt; es wird auf den Stationen schriftlich beworben und ist in Gestalt der Dialyseberaterin auch persönlich im Klinikalltag präsent. Aber es ist vermutlich weniger die mangelnde Kenntnis als das mangelnde Vertrauen in eine Beratungskonstellation, die gerade Ärzte vielfach zögern lässt. Wie mehrfach beschrieben wurde,249 spielt schon bei der Implementierung der Widerstand von ärztlicher Seite oft eine wichtige Rolle. Dabei wird vielfach die Sorge um den Verlust der alleinigen Entscheidungskompetenz angeführt. Die Zurückhaltung von Ärzten gegenüber der Ethikberatung begleitet das Thema seit seinen Anfängen und ist vielfach publiziert. So sind diejenigen, die ein solches Angebot explizit nicht nutzen, oft der Meinung, ethische Probleme selbst lösen zu können bzw. müssen.250 In den USA zeigt eine Befragung von 229 Ärzten in der Ausbildung zum Internisten, Chirurgen, Anästhesisten und Pädiater die drei häufigsten Gründe für das Scheitern einer Anforderung von Ethikberatung: der mögliche Ärger mit dem diensthabenden Arzt, das vermutete Missverhältnis von Aufwand und Nutzen und der etwaige Kontrollverlust bei Entscheidungen.251 Anders bewerten diejenigen Ärzte das Angebot, die eine Ethikberatung konkret kennengelernt und selbst daran teilgenommen haben. Schon Ende der 1980er Jahre konnte mehrfach gezeigt werden, dass Ärzte die Ethikberatung hilfreich finden, 252 insbesondere dann, wenn es zu Änderungen des Behandlungsregimes kommen sollte oder gekommen war. 253 In einer Studie zur Bewertung der Ethikberatung von Patienten und Gesundheitspersonal fanden die Beratung immerhin 96% der Ärzte und 95% der Pflegenden hilfreich. 254 Die bereits vermutete Zurückhaltung von Pflegenden gegenüber dem Einschalten des Ethikkreises könnte darin begründet sein, dass moralische Konflikte für sie weniger relevant sind als für die Ärzte oder bei Ärzten kein wirkliches Interesse an ethischen Fragen vermutet wird. 249 Dörries (2003), Strech (2010). Orlowski (2006). 251 Gacki-Smith (2005). 252 La Puma (1988). 253 Orr (1996). 254 McClung (1996). 250 170 Wer eine geringe Akzeptanz für eine Ethikberatung im eigenen Stations- oder Klinikbereich vermutet oder erlebt, wird sich schwer tun, diese vorzuschlagen oder einzufordern. Die Befragung in der Medizinischen Klinik 4 zeigt in diesem Zusammenhang, dass 41% der befragten Ärzte angaben, wöchentlich mit anderen nicht-ärztlichen Kollegen des Teams über ethische Konflikte zu sprechen, während dies nur 21% der Pflegenden angaben. Vielleicht üben Pflegende im Gespräch mit Ärzten eine derartige Zurückhaltung, dass sie die Möglichkeit einer Ethikberatung gar nicht in Betracht ziehen: wenn auf der Station keine offene Gesprächskultur gepflegt wird, fällt es umso schwerer, außenstehende Ethikberater in schwierige Entscheidungen einzubeziehen. Ob die hier vermutete Zurückhaltung auf Verhaltensweisen der „anderen“ Berufsgruppe zurückgeführt werden kann, bleibt spekulativ. In jedem Fall ist die Zurückhaltung von Pflegenden kein Nürnberger Phänomen, sondern wird auch andernorts beschrieben. 255 Auf einen Zeitmangel sollte sich die Zurückhaltung beim Einschalten der Ethikberatung eher weniger zurückführen lassen. Ist doch das Charakteristikum des Nürnberger Ethikkreises, dass er nicht das aufwändige gemeinsame Gespräch aller Beteiligten erfordert, sondern in zwei Schritten – Informationsgespräch mit verantwortlichen Ärzten und Pflegenden und eigentliches Beratungsgespräch mit Patienten und Angehörigen – eine Lösung herbeizuführen sucht. Ärzte wie Pflegende können in diesen Prozess mit vergleichsweise geringem Aufwand ihre fachliche und psychosoziale Sicht einbringen und den zeitaufwändigen Gesprächen dennoch fern bleiben. Insofern sollte der oft genannte „Zeitfaktor“ als Hinderungsgrund für die Ausweitung der Ethikberatungen in diesem Fall nicht gelten. Mit der Klinischen Ethikberatung steht letztlich ein Instrument zur Verfügung, das einem wichtigen Grundprinzip der Medizin entspricht („informed consent“), den Wandel in den Erwartungen vieler Patienten aufgreift („shared-decisionmaking“) und in einem System hoher Arbeitsverdichtung sinnvolle Entlastung verspricht. Umso mehr verwundert es, dass dieses Instrument bis heute keine intensivere Evaluation erfährt. Sowohl Ärzte und Pflegende wie auch Patienten und Angehörige sollten die Gelegenheit erhalten, die die beiden aussagekräftigsten Fragen zu beantworten: Was hat es gebracht? Würden Sie das Instrument weiterempfehlen? 255 Siehe u.a. Nilson (2008). 171 Wie bereits beschrieben, liegen aus fast 40 Jahren nur 14 Publikationen vor, die sich dezidiert mit klinischen Auswirkungen der Beratung befassen. Dies legt den Verdacht nahe, dass es methodische Hürden gibt, die einer breiten Evaluationsforschung entgegenstehen, oder dass andere Gründe eine stärkere wissenschaftliche Begleitung der Klinischen Ethikberatung hemmen. Die wenigen Beratungsfälle vielerorts dürften kein hinreichender Grund sein, da – wie in vielen Studien gezeigt – auch kleine Fallzahlen erste Erkundungen ermöglichen. Für künftige Evaluationen des Ethikkreises und anderer Ethikberatungen sollte sich an die vorliegende Arbeit eine qualitative Befragung von anfordernden Ärzten und Pflegenden bzw. teilnehmenden Patienten und Angehörigen anschließen. Damit könnten für letztere die kurz-, mittel- und langfristigen Wirkungen und für die Mitarbeiter die mögliche Entlastung sowie deren Einstellungen und Bedürfnisse bezüglich der Ethikberatung ermittelt werden. Eine Evaluation der Ethikberatung sollte sich dabei an den Bedürfnissen von Ärzten, Pflegenden, Patienten und Angehörigen orientieren und nicht nur an ökonomischen Größen oder vermeintlich harten Kriterien wie der Mortalität oder den Behandlungstagen. Studien dieser Art führen die Klinische Ethikberatung in die falsche Richtung und öffnen der unreflektierten Instrumentalisierung ethischer Konflikte Tür und Tor. Die Ethikberatung der Nürnberger Ethikkreises wurde initiiert angesichts der zunehmenden Gewissensfragen bei den schweren Entscheidungen zu Fortführung oder Beendigung einer Dialyse, und sie wurden inspiriert durch einen Nürnberger Kongress, der bewusst das Prinzip des „informed consent“ in seiner Bedeutung unterstrichen hat. In dieser Tradition sind eine künftige Forschung und Praxis am Klinikum Nürnberg und in anderen Krankenhäusern wünschenswert. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Anzahl der Beratungen des Ethikkreises überdurchschnittlich hoch ist und dass ein Potenzial von 40 bis 60 Beratungen pro Jahr bei entsprechend unterstützenden Maßnahmen durchaus realistisch erscheint. Abschließend ein kleines Zahlenspiel zur Anregung: Würde für die Medizinische Klinik 4 als grobe Kennzahl eine Ethikberatung pro Intensivbett und Dialyseplatz definiert, entspräche dies 38 Beratungen pro Jahr. Auf die letzten Jahre angewandt, hätte die Klinik für das Jahr 2009 gut die Hälfte (55%) erreicht, für 2007 sogar 126% und für 2008 noch 121%. Die Berechnung quantitativer Ziele mag in diesem Kontext ungewohnt erscheinen, sie kann aus den genannten Gründen aber Sinn machen und sollte daher rechtzeitig und differenziert vorbereitet werden. 172 6.4.8. Entwicklung von Vergleichen und Kennzahlen In diesem Zusammenhang lohnt der Vergleich von sechs Universitätskliniken und zwei kommunalen Großkrankenhäusern, bei denen die für 2009 ermittelten Ethikberatungen256 mit den vollstationären Patientenzahlen ins Verhältnis gesetzt werden. Der Vergleich dient nur der Orientierung. Er lässt die je unterschiedlichen Beratungsmodelle, „Zählweisen“ der Beratungen und auch die unterschiedlichen Strukturen der Klinken, etwa bei der Anzahl der Intensivbetten, der Geburten, Frühgeburten oder beim Schweregrad der Erkrankungen, unberücksichtigt. Krankenhaus Beratungsmodell Beratungen Patienten Ungefähres pro Jahr pro Jahr Verhältnis Ev. Krankenhaus Bielefeld Meist berät ein Mitglied des Ethikberatungsdienstes (14 Personen) 46 ca. 47.000 1 : 1.021 Universitätsklinik Erlangen 20 Mitgl. des KEK beraten, jeweils zu 2 - 3 Patienten, AG Ethikberatung 25 ca. 65.000 1 : 2.600 Med. Hochschule Hannover 17 Mitgl. des KEK beraten, jeweils zu dritt (med., pfleg. und externe Perspektive) 56 ca. 55.000 1 : 982 Universitätsklinik Marburg Einzelner Ethikberater (Arzt) bietet Ethikvisiten an, keine größeren Beratungen Siehe Text ca. 44.000 1 : 278 Universitätsklinik Jena 12 Mitgl. des KEK beraten, jeweils zu zweit (ein Arzt), als „Ethikkonsil“ bezeichnet 10 ca. 51.000 1 : 5.100 Universitätsklinik Mannheim Mitgl. des KEK beraten zu dritt, maximal zu viert 8-10 ca. 66.000 1 : 7.333 Klinikum Nürnberg Insgesamt ca.15 Berater, die zentral angefordert, zu zweit beraten 12 ca. 93.000 1 : 7.750 Universitätsklinik Tübingen AG Ethikberatung/KEK, fünf Berater moderieren auf Station Fallbesprechungen 30 ca. 62.000 1 : 2.066 Ethikkreis Med. Klinik 4 Nürnberg Zweistufige Beratung, siebenköpfiges Team, beraten mind. zu zweit 21 ca. 5.000 1 : 238 Tabelle 32: Ethikberatungen 2009 im Krankenhausvergleich 256 Die Angaben wurden über persönliche Mitteilungen oder die Homepage der Kliniken ermittelt. 173 Der Vergleich zeigt zumindest einige Unterschiede auf, wenngleich die große Vielfalt der Modelle, die hierzulande praktiziert wird, und auch die Dynamik, mit der sich die Ethikberatung mancherorts ausgebreitet bzw. etabliert hat, nicht erkennbar sind. So hat sich das Angebot am Evangelischen Krankenhaus in Bielefeld binnen weniger Jahre von zwölf Beratungen im Jahr 2006, über 14 in 2007, 27 in 2008 auf immerhin 46 Beratungen im Jahr 2009 entwickelt. 257 Dagegen feierte das Angebot an der Medizinischen Hochschule Hannover im Dezember 2010 bereits sein zehnjähriges Bestehen und führt die „Liste“ mit jährlich 56 Beratungen an, wobei hier eigene Einschlusskriterien gelten dürften. Die Ethik-Konsile am Universitätsklinikum Marburg sind in diese Tabelle nur bedingt zu integrieren. In Marburg wird im Rahmen der Ethik-Visiten der Kontakt zu jedem einzelnen Patienten gezählt, was mit den Ethikdiensten anderer Kliniken wenig vergleichbar ist und daher zu noch größeren Verzerrungen führt. Wie erwähnt, soll die Bestimmung der Relation zwischen Ethikberatungen und stationären Patienten nur der Orientierung dienen und für die grundsätzliche Idee einer Generierung von „Kennzahlen“ werben. Daraus eine „Rangliste“ der aktivsten Standorte der Ethikberatung ableiten zu wollen, würde zu kurz greifen. Die Angebote selbst sind nur schwer vergleichbar, von der Vergleichbarkeit der gesamten Kliniken ganz zu schweigen. Dennoch erlaubt die hier vorgeschlagene Relation zwischen Ethikberatung und Fallzahlen einen ersten Eindruck vom Umfang der Aktivitäten und ihrem Verhältnis zur Gesamtversorgung. Damit ist nicht gemeint, dass die Klinische Ethikberatung ihre Berechtigung nur durch große Fallzahlen sicherstellt – im Gegenteil. Die gelingende Moderation und Begleitung einer schwierigen Entscheidung bei einem schwerkranken oder sterbenden Patienten und seinen Angehörigen ist in jedem (Einzel-)Fall eine wichtige Hilfestellung, die für die Verarbeitung dieser persönlichen, familiären oder beruflichen Situation von bleibender Bedeutung sein kann. Die Relevanz der Ethikberatung lässt sich nicht zuerst in Zahlen bemessen. Die Ethikberatung kann sich bereits durch die erfolgreiche Begleitung weniger Fälle bewähren und für ein öffentliches oder freigemeinnütziges Krankenhauses sinnvoll sein; zumal dann, wenn sie der praktische Ausdruck der meist in Leitbildern formulierten Werte ist. 257 Kobert (2010). Der Klinische Ethikberater des Evangelischen Krankenhauses in Bielefeld gibt seit 2005 einen jährlich erscheinenden Bericht heraus, der auf knapp 50 Seiten vorbildlich über verschiedene Aktivitäten des Klinischen Ethikkomitees, seiner Arbeitsgruppen und weiterer Initiativen informiert. 174 Vielleicht gibt es analog anderen „Faustregeln“ auch für die Ethikberatung eine einfache Formel, die zum Aktivitätsgrad Klinischer Ethikdienste valide Aussagen zuließe und diese im Hinblick auf die Anzahl der Beratungen vergleichbar machen würde. Eine solche – mehr volkstümliche als wissenschaftlich basierte – „Daumenregel“ soll es früher beispielsweise für die Anzahl der Verstorbenen pro Krankenhaus und Jahr gegeben haben. Sie lautete kurz und prägnant: es sterben im Krankenhaus pro Jahr etwa so viele Patienten wie das Krankenhaus Betten hat. Die Suche nach einer angemessenen Formel oder Kennzahl für die Beurteilung der Anzahl ethischer Beratungen im Krankenhaus ist weder theoretische Spielerei noch akademische Übung; sie ist ein sinnvoller strategischer Schritt, um mögliche Diskussionen um die Ausgestaltung dieses besonderen Angebots zu versachlichen. Angesichts des wachsenden Kostendrucks in den Kliniken werden derartige Diskussionen unweigerlich zunehmen und damit auch die Ethikberatung wie viele andere Dienstleistungen vielleicht vermehrt auf den Prüfstand geraten.258 Zur weiteren Diskussion einer Kennziffer für die anzustrebende Zahl von Ethikberatungen pro Krankenhaus bieten sich je nach Schwerpunkt der Klinik bzw. der vorhandenen Beratung zum Beispiel folgende Strukturmerkmale von Krankenhäusern an, um sie zur Anzahl der Ethikberatungen in Relation zu setzen: - Anzahl der Betten von Intensivstationen und/oder Palliativstation - Anzahl der Dialyseplätze - Anzahl der Geburten oder Frühgeburten pro Jahr - Casemix-Index der Klinik (Schweregrad der Erkrankungen) Würde man diese Merkmale auf die oben genannten Krankenhäuser übertragen, ergäbe sich vermutlich ein interessantes Bild. Insgesamt zeigt sich, dass der Ethikkreis einer Fachabteilung im Klinikum Nürnberg ebenso viele oder mehr Ethikberatungen im Jahr durchführt wie andere Krankenhäuser insgesamt. Sollte das Modell des abteilungsbezogenen Ethikkreises im Klinikum Nürnberg allein dort auf die Fächer Onkologie (inkl. Palliativstation), Geriatrie und Neurologie ausgeweitet werden, könnten im Klinikum Nürnberg mehr als 100 Ethikberatungen pro Jahr stattfinden. Auf weitere Fachkliniken ausgedehnt, hat das Modell ein Potenzial von mehreren hundert Beratungen pro Jahr, was einer flächendeckenden Versorgung gleichkäme. 258 Schildmann (2010). 175 6.5. Zusammenfassung des Kapitels Entstanden aus der Dialyseberatung, bildete sich der Ethikkreis der Medizinischen Klinik 4 bereits 1997 und bot sich Mitarbeitern, Patienten und Angehörigen an, um Hilfestellung in Konfliktfällen zu geben, bei Entscheidungen zu vermitteln und Beistand in schwierigen Situation zu leisten. Hieraus entwickelte sich das Angebot einer Klinischen Ethikberatung, die bis heute von sieben Mitarbeitern aus Pflege, Medizin und Seelsorge getragen wird. Die Beratung erfolgt mindestens zu zweit und besteht meist aus zwei Teilen: einem Gespräch mit den betreuenden Ärzten und Pflegenden, um den Hintergrund differenziert zu klären; und einem zweiten Gespräch mit Patienten und Angehörigen, der eigentlichen Ethikberatung. Deren Ergebnis wird dokumentiert und dem Behandlungsteam übermittelt, das am Beratungsgespräch selbst nicht notwendigerweise teilnehmen muss. Auf der Grundlage von 262 Beratungsprotokollen aus den Jahren 1999 bis 2011 wurde die bisherige Beratungspraxis mittels eines eigens entworfenen Analysebogens deskriptiv-quantitativ ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass an jeder zweiten Beratung der Patient selbst teilgenommen hat, wenn auch nur zu 43% kontaktfähig. Der Patientenwille war in 58% der Fälle direkt oder indirekt bekannt und eindeutig, in 19% der Fälle war er ambivalent. 59% der Gespräche verliefen unstrittig, 36% dagegen kontrovers. In 89% der Beratungen konnte ein Konsens erzielt werden, in 96% wurde eine Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt wurden 331 Empfehlungen gegeben. Von den 163 Empfehlungen zur Dialyse votierten 81 für eine Fortsetzung und 82 für eine Beendigung; ein Ergebnis, das die Ausgewogenheit der Beratungen durch den Ethikkreis deutlich bestätigt. Aus den meist kurzen Protokollen lassen sich keine Gesprächsverläufe nachvollziehen. Daher bleiben leider der Kern dessen, was sich im Verlauf der Gespräche vollzieht, und die Genese von Meinungsänderungen unklar. Wohl aber lässt sich zeigen, dass der Ethikkreis mit seinen Ethikberatungen ein patientenorientiertes Angebot etabliert hat, das in fast allen Fällen zu einem Konsens führt. Ob die gefundenen Entscheidungen letztlich hilfreich, belastbar und dauerhaft waren, können nur künftige Befragungen aller Beteiligten zeigen. Die besondere Nähe des Ethikkreises zu den Kolleginnen und Kollegen der Klinik – ähnlich wie bei einem Liaisondienst – scheint ein erfolgversprechendes Modell von Ethikberatung zu sein und sollte weitere Verbreitung finden. Für die Aktivitätsmessung von Ethikberatungen bieten sich verschiedene Kennzahlen an. 176 7. Schlussfolgerungen Aus den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung zum Thema „Ethik“ im Sommer 2007 und der Auswertung der Protokolle des Ethikkreises für den Zeitraum von 1999 bis 2011 lassen sich eine Reihe von Schlussfolgerungen ableiten. Sie folgen der Frage, welche Rahmenbedingungen dazu beitragen, das für sinnvoll erachtete Angebot der Ethikberatung weiter zu verbreiten und dabei die Bedürfnisse der Patienten und Angehörigen wie der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen zu berücksichtigen. Auch wenn letztlich der Patient im Mittelpunkt steht, bedarf es doch eines Rahmens, der die patientennah arbeitenden Pflegenden und Ärzte darin unterstützt, ihre physisch und psychisch oft belastende Arbeit mit einem hohen Maß persönlicher Arbeitszufriedenheit leisten zu können. Die Ethikberatung hat das Potenzial, ein besonderes Angebot einer Klinik darzustellen, das mit einer hohen Patientenorientierung verbunden ist und Empathie, Wertschätzung und Zuwendung vermittelt. Was Patienten unmittelbar beurteilen können, ist neben der Termintreue, Sauberkeit und dem Essen besonders der Umgang der Mitarbeiter untereinander und ihnen gegenüber. Dies drückt sich in einfachen Fragen aus: „Hat man sich Zeit für mich genommen?“, „Wurden meine Fragen gehört und beantwortet?“, „Wie wurde ich behandelt?“ Vor diesem Hintergrund kann die Ethikberatung für diejenigen, denen sie zuteil wird, eine wichtige Erfahrung und Hilfe sein, die ihnen bei der Verarbeitung von Krankheit oder Krankheitsbegleitung hilft und eine innere Bindung zu Ärzten und Pflegenden entstehen lässt. Gerade für Angehörige von verstorbenen Patienten spielen die Gespräche und Rituale, die sie im Krankenhaus erfahren, für die weitere Bewältigungs- und Trauerarbeit eine wichtige Rolle. In jedem Fall sollten das Angebot des Ethikkreises und die dafür notwendigen Ressourcen auch künftig aufrechterhalten werden. Die Zeit und das Engagement der dienstältesten Pflegekraft und des teilnehmenden Seelsorgers bilden das notwendige Fundament, auf dem der Kreis seine Aktivitäten der Beratung und Supervision konsequent aufbauen und fortentwickeln kann. Der sprunghafte Anstieg der Beratungen in den Jahren 2007 und 2008 belegt, dass klinikinterne Maßnahmen zum Thema Ethik die Nachfrage derartiger Angebote deutlich steigern können. Insofern scheint es empfehlenswert, vergleichbare Aktivitäten auch künftig zu initiieren, ob als klinikinterne Fortbildungen oder Forschung. 177 Um die Akzeptanz und Nutzung der Ethikberatung weiter zu fördern, könnten die Mitglieder des Ethikkreises darauf achten, gerade neuen ärztlichen Mitarbeitern das Angebot der Ethikberatung ausdrücklich zu erläutern und sie auch für eine persönliche Teilnahme zu motivieren. Wie bereits gezeigt, bewerten Ärzte, die bereits Erfahrungen mit der Klinischen Ethikberatung gesammelt haben, diese deutlich positiver. Die Initiative zur Gründung des Ethikkreises an der Medizinischen Klinik 4 war ein Glücksfall, der engagierten Ärzten und Pflegenden und einer weitsichtigen kooperativen Leitung zu verdanken ist. Ob dieser Glücksfall auch zum Standard für das gesamte Klinikum Nürnberg werden kann, ist sorgfältig abzuwägen. Angesichts der zahlreichen Implementierungshürden im Klinikalltag (z.B. Entscheidungshoheit, Zeitmangel, Teamdissens) sind alle Schritte hilfreich, die eine Schwellenangst gegenüber der Beratung reduzieren. So könnte eine stärkere Zuordnung der Ethikberater der „Zentralen Mobilen Ethikberatung“ (ZME) am Klinikum Nürnberg an definierte einzelne Abteilungen die potenzielle höhere Anonymität und Distanz einer zentralen Dienstleistung verringern und damit ein größeres Vertrauen in das Angebot der Ethikberatung ermöglichen. Eine solche Zuordnung – etwa als Ethischer Liaison-Dienst – sollte mit den Mitgliedern der ZME diskutiert und im Rahmen von Pilotprojekten in geeigneten Kliniken erprobt werden. Aufgrund ihrer spezifischen Patientengruppen würden sich beispielsweise die Kliniken für Onkologie, Geriatrie, Neurologie oder Neurochirurgie bzw. die internistischen Intensivstationen anbieten. Im Rahmen einer Erprobung könnten Ärzte und Pflegende der Kliniken zunächst intensiv über das Angebot informiert werden, bevor dann die abteilungsbezogenen „KlinikEthiker“ ihren Dienst aufnehmen. Die hier am Beispiel des Ethikkreises der Medizinischen Klinik 4 untersuchte besondere Aktivität im Bereich der Klinischen Ethikberatung im Klinikum Nürnberg ist vor dem eingangs geschilderten historischen Hintergrund besonders bemerkenswert. Sie passt daher nicht nur zur Stadt Nürnberg als historischem Ort des Nürnberger Ärzteprozesses und heutiger Stadt der Menschenrechte, sondern auch zum Klinikum Nürnberg als ihrem Kommunalunternehmen. In diesem Sinne – und aufgrund der hier vorgestellten positiven Evaluationsergebnisse – sind die Klinischen Ethikberatungen auf Dauer wichtig und unterstützenswert und bedürfen einer weiteren wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation. 178 8. Literatur 1. Ad-hoc-Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death (1968): A definition of irreverible coma. In: The Journal of the American Medical Association 205, S. 85-88. 2. Agic h GJ, Yougner SJ (1991): For experts only? Access to Hospital ethics Committees. In: The Hastings Center Report (1991), S. 17-26. 3. Alexander S (1962): They Decide Who Lives, Who dies. Medical Miracle Puts a Moral Burden on a Small Community. In: Life 9, S.102-125. 4. American Society for Bioethics and Humanities (ASBH) (1998): Core Competencies for Health Care Ethics Consultations. Glenview, IL. 5. American Society for Bioethics and Humanities (ASBH) (2011): Core Competencies for Health Care Ethics Consultations. 2. Auflage. Glenview, IL. 6. Annas G, Grodin M (1992): The Nazi Doctors and the Nuremberg Code. Human Rights in Human Experimentation. Oxford University Press, Oxford. 7. Andereck WS (1992): Development of a hospital ethics committee: lessons from five years of case evaluation. In: Cambridge Quarterly Health Ethics 1:41-50. 8. Aulisio PA, Arnold RM, Youngner ST (2000): Health Care Ethics Consultation: nature, goals, and competencies. A position paper from the Society of Health and Human Values – Society für Bioethics Consultation Task Force on Standards for Bioethics Consultation. In: Annals of Internal Medicine 133 (1):59-69. 9. Baader G, Schultz U (1980): Medizin im Nationalsozialismus. Tabuisierte Vergangenheit. Ungebrochene Tradition? Dokumentation des Gesundheitstages Berlin 1980. Band 1. Berlin. 10. Baader G (1998): Menschenwürde zwischen Medizinverbrechen und Modernität. In: Kolb/Seithe (1998), S. 128-150. 11. Bauer AW (2007): Das Klinische Ethik-Komitee (KEK) im Spannungsfeld zwischen Krankenhaus-Zertifizierung, Moralpragmatik und wissenschaftlichem Anspruch. In: Wiener Medizinische Wochenschrift 157/910:201-209. 12. Beauchamp TL, Childress JE (2009): Principles of biomedical ethics. 6. Auflage. Oxford University Press, New York. 13. Beecher HK (1959): Experimentation in Man. In: Journal of the American Medical Association 169 (5):461-478. 179 14. Beecher HK (1968): A definition of irreversible coma. Report of the Ad-hocCommittee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death. In: Journal of the American Medical Association 205, S. 337340. 15. Blum K, Offermanns M, Perner P (2008): Krankenhaus Barometer. Umfrage 2008. Deutsches Krankenhausinstitut, Düsseldorf. 16. Bobbert M (2002): Patientenautonomie und Pflege. Campus, Frankfurt a. M., New York. 17. Böcken J, Braun B, Schnee M (2004): Gesundheitsmonitor 2004. Die ambulante Versorgung aus der Sicht der Bevölkerung und Ärzteschaft. Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. 18. Böhme G (2008): Den Fall Viktor von Weizsäcker ernst nehmen. Zur Topik der Bioethik. In: Böhme et al. (2008), S. 102-119. 19. Böhme G, LaFleur WR, Shimazono S (Hrsg.) (2008): Fragwürdige Medizin. Unmoralische Forschung in Deutschland, Japan und den USA im 20. Jahrhundert. Campus, Frankfurt a.M. 20. Bramstedt KA, Jonsen AR, Anderek WS, McGaughey JW, Neidich AB (2009): Optimising the documentation practises of an Ethics Consultation Service. 35;47-50. 21. Brennan TA (1988): Ethics Committes and Decisions to Limit Care. The Experience at the Massachusetts General Hospital. In: Journal of the American Medical Association 260,6:803-807. 22. Brunner A, Wildner M, Fischer R, Ludwig MS, Meyer N, Crispin A, Weitkunat R (2000): Patientenrechte in vier deutschsprachigen europäischen Gesundheitsregionen. Patients rights in four german speaking european regions. In: Journal of Public Health, Volume 8, 3:273-286. 23. Bruns F, Frewer A (2008): Systematische Erosion des Gewissens. Neuere Forschung zu Medizingeschichte und Ethik im Zweiten Weltkrieg. In: Gerhardt/Kolb et al. (2008), S. 55-71. 24. Bruns F, Frewer A (2010): Fallstudien im Vergleich. Ein Beitrag zur Standardisierung Klinischer Ethikberatung. In: Frewer et al. (2010), S. 301310. 25. Bruns F, Frewer A (2011): Klinische Ethikberatung und palliative Sedierung. Ein Vergleich unterschiedlicher Perspektiven. In: Frewer et al. (2011), S. 259-264. 26. Charles C, Gafni A, Whelan T (1999): Decision making in the physicianpatient encounter: revisiting the shared treatment decision-making modell. In: Social Science and Medicine 49:651-661. 180 27. Cohn F, Goodman-Crews P, Rudman W, Schneidermann LJ, Waldman E (2007): Proactive Ethics Consultation in the ICU: A Comparison of Value Perceived by Healthcare Professionals and Recipients. In: The Journal of Clinical Ethics. 18 (2):140-147. 28. Colen BD (1976): Karen Ann Quinlan. Dying in the Age of Eternal Life. New York. 29. Coulter A, Magee H (2003): The European Patient in the Future. Open University Press, Maidenhead, Philadelphia. 30. Deppe U (2008): Solidarität statt Kommerzialisierung. Zur grundlegenden Orientierung von Gesundheitspolitik. In: Gerhardt/Kolb et al. (2008), S. 133149. 31. Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e.V./Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e.V (DEKV/KKVD) (1997) EthikKomitee im Krankenhaus. Erfahrungsberichte zur Einrichtung von Klinischen Ethik-Komitees. Rebholz, Berlin. Freiburg. 32. Deutsches Krankenhausinstitut (2010): Das erfolgreiche kommunale Krankenhaus. Forschungsgutachten des deutschen Krankenhausinstituts im Auftrag des Interessenverbandes kommunaler Krankenhäuser e.V., Düsseldorf. 33. Deutsches Krankenhausinstitut (2010): Krankenhausbarometer. Umfrage 2010. Düsseldorf. 34. Dierks ML, Seidel G, Schwartz W (2006): Bürger und Patientenorientierung im Gesundheitswesen. In: Gesundheitsberichterstattung Heft 32. 35. Dörner K, Ebbinghaus A, Linne A (Hrsg.) (1999): Der Nürnberger Ärzteprozeß 1946/47. Wortprotokolle, Anklage- und Verteidigungsmaterial, Quellen zum Umfeld, München. 36. Dörner K (1988): Tödliches Mitleid. Jakob von Hoddis, Gütersloh. 37. Dörner K (2004): Gesundheit in der Marktfalle. In: Graumann/Grüber (2004), LIT, Münster, S. 71-82. 38. Dörner K (2004): Das Gesundheitsdilemma. Woran unsere Medizin krankt. Ullstein, Berlin. 39. Dörner K (2005): Der gute Arzt. Schattauer, Stuttgart. 40. Dörries A (2003): Mixed feelings. Physician´s concerns about clinical ethics committees in Germany. In: HEC Forum 15:245-257. 41. Dörries A et al. (2005): Ethikberatung im Krankenhaus. Qualifizierungsprogramm Hannover. In: Ethik in der Medizin 17:327-331. 181 42. Dörries A, Hespe-Jungesblut K (2007): Die Implementierung Klinischer Ethikberatung in Deutschland. Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage bei Krankenhäusern. In: Ethik in der Medizin 19:148-156. 43. Dörries A, Neitzke G, Simon A, Vollmann J (Hrsg.) (2008): Klinische Ethikberatung. Ein Praxisbuch. Kohlhammer, Stuttgart. 44. Dörries A, Simon A, Neitzke G, Vollmann J (2010): Implementing clinical ethics in German hospitals: content, didactics and evaluation of a nationwide postgraduate training programme. In: Journal of Medical Ethics 36:721-726. 45. Dowdy M, Robertson C, Bander A (1998): A study of proactive ethics consultation for critically and terminally ill patients with extended lengths of stay. In: Critical Care Medicine 26 (2):252-259. 46. Du Val G, Clarridge B, Gensler G, Danis M (2004): A National Survey of U.S. Internists´ Experiences with Ethical Dilemmas and Ethics Consultation. In: Journal of General Internal Medicine 19:251-258. 47. Eckart WU (2009): Verletzungen der Menschenwürde: Gefährliche Forschungsversuche vom „Dritten Reich“ bis heute. In: Frewer et al. (2009), S. 25-50. 48. Edwards a, Elwyn G (2001): Evidence-based patient choice. Inevitable or impossible? Oxford University Press, Oxford. 49. Emanuel EH, Emanual LL (1992): Four models of the physician-patient relationship. In: Journal of the American Medical Association 267:22212226. 50. Engel GL (1996): Wie lange noch muss sich die Wissenschaft der Medizin auf eine Weltanschauung aus dem 17. Jahrhundert stützen? In: Uexküll et al. (1996), S. 3-11. 51. Engelhardt D, Loewenich V, Simon A (Hrsg.) (2001): Die Heilberufe auf der Suche nach ihrer Identität. LIT, Münster. 52. Erbguth F (2008): Patientenautonomie durch „Vollzug“ therapielimitierender Patientenverfügungen. In: Gerhardt/Kolb et al. (2008), S. 397-411. 53. Erbguth F, Fichtner R, Sieber C (2007): Ethik als Aufgabe der Unternehmensentwicklung. In: Maly U, Estelmann A (2007), S. 157-176. 54. Fahr U (2008): Die Entwicklung emotionaler Kompetenz in einzelfallbezogenen Lernarrangements. In: Ethik in der Medizin 20:26-39. 55. Fahr U (2008): Philosophische Modelle klinischer Ethikberatung. Ihre Bedeutung für Praxis und Evaluation. In: Frewer et al. (2008) S. 75-98. 56. Fahr U (2008): Die Aufgaben des Klinischen Ethikberaters aus erwachsenenpädagogischer Sicht. In: Groß et al. (2008), S. 69-79. 182 57. Fahr U (2009): Die Dokumentation Klinischer Ethikberatung. In: Ethik in der Medizin 21:32-44. 58. Fahr U, Herrmann B, May AT, Reinhardt-Gilmour A, Winkler EC (2011): Empfehlungen für die Dokumentation Ethik-Fallberatungen. In: Ethik in der Medizin 23 (2):155-159. 59. Fallowfield L, Jenkins V, Farewell V, Solis-Trapala I (2003): Enduring impact of communication skills training: results of a 12-month follow-up. In: British Journal of Cancer 89:1445-1449. 60. Fallowfield L, Jenkins V (2003): Communicating sad, bad, and difficult news in medicine. In: Lancet 363:312-319. 61. Fletcher JC, Hoffmann DE (1994): Ethics Committees, Time to Experiment with Standards. In: Annals of Internal Medicine 120:335-338. 62. Foerde R, Pedersen R, Akre V (2008): Clinician´s evaluation of clinical ethics consultations in Norway: a qualitative study. In: Medicine, Health Care and Philosophy. 11:17-25. 63. Foerde R, Vandvik IH (2005): Clinical ethics, information, and communication: review of 31 cases from a clinical ethics committee. In: Journal of Medical Ethics 31:73-77. 64. Fox E, Myers S, Pearlman R (2007): Ethics consultation in United States Hospitals: a national survey. In: American Journal of Bioethics 7:13-25. 65. Freedom B, Weijer C, Bereza E (1993): Case notes and charting of bioethical case consultation. In: HEC Forum 5 (3):176-195. 66. Frewer A (2000): Medizin und Moral in Weimarer Republik und Nationalsozialismus. Die Zeitschrift „Ethik“ unter Emil Abderhalden. Campus, Frankfurt a.M., New York. 67. Frewer A (2007): History of Medicine and Ethics in Conflict. Research on National Socialism as a Moral Problem. In: Schmidt/Frewer (2007), S. 255282. 68. Frewer A (2008): Moralische Probleme medizinischer Forschung. Argumentationsprofile in der Zeitschrift „Ethik“ und ihr Kontext. In: Böhme et al. (2008), S. 52-79. 69. Frewer A (2008): Ethikkomitees zur Beratung in der Medizin. Entwicklung und Probleme der Institutionalisierung. In: Frewer et al. (2008), S. 47-74. 70. Frewer A (2009): Medizinethik 1948. Moral und Menschenrechte in historischer Perspektive. In: Frewer et al. (2009), S. 51-71. 71. Frewer A, Bruns F (2004): „Ewiges Arzttum“ oder „neue Medizinethik“ 1939 – 1945? Hippokrates und Historiker im Dienst des Krieges. In: Medizinhistorisches Journal, Heft ¾, S. 313-336. 183 72. Frewer A, Bruns F, Rascher W (Hrsg.) (2010): Hoffnung und Verantwortung. Herausforderungen für die Medizin. Jahrbuch Ethik in der Klinik 3. Königshausen & Neumann, Würzburg. 73. Frewer A, Fahr U (2007): Clinical Ethics and Confidentiality. Opinions of Experts and Ethics Committees. In: HEC Forum 19 (4):275-289. 74. Frewer A, Fahr U, Rascher W (Hrsg.) (2008): Klinische Ethikkomitees. Chancen, Risiken und Nebenwirkungen. Jahrbuch Ethik in der Klinik 1. Königshausen & Neumann, Würzburg. 75. Frewer A, Kolb S, Krása K (Hrsg.) (2009): Medizin, Ethik und Menschenrechte. V&R unipress, Göttingen. 76. Fukuyama M, Asai A, Itai K, Bito S (2008): A report on small team clinical ethics consultation programmes in Japan. In: Journal of Medical Ethics 34:858-862. 77. Gacki-Smith J (2005): Residents` access to ethics consultation. Knowledge, use, and perceptions. In: Academic Medicine 80:168-175. 78. Geisler L (2004): Patientenautonomie. Eine kritische Begriffsbestimmung. In: Deutsche Medizinische Wochenschrift 129:453-456. 79. Gerdes B, Richter G (1999): Ethik-Konsultationsdienst nach dem Konzept von J.C. Fletcher an der University of Virginia, Charlottesville USA. In: Ethik in der Medizin 11:249-261. 80. Gerhardt M, Kolb S, Bonde I, Kaiser T, Klein K, Wolf C (Hrsg.) (2008): Medizin und Gewissen. Im Streit zwischen Markt und Solidarität. Mabuse, Frankfurt a.M. 81. Gerst TH (1994): Der Auftrag der Ärztekammern an Alexander Mitscherlich zur Beobachtung und Dokumentation des Prozeßverlaufs. In: Deutsches Ärzteblatt 91, S.1037-1046. 82. Gill AW, Saul P, McPhee J (2004): Acute clinical ethics consultation. The practicalities. In: Medical Journal of Australia, 181:204-206. 83. Gold C, Geene R, Stötzner K (2000): Patienten, Versicherte, Verbraucher. Möglichkeiten einer angemessenen Vertretung. b-books, Berlin. 84. Graumann S (2004): Autonomie als moralisches Recht. Eine Grundlage für die politische Gestaltung des Gesundheitswesens? In: Graumann/Grüber (2004), S.49-70. 85. Graumann S (2008): Voraussetzungen Gerhardt/Kolb (2008), S. 415-428. von Patientenautonomie. In: 86. Graumann S, Grüber K. (Hrsg.) (2004): Patient – Bürger – Kunde. Soziale und ethische Aspekte des Gesundheitswesens. LIT, Münster. 184 87. Grekul J, Krahn H, Odynak D (2004): Sterilizing the „Feeble-minded“: Eugenics in Alberta, Canada, 1929-1972. In: Journal of Historical Sociology 17;358-384. 88. Groß D, May AT, Simon A. (Hrsg.) (2008): Klinische Ethikberatung an Universitätskliniken, Reihe: Ethik in der Praxis, Münster. 89. Hanauske-Abel H (1998): Von Anbeginn eine tiefe Beziehung: Nationalsozialismus und Ärzteschaft im Jahre 1933. In: Kolb/Seithe (1998), S. 52-67. 90. Hohendorf G, Magull-Seltenreich A (Hrsg.) (1990): Von der Heilkunde zur Massentötung. Medizin im Nationalsozialismus. Wunderhorn, Heidelberg. 91. Huber E (1998): Ärztinnen und Ärzte in sozialer Verantwortung. Gedanken zu einer gewissenhaften Medizin. In: Kolb/Seithe (1998), S. 435-446. 92. Huber E, Langbein K (2004): Die Gesundheitsrevolution. Radikale Wege aus der Krise. Was Patienten wissen müssen. Aufbau, Berlin. 93. Hurst SA, Hull SC, Du Val G, Danis M (2005): How physicians face ethical difficulties: a qualitative analysis. In: Journal of Medical Ethics 31 (1):7-14. 94. Hurst SA, Slowther AM, Foerde R, Pegoraro R, Reiter-Theil S, Perrier A, Garrett-Mayer E, Danis M (2006): Prevalence and Determinants of Physician Bedside Rationing. In: Journal of General Internal Medicine 21:1138-1143. 95. Hurst SA, Perrier A, Pegoraro R, Reiter-Theil S, Foerde R, Slowther AM, Garrett-Mayer E, Danis M (2007): Ethical difficulties in clinical practise: experiences of European doctors. In: Journal of Medical Ethics 33 (1):51-57. 96. Hurst SA, Foerde R, Reiter-Theil S, Slowther AM, Perrier A, Pegoraro R, Danis M (2007): Physicians´views on resource availability and equity in four European health care systems. In: BMC Health Services Research 7:137. 97. Hurst SA, Reiter-Theil S, Perrier A, Foerde R, Slowther AM, Pegoraro, Danis M (2007): Physicians´ Access to Ethics Support Services in Four European Countries. In: Health Care Annuals 15:321-335. 98. Illich I (1995): Die Nemesis der Medizin. 4. überarbeitete Auflage. C. H. Beck, München. 99. Isfort J, Floer B, Koneczny N, Vollmar HC, Lange S, Rieger M, Butzlaff M (2004): Shared Decision Making. Sind die Patienten in der hausärztlichen Praxis dazu bereit? Poster, Patientenbeteiligung bei medizinischen Entscheidungen. 2. Tagung des Förderschwerpunktes „Der Patient als Partner im medizinischen Entscheidungsprozess“. Freiburg. 100. Isfort M, Weidner F (2009): Pflege-Thermometer 2009. Eine bundesweite Befragung von Pflegekräften zur Situation der Pflege und Patientenversorgung im Krankenhaus. Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung, Köln. 185 101. Katz J (1998): Menschenopfer und Menschenversuche. Nachdenken in Nürnberg. In: Kolb/Seithe (1998), S. 225-243. 102. Kettner M (2008): Autorität und Organisationsform Ethikkomitees. In: Frewer et al. (2008), S. 15-28 Klinischer 103. Kettner M, May A (2002): Ethik-Komitees in Kliniken. Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven. In: Ethik in der Medizin 14:295-297. 104. Kiss A, Söllner W (2006): Communication and Communication Skills Training in Oncology: Open Questions and Future Tasks. In: Recent Results in Cancer Research 168:121-125. 105. Klauber J, Robra BT, Schellschmidt H (Hrsg.) (2007): Krankenhausreport 2007. Krankenhausmarkt im Umbruch. Schattauer, Stuttgart. 106. Klee E (2001): Deutsche Medizin im Dritten Reich. Karrieren vor und nach 1945. Fischer, Frankfurt a.M. 107. Klemperer D, Rosenwirth (2005): Chartbook Shared Decision Making: Konzept, Voraussetzungen und politische Implikationen. Bertelsmann, Gütersloh. 108. Klinikum Nürnberg (2007): Das Ethik-Projekt. Nürnberg. 109. Klinikum Nürnberg (2009): Klinikum Nürnberg Jahresbericht 2008. Nürnberg. 110. Klinikum Nürnberg (2010): Klinikum Nürnberg Qualitätsbericht 2010. Nürnberg. 111. Kobert K, Pfäfflin M, Reiter-Theil S (2008): Der klinische EthikBeratungsdienst im Evangelischen Krankenhaus Bielefeld. In: Ethik in der Medizin 20:122-133. 112. Köhle K, Joraschky P (1990): Die Institutionalisierung der Psychosomatischen Medizin im klinischen Bereich. In: Psychosomatische Medizin. Uexküll et al. (1990) S. 415-460. 113. Krause TL, Winslade WJ (1997): Fünfzig Jahre Nürnberger Kodex. In: Tröhler/Reiter-Theil (1997), S. 189-220. 114. Kolb S (Hrsg.) (1996): Fürsorge oder Vorsorge. Die Ethik medizinscher Forschung. Fischer, Frankfurt a.M. 115. Kolb S, Seithe H (Hrsg.) (1998): Medizin und Gewissen. 50 Jahre nach dem Nürnberger Ärzteprozess. Mabuse, Frankfurt a.M. 116. Kolb S, Härlein J, Klein K, Krása K, Melf K, Missbach C, Mittag C, Resch S, Seite H, Watermann U, Werthmann L, Wick S (Hrsg.) (2002): Medizin und Gewissen. Wenn Würde ein Wert wäre. Mabuse, Frankfurt a.M. 186 117. Kolb S, Missbach C (Hrsg.) (2006): Kein einziges Märchen. Leidfaden Gesundheitswesen. Mabuse, Frankfurt a.M. 118. Kuhn TS (1993): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Suhrkamp, Frankfurt a.M. 119. Kühn H (1996): Zur Moral einer ökonomisch rationalisierten Medizin. In: Kolb S (1996), S. 117-139. 120. Kütemeyer M (1973): Anthropologische Medizin oder die Entstehung einer neuen Wissenschaft. Zur Geschichte der Heidelberger Schule. Diss. Med. Heidelberg. 121. Langewitz W, Nubling M, Weber H (2006): Hospital patient´s preferences for involvement in decision-making. A questionnaire of 1040 patients from a Swiss university hospital. In: Swiss Medical Weekly 136:193-198. 122. La Puma J (1987): Consultations in clinical ethics: issues and questions in 27 cases. In: Western Journal of Medicine 146:633-637. 123. La Puma J, Stocking CB, Silverstein MD, DiMartini A, Siegler M (1988): An Ethics Consultation Service in a Teaching Hospital.Utilization and Evaluation. In: Journal of the American Medical Association 260:808-811. 124. La Puma J, Stocking CB, Darling CM, Siegler M (1992): Communitiy hospital ethics consultation: evaluation and comparison with a university hospital service. In: American Journal of Medicine 92:346-351. 125. Lecher S, Klapper B, Schaeffer D, Koch U (2002): Endbericht zum Modellprojekt „Interprofessionelle Kommunikation im Krankenhaus“ von April 1999 bis Mai 2002. 126. Leven KH (1997): Die Erfindung des Hippokrates. Eid. Roman und Corpus Hippocratikum. In: Tröhler/Reiter-Teil (1997), S. 19-40. 127. Levine C (1984): Questions and (some very tentative) answers about hospital ethics committees. In: Hastings Center Report 14,3:9-12. 128. Ley F (2005): Klinische Ethik. Entlastung durch ethische Kommunikation? In: Ethik in der Medizin 17:298-309. 129. Lifton RJ (1996): Ärzte im Dritten Reich. Zweite Auflage. Klett Cotta, Stuttgart. 130. Lo B (1987): Behind closed doors: Promises and Pitfalls of an Ethics Committee. In: New England Journal of Medicine 317 (1):46-49. 131. Loh A, Simon D, Kriston L, Härter M (2007): Patientenbeteiligung bei medizinischen Entscheidungen: Effekte der Partizipativen Entscheidungsfindung aus systematischen Reviews. In: Deutsches Ärzteblatt 104 (21):A1483-1488. 187 132. Maguire P (1999): Improving communication with cancer patients. In: European Journal of Cancer 35:2058-2065. 133. Maly U, Estelmann A (2007): Kommunal und erfolgreich. Das Klinikum Nürnberg im Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und öffentlicher Daseinsvorsorge. Mabuse, Frankfurt a.M. 134. May AT (2004): Ethische Entscheidungsfindung in der klinischen Praxis. Die Rolle des klinischen Ethikkomitees. In: Ethik in der Medizin 16:242-252. 135. McClung JA, Karner RS, DeLuca M, Barber HJ (1996): Evaluations of a Medical Ethics Consultation Service: Opinions of Patients and Health Care Providers. In: The American Journal of Medicine 100:456-460. 136. McGee J, Caplan AL, Spanogle JP, Asch DA (2001): A national study of ethics committes. In: American Journal of Bioethics 1(4):60-64 137. Meulenbergs T, Vermylen J, Schotsmans PT (2005): The current state of clinical ethics and health care ethics committees in Belgium. In: Journal of Medical Ethics 31:318-321. 138. Michel DM, Moss AH (2005): Communicating Prognosis in the Dialysis Consent Process. A Patient-Centered, Guideline-Supported Approach. In: Advances in Chronic Kidney Disease 12:196-201. 139. Mitscherlich A, Mielke F (1947): Das Diktat der Menschenverachtung. Eine Dokumentation. Heidelberg. 140. Mitscherlich A, Mielke F (1949): Wissenschaft ohne Menschlichkeit. Medizinische und eugenische Irrwege unter Diktatur, Bürokratie und Krieg, mit einem Vorwort der Arbeitsgemeinschaft der Westdeutschen Ärztekammern. Heidelberg. 141. Mitscherlich A, Mielke F (1960): Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses. Fischer, Frankfurt a.M. 142. Müller S (2010): Revival der Hirntod-Debatte. Funktionelle Bildgebung für die Hirntod-Diagnostik. In: Ethik in der Medizin 22:5-17. 143. Nagao N, Takimoto T, Akabayashi A (2005): A Survey on the current state of hospital ethics consultation in Japan. Journal of the Japanese Bioethics Association 15:101-106. 144. Neitzke G (2005): Interprofessioneller Ethikunterricht. In: Zeitschrift für Medizinische Ausbildung 22(2):1-6. 145. Neitzke G (2007): Confidentiality, secrecy and privacy in ethics consultation. In: HEC Forum 19 (4):293-302. 146. Neitzke G (2007): Ethische Konflikte im Klinikalltag. Ergebnisse einer empirischen Studie. In: Bochumer Medizinethische Materialien. Heft Nr. 177. 188 147. Neitzke G (2008): Aufgaben und Modelle von Klinischer Ethikberatung. In: Dörries et al. (2008), S. 58-75. 148. Nilson EG, Acres CA, Tamerin NG, Fins JJ (2008): Clinical Ethics and the Quality Initiative: A Pilote Study for the Emperical Evaluation of Ethics Case Consultation. In: American Journal of Medical Quality 23:356-364. 149. Opel DJ, Wilfond BS, Brownstein D, Diekema DS, Pearlman RA (2009): Characterisation of organisational issues in paediatric clinical ethics consultation. A qualitative study. In: Journal of Medical Ethics 35:477-482. 150. Orr RD, Moon E (1993): Effectiveness of an Ethics Consultation Service. In: The Journal of Familiy Practise 36:49-53. 151. Orr RD, Morton KR, deLeon DM, Fals JC (1996): Evaluation of an Ethics Consultation Service: Patient and Family Perspektive. In: American Journal of Medicine 101:135-141. 152. Orlowski JP (2006): Why doctors use or do not use ethics consultation. In: Journal of Medical Ethics 31:499-502. 153. Oswald C (2008): Die „Anordnung zum Verzicht auf Wiederbelebung“ im Krankenhaus. In: Ethik in der Medizin 20:110-121. 154. Oswald C (2009): Patientenverfügung, Pflege und ethische Entscheidung. Die pflegerische Perspektive im Behandlungsteam bei „Anordnung zum Verzicht auf Wiederbelebung“. In: Frewer et al. (2009), S. 167-182. 155. Pantilat SZ, Alpers A, Wachter RM (1999): A New Doctor in the House. Ethical Issues in Hospitalist Systems. In: Journal of the American Medical Association 282:171-174. 156. Pedersen R, Foerde R (2005): What are the clinical ethics committees doing? In: Tidsskrift for Den Norske Laegeforening 125 (22): 3127-3129. 157. Pedersen R, Akre V, Foerde R (2008): Barriers and Challenges in Clinical Ethics Consultations: The Experiences of nine Clinical Ethics Committees. In: Bioethics 23 (9):460-469. 158. Pellegrino ED (1988): Clinical Ethics: Biomedical Ethics at the Bedside. In: The Journal of the American Medical Association 260:837-839. 159. Perkins HA, Saathoff BS (1988): Impact of Medical Ethics Consultation on Physicians. An Exploratory Study. In: The American Journal of Medicine 85:761-765. 160. Peter J (1996): Die Reaktion Viktor von Weizsäckers auf den Nürnberger Ärzteprozess. Vortrag gehalten am 25.10.1996 auf dem IPPNW-Kongress Medizin und Gewissen in Nürnberg (unveröffentlicht). 161. Platen-Hallermund A (1948): Die Tötung Geisteskranker in Deutschland. Aus der Deutschen Ärztekommission beim Amerikanischen Militärgericht. In: 189 Frankfurter Hefte. Frankfurt a. M. (Neuauflagen: 1993 im Psychiatrie Verlag und 2005 im Mabuse Verlag). 162. Pontzen W (1990): Zehn Jahre psychosomatische Abteilung am Allgemeinkrankenhaus. Rückblick und Perspektiven. In: Psychotherapie. Psychosomatik. Medizinische Psychologie 40:346-350. 163. Razavi D, Merckaert I, Marchal S, Libert Y, Conradt S, Bonvier J, Etienne AM, Fontaine O, Janne A, Klastersky J, Reynaert C, Scalliet P, Slachmuylder JL, Delvaux N (2003): How to optimize physicians´s communications skills in cancer care: results of a randomized study assessing the usefulness of posttraining consolidation workshops. In: Journal of Clinical Oncology 21:3141-3149. 164. Reiter-Theil S (1999): Ethik in der Medizin.Theorie für die Praxis. Ziele, Aufgaben und Möglichkeiten des Ethik-Konsils. In: Ethik in der Medizin 11:222-232. 165. Reiter-Theil S (2000): Ethics consultation on demand. Concepts, practical experiences and a case study. In: Journal of Medical Ethics 3:198-203. 166. Reiter-Theil S (2001): Ethics consultation in Germany. The present situation. In: HEC Forum 13:265-280. 167. Reiter-Theil S (2003): Balancing the perspectives. The patient’s role in clinical ethics consultation. In: Medicine, Health Care and Philosophy 6:247254. 168. Reiter-Theil S (2005): Klinische Ethikkonsultationen. Eine methodische Orientierung zur ethischen Beratung am Krankenbett. In: Schweizerische Ärztezeitung 86:346-351. 169. Renal Physicians Association and American Society of Nephrology (2000): Shared decision making in the Appropriate Initiation of and withdrawl from dialysis. Rockville. 170. Renal Physicians Association and American Society of Nephrology (2010): Shared decision making in the Appropriate Initiation of and withdrawl from dialysis. Second Edition. Rockville. 171. Ricciardi von Platen A (1998) Geleitwort zum Kongress Medizin und Gewissen. In: Kolb/Seithe (1998), S. 13-14. 172. Richter H E (1998): Medizin und Gewissen. In: Kolb/Seithe (1998), S. 15-26. 173. Richter G (2001): Ethics Consultation and the University Medical Center Marburg. In: HEC Forum 13:294-351. 174. Richter G (2008): Ethik-Liaisondienst und Ethikvisiten als Modell der Klinischen Ethikberatung. In: Dörries et al. (2008), S. 75-86. 190 175. Rimpau W (1990): Viktor von Weizsäcker im Nationalsozialismus. In: Hohendorf/Magull-Seltenreich (1990), S. 113-130. 176. Rosenbrock R (2008): Worauf wir nicht verzichten sollten. Gesundheitssystem und Solidarität. In: Gerhardt/Kolb (2008), S. 149-173. 177. Roth KH (1986): Psychosomatische Medizin und „Euthanasie“: Der Fall Viktor von Weizsäcker. In: 1999. Zeitschrift des 20. Und 21. Jahrhunderts 1:65-99. 178. Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (2002): Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit. Bd. I-IV, Nomos Verlag, Baden-Baden. 179. Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (2003): Finanzierung, Nutzerorientierung und Qualität, Langfassung: http://dip.bundestag.de/btd/15/005/1500530.pdf. 180. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2005): Koordination und Qualität im Gesundheitswesen. Kohlhammer, Stuttgart. 181. Salfeld R, Hehner S, Wichels R (Hrsg.) (2009): Modernes Krankenhausmanagement. Konzepte und Lösungen. Springer, Heidelberg. 182. Salathe M, Leuthold M, Amstad M, Vallotton M (2003): Clinical Ethics Committees in Switzerland: The Current Situation. In: Bulletin of Swiss Physicians 84:2264-2267. 183. Sass HM, Viefhues H (1988): Bochumer Arbeitsbogen zur medizinethischen Praxis. In: Medizinethische Materialien Bochum, Heft 2, 2. erweiterte Auflage. 184. Sass HM (1989): Medizin und Ethik. Reclam, Stuttgart. 185. Schaefer K (2000): Erfahrungen mit der Einrichtung eines Ethikkomitees in einem konfessionellen Krankenhaus. In: Zeitschrift für Medizinische Ethik 46:299-303. 186. Scheibler F, Pfaff H (2003): Shared Decision-Making. Der Patient als Partner im medizinischen Entscheidungsprozess. Juventa, Weinheim. München. 187. Scheibler F (2004): Shared Decision-Making. Von der Compliance zur partnerschaftlichen Entscheidungsfindung. Hans Huber, Bern. 188. Schenkenberg T (1997): Salt Lake City VA Medical Center´s first 150 ethics committee case consultations: what we have learned (so far). In: HEC Forum 36:49-53. 189. Schildmann J (2010): Evaluation of clinical ethics consultation: A systematic review and ciritical appraisal of research methods and outcome criteria. In: Schildmann et al. (2010), S. 203-215 191 190. Schildmann J, Gordon JS, Vollmann J. (Eds.) (2010): Clinical Ethics Consultation. Theories and Methods, Implementation, Evaluation. Ashgate Publishers, Farnham. 191. Schmidt K, Frewer A (Eds.) (2008): Clinical Ethics and Confidentiality. The Role of the Family, Experts and Committees. HEC Forum 19, No.4. 192. Schmidt U, Frewer A (Eds.) (2008): History and Theory of Human Experimentation. The Declaration of Helsinki and Modern Medical Ethics. History and Philosophy of Medicine/Geschichte und Philosophie der Medizin. Steiner Verlag. Stuttgart. 193. Schneidermann LJ, Gilmer T, Teetzel HD, Dugan DO, Blustein J, Cranford R et al. (2003): Effect of Ethics Consultations on Nonbeneficial Life-Sustaining Treatments in the Intensive Care Setting. In: Journal of the American Medical Association 290:1166-1172. 194. Schneidermann LJ, Gilmer T, Teetzel HD, Dugan DO, Goodman-Crews P, Cohn F (2006): Dissatisfaction with Ethics Consultations: The Anna Karenina Principle. In: Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 15:101106. 195. Schöne-Seifert B (1996): Medizinethik. In: Nida-Rümelin (1996), S. 552648. 196. Seidler E (1998): Vom Nürnberger Ärzteprozess zur Bioethikkonvention. Geschichte der Ethik der Menschenversuche. In: Kolb/Seithe (1998), S. 307312. 197. Scofield GR (2008): Speaking of Ethical Expertise. In: Kennedy Institute of Ethics Journal 18 (4):369-384. 198. Simon A, May A, Neitzke N (2005): AEM-Curriculum „Ethikberatung im Krankenhaus“ Ethik in der Medizin 17:322-326. 199. Simon A, Neitzke N (2008): Medizinethische Aspekte der Klinischen Ethikberatung. In: Dörries et al. (2008), S. 24-39. 200. Simon A (2008): Qualitätssicherung und Evaluation von Ethikberatung. In: Dörries et al. (2008), S. 167-181. 201. Simon A, Gillen E (2001): Klinische Ethik-Komitees in Deutschlang. Feigenblatt oder praktische Hilfestellung in Konfliktsituationen? In: Engelhardt et al. (2001), S. 151-157 202. Slowther A, Bunch C, Woolnough B, Hope T (2001): Clinical ethics support in the UK: A review of the current position and likely development. London, Nuffield Trust. 203. Slowther A, Hope T, Ashcroft R (2001): Clinical ethics committees: A worldwide development. In: Journal of Medical Ethics 27, (Suppl.1). 192 204. Slowther A, Johnston C, Goodall J, Hope T (2004): Development of clinical ethic committees. In: British Medical Journal 328:950-952. 205. Söllner W, Gutberlet S, Wentzlaff E, Faulstich C, Stein B (2007): Förderung der kommunikativen Kompetenz. Trainingsseminare für Ärzte im Rahmen psychosomatischer Konsiliar-Liaison-Arbeit. In: Deter (2007), S. 145-158 206. Söllner W, Stein B (2011): Konsiliar- und Liaisondienste. In: Uexküll (2011), S. 543-552 207. Steinkamp N, Gordijn B (2000): Implementierung klinischer Ethik. Ein Zweistufenmodell zur Implementierung medizinischer Ethik. In: Krankenhausdienst 73:235-244. 208. Steinkamp N, Gordjin B (2005): Ethik in Klinik und Pflegeeinrichtung. Ein Arbeitsbuch. 2. überarbeitete Auflage. Luchterhand, Neuwied. 209. Strech D, Hurst S, Danis M (2010): The role of ethics committees and ethics consultation in allocation decisions: a 4-stage process. In: Medical Care 48 (9):821-826. 210. Swetz KM, Crowley ME (2007): Report of 255 Clinical ethics Consultations and Review of Literature. In: Mayo Clinic Proceedings 82 (6): 686-691. 211. Toellner R (1998): Der blinde Spiegel. Über das Verhältnis der deutschen Ärzteschaft zum Nürnberger Ärzteprozeß in seiner epochalen Bedeutung. In: Kolb/Seithe (1998), S. 288-304. 212. Tröhler U, Reiter-Theil S (Hrsg.) (1997) Ethik und Medizin 1947-1997. Was leistet die Kodifizierung von Ethik? Wallstein, Göttingen. 213. Tulsky JA, Fox E (1996): Evaluating ethics consultation: Framing the questions. In: Journal of Medical Ethics 7 (2):109-115. 214. Uexküll Tv, Adler R, Herrmann JM, Köhle K, Schonecke OW, Wesiack W (Hrsg.) (1990): Psychosomatische Medizin. 4. Auflage. Urban & Schwarzenberg, München. 215. Uexküll Tv, Adler R, Herzog W, Joraschky P, Köhle K, Langewitz W, Söllner W, Wesiack W (Hrsg.) (2011): Psychosomatische Medizin. 7. Auflage. Urban & Fischer, München. 216. Uexküll Tv, Wesiack W (1991): Theorie der Humanmedizin. Grundlagen ärztlichen Denkens und Handelns. Urban & Schwarzenberg, München. 217. Uexküll Tv, Wesiack W (2011): Integrierte Medizin als Gesamtmodell der Heilkunde. Ein bio-psycho-soziales Modell. In: Uexküll et al. (2011), S. 3-40 218. UK Clinical Ethics Network website: www.ethics-network.org.uk. 193 219. Vollmann J, Weidtmann A (2004): Das klinische Ethikkomitee des Erlanger Universitätsklinikums. Institutionalisierung, Arbeitsweise, Perspektiven. In: Ethik in der Medizin 15:229-238. 220. Vollmann J (2006): Ethik in der klinischen Medizin. Bestandsaufnahme und Ausblick. In: Ethik in der Medizin 18:348-352. 221. Vollmann J (2008): Ethische Falldiskussionen. In: Dörries et al. (2008), S. 87-101. 222. Vollmann J (2008): Prozess der Implementierung. In: Dörries et al. (2008), S. 116-128. 223. Vorstand der Akademie für Ethik in der Medizin e.V. (2010): Standards für Ethikberatung in Einrichtungen des Gesundheitswesens. In: Ethik in der Medizin 22:149-153. 224. Waisel DB, Vanscoy SE, Tice LH, Bulger KL, Schmelz JO, Perucca PJ (2000): Activities of an ethics consultation service in a tertiary military medical center. In: Military Medicine 165:528-532. 225. Weindling P (2006): Nazi medicine and the Nuremberg Trials. From medical war crimes to informed consent. Basingstoke, Hampshire. 226. Weizsäcker V v (1947) „Euthanasie“ und Menschenversuche. In: Psyche 1, S. 68-102. 227. Weizsäcker Vv (1986-2005) Gesammelte Schriften. BD 5. Suhrkamp, Frankfurt a.M., S. 134. 228. Weizsäcker Vv (1986-2005) Gesammelte Schriften. BD 9. Suhrkamp, Frankfurt a.M., S. 19. 229. Wernstedt T, Vollmann J (2005): Das Erlanger Ethikkomitee. Organisationsethik an einem deutschen Universitätsklinikum. In: Ethik in der Medizin 17:44-51. 230. Wehkamp K-H (1999): Ethik am Klinikum Untersuchungsbericht mit Empfehlungen, (unveröffentlicht). Nürnberg. Interner Hamburg/Bremen 231. Wehkamp K-H (2001): Die Bedeutung der Ethik für die Unternehmensentwicklung und -beratung. In: Wolf/Dörries (2001), S. 202214. 232. White JC, Dunn PM, Homer L (1997): A Practical Instrument To Evaluate Ethics Consultation. In: HEC Forum 9 (3):228-246. 233. Winau R (1998): Versuche mit Menschen. Ärztliche Praxis und rechtliche Regelungen vor 1933. In: Kolb/Seithe (1998), S. 29-38. 194 234. Windsheimer B (1997): 100 Jahre Klinikum Nürnberg. Die Geschichte des Nürnberger Gesundheitswesens im späten 19. und 20. Jahrhundert. Tümmels, Nürnberg. 235. Winkler EC (2009): Sollte es ein favorisiertes Modell klinischer Ethikberatung für Krankenhäuser geben? Erfahrungen aus den USA. In: Ethik in der Medizin 21:309-322. 236. Wray W (2000): Ethics committees in Italy. In: Bulletin of Medical Ethics 166:13-16. 237. Wulsin LR, Söllner W, Pincis HA (2006): Models of Integrated Care. In: The Medical Clinics of North America. 90:647-677. 238. Wunder M (2002): Der Nürnberger Kodex und seine Bedeutung für heute. In: Kolb et al (Hrsg.) (2002): Medizin und Gewissen. Wenn Würde ein Wert wäre. Mabuse, Frankfurt a.M., S.55-63. 239. Wuttke-Groneberg W (1980): Die Euthanasie im Dritten Reich. In: Baader/Schultz (1980), S. 120-131. 240. ZEKO/Zentrale Ethikkommission an der Bundesärztekammer (2006): Stellungnahme Ethikberatung in der klinischen Medizin. In: Deutsches Ärzteblatt 103:A 1703-1707. 195 9. Anhang 9.1. Allgemeine Dokumente 9.1.1. Hippokratischer Eid 259 Hippokratischer Eid Ich schwöre, bei Appollon dem Arzt und bei Asklepios und Hygieia und Panakeia sowie allen Göttern und Göttinnen, dass ich nach bestem Vermögen und Urteil diesen Eid und die Verpflichtung erfüllen werde: denjenigen, der mich diese Kunst lehrte, meinen Eltern gleich zu achten, mit ihm den Lebensunterhalt zu teilen und ihn, wenn er Not leidet, mit zu versorgen. Seine Nachkommen werde ich meinen Brüdern gleichstellen und, wenn sie es wünschen, sie die ärztliche Kunst lehren ohne Entgelt und Vertrag. Ratschlag und Vorlesung und alle übrigen Belehrungen werde ich meinen und meines Lehrers Söhnen mitteilen, wie auch den Schülern, die durch ärztlichen Brauch durch einen Vertrag gebunden und durch einen Eid verpflichtet sind, sonst aber niemanden. Meine Verordnungen werde ich treffen zu Nutz und Frommen der Kranken, nach bestem Vermögen und Urteil. Ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht. Ich werde niemand, auch nicht auf seine Bitte hin, ein tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu raten. Ich werde auch nie einer Frau ein abtreibendes Zäpfchen geben. Rein und heilig werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren. Ich werde nicht schneiden, nicht einmal den Blasenstein, sondern es denen überlassen, deren Gewerbe dies ist. In welche Häuser ich auch immer kommen werde, ich will zu Nutz und Frommen der Kranken eintreten, mich enthalten jedes willkürlichen Unrechtes und jeder Schädigung, auch aller Werke der Wollust an den Leibern von Frauen und Männern, Freien und Sklaven. Was ich bei der Behandlung sehe oder höre, oder auch außerhalb der Behandlung im Leben der Menschen, werde ich, soweit man es nicht weitersagen darf, verschweigen und als ein Geheimnis betrachten. Wenn ich nun diesen Eid erfülle und nicht verletze, möge mir im Leben und in der Kunst Erfolg zuteil werden und Ruhm bei allen Menschen bis in ewige Zeiten; wenn ich ihn übertrete und meineidig werde, das Gegenteil. 259 Frewer et al. (2009), S. 303. 196 9.1.2. Nürnberger Kodex (1947)260 Zulässige medizinische Versuche 1. Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Das heißt, daß die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muß, ihre Einwilligung zu geben; daß sie in der Lage sein muß, unbeeinflußt durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen; daß sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muß, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können. Diese letzte Bedingung macht es notwendig, daß der Versuchsperson vor der Einholung ihrer Zustimmung das Wesen, die Länge und der Zweck des Versuches klargemacht werden; sowie die Methode und die Mittel, welche angewendet werden sollen, alle Unannehmlichkeiten und Gefahren, welche mit Fug zu erwarten sind, und die Folgen für ihre Gesundheit oder ihre Person, welche sich aus der Teilnahme ergeben mögen. Die Pflicht und Verantwortlichkeit, den Wert der Zustimmung festzustellen, obliegt jedem, der den Versuch anordnet, leitet oder ihn durchführt. Dies ist eine persönliche Pflicht und Verantwortlichkeit, welche nicht straflos an andere weitergegeben werden kann. 2. Der Versuch muss so gestaltet sein, daß fruchtbare Ergebnisse für das Wohl der Gesellschaft zu erwarten sind, welche nicht durch andere Forschungsmittel oder Methoden zu erlangen sind. Er darf seiner Natur nach nicht willkürlich oder überflüssig sein. 3. Der Versuch ist so zu planen und auf Ergebnissen von Tierversuchen und naturkundlichem Wissen über die Krankheit oder das Forschungsproblem aufzubauen, daß die zu erwartenden Ergebnisse die Durchführung des Versuchs rechtfertigen werden. 4. Der Versuch ist so auszuführen, daß alles unnötige körperliche und seelische Leiden und Schädigungen vermieden werden. 5. Kein Versuch darf durchgeführt werden, wenn von vornherein mit Fug angenommen werden kann, daß es zum Tod oder einem dauernden Schaden führen wird, höchstens jene Versuche ausgenommen, bei welchen der Versuchsleiter gleichzeitig als Versuchsperson dient. 6. Die Gefährdung darf niemals über jene Grenzen hinausgehen, die durch die humanitäre Bedeutung des zu lösenden Problems vorgegeben sind. 7. Es ist für ausreichende Vorbereitung und geeignete Vorrichtungen Sorge zu tragen, um die Versuchsperson auch vor der geringsten Möglichkeit von Verletzung, bleibendem Schaden oder Tod zu schützen. 260 Mitscherlich/Mielke (1960), S.272-273. 197 8. Der Versuch darf nur von wissenschaftlich qualifizierten Personen durchgeführt werden. Größte Geschicklichkeit und Vorsicht sind auf allen Stufen des Versuchs von denjenigen zu verlangen, die den Versuch leiten oder durchführen. 9. Während des Versuches muss der Versuchsperson freigestellt bleiben, den Versuch zu beenden, wenn sie körperlich oder psychisch einen Punkt erreicht hat, an dem ihr seine Fortsetzung unmöglich erscheint. 10. Im Verlauf des Versuchs muß der Versuchsleiter jederzeit darauf vorbereitet sein, den Versuch abzubrechen, wenn er auf Grund des von ihm verlangten guten Glaubens, seiner besonderen Erfahrung und seines sorgfältigen Urteils vermuten muß, daß eine Fortsetzung des Versuches eine Verletzung, eine bleibende Schädigung oder den Tod der Versuchsperson zur Folge haben könnte. 198 9.1.3. Nürnberger Kodex 1997 261 Zum 50. Jahrestag der Verkündung des Urteils im Nürnberger Ärzteprozess und des Nürnberger Kodex Präambel Im Gedenken an die Opfer gewissenloser Menschenversuche, des Massenmordes an psychisch kranken und behinderten Menschen und anderer Verbrechen gegen die Menschlichkeit, deren sich deutsche Ärztinnen und Ärzte im Nationalsozialismus schuldig gemacht haben, im Bewußtsein der Verantwortung, welche der Nürnberger Kodex von 1947 und die „Richtlinien für neuartige Heilbehandlung und für die Vornahme wissenschaftlicher Versuche am Menschen“ von 1931 allen Forschenden auferlegen, eingedenk der Ambivalenz des medizinischen Fortschritts und seiner möglichen Gefahren für die Menschlichkeit und getragen von dem Wunsch, Kranke und Heilkundige vor der Bedrohung durch kommerzielle und andere fremdnützige Interessen zu schützen, bekennen sich Ärztinnen und Ärzte sowie alle anderen Menschen, die durch ihre berufliche Tätigkeit in Beziehung zu Patienten stehen, zu ihrer persönlichen Verantwortung für das gesundheitliche Wohl des Individuums und zur Verwirklichung einer menschlichen Medizin und erklären: 1. Voraussetzungen des Medizinversuches (Punkt 1 Nürnberger Kodex 1947) „Die freiwillige Einwilligung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Das heißt, daß der Betreffende die anerkannte Fähigkeit haben muß, seine Einwilligung zu geben. Er muß in der Lage sein, eine freie Entscheidung zu treffen, unbeeinflußt durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Beeinflussung oder des Zwangs. Er muß genügend Kenntnis von und Einsicht in die wesentlichen Fakten des betreffenden Versuchs haben, um eine verstehende und aufgeklärte Entscheidung treffen zu können. Diese letzte Bedingung macht es notwendig, daß der Versuchsperson vor der Annahme ihrer zustimmenden Entscheidung das Wesen, die Dauer, und der Zweck des Versuchs klargemacht werden; sowie die Methode und die Mittel, welche angewendet werden sollen, alle Unannehmlichkeiten und Gefahren, welche mit Fug zu erwarten sind, und die Folgen für ihre Gesundheit oder ihre Person, welche sich aus der Teilnahme ergeben mögen. Die Pflicht und die Verantwortlichkeit, den Wert der Zustimmung festzustellen, obliegt jedem, der den Versuch anordnet, leitet oder ihn durchführt. Dies sind persönliche Pflichten und persönliche Verantwortungen, welche nicht ungestraft auf andere übertragen werden können.“ 261 Kolb et al. (2002), S.460-466. 199 2. Der „informed consent“ als eine Grundlage des Gesundheitswesens Die freiwillige und informierte Einwilligung des Patienten nach bestmöglicher Aufklärung („informed consent“) ist eine prinzipielle Grundlage aller Behandlungen im Gesundheitswesen, aller Heilversuche und aller medizinischen Experimente am Menschen. Nur im Falle von Notfallbehandlungen kann diese Zustimmung nachträglich eingeholt werden. Alle medizinischen Versuche, die einen Nutzen für andere als die Versuchspersonen haben sollen, bedürfen der freiwilligen und informierten Einwilligung in besonderem Maße. Anerkannte Heilbehandlungen sowie Heilversuche, die einen Nutzen für die betreffende Person haben sollen, können bei nichteinwilligungsfähigen Menschen durchgeführt werden, wenn ersatzweise die informierte Einwilligung des gesetzmäßigen Vertreters nach dessen bestmöglicher Aufklärung vorliegt. Sie dürfen aber nicht durchgeführt werden, wenn der Betroffene sich in Ausübung seines natürlichen Willens widersetzt. An nicht-einwilligungsfähigen Menschen dürfen medizinische Versuche ohne Nutzen für die Betroffenen nicht durchgeführt werden. Sie sind an die persönliche, nicht ersetzbare Einwilligung gebunden. Einzige Ausnahme sind noch nicht-einwilligungsfähige Kinder, die Wesen und Bedeutung des Versuches noch nicht zu beurteilen vermögen. Für sie können die gesetzlichen Vertreter die Einwilligung zu einem Medizinversuch geben. Medizinversuche an Menschen in Gefängnissen oder psychiatrischen Einrichtungen sind unzulässig, auch wenn die Betroffenen einwilligungsfähig sind. 3. Art des Menschenversuches Die Achtung vor der Würde des Menschen ist oberstes Gebot jeder medizinischen Forschung; auch die Freiheit der Forschung findet hier ihre klaren Grenzen. Dies gilt sowohl für den Heilversuch als auch für das nichttherapeutische Experiment. Für den Schutz von Versuchsteilnehmern muß umso entschiedener gesorgt werden, je abhängiger die betroffenen Personen sind und je weniger sie in der Lage sind, ihre Rechte selbst zu verteidigen. Dazu bedarf es unter anderem eines beständigen offenen Dialogs zwischen Versuchsleiter und Versuchsperson. Die volle Verantwortung für den Versuch bleibt stets beim Versuchsleiter. Versuche am Menschen müssen stets so angelegt sein, daß sich von ihnen ein gesundheitlicher Gewinn für konkrete Personen oder Personengruppen erwarten läßt, der durch andere Methoden nicht erreichbar ist. Die Versuchsergebnisse sind wahrheitsgetreu und vollständig zu veröffentlichen. Menschenversuche müssen auf bekanntem Wissen aufbauen und dieses nutzen, um unnötige Versuche zu vermeiden. Unnötige körperliche Eingriffe und Belastungen müssen von den betroffenen Personen ferngehalten werden. Menschenversuche müssen so durchgeführt werden, daß die Versuchsteilnehmer jederzeit die Weiterführung des Versuchs verweigern können. Die Entwicklung von Forschungspräferenzen und die Durchführung von Forschungsprojekten bedürfen gesellschaftlicher Transparenz. Wissenschaftler müssen sich frühzeitig mit den ethischen und sozialen Folgen ihres Tuns auseinandersetzen. Die Finanzierung von Forschungsprojekten muß von der Realisierung eines solchen begleitenden Dialogs mit der Öffentlichkeit abhängig gemacht werden. Ethikkommissionen 200 müssen in einem demokratischen Verfahren eingesetzt und nach paritätischem Prinzip nicht nur mit Fachleuten, sondern auch mit sachkundigen Laien, Vertretern von Betroffenenverbänden oder Selbsthilfegruppen besetzt werden. Entscheidungen der Ethikkommissionen sind für die Antragssteller verbindlich. 4. Fortpflanzungsmedizin und Pränataldiagnostik Medizinische und biotechnische Entwicklungen ermöglichen in zunehmendem Maße, Elternschaft, Schwangerschaft und Geburt technisch zu kontrollieren und zu manipulieren. Dadurch werden die Eltern einer großen Belastung ausgesetzt und schwangere Frauen mit Entscheidungszwängen konfrontiert. Die gesellschaftliche Tendenz zu einer „Eugenik von unten“ und die Aussonderung von Menschen mit zu erwartenden Behinderungen werden verstärkt. Vorgeburtliche Untersuchungen, die gezielt nach Fehlbildungen oder genetischen Abweichungen beim Ungeborenen suchen, gehören nicht in die Routine der Schwangerenvorsorge. Vor Inanspruchnahme solcher Untersuchungen muß den Frauen eine von den Anbietern pränataler Diagnostik unabhängige Beratung zur Verfügung stehen, wobei die Konsequenzen der Untersuchung aufgedeckt werden. Werdenden Eltern muß das „Recht auf Nicht-Wissen“ erhalten bleiben, ohne daß sie soziale und finanzielle Konsequenzen befürchten müssen. Die Methoden der künstlichen Befruchtung dürfen nur angewandt werden, um langfristige und auf andere Weise nicht zu behandelnde Unfruchtbarkeit zu beheben. Nicht zulässig ist die Präimplantationsdiagnostik zur Selektion von Embryonen mit zu erwartenden Behinderungen. Ebenso sind die kommerzielle Beschaffung und Übertragung fremder Keimzellen und Embryonen sowie die Leihmutterschaft unzulässig. Abzulehnen ist auch die mißbräuchliche Verwendung menschlicher Embryonen zur verbrauchenden Forschung, zur Klonierung, zur Chimärenund Hybridbildung. 5. Gendiagnostik Genetische Tests können individuelle gesundheitliche Risiken aufzeigen, aber auch Merkmale identifizieren, die zwar ohne eindeutigen Krankheitswert sind, aber einen stigmatisierenden Effekt haben. Sie können das Leben der betroffenen Menschen und ihrer Familien durch Vorhersagen schwer belasten. Genetische Tests sind psychisch invasive Eingriffe und streng an die informierte Einwilligung zu binden. Sie sollen nur dann durchgeführt werden, wenn sie ärztlich angezeigt sind, und wenn die betroffenen Familienangehörigen ausführlich und sachkundig über die Konsequenzen eines belastenden Testergebnisses wie auch über Alternativen zur Testung beraten worden sind. Betroffene haben Anspruch auf soziale und psychologische Betreuung. Gentests stellen Wissen zur Verfügung, dessen Vertraulichkeit gesichert sein muß. 201 Ihr Gebrauch für kommerzielle oder bevölkerungspolitische Zwecke ist auszuschließen. So darf niemand genötigt werden, einen Gentest vornehmen zu lassen. Genetisches Wissen darf nicht in diskriminierender und rassistischer Absicht verwendet werden. 6. Gentherapie Der eingeengte Blick auf die Gene versperrt die Sicht auf die vielfältigen Facetten des Phänomens Krankheit, auf soziale und psychische Aspekte und krankmachende Konsum-, Arbeitsoder Umweltfaktoren. Die wissenschaftliche Erforschung des menschlichen Genoms kann dazu beitragen, Krankheiten ursächlich zu behandeln. Sie birgt aber auch die Gefahr der Menschenzüchtung sowie der Enteignung und kommerziellen Ausbeutung menschlicher Körpersubstanz in sich. Die jetzt noch experimentelle somatische Gentherapie darf nur bei schweren Krankheiten und sorgfältigster wissenschaftlicher Prüfung der damit verbundenen Risiken sowie nach Ausschöpfung aller alternativen Behandlungsverfahren angewandt werden. Genetische Eingriffe in die Keimbahn des Menschen – seien sie Behandlungsabsicht oder Nebenwirkung somatischer Gentherapie – haben schwerwiegende, nicht absehbare Konsequenzen für nachfolgende Generationen. Sie sind deshalb nicht zu rechtfertigen. Genetisches Wissen muß auch in Zukunft allen Menschen zur Verfügung stehen. Menschliche Gene werden entdeckt, nicht erfunden. Sie sind deshalb nicht patentierbar. 7. Transplantationsmedizin Die Transplantation von Organen und Geweben darf nur zur Lebensrettung oder zur Behebung schwerer Leidens- und Krankheitszustände angewandt werden. Transplantationen zu experimentellen Zwecken sind abzulehnen. Einen Anspruch auf fremde Organe oder fremdes Gewebe gibt es nicht. Jeder Mensch hat auch über den Tod hinaus ein Recht, über seinen Körper selbst zu bestimmen. Die Spende eines Organs oder von Gewebe darf nur aufgrund freier, informierter und persönlicher Einwilligung und aus dem Motiv der Hilfsbereitschaft erfolgen. Eine Ersatzeinwilligung von Vertrauenspersonen ist dann gerechtfertigt, wenn diese von den Betroffenen ausdrücklich dazu beauftragt wurden. Die Verpflanzung von Organen und Geweben von Menschen, die ihre persönliche Einwilligung nicht gegeben haben oder die aus wirtschaftlicher Not zur Spende gezwungen waren, ist unzulässig. Eine Nachweispflicht über die freiwillige und informierte Einwilligung zur Entnahme muß international eingeführt werden. Der Hirntod ist nicht mit dem vollendeten Tod des Menschen gleichzusetzen. Der Hirntod kann allenfalls als Entnahmekriterium für Organe auf der Basis der freiwilligen und informierten Einwilligung gelten. Die Organ- und Gewebsentnahme bei noch nicht einwilligungsfähigen Kindern ist an die freiwillige und informierte Einwilligung durch den gesetzlichen Vertreter gebunden. Menschen, die aufgrund ihres Alters selber einwilligen könnten, die aber einwilligungsunfähig sind wegen einer Erkrankung oder Behinderung, sind vor der Entnahme von 202 Organen und Geweben, auch vor der Entnahme regenerierbaren Gewebes oder eines paarigen Organs, geschützt. Eine Transplantation von Gehirngewebe ist nicht zu rechtfertigen, wenn sie die geringste Gefahr in sich birgt, Individualität und Persönlichkeit des Menschen in Frage zu stellen. Die Transplantation von Fötalgewebe ist abzulehnen, weil sie auf die Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch Einfluß nehmen kann und verhindert, daß die für den Fötus schmerzloseste und für die Schwangere schonendste Methode des Schwangerschaftsabbruchs gewählt wird. Der Handel mit Organen und Geweben ist durch internationale Übereinkommen zu unterbinden. 8. Sterbebegleitung und Sterbehilfe Sterben ist ein Teil des Lebens, in dem der Mensch, besonderer liebevollmitfühlender Begleitung und leidensmindernder medizinischer Hilfen bedarf. Voraussetzung hierfür ist die bestmögliche Kommunikation zwischen dem Sterbenden und den Begleitpersonen sowie aller Begleitpersonen untereinander. Eine humane Medizin und ein humanes Gesundheitswesen geben Hilfen beim Sterben, aber keine Hilfen zum Sterben. Ziel ist es, ein Sterben in Würde zu ermöglichen. Bei Menschen, bei denen der Tod in kurzer Zeit zu erwarten ist, können lebenserhaltende Maßnahmen abgebrochen oder unterlassen werden, wenn dies dem erklärten Willen, ersatzweise dem mutmaßlichen Willen des Betreffenden entspricht. Der mutmaßliche Wille kann nur aufgrund eines vorherigen ernsthaften Dialogs festgestellt werden. In Zweifelsfällen ist immer für den Lebenserhalt zu entscheiden. Ebenso sind bei Vorliegen des erklärten oder des mutmaßlichen Willens leidensmindernde Maßnahmen, insbesondere eine angemessene Schmerztherapie, zu ergreifen, auch wenn diese eine Lebensverkürzung bewirken könnten. Maßnahmen, deren Absetzung auch bei nicht Sterbenden zum Tode führen, wie Körperpflege, Freihalten der Atemwege, Flüssigkeitszufuhr und die jeweils notwendige Ernährung, sind in jedem Falle zu gewährleisten. Sie können nur durch den unmittelbar erklärten Willen des Betroffenen abgebrochen werden, nicht durch den mutmaßlichen Willen. Maßnahmen mit dem Ziel der vorzeitigen Lebensbeendigung und die Hilfe bei der Selbsttötung sind strikt abzulehnen, auch wenn diese vom Patienten erwünscht werden. Unheilbar kranke Menschen sowie Patienten im Wachkoma sind keine Sterbenden. Alle Behandelnden, die Umgang mit unheilbar Kranken und Sterbenden haben, sind verpflichtet, sich palliativmedizinisch fortzubilden. Dies schließt die Befähigung ein, mit den Betroffenen in einen ehrlichen und einfühlsamen Dialog über ihr Befinden und über ihre Behandlung zu kommen. 9. Medizin und Ökonomie Menschen, die krank sind oder anderweitig Hilfe benötigen, haben das uneinschränkbare Recht auf gute Behandlung und Versorgung. Kranke und speziell chronisch kranke Menschen werden im Rahmen von Sparpolitik und Kosten-Nutzen-Rechnungen unvertretbaren sozialen Risiken ausgesetzt. Die Solidariät mit den kranken und schwachen Menschen ist der Gradmesser für 203 die Menschlichkeit einer Gesellschaft. Das Leben von Menschen läßt sich nicht gegen andere Güter aufrechnen. Für eine angemessene Gesundheitsversorgung und für die Sicherung des Sozialsystems sind die notwendigen Mittel bereitzustellen. Die Solidargemeinschaft ist so zu gestalten, daß die Versorgung der sozial Benachteiligten gerade in Krisenzeiten sichergestellt ist. Die Wahrung des Rechts auf gute medizinische Behandlung und Pflege des einzelnen Patienten verbietet es, die solidarischen Beitragspflichten der Gesunden zu reduzieren oder aufzuheben. Die im Gesundheitswesen tätigen Menschen weisen offen und selbstkritisch auf Mängel und Fehlentwicklungen hin und informieren über die Qualität ihrer Arbeit und deren Nutzen für die Patienten und die Gesellschaft. Maßnahmen am Patienten, die nur kommerziellen Zwecken dienen, dürfen nicht durchgeführt werden. 10. Medizin in einer Welt Die im Gesundheitswesen tätigen Menschen tragen über nationale und ethnische Grenzen hinweg Verantwortung für alle Kranken und Hilfesuchenden. Für die Opfer von Armut, Kriegen, Vertreibung und Folter sind medizinische, psychische und soziale Hilfen national und international auszubauen. Die im Gesundheitswesen tätigen Menschen beteiligen sich nicht an Maßnahmen, die Folterungen unterstützen, oder an der Vollstreckung von Todesurteilen. Der Ausbeutung von Menschen im Namen der Medizin ist Einhalt zu gebieten. Die medizinische Versorgung der Mehrheit der Weltbevölkerung entspricht keineswegs dem erreichten Stand medizinischen Wissens. Der Fortschritt der Medizin muß sich auch an der Gerechtigkeit der Verteilung medizinischer Ressourcen messen lassen. Die Diskrepanz zwischen dem darniederliegenden Gesundheitswesen in zahlreichen armen Ländern und der teuren Hochleistungsmedizin in den reichen Staaten ist zum Wohle der armen Länder zu verringern, um für alle Menschen ein größtmögliches Maß an Gesundheit zu erreichen. Nürnberg, am 20. August 1997 204 9.2. Klinikum Nürnberg 9.2.1. Ethik-Code Klinikum Nürnberg 262 Entsprechend dem Nürnberger Ärztekodex von 1947 steht der Patient im Mittelpunkt aller Dienstleistungen. Die Beachtung ethischer Grundsätze soll sicherstellen, dass die Patienten/innen des Klinikums Nürnberg stets mit höchster Fachkompetenz behandelt und betreut werden. Die ethische Selbstverpflichtung und Reflexion soll verdeutlichen, dass jede Intervention am Patienten in einem Spannungsfeld von widerstreitenden ethischen Prinzipien (z. B. bei der Entscheidung über lebensverlängernde Maßnahmen) stehen kann. Auch zwischen medizinischen und ökonomischen Gesichtspunkten sind Spannungen unvermeidbar. Sie müssen in jedem Einzelfall individuell und kooperativ ausgetragen werden. Wirtschaftlichkeit und Ethik sind dabei kein Gegensatz. Vielmehr dient der möglichst effiziente und effektive Umgang mit Ressourcen auch der möglichst optimalen Patientenversorgung. Die unmittelbare Verantwortlichkeit von Ärzten und Pflegekräften gegenüber jedem einzelnen Patienten ist im Klinikum Nürnberg Grundlage aller Entscheidungs- und Handlungsprozesse. Die Achtung der Würde jedes einzelnen Patienten umfasst den Schutz sowie den Respekt vor dessen Autonomie. Dazu gehören immer bestmögliche Aufklärung, Information und Achtung der Patientenrechte. Entscheidungen in jedweden Krankheitsverläufen müssen transparent gemacht werden; das Wohl des Patienten steht immer im Vordergrund, auch wenn dies mit betrieblichen Zielen kollidiert. Diagnostische und therapeutische Entscheidungen sind leitliniengeprägt. Das Klinikum strebt evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen an, um die für den Patienten erforderliche diagnostische und therapeutische Entscheidung auf derzeitigem Wissensniveau zu erzielen. Ziel ist eine Medizin nach Maß, die dem Patienten nützt und seiner individuellen Krankheits- und Lebenssituation gerecht wird. Auch die Einführung neuer diagnostischer und therapeutischer Methoden wird sich an den Grundsätzen evidenzbasierter Medizin und Pflege orientieren. Im unmittelbaren Umgang mit Patienten, insbesondere mit leidenden oder sterbenden Menschen sind die Gebote der Achtsamkeit und Behutsamkeit vorrangig zu befolgen. Die Vermeidung von Schädigung mit Schmerzen, Unannehmlichkeiten, Peinlichkeiten, Beunruhigungen sind ein wichtiger Teil unserer Sorge für den Patienten. Grundsätze der Gleichbehandlung aller unserer Patienten bedeuten, dass in jedem Einzelfall für den betroffenen Patienten versucht wird, die bestmögliche Entscheidung zu treffen und dass jedwede Benachteiligungen wegen des Geschlechts, der Nationalität, Hautfarbe oder sozialen Herkunft eines Patienten unterbleiben. 262 Klinikum Nürnberg (2006), S. 33-34. 205 9.2.2. Mitglieder des Ethikforums (Stand: Oktober 2011) Dr. Dirk Debus, Oberarzt der Hautklinik Dr. Susanne Dietze, Anästhesistin der Klinik für Anästhesiologie Prof. Dr. Frank Erbguth, Leitender Arzt der Klinik für Neurologie, 1. Vorsitzender des Ethikforums Roland Fichtner, Leitung der Abteilung Personalmanagement Elke Härtel, Vorsitzende der Personalvertretung Christina Lehner, Vertrauensperson der Schwerbehinderten, Mitarbeiterin im Ethikcafé Norbert Kettlitz, Vorstandsmitglied AOK Mittelfranken, externes Mitglied Pfarrerin Ulrike Klein, ev. Seelsorge am Klinikum Nürnberg Nord, Mitarbeiterin in der ZME Stephan Kolb, Leitung des Bereichs Unternehmensentwicklung, Geschäftsführer Ethikforum Christof Oswald, Stationsleitung in der Klinik für Nephrologie, Mitarbeiter im Ethikkreis Med. 4 Martin Roettinger, Krankenpfleger Klinik für Psychiatrie, Mitarbeiter in ZME und Ethikcafé Pfarrer Richard Schuster, ev. Seelsorge Klinikum Nürnberg Süd, 2. Vorsitzender des Ethikforums Elisabeth Senft-Wenny, pensionierte Richterin, externes Mitglied Adriane Yiannouris, Pflegerische Stationsleitung, Klinik für Kardiologie, Koordinatorin der ZME 206 9.2.3. Empfehlungen zum Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden 207 208 209 210 9.2.4. VaW-Anordnung zum Verzicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen 211 212 9.3. Medizinische Klinik 4 9.3.1. Informationsschreiben zur Mitarbeiterbefragung 213 9.3.2. Fragebogen der Mitarbeiterbefragung 214 215 216 9.3.3. Auswertungsbogen zur Ethikbefragung 217 9.3.4. Beispielprotokolle der Ethikberatung 218 219 220 221 9.3.5. Informationstexte zum Ethikkreis für Mitarbeiter 222 223 224 9.3.6 Informationsblatt zum Ethikkreis für Patienten 225 226