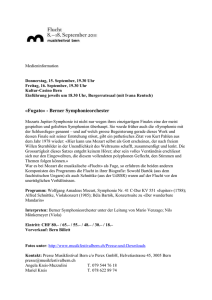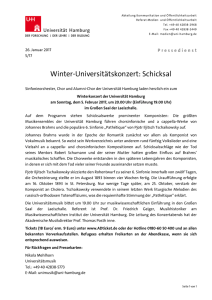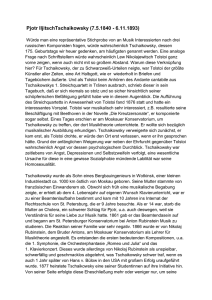SOUVENIRS - Oper Stuttgart
Werbung

3. K A M M E R KO N Z ERT IRS CHTIGE SOUVENN R A NDÄ ICHT NU EN, A NDENK 0 UHR 013, 19.3 A AL 9. JA N 2 OZ A RT S M , E L L A H LIEDER A BAIDULIN U G N A I O F E SO A K KO R D E F ÜR ) IN CR OC LO (19 7 9 LONCEL IO UND V UN TCH O: DORIS ING L L E C N V IOLO A HE NN EON: IN A K KO R D E CHNIT TK S D E R F AL (19 8 5) T RIO S T REICH R ATO 1. MODE IO G 2. A DA K NI S CHU L : JE W GE BY Y Z R P V IOL INE EL EINE D A OU TON M : G A V IOL F R A NCIS : O L L E V IOLONC – PAUSE – SK Y HAIKOWL C S T R E L PE T T T D -M O ) . 7 0 (18 9 2 SE X T E NCE« OP E R S T REICH O L F NIR DE »S O U V E SP IRITO R O CO N N MOTO 1. A L L EG A N TA BIL E E CO IO C O 2. A DAG ODER AT RE T TO M G E L L A 3. CE P OV R O V IVA GE N Y P O T 4 . A L L EG HUK , E V T E K IR S C T S O I L N R E A G H W C T UNI E , A J L : R Y PR Z Y B HE B A G V IOL INE C E A IN V , E L N E AD U TO V IOL A : M LO: F R A NCIS G O L E C N O L V IO 21 IRS SOUVGEIONMOR ABITO V O N S ER In den begleitenden Pizzicato-Figuren klingen von fern Gitarren an, eine Fülle ausgelassener Melodien signalisiert Lebensfreude: Tschaikowskys Streichsextett beschwört die Erinnerung an einen Aufenthalt in Florenz und durchsetzt sie mit Anklängen an die russische Heimat. Der in vielen Stilen gewandte Alfred Schnittke erinnert sich in seinem Streichtrio an seine eigenen Jahre in Wien. Tänzerisches, Melancholisches und Pathetisches durchweht die Musik, die auch mit stilistisch fremden Welten wie einem Tango oder einer frühbarocken Pavane überrascht. Solche Einstrahlungen sind Gubaidulina fremd. »Außen ist jetzt alles unsympathisch«, sagt sie und widmet sich in ihrem Duo für Cello und Akkordeon einer Meditation über die Figur des Kreuzes. 22 3. KAMMERKONZERT EN, ANDENK A NDÄCHTIGE NICH T N UR Ein Höhepunkt der aktuellen Stuttgarter Opernspielzeit ist die Neuinszenierung von Edison Denisovs Der Schaum der Tage – Anlass für das Staatsorchester, Denisov auch seinerseits in seinen Konzertreihen zu würdigen durch Aufführungen vokal-instrumentaler Kammermusik und des Saxophon-Konzertes. Das heutige Programm bietet nun Gelegenheit, die andern beiden Mitglieder der sogenannten »Moskauer Troika« kennenzulernen. Die Generationsgenossen Sofia Gubaidulina (* 1931) und Alfred Schnittke (* 1934) waren neben Denisov (* 1929) die Komponisten, die zur Zeit der im Zwangskorsett der Doktrin vom Sozialistischen Realismus eingeschnürten Künste gegen alle Widerstände den Aufbruch zu neuen Ufern wagten. Ihnen ist es wesentlich zu verdanken, dass die Stimme Russlands im Konzert der neuen Musik damals nicht verstummte. Für alle drei Komponisten spielen Auslands- und /oder Exil-Erfahrungen eine Rolle. Gubaidulina und Schnittke – wie viele Künstler und Intellektuelle zogen sie sich aus einem Land zurück, das die eigene Bevölkerung kolonisiert hatte, und emigrierten nach Deutschland. Schnittke starb 1998 in Hamburg, Gubaidulina lebt seit 1992 in der Nähe dieser Stadt. Und beide konvertierten: Gubaidulina empfing als Erwachsene die orthodoxe Taufe, Schnittke, Sohn eines areligiösen deutsch-jüdischen Vaters, trat zum Katholizismus über. Das Eingedenken ihres Schaffens betrifft so nicht zuletzt die von den Sowjets gewaltsam unterdrückten spirituellen Bindungen der russischen Kultur. So erinnert sich Sofia Gubaidulina an das Erschrecken ihrer Eltern über die erwachende Religiosität ihrer Tochter. Im heutigen Konzert nimmt der dem Trivialen in Hassliebe verhaftete Schnittke zudem so etwas wie eine vermittelnde Position ein zwischen der meditativen Versenkung Gubaidulinas und der diesseitigen Emotionalität Tschaikowskys (1840 – 1893). S OFI A G IN CR OC UBAIDU LINA E Das Werk ist wie viele Werke dieser Komponistin eine Darstellung der Wechselwirkung von Polaritäten, ihrer Durchdringung und Auflösung, Sinnbilder des menschlichen Daseins zwischen »Erdverbundenheit« und »himmlischem Streben«. Komponiert ist es ursprünglich für Cello und Orgel. Es entstand innerhalb von 26 Tagen für ein Konzert des Cellisten und Widmungsträgers Wladimir Toncha in Kasan. Im Konzertsaal des dortigen Konservatoriums, dessen Studentin die Komponistin von 1949 bis 1954 gewesen war, wurde es am 27. März 1979 uraufgeführt, den Orgelpart gestaltete Rubin Abdullin. Dieser erinnert sich: »Mit zwei Worten hatte Sofia uns das Werk erklärt: In croce [ital. am Kreuz]!« SOUVERNIRS 23 Dieser Titel bezieht sich nicht nur auf den Wesensgehalt, sondern bestimmt auch die Satzstruktur des Werkes, wie Viktor Suslin erläutert. Während die Orgel zu Beginn in hoher Lage und das Cello äußerst tief zu spielen hat, kommen sie im Verlauf immer mehr aufeinander zu und »kreuzen« sich: »Wann immer beide Linien sich kreuzen, kommt es zu einem Höhepunkt – gleich einer elektrischen Entladung.« Suslin macht darauf aufmerksam, dass beide Instrumente den Orgelpunkt E zum gemeinsamen Ausgangspunkt haben; man vergleiche aber »die quälenden, durch grelle Akzente, Chromatismen und Mikrointervalle gekennzeichneten Versuche des Cellos, sich von diesem zu lösen, mit den fröhlich-flimmernden Figurationen des Orgelpunktes in der Orgel. … Es ist von tiefer Symbolik, wenn in der Coda das Cello sein qualvolles, einer menschlichen Stimme ähnliches Spiel aufgibt und sich die ätherisch-verklärten Figurationen über dem Orgelpunkt E zu eigen macht, die zu Beginn von der Orgel zu hören waren. Diese lösen sich schließlich in den irisierenden Klängen der Obertonreihe der A-Seite auf.« Auch die symbolische Verwendung des Cello-Stegs als Grenze zwischen Diesseits und Jenseits und seine »Überkreuzung« wird zur Metapher für den außermusikalischen Gehalt dieser Meditation. Der Orgelpart von In croce wurde von der Bajan-Virtuosin und »von mir [Gubaidulina] hochgeschätzten großen Künstlerin« Elsbeth Moser für ihr Instrument transkribiert. Das Bajan ist ein Proletarierinstrument von eher zweifelhaftem Ruf. Es handelt sich um das – nach einem altrussischen Märchen benannte – osteuropäische Knopfgriffakkordeon. Es soll von Weißrussland bis nach Sibirien auf keiner Hochzeit, keinem Dorffest fehlen. Gubaidulina hat es in mittlerweile zahlreichen Originalkompositionen für sich entdeckt. Auf die Frage »Wissen Sie warum ich dieses Instrument so liebe?« bekannte sie: »Weil es atmet …« Gubaidulinas In croce-Konzept erfährt so eine weitere Verkehrung oder auch … Kreuzung. Die Orgel hatte sich Rubin Abdullin »in der gegebenen Kombination als mächtigen Geist« vorgestellt, »der manchmal auf die Erde hinabsteigt, um seinen Zorn auszubreiten.« Anders als der Luftstrom der Orgel ist der Atem des Bajan an die Physis des Menschen gebunden, und verbindet so wie der Wind Himmel und Erde. Gubaidulinas Biograph Michael Kurtz hat geschildert, wie es das talentierte und schwungvolle Spiel Schurka-Duraks (Schurka des Dummkopfs), eines geistig Zurückgebliebenen, auf diesem Instrument war, das zur Entdeckung des musikalischen Talents der knapp fünfjährigen, damals Sonetchka gerufenen Sofia führte, die den Klängen zunächst verzaubert gelauscht und dann zu tanzen begonnen hatte. 24 3. K AMMERKONZERT SC A L F R ED S T REICH HNIT TKE T RIO Auf die Frage, ob er mit dem Klangmaterial als solchem arbeite, antwortete Schnittke 1982: »Nein, nein. Mit der Form und besonders mit vieldimensionalen Beziehungen. Um die Vieldeutigkeit der Beziehungen handelt es sich – also nicht um die Neuartigkeit des Moments. Das gesamte Netz der Beziehungen, das ist für mich das wichtigste.« Und immer wieder hat Schnittke betont, erst mit seiner Befreiung vom abstrakten Materialdenken des Serialismus und durch seine Öffnung für die Vielfalt musikalischer Sprachen habe er zu seiner eigenen Sprache gefunden. Ein nur scheinbares Paradox, denn für Schnittke strukturieren sich die uns chaotisch umgebenden Stile und Genres als Momente intimer existentieller Erfahrung. So hat er auch die poly-stilistische Ausrichtung seines Schaffens stets in den Zusammenhang seiner ›Poly-Identität‹ als deutsch-jüdischer, 1990 emigrierter Russe gestellt. Das 1985 entstandene Streichtrio ist ein beeindruckender Beleg für die vielfältigen kaleidoskopartig-gebrochenen Spiegelungen, in denen Schnittke sein Material reflektiert. Schnittke schrieb das Werk im Auftrag der Alban Berg Stiftung anlässlich des 100. Geburtstags des Komponisten. Und es ist gleichsam imprägniert von dem musikalischen Gedächtnis dieser Stadt und an diese Stadt, in der der zwölfjährige Schnittke seinen ersten Klavierunterricht erhielt. Wir werden Zeugen einer Meditation über Klangspuren Schuberts, Mahlers und Bergs. Es ist ein Thema, nein, nicht einmal ein Themenkopf, nur ein kleines Motiv, das in dem zweisätzigen Werk die wunderlichsten Metamorphosen erfährt. Es ist schwer zu bestimmen, ob es eher einem Ländler oder einem Trauermarsch entstammt. Zusammen mit einer begrenzten Zahl thematischer Bausteine wird es zum Objekt wechselnder resignativer, schwelgerischer oder aggressiver Affekte. In immer neuen Ansätzen wird es beleuchtet, variiert, montiert, collagiert, forciert und demoliert. Beide Sätze – das zerrissene Moderato und das abgekämpft-abgeklärte Adagio – bearbeiten den selben motivischen Kernbestand. Auch eine an die Minimalmusic erinnernde ›mahlende‹ Dreiklangspassage begegnet in beiden Sätzen. Allerdings treten aus der Erschöpfung des zweiten Satzes zwei neue Gestalten hervor: zunächst ein ›non vibrato‹ zu spielender Marsch aus über leeren Quinten sequenzierten Dreiklangs- und Tonleiterfragmenten. Dann lässt das Cello im Flageolett das ferne Echo einer Fanfare erklingen. Ein Gruß von »wo die schönen Trompeten blasen«? Mit diesem Werk tritt ein bohrender Ernst und Einsamkeitsgestus aus dem Hintergrund der augenzwinkernden Heiterkeit, mit der Schnittke mitunter mit den unterschiedlichsten Stilzitaten zu jonglieren wusste. Entstanden ist es kurz vor der Zäsur seines ersten schweren Schlaganfalls. Der befreundete Geigenvirtuose Gidon Kremer meint, im Trio sei die Krankheit bereits zu spüren ehe sie ausbrach, denn ihm sei die »Läuterung eigen, die manchmal nach überstandener Krankheit eintritt.« Dieses Trio bleibe für ihn »die Quintessenz seiner [Schnittkes] ganzen qualvollen Suche nach jener überirdischen Kraft, die die irdische Schwerkraft hätte überwinden können.« SOUVERNIRS 25 SK Y HAIKOWENIR DE FLORENCE« C S T R E PE T T »S O U V S T REICH SE X T E T »Was für eine herrliche Formation ist doch ein Streichsextett«, begeisterte sich Tschaikowsky in einem Brief an den Geiger Konstantin Albrecht, dem Präsidenten der St. Petersburger Kammermusikgesellschaft, der er sein Werk gewidmet hatte. Und dem Bruder Modest gegenüber bekannte er: »Ganz schrecklich, wie zufrieden ich mit mir bin … ich bin immer mehr davon gefangen.« Diese Euphorie entlohnte den Komponisten erst am Ende eines langen und krisenreichen Entstehungsprozesses. Während der Arbeit schrieb er dem Bruder: »Ich komponiere mit unglaublichen Schwierigkeiten. Mich blockiert nicht das Fehlen von Ideen sondern die Neuheit der Form. Es müssen sechs voneinander unabhängige und doch homogene Stimmen sein.« Bei der Uraufführung am 7. und einer Wiederholung am 10. Dezember 1890 befriedigten den Komponisten nur die ersten beiden Sätze. Die definitive Werkgestalt ist Resultat einer weiteren Überarbeitung, die zwei Jahre später, ebenfalls in Petersburg, präsentiert wurde. Worauf bezieht sich der Titel des Werkes? Tschaikowsky hatte nach der erfolgreichen Premiere seines Dornröschen-Balletts zu Beginn des Jahres 1890 Russland verlassen und war ohne ein bestimmtes Ziel nach Westeuropa gereist. In Berlin entschied er, nach Florenz zu gehen, wo er am 30. Januar eintraf. Wie immer nutze Tschaikowsky seinen Erholungsaufenthalt zur Arbeit an seiner nächsten Oper. Als er die Stadt am 7. April wieder verließ, hatte er die Pique Dame als fertigen Klavierauszug im Gepäck. Das Sextett entstand dann im Sommer des Jahres in seinem ländlichen Anwesen Frolowskoe in der Moskauer Provinz. In Florenz hatte Tschaikowsky keine unbeschwerte Zeit durchlebt. Er litt unter Depressionen und selbst der euphorische Rauschzustand, in den ihn die Arbeit an der Oper versetzt hatte, war nicht frei von selbstquälerischen Zügen. Das schlechte Wetter setzte ihm zu, es regnete unaufhörlich, und der Arno, der vor den Fenstern seines Quartiers vorbei floss, war gefährlich angeschwollen. Ob diese Erinnerung den stürmischen ersten Satz seines Sextetts mit gestaltet hat? Ohne Präliminarien setzt er ein mit einem dissonanten NonenAkkord auf der Dominante, und diese harmonische Spannung verleiht seinem ersten Thema ein entfesseltes, mitreißendes Momentum. Auch das zweite, lyrische Thema in chromatisiertem A-Dur, das die 1. Geige ans 1. Cello weiterreicht, bleibt von einem nervösen, rhythmisch bewegten Untergrund durchpulst. Beide Tendenzen – die Rhythmik des ersten und die Kantabilität des zweiten Themas – tragen eine modulationsreiche Durchführung aus. Die Reprise gipfelt in einem grandiosen Accelerando, das alle thematischen Bildungen fortzuspülen scheint. Der ganze Satz ist, so Tschaikowsky, »mit einem hohen Maß an Leidenschaft und Schwung zu spielen.« Der zweite Satz ist ein Adagio. Seine Kantabilität ist immer schon als Hommage an das Land des Belcanto verstanden worden. Zu Beginn sowie als Klimax der zweimaligen Entfaltung der Melodie setzt Tschaikowsky eine Sequenz choralartig harmonisierter Akkorde. Ein rätselhaft-huschender Zwischensatz steht in 26 3. K AMMERKONZERT stärkstem koloristischem Kontrast. Die Geige exponiert ihre schwelgerisch»trällernde« Linie (Tschaikowsky) über gezupften Triolen der 2. Geige und der beiden Bratschen, ein charakteristisches Satzmuster der italienischen Gesangsoper. Und weniger die Melodie selbst, die unverwechselbar Tschaikowsky angehört, als die Art, wie diese Melodie vom Cello zunächst beantwortet und dann aufgegriffen wird und wie sie vor allem dann von den Duettpartnern gleichsam mit Koloraturen ausgeziert wird, gemahnt an den Stil der Belcantisten – vielleicht als Reminiszenz an eine Aufführung von Bellinis I Puritani in der florentiner Oper, deren Besuch durch Tschaikowsky bezeugt ist? Oder sublimiert Tschaikowsky hier die Faszination zweier jugendlicher Straßensänger, die ihren Gesang, der ihm »in die tiefste Herzenstiefe eingedrungen« war, auf Gitarre oder Mandoline selbst begleiteten? Der 1. Bratsche, der die Melodie des zweiten Satzes als letzte zugespielt worden war, gehört zunächst auch das Thema des dritten, eines Allegrettos. In Duktus, Harmonisierung und nicht zuletzt auch in seiner Melancholie mutet es durchaus slawisch an. Auch hier ein kontrastierender Zwischensatz, der als burleskes Stretta-Thema einer Rossini-Oper figurieren könnte. Der letzte Satz ist nicht nur durch sein rhythmisches Feuer bemerkenswert. Seine außerordentliche Energie verdankt sich nicht zuletzt auch dem durchmessenen harmonischen Parcours: Der Satz und mit ihm die gesamte Komposition endet in jubelndem D-Dur. Dennoch: Auch dieses Finale kann jene »innere Heimatlosigkeit« Tschaikowskys, von der der große Musikkritiker Alexander Berrsche einmal sprach, und die auch dieses Werk durchweht hat, kaum ganz vergessen machen. SOUVERNIRS 27