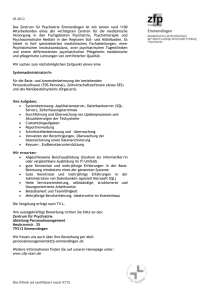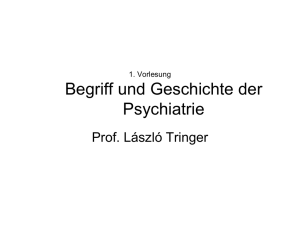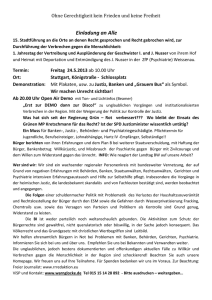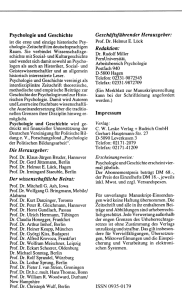2011_Heft_25_1
Werbung

Titelmotiv_Heft 25_1.qxd:Umschlag_1-2007_5.0.qxd 29.03.2011 9:22 Uhr Seite 1 Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt – B 20695 F – Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle – Bajuwarenring 4 – D-82041 Deisenhofen – Oberhaching Wissenschaftliches Organ der pro mente austria, ÖAG, ÖGKJP, ÖSG This journal is indexed in Current Contents / Science Citation Index / MEDLINE / Clinical Practice and EMBASE/Excerpta Medical Abstract Journals and PSYNDEX Tiefe Hirnstimulation Gedächtnisambulanzen Young Mania Rating Scale Straffällige Jugendliche & Psychopathologie Ältere Arbeitslose & psychische Störungen Zwangsmaßnahmen Medizinische Psychologie in Österreich VERSENDET DURCH ISSN 0948-6259 25/1 Band 25 Nummer 1 – 2011 Übersicht Die tiefe Hirnstimulation: Zum Stand der aktuellen Forschung – eine Übersicht A. Conca, J. Di Pauli, H. Hinterhuber, H.-P. Kapfhammer Volume 25 Number 1 – 2011 1 Gedächtnisambulanzen in Österreich – Charakteristika und diagnostisch-therapeutsiche Praxis M. Rainer, Ch. Krüger-Rainer, F. Eidler, P. Fischer, J. Marksteiner 9 Reliabilität und Übereinstimmungsvalidität der deutschen Version der Young Mania Rating Scale (YMRS-D) M. Mühlbacher, Ch. Egger, P. Kaplan, Ch. Simhandl, H. Grunze, Ch. Geretsegger, A. Whitworth, Ch. Stuppäck 16 Erfassung von Psychopathologien bei straffälligen Jugendlichen D. Gutschner, S. Völkl-Kernstock, A. Perret, Th. Doreleijers, R. Vermeiren, J. M. Fegert, K. Schmeck 26 Prävalenz psychischer Störungen bei älteren Langzeitarbeitslosen. Ein Vergleich von Ergebnissen aus dem Projekt KompAQT mit Daten aus dem Bundesgesundheitssurvey I. Liwowsky, R. Mergl, A.-K. Allgaier, U. Hegerl 36 Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie – ein Tabu? U. Meise, B. Frajo-Apor, M. Stippler, J. Wancata Geschichte Deep Brain Stimulation: a review on current research A. Conca, J. Di Pauli, H. Hinterhuber, H.-P. Kapfhammer Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Original Originalarbeit Kritisches Essay Review Memory clinics in Austria – characteristics and patterns of prac­ tice M. Rainer, Ch. Krüger-Rainer, F. Eidler, P. Fischer, J. Marksteiner Reliability and concordance validity of a german version of the Young Mania Rating Scale (YMRS-D) Th. M. Mühlbacher, Ch. Egger, P. Kaplan, Ch. Simhandl, H. Grunze, Ch. Geretsegger, A. Whitworth, Ch. Stuppäck Zeitungsgründer 1 11 Franz Gestenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Redaktion 44 Screening of psychopathology with juvenile deviants D. Gutschner, S. Völkl-Kernstock, A. Perret, Th. Doreleijers, R. Vermeiren, J. M. Fegert, K. Schmeck Prevalence of mental disorders in the elderly long-term unemployed. Comparison of results of the project KompAQT and the German National Health Interview and Examination Survey I. Liwowsky, R. Mergl, A.-K. Allgaier, U. Hegerl Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck Johannes Wancata, Wien Wissenschaftliches Organ • pro mente austria Dachverband der Sozialpsy chiatrischen Gesellschaften • Österreichische Alzheimer Gesellschaft • Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend psychiatrie • Österreichische Schizophrenie­gesellschaft Critical Essay Coercion in Psychiatry – a taboo? U. Meise, B. Frajo-Apor, M. Stippler, J. Wancata History Zur Geschichte der Institutionalisierung der Medizinischen Psychologie in Österreich H. Hirnsperger, R. Mundschütz, G. Sonneck 51 Wilhelm-Exner Preis für Psychologie 2011 43 The history of the institutionalization of medical psychology in Austria H. Hirnsperger, R. Mundschütz, G. Sonneck Dustri-Verlag Dr. Dustri-Verlag Dr. Karl Karl Feistle Feistle http://www.durstri.de http//:www.dustri.de ISSN 0948-6259 0948-6259 ISSN I Zeitungsgründer Franz Gerstenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Herausgeber Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck (geschäftsführend) Johannes Wancata, Wien Wissenschaftlicher Beirat Hans Förstl, München Andreas Heinz, Berlin Wulf Rössler, Zürich Günter Klug, Graz Katharina Purtscher, Graz Reinhold Schmidt, Graz Werner Schöny, Linz Erweiterter wissenschaftlicher Beirat Josef Aldenhoff, Kiel Michaela Amering, Wien Jules Angst, Zürich Christian Bancher, Horn Ernst Berger, Wien Karl Dantendorfer, Wien Peter Falkai, Göttingen Max Friedrich, Wien Christian Haring, Hall i. T. Armand Hausmann, Innsbruck Wolfgang Gaebel, Düsseldorf Verena Günther, Innsbruck Reinhard Haller, Frastanz Ulrich Hegerl, Leipzig Isabella Heuser, Berlin Florian Holsboer, München Christian Humpel, Innsbruck Kurt Jellinger, Wien Hans Peter Kapfhammer, Graz Siegfried Kasper, Wien Heinz Katschnig, Wien Ilse Kryspin-Exner, Wien Wolfgang Maier, Bonn Karl Mann, Mannheim Josef Marksteiner, Rankweil Hans-Jürgen Möller, München Heidi Möller, Kassel Walter Pieringer, Graz Roger Psycha, Bruneck Anita Riecher-Rössler, Basel Peter Riederer, Würzburg Hans Rittmannsberger, Linz Wolfgang Rutz, Uppsala Hans-Joachim Salize, Mannheim Alois Saria, Innsbruck Norman Sartorius, Genf Heinrich Sauer, Jena Gerhard Schüssler, Innsbruck Josef Schwitzer, Brixen Ingrid Sibitz, Wien Christian Simhandl, Wien Gernot Sonneck, Wien Marianne Springer-Kremser, Wien Thomas Stompe, Wien Gabriela Stoppe, Basel Elisabeth M. Weiss, Graz Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Zeitungsgründer Franz Gestenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Redaktion Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck Johannes Wancata, Wien Wissenschaftliches Organ Redaktionsadresse Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise, Universitätsklinik für Psychiatrie Innsbruck, Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck, Telefon: +43-512-504-24284, Fax: +43-512-504-23628, Email: [email protected] Lizenz für die österreichische Ausgabe VIP-Verlag Integrative Psychiatrie Innsbruck Anton-Rauch-Straße 8 c, A-6020 Innsbruck, Email: [email protected] www.vip-verlag.com – Tel. +43 (0) 664 / 38 19 488 • pro mente austria Dachverband der Sozialpsy chiatrischen Gesellschaften • Österreichische Alzheimer Gesellschaft • Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend psychiatrie • Österreichische Schizophrenie­gesellschaft Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle, Postfach 1351, © 2011 Jörg Feistle. D-82032 München-Deisenhofen, Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle. Tel. +49 (0) 89 61 38 61-0, Telefax +49 (0) 89 6 13 54 12 ISSN 0948-6259 Email: [email protected] Regulary indexed in Current Contents/Science Citation Index/MEDLINE/Clinical Practice and EMBASE/Excerpta Medical Abstract Journals and PSYNDEX Mit der Annahme des Manuskriptes und seiner Veröffentlichung durch den Verlag geht das Ver­lagsrecht für alle Sprachen und Länder einschließlich des Rechts der photomechanischen Wiedergabe oder einer sonstigen Vervielfäl­ tigung an den Verlag über. benutzt werden dürften. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen wird vom Verlag keine Gewähr übernommen. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Die Neuro­ psychiatrie erscheint vierteljährlich. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß sol­che Namen im Sinne der Warenzeichenund Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu be­trachten wären und daher von jedermann Bezugspreis jährlich € 84,–. Preis des Einzelheftes € 23,– zusätzlich € 6,– Versandgebühr, inkl. Mehrwertsteuer. Einbanddecken sind lieferbar. Bezug durch jede Buchhandlung oder direkt beim Verlag. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um 1 Jahr, wenn nicht eine Abbestellung bis 4 Wochen vor Jahresende erfolgt. Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle http//:www.dustri.de ISSN 0948-6259 II Hinweise für AutorInnen: Sämtliche Manuskripte unterliegen der wissenschaftlichen und redaktionellen Begutachtung durch Schriftleitung und Reviewer. Allgemeines: Bitte die Texte unformatiert im Flattersatz (Ausnahme: Überschrift und Zwischenüberschriften, Hervorhebungen) und keine Trennungen verwenden! Manuskripte – verfasst im Word – sind am besten per Email an die Redaktion (Adresse ­siehe ­unten) zu übermitteln. Sie können auch elektronisch auf CD oder Diskette an die Redaktions­adresse ­gesandt werden. Die Zahl der Abbildungen und Tabellen sollte sich auf maximal 5 beschränken. Manuskriptgestaltung: • Länge der Arbeiten (bitte beachten): - Übersichtsarbeiten: bis ca. 50.000 Zeichen inkl. Leerzeichen - Originalarbeiten: bis ca. 35.000 Zeichen inkl. Leerzeichen - Kasuistiken, Berichte, Editorials: bis ca. 12.000 Zeichen inkl. Leerzeichen • Titelseite: (erste Manuskriptseite) - Titel der Arbeit: - Namen der Autoren (vollständiger Vorname vorangestellt) - Klinik(en) oder Institution(en), an denen die Autoren tätig sind - Anschrift des federführenden Autors (inkl. Email-Adresse) • Zusammenfassung: (zweite Manuskriptseite) - Sollte 15 Schreibmaschinenzeilen nicht übersteigen - Gliederung nach: Anliegen; Methode; Ergebnisse; Schlussfolgerungen; - Schlüsselwörter (mindestens 3) gesondert angeben • Titel und Abstract in englischer Sprache (3. Manuskriptseite) - Kann ausführlicher als die deutsche Zusammenfassung sein - Gliederung nach: Objective; Methods; Results; Conclusions - Keywords: (mindestens 3) gesondert angeben • Text: (ab 4. Manuskriptseite) Für wissenschaftliche Texte Gliederung wenn möglich in Einleitung, Material und Methode, Ergebnisse, Diskussion, evtl. Schlussfolgerungen, evtl. Danksagung, evtl. Interessenskonflikt • Literaturverzeichnis: (mit eigener Manuskriptseite beginnen) - Literaturangaben sollen auf etwas 20 grundlegende Werke und Übersichtsarbeiten beschränkt werden. Das Literaturverzeichnis soll nach Autoren alphabetisch geordnet werden und fortlaufend mit arabischen Zahlen, die in [eckige Klammern] gestellt sind, nummeriert sein. - Im Text die Verweiszahlen in [eckiger Klammer] an der entsprechenden Stelle einfügen. Beispiele: Arbeiten, die in Zeitschriften erschienen sind: [1] Rittmannsberger H., Sonnleitner W., Kölbl J., Schöny W.: Plan und Wirklichkeit in der ­psychiatrischen Versorgung. Ergebnisse der Linzer Wohnplatzerhebung. Neuropsychiatr 15, 5-9 (2001). (Abkürzung Neuropsychiatr) Bücher: [2] Hinterhuber H., Fleischhacker W.: Lehrbuch der Psychiatrie. Thieme, Stuttgart 1997. Beiträge in Büchern: [3] Albers M.: Kosten und Nutzen der tagesklinischen Behandlung. In: Eikelmann B., Reker T., Albers M.: Die psychiatrische Tagesklinik. Thieme, Stuttgart 1999. • Abbildungen und Tabellen: (jeweils auf eigener Manuskriptseite - Jede Abbildung und jede Tabelle sollte mit einer kurzen Legende versehen sein. - Verwendete Abkürzungen und Zeichen sollten erklärt werden. - Die Platzierung von Abbildungen und Tabellen sollte im Text durch eine Anmerkung markiert werden („etwa hier Abbildung 1 einfügen“). - Abbildungen und Grafiken sollten als separate Dateien gespeichert werden und nicht in den Text eingebunden werden! - Folgende Dateiformate können verwendet werden: Für Farb-/Graustufenabbildungen: .tiff, .jpg, (Auflösung: 300 dpi); für Grafiken/Strichabbildungen (Auflösung: 800 dpi) Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Zeitungsgründer Franz Gestenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Redaktion Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck Johannes Wancata, Wien Wissenschaftliches Organ • pro mente austria Dachverband der Sozialpsy chiatrischen Gesellschaften • Österreichische Alzheimer Gesellschaft • Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend psychiatrie • Österreichische Schizophrenie­gesellschaft Ethische Aspekte: Vergewissern Sie sich bitte, dass bei allen Untersuchungen, in die Patienten involviert sind, die Zustimmung der zuständigen Ethikkommission beachtet worden ist. Besteht ein Interessenskonflikt gemäß den Richtlinien des International Committee of Medical Journal Editors, muss dieser gesondert am Ende des Artikels ausgewiesen werden. Korrekturabzüge: Nach Anfertigung des Satzes erhält der verantwortliche Autor einen Fahnenabzug des Artikels elektronisch als pdf-Datei übermittelt. Die auf Druckfehler und sachliche Fehler durchgesehenen Korrekturfahnen sollten auf dem Postweg an die Verlagsadresse zurückgesandt werden. Manuskript-Einreichung: Ausserhalb von Österreich: Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise, Universitätsklinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Innsbruck, Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck, Email: [email protected] Innerhalb von Österreich: Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata, Universitätsklinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Wien, Währingergürtel 18-20, A-1090 Wien, Email: [email protected] Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle http//:www.dustri.de ISSN 0948-6259 IV Übersicht Review Neuropsychiatrie, Band 25, Nr. 1/2011, S. 1–8 Die tiefe Hirnstimulation: Zum Stand der aktuellen Forschung – eine Übersicht*) Andreas Conca1, Jan Di Pauli2, Hartmann Hinterhuber3 und Hans-Peter Kapfhammer4 Psychiatrischer Dienst des Gesundheitsbezirkes Bozen-Südtirol (Italien) Abteilung Psychiatrie I, Landeskrankenhaus Rankweil, Vorarlberg 3 Univ.-Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie Innsbruck 4 Univ.-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Graz 1 2 Schlüsselwörter: tiefe Hirnstimulation (THS) – therapieresistente psychiatrische Krankheiten – ethische Aspekte Key words: deep brain stimulation (DBS) – therapy resistant psychiatric illnesses – ethical aspects Die tiefe Hirnstimulation: Zum Stand der aktuellen Forschung – eine Übersicht Die Tiefe Hirnstimulation (THS) hat bei der Behandlung neurologischer Krankheitsbilder in den letzten Jahren immer mehr Anwendungsbereiche gefunden. Bei der Therapie von Bewegungsstörungen nimmt sie einen revolutionierenden Stellenwert ein. Die Behandlung mit THS bei psychiatrischen Erkrankungen ist hingegen noch wenig erforscht. Die bisherigen Anwendungen bei Depressionen, Zwangsstörungen und therapieresistentem Tourette-Syndrom weisen auf positive Effekte hin und lassen die THS als eine Alternative zu neurochirurgischen Therapien erscheinen. Positive Ergebnisse wurden auch bei der Schizophreniebehandlung und bei der Therapie von Suchtverhalten verzeichnet, gleichwohl die Patientenstichprobe noch gering war. Der exakte Wirkmechanismus erscheint noch weitgehend unbekannt; die Nebenwirkungen sind umschrieben und zum Teil durch die jeweiligen Stimulationsparameter moduliert. Aufgrund der Tatsache, dass die Langzeitwirkungen der THS bei psychiatrischen Erkrankungen noch nicht schlüssig erfasst werden konnten, und diese Technik von einigen Ethikkommissionen als Eingriff in die Persönlichkeit erachtet wird, darf die Anwendung derzeit ausschließlich unter sehr strenger, individueller Indikationsstellung und rigoroser Berücksichtigung ethischer Fragestellungen erfolgen. Deep Brain Stimulation: a review on current research Recently Deep brain stimulation (DBS) has found continuous use in treatment of neurological movement disorders. However DBS in psychiatric illnesses is less investigated. Its application in depression, obsessive-compulsive disorder, and therapy-resistant TouretteSyndrome shows positive effects and offers an advanced alternative to neurosurgical therapies of the past. There are also case reports suggesting therapeutic benefits in schizophrenia and addiction. To a large extent, the mechanisms of action appear to be still unknown; the side effects seem partially modulated through the stimulation parameters. Furthermore, some ethics committees argue that DBS exhibits a relevant impact on the personality. The novel approach as well as the unknown long term effects of DBS implicate that the technique can be performed only under strict individual diagnosis and rigorous consideration of all ethical concerns. *) Die als Editorial im Heft 23/3 publizierte Arbeit "Neue Indikationen und ethische Implikationen der tiefen Hirnstimulation" gab das Referat wieder, das Hartmann Hinterhuber anlässlich der 9. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie in Gmunden am 23.4.2009 gehalten hat. Das große Interesse, das sowohl der Vortrag, als auch die Publikation im genannten Heft der "Neuropsychiatrie" fand und die dadurch ausgelöste Diskussion zu verschiedenen Aspekten der "tiefen Hirnstiumulation" motiviert die Herausgeber nun eine erweiterte Fassung der Arbeit zu publizieren, an der alle genannten Autoren zu gleichen Teilen beigetragen haben. © 2011 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 A. Conca, J. Di Pauli, H. Hinterhuber, H.-P. Kapfhammer 1. Einführung 1952 publizierte J.M.R. Delgado gemeinsam mit seinen Mitarbeitern H. Hamlin und W.P. Chapman die von ihnen entwickelte Technik der Hirnstimulation mittels intrakraniell eingebrachter Elektroden und diskutierte einen möglichen therapeutischen Effekt bei psychotischen Patienten (8). R.G. Heath veröffentlichte 1960 im Sammelband "Electrical Studies on the Unanesthetized Brain" ihre 7 Jahre währenden Erfahrungen mit der tiefen Hirnstimulation (19). Die Technik geriet durch beinahe ein viertel Jahrhundert in Vergessenheit. Erst im Jahr 1986 führte der Neurochirurg Benabid und der Neurologe Pollak in Grenoble wieder eine "Tiefe Hirn-Stimulation" bei einem Patienten mit Tremor durch: Dieser fand in der Vergangenheit durch eine Thalamotomie eine deutliche Linderung des Tremors in der kontralateralen Extremität. Die bekannten Risiken einer beidseitigen Thalamoto- mie verboten einen zweiten neurochirurgischen Eingriff. Für die genannten Forscher bot sich nun die Implantation eines Neurostimulationssystems im gegenüberliegenden Thalamus als weniger riskante Alternative an. Der Eingriff erbrachte den gewünschten Erfolg. In der Zwischenzeit ist die tiefe HirnStimulation des Nucleus subthalamicus ein bewährtes Verfahren zur Therapie motorischer Fluktuationen und Dyskinesien bei fortgeschrittenem Morbus Parkinson; Patienten mit schweren Dystonien hilft eine Pallidum-Stimulation, solchen mit therapieresistenten Tremorsyndromen die bereits erwähnte Thalamusstimulation. Darüber hinaus gibt es Therapieversuche bei Patienten mit Multipler Sklerose, therapierefraktärer Epilepsie und unbehandelbaren Schmerzsyndromen (7). Die Ergebnisse der bisher größten Stimulationsstudie bei Parkinsonscher Erkrankung bzw. deren Möglichkeiten und Grenzen gibt die Abbildung 1 wieder (52). Weltweit scheinen bereits mehr als 40.000 Patienten mit tiefer Hirn-Stimulation therapiert worden zu sein. In Deutschland werden in rund 30 Kliniken jährlich etwa 400 "Hirnschrittmacher" implantiert. Die tiefe Hirn-Stimulation zählt heute zu den erfolgversprechenden Techniken der Neuromodulation. Thomas Schläpfer (43) definiert "Neuromodulation" als "die Beeinflussung einer durch Krankheit veränderten Aktivität von Nervenzellverbänden und neuronalen Netzwerken durch technische Stimulationssysteme mit dem Ziel einer therapeutischen Wirkung…Bei ihr wird eine dünne Elektrode in genau definierte Stellen des Gehirns implantiert, von denen bekannt ist, dass ihre krankhaft veränderte Nervenzellaktivität gewissen klinischen Symptomen (wie z. B. der Tremor bei der Parkinson'schen Erkrankung oder psychiatrischen Symptomen) zu Grunde liegt." Abbildung 1 Therapieresultate bei fortgeschrittener Parkinson-Erkrankung: Bilaterale tiefe Hirnstimulation vs. optimierter medikamentöser Therapie Optimierte medikamentöse Anti-Parkinson-Therapie → 134 Patienten Tiefe Hirn-Stimulation Stimulation des N. subthalamicus Stimulation des Globus pallidus → 60 Patienten → 60 Patienten Gewinn an Stunden im On-Status pro Tag Patienten der Stimulationsgruppe ........................................................................................................... 4,6 Stunden Patienten mit medikamentöser Therapie . ................................................................................................... 0 Stunden Reduktion der Off-Zeiten Patienten der Stimulationsgruppe ............................................................................................................ 2,4 Stunden Patienten mit medikamentöser Therapie . ................................................................................................... 0 Stunden Verbesserung der Motorik (5 Punkte und mehr): Patienten der Stimulationsgruppe........................................................................................................................71 % Patienten mit medikamentöser Therapie..............................................................................................................31 % Ernsthafte Nebenwirkungen: Unter THS ............................................................................................................................... 40 % (1 Todesfall) Unter Medikation................................................................................................................................................ 11 % F.M. Weaver et al. JAMA 301, 1 (2009) 63 Die tiefe Hirnstimulation: Zum Stand der aktuellen Forschung – eine Übersicht 2. Die technische Durchführung der tiefen HirnStimulation 3. Die tiefe Hirnstimulation bei psychiatrischen Stör­ungen Die krankhaft veränderte Aktivität des betreffenden Hirnareals wird durch hochfrequente elektrische Impulse mit veränderbarer Frequenz, Polarität, Amplitude und Pulsweite beeinflusst bzw. moduliert. Die Elektrode ist mit einem elektrischen Impulsgenerator verbunden, der wie ein Herzschrittmacher unter der Clavicula implantiert wird. Vom Batterie-betriebenen Generator geht bei "Soletra" eine Elektrode ab, bei "Kinetra" sind es zwei. Die Implantation am Zielort erfolgt stereotaktisch mit Neuro-Imaging-Unterstützung. Heute bietet sich die transkranielle Sonographie als hochauflösende SofortBildgebung auch zum intraoperativen Monitoring im Rahmen der Implantation der Stimulationselektroden an. Die MRT ist diesbezüglich nur unter sehr aufwändigen Bedingungen einzusetzen. Die transkranielle Sonographie erlaubt eine exakte Positionierung der Stimulationselektroden. Da simultan auch die Hirnarterien dargestellt werden, können Hirnblutungen somit vermieden werden. Postoperativ eignet sich die transkranielle Sonographie zur Lagekontrolle der Elektroden (52). Die von der FDA zugelassenen Elektroden, sog. Quadripole, enthalten 4 Kontakte. Der Generator gibt kurze Stromimpulse zwischen Anode und Kathode ab, sodass eine kontinuierlich rechteckige Wellenform entsteht. Die Dauer einer Welle wird als Impulsbreite bezeichnet, diese kann zwischen 60 und 450 μs eingestellt werden. Die Amplitude (die Höhe der Welle) wird in Volt angegeben, die Variationsmöglichkeiten betragen zwischen 0 und 10,5 V. Die Pulsfrequenz (der Wellenabstand) beträgt 2 bis 250 Hz. Die FDA lässt eine Veränderung der Voltzahl nicht zu. Die Stimulationsparameter werden über ein externes Programmiergerät eingestellt und kontrolliert. Über dieses Gerät kann der Generator jederzeit einoder ausgeschaltet werden. Die Batterien müssen alle 3 bis 5 Jahre gewechselt werden (22). Die tiefe Hirnstimulation hat in der Neurologie die Therapie von Bewegungsstörungen revolutioniert: In der Neurologie ist die tiefe Hirn-Stimulation in der Tat besonders bei Bewegungsstörungen ein bereits gut etabliertes Verfahren. Im Unterschied zu neurologischen Erkrankungen stellt die tiefe Hirn-Stimulation bei psychiatrischen Störungen ein neues, noch wenig erforschtes, reversibles neurochirurgisches Vorgehen dar, auch wenn die ersten Eingriffe in dieser Indikation schon in den 50er Jahren durchgeführt wurden (J.M.R. Delgado et al. 1952 (8) und R.G. Heath et al. 1960 (19)). Die zunehmenden systematisierten und wissenschaftlich begleiteten Erfahrungen mit der tiefen Hirn-Stimulation belegen, dass diese Technik sowohl motorische als auch kognitive und emotionale Wirkungen zu entfalten in der Lage ist. Das Potenzial der THS kann auch bei ausgewählten schwersten psychiatrischen Erkrankungen vielversprechend sein, besonders wenn die Störung durch eng umschriebenen Dysfunktionen von neuronalen Netzwerken verursacht wird und diese medikamentös nicht beeinflussbar ist (44). 3.1 Mögliche Indikationen Welche Anwendungsgebiete werden heute in der Psychiatrie diskutiert? 2005 veröffentlichten Helen Mayberg und Mitarbeiter (29) die Ergebnisse der THS bei 6 an therapieresistenter chronischer Depression leidenden Patienten. Die Stimulation erfolgte bilateral in der weißen Substanz unter dem subgenualen cingulären Cortex (Brodmann-Area 25). Diese Region ist bekanntlich bei behandlungsresistenter Depression überaktiv. Bei 5 Patienten konnte nach 2 Monaten chronischer Stimulation eine Besserung beobachtet werden, bei 4 Patienten blieb die Besserung auch nach weiteren 4 Monaten bestehen. Die Autoren beschrieben insbesondere eine Verbesserung des Affektes und der Interessenslage. Th. Schläpfer publizierte mit seiner Gruppe (42) auch eine Verbesserung anhedonischer und depressiver Symptome bei 2 von 3 Patienten, deren Nucleus accumbens stimuliert worden war. Diese erfolgversprechenden Ergebnisse wurden auch in einer weiteren Fallserie von 10 Patienten durch die Arbeitsgruppe bestätigt (5). Lonzano et al. veröffentlichten 2008 die bisher größte Studie von 20 therapierefraktären depressiven Patienten, wobei die 6 Patienten aus der Studie von Mayberg miteingeschlossen waren. Die in die Studie aufgenommenen depressiv Erkrankten sprachen auf keine der mindestens 4 lege artis durchgeführten Therapiezyklen an, alle 20 erhielten und nutzten psychotherapeutische Angebote, 17 der 20 Patienten wurden einer EKT unterzogen. Die Ergebnisse zeigt Abbildung 2. Die erzielten positiven Resultate konnten auch für einen Follow up-Zeitraum von 3 bis 6 Jahren nachgewiesen werden (24). Waren von den 20 Patienten vor der tiefen Hirnstimulation 18 aufgrund ihrer Erkrankung arbeitslos, sank 12 Monate nach Stimulation die Zahl auf 12. Malone et al. untersuchte 15 schwer depressive Patienten. Stimuliert wurde das ventrale Striatum/ventrale Kapsula. Der Stimulationsort wurde aufgrund von positiven Fallberichten der Tiefen Hirnstimulation bei Zwangspatienten gewählt. 5 Patienten remittierten und 8 weitere zeigten zumindest eine signifikante Verbesserung. Die Stimulusparameter wurden titriert. Ein Patient mit bipolar affektiver Störung wurde in diese Arbeit eingeschlossen. Bei diesem Kranken kam es während der Stimulation zu hypomannen Episoden welche nach Abschalten der Stimulation sistierten. Ein weiterer Zielort ist der inferiore thalamische Pedunculus. Anhand von PET Studien konnte gezeigt werden dass, im Rahmen einer depressiven Störung diese Region hyperaktiv ist und sich deren Aktivität bei einer erfolgreichen medikamentösen Behandlung normalisiert. A. Conca, J. Di Pauli, H. Hinterhuber, H.-P. Kapfhammer Abbildung 2: THS bei therapie-refraktärer Depression Lonzano et al. (2008) Jimenez et al (23) berichtete 2005 von einer erfolgreichen Implantation bei einer 49-jährigen Patientin mit therapieresistenter Depression. Allerdings hielt der Effekt auch nach Abschalten des Gerätes an. Bei den Patienten von Malone (28) kam es nach Abschalten der Stimulation zu einem Rückfall, sodass bezweifelt werden kann, ob der Therapieerfolg beim Patienten von Jimenez auf die Stimulation zurückgeführt werden kann. Der Hinweis, dass depressive Störungen eine hohe Ansprechrate auf Placebo aufweisen, kann durch die Tatsache entkräftigt werden, dass in den bisherigen Studien nur Schwerstkranke einer tiefen Hirnstimulation zugeführt wurden: Schwerstkranke respondieren bekanntlich schlecht auf Placebo. Bei schwersten therapieresistenten Zwangsstörungen wurde im vorderen Schenkel der inneren Kapsel stimuliert, um hyperaktive dopaminerge neuronale Regelkreise zu beeinflussen (13): Diese Zielregion wurde aufgrund der Erfahrungen bei ablativen neurochirurgischen Interventionen und der Ergebnisse funktioneller bildgebender Verfahren gewählt. 4 der 8 Patienten von Greenberg et al. (13) zeigten auch nach 36 Monaten eine gute Response. Nuttin et al. (32, 33, 34) veröffentlichten eine Studie im rando- misierten doppelblinden on/off-Setting. In der Off-Phase verschlechterten sich 3 der 6 Patienten innerhalb der dreimonatigen Beobachtungszeit, bei 2 musste die Stimulation vorzeitig wieder eingeschaltet werden. Stimuliert wurde auch in dieser Studie die Capsula interna. Ähnliche Ergebnisse bei identem Studiendesign publizierte Abelson et al. (9, 11, 14, 21, 27). Kontrollierte Fallserien und Kasuistiken schreiben auch der Stimulation des Nucleus subthalamicus, des ventralen Nucleus caudatus und des Nucleus accumbens positive klinische Aspekte zu. Neben den bisher genannten Indikationen scheinen Tourette-Patienten von der Stimulation verschiedener subkortikaler Kerngebiete am besten zu profitieren (31, 50). Da eine Fehlfunktion des kortiko-striato-thalamo-kortikalen Regelkreises angenommen wird, und sich auch Veränderungen in den Basalganglien finden, ergeben sich hieraus unterschiedliche Stimulationsorte. Bisher liegen 6 Fallberichte (2, 25, 50) vor, bei denen der Thalamus stimuliert wurde. Die Ergebnisse waren durchwegs positiv. Ein zufriedenstellender Therapieerfolg fand sich auch bei Stimulation des Globus pallidus und des Nucleus accumbens ein. Insgesamt scheinen die therapeutischen Erfolge bei TourettePatienten vielversprechend zu sein: in den Fallberichten werden Vollremissionen berichtet, andere beschreiben deutliche Verbesserungen der Tics und der koprolalen Episoden bei ca. zwei Drittel der behandelten Patienten. Bezüglich der THS bei schizophrenen Patienten liegen derzeit nur wenige Fallberichte vor. Invasive Eingriffe sind aber gerade bei an Schizophrenie erkrankten Menschen unter ethischen Aspekten historisch schwer belastet. Die Arbeitsgruppe um G. Winterer in Düsseldorf (3, 53) fand aber, dass die tiefe Hirn-Stimulation im Globus Pallidus internus auch bei chronisch schizophrenen Patienten mit tardiven Dyskinesien erfolgversprechend zu sein scheint. Potenzielle Anwendungsgebiete könn­ ten auch die Negativ-Symptome bzw. schwere kognitive Defizite bei schizophrenen Patienten darstellen: Das pathophysiologische Korrelat dieser Symptomatik findet sich in einem prä­ frontalen Synchronisierungsdefizit im Theta-Frequenzbereich mit einem Maximum im Anterioren Cingulären Cortex (ACC). Die genannte Düsseldorfer Arbeitsgruppe bereitet derzeit eine THS-Studie mit dem Ziel vor, diese Symptomatik über eine Theta-Synchronisierung im ACC zu verbessern (3, 53). Die tiefe Hirnstimulation: Zum Stand der aktuellen Forschung – eine Übersicht Erste kasuistische Berichte glaubten bereits eine Beeinflussung süchtigen Verhaltens durch die Stimulation des Nucleus accumbens ermöglichen zu können: Ein Patient wurde aufgrund einer depressiven Störung mit Panikattacken und sekundärem Alkoholismus mittels tiefer Hirnstimulation behandelt. Die depressive Symptomatik konnte nicht beeinflusst werden, wohl aber besserte sich das Craving und somit der Konsum von Alkohol. Zwei weitere verloren ihr pathologisches Spielverhalten. Bandini et al. (4) und Witjas (55) sowie die Arbeitsgruppe um B. Bogerts (6) fanden somit schon Hinweise für eine Indikation der tiefen Hirn-Stimulation bei Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen. Auch wenn die THS bei schwersten, therapieresistenten Zwangsstörungen (13) und affektiven Psychosen (26, 40, 42) viel versprechende Ergebnisse zeigt, muss - zusammenfassend - betont werden, dass die bisher publizierten Fallzahlen immer noch sehr klein sind. Belegen erste methodisch gut durchgeführte Studien an kleinen Patientengruppen mit chronifizierten Zwangsstörungen und depressiven Erkrankungen in der Tat die Effektivität der tiefen Hirn-Stimulation, ist deren Erfolg jedoch nicht konsistent: Einige Patienten geben bei entsprechender Stimulation keine Verbesserung ihrer quälenden Symptomatik an. Die NonResponse wird derzeit noch kontroversiell diskutiert. 3.2 Wirkmechanismus Der Wirkmechanismus der tiefen HirnStimulation ist noch nicht bekannt; es wird vermutet, dass chronische hochfrequente Stimulation mit 130 bis 185 Hz spannungsabhängige neuronale Ionenkanäle inaktiviert und auf diesem Weg die neuronale Transmission beeinflussen kann. Das Ergebnis wäre somit eine "funktionelle Läsion" ähnlich einer ablativen neurochirurgischen Operation (17). Ob eine niedrigere Frequenz effektiv zu einer Stimulation der betreffenden Region führt, ist heute noch nicht zu klären. 3.3. Nebenwirkungen Als Nebenwirkungen der THS werden einerseits jene beschrieben, die auf Grund der chirurgischen Implantation auftreten, andererseits jene, die durch die Stimulation selbst ausgelöst werden (42, 43). Eine eingehende Zusammenfassung findet sich bei Grill et al. (15). • Die Häufigkeit von Blutungen durch elektrodenbedingte Verletzung von Blutgefäßen beträgt 1 bis 5 %. • Die Häufigkeit von epileptischen Anfällen wird mit 1 bis 3 % beschrieben. • Bei 2 bis 25 % treten vor allem oberflächliche Infektionen auf. Neben dem Narkose- und OP-Risiko treten Nebenwirkungen in Abhängigkeit des Zielortes auf. Stimulationsabhängige Nebenwirkungen sind in der Regel passager und können durch eine Änderung der Stimulationsparameter korrigiert werden. Beschrieben sind Parästhesien, Muskelkontraktionen, Dysarthrie, Doppelbilder sowie Veränderung der Stimmungslage, des Gedächtnisses und der kognitiven Parameter. Darüber hinaus wurden bei nicht richtiger Platzierung der Elektroden noch weitere Nebenwirkungen wie Sprachstörungen, Störungen der Augenbewegungen und eine Verschlechterung der Beweglichkeit beobachtet. Okun et al. (36) beschrieben das Auslösen von Lachen und Euphorie bei THS im Rahmen einer Zwangsstörung, Shapira et al. (47) beobachteten bei der selben Indikationsstellung Panik, Angst und vegetative Symptome. Visser-Vandewalle et al. (50) beobachteten bei einem Patienten mit Tourette-Syndrom Sedation und Sexualstörungen. Bandini et al. (4) sowie Witjas et al. (55) beobachteten bei Parkinson-Patienten, die im Nucleus subthalamicus stimuliert worden sind, eine Beeinflussung ihres pathologischen Spielverhaltens, Schneider und Mitarbeiter (46) ebenfalls bei Parkinson-Patienten eine Stimmungsaufhellung sowie eine Verbesserung des emotionalen Gedächt- nisses. Lozano et al. (26) stimulierten bei einem krankhaft fettsüchtigem Patienten den Hypothalamus, dieser beschrieb daraufhin Déjà-vu-Erlebnisse. Nach 3 Wochen Stimulation schnitt er bei Gedächtnistests aber deutlich besser ab als vor der Behandlung. Dies führte sofort zu unreflektierten Mitteilungen von hoffnungsvollen Behandlungsansätzen bei Alzheimer Demenz (48). M. Ulla et al. (49) beschrieben bei einem stimulierten Parkinsonpatienten ein auf ein Jahr begrenztes manisches Verhalten mit inadäquat angehobener Stimmung, abnormer Antriebssteigerung und Kritiklosigkeit. Es muss aber auch an eine mögliche Gewebsreaktion gegen die Elektroden gedacht werden, da diese jahrelang bzw. lebenslang verbleiben. Wenige post-mortem-Studien belegen, dass es um die Elektrode zu einem geringen Verlust an neuronalen Zellen sowie zu einer Fremdkörperreaktion mit FibrinGewebe und Gliosis kommt. Noch nicht geklärt ist die Frage, ob der Untergang neuronaler Zellen durch die Stimulation bedingt ist oder rein mechanisch erklärbar ist (38). Die Gewebsreaktionen wie auch der Verlust an neuronalen Zellen ist jedoch gering. Die diesbezügliche Datenlage ist jedoch heute noch sehr schlecht. Unter den Kriterien der evidenzbasierten Medizin (41, 43) ist zu sagen, dass zur THS als antidepressive Behandlungsmethode nur die erwähnte Studie mit 6 bzw. 20 Patienten und einige wenige kasuistische Mitteilungen vorliegen (Evidenzgrad III). Bei Zwangsstörungen sind nur wenige placebokontrollierte Studien mit geringen Fallzahlen sowie kasuistische Darstellungen publiziert (Evidenzgrad IIb). Angeboten wird die tiefe Hirn-Stimulation zur Behandlung schwerer, therapieresistenter Depression vor allem an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bonn (Prof. Dr. Thomas E. Schläpfer) in Verbindung mit der Klinik für Stereotaxie und Funktioneller Neurochirurgie der Universität zu Köln (Prof. Dr. Volker Sturm) und an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Charité Zentrum A. Conca, J. Di Pauli, H. Hinterhuber, H.-P. Kapfhammer für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie in Berlin (Prof. Dr. Malek Bajbouj). 4. Ethische Implikationen Langzeiteffekte der THS bei psychiatrischen Erkrankungen sind bisher nicht bekannt. Bei der Frage der Anwendung ist besondere Sorgfalt geboten. Christiane Woopen vom Kölner Institut für Geschichte und Ethik der Medizin (56) fasst dies folgendermaßen zusammen: "Die Nutzen-Risiko-Abwägungen sind extrem individuell zu treffen, da wir nicht nur von Eingriffen in einzelne körperliche Funktionen sprechen, sondern von Eingriffen in die Persönlichkeit." Der Ort der Anwendung, die invasive Methodik mit einem potenziell schweren Nebenwirkungsprofil einerseits und die Komplexität der erzielten Wirkung und die damit verbundenen neuen Erkenntnis- und Behandlungsmöglichkeiten andererseits fordern sowohl bei Forschungsvorhaben als auch bei der klinischen Anwendung der THS die rigorose Berücksichtigung ethischer Fragestellungen. An der Basis dieser ethischen Überlegungen steht einmal unser grundsätzliches Verständnis von Gesundheit und Lebensqualität, zum anderen die Berücksichtigung der personalen Identität (37, 39, 45). Der deutsche nationale Ethikrat (30) hat im Jahr 2006 eine Diskussion über Neuroimplantate geführt. Bedenken und skeptische Reaktionen gegenüber der Informations- und Kommunikationstechnologie betreffen vor allem folgende Fragen: • Führt der Einsatz von Neuroimplantaten zu unerwünschten psychischen Veränderungen? • Wissen wir noch, wer wir sind, wenn Kommunikations- und Informationselektronik Funktionen unseres Gehirns und Nervensystems unterstützt oder ersetzt? • Können dadurch unser Erkennen, Wahrnehmen und Handeln kontrolliert oder gar manipuliert werden? Insgesamt ist die generelle Diskussion bezüglich der IKT für die speziellen Fragestellungen bezüglich der tiefen Hirnstimulation wenig hilfreich, da unter diesen Technologien auch Instrumente zur Manipulation und Überwachung von Individuen oder Gruppen subsumiert werden. Für die entweder im ZNS oder peripher eingepflanzten Implantate stellen sich in Abhängigkeit von den Anwendungszielen vielfältige, aber unterschiedliche ethische Fragen. Eve-Marie Engels (30) formuliert dies folgendermaßen: "Die Verwendung von Neuroimplantaten und anderen Informations- und Kommunikationsimplantaten stellt also eine Gradwanderung dar zwischen einer legitimen oder gar gebotenen medizinischen Anwendung zum Wohle von Kranken und dem Missbrauch dieser Technik, die aus uns im Extremfall ferngesteuerte Roboter machen kann..." Was die THS betrifft, wurde im Sinne der Selbstbestimmung als vorteilhaft angesehen, dass diese Methode reversibel ist und der Generator jederzeit abgeschaltet werden kann. Auch wenn dieser therapeutische Eingriff rückgängig gemacht und der Impulsgeber wieder entfernt werden kann und somit der Patient wieder in jene Psychopathologie zurückfällt, die vor dem Eingriff bestanden hat, muss aber bedacht werden, dass durch die stereotaktische Implantation der Elektrode auch irreversible Störungen wie blutungsbedingte Nervenzellausfälle möglich sind. Die Beurteilung der tiefen Hirn-Stimulation muss immer auch ideen- und kulturgeschichtliche sowie sozialhistorische Aspekte berücksichtigen, die in der Vergangenheit den Umgang mit experimentellen psychiatrischen Therapien definiert haben. Die THS wird in der Tat von nicht wenigen Psychiatern und interessierten Laien in eine Beziehung zur Psychochirurgie des frühen 20. Jahrhunderts gebracht. Diesbezüglich schreibt aber Heiner Fangerau (10) zurecht, dass die derzeitige ethische Diskussion aber weniger von den Erfahrungen mit der Psychochirurgie dominiert wird, sondern vielmehr den gesellschaftlichen Umgang mit psychisch Kranken, besonders während der NSZeit reflektiert. Bezüglich der ethischen Aspekte fordert Georg Winterer (54) die Berücksichtigung folgender Punkte: 1. den historischen Hintergrund der verbrecherischen nationalsozialistischen Versuche an psychisch Kranken und Behinderten sowie 2. jenen der Psychochirurgie zu berücksichtigen; 3. den Respekt der freien Entscheidung der Patienten uneingeschränkt zu akzeptieren; 4. spezifische Krankheitsmerkmale zu bedenken, die eine Psychose triggern bzw. zu einer nachhaltigen psychischen Traumatisierung führen können; 5. besondere Standards bei der Diagnostik und beim Einschluss in die Studie bzw. bei der Erstellung des Studienprotokolls zu erfüllen; 6. die strikte wissenschaftliche Fundierung des Studiendesigns einzuhalten; 7. externe Supervision der beteiligten Studienärzte und regelmäßige Patientengespräche durch studienunabhängige externe Ärzte zu garantieren. Tief im Menschen verwurzelt ist und bleibt das Unbehagen, durch ein technisch-chirurgisches Verfahren die Stimmungslage und das Verhalten des Menschen zu beeinflussen. Besonders problematisch erscheint für viele eine mögliche unreflektierte künftige Indikationserweiterung. Kann die Möglichkeit einer externen Manipulation des Stimulators ausgeschalten werden? R. Capurro, Mitglied des European Group on Ethics, betont das ethische Konzept der Unversehrtheit des menschlichen Körpers. Zur Freiheit der Forschung in der Medizin sagt er (30) "Das ethische Konzept der Unversehrtheit des menschlichen Körpers sollte nicht als Hemmnis für den Fortschritt in Wissenschaft und Technik, sondern als ein Schutzwall gegen den potentiellen Missbrauch dieses Fortschrittes betrachtet werden." M. Tatagiba, Direktor der Neurochirurgischen Klinik in Tübingen, appelliert Die tiefe Hirnstimulation: Zum Stand der aktuellen Forschung – eine Übersicht zur Wachsamkeit bei der Anwendung der THS, da durch entsprechende Stimulationen des Gehirns auch Verhaltensänderungen des betreffenden Menschen und Veränderungen seiner Persönlichkeit möglich sind: "Umso mehr muss man vorsichtig sein und aufpassen!" (30) Methode. Die Indikationsstellung muss nach gesundheitlichen Kriterien, nicht nach der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung des Patienten erfolgen. Stets müssen wir uns aber heute vor Augen halten, dass die THS in der Psychiatrie immer noch als experimentelle Therapieform zu bezeichnen ist. 5. Diskussion Literatur Die tiefe Hirn-Stimulation wurde bisher bei nicht mehr als ca. 120 psychiatrischen Patienten angewandt, die Wirksamkeit wurde vorwiegend – wie erwähnt – bei schwerstkranken Patienten mit Zwangsstörungen und therapierefraktären Depressionen untersucht. Zusammenfassend kann festgehalten werden: Bei extremen Ausprägungen von therapierefraktären Zwangsstörungen und einer Tourette-Symptomatik sowie vereinzelt auch bei unbehandelbaren depressiven Erkrankungen kann die THS als Alternative zu ablativen neurochirurgischen Operationen gesehen werden: Ein Vorteil der THS wird in der Reversibilität des Eingriffes gesehen: Eine individuelle Anpassung der Stimulationsparameter kann einen optimalen therapeutischen Effekt ermöglichen. Auch sind placebokontrollierte Studien durchführbar. Die Implantation einer Elektrode zur tiefen Hirn-Stimulation ist bei psychisch schwerstkranken Patienten ethisch dann zu rechtfertigen, wenn kein weniger invasives Verfahren zur Verwirklichung des Therapiezieles existiert. Bei geschäftsunfähigen Personen ist die THS nur im Einklang mit den Übereinkommen des Europarates über Menschenrechte und Biomedizin anzuwenden. Die Indikationsstellung zur THS muss rigorose Kriterien erfüllen. In diesen Prozess ist auch die lokale Ethikkommission einzubinden. Auch sollte die Durchführung der THS bei psychiatrischen Erkrankungen auf wenige (europäische) Zentren beschränkt bleiben. Sicherzustellen ist aber genauso ein fairer Zugang zu dieser therapeutischen [1] Abelson JL, Curtis GC, Sagher O, Albucher RC, Harrigan M, Tayler SF et al. Deep brain stimulation for refractory obsessive-compulsive disorder. Biological Psychiatry 57: 510-516, 2005. [2] Anderson D, Ahmed A. Deep brain stimulation in Tourette`s syndrom: Two targets. Movement Disorders 21: 709713, 2006. [3] Arends M, Winterer G. Tiefe Hirnstimulation bei Schizophrenie - Ein neues Forschungsprojekt. Der Nervenarzt Suppl 4, S470, 2008. [4] Bandini F, Primavera A, Pizzorno M et al. Using STN DBS and medication reduction as a strategy to treat pathological gambling in Parkinson‘s disease. Parkinsonism Relat Disord. 13:369-71, 2007. [5] Bewernick BH, Hurlemann R, Matusch A, et al. Nucleus accumbens deep brain stimulation decreases ratings of depression and anxiety in treatment-resistant depression. Biol Psychiatry 67: 110-116, 2010 [6] Bogerts B, Müller UJ, Sturm V, Voges J, Heinze HJ, Galazky I, Heldmann M, Scheich H. Successful treatment of chronic resistant alcoholism by deep brain stimulation of nucleus accumbens: first experience with three cases. Pharmacopsychiatry 42:1-4, 2009. [7] Chang J-Y. Brain stimulation for neurological and psychiatric disorders. Current status and future direction. J Pharmacol Exp Ther 309: 1-7, 2004. [8] Delgado JMR, Hamlin H, Chapman WP. Technique of intracranial electrode implacement for recording and stimulation and its possible therapeutic value in psychotic patients Confinia Neurologica 12:315-319, 1952. [9] Denys D, Mantione M, Figee M, et al. Deep brain stimulation of the nucleus accumbens for treatment-refractory obsessive-compulsive disorder. Arch Gen Psychiatry 67: 1061-1068, 2010. [10] Fangerau H. Zukunft ohne Herkunft? Die historische Dimension ethischer Dilemmata in der tiefen Hirnstimulation. Nervenarzt Suppl 4, S471, 2008. [11] Goodman WK, Foote KD, Greenberg BD, Ricciuti N, Bauer R, Ward H, Shapira NA, Wu SS, Hill CL, Rasmussen SA, Okun MS. Deep brain stimulation for intractable obsessive compulsive disorder: pilot study using a blinded, staggered-onset design. Biol. Psychiatry 67:535-542, 2010. [12] Gorgulho A DSA, Frighetto L, Behnke E. Incidence of hemorrhage during microelectrode guided deep brainstimulator implantation for movement disorders. Neurosurgery 56: 722-732, 2005. [13] Greenberg BD, Malone DA, Friehs GM, Rezai AR, Kubu CS, Malloy PF, Salloway SP, Okun MS, Goodman WK, Rasmussen SA: Three-year outcomes in deep brain stimulation for highly resistant obsessive-compulsive disorder. Neuropsychopharmacology 31: 23842393, 2006. [14] Greenberg BD, Gabriels LA, Malone DA Jr, et al. Deep brain stimulation of the ventral internal capsule/ventral striatum for obsessive-compulsive disorder: worldwide experience. Mol Psychiatry 15: 64-79, 2010. [15] Grill W. Safty considerations for deep brain stimulation: review and analysis. Expert Rev Med Devices 2: 409-420, 2005. [16] Hamani C, McAndrews MP, Cohn M, Oh M, Zumsteg D, Shapiro CM, Wennberg RA, Lozano AM. Memory enhancement induced by hypothalamic/fornix deep brain stimulation. Ann Neurol 63:119123, 2008. [17] Hamani C, Nóbrega JN. Deep brain stimulation in clinical trials and animal models of depression. Eur J Neurosci 32: 1109-17, 2010. [18] Heath RG, Mickle WA. Evaluation of 7 years‘ experience with depth electrode studies in human patients, in Ramey ER, O‘Doherty DS (eds): Electrical studies on the unanesthetized brain. New York, P. Hoeber, pp 214–247, 1960. [19] Hinterhuber H. Neue Indikationen und ethische Implikationen der tiefen HirnStimulation. Neuropsychiatrie 23, 3: 139-143, 2009. [20] Houeto F, Karachi C, Mallet L, et a. Tourette`s syndrom and deep brain stimulation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 76: 992-995, 2005. [21] Huff W, Lenartz D, Schormann M, et al. Unilateral deep brain stimulation of the nucleus accumbens in patients with treatment-resistant obsessive-compulsive disorder: Outcomes after one year. Clin Neurol Neurosurg 112: 137-143, 2010. [22] Hunka K, Suchowersky O, Wood S, Derwent L, Kiss ZHT. Nursing Time to Program and Assess Deep Brain Stimulators in Movement Disorder Patients. J Neurosci Nurs 37: 204-210, 2005. A. Conca, J. Di Pauli, H. Hinterhuber, H.-P. Kapfhammer [23] Jiménez F, Velasco F, Salin-Pascual R, Hernández JA, Velasco M, Criales JL, Nicolini H. A patient with a resistant major depression disorder treated with deep brain stimulation in the inferior thalamic peduncle. Neurosurgery 57: 585-593, 2005. [24] Kennedy SH, Giacobbe P, Rizvi SJ, et al. Deep brain stimulation for treatmentresistant depression: follow-up after 3 to 6 years. Am J Psychiatry 2011 (epub ahead of print). [25] Kuhn J. Die Anwendung der tiefen Hirnstimulation bei psychiatrischen Erkrankungen - ein Überblick. Nervenarzt Suppl 4, S471, 2008. [26] Lozano AM, Mayberg H, Giacobbe P, Hamani C, Craddock C, Kennedy SH. Subcallosal cingulate gyrus deep brain stimulation for treatment-resistant depression. Biol Psychiatry 64(6):461-467, 2008. [27] Mallet L, Polosan M, Jaafari N, et al; STOC Study Group. Subthalamic nucleus stimulation in severe obsessivecompulsive disorder. N Engl J Med 359: 2121-2134, 2008. [28] Malone DA Jr, Dougherty DD, Rezai AR, Carpenter LL, Friehs GM, Eskandar EN, Rauch SL, Rasmussen SA, Machado AG, Kubu CS, Tyrka AR, Price LH, Stypulkowski PH, Giftakis JE, Rise MT, Malloy PF, Salloway SP, Greenberg BD. Deep Brain Stimulation of the Ventral Capsule/Ventral Striatum for TreatmentResistant Depression. Biol Psychiatry 65:267-75, 2009. [29] Mayberg HS, Lozano AM, Voon V, McNeely HE, Seminowicz D, Hamani C, Schwalb JM, Kennedy SH. Deep brain stimulation for treatment-resistant depression. Neuron 45: 651-660, 2005. [30] Nationaler Ethikrat: Forum Bioethik - Neuroimplantate: Stimulus oder Steuerung?, 25.1.2006. http://www.ethikrat. org/veranstaltungen/pdf/Wortprotokoll_ FB_2006-01-25.pdf [31] Neuner I, Schneider F. Tiefe Hirnstimulation bei psychischen Erkrankungen. Indikation in Einzelfällen bei Depressionen, Zwangsstörungen, Tourette-Syndrom und tardiven Dyskinesien. psychoneuro 33: 297-303, 2007. [32] Nuttin B, Cosgyns P, Demeulemeester H, al e. Electrical stimulation in anterior limbs of the internal capsules in patients with serve obsessive-compulsive disorder. Lancet 354: 1526, 1999. [33] Nuttin B, Gybels J, Cosyns P, Gabriel L, Meyerson B, Andréewitch S, Rasmussen S, Greenberg B, Friehs G, Rezai AR, Montgomery E, Malone D, Fins JJ. Deep brain stimulation for psychiatric disorders. Neurosurgery 51: 519, 2002. [34] Nuttin B, Gabriels L, Van Kuyck K, Cosgyns P. Electrical stimulation of the anterior limbs of the internal capsules in [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] patients with severe obssesive-compulsive-disorder: anecdoctal reports. Neurosurg Clin N Am 14: 267-274, 2003. Obeso J. Deep-Brain Stimulation of the Subthalamic Nucleus or the Pars Interna of the Globus Pallidus in Parkinson‘s Disease. N Engl J Med 345: 956-963, 2001. Okun MS, Mann G, Foote KD et al. Deep brain stimulation in the internal capsule and nucleus accumbens region: responses observed during active and sham programming. J Neurol Neurosurg Psychiatry 78: 310–314, 2007. Rabins P, Appleby BS, Brandt J, et al. Scientific and ethical issues related to deep brain stimulation for disorders of mood, behavior, and thought. Arch Gen Psychiatry 66: 931-937, 2009. Romito LM, Albanese A. Dopaminergic therapy and subthalamic stimulation in Parkinson‘s disease: a review of 5-year reports. J Neurol 257: 298-304, 2010. Schechtman M. Philosophical reflections on narrative and deep brain stimulation. J Clin Ethics 21: 133-139, 2010. Schlaepfer T, Lieb K. Deep brain stimulation for treatment refractory depression. Lancet 366: 1420-1422, 2005. Schlaepfer T.: Hirnstimulationsverfahren bei Therapieresistenz. Der Nervenarzt Suppl. 3, 78: 575-584, 2007. Schlaepfer T, Cohen MX, Frick C, Kosel M, Brodesser D, Axmacher N, Joe AJ, Kreft M, Lenartz D, Sturm V. Deep brain stimulation to reward circuitry alleviates anhedonia in refractory major depression. Neuropsychopharmacology 33: 368377, 2008. Schlaepfer T.: Stimulationsverfahren in der Psychiatrie. Die Psychiatrie 5: 237243, 2008. Schlaepfer TE, Kayser S. Die Entwicklung der tiefen Hirnstimulation bei der Behandlung therapieresistenter psychiatrischer Erkrankungen. Nervenarzt 81: 696-701, 2010. Schmetz MK, Heinemann T. Ethische Aspekte der tiefen Hirnstimulation in der Behandlung psychiatrischer Störungen. Fortschr Neurol Psychiatr 78: 269-278, 2010. Schneider F, Habel U, Volkmann J et al. Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus enhances emotional processing in Parkinson disease. Arch Gen Psychiatry 60: 296–302, 2003. Shapira NA, Okun MS, Wint D et al. Panic and fear induced by deep brain stimulation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 77: 410–12, 2006. Tiefe Hirnstimulation verbessert das Gedächtnis. Hoffnung auf neuen Behandlungsansatz gegen Alzheimer. http://www.pressetext.at/pte. mc?pte=080130010 [49] Ulla M. et al: Manic behaviour induced by deep-brain stimulation in Parkinson‘s disease: evidence of substantia nigra implication?, In: J Neurol, Neurosurg Psychiatry 77: 1363-1366, 2006. [50] Visser-Vandewalle V, Temel Y, Boon P et al. Chronic bilateral thalamic stimulation: a new therapeutic approach in intractable Tourette syndrome. Report of three cases. J Neurosurg 99: 1094–1100, 2003. [51] Volkmann J. Tiefe Hirnstimulation. psychoneuro 33: 271, 2007. [52] Walter U. Bildgebung des Gehirns: Was kann die transkranielle Sonografie besser als die Magnetresonanztomografie? Fortschr Neurol Psychiat 2009, 77 (Suppl 1): S39-S41. [53] Weaver F.M. Follett K, Stern M, Hur K, Harris C, Marks WJ Jr, Rothlind J, Sagher O, Reda D, Moy CS, Pahwa R, Burchiel K, Hogarth P, Lai EC, Duda JE, Holloway K, Samii A, Horn S, Bronstein J, Stoner G, Heemskerk J, Huang GD; CSP 468 Study Group. Bilateral deep brain stimulation vs. best medical therapie for patients with advanced parkinson disease. A randomized controlled trial. JAMA 301: 63-73, 2009. [54] Winterer G. Tiefenhirnstimulation bei Schizophrenie - Ethische Aspekte. Nervenarzt Suppl 4, S471, 2008. [55] Witjas T, Baunez C, Henry JM et al. Addictions in Parkinson’s disease: impact of subthalamic nucleus deep brain stimulation. Mov Disord 20: 1052–1055, 2005. [56] Woopen C. Ethische Fragen im Zusammenhang mit tiefer Hirnstimulation. Nervenarzt Suppl 4, S471-S472, 2008. o. Univ.-Prof. Dr. Hartmann Hinterhuber Univ.-Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie Department für Psychiatrie und Psychotherapie Medizinische Universität Innsbruck [email protected] Original Original Neuropsychiatrie, Band 25, Nr. 1/2011, S. 9–15 Gedächtnisambulanzen in Österreich – Charakteristika und diagnostisch-therapeutische Praxis Michael Rainer1, 2, Christine Krüger-Rainer1, Florence Eidler2, Peter Fischer2 und Josef Marksteiner3 Karl Landsteiner Institut für Gedächtnis- und Alzheimerforschung und Memory Clinic Psychiatrische Abteilung SMZOst 3 Psychiatrisches Krankenhaus Hall in Tirol 1 2 Schlüsselwörter: Gedächtnisambulanz – Demenzscreening – Österreich Keywords: memory clinics – cognitive screening – psychiatric primary care – Austria Gedächtnisambulanzen in Österreich – Charakteristika und diagnostisch-therapeutsiche Praxis Anliegen: Erstellung einer Querschnittsübersicht der Gedächtnisambulanzen („Memory-Kliniken“) in Österreich, ihrer Ausstattung, der diagnostischen und therapeutischen Programme sowie der Patientenfrequenz. Methode: Im Frühjahr 2009 nahmen 27 der 29 österreichischen Gedächtnisambulanzen an einer telefonischen Befragung auf der Basis eines standardisierten Fragenkataloges teil. Ergebnisse und Schlußfolgerungen: Die Zahl der Memory-Kliniken hat seit der Gründung des ersten Institutes 1987 fast linear zugenommen; in der großen Mehrzahl (85%) werden sie von Bundesländern und/oder Gemeinden finanziert. Sie werden nicht nur von Patienten und deren Angehörigen sondern auch von der Ärzteschaft als Anlaufstelle für kognitive Probleme © 2011 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 gesehen; 57% der Erstkontakte wurden von einem praktischen Arzt oder einem Facharzt zugewiesen. Die psychometrischen Werkzeuge zur Feststellung von kognitiven und depressiven Störungen entsprechen dem Stand der Wissenschaft. Neben labormedizinischen Untersuchungen sind auch bildgebende Verfahren überwiegend obligate Bestandteile des Diagnoseprogramms. Im therapeutischen Bereich ist psychosoziale Beratung das dominierende Einzelangebot (44%), dem gegenüber treten kognitives Training (15%) und Angehörigengruppen mit oder ohne Trainingskursen (6% bzw. 23%) zurück. Es besteht fast durchgängiges Interesse an einer organisierten Zusammenarbeit der Gedächtnisambulanzen im deutschsprachigen Raum. Memory clinics in Austria – characteristics and patterns of practice Objective: To compile a cross-sectional overview of Austria‘s Memory Clincs, their staffing, diagnostic and therapeutic programs, and their acceptance and use. Methods: In April and May 2009 27 out of the 29 Austrian Memory Clinics participated in a telephone survey based on a standardized questionnaire. Results and Conclusions: The number of Austrian Memory Clinics has risen in an essentially linear fashion between 1987 and 2009. A large majority (85%) had public sponsors. The fact that 57% of all patients seen at these institutions had been referred by their physician (while 25% were self-referrals) illustrates that Memory Clinics enjoy considerable acceptance and reputation among physicians, patients and caregivers. The psychometric tools that are employed conform to the state of the art in depression and cognitive screening in this type of population. In the large majority of Memory Clinics blood chemistry, cell counts, and medical imaging is mandatory, and frequently includes cerebral SPECT or PET radioimaging. Psychosocial counseling was the single most frequent therapeutic program feature (44%), followed by cognition training (15%) and caregiver counseling groups with or without explicit training (6% and 23%, resp.). Interest in a potential cross-border collaboration of Memory Clinics in German-speaking countries is almost universal. Einleitung Gedächtnisambulanzen (in Anlehnung an den internationalen Sprachgebrauch oft auch im deutschen Sprachraum als “Memory-Kliniken” bezeichnet) stellen für eine große Zahl von Personen mit objektiv bestehenden oder subjektiv empfundenen Gedächtnisproblemen die hauptsächliche Anlaufstelle für neuropsychiatrische und psychologische Erstbeurteilung dar. Bereits 1981 for- M. Rainer et al. derte die WHO (1) die Einrichtung von ambulanten Anlaufstellen zur Frühdiagnose von psychischen Erkrankungen im Alter. In Europa wurde die 1. Memory Clinic in London durch den Geriater Exton-Smith,1983 (2) und in weiterer Folge 1985 und 1986 in München und Basel weitere Memory Kliniken gegründet. Gründe für die Entstehung von Memory Kliniken waren die Unzufriedenheit von Familienmitgliedern von Dementen über den weit verbreiteten diagnostischen und therapeutischen Nihilismus und das Gefühl von den Ärzten mit ihren Anliegen nicht ernst genommen zu werden. Außerdem bestand in den 80iger Jahren noch kein ausreichendes Bewusstsein über die Dimensionen des Demenzproblems in der Ärzteschaft und Öffentlichkeit. Memory Kliniken sind ein sinnvoller Beitrag zu einem besseren Versorgungskonzept und sie spielen eine zunehmende bedeutsamere, ergänzende Rolle in der ambulanten Versorgung Demenzkranker und ihrer Angehörigen. Es konnte dokumentiert werden, dass im Bereich der ambulanten (hausärztlichen) Versorgung eine Frühdiagnose zumeist nicht stattfindet, und dass dafür neben der fehlenden Fachkompetenz auch Aspekte, wie Nihilismus bzw. das Stigma der Demenzdiagnose eine Rolle spielen (3 ,4). Eine Stigmatisierung nimmt nicht nur mit der vermuteten „Psychiatrienähe“, sondern nimmt mit Umfang und Qualität des Angebotes für die Kranken ab – was uns für die Zukunft optimistisch stimmt (5). Entscheidende Kennzeichen für Gedächtnissprechstunden sind neben der Kompetenz und dem Bestreben, eine Frühdiagnose durchzuführen, Interdisziplinarität, das Angebot von psychosozialen Maßnahmen, Angehörigenberatung, Initiierung von Fort- und Weiterbildungsangeboten, sowie die Teilnahme an klinischen Forschungsprojekten (6). In seltenen Fällen wurden auch spezielle Ferienund Freizeitangebote für Demenzkranke und Angehörige von Memory Kliniken entwickelt (7). Wie im übrigen Europa haben diese Einrichtungen auch in Österreich eine äußerst dynamische Entwicklung ge- 10 nommen. Die vorliegende Arbeit stellte sich zur Aufgabe, einen Überblick über die Struktur dieser Institutionen, die von ihnen angebotenen Leistungen und Charakteristika ihrer diagnostischen und therapeutischen Praxis zu vermitteln. Material und Methode Insgesamt wurden 29 medizinische Einrichtungen identifiziert die sich als „Memory Klinik“ bzw. „Gedächtnisambulanz“ auswiesen. Im April und Mai 2009 wurden diese kontaktiert und der/die Administrator(in) ersucht sich einem telefonischen Interview auf der Basis eines standardisierten Fragenkataloges zu unterziehen. In dem Fragekatalog wurden neben dem Namen der Institution und des Leiters auch der Träger bzw. Sponsor und der Gründungszeitpunkt dokumentiert. Personelle Ausstattung und Interdisziplinarität wurde durch Befragung der mitwirkenden Spezialisten und Personengruppen (Psychiater, Neurologen, Geriater, Psychologen, Sozialarbeiter, Pflegepersonal und andere) erhoben. Zur Erhebung der patientenbezogenen Daten und der Anzahl der Kontakte wurde nach der Anzahl der Ambulanztage pro Woche, der zuweisenden Stellen, der Zahl der pro Jahr gesehenen Erstkontakte und Folgekontakte, der durchschnittlichen Patientenwartezeit bis zum Erstkontakt, der durchschnittlichen Dauer des Erstkontaktes, der durchschnittlichen Zahl der geplanten Folgekontakte und der Qualifikation der für den Erstkontakt verantwortlichen Fachkraft (Assistenzarzt, Facharzt, Psychologe) gefragt. Auch die Befragung der Diagnostik nahm einen besonderen Stellenwert ein. So wurden die obligaten Screeningstests (MMSE, Uhrentest, DEMTECT, CERAD, SIDAM, TMT, Wortflüssigkeitstests) die verwendeten Depressionsskalen (SGDS, Beck´sches Depressionsinventar), der Verwendung des Hachinskiscore, die obligaten bildgebenden Verfahren, Elektrophysiologie und die Laboruntersuchungen dokumentiert. Ob die Diagnose dem Patienten oder dem Angehörigen, als auch dem Zuweiser mitgeteilt würde, war ebenfalls eine wichtige Fragestellung. Darüber hinaus wurden noch die psychosozialen Leistungen, wie kognitives Training, Angehörigengruppen oder Kurse, psychosoziale Beratung oder anderen Angebote erhoben. Weiters interessierte uns, ob Datenbanken verwendet werden, welche Kommentare und Verbesserungsvorschläge vorliegen würden und ob ein Interesse an einem Verband deutschsprachiger Memory Kliniken bestünde. Ergebnisse Von den 29 kontaktierten Institutionen beteiligten sich 27 an der Befragung. Sie wurden zu fast gleichen Teilen von Neurologen (52%) und Psychiatern (48%) geleitet, und mehrheitlich (52%) von Gemeinden finanziert, in 33% vom jeweiligen Bundesland. Fünfzehn Prozent hatten andere Sponsoren. Abbildung 1 zeigt die nahezu lineare Entwicklung der Zahl der österreichischen Memory-Kliniken seit 1987 (n=absolute Anzahl). Psychiater, Psychologen und Pflegepersonal waren die drei am stärksten vertretenen Berufsgruppen, gefolgt von Neurologen und Sozialarbeitern. In all diesen Fällen waren mindestens ein Drittel der Kräfte nur stundenweise beschäftigt; die genannte Reihenfolge veränderte sich jedoch auch bei jeweils ausschließlicher Betrachtung der volloder teilzeitbeschäftigten Personen nicht (Abb. 2). Fast die Hälfte der 27 befragten Institutionen (n=13) hatten nur einen Tag pro Woche Betrieb, diejenigen mit 5 Ambulanztagen pro Woche stellten jedoch die zweitstärkste Gruppe (n=6). Die restlichen hatten 2 Tage (n=5) oder 3 Tage (n=2) geöffnet, in einem Fall nur bei Bedarf. Den Patienten, deren Zuweisungen ein zwischen Praktischen Gedächtnisambulanzen in Österreich – Charakteristika und diagnostisch-therapeutische Praxis 11 Ärzten, Fachärzten und selbstinitiierten bzw. durch Angehörige veranlassten Kontakten fast gleich verteiltes Bild ergeben (Tab. 1), stehen somit Angebote in recht unterschiedlicher Frequenz zur Verfügung. Die Wartezeit ab Anmeldung schwankte zwischen 2 und 8 Wochen, nur in einem Fall wurden 12 Wochen angegeben. Abbildung 1: Lineare Entwicklung der Zahl der österreichischen Memory-Kliniken seit 1987 (n=absolute Anzahl) Ziemlich genau die Hälfte (51%) der Memory-Kliniken hatten durchschnittlich höchstens 100 Erstkontakte pro Jahr. Für Erstkontakte stand in der Mehrzahl der Institutionen (56%) durchschnittlich eine Stunde Zeit zur Verfügung, 19% gaben 30 Minuten an, 18% wandten dafür 2-3 Stunden auf oder gaben an sich den Vorgestellten nach Bedarf zu widmen. Erstkontakte wurden in allen Memory-Kliniken von einem Facharzt durchgeführt, entweder von diesem allein (n=7) oder mit einem Assistenzarzt (n=6), meist aber unter Hinzuziehung eines Psychologen (n=14). Fast die Hälfte gab an Folgekontakte nicht explizit zu planen, sondern diese kontinuierlich (19%) oder nach Bedarf (26%) anzubieten. Die übrigen Institute sahen ein Schema mit einem oder zwei (je 22%) oder drei (11%) Folgekontakten vor. Diagnostik Abbildung 2: In österreichischen Memory-Kliniken voll- bzw. teilzeitbeschäftigte Berufsgruppen (p.A.= praktischer Arzt, n= absolute Anzahl) Zuweisungsquelle Anteil Praktischer Arzt 29% Facharzt 28% Pflegeheim 10% Selbsthilfegruppe 8% Eigeninitiative 25% Tabelle 1: Initiatoren der Zuweisungen zu österreichischen Memory-Kliniken In allen Zentren kamen Kombinationen zweier oder mehrerer kognitiver Screeningtests zum Einsatz, wobei die Mehrzahl das Mini-Mental State Exam [8] (n=22) und den Uhrentest [9] (n=23) durchführte. Auch die gesamte CERAD-Testbatterie [10] (die neben dem MMSE und dem Wortflüssigkeitstest noch 5 weitere Untertests umfaßt) wurde häufig verwendet (n=15). Die Kurzform der geriatrischen Depressionsskala (SGDS) und das Beck‘sche Depressionsinventar waren mit 52% bzw. 37% die verbreitetsten Werkzeuge zur Diagnose von depressiven Zuständen. Nur 16 der 25 diesbezüglich Auskunft gebenden Memory-Kliniken wandten den Hachinski-Score zur Differenzie- M. Rainer et al. rung degenerativer und vaskulärer Demenzen an. Bei den bildgebenden Verfahren zeigte sich wie erwartet ein mit zunehmender apparativer Komplexität der betreffenden Techniken abnehmender Grad der obligaten Anwendung (n= absolute Anzahl) (Abb. 3). Die Erfassung von Blutbild und Blutchemie (im Hause oder durch Zuweisung an ein externes Labor) war an allen außer zwei Kliniken obligat. En- 12 dokrine und mikronutrielle ScreeningParameter (TSH, Kobalamin/Folsäure) [11] erfreuten sich einer etwas geringeren obligatorischen Implementation; Serodiagnostik infektiöser Krankheiten wurde von der Hälfte der Antwortenden nicht oder nur bei Verdacht durchgeführt (Abb. 4). Elektrophysiologie war ebenfalls kein universell eingesetztes Werkzeug: Nur 16 bzw. 17 Institute nahmen ein Elektrokardiogramm bzw. Enzephalogramm auf oder wiesen dafür die Patienten einer externen Stelle zu. Diagnosen wurden ausnahmslos sowohl dem zuweisenden bzw. betreuenden Arzt mitgeteilt als auch den betroffenen Patienten und deren Angehörigen im Rahmen eines gemeinsamen Gespräches. Drei Institutionen führten darüber hinaus noch explizite Patienteninformation durch. Bemerkenswerterweise deklarierten nur 22% der Institute die durchgehende Verwendung einer Datenbank zur systematischen Erfassung, Dokumentation und Analyse der quantitativen Patientenwerte. Während 19% ein solches System in Teilbereichen einsetzten, verwendeten 59% überhaupt keines. Psychosoziales Leistungsangebot Wie erwartet ergab sich hier durch Mehrfachangaben eine unübersichtliche Situation, jedoch war psychosoziale Beratung das dominierende Einzelangebot (44%), dem gegenüber traten kognitives Training (15%) und Angehörigengruppen mit oder ohne Trainingskursen (6% bzw. 23%) klar zurück. Abbildung 3: Bei den bildgebenden Verfahren zeigte sich wie erwartet ein mit zunehmender apparativer Komplexität der betreffenden Techniken abnehmender Grad der obligaten Anwendung (n=absolute Anzahl) Interesse an Kooperation Nicht weniger als 81% der antwortenden Institute erklärten, an der Teilnahme an einer Vereinigung deutschsprachiger Memory-Kliniken ohne Einschränkungen interessiert zu sein; bei 15% war das Interesse an Voraussetzungen geknüpft und die restlichen 4% lehnten ein Mitmachen ab. Diskussion Abbildung 4: Verwendete Labortests und ihre interne bzw. externe Durchführung, (n= absolute Anzahl) Die 1980 erstmals beschriebenen Gedächtnisambulanzen gelten als ein entscheidender Baustein in Systemen zur frühzeitigen Erkennung und Behandlung von Demenzsyndromen [4,6] und sind – wie eine Analyse des britischen National Dementia Service gezeigt hat – auch gesundheitsökonomisch effizi- Gedächtnisambulanzen in Österreich – Charakteristika und diagnostisch-therapeutische Praxis ent [12]. Ähnliche Untersuchungen mit Fragebögen wurden bereits von Bucks, 1999 durchgeführt (13), Fragebögen wurden an 28 Memory Kliniken in Nordamerika, Großbritannien, Europa und Australien versendet. Davon wurden 68% der Fragebögen retourniert. Wesentlicher Unterschied gegenüber unserer Befragung war, dass die Memory Kliniken international überwiegend von Geriatern (32%) und weniger oft von Neurologen (21%) und Psychiatern (21%) und Psychologen (1,5%) geleitet wurden. Die Leitung der Memory Kliniken ausschließlich durch Neurologen oder Psychiater stellt international gesehen eher eine Ausnahme darf. Die personelle Ausstattung ist in den international befragten Memory Kliniken zumeist besser, da auch noch andere Berufsgruppen, wie Geriater, andere Ärzte, Sprachtherapeuten und Arbeitstherapeuten im Team mitarbeiten. Die angebotenen Untersuchungsmethoden, Anzahl der geöffneten Tage und die Patientenfrequenz entspricht in etwa den österreichischen Daten, wobei ganz wenige Zentren auch über 1000 Patienten pro Jahr untersuchen. Im Gegensatz zu Österreich gibt es nur in Nordamerika und in Großbritannien spezielle, von der pharmazeutischen Industrie gesponserte Memory Kliniken. In Deutschland wurden im Jahr 2003 insgesamt 41 Gedächtnisambulanzen zur Organisation, Diagnostik und Therapieangeboten befragt (14). Dabei zeigte sich, dass ein einheitlicher Standard zur Betreuung von Demenzerkrankten fehlte. Daraus resultieren Probleme der Qualitätssicherung und Finanzierung. Die Schweiz verfügte im Vergleich zu den anderen Ländern über ein flächendeckenderes und intensiveres Versorgungskonzept, das auch angemessen vergütet wird. Die Forderung nach Richtlinien und einheitlichen Qualitätsstandards war einer der wichtigsten Ergebnisse dieser Befragung. Interessant war hierbei, dass sowohl in Österreich, als auch in der Schweiz bereits Therapieangebote durch Memory Kliniken vorhanden waren, während in Deutschland nur 25 von 41 Einrich- tungen eine Therapie anboten. Auch die Angehörigenbetreuung ist in der Schweiz ein integraler Bestandteil der Memory Klinik-Arbeiten (9 von 10 Einrichtungen bieten diese an), während in Deutschland nur 2/3 derartige Angebote stellten. Die Patientenanzahl bewegte sich in den befragten Memory Kliniken zwischen 30 und 750 pro Jahr und ist damit mit der Situation in Österreich durchaus vergleichbar. Anzumerken ist, dass im Jahr 2003 von den österreichischen Memory Kliniken nur eine einzige an dieser Evaluierung teilnahm. Insofern stellte unsere erstmals durchgeführte österreichische Befragung der Memory Kliniken einen wesentlichen Beitrag zur Erfassung der Arbeitsweisen österreichischer Gedächtnisambulanzen dar. Ein Vergleich zur Anzahl der Gedächtnisambulanzen in Deutschland und der Schweiz zeigt, dass Österreich zwar spät mit der Implementierung derartiger Gedächtnisambulanzen begonnen hat, es aber einen rasanten Entwicklungsprozess in den letzten Jahren gegeben hat. So liegt Österreich mittlerweile mit seinen 29 Einrichtungen bezogen auf die Einwohneranzahl sogar an 1. Stelle im deutschsprachigen Raum. Aktuelle Zahlen zur Situation in der Schweiz gibt es vom letzten 11. deutschsprachigen Memory Klinik-Treffen im SMZ-Ost vom Mai 2009. In Deutschland liegen nach einem Bericht von Dirk Wolter unterschiedliche Zahlen durch das Alzheimerforum, die Deutsche Alzheimergesellschaft und die Hirnliga vor. Addiert man jedoch die unterschiedlichen Zahlen, so existieren derzeit in Deutschland ca. 150 Gedächtnissprechstunden. 2004 dürften es noch nach Angaben der Deutschen Hirnliga um die 90 gewesen sein. Nach Andreas Monsch gab es in der Schweiz im Jahr 2006 16 Memory Kliniken, wobei auch hier die Anzahl kontinuierlich seit Anfang der 90iger Jahre von damals 2 Institutionen angestiegen ist. Obwohl es uns nicht möglich war eine Analyse nach formellen Qualitätsindikatoren für Memory-Kliniken durchzuführen, wie sie vor kurzem vorgeschla- 13 gen wurden [15], zeigt doch schon die Durchsicht der erhobenen Daten, dass die schnelle Verbreitung solcher Institutionen in Österreich ab den 1990er Jahren unter Einhaltung hoher Qualitätskriterien erfolgt ist. Auffällig in unserer Untersuchung war die Heterogenität der Einrichtungen bezüglich der Personalausstattung, der diagnostischen Verfahren, der psychosozialen Angebote und der Einbindung oder Angliederung an größere Kliniken. Gedächtnisambulanzen in Universitätskliniken sind zumeist Forschungsreinrichtungen bei denen die Diagnostik dementieller Syndrome im Vordergrund steht und bei denen Patienten oftmals für Forschungsprojekte rekrutiert werden. Die Finanzierung erfolgt zumeist über Forschungsgelder, sodass psychosoziale Therapieprojekte meist weniger oft durchgeführt werden. Die Ausstattung mit psychiatrischneurologischem und psychologischem Fachpersonal entspricht den Erwartungen. Dass 57% der Erstkontakte vom behandelnden praktischen Arzt oder einem Facharzt zugewiesen wurden, belegt die Akzeptanz der Gedächtnisambulanzen in der niedergelassenen Ärzteschaft. Im kognitiven Screening wird überwiegend der Mini-Mental State Examination gemeinsam mit dem Uhrentest eingesetzt, eine schnell und einfach durchzuführende Testkombination, die gerade in Gedächtnisambulanzen frühe und mittelgradige Alzheimer-Demenz effizient erfassen kann [16,17]. Eine spezielle Gedächtnistestung wird jedoch nur in 24% der befragten Gedächtnisambulanzen als Teil einer Testbatterie durchgeführt. Die verwendeten Depressionsskalen sind adäquat. Dass der Hachinski-Score, der eine erste vorläufige Differenzierung zwischen möglicher Alzheimer‘scher Krankheit und Multiinfarkt-Demenz erlaubt, nur teilweise angewandt wird, hat wohl einerseits mit dem Charakter von Gedächtnisambulanzen als erste klinische Anlaufstelle für Gedächtnisprobleme zu tun, andererseits mit der mangel- M. Rainer et al. haften Definition und Evaluierung dieser Skala [18]. Auch bei der nicht durchgängigen Verwendung der Elektrophysiologie wird man vom Bestehen ähnlicher Überlegungen ausgehen können. Bei den bildgebenden Verfahren zeichnet sich ein erfreulicher Trend zu fortgeschrittenen Methoden ab. Kernspinresonanz ist bereits fast so verbreitet wie Röntgen-Computertomographie. Die nuklearmedizinischen Methoden (Szintillationstomographie und sogar die aufwändige Positronen-Emissionstomographie als empfindlichste Erfassungsmethode für den lokalen zerebralen Glukosemetabolismus) werden von einem erheblichen Teil der Zentren obligat verordnet. Dass SchilddrüsenScreening durch Bestimmung von TSH von vier Zentren nicht obligat durchgeführt wird, scheint hingegen angesichts der Zusammenhänge zwischen Hypothyreose und Neigung zu kognitiver und depressiver Symptomatik [19,20] diskussionswürdig zu sein. Unbefriedigend erscheint weiters, dass zwei Zentren allgemeine Labordiagnostik (Blutbild, Blutchemie) nicht als obligat ansehen. Somit wird auf quantitative Hinweise die auf Allgemeinerkrankungen, die eine Demenz vortäuschen können, gänzlich verzichtet. Wodurch unterscheiden sich Memory Kliniken von spezialisierten Facharztordinationen? Patienten und deren Angehörige haben ein Recht auf eine verlässliche Diagnostik. Auf der Grundlage der Diagnose geben die meisten Memory Kliniken Therapieempfehlungen und viele Memory Kliniken leiten die Behandlung selbst ein, einige führen auch die Therapie selbst weiter. Eine Erfolgskontrolle wird von den Memory Kliniken zumeist angeregt oder selbst durchgeführt. Da diese Aufgaben sehr zeitaufwendig sind, können sie im Rahmen einer multidisziplinär geführten Memory Klinik zumeist besser durchgeführt werden, als in den Facharztordinationen. Durch das multidisziplinäre Team einer Memory Klinik wird zumeist versucht, ein bestmögliches 14 „Casemanagement“ zu erreichen. Eine suffiziente Angehörigenbetreuung, zu der neben Angehörigeninformationsabenden, Angehörigengruppen, auch spezielle Trainingskurse für Angehörige gehören, zählen ebenso zu den Aufgaben mancher Memory Kliniken, wie die Durchführung von speziellen Fortbildungsveranstaltungen und eine breite Öffentlichkeitsarbeit. Die Einbindung von Patienten in neueste medikamentöse Studien erweitert die therapeutischen Optionen. Damit tragen die Memory Kliniken auch wesentlich zur noch immer notwendigen Enttabuisierung und Entstigmatisierung der Demenzerkrankungen bei. Memory Kliniken sehen sich somit als wichtiges Bindeglied zwischen Praxis und Wissenschaft. Vier Fünftel der antwortenden 27 Gedächtnisambulanzen zeigten lebhaftes und unbedingtes Interesse an institutionalisierter, grenzüberschreitender Zusammenarbeit im deutschsprachigen Raum. Das Treffen der deutschen, Schweizer und österreichischen Memory-Kliniken Ende Mai 2009 in Wien hat diesen Wünschen durch Diskussion möglicher Organisationsformen bereits Rechnung getragen. Es ist zu hoffen, dass sich diese Zusammenarbeit auch auf gemeinsame Empfehlungen zur Standardisierung der Patientendokumentation (die derzeit nur bei 22% der österreichischen Institute mittels systematisch geführter Datenbank erfolgt) erstrecken wird; dies würde eine vertiefte wissenschaftliche Auswertung der Arbeit der Gedächtnisambulanzen erlauben. Großteils bestand Konsens zu den typischen Merkmalen einer Memory Klinik, zu denen neben Kompetenz, Frühdiagnose, Therapien, Beratung und psychosozialen Maßnahmen auch Angehörigenberatung, Interdisziplinarität und Forschung gehören [7]. Die im Juli 2009 in Wien, mit Unterstützung von Alzheimer Europe, erfolgte Gründung der EMCA (European Memory Klinik Association) unterstreicht die Bedeutung ambulanter Spezialeinrichtungen für die Diagnose und Behandlung von Demenzkranken. Nachsatz Es besteht kein Interessenskonflikt. Literatur [1] WHO Bureau régional de l’Europe: La gérontopsychiatrie dans la collective. La Santé publique en Europe 10, Kopenhagen: 1981. [2] Van der Cammen T.J.M., Simpson J.M., Fraser R.M., Preker A.S., Exton-Smith A.N. A network of memory clinics: when and how? The Lancet Neurology 7: 663 (2008) [3] The Memory Clinic: A new Approach to the Detection of Dementia. Br J Psychiatry, 150: 359-364 (1987) [4] Stoppe G, Haak S, Knoblauch A, Maeck L: Diagnosis of dementia in primary care: a representative survey of family physicans and neuropsychiatrists in Germany. Dement Geriatr Cogn Disord 2007; 23: 207-214 [5] Waldemar G, Phung KT, Burns A, Georges J, Hansen FR, Iliffe S, Marking C, Rikkert MO, Selmes J, Stoppe G, Sartorius N. Access to diagnostic evaluation and treatment for dementia in Europe. Int J Geriatr Psychiatry 22(1): 47-54 ( 2007) [6] Vernooij-Dassen MJ, Moniz-Cook ED, Woods RT, De Lepeleire J, Leuschner A, Zanetti O, de Rotrou J, Kenny G, FrancoM, Peters V, Iliffe S: Factors affecting timely recognition and diagnosis of dementia across Europe: from awareness to stigma. Int J Geriatr Psychiatry 2005; 20: 377-386 [7] Jolley D, Benbow SM, Grizzell M. Memory clinics. Postgrad Med J. 82(965): 199-206 (2006) [8] Stoppe G. Bedeutung der Memory-Kliniken/Gedächtnisambulanzen. Psychiatrie1: 1-4 (2009) [9] Mitchell AJ. A meta-analysis of the accuracy of the mini-mental state examination in the detection of dementia and mild cognitive impairment. J Psychiatr Res 43(4): 411-31 (2009) [10] Shulman KI. Clock-drawing: is it the ideal cognitive screening test? Int J Geriatr Psychiatry 15(6): 548-61 (2000) [11] Satzger W, Hampel H, Padberg F, Bürger K, Nolde T, Ingrassia G und Engel RR. Zur praktischen Anwendung der CERAD-Testbatterie als neuropsychologisches Demenzscreening. Der Nervenarzt 72(3): 196-203 (2001) [12] Annerbo S, Wahlund LO, Lökk J. The significance of thyroid-stimulating hormone and homocysteine in the development of Alzheimer‘s disease in mild Gedächtnisambulanzen in Österreich – Charakteristika und diagnostisch-therapeutische Praxis [13] [14] [15] [16] cognitive impairment: a 6-year followup study. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 21(3): 182-8 (2006) (Kein Autor genannt) A network of memory clinics: when and how? The Lancet Neurology 7: 663 (2008) Bucks R.S., Byrne M.T., Wilcock G.K., Rockwood K. A survey of the Memory Disorder Teams represented by the contributors. In Wilcock G. Diagnosis and management of dementia. Oxford University Press: 374-385 (1999) Aguirreche E, Zeppenfeld G, Kolb G.F. Gedächtnissprechstunden: “MemoryKliniken” im deutschsprachigem Raum. Z. Gerontol Geriatr 36: 183-188 (2003) Draskovic I, Vernooj-Dassen M, Verhey F, Scheltens P, Rikkert MO. Develop- [17] [18] [19] [20] ment of quality indicators for memory clinics. Int J Geriatr Psychiatry 23: 119128 (2008) Brodaty H, Moore CM. The Clock Drawing Test for dementia of the Alzheimer‘s type: A comparison of three scoring methods in a memory disorders clinic. Int J Geriatr Psychiatry 12(6): 619-27 ( 1997) Harvan JR, Cotter V. An evaluation of dementia screening in the primary care setting. J Am Acad Nurse Pract 18(8): 351-60 (2006) Pantoni L, Inzitari D. Hachinski‘s ischemic score and the diagnosis of vascular dementia: a review. Ital J Neurol Sci 14(7):539-46 (1993) Arem R, Cusi K. Thyroid function testing in psychiatric illness: Usefulness 15 and limitations. Trends Endocrinol Metab 8(7): 282-7 (1997) [21] Davis JD, Tremont G. Neuropsychiatric aspects of hypothyroidism and treatment reversibility. Minerva Endocrinol 32(1): 49-65 (2007) Michael Rainer Karl Landsteiner Institut für Gedächtnis- und Alzheimerforschung und Memory Clinic Sozialmedizinisches Zentrum Ost [email protected] Neuropsychiatrie, Band 25, Nr. 1/2011, S. 16–25 Original Original Relabilität und Übereinstimmungsvalidität der deutschen Version der Young Mania Rating Scale (YMRS-D) Moritz Mühlbacher1, Christoph Egger1, Patrick Kaplan1, Christian Simhandl2, Heinz Grunze3, Christian Geretsegger1, Alexandra Whitworth1 und Christoph Stuppäck1 Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie I, Paracelsus Privatmedizinische Universität, Salzburg, 2 Bipolar Zentrum, Wiener Neustadt 3 Institute of Neuroscience, University of Newcastle upon Tyne 1 Schlüsselwörter: Young Mania Rating Skala – Übersetzung – – Reliabilität deutsch - – Validierung Änderungssensitivität Key words: Young Mania Rating Scale – translation – german – validity- reliability – sensitivity to change Reliabilität und Übereinstimmungs validität der deutschen Version der Young Mania Rating Scale (YMRSD) Anliegen: Die Young Mania Rating Skala (YMRS) stellt die weltweit meistverwendete Ratingskala zur Beurteilung und Quantifizierung manischer Symptome dar. Bisher stand noch keine validierte deutschsprachige Version zur Verfügung. Methoden: Die Originalskala wurde ins Deutsche übersetzt (YMRS-D) und ihr Gebrauch im Alltag an zwei österreichischen Kliniken an 81 manischen Patienten getestet. Die Interviews wurden in Paaren von je zwei Interviewern durchgeführt, zusätzlich erfolgte © 2011 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 zur Bestimmung der Übereinstim­ mungsvalidität eine Beurteilung des Schweregrads durch einen Erfahrenen Senior-Rater mit Hilfe der CGI-BP Skala. Resultate: Es zeigte sich eine hohe Inter-Rater Reliabilität mit ICCWerten von 0.94 für den Gesamtscore und zwischen 0.79 and 0.97 (alle p<.001) für die einzelnen Items, sowie eine gute Korrelation von YMRSGesamtscore und CGI-BP Werten (Spearman Rank Korrelation, r=0.91, p<.001). Die Analyse der internen Konsistenz der Skala ergab einen Wert von 0.74 (Cronbachs Alpha). Zur Bestimmung der Änderungssensitivität wurden die Interviews an 20 Patienten nach 3 Wochen wiederholt, wobei sich ebenfalls eine gutausgeprägte Korrelation zwischen Veränderungen des YMRS-D Scores und an der CGIBP Skala zeigte (r = –0,953; p<.0005). Zusammenfassung: Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass die deutschsprachige YMRS-D eine valide reliable und änderungssensitive Testskala zur Beurteilung und Quantifizierung manischer Symptome darstellt. Reliability and concordance validity of a german version of the Young Mania Rating Scale (YMRS-D) Objective: The Young Mania Rating Scale (YMRS) is the most widely used assessment tool for severity of manic symptoms in bipolar patients. While the original English version has been translated to various different languages, a validated German translation of YMRS has not yet been available. Methods: We translated the original English version to German (YMRS-D) and tested its use in clinical practice in 81 manic inpatients at two different psychiatric hospitals in Austria. The interviews were carried out by eight experienced and trained psychiatrists in random pairs of two interviewers. In order to assess concordance validity of YMRS-D, all patients were simultaneously rated using the Clinical Global Impression Rating Scale, Bipolar Version (CGIBP), by one of three experienced senior raters. Results: Inter-Rater Reliability was assessed calculating the Intra-Class Correlation Coefficient and showed high values (between 0.79 and 0.97, all p<.001) in all items of the German Rating Scale. Internal Consistency analysis of the scale yielded a value of .74 (Cronbach’s Alpha). Spearmans rank correlation coefficient for the total scores of CGI-BP and YMRS-G was Relibilität und Übereinstimmungsvalidität der deutschen Version von Young Mania Rating Sale (YMRS-D) high (0.91, p<.001), suggesting good concordance validity of YMRS-D. Sensitivity to change was assessed in a subgroup of 20 patients by comparing YMRS-D and CGI-BP total scores at inclusion and at an additional interview three weeks later which showed a highly significant correlation (r = –0,953; p<.0005). Conclusions: The German version of YMRS seems to be a valid, reliable and useful tool for the assessment and quantification of manic symptoms. Einleitung Bipolare Erkrankunken sind hoch rezidivierende, unter-diagnostizierte und unterbehandelte psychische Erkrankungen. Die klassische Verlaufsform (Bipolar Typ I) hat eine Lebenszeitprävalenz von etwa 1%, die Gesamtheit der Bipolar- Spektrum Erkrankungen bis zu 5 Prozent [6]. Manische oder hypomanische Symptome sind definierende Charakteristika der Erkrankung und führen häufig zu Komplikationen wie Enthemmung bei gestörter Impulskontrolle und Störung kognitiver Funktionen[9]. Während der letzten Jahrzehnte wurde verschiedene Testskalen zur Erfassung und Quantifizierung manischer Symptome entwickelt [2,8,3]. Die Young Mania Rating Scale (YMRS) [14] wurde 1978 eingeführt, gilt heute als Standard zur Bestimmung des Schweregrads manischer Symptome von bipolaren Patienten und wird regelmäßig als Referenzskala in kontrollierten klinischen Studien verwendet. Sie ist in Art und Form weitgehend an die „Hamilton Rating Scale for Depression“ (HDRS) angelehnt und besteht aus 11 Items (gehobene Stimmung, gesteigerte motorische Aktivität, sexuelles Interesse, Schlaf, Reizbarkeit, Sprechweise, Sprachund Denkstörungen, Denkinhalte, expansiv-aggressives Verhalten, äußere Erscheinung und Krankheitseinsicht), die anhand der klinisch relevanten publizierten Kernsymptome der Manie ausgewählt wurden. Vier Items (Reizbarkeit, Sprechweise, Sprach- und Denkstörungen, expansivaggressives Verhalten) werden auf einer Punkteskala von 0 bis 8 bewertet, während die restlichen 7 Items Punktewerte von 0-4 erzielen können. Die Beurteilung basiert einerseits auf den subjektiven Aussagen der Patienten über Empfinden und klinischen Gesamtzustand während der letzten 48 Stunden, andererseits wird zusätzliche Information durch den Interviewer anhand des klinischen Eindrucks während des Interviews gewonnen. Die Stärken der YMRS liegen in ihrer Kürze, der vergleichsweise einfachen Handhabung, der großen Akzeptanz und ihrer weiten Verbreitung. Eine mögliche Einschränkung der Reliabilität könnte durch das teilweise Einbeziehen subjektiver Aussagen des Patienten in die Beurteilung entstehen, da im Rahmen manischer Episoden nicht selten schwerwiegende formale Denkstörungen oder auch produktiv-psychotische Symptome auftreten. Gerade bei schweren manischen Episoden kann daher die Selbstbeurteilung und Rapportfähigkeit der Patienten stark eingeschränkt sein, wodurch in verschiedenen Items, die stärker von subjektiven Aussagen der Patienten abhängig sind, möglicherweise verfälschte Werte erzielt werden. Durch die Doppelgewichtung von vier vorwiegend durch Fremdbeurteilung bestimmten Items und damit der zweifachen möglichen Punktezahl im Vergleich zu anderen Items soll gewährleistet bleiben, dass insgesamt dem Schweregrad der Manie entsprechend hohe Punktewerte erreicht werden. Die YMRS- Skala hat sich weltweit als Referenzstandard für die Beurteilung des Schweregrads manischer Symptome etabliert und wird insbesondere im Rahmen klinischer Studien regelmäßig angewandt. Während YMRS bereits in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde [4,7,5,13] stand eine validierte deutsche Version der Ratingskala bisher noch nicht zur Verfügung. 17 Methoden Übersetzung Die englische Version der YMRS wurde von zwei geprüften Übersetzern zunächst ins Deutsche übertragen. Die resultierenden, geringfügig verschiedenen Versionen wurden verglichen, diskutiert und aufeinander abgestimmt. Die deutsche Version (YMRS-D) wurde danach unabhängig von einem anderen zweisprachigen Übersetzer ins Englische rückübersetzt und auf mögliche Unstimmigkeiten im Vergleich zur englischen Originalversion überprüft. Für alle 11 Items der Skala wurden obligate Leitfragen erstellt. Darüber hinaus sind jedoch wie auch in der englischen Version weitere Fragen gestattet, wenn zusätzliche Informationen notwendig erscheinen, um das Rating durchzuführen. Eine detaillierte Erklärung und Anwendungsanleitung wurden der übersetzten Skala beigelegt. Training der Rater Acht Psychiater aus zwei österreichischen psychiatrischen Abteilungen wurden in einem gemeinsamen RaterTraining in den Gebrauch der Testskala eingeführt. Die einzelnen Items und Beurteilungskriterien wurden ausführlich erklärt und anhand von Videoaufzeichnungen von Interviews mit manischen Patienten demonstriert. Zu Test- und Trainingszwecken wurden danach von einem Trainer Probeinterviews mit mehreren stationären manischen Patienten durchgeführt und von allen acht Ratern unabhängig voneinander mit Hilfe der YMRS-D beurteilt. Die Resultate wurden miteinander verglichen und Unterschiede in der Beurteilung identifiziert und diskutiert. Das Training wurde wiederholt, bis eine maximale Übereinstimmung mit Abweichungen von weniger als 15% erreicht war. M. Mühlbacher et al. 18 Patienten und Methoden Statistische Analyse Resultate In das Rating wurden 81 bipolare Patienten (46 weiblich, 35 männlich) mit einer manischen Episode nach DSM-IV Kriterien im Alter zwischen 18 und 65 Jahren an zwei österreichischen psychiatrischen Klinken einbezogen. Der Schweregrad manischer Symptome wurde mit Hilfe des YMRS-D von jeweils zwei Interviewern gleichzeitig unabhängig von einander beurteilt. Zur Beurteilung der Übereinstimmungsva lidität der YMRS-D Messskala wurde – ähnlich wie bei der ursprünglichen Validierung der englischsprachigen Version [15] - der Schweregrad der manischen Episode am gleichen Tag und unabhängig von einem erfahrenen Senior-Rater mit Hilfe der Clinical Global Impression Scale, Bipolare Version (CGI-BP) beurteilt. Sie gilt als einfaches und effizientes Mittel zur Bestimmung des Schweregrads affektiver Episoden auf einer Skala von 1 bis 7 Punkten bei bipolaren Patienten und besitzt hohe Reliabilität [11]. Eine eigens für die CGI-BP entwickelte detaillierte Anwendungsanleitung erleichtert und standardisiert ihren Gebrauch und sichert höchstmögliche Reliabilität. Neben dem Schweregrad wird bei wiederholten Messungen auch die Veränderung des Zustandes auf einer Skala von 1 bis 7 beurteilt, wobei 1 für die größtmögliche Verbesserung, 7 für die größtmögliche Verschlechterung des Zustands steht. An einer Untergruppe von 20 Patienten (13 weiblich, 7 männlich) wurde die Testung nach 3 Wochen (± 3 Tage) wiederholt, um Veränderungen des YMRS-D und CGI-BP Scores im Krankheitsverlauf festzuhalten und in die Analyse der Änderungssensitivität des Testinstruments einzubeziehen. Die Daten wurden zweifach unabhängig voneinander elektronisch erfasst und auf Abweichungen kontrolliert. Annähernd zwei Prozent der Eingaben wurden als Fehleingaben identifiziert und anhand der Originaldaten korri­ giert. Die Auswertung erfolgte mit dem Statistikprogramm SPSS für Windows Software Version 12.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois). Die Inter-Rater Reliabi­lität wurde mit Hilfe des IntraKlassen Korrelationskoeffizienten (ICC) errechnet, der als bestgeeignetes Maß zur Beurteilung der Reliabilität zwischen zwei Bewertern gilt [1]. Zur Berechnung der internen Konsistenz der Skala wurde Cronbach’s Alpha herangezogen. Die Beurteilung der Übereinstimmungsvalidität erfolgte durch Berechnung des Spearman Rangkorrelationskoeffizienten der Ge­ samtscores von CGI-BP und YMRS-D. Die Grenze der statistischen Signifikanz wurde für beide Tests mit p≤0.05 festgelegt. Demographische und klinische Charkateristika Die demographischen Daten der eingeschlossenen Patienten werden in Tabelle 1 aufgeführt. Die Gruppe setzte sich zu großen Teilen aus Patienten zusammen, die an einer manischen Episode mit oder ohne psychotische Symptome litten, ein geringerer Anteil (8,6 Prozent) erfüllte die DSM-IV Kriterien für Hypomanie. Der mittlere YMRS-D Score aller Patienten war mit 37.2 Punkten im Bereich deutlich ausgeprägter Krankheitssymptome, wobei eine hohe Streuungsbreite (Minimum 17, Maximum 57 Punkte) vorlag. Somit wurde die deutschsprachige Version des YMRS an einem breiten Patientenklientel untersucht, welches das gesamte Spektrum von geringgradig ausgeprägten Episoden bis hin zu schweren manischpsychotischen Phasen umfasste. Alle Demographische und klinische Daten der Testpopulation Anzahl n=81 Geschlecht 46 weiblich 35 männlich Alter (Jahre) Mittelwert 41.2 (Minimum 18, Maximum 62 ) F31.0 :Bipolar affektive Erkrankung, gegenwärtig hypomanische Episode (n=7) Diagnose F 31.1: Bipolar affektive Erkrankung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome (n=41) F31.2: Bipolar affektive Erkrankung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen (n=33) YMRS Score Mittelwert 37.2 (Minimum 17, Maximum 57) Medikation Atypische Antipsychotika (78%) Valproinsäure (56%) Lithium (38%) Carbamazepin (7%) Lamotrigin (8%) Tranquilizer (91%)* * keine Verabreichung von Tranquilizern am Tag des Interviews vor Durchführung der Ratings Tabelle 1: Demographische und klinische Daten der Testpopulation Relibilität und Übereinstimmungsvalidität der deutschen Version von Young Mania Rating Sale (YMRS-D) Patienten befanden sich zum Zeitpunkt der Beurteilung in vollstationärer Behandlung und erhielten medikamentöse Therapie. Diese Bestand in der Regel die Kombination eines „Mood Stabilizers“ (Lithium, Valproinsäure) mit einem atypischen Antipsychotikum (Tabelle 1). Auf die Verabreichung von Tranquilizern wurde am Tag des Interviews jeweils vor Durchführung der Ratings verzichtet, um einen verfälschenden Effekt im Sinne einer Sedierung auszuschließen. Reliabilität In allen Items der YMRS-D zeigte sich eine hohe Übereinstimmung zwischen den Resultaten der verschiedenen Rater, die durchwegs statistische Signifikanz erzielte. Die ICC-Werte lagen zwischen 0.79 und 0.97 (alle p<0.001), mit der besten Übereinstimmung in dem Item „Schlafstörung“ und der geringsten Übereinstimmung im Bereich „Sprechund Denkstörung“ (Tabelle 2). Die Berechung der internen Konsistenz der Skala ergab einen Wert von 0.74 (Cronbach’s Alpha, p< 0.001) für die gesamte Skala. Die einzelnen Items korrelierten gut miteinander und mit dem Gesamtscore. Inter-Rater Reliabilität der YMRS-D ICC Wert (Intra-Klassen Korrelationskoeffizient) Gesamtscore Der Vergleich des Gesamtscores der YMRS-D mit dem Score der ManieSubskala der CGI-BP zeigte eine hohe Korrelation von rs= 0.82 (Spearman Rangkorellationskoeffizent), wobei die Streuung aus den Teilbereichen von YMRS-D zwischen 0.66 und 0.92 (alle p< 0.005) lag. Eine vergleichsweise niedrigere Übereinstimmung mit dem CGI-BP Wert hatten dabei die Aspekte „äußere Erscheinung “ und „Krankheitseinsicht“ (rs= 0.66 bzw. 0.69), während die höchste Korrelation für die Items „Sprechweise“ und „Sprach- und Denkstörung“ gefunden wurde (rs= 0.92 bzw. 0.87). . 0.94 Item 1. Gehobene Stimmung 0.96 2. Gesteigerte Aktivität 0.83 3. Sexuelles Interesse 0.96 4. Schlaf 0.98 5. Reizbarkeit 0.95 6. Sprechweise 0.91 7. Sprach- und Denkstörung 0.79 8. Denkinhalte 0.97 9. aggressive-expansives Verhalten 0.93 10. äußere Erscheinung 0.89 11. Krankheitseinsicht 0.94 Tabelle 2: Inter-Rater Reliabilität der deutschen Version der Young Mania Rating Scale. Intra-Klassen Korrelationskoeffizienten (ICC-Werte) anhand von Messungen an 81 Patienten durch jeweils zwei Rater Übereinstimmungsvalidität der YMRSD-G Spearman Rangkorrelations-koeffizient mit CGI-BP (rs) Gesamtscore YMRS-D Übereinstimmungsvalidität 19 0.82 Item 1. Gehobene Stimmung 0.82 2. Gesteigerte Aktivität 0.78 3. Sexuelles Interesse 0.81 4.Schlaf 0.88 5.Reizbarkeit 0.71 6.Sprechweise 0.92 7.Sprach- und Denkstörung 0.87 8.Denkinhalte 0.80 9.aggressive-expansives Verhalten 0.86 10.äußere Erscheinung 0.66 11.Krankheitseinsicht 0.69 Tabelle 3: Übereinstimmungsvalidität der deutschen Version der Young Mania Rating Scale. Spearman Rangkorrelationskoeffizient anhand von Messungen an 81 Patienten mit YMRS-D und CGI-BP M. Mühlbacher et al. 20 CGI-BP Veränderung 1 = sehr deutlich gebessert 2 = deutlich gebessert 3 /4 = minimal gebessert/keine Veränderung 8 6 6 Minimum 16 8 -2 Maximum 33 10 6 26,6 (6,4) 9,2 (0,75) 2,7 (2,8) 21,3 bis 32,0 8,4 bis 10,0 -0,3 bis 5,6 N YMRS Veränderung Differenz-MW (SA) 95 % Konfidenz­interval für den MW Tabelle 4: Veränderung von CGI-BP und YMRS-D bei 20 Patienten anhand von 2 Messungen im Abstand von 3 Wochen (± 3 Tage). Änderungssensitivität An einer Untergruppe von 20 Patienten wurde das Rating nach 3 Wochen (± 3 Tage) wiederholt. 8 Patienten wurden anhand der CGI-BP Skala „Veränderung im Vergleich zur letzten Untersuchung“ als „1 =sehr deutlich gebessert“ eingestuft, während 6 Patienten als „2= deutlich gebessert“ gesehen wurden. Für insgesamt weitere 6 Patienten wurde entweder nur eine „minimale Besserung“ (CGI: 3) oder „keine Veränderung“ (CGI:4) festgestellt. Die gleichzeitig gemessenen Veränderungen im YMRS-Gesamtscore korrelierten hochsignifikant mit den CGI-Werten für Veränderung (Spearman’s Rangkorrelation rs = –0,953; p<0,0005), wobei die negative Korrelation damit zu erklären ist, dass hohe positive Differenzwerte im YMRS-Gesamtscore mit niedrigen Werten der CGI-Veränderungsskala einhergehen. Wenn man die Korrelation der Veränderungen der einzelnen YMRS-Items mit dem CGIBP Scores einzeln betrachtet, findet sich die beste Übereinstimmung für die Items 9 (Expansiv-aggressives Verhalten), 10 (Äußere Erscheinung) und 5 (Reizbarkeit, alle p <0.0005). Mit Ausnahme von Item 11 (Einsicht, p=0.171) zeigte sich in allen Teilbereichen eine signifikante Korrelation mit der CGI‑BP Wertung. Ein Vergleich der Veränderungen (ANOVA) für die drei Patientengruppen mit gleichem beziehungsweise ähnlichem CGI-Score erbrachte hochsignifikante Ergebnisse (p<0.005), ebenso auch der paarweise Vergleich aller drei Gruppenpaare (CGI=1 vs. CGI=2, CGI=1 vs. CGI=3-4 und CGI=2 vs. CGI=3-4, alle p<0.005). Diskussion Mit der vorliegenden Übersetzung der Young Mania Rating Scale liegt nun erstmals eine deutschsprachige Version der zu Forschungszwecken, aber auch im klinischen Alltag meistverwendeten Beurteilungsskala für manische Episoden vor. Die Originalversion weist eine Inter-Rater Reliabilität gemessen anhand des IntraKlassen Korrelationskoeffizient von ICC= 0.93 für den Gesamtscore und zwischen ICC= 0.66 und ICC=0.92 für einzelne Items auf [16]. Die Inter-Rater Reliabilität der deutschen Version ist jener der ursprünglichen englischen Originalversion gut vergleichbar, und war in unserer Untersuchung ten­denziell sogar etwas höher. Als mögliche Ursachen hierfür kommen unter anderem das vorausgehende, detaillierte Interrater-Training und die Ausformulierung von klaren Leitfragen im Sinne eines teilstrukturierten Interviews in Betracht. Die ICCWerte lagen für alle Items der Skala im Bereich über 0.75 und zeigen somit exzellente Übereinstimmung und hohe Verlässlichkeit [12]. Für den Gesamtscore zeigte sich eine Inter-Rater Reliabilität von ICC= 0.94. Die höchste Übereinstimmung zwischen den Ratern gab es für das Item „Schlafstörung“, während die Bewertung des Items „Sprach- und Denkstörung“ höhere Varianz aufwies. In der englischsprachigen Originalskala, aber auch in einigen anderen fremdsprachigen Übersetzungen (französisch, portugiesisch) zeigte jeweils die Beurteilung eines anderen Bereichs - nämlich des „expansivaggressiven Verhaltens“ - die breiteste Streuung in der Beurteilung durch verschiedene Rater. Dies wird häufig mit der oft ausgeprägten ethnischen und kulturellen Hetereogenität der Rater und durch teilweise abweichenden Normen bezüglich Distanz und aggressiven Verhaltens erklärt. Möglicherweise führte eine höhere Homogenität der deutschsprachigen Rater hier zu einer höheren Übereinstimmung in der Beurteilung. Die CGI-BP Skala ist eine speziell für bipolare Patienten adaptierte Version der ursprünglichen CGI-Skala, anhand derer auf einer Skala von 1 bis 7 der Schweregrad der Erkrankung beurteilt wird. Neben dem Schweregrad wird bei wiederholten Messungen auch Relibilität und Übereinstimmungsvalidität der deutschen Version von Young Mania Rating Sale (YMRS-D) die Veränderung des Zustandes auf einer Skala von 1 bis 7 beurteilt. Die CGIBP gilt als einfaches, aber verlässliches und effizientes Messwerkzeug für den Schweregrad manischer Episoden [10] und wurde von uns zur Überprüfung der Übereinstimmungsvalidität von YMRS-D herangezogen. Dabei zeigte sich eine sehr gute Übereinstimmung sowohl des YMRS-Gesamtscores mit dem Score der Manie-Subskala von CGI-BP, als auch hohe Korrelation mit den Einzelitems. Wie auch in der englischsprachigen Fassung der YMRS war die Übereinstimmung mit der globalen klinischen Beurteilung in den Bereichen Krankheitseinsicht und äußere Erscheinung niedriger, in den Bereichen Sprach- und Denksstörung, Inhalt, Stimmung und Aktivität höher. Insgesamt kann anhand unserer Ergebnisse von guter Übereinstim­ mungsvalidität der deutschen Version der YMRS ausgegangen werden. Auch die mit Hilfe der CGI-BP gemessene Veränderung des klinischen Zustands bei wiederholter Messung korrelierte gut mit der Veränderung des Scores der YMRS-D, was für eine gut ausgeprägte Änderungssensitivität spricht. Einschränkend ist zu erwähnen, dass sowohl die englische, als auch die deutsche Version der YMRS zusammenfassend den Zustand der letzten 48 Stunden beurteilen und daher sehr kurzfristige Veränderungen nicht ausreichend erfasst werden können. Die YMRS-D ist eine Rating-Skala, die verhältnismäßig unkompliziert angewandt werden kann und nur einer relativ kurzen, einfachen Einschulung für den korrekten Gebrauch bedarf. Die Verwendung eines semi-struk­ turierten Interviews mit Leit­fragen und klar definierten Ankerpunkten erleichtert zusätzlich die Anwendung und erhöht die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Ratern und im Rahmen multizentrischer Zusammenfassend kann Stu­dien. davon ausgegangen werden, dass die deutschsprachige YMRS-D eine valide, reliable und änderungssensitive Testskala zur Beurteilung und Quantifizierung manischer Symptome darstellt. [8] [9] [10] [11] [12] Literatur [13] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Bartko, J. J.Carpenter, W. T., Jr.:On the methods and theory of reliability. J.Nerv. Ment.Dis. 163, 307- 317. Bech, P., Rafaelsen, O. J., Kramp, P., Bolwig, T. G.:The mania rating scale: scale construction and inter-observer agreement. Neuropharmacology 17, 430- 431. Blackburn, I. M., Loudon, J. B., Ashworth, C. M.:A new scale for measuring mania. Psychol.Med. 7, 453458. Colom, F., Vieta, E., Martinez-Aran, A., Garcia-Garcia, M., Reinares, M., Torrent, C., Goikolea, J. M., Banus, S., Salamero, M.:[Spanish version of a scale for the assessment of mania: validity and reliability of the Young Mania Rating Scale]. Med.Clin.(Barc.) 119, 366- 371. Favre, S., Aubry, J. M., Gex-Fabry, M., Ragama-Pardos, E., McQuillan, A., Bertschy, G.:[Translation and validation of a French version of the Young Mania Rating Scale (YMRS)]. Encephale 29, 499- 505. Hausmann, A.:Focussing on bipolar disorder. Neuropsychiatrie 21, 76- 83. Kongsakon, R.Bhatanaprabhabhan, D.: Validity and reliability of the Young Mania Rating Scale: Thai version. J.Med.Assoc.Thai. 88, 1598- 1604. [14] [15] [16] 21 Murphy, D. L., Beigel, A., Weingartner, H., Bunney, W. E., Jr.:The quantitation of manic behavior. Mod.Probl. Pharmacopsychiatry 7, 203- 220. Sachs, G., Schaffer, M., Winklbaur, B.: Cognitive deficits in bipolar disorder. Neuropsychiatrie 21, 93- 101. Spearing, M. K., Post, R. M., Leverich, G. S., Brandt, D., Nolen, W.:Modification of the Clinical Global Impressions (CGI) Scale for use in bipolar illness (BP): the CGI-BP. Psychiatry Res. 73, 159- 171. Spearing, M. K., Post, R. M., Leverich, G. S., Brandt, D., Nolen, W.:Modification of the Clinical Global Impressions (CGI) Scale for use in bipolar illness (BP): the CGI-BP. Psychiatry Res. 73, 159- 171. Streiner, D. L.:Learning how to differ: agreement and reliability statistics in psychiatry. Can.J.Psychiatry 40, 60- 66. Vilela, J. A., Crippa, J. A., Del Ben, C. M., Loureiro, S. R.:Reliability and validity of a Portuguese version of the Young Mania Rating Scale. Braz.J.Med. Biol.Res. 38, 1429- 1439. Young, R. C., Biggs, J. T., Ziegler, V. E., Meyer, D. A.:A rating scale for mania: reliability, validity and sensitivity. Br.J.Psychiatry 133, 429- 435. Young, R. C., Biggs, J. T., Ziegler, V. E., Meyer, D. A.:A rating scale for mania: reliability, validity and sensitivity. Br.J.Psychiatry 133, 429- 435. Young, R. C., Biggs, J. T., Ziegler, V. E., Meyer, D. A.:A rating scale for mania: reliability, validity and sensitivity. Br.J.Psychiatry 133, 429- 435. Dr. Moritz Muehlbacher Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie I Christian Doppler Klinik Paracelsus Privatmedizinische Universität Salzburg [email protected] M. Mühlbacher et al. 22 Young-Mania-Rating-Scale (Fremdrating, deutsche Übersetzung) Beginnen Sie die Befragung bitte bei jedem Item mit Fragen des Scripts. Sind noch zusätzliche Informationen notwendig, um das Rating auszuführen, können Sie noch weitere Fragen stellen. Beurteilen Sie jedes Item vor allem nach Ihrem eigenen Ermessen ausschließlich nach dem Bericht des Patienten. Das Ziel jedes Items ist es, die Schwere des jeweiligen Symptoms bei dem Patienten festzustellen. Um die Schwere eines Symptoms festzustellen, ist es ausreichend, wenn nur ein einziges Symptom eines jeweiligen Schweregrads vorhanden ist, damit diese Punktezahl vergeben werden muss. Die Symptombeschreibungen neben der Punktzahl sind Hinweise. Falls nötig, kann man diese ignorieren, um die Schwere eines Symptoms zu bestimmen. Jedoch sollte dies eher die Ausnahme als die Regel darstellen. Benutzen Sie jedoch nur volle Punktzahlen. Entscheiden Sie sich bei jedem Item für die Kategorie, die den Patienten in den letzten 48 Stunden am besten beschreibt. 1. Gehobene Stimmung In den letzten 2 Tagen, wie war da Ihre Stimmung? 0 – nicht vorhanden Waren Sie optimistisch, wenn Sie an die Zukunft dachten? (Gab es Grund dazu?) 1 – auf Befragen, möglicherweise oder leicht erhöht, fröhlich Fühlten Sie sich besonders selbstbewusst? Gab es Zeiten, in denen Sie sich ein bisschen zu gut fühlten, oder sogar ein bisschen „high“? (Falls ja) Waren diese Zeiten wirklich „zu“ gut, oder nur besser als die schlechten Tage? 2 – subjektiv eindeutig gehoben, optimistisch, selbstbewusst, dem Inhalt angemessen Gab es Momente, in denen Sie über Sachen gelacht haben, die Sie normalerweise nicht lustig finden? Oder haben Sie Witze gemacht oder über Sachen gelacht, die andere Leute nicht lustig fanden? 3 – gehoben, dem Inhalt nicht angemessen, läppisch 4 – euphorisch, unangebrachtes Lachen und/oder Singen 2. Gesteigerte motorische Aktivität / Energie In den letzten 2 Tagen: Wie war Ihre Energie? 0 – nicht vorhanden Gab es Momente, in denen Sie besonders viel Energie hatten? 1 – subjektiv gesteigert (Falls ja) War es schwierig, sich wieder zu beruhigen? 2 – lebhaft, vermehrte Gestik Fühlten Sie sich rastlos, hatten Schwierigkeiten, still sitzen zu bleiben? 3 – überschießende Energie, zeitweise hyperaktiv, rastlos (kann jedoch beruhigt werden) Waren Sie aktiver als sonst, haben Sie viel mehr geschafft, als üblich? 4 – motorisch erregt, ständig hyperaktiv (kann nicht mehr beruhigt werden) Relibilität und Übereinstimmungsvalidität der deutschen Version von Young Mania Rating Sale (YMRS-D) 23 3. Sexuelles Interesse War Sex wichtiger oder interessanter für Sie, als sonst? 0 – normal, nicht gesteigert 1 – möglicherweise oder leicht gesteigert Haben Sie häufiger über Sex gesprochen, oder Witze gemacht, als Sie es normalerweise tun? 2 – auf Befragung subjektiv eindeutig gesteigert 3 – spontan vorgebrachte sexuelle Inhalte, spricht ausführlich über sexuelle Themen, schätzt sich selbst als hypersexuell ein 4 – offene sexuelle Handlungen (gegenüber Patienten, Personal oder dem Interviewer) 4. Schlaf Wie viele Stunden schlafen Sie in den letzten 2 Tagen? 0 – berichtet über gewohnte oder erhöhte Schlafdauer Brauchen Sie weniger Schlaf als gewöhnlich? Sind sie trotzdem ausgeruht? 1 – gewohnte Schlafdauer um bis zu einer Stunde reduziert 2 – gewohnte Schlafdauer um mehr als eine Stunde reduziert 3 – berichtet reduziertes Schlafbedürfnis 4 – bestreitet, Schlaf zu benötigen 5. Reizbarkeit Waren Sie ärgerlich über Dinge die passiert sind, oder wie Leute Sie behandelt haben? 0 – nicht vorhanden 2 – subjektiv erhöht Haben Sie Dinge mehr gestört als sonst? Waren Sie gereizt? 4 – während des Interviews zeitweise reizbar, kürzliche Episoden von Zorn und Gereiztheit auf Station Wie zeigten Sie Ihren Ärger? 6 – während des Interviews häufig gereizt, durchwegs kurz angebunden, barsch 8 – feindselig, unkooperativ, Interview nicht möglich M. Mühlbacher et al. 24 6. Sprechweise (Geschwindigkeit und Qualität) Waren Sie gesprächiger als sonst? 0 – nicht gesteigert Haben sich manche beschwert, dass sie nicht zu Wort kommen? 2 – fühlt sich gesprächig Fanden Sie es schwierig, wieder mit dem Reden aufzuhören, nachdem Sie begonnen hatten? 4 – zeitweise erhöhte Sprechgeschwindigkeit und -menge, zeitweise weitschweifig Gab es Momente, in denen Sie so schnell gesprochen haben, dass die Leute sie kaum verstanden haben? 6 – Rededrang, durchwegs erhöhte Sprechgeschwindigkeit und –quantität, schwer zu unterbrechen 8 – getrieben, nicht zu unterbrechen, unaufhörlicher Redefluss 7. Sprach-/Denkstörungen Hatten Sie mehr Ideen als gewöhnlich, oder einige besonders gute? 0 – nicht vorhanden War Ihr Verstand besonders klar oder scharfsinnig? 1 – umständlich, geringfügige Ablenkbarkeit, schnelles Denken (flüchtige Gedanken?) Wurden Sie häufig abgelenkt? Hatten Sie das Gefühl, Ihr Verstand arbeitet schneller als sonst? Hatten Sie manchmal so viele Ideen, dass sie den Faden verloren? Haben Sie sich in Details verloren? 2 – ablenkbar, verliert den Faden, häufige Themenwechsel, Gedankenjagen 3 – Ideenflucht, vorbeireden, Schwierigkeit, den Gedanken zu folgen, spricht in Reimen, Echolalie 4 – inkohärent, Kommunikation unmöglich 8. Inhalte Haben Sie neue Pläne, oder mit neuen Projekten begonnen? 0 – normal Haben Sie etwas besonderes erreicht, oder neue Fähigkeiten an sich entdeckt? 2 – fragwürdige Pläne, neue Interessen 4 – spezielle Projekte, Überreligiosität Hatten Sie das Gefühl, Sie hätten ein tieferes Verständnis für manche Dinge? 6 – Größen- oder paranoide Inhalte, Beziehungsideen Hatten Sie religiöse Einsichten? 8 – Wahnvorstellungen, Halluzinationen Gab es eine bestimmte Bedeutung für Dinge, die passiert sind, oder die Art, wie die Dinge arrangiert waren? Sind Ihnen Dinge aufgefallen, die anderen Menschen verborgen blieben, oder hatten Sie das Gefühl, dass Andere über Sie reden, oder Sie sogar verletzen wollten? Hatten sie Gedanken, die andere Menschen nicht verstehen konnten. Haben Sie Stimmen gehört, oder Dinge gesehen, die andere Menschen nicht wahrgenommen haben? Relibilität und Übereinstimmungsvalidität der deutschen Version von Young Mania Rating Sale (YMRS-D) 25 9. Expansiv-aggressives Verhalten 0 – fehlt, kooperativ Wie kamen Sie mit anderen Menschen zurecht? 2 – sarkastisch, gelegentlich laut, misstrauisch Gab es Momente, in denen Sie laut wurden, oder fordernd, oder sarkastisch? Hatten Sie Streitigkeiten mit anderen Menschen (was ist passiert)? 4 – fordernd, spricht Drohungen aus 6 – bedroht den Interviewer, schreit, Interview schwierig Haben Sie geschrieen, Gegenstände geworfen oder etwas zerstört? 8 – wird tätlich, destruktiv, Interview unmöglich 10. äußere Erscheinung Wie viel Zeit verbrachten Sie mit Körperpflege? 0 – angemessene Kleidung und Körperpflege Gab es Momente, wo andere dachten, Sie seien over- oder underdressed? 1 – etwas vernachlässigt Haben Sie andere Farben als sonst getragen? Trugen Sie mehr Schmuck oder Make up? 2 – mäßig ungepflegt, unordentlich und übertrieben gekleidet 3 – unordentlich und unvollständig bekleidet, auffallend geschminkt 4 – völlig vernachlässigt, geschmückt, bizarre Kleidung 11. Krankheitseinsicht Wenn Sie zurückschauen, gab es Dinge, die Sie getan haben, die ungewöhnlich sind für Sie? 0 – ist vorhanden, räumt Krankheit ein, bejaht die Notwendigkeit einer Therapie (Falls ja) War das so, weil Ihre Stimmung eher zu gut ist? 1 – möglicherweise krank Wie erklären Sie sich (Beispiel für Symptom)? 2 – erkennt Verhaltensänderung, verneint jedoch Krankheit 3 – räumt mögliche Verhaltensänderung ein, verneint jedoch Krankheit 4 – verneint jegliche Verhaltensänderung Neuropsychiatrie, Band 25, Nr. 1/2011, S. 26–35 Original Original Erfassung von Psychopathologien bei straffälligen Jugendlichen Daniel Gutschner1, Sabine Völkl-Kernstock2,,Aïsha Perret1 Theo Doreleijers3, Robert Vermeiren6, Jörg M. Fegert4 und Klaus Schmeck5 Institut für forensische Kinder- und Jugendpsychologie, -psychiatrie und -beratung, Bern 2 Univ.-Klinik für Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters, Medizinische Universität Wien 3 Klinikum der Freien Universität Amsterdam (VUmc) Duivendrecht 4 Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie des Universitätsklinikum Ulm 5 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Basel, Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel 6 Forensische Psychiatrie, Universität Leiden 1 Schlüsselwörter: Screeninginstrument – Psychopathologie – jugendliche Straftäter – Validierungs­ studie – BARO Keywords: screeninginstrument – psychopathol- ogy – juvenile offenders – validation study – BARO Erfassung von Psychopathologien bei straffälligen Jugendlichen Ziel dieses Artikels ist es, die psychometrischen Eigenschaften der deutschen Version des Screeninginstruments BARO (Basis Raads Onderzoek) darzustellen. Das BARO (1999 von Theo Doreleijers in den Niederlanden entwickelt) soll den Jugendgerichten ein standardisiertes Verfahren zur Herausfilterung diejenigen Jugendlichen bieten, die möglicherweise eine psychische Störung aufweisen. Der vorliegende Artikel beschreibt © 2011 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 die Validierungsstudie der deutschen Version des BAROs. Dazu wurden 125 straffällige Jugendliche aus der deutschsprachigen Schweiz einbezogen, die beim Jugendgericht im Zuge eines Strafverfahrens mittels BARO untersucht worden sind. Zur Überprüfung der Validität wurde zusätzlich eine Begutachtung von forensischen Experten durchgeführt, unter Anwendung des Diagnostischen Interviews zur Erfassung psychischer Störungen (DIPS) und der Checkliste zur Erfassung von Persönlichkeitsstörungen nach DSMIV (SKID II). Weiter wurde ein selbst konstruierter Fragebogen von den Benützern ausgefüllt, um die Anwendbarkeit des BAROs zu beurteilen. Es zeigte sich, dass die Reliabilität und die Interrater Reliabilität als gut, resp. sehr gut (α=.80, r=.84) bezeichnet werden können. Sensitivität und Spezifität als Masse der Vorhersagequalität wurden anhand einer ROC-Kurve (receiver operator curve) erhoben. Dabei ergab sich ein respektabler AUC-Wert von .882, der auf eine gute Validität hinweist. Der optimale Cut-off-Wert von 16.5 korrespondiert mit einer Sensitivität von 86% und einer Spezifität von 84%. Die Anwender beurteilen das BARO als handhabbares und nützliches Instrument. Aufgrund dieser guten psychometrischen und diskriminativen Eigenschaften kann das BARO als ein geeignetes Screeninginstrument zur Ersterfassung psychischer Störungen angesehen werden, insbesondere für die Anwendung im jugendgerichtlichen Verfahren. Screening of psychopathology with juvenile deviants The aim of this article is to describe the psychometric properties of the German version of the BARO (Basis Raads Onderzoek/Basic Council Examination), a mental health screening instrument for delinquent adolescents which are referred to juvenile court. The BARO was developed in 1999 by Theo Doreleijers in the Netherlands. The present article reports on a validation study concerning the German BARO. For this study, a sample of 125 Swiss German speaking youth, referred to forensic investigation for having committed an offence, was used. For purposes of validation, besides the Erfassung von Psychopathologien bei straffälligen Jugendlichen BARO, the DIPS (Diagnostic interview for psychiatric disorders) and the SKID II (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders) were conducted. A specifically for this goal created questionnaire was filled out by the users, in order to judge the applicability of the BARO. With respect to reliability, both internal consistency, and interrater reliability ranged from good to very good (α = .80 and r= .84). For analysing the validity, a ROC estimation (receiver operator curve) was performed and showed an AUC (area under the curve) of .88 for the presence of a mental health disorder. This result can be considered as very good. An optimal cut-off-point of 16.5 corresponds with a sensitivity of 86% and a specificity of 84%. The applicability of the BARO was rated as satisfying by the mental health professionals who used the instruments. The good psychometric properties and discriminative power of the BARO indicates that it is a useful mental health screeninginstrument for youth in contact with juvenile justice. Further research should focus on the usefulness in other populations and on the predictive validity for long-term outcome. 1. Einleitung Wenn auch in den letzten Jahren eine Abnahme der Jugendstrafurteile in der Schweiz zu vermerken war (Bundesamt für Statistik der Schweiz), so ist dennoch eine Zunahme der Gewaltdelikte zu erkennen. Auch Snyder [24] weist auf eine Zunahme vor allem von Gewalt- und Sexualdelikte hin. Weiter ist besorgniserregend, dass das Alter der Täter bei Begehung der Straftat gleichzeitig abgenommen hat. Verschiedene Studien weisen auf den Zusammenhang zwischen Delinquenz und Psychopathologie hin [4, 17, 20, 21, 25, 27, 14]. Vorwiegend werden Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen, aber auch internalisierende Störungen diagnostiziert. Aus den Daten einer prospektiven Langzeitstudie mit straffälligen Jugendlichen in der Schweiz [13] wird ersichtlich, dass bei den 158 miteinbezognen Jugendlichen (Stand September 2007), lediglich knapp 10% keine psychische Störung aufweisen. Am Häufigsten finden sich mit 41.8% Verhaltensstörungen (F9), gefolgt von 21.5% Persönlichkeitsstörungen (F6), 13.3% Anpassungstörungen (F4), 7.6% affektive Störungen (F3), 1.9% psychotische Störungen (F2) und 1.3% Substanzabhängigkeiten. Die geringe Prävalenz von Substanzabhängigkeiten hat damit zu tun, dass Suchtstörungen mit Cannabinoiden nicht miteinbezogen worden sind. Diese Zahlen sind durchaus vergleichbar mit anderen Studienergebnissen. Betrachtet man die doch hohe Anzahl von Jugendlichen mit einer Psychopathologie, wird ersichtlich, dass es für die Jugendstrafbehörden schwierig ist, jene jugendlichen Straftäter herauszufiltern, die unter schwereren psychischen Störungen leiden. Damit strafrechtliche Maßnahmen oder Sanktionen besser getroffen werden können, ist von daher eine Entwicklung von leicht handhabbaren Screeninginstrumenten für den Einsatz bei Jugendstrafbehörden wichtig. In den meisten westlichen Ländern hat die Jugendstrafbehörde eine wichtige Rolle im Umgang mit jugendlichen Straftätern, wobei diese nach einer begangenen Straftat oftmals den ersten Kontakt mit den Jugendlichen herstellen. Im Anschluss daran muss eine Entscheidung betreffend Bestrafung oder weiterführenden strafrechtlichen Maßnahmen getroffen werden. Die jugendstrafrechtlichen Maßnahmen verfolgen meist pädagogische Ziele, jedoch ist die Entscheidung, welche Maßnahmen geeignet, notwendig und zielführend sind, nicht immer einfach zu treffen. Zurzeit gibt es keine standardisierten Kriterien für die Entscheidung, welche weiteren Schutzmaßnahmen für einen Jugendlichen ergriffen, und ab welchem Zeitpunkt ein forensischer Experte hinzugezogen werden soll. In 27 einer schweizerischen Untersuchung [2] konnte gezeigt werden, dass die Entscheidung, wann ein forensischer Experte involviert wird, weitgehend von der begangenen Straftat abhängt. Generell kann gesagt werden, dass ein Mangel an standardisierten Screeninginstrumenten oder Methoden besteht, um diese Frage nach dem Einsatz eines Experten betreffend einer intensiveren Abklärung des Jugendlichen, und einer daraus folgenden Entscheidung für eine adäquaten Schutzmassnahme, entsprechend beantworten zu können. Eine weitere Schwierigkeit zeigt sich darin, dass Sozialarbeiter, die solche Jugendliche für das Jugendgericht abklären, über ein spezielles Wissen im Bereich der Psychiatrie und klinischen Psychologie verfügen sollten. Diese Erkenntnis lässt den Schluss zu, dass spezielle und einfach handhabbare Instrumente zur Erfassung psychischer Störungen und wichtiger Informationen für die Entscheidungsfindung weiterer strafrechtlicher Interventionen benötigt werden. Screeningverfahren dienen dazu, aus einer größeren Population diejenigen Personen herauszufiltern, welche ein bestimmtes Kriterium erfüllen (hier beispielsweise das Vorhandensein einer psychischen Störung). Generell müssen Screeningmethoden den Anspruch erfüllen, schnell, handhabbar und einfach in der Durchführung zu sein und alle wichtigen Informationen zu erfassen. Der SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) [9] und die CBCL, YSR, TRF (Child Behavior Checklist, Youth Self Report, Teacher Report Form) [1] sind die am meisten verbreiteten Screeninginstrumente zur Erfassung psychopathologischer Auffälligkeiten bei Jugendlichen. Zur Erfassung psychischer Auffälligkeiten in der Allgemeinbevölkerung sind diese beiden Instrumente gut validiert. Im Gebrauch bei jugendlichen Straftätern zeigen diese diagnostischen Verfahren jedoch ungenügende Sensitivität [6] und führen daher zu einer weniger dienlichen Informationsmenge zur Weiteverfolgung im D. Gutschner et al. jugendstrafrechtlichen Prozess. In den USA wird in den meisten Jugendstrafanstalten der MAYSI-2 (Massachusetts Youth Screening Instrument) [10] angewendet, ein Selbstbeurteilungsinstrument zur Erfassung insbesondere von Suizidalität und Psychosen, welches in der Durchführung etwa 10 Minuten dauert. Da sich der MAYSI-2 auf akute Gefährdungen konzentriert, ist er zur Aufdeckung von mittelschweren Psychopathologien weniger geeignet. Ein gutes Screeninginstrument im Bereich des Jugendstrafrechtes sollte in der Anwendung klar strukturiert sein und standardisiert Informationen des Jugendlichen, der Eltern und anderer Drittpersonen erfassen. Weiter soll es Jugendliche mit einer psychischen Störung aufdecken und klare Informationen über das Funktionsniveau in verschiedenen Lebensbereichen erbringen. Generell ist die Erfassung dieser Informationen nur durch ein strukturiertes und standardisiertes Vorgehen möglich. Zurzeit gibt es nur sehr wenige Forschungen im Bezug auf die Entwicklung von diagnostischen Verfahren oder Abklärungsmethoden bezüglich der Entscheidung für eine adäquate jugendstrafrechtliche Maßnahme für delinquente Jugendliche. Aus diesem Grund zielt die vorliegende Studie auf die Darstellung der psychometrischen Daten der deutschsprachigen Fassung des Screeninginstruments BARO (Basic Raads Onderzoek) ab. Der BARO wurde von Doreleijers et al. [3] in den Niederlanden entwickelt und überprüft. Neben den psychometrischen Daten sowie der diskriminativen Validität soll die Handhabbarkeit dieses diagnostischen Verfahrens in der Anwendung bei der Jugendstrafbehörde erprobt werden. 28 2. Exkurs: Das Schweizerische Jungendstrafrecht Das Schweizerische Jugendstrafrecht besteht erst seit 1942 als Teil des allgemeinen Strafgesetzbuches (StGB) und ist speziell und differenziert für Kinder und Jugendliche ausgestaltet. Das Jugendstrafrecht ist in seinen Grundzügen bis heute erhalten geblieben und wurde anlässlich einer größeren Revision 1971 verfeinert und ergänzt. Dieses Jugendstrafrecht hat sich im Allgemeinen bewährt, es sind aber, gemäß Botschaft des Bundesrates, einige wesentliche Mängel nicht zu übersehen. Aus diesem Grunde wurde ein neues Jugendstrafgesetz (JStG) entwickelt, welches am 01.01.2007 in Kraft getreten ist. Es sollen hier nur einige wichtige Änderungen, welche auch im Zusammenhang mit dem Screeninginstrument BARO stehen, angemerkt werden. Die bedeutendste formale Änderung zeigt die Richtung der Reformbestrebungen an. Das neue Jugendstrafgesetz ist fortan nicht mehr Bestandteil des allgemeinen Strafgesetzbuches, sondern wurde herausgelöst und bildet ein eigenständiges Gesetz. Der Gedanke der Integration des jugendlichen Straftäters wird vom geltenden Recht übernommen. Die Strafmündigkeit wurde vom siebten auf das vollendete 10. Lebensjahr erhöht, und es ist nun auch konsequenter möglich, Maßnahmen und Strafen gleichzeitig auszusprechen. Die Grundlagen für das Einholen eines psychologisch/psychiatrischen Gutachtens sind im neuen Jugendstrafgesetz besser geregelt, aber auch diese weisen dahingehend noch einige Lücken auf [14]. Die Bestimmungen zur Anwendung strafrechtlicher Schutzmassnahmen sind im neuen Jugendstrafgesetz ebenfalls differenzierter und klarer dargestellt. Als wichtige Erneuerung erscheint die Forderung, alle Schutzmassnahmen jährlich auf Zweck- und Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Nur bleibt die Frage offen, wer diese Überprüfung durchführt und welche Kriterien hierfür angewendet werden. Generell verfolgt das schweizerische Jugendstrafrecht pädagogische Ziele, Bestrafungen und Bussen werden eine untergeordnete Rolle zugeteilt. Eine wichtige Änderung scheint hier die Frage nach dem schuldhaften Verhalten. Im früheren Jugendstrafrecht war die Frage, ob der jugendliche Straftäter schuldhaft gehandelt hat, weniger explizit gestellt. Eine weitere weitreichende Neuheit ist im Ausmaß der Einschließungsstrafe ersichtlich. Nach dem neuen Jugendstrafgesetz können Jugendliche für eine begangene Straftat zu einer Einschließungsstrafe von bis zu vier Jahren verurteilt werden. Im vorherigen Jugendstrafrecht lag die höchstmögliche Einschlussstrafe bei einem Jahr. Dies zeigt eine etwas stärkere Betonung der Punitivität im Vergleich zur bisherigen stärkeren Fokussierung auf Nacherziehung und Resozialisierung. 2009 wurden in der Schweiz 15’064 jugendliche Straftäter im Alter von 10 bis 18 Jahren verurteilt. 76.3% dieser Jugendlichen waren im Alter von 15 bis 18 Jahren, 68.2% dieser jugendlichen Straftäter waren Schweizer. Am häufigsten waren Diebstahl (29.4%), gefolgt von Konsum von Betäubungsmitteln (27.4%), Sachbeschädigung (18.2%), Hausfriedensbruch (9.6%), Gewaltdelikten (Tätlichkeit und einfache Körperverletzung mit 9.4%), Entwendung zum Gebrauch (6.6%), Fahren ohne Führerausweis (6.3%), Handel von Betäubungsmittel (4.1%), Hehlerei (2.3%), Drohung (2.2%), Raub (2.2%), Brandstiftung (1.2%), sexuelle Nötigung (0.5%) und Sexualdelikten (Sexuelle Handlungen mit Kindern und sexuelle Nötigung mit 0.4%) (Bundesamt für Statistik der Schweiz). Anders als in anderen Ländern ist in der Schweiz die Jugendstrafbehörde für alle Gesetzesübertretungen (inklusive Straßenverkehrsdelikte) zuständig. Die Erstabklärung wird von den Sozialarbeitern direkt am Jugendgericht durchgeführt. Nach solchen Abklärungen geben die Sozialarbeiter den Jugendrichtern oder Jugendanwälten Empfehlungen für das weitere Vorgehen ab. Gibt es jedoch Hinweise, dass der Jugendliche an einem physischen Erfassung von Psychopathologien bei straffälligen Jugendlichen oder psychischen Gebrechen leidet, so wird ein forensischer Experte mit der psychologisch-psychiatrischen Begutachtung beauftragt werden [13]. Hier setzt der BARO an, welcher den Sozial­ arbeitern ein einfach anwendbares, stan­ dardisiertes Screeninginstrument bietet, um die Notwendigkeit einer intensiveren Begutachtung heraus zu filtern. 29 Häufigkeit (n) Prozente (%) Diebstahl 34 27.2 Sachbeschädigung 23 18.4 Verstoß gegen BetmG 22 17.6 Körperverletzung 13 10.4 Einbruch 9 7.2 Verstoß gegen SVG 9 7.2 Nötigung 5 4.0 3. Methoden Sexualdelikt 4 3.2 Raub 4 3.2 3.1 Stichprobe Irreführung der Rechtspflege 2 1.6 125 100 Für diese Untersuchung wurden insgesamt 125 jugendliche Straftäter herangezogen, bei denen aufgrund eines Delikts beim Jugendgericht oder bei der Jugendanwaltschaft ein Strafverfahren eröffnet wurde. Alle diese Jugendlichen wurden von der Jugendstrafbehörde mittels BARO untersucht und zu einer weiteren Begutachtung überwiesen. Das Durchschnittsalter der jugendlichen Straftäter befindet sich bei 15.98 Jahren (SD = 1.55), der Anteil der weiblichen jugendlichen Straftäter liegt bei 13%. Tabelle 1 zeigt die begangenen Straftaten. Diebstahl (27.2%) war die häufigste Straftat, gefolgt von Sachbeschädigung (18.4%), Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (17.6%), Körperverletzung (10.4%), Einbruch (7.2%), Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz (7.2%), Nötigung (4.0%), Sexualdelikt (3.2%), Raub (3.2%) und Irreführung der Rechtspflege (1.6%). Delikte Total Tabelle 1: Deliktverteilung externalisierende Störungen, 5) internalisierende Störungen, 6) Funktionieren zu Hause, 7) Funktionieren in der Schule, 8) Funktionieren im Freizeitbereich und 9) Umgebungsfaktoren. Nach separat durchgeführten Interviews mit den Eltern, bzw. mit den Bezugspersonen und den Jugendlichen werden diese einzelnen Bereiche betreffend ihrer so genannten Sorgenindex (wenig besorgniserregend, besorgniserregend, sehr besorgniserregend) bewertet. Neben dieser Einschätzung beinhaltet das BARO zehn Indexfragen (fünf zuhanden des Jugendlichen (J 1 – 5), fünf an die Eltern (E 1 – 5)), die empirisch ausgewählt wurden, um diejenigen Jugendlichen herauszufiltern, die möglicherweise an einer psychischen Störung leiden, und um die Notwendigkeit einer weiteren forensischen Begutachtung zu bestätigen oder zu verwerfen. Diese Indexfragen werden Computer unterstützt bewertet und werden als „J- und E-Index“ dargestellt. Die Indexfragen an den Jugendlichen sind: „frühere zivilrechtliche Maßregeln wie Erziehungshilfe oder Heimunterbringung“, „Verhaltensprobleme gegenüber den Mitschülern und Lehrern; Lernprobleme“, „Misshandlung außerhalb der Familie; Teilnahme an ernsten Schlägereien“, „körperliche Beschwerden, für die vom Arzt keine Ursachen gefunden werden konnte“, „Beschwerden wegen Alkohol- oder Drogenkonsum; etwaige Inanspruchnahme von professioneller Hilfe wegen diesen Beschwerden“. Indexfragen an die Eltern: „frühere Polizeikontakte des Jugendlichen“, „Verhaltensprobleme in der Schule“, „frühere oder aktuelle Stimmungsprobleme des Jugendlichen“, „frühere oder aktuelle Unfallneigung des Ju- 3.2 Instrumente Das BARO (Basic Raads Onderzoek) [3] ist ein halbstrukturiertes Interview für die Ersterfassung straffälliger Jugendlicher. Dieses Screeningverfahren besteht aus einem standardisierten Fragenkatalog, der in verschiedene Bereiche unterteilt ist. Insgesamt gibt es Fragen zu den folgenden neun Bereiche: 1) Delinquentes Verhalten, 2) psychosoziale Entwicklung, 3) somatische Entwicklung und Krankheit, 4) Indexfragen Jugendlicher J1 – J53 Indexfragen Eltern E1 – E54 Gesamtsumme J1 – E5 Beurteilerübereinstimmung/Kappa2 .691 .561 .801 .84*** ***p < .001 1 Reliabilitätskoeffizienten (Cronbach's Alpha) der Gesamtsumme der Indexfragen 2 Interrater Reliabilität (Cohens Kappa) 2 Beurteiler 3 5 Indexfragen für den Jugendlichen (J1 – J5) 4 5 Indexfragen für die Eltern (E1 – E5) Tabelle 2: Interne Konsistenz der Indexfragen D. Gutschner et al. gendlichen“, „hilfeleistungsbedürftige seelische Gesundheitsprobleme des Vaters“ (Tab. 2). Das BARO erfasst nicht spezifische Diagnosen nach DSM-IV oder ICD10, sondern gibt lediglich Hinweise, ob möglicherweise eine psychische Störung vorhanden ist, damit diejenigen Jugendlichen, die wahrscheinlich an einer psychischen Störung leiden, von einem forensischen Experten weiter begutachtet werden können. Das BARO gibt Indikatoren an, die für die Bestimmung strafrechtlicher Maßnahmen wichtig sind, indem die verschiedenen Bereiche in ihrer Besorgniserregung bewertet werden. Mit dem BARO können Jugendliche und Eltern/Bezugspersonen separat interviewt werden, Drittinformationen wie z.B. von der Schule, Polizei oder anderen Institutionen können in die Auswertung mit einfließen. Die Wichtigkeit, in den Abklärungsprozess jugendlicher Straftäter auch die Angaben von Drittpersonen zu integrieren, wird mit diesem Instrumentarium deutlich unterstrichen. Das Screeninginstrument BARO besteht aus fünf Teilen: 1. Das Personalblatt, welches Platz bietet zur Erfassung aller sachlichen Informationen bezüglich des Jugendlichen, der Familiensituation und der Schule sowie juristischer Informationen. 2. Das BARO Interview selber, zur Erfassung der oben erwähnten neun Bereiche. 3. Das Auswertungsschema, bei welchem der Untersucher/Interviewer das Maß der besorgniserregenden Faktoren für jeden einzelnen Bereich bewerten kann. Ferner werden mit diesem Auswertungsschema die Indexfragen bewertet, die nachfolgend von einem Computerprogramm ausgewertet werden. 4. Das Beschlussblatt beinhaltet einen Entscheidungsbaum welcher dem Sozialarbeiter dabei zu einen Ratschlage oder einer Entscheidung zu kommen. Die daraus resultierenden Indikationen bezüglich einer ambulanten oder stationären Begutach- 30 tung sowie zu den Schutzmassnahmen werden hier festgehalten. 5. Der letzte Abschnitt ist eine Checkliste für die Erstellung des Berichts. Hier werden Kriterien dargelegt, welche die wichtigsten Informationen für den Bericht enthalten. Für die Validierung des BAROs wurden zur Erfassung von Psychopathologien das Diagnostische Interview bei psychischen Störungen (DIPS) [18, 19] sowie die Checkliste zur Erfassung von Persönlichkeitsstörungen nach DSMIV (SKID II: Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV, Achse II) [29] verwendet. 4. Ergebnisse Reliabilität Unter der Reliabilität eines diagnostischen Instruments versteht man den Grad an Genauigkeit, mit dem ein bestimmtes Merkmal gemessen wird. Reliabilität bezeichnet somit die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen unter gleichen, intersubjektiven Bedingungen. Als zentrales Reliabilitätsmass wird die „Interne Konsistenz“ (Cronbach’s Alpha) angegeben. Die „Interne Konsistenz“ der fünf Indexfragen, die dem Jugendlichen gestellt wurden, ist mit α = .69 akzeptabel, jene der fünf Indexfragen, die den Eltern gestellt wurden, mit α = .56 eher schlecht. Die Gesamtsumme der internen Konsistenz ist mit α = .80 zufrieden stellend (Tab. 3). Interrater Reliabilität Zur Überprüfung der Interrater Reliabilität der Indexfragen wurde der Kappa-Koeffizient nach Cohen (für zwei Beobachter) verwendet. Die Interrater Reliabilität gibt an, ob verschiedene Anwender anhand derselben Informationen zu den gleichen Ergebnissen gekommen sind. Zur Überprüfung der Interrater Reliabilität wurden die Indexfragen durch einen zweiten Beurteiler bewertet. Die Beurteilerüberein- stimmung zwischen den zwei Beurteilern (Sozialarbeiter beim Jugendgericht und forensischer Experte) ist mit Kappa = .84; und p < .001 sehr gut (Tab. 3). Diskriminante Validität Die diskriminante Validität des Instruments wurde mittels der „Receiver Operator Curve“ (ROC) berechnet. Dazu wurden die Auswertungen der Indexfragen durch den Sozialarbeiter des Jugendgerichtes und die dadurch erlangten Ergebnisse mittels BARO, mit denjenigen der Instrumente, welche in der forensischen Begutachtung verwendet wurden (DIPS, SKID II), verglichen. Die ROC-Kurve zeigt die Sensitivität und Spezifität des Instruments bei der Erkennung einer psychischen Störung bei unterschiedlichen Cut-off points an. Mit der Sensitivität wird die Anzahl der richtig positiven Vorhersagen bezeichnet. Unter der Spezifität eines Tests wird die Anzahl der richtig negativen Vorhersagen verstanden. Die Beziehung zwischen den richtig positiven und richtig negativen Fällen wird durch die ROC-Kurve dargestellt. Die Fläche unter der Kurve (AUC: Area under the Curve) zeigt die Gesamtheit der Sensitivität und Spezifität bei den unterschiedlichen cut-off points. Ein AUC-Wert von .50 (also 50%) entspricht der Zufallswahrscheinlichkeit einer Vorhersage, Werte >.50 weisen auf eine Vorhersagegenauigkeit hin, die über der Zufallswahrscheinlichkeit liegt. Ein Wert von 1.0 bildet eine perfekte Vorhersage ab. Bezüglich der Nützlichkeit des BAROs wurde den Anwendern mittels eines eigens konstruierten Fragebogens offene Fragen zur Einschätzung des Zeitaufwandsfaktors, der Handhabbarkeit und der allgemeinen Zufriedenheit mit dem Instrument gestellt. Die Fläche unter der Kurve (AUC) ist mit .84 als gut einzuschätzen, wenn nur die Indexfragen der Jugendlichen herangezogen werden (95% Konfidenz Intervall: 0.76 – 0.91, p < .0001). Der optimale cut-off point liegt bei 8.5 und Erfassung von Psychopathologien bei straffälligen Jugendlichen Indexfragen* 31 Dazugehörige Fragen J1 Bist du ausser Haus schon einmal geschlagen worden? Weshalb und womit? Hattest du schon einmal Verletzungen davon getragen? Bist du nach einem Schlag schon einmal bewusstlos gewesen oder ist dir schlecht geworden? Was war der schlimmste Streit, bei dem du jemals beteiligt warst? (J1) J2 Hast du jemals geschwänzt? Wie oft? Wieso? Wie gehst du mit den Klassenkameraden um? Wirst du gehänselt? Bist du einer der hänselt? (J 2) J3 Welche Wirkungen hat das Konsumieren von Alkohol, Gras und anderen Drogen auf dich? Hast du zum Beispiel schon Halluzinationen, Schmerzen, Ängste? Hast du schon einmal Hilfe gesucht, weil du Probleme mit solchen Nebenwirkungen hattest? J4 Hast du oft Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit oder Schwindel? Hast du sonst irgendwelche Schmerzen? Weißt du, woher die kommen? Hast du manchmal so starke Schmerzen, dass du Sachen nicht mehr tun kannst? J5 Hast du jemals in einem Heim gewohnt? Wie oft? E1 Wie oft hatte x schon Kontakt mit der Polizei? E2 Haben Sie (Vater) Kontakt (gehabt) mit dem psychiatrischen Dienst? E3 E4 E5 Was hören Sie über sein Verhalten in der Schule? Hat x oft Probleme mit den Lehrern? Oder dass er sich öfters als normal schlecht fühlt? Haben Sie manchmal Angst, dass er sich etwas antun könnte? Welche gefährlichen Sachen machte x früher? *J1 – J5 Indexfragen für den Jugendlicher; E1 – E5 Indexfragen für die Eltern Tabelle 3: 10 Indexfragen Abbildung 1: ROC-Kurve der Indexfragen des Jugendlichen (J1 – J5) steht im Zusammenhang mit einer Sensitivität von 84% und einer Spezifität von 73% (Abb. 1). Werden nur die Elternindexfragen hergenommen, ist der AUC mit .86 ebenfalls gut (95% CI: .79 – .93, p < .0001). Der optimale cut-off point liegt hier ebenfalls bei 8.5 und steht im Zusammenhang mit einer Sensitivität von 78% und einer Spezifität von 82% (Abb. 2). AUC .837 Signifikanz .000 95% Konfidenz Intervall Standard Fehler Untere Grenze Obere Grenze .038 .763 .910 Der AUC für die Indexfragen des Jugendlichen und der Eltern erreicht mit .88 (95% CI: .82 - .95, p < .0001) ein gutes Resultat. Der optimale cut-off point von 16.5 hat eine Sensitivität von 86% und eine Spezifität von 84% (Abb. 3). D. Gutschner et al. Abbildung 2: AUC .859 Abbildung 3: 32 ROC-Kurve der Indexfragen der Eltern (E1 – E5) Signifikanz .000 95% Konfidenz Intervall Standard Fehler Untere Grenze Obere Grenze .036 .787 .930 ersichtlich (Mehrfelder Chi-Quadrat Test p = .01). Die Delikttypen orientieren sich an den Straftatbeständen. Bei der Gruppe „Psychopathologie vorhanden“ war am häufigsten Diebstahl (22%) vertreten, gefolgt von Sachbeschädigung (16%), Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (15%), Körperverletzung (15%), Einbruch (11%), Nötigung (6%), Raub (5%), Sexualdelikte (5%), Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz (2%) und Irreführung der Rechtspflege (2%) (Abb. 4). Das heißt, dass die delinquenten Jugendlichen, bei denen eine psychische Störung hat festgestellt werden konnte, signifikant mehr Körperverletzungen, Einbrüche und Raube begingen, als diejenigen als diejenigen, die keine Diagnose gestellt bekamen (bzw. signifikant weniger Verstoße gegen das Straßenverkehrsgesetz verübten als diejenigen, die keine Diagnose gestellt bekamen. ROC-Kurve der Gesamtindexfragen (J1 – E5) Nützlichkeit und Ökonomie AUC .882 Signifikanz .000 95% Konfidenz Intervall Standard Fehler Untere Grenze Obere Grenze .034 .815 .950 Deliktunterschiede Zwischen Jugendlichen, bei denen mittels BARO eine psychische Auffälligkeit ermittelt wurde, und jenen ohne ermittelte Psychopathologie können keine signifikanten Unterschiede bezüglich des Geschlechts (Chi-Quadrat χ2: p = .614) oder der Altersverteilung (t-test: p = .619) gefunden werden. Signifikante Unterschiede waren jedoch in Bezug auf die begangenen Straftaten Den BARO-Anwendern (n = 16) wurden offene Fragen bezüglich der Nützlichkeit und Anwendbarkeit gestellt (Tab. 4). Uns interessierte vor allem der Zeitfaktor (zeitlicher Aufwand) und wie sie das strukturierte und standardisierte Vorgehen persönlich bewerten. Eine Verkürzung der Abklärungszeit wurde von allen befragten Fachpersonen hervorgehoben, wobei diese zum Teil bis zu einem Monat betrug. Als positiv bewertet wurde zudem, dass alle straffälligen Jugendlichen nach den gleichen Kriterien abgeklärt werden, was die rechtsgleiche Behandlung innerhalb der Kantone verbessern kann und die Vergleichbarkeit erhöht. Als weiteres Ergebnis wurde seitens der Interviewten (meistens der Eltern) angegeben, dass sie sich mit dieser Art der Befragung „aufgehobener“ fühlten und eher bereit waren, Auskunft über schwierige Themen zu geben. In Ergänzung zu diesem Resultat wurde von den Anwendern angegeben, dass durch diese Art der Befragung das Informationsmaterial über die Situation der Klienten Erfassung von Psychopathologien bei straffälligen Jugendlichen Abbildung 4: 33 Deliktunterschiede te manchen Anwendern etwas Mühe. Etwa 10% aller Anwender bevorzugten die vorherige Arbeitsweise und kritisierten das klar strukturierte und standardisierte Vorgehen des BAROs. Insgesamt kann diese Auswertung jedoch als sehr positiv betrachtet werden. 5. Diskussion Verkürzte sich die Abklärungszeit durch die Anwendung des Screeninginstrument BARO? ja 75.0% Zeitverkürzung längere Bearbeitungszeit 25.0% um eine Woche 18.8% um zwei Wochen 18.8% um einen Monat 37.5% Wie beurteilen Sie die Handhabbarkeit des Screeninginstruments BARO? nicht einsetzbar 6.0% schwierig einsetzbar 25.0% gut einsetzbar 50.0% sehr gut einsetzbar 19.0% Wie empfinden Sie das strukturierte und standardisierte Arbeiten mittels BARO? schlecht 19.0% gut 81.0% Bevorzugen Sie die vorherige Arbeitsweise? ja 13.0% Weitere Angaben großer Zeitaufwand 19.0% Eltern fühlten sich aufgehobener 25.0% Informationen sind reichhaltiger 44.0% Gleichbehandlung zwischen den Jugendlichen 44.0% Tabelle 4: Fragen zur Nützlichkeit und Ökonomie (n=16) reichhaltiger geworden ist und die richterlichen Beschlüsse in weiterer Folge differenzierter gefasst werden können. Das strukturierte Arbeiten bereite- Die Sozialarbeiter bei den Jugendgerichten in der Schweiz haben die Aufgabe, straffällige Jugendliche und deren soziales Umfeld abzuklären und dem Jugendgericht Vorschläge zu den weiteren strafrechtlichen Maßnahmen zu unterbreiten. Falls es Hinweise für physische oder psychische Störungen bei den Jugendlichen gibt, sieht der Gesetzgeber eine vertiefende medizinische oder psychologische Begutachtung vor. Es ist jedoch sehr schwierig, solche Entscheidungen/Beurteilungen zu treffen, da die Fälle im Jugendstrafrecht immer komplexer und schwieriger zu erfassen sind. Auch, weil es bis anhin keine standardisierten und strukturierten Instrumente gegeben hat, die diese Arbeit erleichtert hätten und mit denen diese Entscheidungen nach einheitlichen Kriterien hätte durchgeführt werden können. Für die Zuweisung zur psychologisch/psychiatrischen Begutachtung ist normalerweise der Schweregrad der Delikte ausschlaggebend und nicht der Gesundheitszustand des Straftäters [2, 7, 8]. Da aber viele internationale Studien auf eine hohe Prävalenz psychischer Störungen bei straffälligen Jugendlichen hinweisen [4, 17, 20, 21, 25, 27, 14] sollten genau diese auch bei der Maßnahmenimplementierung eine wichtige Rolle spielen. Zudem ist es ein wichtiger Punkt, dass viele dieser Straftäter noch nicht einmal tiefer gehend begutachtet worden sind [26]. Das Wissen über die Prävalenz psychischer Störungen in dieser Population ist für weitere Prognosen [15, 23, 22], für die Bestimmung strafrechtlicher D. Gutschner et al. Maßnahmen, für die Erforschung der Rückfallwahrscheinlichkeit [27] sowie zur Erstellung von Präventionsprogrammen elementar. Ein Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein einer psychischen Störung und der Rückfälligkeit konnte deutlich aufgezeigt werden [5, 17, 20, 21, 25, 26, 13]. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass das BARO als Ersterfassungsinstrument bei den Jugendstrafbehörden über gute psychometrische Eigenschaften verfügt. Die Reliabilität zeigt die Wichtigkeit auf, dass Informationen sowohl von den Jugendlichen als auch von den Eltern mit in die Bewertung mittels BAROs einfließen sollten. Denn die Reliabilität innerhalb der Indexfragen betreffend die Jugendlichen konnte mittels Hinzunahme der Indexfragen der Eltern von .69 auf .80 gesteigert werden, was die Wichtigkeit des Einfließens der elterlichen Erfahrung und Meinung befürwortet. Die Ergebnisse der ROC-Kurve (Receiver Operator Curve) weisen auf eine gute Validität des Screeninginstrument hin, wenn die Indexfragen von den Eltern und den Jugendlichen gemeinsam verwendet werden. Die Nützlichkeit und die Handhabbarkeit werden von den Sozialarbeitern an den Jugendgerichten als gut beurteilt. Weiter weisen diese darauf hin, dass durch dieses Vorgehen klare Indikatoren erhoben werden und der weitere Bedarf strafrechtlicher Maßnahmen nachvollziehbarer und überprüfbarer wird. Erfreulich sind die Aussagen, dass durch dieses standardisierte und strukturierte Vorgehen Zeit eingespart werden konnte. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass das BARO ein gutes und zuverlässiges Screeninginstrument ist, um im Erstkontakt der Jugendlichen mit den Jugendgerichten diejenigen Delinquenten herauszufiltern, die eine psychische Störung aufweisen. Die klinische Auswirkung dieser Ergebnisse darf nicht unterschätzt werden, da psychische Störungen bei straffälligen 34 Jugendlichen häufig zu finden sind [28] und diese Störungen normalerweise oft unbemerkt bleiben. Ohne eine strukturierte Erfassung von straffälligen Jugendlichen ist es kaum möglich, Entscheidungen über das weitere strafrechtliche Vorgehen zu treffen. D.h., ob beispielsweise eine Heimeinweisung notwendig ist, eine sozialpädagogische Familienbegleitung genügt oder ob dieser Jugendliche nur zu „bestrafen“ ist etc. Auch kann ohne strukturierte Erfassung keine valide Beurteilung über allfällige Störungen gemacht werden. Diese Erkenntnisse sollten für die weitere Zukunft in der Ersterfassung straffälliger Jugendlicher Anklang finden. Obwohl dem BARO gute bis sehr gute Eigenschaften zuerkannt werden können, ist einschränkend zu bemerken, dass der Zeitaufwand zu groß ist, um alle Jugendlichen, die mit der Jugendstrafbehörde in Kontakt kommen, zu interviewen. Auch bedarf es zum Teil einer Umstrukturierung des Ablaufes bei der Behörde und eines unabdingbaren entsprechenden Trainings der zukünftigen Anwender. Ohne diese Schulung ist die Zuverlässigkeit des Interviews nicht gewährleistet. Die Interviewer müssen über die Interviewtechnik und über Grundlagen der Entwicklungspsychologie und Psychopathologie verfügen und geschult werden. Da neuere Forschungen im Bereich der Jugendkriminalität zeigen, dass psychische Störungen bei straffälligen Jugendlichen immer häufiger auftreten, ist es umso wichtiger, Sozialarbeiter, die u.a. mit straffälligen Jugendlichen arbeiten, bezüglich psychischen Störungen und deren Auswirkungen zu schulen, vor allem wenn dies Sozialarbeiten mit nicht adäquaten beruflichem Hintergrund sind. Mit dem BARO werden keine Diagnosen nach den internationalen Klassifikationsschematas DSM-IV oder ICD10 erhoben. Das BARO gibt Auskunft, ob eine psychische Störung vorhanden ist, und ob eine weitere Begutachtung indiziert ist. Es ersetzt aber in keiner Weise eine weitere psychologisch/psychiatrische Begutachtung. Vorhandene psychische Störungen müssen von forensisch erfahrenen Fachpersonen genauer diagnostiziert werden, da diese eine erhebliche Rolle in der Ausführung weiterer strafrechtlicher Maßnahmen oder Hilfestellungen spielen. Bislang wurde das BARO ins Deutsche, Englische, Finnische, Russische und Italienische übersetzt. Die Validierungsstudie der deutschen Version in der Schweiz ist abgeschlossen [12]. In Finnland wurde zusätzlich eine elektronische Version des BARO entwickelt: Der E-BARO. Auch ist für die Ersterfassung von jugendlichen Sexualstraftätern das Zusatzinterview S-BARO (Sexual BARO) entwickelt worden. So wie beim BARO war die Zielsetzung, ein Screeninginstrument zu entwickeln, mit welchem bei jugendlichen Sexualstraftätern eine erste Selektion ermöglicht wird, um diejenigen herauszufiltern, die weitere Abklärungen oder eine Begutachtung benötigen. Wichtig war es, diejenigen Jugendlichen zu erfassen, die eine mittlere Problematik aufweisen, da diese viel schwerer zu erfassen sind, als diejenigen mit einem schwerproblematischen oder eher wenig problematischen Hintergrund. Der BARO macht keine Vorhersagen über die Rückfallgefahr, denn dafür ist ein Risikoeinschätzungsinstrument geeigneter als ein Screeninginstrument [6]. Die fortschreitend verbreitete Anwendung der BAROs wird, auch im Ländervergleich, weitere Erkenntnisse bezüglich der Einsetzbarkeit dieses diagnostischen Instruments erbringen. Generell kann jedoch gesagt werden, dass der BARO ein standardisiertes Vorgehen im gerichtlichen Erstkontakt mit den Jugendlichen ermöglicht. Würde er vielerorts angewendet, so wäre eine Vergleichbarkeit gegeben, wie auch eine Rechtsgleichheit was die Behandlung der devianten Adoleszenten anbelangt. Weiter kann der BARO Aussagen über die Psychopathologie machen und diesbezüglich eine adäquate Schutzmass- Erfassung von Psychopathologien bei straffälligen Jugendlichen nahme ermöglichen, angepasst an die Bedürfnisse des Jugendlichen. Somit können möglicherweise die Rückfälle in den devianten Verhalten verringert werden. [9] [10] Literatur [1] Achenbach T.M.: Manual for the Child Behavior Checklist/4-18 and 1991 Profile. University of Vermont, Department of Psychiatry. Burlington 1991. [2] Chevallaz-Rösch A.M.: Kriterien für die richterliche Anordnung einer psychologisch-psychiatrischen Begutachtung jugendlicher Delinquenten. Unveröffentlichte Diplomarbeit an der Universität Bern 2000. [3] Doreleijers T.A.H., Bij B., van der Veldt M.C., van Loosbroek E.: BARO Standaardisering en Protocollering, Basisanderzork Strafzaken, Raad voor de Kinderbescherming. Nederlands Instituut voor Zorg en Welijn, Vrije Universiteit Amsterdam 1999. [4] Doreleijers T.A.H., Spaander M.: The development and implementation of the BARO: A new device to detect psychopathology in minors with first police contacts. In: Corrado R.R., Roesch R., Hart S.D., Gierowski J.K. (Eds.): Multi-problem violent youth: A foundation for comparative research on needs, interventions and outcomes. IOS Press, Amsterdam, 232-240 (2000). [5] Doreleijers T.A.H., Moser F., Thijs P., van Engeland H., Beyaert F.H.L.: Forensic assessment of juvenile delinquents: prevalence of psychopathology and decision- making at court in the Netherlands. Journal of Adolescence 23, 263–75 (2000). [6] Doreleijers T.A.H., Jäger M., Gutschner D.: Screening und Diagnostik bei delinquenten Jugendlichen. In: Steinhausen H.-C., Bessler C. (Hrsg): Jugenddelinquenz. Kohlhammer, Stuttgart 2007. [7] Fegert J.M., Häßler F., Schnoor K., Rebernig E., König C., Auer U., Schläfke D.: Bestandsaufnahme und Qualitätssicherung der forensisch-psychiatrischen Gutachtertätigkeit in Mecklenburg-Vorpommern bei Tötungs- und Brandstiftungsdelikten. Books on Demand, Norderstedt 2003. [8] Fegert J.M., Schnoor K., König C., Schläfke D.: Psychiatrische Begutachtung in Sexualstrafverfahren. Eine empirische Untersuchung von Gutachten zur Schuldfähigkeit bei jugendlichen, heranwachsenden und erwachsenen Beschul- [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] digten in Mecklenburg-Vorpommern. Centaurus, Herbolzheim 2006. Goodman R.: The Strengths and Difficulties Questionnaire. A research note. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines 38(5), 581586 (1997). Grisso T., Barnum R., Fletcher K., Cauffman E., Peuschold D.: Massachusetts Youth Screening Instrument for Mental Health Needs of Juvenile Justice Youths. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 40(5), 541-548 (2001). Gutschner D., Doreleijers T.A.H.: Das Screeninginstrument BARO zur Erstbeurteilung von jugendlichen Straftätern. Zeitschrift für interdisziplinäre Fortbildung Nervenheilkunde 20, 33-39 (2004). Gutschner D., Doreleijers T.A.H.: Das Screeninginstrument BARO.ch für sozial auffällige Jugendliche. Vierteljahresschrift der Heilpädagogik 73, 191-202 (2004). Gutschner D.: Welche Maßnahmen machen einen Sinn? Auszug der Ergebnisse einer 25jährigen prospektiven Langzeitstudie mit dissozialen Jugendlichen in der Schweiz. In: Saimeh N. (Hrsg.): Was wirkt? Prävention – Behandlung – Rehabilitation. Psychiatrie-Verlag, Bonn, 86 – 96 (2005). Gutschner D., Kobel B., Niklaus P.: Strafrechtliche Begutachtung im Kindes- und Jugendalter in der Schweiz. In: Dahle K.P., Volbert R. (Hrsg): Aspekte der Rechtspsychologie. Hogrefe, 70 – 79 (2005). Lempp R.: Gerichtliche Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hans Huber, Bern 1983. Lempp R., Schütze G., Köhnken G.: Forensische Psychiatrie und Psychologie des Kindes- und Jugendalters. Steinkopff Verlag, Darmstadt 1999. Loeber R.: Natural histories of conduct problems, delinquency, and associated substance use: evidence for developmental progression. In: Lahey B.B., Kazdin A. (Eds.): Advances in Clinical Psychology 11, 73-124 (1988). Margraf J., Schneider S., Ehlers A. (Hrsg): DIPS - Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen. Springer, Berlin 1991. Margraf J., Schneider S., Ehlers A. (Hrsg): Kinder DIPS - Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen. Springer, Berlin 1994. Moffitt T.E.: Juvenile delinquency and Attention Deficit Disorder. Developmental trajectories from age 3 to 15. Child Development 61, 893-910 (1990). 35 [21] Moffitt T.E.: The neuropsychology of conduct disorder. Development and Psychopathology 5, 135-152 (1993). [22] Nedopil N.: Forensische Psychiatrie. Klinik, Begutachtung und Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht. Thieme 1996. [23] Remschmidt H.: Forensische Kinder- und Jugendpsychiatrie. Huber, Bern 1997. [24] Snyder H.N.: Juvenile Arrests 2003. Juvenile Justice Bulletin. U.S. Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention 2005. [25] Steiner H., Garcia I., Matthews Z.: Posttraumatic Stress disorder in incarcerated juvenile delinquents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 36, 357-365 (1997). [26] Vermeiren R., De Clippele A., Deboutte D.: A descriptive survey of Flemish delinquent adolescents. Journal of Adolescence 23, 277-285 (2000). [27] Vermeiren R.: Predicting Recidivism in Delinquent Adolescents from Psychological and Psychiatric Assessment. Comprehensive Psychiatry 43, 142-149 (2002). [28] Vermeiren R.: Psychopathology and delinquency in adolescents: a descriptive and developmental perspective. Clinical Psychology Review 23, 277-318 (2003). [29] Wittchen H.-U., Zaudig M., Fydrich T.: SKID. Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV. Achse I und II. Hogrefe, Göttingen 1997. Dr. Daniel Gutschner Institut für forensische Kinder- und Jugendpsychologie, -psychiatrie und -beratung Bern [email protected]; www.ifkjb.ch Original Original Neuropsychiatrie, Band 25, Nr. 1/2011, S. 36–43 Prävalenz psychischer Störungen bei älteren Langzeitarbeitslosen – Ein Vergleich von Ergebnissen aus dem Projekt KompAQT mit Daten aus dem Bundesgesundheitssurvey Iris Liwowsky1, Roland Mergl2, Antje-Kathrin Allgaier3 und Ulrich Hegerl2 Klinik und Poliklink für Psychiatrie und Psychotherapie, Ludwig-Maximilians-Universität München 2 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie der Universität Leipzig 3 Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Ludwig-Maximilians-Universität München 1 Schlüsselwörter: Langzeitarbeitslosigkeit – höheres Alter – psychische Störungen – Prävalenz – ­affektive Störungen Keywords: long-term unemploymen – elderly – mental disorder – prevalence – mood disorders Prävalenz psychischer Störungen bei älteren Langzeitarbeitslosen. Ein Vergleich von Ergebnissen aus dem Projekt KompAQT mit Daten aus dem Bundesgesundheitssurvey Anliegen: Pilotstudie zur Ermittlung von Prävalenzraten für psychische Störungen bei älteren Langzeitarbeitslosen Methode: Vergleich der Prävalenzraten psychischer Störungen aus einem Förderprojekt für langzeitarbeitslose Menschen mit den entsprechenden ge­schlechts-, alters- und familienstandsadjustierten Prävalenzraten für die Allgemeinbevölkerung aus dem Bundesgesundheitssurvey. Ergebnis­ se: In Relation zur Allgemeinbevölkerung ergaben sich für die älteren © 2011 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Langzeitarbeitslosen deutlich erhöhte Prävalenzen, spezifisch in der Gruppe der affektiven Störungen. Aufgrund der kleinen Stichprobe und der eingeschränkten Repräsentativität sind die Ergebnisse nur bedingt generalisierbar. Schlussfolgerungen: Die Fragestellung sollte mit adäquaten Methoden in einer größeren, repräsentativen Stichprobe weiter untersucht werden. Prevalence of mental disorders in the elderly long-term unemployed. Comparison of results of the project KompAQT and the German National Health Interview and Examination Survey Objective: Unemployed persons have a higher risk for mental disorders. There is some evidence that this risk is even greater for the elderly longterm unemployed. This study assesses the prevalence of mental disorders in this group. Methods: This pilot study was conducted within a programme for assisting long-term unemployed subjects to re-enter the workforce. 12-month prevalences for mental disorders according to ICD-10 were calculated using the DIA-X Structured Clinical Interview. Prevalence rates were compared to those of the German National Health Interview and Examination Survey, Mental Health Supplement in the community. Prevalence rates were adjusted concerning sex, age and family status. Results: Compared to the prevalence rate in the general population, prevalence rates for the elderly long-term unemployed were elevated only for mood disorders. 12-month prevalence rates were 32.18% for depressive disorders and 37.58% for dysthymia. There are some methodological limitations like selectivity of the sample that may influence the validity of the results. Conclusions: The risk for depressive disorder in elderly long-term unemployed persons should be investigated with adequate methods in a larger representative sample. Einleitung Bei Langzeitarbeitslosen, also Perso­ nen, die länger als ein Jahr arbeitslos gemeldet sind, bilden die über 50Jährigen mit 62,3% den größten Teil [5]. Nicht nur die Anzahl, sondern auch die Dauer der Arbeitslosigkeit ist in der Gruppe der älteren Arbeitslosen erhöht [4]. Der Anteil der Menschen über 55 Jahre wird zwischen 2010 und 2030 um 15,5% steigen [13]. Zugleich wird das Renteneintrittsalter Prävalenz psychischer Störungen bei älteren Langzeitarbeitslosen von 65 Jahren auf 67 Jahre erhöht. Die Personengruppe der über 50Jährigen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, wird sich somit weiter erhöhen. Die Europäische Union hat im Grünbuch die Bedeutung einer zeitgemäßen und modernen psychiatrischen Gesundheitsversorgung bekräftigt. Dies schließt die Prävention psychischer Erkrankungen und die Berücksichtigung bislang vernachlässigter, besonders vulnerabler Bevölkerungsgruppen ein [vgl. 15]. Die gesundheitlichen Risiken von Arbeitslosigkeit wurden in vielen Studien untersucht [2, 8]. Für die Erklärung dieses Zusammenhangs werden im Wesentlichen zwei Hypothesen herangezogen [2]: Die Kausalitätshypothese [9] sieht Arbeitslosigkeit als eigenständigen Risikofaktor und besagt, dass der Eintritt von Arbeitslosigkeit kausal zu psychischen und physischen Beschwerden, zu Krankheit und sogar Tod führt. Nach der Selektionshypothese [6] tritt Arbeitslosigkeit als Folge schlechter Gesundheit ein. Personen, die häufiger und länger krank sind, haben ein höheres Risiko, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, und sind im Sinne einer Auslese vermehrt von Arbeitslosigkeit betroffen. Einige Untersuchungen zeigten, dass beide Hypothesen ihre Berechtigung haben. Personen, die eine schlechtere Gesundheit aufweisen, werden häufiger arbeitslos, wodurch ihr Zustand sich verschlechtert, was wiederum die Chancen auf dem Arbeitsmarkt senkt [3, 8]. Die belastende Wirkung von Arbeitslosigkeit ist abhängig vom sozialen, wirtschaftlichen und persönlichen Kontext. Moser und Paul [17] fanden in ihrer Metaanalyse, dass insbesondere Langzeitarbeitslose unter den psychischen Folgen von Arbeitslosigkeit leiden. In einer aktuellen deutschen Studie [19] kann auf der Grundlage der Daten des sozioökonomischen Panels von 1984-2001 festgestellt werden, dass Personen über 50 Jahre die Folgen der Arbeitslosigkeit als schwerwie- gender empfinden als jüngere. Viele ältere Langzeitarbeitslose verfügen über ein sehr geringes Einkommen (Hartz IV). Finanzielle Bedrohung ist bei Arbeitslosen mit erhöhten Depressivitätswerten assoziiert [16]. Der Schluss, dass die psychische Befindlichkeit bei Langzeitarbeitslosigkeit beeinträchtigt ist, liegt nahe, bedeutet aber nicht zwangsläufig eine Zunahme psychiatrischer Erkrankungen. Eben diese Unterscheidung ist wesentlich, da bei psychiatrischen Erkrankungen, vor allem bei depressiven Störungen, evidenzbasierte Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Nur wenige Untersuchungen erheben Daten zur psychischen Gesundheit Langzeitarbeitsloser unter Verwendung strukturierter diagnostischer Interviews. Rose und Jacobi [20] berichten bei Arbeitslosen eine Prävalenz von affektiven Störungen von 20%. Hämäläinen et al. [10] belegen in ihrer Untersuchung ein erhöhtes Risiko depressiver Episoden bei Langzeitarbeitslosen. Hierbei ist die Chance arbeitsloser Männer, von einer depressiven Störung betroffen zu sein, um den Faktor 2,5 größer als in der Gruppe der erwerbstätigen Männer. Es ist anzunehmen, dass in der Gruppe der älteren Langzeitarbeitslosen ein beträchtlicher Prozentsatz an psychischen Störungen besteht, die bisher nicht diagnostiziert und nicht behandelt sind. Diese zu erkennen ist sowohl aus medizinischen, als auch aus arbeitsmarktpolitischen Gründen dringend erforderlich. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Prävalenzraten psychischer Störungen aus einem Förderprojekt für langzeitarbeitslose Menschen mit den entsprechenden geschlechts-, alters- und familienstandsadjustierten Prävalenzen aus der Allgemeinbevölkerung zu vergleichen. 37 Material und Methode Studiendesign Die Daten der älteren Langzeitarbeitslosen wurden im Rahmen des Förderprojektes KompAQT- Kompetenznetz für Arbeit, Qualifizierung und Transfer erhoben, welches seit Oktober 2005 in München durchgeführt wird. Als Vergleichsgruppe dienen die Daten einer repräsentativen Stichprobe zu psychischen Störungen in der Allgemeinbevölkerung. Diese wurden dem Zusatzsurvey „Psychische Störungen“ des Bundesgesundheitssurveys 1998/99 (BGS) entnommen [22]. KompAQT Die vorliegende Forschungsarbeit stellt eine Zusammenarbeit der Ar­beits­gemeinschaft (Arge) für Be­schäf­tigung, München und des Hu­man­wissenschaftlichen Zen­ trums der Lud­wig-MaximiliansUni­versität München dar. Das Projekt KompAQT ist eingebet­ tet in das Programm „Perspektive 50plus – Beschäftigungspakete für Ältere in den Regionen“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Verbesserung der Be­schäftigungschancen älterer Langzeitarbeitsloser. Inhaltlich widmet es sich der Integration von Langzeitarbeitslosen über 50 Jahre in den Arbeitsmarkt (nähere Information unter www.kompaqt.de). Die Datenerhebung erfolgte im Zeitraum von September 2006 bis Februar 2007. Im Rahmen des Pro­jektes wurden wöchentlich As sessmentveranstaltungen durchgeführt, um die Langzeitarbeitslosen kennenzulernen. Die Rekrutierung der Teilnehmer für das klinische Interview erfolgte während dieser Veranstaltungen und wurde von einer projektunabhängigen Mitarbeiterin der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt. Hierbei wurden Informationsblätter und I. Liwowsky et al. Einverständniserklärungen verteilt. Nach schriftlicher Zustimmung wurden die diagnostischen Interviews innerhalb einer Woche telefonisch von einer geschulten Interviewerin durchgeführt und mit 20 Euro vergütet. Die Äquivalenz von telefonischer Darbietung und vis-à-visDurchführung wurde für verschiedene klinische Interviews in Studien bestätigt (vgl. z.B. [18]). Speziell für die deutsche Version des in dieser Studie eingesetzten Instruments wurde die Vergleichbarkeit beider Darbietungsformen bislang noch nicht belegt. Alle im Studienverlauf erhobenen Daten wurden vertraulich behandelt und anonymisiert. Für das Stu­ dien­protokoll sowie die schriftliche Einverständniserklärung zum Tele­ foninterview wurde das positive Votum der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der LMU München eingeholt. Bundesgesundheitssurvey Design, Methodik und Gesamtstichprobe des Bundesgesundheitssurveys sind an anderer Stelle bereits ausführlich beschrieben [12], weshalb im Folgenden nur Basisangaben berichtet werden. Die Daten aus der Allgemeinbevölkerung wurden im Rahmen des Zusatzsurveys „Psychische Störungen“ des Bundes-Gesundheitssurveys 1998 erhoben, der ersten bundesweiten epidemiologischen Untersuchung psychischer Gesundheit der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland [12]. Der Kernsurvey wurde vom RobertKoch-Institut durchgeführt, der Zusatzsurvey „Psychische Störungen“, eines von mehreren Zusatzmodulen des Kernsurveys, wurde vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie durchgeführt. Der Datenerhebung des Zusatzsurveys liegt ein zweistufiges Design zugrunde. In einem ersten Schritt wurden alle Teilnehmer des Kernsurveys (N=7124) mit dem Münchner Composite International 38 Diagnostic Interview-Stammfragebogen (M-CIDI-S) gescreent. Im zweiten Schritt wurden alle screening-positiven und 50% der screening-negativen Teilnehmer mit dem diagnostischen Interview M-CIDI untersucht. Die Stichprobengröße des Zusatzsurveys beträgt N=4181 (konditionale Response-Rate: 87,6 % [12]). Untersuchungsinstrumente Beide Projekte arbeiteten mit dem Münchner Composite International Diagnostic Interview (DIA-X/MCIDI) [23], einer überarbeiteten und computergestützten Version des von der World Health Organisation entwickelten Composite International Diagnostic Interview (CIDI) [24]. Es ermöglicht eine reliable und valide Erhebung von Symptomen, Syndromen und Diagnosen psychischer Störungen nach DSM-IV und ICD10 (4-Wochen-, 12-Monats- und Lebenszeitprävalenz). Hinsichtlich seiner Testgütekriterien kann das CIDI bzw. DIA-X als mehrfach geprüftes, bewährtes Instrument gelten. Die Reliabilität des DIA-XInterviews ist als gut zu bezeichnen. Die Interraterreliabilität erreicht Kappa-Werte zwischen .82 bis .98 für diagnostische Entscheidungen. Die Test-Retest-Reliabilität ist insgesamt befriedigend hoch. Auch im Hinblick auf die Validität erweist sich das DIA-X als zufriedenstellendes Instrument [1, 21]. Neben den Diagnosemodulen wurden der Schweregrad einer Erkrankung und das Hilfesuchverhalten erfragt. Die mittlere Dauer der Durchführung des Interviews beträgt 45 Minuten. Das M-CIDI wurde in beiden Projekten von klinisch erfahrenen, trainierten Interviewern durchgeführt. In Rahmen des Projekts KompAQT wurden alle Interviews ausschließlich von einer Mitarbeiterin erhoben, so dass keine Bestimmung der Interraterreliabilität erforderlich ist. Das Training umfasste eine Einarbeitung in alle Sektionen entsprechend des Instruktionsmanuals zur Durchführung des Interviews [21]. Die Auswertung erfolgte computerisiert über das Standard-DIAX/M-CIDI-Programm und ist somit auswertungsobjektiv. Datenanalyse Unter Verwendung des Programms „G*Power“ (Version 3.0.5.) wurde derjenige optimale Stichprobenumfang berechnet, durch den sich – bei der Prüfung der Nullhypothese „H0 (π = π0 = 0.1085)“ mittels eines zweiseitigen Binomial-Tests – ein mittlerer Effekt der Größenordnung „g = 0.15“ bei einem vorgegebenen Signifikanzniveau von α = 0.05 und einer Mindest-Teststärke von 1-β = 0.84 detektieren lässt. π ist hierbei identisch mit der 12-Monats-Prävalenz depressiver Störungen nach Daten des Zusatzsurveys „Psychische Störungen“ des Bundes-Gesundheitssurveys 1998 (vgl. [22]), nachdem die Prävalenz depressiver Störungen bei älteren Langzeitarbeitslosen im Kontext dieser Originalarbeit von besonderem Interesse ist. Als optimaler Stichprobenumfang ergab sich N = 58, eine Fallzahl, die von dem Umfang der vorliegenden Stichprobe (siehe unten) überschritten wird. Die Daten wurden mit SPSS für Windows (Version 12.0) ausgewertet. Die Berechnung von 95%-Konfidenzintervallen für Prävalenzraten und Odds Ratios erfolgte mit BiAS für Windows (Version 8.4.2). Die Auswertung der BGS-Daten beschränkt sich auf Westdeutschland. Die Beschränkung auf Westdeutschland hängt damit zusammen, dass die meisten Assoziationen zwischen Arbeitslosigkeit und Ge­sund­ heitsstörungen in den alten Bundes­ ländern deutlich stärker ausgeprägt sind als in den neuen Bundesländern (vgl. [20]). Um die Prävalenzraten für psychische Störungen in beiden Stichproben vergleichbar zu machen, wurden Prävalenz psychischer Störungen bei älteren Langzeitarbeitslosen in einem ersten Schritt die Daten in der Langzeitarbeitslosen-Stichprobe (KompAQT) nach Alter, Geschlecht und Familienstand gewichtet, wobei der Altersrange der KompAQTStichprobe und derjenige der BGSStichprobe aneinander angepasst und arbeitslos gemeldete Personen aus der BGS-Stichprobe ausgeschlossen wurden. Anschließend wurden für die beiden Stichproben 12-Monats-Prävalenzraten psychischer Störungen und Odds Ratios (jeweils mit 95%-Konfidenzintervall) berechnet. Die Odds Ratios geben darüber Auskunft, um wie viel größer die Wahrscheinlichkeit, an einer psychischen Störung zu erkranken, in der Gruppe der älteren Langzeitarbeitslosen ist, verglichen mit der Allgemeinbevölkerung, die erwerbstätige und nicht erwerbstätige Personen gleichermaßen umfasst, nicht aber Arbeitslose. 39 Ergebnisse KompAQT-Stichprobe Während der sechsmonatigen Daten­ erhebung kamen 184 Personen zu den Assessmentveranstaltung en. 104 Personen davon erklärten sich zur freiwilligen Teilnahme am Diagnostischen Interview bereit (Responserate 56,5%). Wenn nach Angleichung der KompAQTStichprobe an die Stichprobe aus dem Bundesgesundheitssurvey nur 98 In­ter­views in die Datenauswertung eingegangen sind, so liegt dies daran, dass im Rahmen der KompAQT-Stic hprobenuntersuchungen 6 Interviews mit unverheirateten Männern im Alter von 55 Jahren durchgeführt worden sind, niemand aus der Bundes­ge­ sundheitssurvey-Stichprobe aber diese speziellen Kriterien (männliches Geschlecht; Alter: 55 Jahre; unverheiratet) erfüllt hat, so dass sich für diese Subgruppe, wenn sie nicht ausgeschlossen worden wäre, ein (unzu- lässiger) Gewichtungsfaktor von „0“ ergeben hätte. Tabelle 1 zeigt, dass die BGSund die KompAQT-Stichprobe durch die Gewichtung hinsichtlich wesent­licher soziodemographischer Charakteristika vergleichbar gemacht werden konnten, und stellt die gewichteten und ungewichteten Stich­ proben nebeneinander. Ergebnisse der DIA-X-Interviews In der untersuchten Stichprobe findet sich ein gegenüber der Allgemeinbevölkerung signifikant erhöhtes Risiko sowohl für depressive Episoden als auch für Dysthymien, wobei das höchste Risiko für Dysthymien zu verzeichnen ist (OR = 8.8; 95% K.I. = 6.0 – 12.9). Für andere Störungen wie z.B. Alkoholismus, somatoforme Schmerzstörung und Angststörungen ergaben sich keine signifikanten OddsRatios (die entsprechenden Odds-Ratio-Konfidenzintervalle schließen den BGS (N1=390) KompAQT (N=98) Variable Geschlecht, m:w (%) Alter, M(s) Familienstand, verheiratet (%) Voll-/teilzeit-beschäftigt (%) ungewichtet gewichtet ungewichtet gewichtet 49.0 : 51.0 51.6 : 48.4 49.7 : 50.3 51.6 : 48.4 52.61 (2.69) 53.25 (2.81) 53.19 (2.81) 53.17 (2.81) 21.5 74.1 72.8 73.9 0 0 78.2 79.2 Tabelle 1: Soziodemographische Charakteristika (ungewichtet und gewichtet) der älteren Langzeitarbeitslosen im Ver­ gleich zu Personen aus der Allgemeinbevölkerung in Westdeutschland (Bundesgesundheitssurvey 1998) 1 Aufgrund der Beschränkung auf Westdeutschland, der Altersanpassung zwischen den Stichproben (nur die 47- bis 60-jährigen Personen gingen in die Analysen ein), des Ausschlusses arbeitslos gemeldeter Personen und der Anpassung hinsichtlich des ­Familienstandes wurden 3791 Personen aus der BGS-Gruppe (ursprünglich N=4181) ausgeschlossen. BGS = Bundesgesundheitssurvey-Stichprobe; KompAQT = Langzeitarbeitslosen-Stichprobe; M = (arithmetischer) Mittelwert; m = männlich; N = Stichprobengröße vor der Datengewichtung; s = Standardabweichung; w = weiblich. I. Liwowsky et al. 40 LAL (N=98) % (95% K.I.) BGS (N=390) % (95% K.I.) Odds Ratios1 Alkoholismus (ICD-10: F10) 4.54 (2.83-6.85) 3.43 (1.93-5.60) 1.34 (0.68-2.62) Mögliche psychotische Störung (ICD-10: F23.0/F23.1) 0.86 (0.24-2.20) 2.52 (1.26-4.46) 0.34 (0.11-1.01) Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode (ICD-10: F31.1/F31.2) 0.65 (0.13-1.88) 0 5.94 (0.66-53.22) Depressive Störungen (ICD-10: F32/F33) 32.18 (27.94-36.65) 7.78 (5.45-10.70) 5.62 (3.88-8.16) Dysthymie (ICD-10: F34.1) 37.58 (33.15-42.17) 6.41 (4.30-9.13) 8.79 (6.01-12.87) Angststörungen (ICD-10: F40/F41) 14.69 (11.59-18.24) 15.10 (11.88-18.81) 0.97 (0.67-1.40) Somatoforme Schmerzstörung (ICD-10: F45.4) 12.74 (9.84-16.13) 8.92 (6.42-12.0) 1.49 (0.97-2.28) Psychische Störung (95% K.I.) Tabelle 2: Geschlechts-, alters- und familienstandsadjustierte 12-Monats-Prävalenzraten und Odds Ratios psychischer Störungen bei älteren Langzeitarbeitslosen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung in Westdeutschland (Bundesgesundheitssurvey 1998) 1 Odds Ratios im Hinblick auf die Allgemeinbevölkerung (ohne Arbeitslose). Signifikante Odds Ratios sind fett hervorgehoben. BGS = Bundesgesundheitssurvey-Stichprobe; ICD-10 = Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Auflage; K.I. = Konfidenzintervall; LAL = Langzeitarbeitslosen-Stichprobe; N = Fallzahl. Wert 1 ein) (vgl. Ta­belle 2). Auch das Risiko älterer Langzeitarbeitsloser, an einer bipolaren affektiven Störung (gegenwärtig manische Episode) zu leiden, war in der untersuchten Stichprobe gegenüber der Allgemeinbevölkerung nicht statistisch signifikant erhöht. Angesichts der relativ kleinen Stichprobe schließen diese Befunde ein erhöhtes Risiko Langzeitarbeitsloser für die genannten psychischen Störungen allerdings nicht aus. Geschlechtsunterschiede in der Prävalenz psychischer Störungen bei älteren Langzeitarbeitslosen Explorativ wurde untersucht, ob sich innerhalb der ungewichteten Stichprobe älterer Langzeitarbeitsloser Männer und Frauen hinsichtlich der 12-Monats-Prävalenz ausgewählter psychischer Störungen voneinander unterscheiden. Dies ist tatsächlich der Fall: Demnach ist bei 14,6% der älteren langzeitarbeitslosen Männer von einer Alkoholismusdiagnose auszugehen, jedoch nur bei 2,0% der älteren langzeitarbeitslosen Frauen (Fishers exakter Test: p = 0,029; zweiseitig). Interessanterweise ist die (12-Monats-)Prävalenz depressiver Episoden bei älteren langzeitarbeitslosen Männern gegenüber älteren langzeitarbeitslosen Frauen nur unwesentlich niedriger (18,8% versus 24,0%; χ2 = 0,40; df = 1; p = 0,53). Hinsichtlich der Prävalenz von Dysthymie und derjenigen der somatoformen Schmerzstörung finden sich keine signifikanten Geschlechtsunter- Prävalenz psychischer Störungen bei älteren Langzeitarbeitslosen schiede (p ≥ 0,195). Hingegen findet man bei älteren langzeitarbeitslosen Frauen im Vergleich zu älteren langzeitarbeitslosen Männern signifikant höhere 12-Monats-Prävalenzen für Angststörungen (28% versus 10,4%; χ2 = 4,85; df = 1; p = 0,028). Diskussion Die Ergebnisse des Vergleichs der nach Alter, Geschlecht und Familienstand adjustierten Stichproben ergaben für ältere Langzeitarbeitslose eine gegenüber der Allgemeinbevölkerung signifikant erhöhte Wahrscheinlichkeit, an einer affektiven Störung zu erkranken. Die adjustierte Prävalenz betrug 32,2% für depressive Störungen und 37,6% für Dysthymie. Dies korrespondiert mit den Ergebnissen der Auswertung des finnischen Gesundheitssurveys [10]. Dort zeigte sich ein Zusammenhang von Langzeitarbeitslosigkeit mit majo­rer Depression und häufiger Alkohol­ intoxikation. Wir fanden, insbesondere in Bezug auf depressive Störungen, wo Geschlechtsunterschiede ein weithin bekanntes Phänomen sind, in der KompAQT-Stichprobe keine signifikant höhere Prävalenzrate der Frauen. Dies könnte an der kleinen Kohorte liegen. In Anbetracht der extrem hohen Prävalenz affektiver Störungen hätte jedoch ein größerer Unterschied zwischen Männern und Frauen erwartet werden können. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass sozioökonomische Nachteile, denen Frauen häufiger als Männer unterliegen, in der insgesamt benachteiligten Gruppe der Langzeitarbeitslosen gleichmäßiger verteilt sind. Darüber hinaus ist in einigen Studien eine größere Empfindlichkeit der Männer für sozioökonomische Härte belegt worden [11]. Am deutlichsten zeigt sich eine erhöhte Prävalenz bei den Dysthymien. Personen mit einer Dysthymie haben über einen längeren Zeitraum eher geringfügigere depressive Symptome. So fehlt ihnen Begeisterungsfähigkeit, Fähigkeit zur Freude, ausreichender Antrieb oder Motivation. Dies scheint als Folge der schwierigen Situation der älteren Langzeitarbeitslosen, mit Statusverlust, finanziellen Einschränkungen und wenig Zukunftsperspektiven, eine nachvollziehbare Reaktion. Für andere psychische Störungen wie z.B. Angststörungen oder somatoforme Schmerzstörungen fanden sich keine erhöhten Prävalenzen. Wider Erwarten wurden auch für Störungen durch Alkohol keine erhöhten Prävalenzen gefunden. Hier könnte die Anbindung der Untersuchung an die Arge München zu Verzerrungen im Antwortverhalten der Teilnehmer geführt haben. Einige Personen hatten Sorge, nicht mehr vermittelt zu werden, sollten sie psychische Beschwerden, wie etwa Suchterkrankungen, angeben. Der signifikante Unterschied zwischen den Geschlechtern bei Angststörungen und bei Störungen durch Alkohol entspricht den Ergebnissen aus der Allgemeinbevölkerung und stellt keine Besonderheit der älteren Langzeitarbeitslosen dar. Alle Langzeitarbeitslosen dieser Studie stammen aus einer westdeutschen Stadt, deren Arbeitslosenquote unterhalb der des deutschen Durchschnittes liegt. Sie können daher als hoch selektierte Gruppe mit einer größeren Morbiditätslast als in Regionen mit höheren Arbeitslosenquoten gesehen werden. Nach Elkeles und Seifert [6] betrifft Arbeitslosigkeit zuerst die Kranken und die Verletzlichen. Nur wenn die Arbeitslosenquoten sich erhöhen, werden auch gesündere Personen betroffen. Demnach würde man in Bereichen mit Massenarbeitslosigkeit wie in Ostdeutschland (Arbeitslosenquoten über 20% in einigen Regionen) geringere Prävalenzraten psychischer Störungen erwarten. Zusätzlich sind der Druck und die Belastung, die auf den einzelnen Personen liegen, in Regionen mit geringer Arbeitslosigkeit höher [9]. 41 Methodische Einschränkungen Bei der Interpretation der Daten sind gewisse Limitationen zu berücksichtigen: Die Repräsentativität der untersuchten Stichprobe für die Gruppe älterer Langzeitarbeitsloser kann nicht als gesichert gelten: Nicht alle eingeladenen Personen erschienen zum Assessment. Die Einladungen zu den Assessmentveranstaltungen erfolgten ohne Selektionskriterien durch 18 verschiedene Mitarbeiter der Arge in den einzelnen Sozial­ bürgerhäusern Münchens. Die Unter­ sucherin hatte als Nicht-Arge-Mit­ arbeiterin keinen Zugang zu diesen Daten. Eine Dokumentation der nicht Erschienenen war daher nicht möglich. 43,5% der Erschienenen nahmen nicht am Interview teil. Dies war zum großen Teil auf mangelnde Deutschkenntnisse zurückzu­führen. Leider konnten diejenigen, die keine Einverständniserklärung zum Inter­ view abgaben, nicht zu ihren Gründen befragt werden. Aufgrund der genannten Einschränkungen könnte auch die Reliabilität der erhobenen Daten reduziert sein. Die Studie ist zwar im Fall depressiver Störungen für die Detektion mittlerer Effektstärken gepowert; um auch geringe Effekte aufzudecken (g = 0.05), hätten allerdings 396 ältere Langzeitarbeitslose in die vorliegende Pilotstudie eingeschlossen werden müssen, was den Rahmen dieses Projektes gesprengt hätte. Schlussfolgerungen Angesichts der zur Verfügung stehenden wirksamen pharmakologischen und psychotherapeuti­ schen Therapiemöglichkeiten ist es wichtig, sich der wenig beach­ teten Risikogruppe der älteren Langzeitarbeitslosen zuzuwenden, um Depressionen frühzeitig zu erkennen und Betroffene einer effizienten Behandlung zuzuführen. Dies könnte zudem dazu beitragen, die behandel- I. Liwowsky et al. ten Personen wieder leichter in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In einer Studie [14] zur Validierung des WHO-5 Well-Being-Index als Screeninginstrument bei älteren Langzeitarbeitslosen erreichte das Instrument eine Sensitivität von 95,5% bei einer Spezifität von 62,2% und wurde sehr gut angenommen (Responserate 83,7%). Weiterhin zeigte diese Studie bei den älteren Langzeitarbeitslosen eine sehr geringe Behandlungsrate sowohl bei den majoren Depressionen als auch bei den Dysthymien, insbesondere im Falle der Männer. Für die Zukunft sollten die Ergebnisse zur Prävalenz psychischer Störungen bei langzeitarbeitslosen Personen über 50 Jahre an größeren, repräsentativen Stichproben repliziert werden. Darüber hinaus sind Interventionsstudien essentiell, da der Einsatz von DepressionsScreeninginstrumenten per se in der klinischen Praxis nicht zwangsläufig zu einer höheren Erkennensrate depressiver Patienten und damit einer größeren Chance auf eine effiziente Behandlung führt [7]. Es wäre zu überlegen, welches weitere Potential der primären und se­kundären Prävention die durch das Förderprogramm Perspek­ti­ ve 50plus initiierten 62 regiona­ len Modellprojekte für derartige Untersuchungen bieten. Man denke dabei auch an Maßnahmen der Ge­ sundheitsförderung, Informations­ material oder Psychoedukation zum Thema psychische Gesundheit. Interessenskonflikte Keine angegeben 42 Literatur [1] Andrews G., Peters L.: The psychometric properties of the Composite International Diagnostic Interview. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 33, 80-88 (1998). [2] Brähler E., Laubach W., Stöbel-Richter Y.: Belastung und Befindlichkeit von Arbeitslosen in Deutschland. In: Schumacher J., Reschke K., Schröder H. (Hrsg): Mensch unter Belastung. Erkenntnisfortschritte und Anwendungsperspektiven der Stressforschung. Verlag für Akademische Schriften, Frankfurt a. M. 2002. [3] Broutschek B., Schmidt S., Dauer S.: Macht Arbeitslosigkeit krank oder Krankheit arbeitslos? In: Dauer S., Hennig H. (Hrsg): Arbeitslosigkeit und Gesundheit. Mitteldeutscher Verlag, Halle 1999. [4] Brussig M., Knuth M., Schweer O.: Arbeitsmarktpolitik für ältere Arbeitslose. IAT-Report 2006-2. IAT, Gelsenkirchen 2006. [5] Bundesagentur für Arbeit: Der Arbeitsund Ausbildungsmarkt in Deutschland. Monatsbericht März 2008: http://www. pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/000000/html/start/monat/aktuell. pdf, Nürnberg 2008. [6] Elkeles T., Seifert W.: Arbeitslosigkeit und Gesundheit. Langzeitanalysen mit dem Sozio-Ökonomischen Panel. Soziale Welt 43, 278-300 (1992). [7] Gilbody S., Sheldon T., House A.: Screening and case-finding instruments for depression: a meta-analysis. CMAJ 178, 997-1003 (2008). [8] Grobe T.G., Schwartz F.W.: Arbeitslosigkeit und Gesundheit. In: Robert-KochInstitut (Hrsg): Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Berlin 2003. [9] Häfner H.: Arbeitslosigkeit - Ursache von Krankheit und Sterberisiken? Z Klin Psychol Psychother 14, 1-17 (1990). [10] Hämäläinen J., Poikolainen K., Isometsä E., Kaprio J., Heikkinen M., Lindemann S., Aro H.: Major depressive episode related to long unemployment and frequent alcohol intoxication. Nord J Psychiatry 59, 486-491 (2005). [11] Helbig S., Lampert T., Klose M., Jacobi F.: Is parenthood associated with mental health? Findings from an epidemiological community survey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 41, 889-896 (2006). [12] Jacobi F., Wittchen H.U., Hölting C., Sommer S., Lieb R., Höfler M., Pfister H.: Estimating the prevalence of mental and somatic disorders in the community: aims and methods of the German National Health Interview and Examination [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] Survey. Int J Methods Psychiatr Res 11, 1-18 (2002). Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Mitteilung der Kommission. Grünbuch. Angesichts des demografischen Wandels - eine neue Solidarität zwischen den Generationen: http://ec.europa.eu/employment_social/ news/2005/mar/comm2005-94_de.pdf, Brüssel 2005. Liwowsky I., Kramer D., Mergl R., Bramesfeld A., Allgaier A.K., Pöppel E., Hegerl U.: Screening for depression in the older long-term unemployed. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, elektronische Vorabpublikation, doi: 10.1007/ s00127-008-0478-y. Meise U., Wancata J.: „Es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit“Die Europäische Ministerielle WHOKonferenz für Psychische Gesundheit; Helsinki 2005. Neuropsychiatr 19, 151154 (2006). Mohr G.: Erwerbslosigkeit, Arbeitsplatzunsicherheit und psychische Befindlichkeit. Lang, Frankfurt a.M. 1997. Moser K., Paul K.: Arbeitslosigkeit und seelische Gesundheit. Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis 33, 431-442 (2001). Rohde P., Lewinsohn P.M., Seeley J.R.: Comparability of telephone and face-toface interviews in assessing axis I and II disorders. Am J Psychiatry 154, 15931598 (1997). Romeu Gordo L.: Beeinflusst die Dauer der Arbeitslosigkeit die Gesundheitszufriedenheit? - Auswertungen des Sozioökonomischen Panels (SOEP) von 1984 bis 2001. In: Hollederer A., Brand H. (Hrsg): Arbeitslosigkeit, Gesundheit und Krankheit. Huber, Bern 2006. Rose U., Jacobi F.: Gesundheitsstörun­ gen bei Arbeitslosen: Ein Vergleich mit Erwerbstätigen im Bundesgesundheitssurvey 98. Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin 41, 556-564 (2006). Wittchen H.U., Pfister H.: Instruktionsmanual zur Durchführung von DIA-X Interviews. Swets Test Services, Frankfurt 1997. [22] Wittchen H.U., Pfister H., Schmidtkunz B., Winter S., Müller N.: Zusatzsurvey "Psychische Störungen" (Bundesgesundheitssurvey 98): Häufigkeit, psychosoziale Beeinträchtigungen und Zusammenhänge mit körperlichen Erkrankungen. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Arbeitsgruppe Klinische Psychologie und Epidemiologie, München 2000. [23] Wittchen H.U., Weigel A., Pfister H.: DIA-X - Diagnostisches Expertensy- Prävalenz psychischer Störungen bei älteren Langzeitarbeitslosen stem. Swets Test Services, Frankfurt 1996. [24] World Health Organization (ed): Composite International Diagnostic Interview (CIDI): (a) CIDI-Interview, Version 1.0, (b) CIDI-User Manual, (c) CIDI-Training Manual, (d) CIDI-Computer Programs. World Health Organization, Genf 1990. 43 Dipl. Psych. Dipl. Soz.Päd. Iris Liwowsky Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Ludwig-Maximilians-Universität München [email protected] Wilhelm-Exner-Preis für Psychologie 2011 Förderpreis für wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Klinischen Psychologie und Gesundheitspsychologie 2008 wurde erstmals der Wilhelm-Exner-Preis für Psychologie für herausragende innovative wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bereich der klinischen Psychologie und Gesundheitspsychologie vergeben. Mit dem Preis soll die wissenschaftlich psychologische Forschung in diesem Bereich und der wissenschaftliche Nachwuchs unterstützt werden. Der Preis wird ausschließlich natürlichen Personen (Altersgrenze 30 Jahre) zuerkannt und ist besonders für (Erstlings-) Arbeiten aus dem universitären Bereich bestimmt (Publikationen, Dissertationen und Diplomarbeiten). Gefördert werden zur Publikation geeignete beziehungsweise als Diplomarbeit/Dissertation eingereichte Arbeiten, wenn diese nicht mehr als zwei Jahre vor dem Einreichtermin fertig gestellt wurden. Veröffentlichungen müssen ebenfalls im Laufe der vergangenen zwei Jahre in peer-reviewten bzw. international zitierten (laut ISI Web of Knowledge oder vergleichbaren Ranking-Systemen) Zeitschriften erschienen sein. Jedes Jahr hat der Preis einen spezifischen Schwerpunkt 2011: „Humor in der Klinischen und Gesundheitspsychologie“ Der Wilhelm-Exner-Preis für Psychologie 2011 wird im Herbst in einer feierlichen Zeremonie im Rahmen der Verleihung der Wilhelm-Exner-Medaille übergeben und ist mit einem Geldpreis von insgesamt 1000 Euro verbunden. Dieser Preis kann einzelnen Personen zuerkannt oder bei gleichwertigen Arbeiten auf bis zu drei PreisträgerInnen aufgeteilt werden. Eine Einreichung erfolgt mittels formlosen Schreibens und Übersendung der Unterlagen in digitaler Form ([email protected]) an die Wilhelm-Exner-Stiftung Österreichischer Gewerbeverein Palais Eschenbach Eschenbachgasse 11 1010 Wien Kennwort: Wilhelm-Exner-Preis für Psychologie 2011 Einreichungsunterlagen Kurze Begründung, warum die Arbeit eine Bereicherung der klinisch psychologischen und gesundheitspsychologischen Forschung darstellt (maximal eine A4 Seite) Zusammenfassung der eingereichten Arbeit auf ein bis zwei A4 Seiten Komplette Arbeit Tabellarisches Curriculum Vitae Einsendeschluss ist der 30. Juni 2011 (Datum des Poststempels) Kontakt: [email protected] I Scheidl Evelyn [[email protected]] Auswahlverfahren und Fachjury Eine Fachjury von fünf ExpertInnen aus Psychologie und Psychiatrie, mit einer Mehrheit aus dem Fachbereich der Psychologie und dem Vorsitzenden der Wilhelm-Exner-Stiftung ermittelt die Preisträger. Besonderes Augenmerk wird auf innovative, international konkurrenzfähige Arbeiten gelegt. Mit der Einreichung ist kein Anspruch auf Preisverleihung verbunden und die Entscheidung der Fachjury ist endgültig. Gegen Beurteilungen oder Entscheidungen der Fachjury ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Kritisches Essay Critical Essay Neuropsychiatrie, Band 25, Nr. 1/2011, S. 44–50 Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie – ein Tabu? Ullrich Meise1, Beatrice Frajo-Apor 2, Maria Stippler 3 und Johannes Wancata4 Gesellschaft für Psychische Gesundheit- pro mente tirol, Innsbruck Department für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Innsbruck 3 Institut für Psychosoziale Intervention und Kommunikationsforschung, Universität Innsbruck 4 Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien 1 2 Schlüsselworte: Psychiatrie – Unterbringung – Fixierung – Isolierung - Zwangsmedikation Key words: psychiatry – restraint coercion – fixation – isolation - involuntary medication Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie – ein Tabu? Wie ein Blick auf die Geschichte zeigt, ist die Diskussion über Zwangsmaßnahmen gegen psychisch Kranke so alt wie die Psychiatrie selbst. Das Dilemma der Psychiatrie liegt in ihrer doppelten Rolle. Neben ihrer therapeutischen Funktion, hat sie - bei definierten Bedingungen - die Aufgabe in die Freiheit von Patienten einzugreifen. Da Gewaltanwendung gegenüber Kranken und Behinderten im Widerspruch zu den ethischen Grundhaltungen und dem Selbstbild helfender Berufe steht, besteht die Gefahr, dass die Gewaltanteile psychiatrischer Arbeit – die heute aus dieser nicht völlig herausgehalten werden können – verdrängt oder tabuisiert und dadurch schwer kontrollierbar werden. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik © 2011 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 erscheint unzureichend und Ländervergleiche sind - sogar zwischen den Staaten der EU - auf Grund der Heterogenität der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von Zwangsmaßnahmen schwierig. Über wichtige Aspekte - wie z.B. Patienten selbst diese Maßnahmen bewerten - finden sich nur wenige Studien. Eine breite und offene Auseinandersetzung über den Sinn und Widersinn von Zwang und Gewalt in der psychiatrischen Behandlung wäre notwendig, um einer „Gewaltroutine“ oder der unangemessenen Gewalt gegenüber psychisch Kranken vorzubeugen. Coercion in Psychiatry – a taboo? History shows that the discussion concerning coercive measures against mentally ill is as old as psychiatry itself. The dilemma of psychiatry lies in its double role - having both a therapeutic and a regulatory function. Violence against sick and disabled people conflicts with the ethical principles of helping professions. This, however, is where the danger lies: that the violent parts of psychiatric work – which in the opinion of experts cannot be entirely avoided - are repressed or seen as taboo and are therefore more difficult to control. Comparisons between EU countries of the nature, frequency and duration of coercive measures are difficult because of the heterogeneity of regulation and differences in established practice. Scientific examination of this issue seems to be insufficient. There are only a few studies on important issues such as how patients rate these measures. An open and thorough debate about the meaning and meaninglessness of coercion and violence in psychiatric treatment would be necessary to prevent "routine violence" or the excessive use of force against the mentally ill. Zwangsmaßnahmen (Unterbringung, Fixierung, Isolierung und Zwangs­ medikation) sind weltweit ein immanenter Bestandteil der psychiatrischen Versorgung. Diese freiheitsbeschränkenden Maßnahmen können notfalls durch unmittelbaren Zwang gegen den ausdrücklichen Willen der Betroffenen durchgesetzt werden. In den westlichen Industrienationen sind die verschiedenen Formen des Zwangs durch Gesetze und rechtliche Rahmenbedingungen zur Wahrung der Patientenrechte geregelt. In Österreich dürfen Personen nur dann in einem Psychiatrischen Krankenhaus oder - Abteilung gegen ihren Willen untergebracht und letztlich auch behandelt werden, wenn sie: • psychisch krank sind, • auf Grund dessen eine ernstliche und erhebliche Gefahr für Leben oder Gesundheit des Patienten selbst oder anderer besteht und Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie – ein Tabu? • außerhalb einer Abteilung für Psychiatrie keine ausreichende Behandlung möglich ist. Nur wenn diese drei Voraussetzungen gleichzeitig vorliegen, ist eine Unterbringung erlaubt (§ 3 UbG) [1]. Die gesetzlichen Grundlagen zur Ausübung legitimierter Gewalt gegenüber psychisch Kranken folgen rechtsstaatlichen Grundlagen; die Entscheidung zur Rechtmäßigkeit der Anwendung von Zwang unterliegt der gerichtlichen Kontrolle und den Patienten wird ein Rechtsbeistand zur Seite gestellt. Dieser Eingriff in die Persönlichkeitsrechte eines Menschen basiert auf zwei Voraussetzungen: dem „Fürsorgegedanken“ und dem Gedanken der „Gefahrenabwehr“ [32]. Diese zwei Grundsätze finden sich in den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen aller EULänder; trotzdem sind diese Gesetze noch heterogen und die Entscheidung, Zwangsmaßnahmen anzuwenden, wird unterschiedlich gehandhabt. 2004 hat der Europäische Rat (Empfehlung Nr. Rec 2004/10 des Ministerkomitees an die Mitgliedsstaaten zum Schutz der Menschenrechte und der Würde von Menschen mit psychischer Störung) Grundsätze und Kriterien beschlossen, die erfüllt sein müssen, um eine unfreiwillige Unterbringung und eine unfreiwillige Behandlung zu rechtfertigen; an diese Richtlinien sind alle EU-Staaten gebunden. Darüberhinaus wird in der UN-Konvention (Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13.12.2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderung), die auch von Österreich ratifiziert wurde, festgehalten, dass die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderung zu gewährleisten und zu fördern sind. Auch wurden von unterschiedlichen Fachvereinigungen Leitlinien und Prozessstandards entwickelt, mit dem Ziel, Zwangsmaßnahmen vorzubeugen und im Falle der Notwendigkeit diese anwenden zu müssen, ein korrektes und möglichst schonendes Vorgehen sicherzustellen [2-8]. In seinem Artikel „Gewaltfreie Psychiatrie - eine Fiktion?“ [9], setzt sich Günther Wienberg in 13 Thesen mit Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie auseinander. Seine erste These lautet: „Gewalt gegen psychisch Kranke existiert vor und unabhängig von psychiatrischen Institutionen“. 60-80% der Patienten - davon besonders weibliche - berichten von sexuellen und andere körperlichen Gewalterfahrungen und Traumatisierung, die außerhalb der psychiatrischen Institutionen gesetzt wurden [10]. Von den nach wie vor vorhandenen subtilen Formen wie Stigmatisierung und Ausgrenzung oder dem Versagen von Lebenschancen, reichte dieses Spektrum in der Vergangenheit vom Wegsperren der Systemkritiker in der ehemaligen Sowjetunion, bis hin zu körperlicher Verstümmelung oder der Ermordung im Rahmen der „Euthanasie“ im Nationalsozialismus [11]. Um solchem Missbrauch vorzubeugen, muss die zuvor skizzierte rechtsstaatliche Grundlage gewahrt bleiben und die Voraussetzungen – der Fürsorgegedanke und der Gedanke der Gefahrenabwehr –eng gefasst und definiert werden, damit sie keinen Interpretationsspielraum ermöglichen. In seiner zweiten These meint Wienberg: „Die Gewaltanteile psychiatrischen Handelns sind unauflösbar mit ihrem gesellschaftlichen Auftrag und ihrer sozialen Funktion verbunden“. Die Anwendung von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie wie unfreiwillige Unterbringung, Fixierung, Isolierung, Zwangsmedikation oder auch Handlungen von informellen Zwang [12], gehören zu den Schattenseiten unserer psychiatrischen Tätigkeit. Das Dilemma der Psychiatrie liegt in dem doppelten Mandat: Sie hat eine therapeutische Aufgabe und muss unter definierten Umständen Patienten in Ihrer Persönlichkeitsrechten beschränken. Diese Doppelfunktion sollte jedoch nicht dazu führen, dass Zwang und Gewalt, die im Rahmen des gesellschaftlichen Auftrages angewandt werden, als Therapie ausgegeben werden. Mit Hilfe von Zwang und Kontrolle werden 45 über eine Person hinweg für diese Ziele definiert und durchgesetzt. „Gewöhnlich wird die Selbstbestimmung von Menschen, was ihrer Gesundheit und Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen betrifft, nicht in Frage gestellt. Jedem Bürger steht es frei, medizinische Behandlung - auch wenn sie als lebensrettend erachtet wird - abzulehnen. Epidemien infektiöser Erkrankungen bilden dabei einen Sonderfall. Die häufigere Ausnahme findet sich jedoch in der Psychiatrie“ [29]. Eine Person kann gegen ihren Willen in die Psychiatrie eingewiesen und dort gegen ihren Willen angehalten und behandelt werden. Dazu formuliert Wienberg die Thesen: „Die Gewaltanteile psychiatrischen Handelns sind unauflösbar mit der therapeutischen Funktion verknüpft“ und „Das Problem der Gewalt gegen psychisch kranke Menschen steht immer im Spannungsfeld von Bewirken und Belassen, von Tun und Nichtstun“ [9]. Die Ausübung von Zwang durch die Psychiatrie ist - nach Ansicht von Wienberg - auch mit ihrer therapeutischen Funktion vergesellschaftet. Die Möglichkeit Menschen mit psychischen Erkrankungen wider deren Willen zu behandeln und somit- zumeist vorübergehend - deren Autonomie und Eigenverantwortung durch Fremdbestimmung und Fürsorge zu ersetzen, basiert dabei auf drei Grundannahmen, die in den verschiedenen Ländern unterschiedlich gewichtet werden [32]: • Die teilweise oder völlige Aufhebung der Freiheit zur autonomen Willensbildung und damit den Verlust der Fähigkeit - aufgrund der Erkrankung - vernünftig über die Behandlungsnotwendigkeit zu entscheiden. • Eine mögliche Selbst- oder Fremdgefährdung als Folge der Erkrankung. • Die Aussicht, den Krankheitszustand durch die erzwungene Behandlung zu verbessern. Für den im Rahmen von psychischen Erkrankungen möglichen Autonomie- U. Meise, B. Frajo-Apor, M. Stippler, J. Wancata verlust spielt die Frage nach der Kompetenz zur Einwilligung oder Ablehnung von Heilbehandlungen eine entscheidende Rolle; „Einsichts- und Urteilsfähigkeit“ sind gefragt. Dabei muss beurteilt werden, ob jemand in der Lage ist, die Information aufzunehmen, die Relevanz des Inhaltes einzuschätzen, die Fähigkeit aufweist, darüber abwägend nachzudenken, um eine Auswahl und Entscheidung treffen zu können. Bei jenen selbstgefährdeten nicht-psychiatrischen Krankenhauspatienten, die an somatischen Abteilungen behandelt werden und diese Fähigkeiten zu bestimmten Zeiten nicht haben, muss die Entscheidung für eine Behandlung durch einen Sachwalter getroffen werden. Bei „Gefahr in Verzug“ ist eine Behandlung ohne das Einholen dieses Einverständnisses möglich. Derzeit haben die meisten Länder eine eigene Gesetzgebung, die sich auf die Unterbringung oder Behandlung gegen den Willen von Patienten im Bereich der Psychiatrie konzentriert. Zu Recht wird die Frage gestellt, ob es nicht für die Medizin ein einziges Gesetz geben könnte, das die Vorgangsweise in solchen Fällen regelt. Dies wird als ein Schritt in Richtung der Gleichbehandlung psychisch Kranker mit nicht-psychiatrischen Patienten angesehen [13]. Zur Annahme, dass sich der Krankheitszustand durch die erzwungene Behandlung verbessert, liegt nach einem Cochrane Review [14] bislang keine methodisch entsprechenden Studien vor, die eine Aussage ermöglichen, ob Isolierung und Fixierung positive oder negative Auswirkungen auf den Behandlungserfolg haben. Ob eine Zwangsbehandlung gleich gut wirksam ist wie jene unter freiwilligen Behandlungsbedingungen ist nicht wirklich geklärt. Die Gewaltanwendung im Rahmen der Behandlung wirft jedoch auch die Frage nach den Folgen von Tun oder Nichtstun auf, da der Verzicht von Zwang in der Behandlung unter Umständen zu einer Unterlassung von lebensnotwendigen Hilfestellungen führen kann. Kommt diese Abwägung zu einem ein- deutigen Ergebnis, kann es nach Asmus Finzen auch ein „Recht auf Zwang“ geben [15]. So besteht z.B. die Pflicht psychisch Kranke daran zu hindern, sich selbst zu töten. Obwohl Zwangsmaßnahmen auch schwere, vereinzelt sogar zum Tode führende Folgen haben können, besteht psychiatrieintern Einmütigkeit, dass es heute nicht möglich sei, auf diese Handlungen in der Psychiatrie völlig zu verzichten. In der Psychiatrie Tätige reagieren auf diesen Aspekt ihrer Arbeit nicht selten mit Verdrängung oder Verleugnung, Schuldgefühlen oder auch unreflektierten Rechtfertigungen dieser Handlungsweisen. Gewaltanwendung gegenüber Schwachen, Kranken oder Behinderten steht im Widerspruch zu den ethischen Grundhaltungen in unserer Gesellschaft und passt auch nicht in das Selbstbild medizinischer und helfender Berufe. Diese Ablehnung kann dazu führen, dass die Gewaltanteile psychiatrischer Arbeit tabuisiert und in der Folge unkontrollierbar werden. Dann lässt sich die Frage nach der Angemessenheit von Zwangsausübung gegenüber Patienten nicht mehr eindeutig beantworten; sie kann sowohl notwendiges Hilfsmittels zur Abwehr einer größeren Gefahr, als auch Ausdruck von Machtmissbrauch und Willkür sein. Die Diskussion zu dieser Thematik ist häufig von unterschiedlichen Standpunkten geprägt und dies kann zu Spaltungen innerhalb der Psychiatrie führen, indem es zu einer Rollenteilung und einer Identifikation für die „gute Therapie“ oder für die „böse Gewalt“ kommt. „Psychiatrisches Handeln braucht gerade in Hinblick auf seine gewaltsamen Anteile kritische Solidarität und öffentliche Kontrolle“ [9]. Man sollte nicht mit Fingern auf jene zeigen, die im Auftrag der Gesellschaft diese Anteile psychiatrischer Arbeit wahrnehmen. Eine historische Spurensuche zeigt, dass Gewalt gegenüber psychisch Kranken in der Psychiatrie stets vorhanden war und immer wieder diskutiert wurde [16]. Diese Gewalt war nicht immer offensichtlich und verbarg sich manchmal in verschiedenem Gewand - u.a. 46 getarnt als therapeutische Maßnahme - was oft erst im Nachhinein erkennbar wurde. Dazu ein Beispiel: Johann Christian August Heinroth (1773-1843), der ab 1811 den weltweit ersten Lehrstuhl für psychische Therapie in Leipzig bekleidete, vertrat als sogenannter „Psychiker“ die Ansicht, dass die eigentlichen Seelenkrankheiten ihre Ursache in der Seele selbst haben und zog die Biographie des Patienten in das Krankheitsbild ein. Heinroth sah die Ursache von psychischer Krankheit in der Sünde. Psychische Krankheit war demnach selbstverschuldet. Dies bedeutete aber auch, dass er seelische Gesundheit als kalkulierbar und lernbar erachtete. Ein zweifelsfreier religiöser Glaube, mehr noch eine moralische, vernunftgeleitete Lebensführung, sollten vor psychischer Krankheit bewahren. Dazu ein kurzer Auszug aus dem Kapitel „Heilmittellehre“ seines Lehrbuches von 1818 [17], in dem er verschiedene Mittel für die „traîtement moral“ erregter Kranker empfiehlt: Er unterscheidet dabei zwischen „elementarisch oder physicalisch beschränkende Mittel“, wie kalte Kopfgießungen, Mütze von Eis, Kappe von Lehm, kaltes Bad, Untertauchen, Einhüllen in kalte Tücher, Tropfbad, Regenschauerbad…., „chirurgische Mittel“, wie die enge Weste, den Sack, den Zwangsriemen, das Gehäuse, den Zwangsstuhl, die Cox`sche Schwingmaschine, die Autenrieth`sche Maske, die Birne, das Autenrieth`sche Zimmer….. und „diverse andere Mittel“ unter die Hungerkuren, Ekelkuren (Brechweinstein, Ipecacuanha), Klistiere, Nießmittel, auspeitschen mit Brennnesseln, Blasenpflaster, Einimpfen von Krätze, Wanzen, Ameisen, Senfteige, Erschrecken….aufgelistet werden. Der Beginn der Psychiatrie wird heute auf den verklärten legendären Akt der „Befreiung der Geisteskranken aus ihren Ketten“ durch den französischen Arzt Philippe Pinel (1745-1826) im Hospital Bicêtre erdichtet. In Wirklichkeit war und ist diese „Befreiung“ ein Prozess, der bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts in verschiedenen europäischen Ländern - u.a. durch Vincenzo Chiarugi (1759-1820) in Florenz Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie – ein Tabu? - in Gang gesetzt wurde. Das bekannte Gemälde von Lucien Muller, das Pinel 1793 bei diesem Befreiungsakt darstellt, ist eine schöne Allegorie, die die Psychiatrie zu einer medizinischen Disziplin erhob. Gewalt und Zwang gegenüber psychisch Erkrankten sowie die Bemühungen sie abzuschaffen, sind ein Thema so alt wie die Psychiatrie und dieses Problem ist nach wie vor aktuell. Bereits 1776 gründete der Quäker William Tuke (1732-1822) in York eine private psychiatrische Anstalt namens „The Retreat“; ein Haus mit ruhiger Atmosphäre und dem Verzicht auf Ketten und körperliche Strafen. 1803 kritisierte Johann Christian Reil (1759-1813) die unwürdigen Zustände in den damals als Zucht- und Tollhäusern bezeichneten psychiatrischen Einrichtungen. Als Professor in Halle, der im Jahre 1808 die Fachbezeichnung „Psychiatrie“ einführte, trat er für eine menschenwürdige Behandlung ohne Gewalt ein und forderte die Bekämpfung des Stigmas. Die „non-restraint“ Methode geht auf Robert Gardiner Hill (1811-1876) zurück, nachdem er den Anstoß dazu durch einen Todesfall erhielt. Ein im Lincoln Lunatic Asylum in London im Jahre 1829 ans Bett fixierter Patient war ums Leben gekommen. Der Direktor Robert Gardiner Hill beschloss daraufhin eine Behandlung ohne Zwangsmaßnahmen einzuführen. Er war der Ansicht, dass bei geeigneten Raumbedingungen und ausreichend Pflegepersonal mechanische Zwangsmittel unnötig seien. Die getroffenen Veränderungen zeigten bald ein positives Ergebnis; seine akribische Dokumentation belegt, dass in seiner Anstalt 1830 von 92 Patienten 39 gefesselt wurden; 1837 waren es nur noch 2 von 120. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts trat John Conolly (1794-1866) für die totale Abschaffung von Zwangsmaßnahmen ein; er äußerte, dass „Zwang gleichbedeutend mit Vernachlässigung ist“ und forderte aktivierende Maßnahmen durch milieutherapeutische Behandlung, Einzelzimmer, ordentliche Räumlichkeiten, gutherzige Pfleger und - was damals eine Novität darstellte – Pflegerinnen, sowie tägliche ärztliche Visiten. Das „non-restraint“ Paradigma hat eine über die Grenzen von England hinausgehend kontrovers geführte Diskussion in Gang gesetzt. Obwohl von manchen versucht wurde, diese Methode umzusetzen - so führte sie z.B. Josef Stolz (Amtszeit 1854-1877) in dem damals als „Landesirrenanstalt“ benannten Psychiatrischen Krankenhaus Hall i. T. ein - konnte sie aber weder breit noch längerfristig Fuß fassen. Bereits 1977 forderte die WPA in der Deklaration von Hawaii (World Psychiatric Association): „No treatment should be provided against the patient`s will, unless withholding treatment would endanger the life of the patient and/or those who surround him or her. Treatment must always be in the best interest of the patient“. Obwohl das paternalistische Prinzip und Handeln „im besten Interesse des Patienten“-in dieser Formulierung beinhaltet ist, geht die Gewichtung dieser Forderung in Richtung einer Patientenautonomie. In Österreich ist eine Zwangsbehandlung nur bei einer Gefährdung des Lebens oder einer ernsten und erheblichen Gefährdung der Gesundheit gestattet; nicht schon bei der Gefahr für die Gesundheit allgemein oder anderen Rechtsgütern. Der Schutz der Menschenrechte und der Würde von Menschen mit psychischen Störungen - besonders jener, die unfreiwillig in psychiatrische Einrichtungen aufgenommen werden - ist ein wichtiges Anliegen in Europa [2]. Es wird gefordert, dass eine Fixierung oder Isolierung nur unter strenger Nutzen-/Risikoabwägung erfolgen darf. Bei gewalttätigem Verhalten von Patienten sollten in erster Linie präventive und deeskalierende Schritte unternommen werden; nur in Ausnahmefällen darf eine Fixierung oder Isolierung erfolgen. Es wird unmissverständlich betont, dass Zwangsmaßnahmen lediglich als „Ultima Ratio“ bei der Hilfestellung zur Abwehr größeren Unglücks zulässig sind. Dennoch beträgt die Prävalenz unfreiwilliger stationärer Aufnahmen (Unterbringungen) im europäischen Vergleich nach Dressing & Salize zwischen 350% aller Aufnahmen [18]. Neben den 47 rechtlichen Rahmenbedingungen scheinen die Versorgungsstrukturen (z.B. die Zahl der psychiatrischen Betten) sowie die Einstellungen der Öffentlichkeit und der professionellen Helfer diese Rate zu beeinflussen. Die Fixierung wird als mechanisch aber auch physisch bedingte Bewegungseinschränkung, als schwerwiegender Eingriff in die persönlichen Grundrechte gesehen, wodurch besonders die Rechte des Patienten auf seine persönliche Freiheit und Menschenwürde als verletzt erachtet werden. Im Ländervergleich erfolgt bei 0-7% der stationär Aufgenommenen eine Fixierung. Ähnliche Werte werden für die Isolierung angegeben. Auch wird geschätzt, dass bei 2-8% der Aufgenommenen eine Zwangsmedikation erfolgt. Die Definition der Medikation als Zwangsmaßnahme und die dazugehörigen gesetzlichen Bestimmungen werden in den einzelnen europäischen Ländern unterschiedlich gehandhabt. Die zwangsweise Verabreichung von Medikamenten wird zudem in Untersuchungen zur Prävalenz von Unterbringung, Isolierung oder Fixierung fast nie berücksichtigt. Das fundierte Wissen zu den Zwangsmaßnahmen ist lückenhaft und die für einzelne Länder verfügbaren Daten sind oft schwer vergleichbar. Demnach finden sich, was die Art, Dauer und Häufigkeit von Maßnahmen betrifft zwischen den einzelnen Staaten der EU große Unterschiede [18,19]. Verantwortlich dafür sind u.a. der fehlende staatenübergreifende Konsens, ob eine Maßnahme als Zwang registriert werden soll sowie standardisierte Definitionen [20]. Dazu einige Ergebnisse [19]: Auffallend sind z.B. die Unterschiede zwischen Großbritannien und den Niederlanden. In Großbritannien ist die mechanische Fixierung verboten; die physische Fixierung ist hingegen erlaubt, die in der Regel weniger als eine halbe Stunde dauert. Für Großbritannien sind aber keine Daten zur medikamentösen Sedierung verfügbar. In den Niederlanden wird die Zwangsmedikation als eine die Integrität von Patienten am gröbsten verletzende Maßnahme erachtet; die diesbezüg- U. Meise, B. Frajo-Apor, M. Stippler, J. Wancata liche Gesetzgebung ist sehr restriktiv. Wahrscheinlich liegt darin die Ursache, dass dort Patienten über einen langen Zeitraum isoliert oder fixiert werden. In den Niederlanden wird die Isolierung - wie in den USA und der Schweiz - gegenüber einer Fixierung bevorzugt. Die Isolierung wird in Österreichs kaum angewendet; in Belgien ist sie sogar gesetzlich verboten. In einigen Bundesländern Österreich sind Netzbetten in Verwendung, während andere Länder auf Fixierung mittels Gurten setzen. In Island wurde vor einigen Jahren die Fixierung und Isolierung von Patienten abgeschafft und durch eine 1:1 Betreuung ersetzt. Für Deutschland ist die Datenlage hinsichtlich der Anwendung von Zwangsmaßnahmen gut; bezogen auf die Bevölkerung findet sich dort die im europäischen Vergleich höchste Rate. In pflichtversorgenden Kliniken erfolgen bei mindestens 5% (eher bei 89%) der stationären Patienten Zwangsmaßnahmen. Diese werden bei über der Hälfte der Fälle bei Patienten mit einer ICD F0-Diagnose angewendet. Obwohl Unterschiede in der Zahl psychiatrischer Betten bestehen, ist die Ausstattung der Psychiatrie in den Ländern der EU ähnlich. Solche Vergleiche lassen aber vermuten, dass die Unterschiede in der Anwendung von Zwang eher auf Tradition oder die Kultur beruhen [21] und weniger auf notwendige medizinische Erfordernisse oder Sicherheitsaspekte. Manche Staaten berichten über geringere Raten von Zwangsmaßnahmen. Dabei wäre zu klären, ob die Behandlung von Patienten bestimmter diagnostischer Zuordnung in andere Institutionen ausgelagert wird und ob sich dort die Anwendung von Zwangsmaßnahmen einer Dokumentation entzieht; so werden z.B. in manchen Ländern demente oder suchtkranke Patienten nicht in der Psychiatrie behandelt. Dies kann die Vergleichbarkeit von Erhebungen beeinflussen. Um solche Probleme mit der Vergleichbarkeit der Daten zu verringern, ist es methodisch sinnvoll die Anwendung von Zwangsmaßnahmen bei umschriebenen diagnostischen Gruppen auszuwerten. So wurde in der Studie von Martin et al [22] verglichen, welchen Zwangsmaßnahmen Patienten mit Schizophrenie, die in Deutschland und in der Schweiz über ein Jahr in je sieben psychiatrischen Krankenhäusern stationär behandelt wurden, unterworfen wurden. Dabei wurde erhoben, wie häufig bei dieser Patientengruppe Fixierung oder Isolierung erfolgten und wie lange diese dauerten. Der Einsatz einer Zwangsmedikation konnte in dieser Untersuchung nicht erhoben werden; auch finden sich keine Informationen hinsichtlich der personellen Ausstattung in den einzelnen Krankenanstalten oder der Einstellungen des Personals gegenüber der Praxis von Zwangsmaßnahmen. Das Ergebnis ist trotzdem beeindruckend: Die Variabilität der Häufigkeit von Isolierung und Fixierung sowie der Dauer ihrer Anwendung ist nicht nur zwischen beiden Staaten beachtlich, sondern auch zwischen den Kliniken in den einzelnen Länder fanden sich erhebliche Unterschiede; dies weist auf nationale Unterschiede, aber auch auf eine eigenständige klinische Praxis in den einzelnen Krankenanstalten hin. Man könnte sich der plakativen Meinung anschließen, dass die Anwendung von Zwangsmaßnahmen eher vom Personal als von Charakteristika der Patienten abhingen. Grundsätzlich bleibt vor dem Hintergrund des Konfliktes zwischen der Wahrung von Patientenautonomie und paternalistischer Verantwortlichkeit die Beantwortung der Fragen offen: wann, wie, wie lange und wie oft diese Maßnahmen wirklich durchgeführt werden müssen. Da die Organisation der Gesundheitsversorgung im Kompetenzbereich der einzelnen Staaten liegt, erscheint es gegenwärtig nicht möglich eine Differentialindikation oder einen Indikationskatalog für Zwangsmaßnahmen in der EU einzuführen. Im IQIP (International Quality Indicator Project) [23] wird die geringere Häufigkeit von Zwangsmaßnahmen als ein Indikator für die Qualität der stationären psychiatrischen Versorgung angesehen. „Gewaltsames Handeln in der Arbeit mit psychisch kranken Menschen steht 48 immer in einem raumzeitlichen und sozialen Kontext“ äußert Wienberg in seiner 13. These. Das „Makro-Milieu“ wie die reglementierende, überstrukturierte Organisation der traditionellen Verwahrungspsychiatrie aber auch die unstrukturierten Milieus in bestimmten Reformeinrichtungen können gewalttätiges Verhalten und somit Gegengewalt fördern. Wichtig sind auch das therapeutische „Mikro-Milieu“ und die Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter sowie deren individuelle Disposition, Haltungen und Bewältigungsmuster. Überstimulierung, Unruhe, Unübersichtlichkeit von Rollen, Funktionen und Räumen, Anonymität, ständiger Wechsel von Bezugspersonen, Entwertung, Kälte, Gleichgültigkeit oder Unberechenbarkeit können Patienten in Angst, Spannung oder Orientierungslosigkeit versetzen und begünstigen deren aggressive Entäußerungen. Unzureichende räumliche und materielle Arbeitsbedingungen, autoritäres Verhalten der Helfer, strafender, fordernder oder entwertender Umgangsstil oder zu Gewalt- und Konfliktbereitschaft disponierte Mitarbeiter tragen ebenfalls dazu bei. So konnte, wie eine Untersuchung von Reimer zeigt [24], eine Zunahme von Zwang in Zusammenhang mit abnehmender Personaldichte festgestellt werden; Fixierungen erfolgten vermehrt in den schlecht besetzten Nachtstunden. Eine sorgfältige Analyse des Kontextes könnte mithelfen, die Möglichkeiten und Grenzen einer Gewaltreduzierung in der Psychiatrie zu erkennen. Insgesamt liegt - bis auf wenige Ausnahmen - der durch die Psychiatrie ausgeübte Zwang nicht im Fokus der klinischen Forschung [25,26]. Das Wissen über das Ausmaß der Anwendung von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen ist lückenhaft. Gibt man in die Datenbank MEDLINE die Suchbegriffe „restraint, coercion - psychiatry“ ein, so scheinen für das Jahr 2010 nur eine geringe Zahl von Artikel auf, die sich gezielt mit dieser Thematik auseinandersetzen. Dabei gäbe es neben der Bearbeitung von administrativen oder deskriptiven Aspekten bezüglich der Art, Häufigkeit oder der Dauer von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie – ein Tabu? Zwangsmaßnahmen noch viele offene Fragen, zu denen bislang noch kaum empirische Befunde vorliegen: • Welchen Einfluss haben Zwangserfahrungen auf das subjektive Erleben und den Selbstwert von Betroffenen? • Wie wird durch die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen die Qualität oder Attraktivität des stationären psychiatrischen Behandlungsangebotes durch Patienten und Angehörige bewertet? • Beeinflussen solche Gewalterfahrungen den weiteren Krankheitsverlauf von Betroffenen, ihre zukünftige Inanspruchnahme psychiatrischer Leistungen oder die Compliance? • Welchen Einfluss haben gesellschaftliche Faktoren - wie z.B. die politische Stimmung über die öffentliche Sicherheit - auf die Häufigkeit von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen? • Welchen Stellenwert haben die Kontextfaktoren der psychiatrischen Behandlung oder die Einstellungen und Wertvorstellungen der involvierten behandelnden Personen auf die Praxis von Zwangsmaßnahmen? • Werden durch Zwangsmaßnahmen die sozialen Beziehungen von Betroffenen betroffen? • Werden die Anwendung von Zwang oder Gewalt durch stigmatisierende Einstellungen gefördert? Verfestigt diese Praxis Einstellungsstereotype wie z.B., dass von Menschen mit psychischer Erkrankung eine Gefahr ausginge? • Begünstigen Zwangsmaßnahmen das Fortbestehen oder die Entwicklung einer PTSD? • Welche Auswirkungen haben die Gewaltanteile psychiatrischen Handelns auf das Image der Psychiatrie in der Gesellschaft? Eine wissenschaftliche Bearbeitung dieser Themenbereiche könnte zum Überdenken der gängigen Praxis der Zwangsmaßnahmen und zu Korrek- turen führen. So wurde z.B. bislang nur selten den Fragen nachgegangen, wie Betroffene selbst diese Maßnahmen erlebt haben und wie man diese aus ihrer Sicht hätte vermeiden können. Die wenigen dazu verfügbaren Studien weisen darauf hin, dass das Erlebnis einer unfreiwilligen Hospitalisierung oder anderer Zwangsmaßnahmen, wie Fixierung oder Zwangsmedikation häufig als ein traumatisierendes und stigmatisierendes Ereignis bewertet werden [10,27-30]. In einer eigenen Untersuchung konnten wir zeigen, dass Betroffene, trotz des dadurch zugefügten Trauma, sich konstruktiv mit dieser Thematik auseinandersetzen, indem sie uns Empfehlungen gaben, wie diese Praxis verbessert werden könnte. Im Heft 4/2010 der Fortbildungszeitschrift „Spectrum Psychiatrie“ widmen sich - durchaus auch kritisch - mehrere Beiträge den freiheitsbeschränkenden Zwangsmaßnahmen. Im Editorial vertritt jedoch der Herausgeber die Ansicht, dass die Bezeichnung „freiheitsbeschränkende Maßnahmen“ unzutreffend sei und durch den Begriff „Schutzmaßnahmen“ (z.B. Unterbringung in klinischen Schutzräumen oder Schutzfixierung) ersetzt werden sollte. Diese besonderen Maßnahmen zum Schutze und Wohle des Patienten seien dann erforderlich, wenn die Erkrankung mit einem massiven Freiheitsgradeverlust einhergeht. Der Autor argumentiert, dass diese Maßnahmen dann nicht mehr als freiheitsbeschränkend bezeichnet werden können, da die zu beschränkende Freiheit von Patienten nicht mehr in ausreichendem Maß gegeben sei, um eine Freiheitsbeschränkung zu ermöglichen. Auch wenn Krankheiten (psychische wie körperliche), immer die Freiheitsgrade der Betroffenen einschränken, ist damit aber die Frage nicht beantwortet, ob Zwang die richtige Antwort darauf ist. Diesen wichtigen Aspekt aus der Diskussion auszuschließen, würde die notwendige Auseinandersetzung mit dieser sensiblen Thematik behindern. Es ist eine offene Konfrontation mit dem ethischen Dilemma notwendig, wie die Psychiatrie ihrem doppelten 49 Auftrag gleichermaßen gerecht werden kann. Einblicke, wie Pfleger und Ärzte die Ausübung von Zwang und Gewalt selbst erleben und verarbeiten, fehlen. Zum Behandlungsauftrag meint Hartmann Hinterhuber: „Eine patientenzentrierte Ethik in der Psychiatrie muss stets um einen Ausgleich zwischen dem traditionellen paternalistischen Patientenwohl und dem radikalen Selbstbestimmungsrecht des Patienten bemüht sein“. Was die legitimierte Möglichkeit zur Freiheitsbeschränkung betrifft, darf sich die Psychiatrie nicht von gesellschaftspolitischen Strömungen beeinflussen lassen [21,31]. Daher muss das enge Korsett, bestehend aus gesetzlichen Regelungen, Legitimationsverpflichtung und Kontrolle durch den Richter, erhalten bleiben. Gerade weil die Auseinandersetzung mit dieser Thematik unter einem hohen Tabuisierungsdruck steht, ist es, da die gewaltfreie Psychiatrie heute noch eine Fiktion darstellt [9], erforderlich, dass dieser Teil psychiatrischen Handelns immer wieder selbstkritisch durchleuchtet wird. Dazu äußerte Daniel Hell 1989: „Zwangsmaßnahmen sind für die stationäre Psychiatrie zwar nicht charakteristisch, aber sie sind für die Betroffenen – die „Opfer“ wie die „Täter“ – so belastend, dass sie immer wieder eine vertiefte Auseinandersetzung über Sinn und Widersinn nötig machen“. Dieser Diskurs sollte zwischen allen Beteiligten geführt werden. Er wäre ein Schutz vor möglicher unreflektierter „Gewaltroutine“ oder unangemessener Gewalt gegen psychisch kranke Menschen und er könnte dazu beitragen, das Stigma psychisch Kranker zu verringern und auch das Image der Psychiatrie in der Öffentlichkeit zu verbessern. U. Meise, B. Frajo-Apor, M. Stippler, J. Wancata Literatur [1] Bundesgesetz vom 1. März 1990 über die Unterbringung psychisch Kranker in Krankenanstalten (Unterbringungsgesetz - UbG)(NR: GP XVII RV 464 AB 1202 S. 132. BR: AB 3820 S. 526.)StF: BGBl. Nr. 155/1990. http://www.jusline. at/Unterbringungsgesetz_(UbG).html [2] EuropäischeKommission. GrünbuchDie psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessern. Brüssel 2005 http:// ec.europa.eu/health/ph_determinants/ life_style/mental/green_paper/mental_ gp_de.pdf [3] Kallert T, Jurjanz L, Schnall K, et al. Eine Empfehlung zur Durchführungspraxis von Fixierungen im Rahmen der stationären psychiatrischen Akutbehandlung. Psychiatr Prax 2007;34 Suppl 2:S233-240 [4] Anderl-Doliwa B, Breitmaier J, Elsner S, Kunz-Sommer B, Winkler I. Leitlinien für den Umgang mit Zwangsmaßnahmen. Psychiatrische Pflege 2005;11:100102 [5] Clinical Guideline 25Violence: the short-term management of disturbed/violent behaviour in psychiatric inpatient settings and emergency departments. In. London: National Institute for Clinical Excellence; 2005 [6] Schweizer Akademie der Wissenschaften. Zwangsmaßnahmen in der Medizin. Schweizerische Ärztezeitung 2004:2707-2714 [7] Helmchen H. Die Deklaration von Madrid 1996. Nervenarzt 1998;69:454-455 [8] Therapeutsiche Maßnahmen bei aggressivem Verhalten. In: DGPPN - Deutsche gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde; 2010 [9] Wienberg G. Gewaltfreie Psychiatrie - eine Fiktion. In: Eink M ed, Gewalttätige Psychiatrie Ein Streitbuch. Bonn: Psychiatrie Verlag; 1997:14-28 [10] Frueh B, Knapp R, Cusack K, et al. Patients' reports of traumatic or harmful experiences within the psychiatric setting. Psychiatr Serv 2005;56:1123-1133 [11] Hinterhuber H. Ermordet und Vergessen. Nationalsozialistische Verbrechen an psychisch Kranken und Behinderten. Innsbruck: VIP-Verlag; 1995 [12] Jäger M, Rössler W. Informeller Zwang zur Verbesserung der Behandlungsbereitschaft psychiatrischer Patienten. Neuropsychiatr 2009;23:206-215 Dawson J, [13] Dawson I, Szmukler G. Fusion of mental health and incapacity legislation. Br J Psychiatry 2006; 188:504-509 [14] Sailas E, Fenton M. Seclusion and restraint for people with serious mental illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000 [15] Finzen A. Gewalt in der Psychiatrie zur Legitimität der Zwangseinweisung. Spektrum 1986:147 - 155 [16] Schott H, Tölle R. Geschichte der Psychiatrie. München: C. H. Beck Verlag; 2005 [17] Heinroth JCA. Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens oder der Seelenstörungen und ihrer Behandlung. Leipzig: Vogel; 1818 [18] Dressing H, Salize H. Compulsory admission of mentally ill patients in European Union Member States. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2004;39:797803 [19] Steinert T, Lepping P, Bernhardsgrütter R, et al. Incidence of seclusion and restraint in psychiatric hospitals: a literature review and survey of international trends. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2010;45:889-897 [20] Salize HJ, Dressing H. Coercion, involuntary treatment and quality of mental health care: is there any link? Curr Opin Psychiatry 2005;18:576-584 [21] Lauber C, Nordt C, Falcato L, Rössler W. Public attitude to compulsory admission of mentally ill people. Acta Psychiatr Scand 2002;105:385-389 [22] Martin V, Bernhardsgrütter R, Göbel R, Steinert T. Ein Vergleich von schweizer und deutschen Kliniken in Bezug auf die Anwendung von Fixierung und Isolierung. . Psychiatr Prax 2007;34 Suppl 2: S212-217 50 [23] International Quality Indicator Project. In: Center for Perfomance Sciences, Inc.; 2002 http://www.internationalqip. com [24] Reimer F, Starz H. Gewalt und Sicherheit im Psychiatrischen Krankhenhaus. Spektrum 1989;5:195-198 [25] Steinert T. Arbeitskreis zur Prävention von Gewalt und Zwang in der Psychiatrie. http: //www.arbeitskreis-gewaltpraevention.de [26] Kallert TW. Coercion in psychiatry. Curr Opin Psychiatry 2008;21:485-489 [27] Olofsson B, Jacobsson L. A plea for respect: involuntarily hospitalized psychiatric patients' narratives about being subjected to coercion. J Psychiatr Ment Health Nurs 2001;8:357-366 [28] Längle G, Bayer W. Psychiatrische Zwangsbehandlung und die Sichtweise der Patienten. Psychiatr Prax 2007;34 Suppl 2:S203-207 [29] Scheutz A, Amering M, Sibitz I. Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie: Auswirkungen auf das Leben von Betroffenen. In, Universitätsklinik für Psychiatrie. Wien: Medizinische Universität Wien; 2008 [30] Längle G, Renner G, Günthner A, et al. Psychiatric commitment: patients' perspectives. Med Law 2003;22:39-53 [31] Hinterhuber H, Lehofer M, Ofner H, Stuppäck Ch. Verhaltenscodex für Psychiater. Neuropsychiatr 2009;23:263266 [32] Hinterhuber H, Ethik in der Psychiatrie (in Möller, Laux, Kapfhammer. Psychiatrie –Psychosomatik – Psychotherapie) 4. Auflage; S. 51-77; Springer Verlag, Heidelberg; 2010 Kontaktadresse: Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise Gesellschaft für Psychische Gesundheit – pro mente tirol, Innsbruck [email protected] Geschichte History Neuropsychiatrie, Band 25, Nr. 1/2011, S. 51–55 Zur Geschichte der Institutionalisierung der Medizinischen Psychologie in Österreich Hans Hirnsperger1, Reinhard Mundschütz2 und Gernot Sonneck1,3 Institut für Medizinische Psychologie, Zentrum für Public Health, Medizinische Universität Wien 2 Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien 3 Ludwig Boltzmann-Institut für Sozialpsychiatrie 1 Schlüsselwörter: Medizinische Psychologie – Medizinischer Unterricht – Universität – Geschichte – Österreich Keywords: medical psychology – medical curriculum – university – history – Austria Zur Geschichte der Institutionalisierung der Medizinischen Psychologie in Österreich Ausgehend von der Freudschen Psychoanalyse und der Zürcher Schule der Psychiatrie, die erstmals zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Forderung eines medizinpsychologischen Unterrichts an den Universitäten aufstellten, skizziert der Artikel den Weg zur Institutionalisierung der Medizinischen Psychologie in Österreich mit Schwerpunkt Wien. Besondere Erwähnung findet dabei der Akademische Verein für Medizinische Psychologie, der seine Vorlesungen und Kurse von 1926 bis 1938 an der Universität Wien abhielt. Er kann damit als Vorläufer für die Gründung der medizinpsychologischen Institute und psychotherapeutischen Kliniken von Ende der 60er bis Anfang der 80er Jahre gelten. © 2011 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 The history of the institutionalization of medical psychology in Austria Beginning with Freudian psychoanalysis and the Zürich school of psychiatry, which in the early 20th century were the first to call for studies in medical psychology at universities, the article traces the path to the institutionalization of medical psychology in Austria especially in Vienna. Particular attention is devoted to the Academic Society for Medical Psychology (Akademischer Verein für Medizinische Psychologie) which held lectures and courses at the University of Vienna from 1926 to 1938. The Society can thus be viewed as a predecessor of the foundation of the institutes for medical psychology and psychotherapeutic clinics, starting in the late 1960s and continuing into the early 1980s. Die Anfänge Bereits 1902 forderte Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie eine Lehrkanzel für soziale Medizin und meinte damit eine Medizin, die sich der Prophylaxe von Krankheit, Elend und Not verpflichtet fühlt. Fast modern anmutend schrieb er: „Für den Ärztestand hätte eine solche Lehrkanzel einen unermesslichen Wert. Die Zeiten sind wohl endgültig vorbei, wo die Meinung Platz greifen konnte je mehr Krankheiten desto besser für die Ärzte. Gerade das Gegenteil ist wahr. Hohe Krankheitszahlen zeugen von einer ausgepowerten Bevölkerung, die zahlungsunfähig und ohne Gefühl für den Wert der Gesundheit dem Ärztestand nicht nur das schuldige Honorar, sondern auch Wertschätzung und Achtung versagt. Je weniger Krankheiten auf ein Volk fallen, desto höher schätzt es seine Gesundheit, desto größer ist das Ansehen seiner Ärzte. Wenn es nun dem Ärztestande gelänge, durch die Erlangung einer wissenschaftlichen Lehrkanzel für soziale Medizin den Dilettantismus und den Zufall aus der Volkshygiene auszumerzen, um an deren Stelle sachverständiges Wirken und ein System der Prophylaxe zu setzen, so wäre das ein segensreiches Geschenk dem Volke wie den Ärzten“ [1] . Die treibende Kraft zur Entwicklung einer modernen Medizinischen Psychologie war neben anderen psychologischen Schulen die Psychoanalyse. Die Lehre Freuds erlebte um 1907 mit Hilfe der so genannten Zürcher Schule, gemeint ist die psychiatrische Schule von Eugen Bleuler und C. G. Jung am Burghölzli in Zürich, eine ungeahnte Akzeptanz. Sigmund Freud befand über Zürich: „An keiner anderen Stelle fand sich auch ein so kompaktes Häuflein von Anhängern beisammen, konnte eine öffentliche Klinik in den Dienst der psychoanalytischen Forschung gestellt werden oder war ein klinischer Lehrer zu sehen, der die psychoanalytische Lehre als integrierenden Bestandteil in den psychiatrischen Unterricht aufnahm” [15], während er über seine Heimatstadt äußerte: „Die Stadt Wien hat aber auch alles dazugetan, um ihren Anteil an der Entste- H. Hirnsperger, R. Mundschütz, G. Sonneck hung der Psychoanalyse zu verleugnen. An keinem anderen Orte ist die feindselige Indifferenz der gelehrten und gebildeten Kreise dem Analytiker so deutlich verspürbar wie gerade in Wien” [15]. Sigmund Freud zählte zu den vielen Verdiensten der Zürcher analytischen Schule die Forderung, jeder zukünftige Psychoanalytiker möge sich einer eigenen Lehranalyse unterziehen [14]. Aber nicht nur in Ausbildungsfragen zum Psychoanalytiker oder zur Psychoanalytikerin waren die Zürcher wegbereitend. Auch für das reguläre Medizinstudium kamen konkrete Vorschläge und Forderungen. Wenige Jahre später forderte der Schweizer Psychiater und Eugeniker August Forel, der der Psychoanalyse kritisch gegenüberstand, einen Unterricht in Medizinischer Psychologie. Er gründete gemeinsam mit Oskar Vogt und Hans von Hattingberg, anlässlich der Tagung der „Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte” in Salzburg im September 1909 den Internationalen Verein für Medizinische Psychologie und Psychotherapie [9]. Seinen Statuten nach bezweckte er die Förderung der „medizinisch wichtigen Abschnitte der Psychologie und der Psychotherapie” und deren Einführung in den Unterricht an den medizinischen Fakultäten [24]. Die erste Sitzung des Vereins fand im August 1910 in Brüssel statt, eine zweite war für 1911 in München geplant, fand aber 1912 in Zürich statt, wo Eugen Bleuler das Präsidium der Sitzung und später des Vereines übernahm (zit. nach [10]. Neben der Einführung eines medizinpsychologischen Unterrichts beabsichtigte August Forel offenbar auch eine Vereinigung aller psychotherapeutisch Tätigen in diesem Verein, was allerdings von den Psychoanalytikern kritisch betrachtet wurde. C. G. Jung brachte dies in einem Brief an August Forel folgendermaßen auf den Punkt: „Ich stehe ihrem Projecte der Vereinigung sämtlicher Psychotherapeuten natürlich sympathisch gegenüber, zweifle aber sehr daran, daß wir Leute von der Freud’ schen Schule bei der gegenwärtigen Unvereinbarkeit der Gegensätze willkommene Gäste wären” [11]. Der Verein hatte 1909 über 50 Mitglieder, darunter berühmte Persönlichkeiten wie Pierre Janet, Hippolyte Bernheim, Joseph Jules Dejerine und Sigbert Josef Maria Ganser [11]. Auch Alfred Adler, der sich 1911 von Sigmund Freud getrennt hatte, und 1932 einen Lehrstuhl für Medizinische Psychologie in den USA erhielt, nahm an diesen Kongressen teil. Im September 1913 tagte der Internationale Verein für Medizinische Psychologie und Psychotherapie in Wien. Der Eröffnungsvortrag von Eugen Bleuler hatte den Titel „Über die Notwendigkeit eines medizinisch-psychologischen Unterrichts“ [5], [6]. Dabei mahnte er, dass die Vernachlässigung psychischer Zusammenhänge grobe Fehler in der Behandlung der Patienten mit sich bringen würde. Die unangenehmsten Fehler sah er in denjenigen, „die deshalb gemacht werden, weil die Ärzte den Einfluß ihrer Worte auf die Psyche nicht zu beachten gewohnt sind” [6] und forderte der technischen Seite der Ausbildung mit einer wissenschaftlichen medizinischen Psychologie ein Gegengewicht zu geben. Der erste Weltkrieg verhinderte jedoch die weitere Entwicklung. Zwischenkriegszeit Die von Eugen Bleuler noch vor dem ersten Weltkrieg aufgestellte Forderung verschiedenste psychologische Schulen in den medizinischen Unterricht zu integrieren, ließ sich unmittelbar nach dem Kriege nicht verwirklichen, waren doch die Studierenden zunächst hauptsächlich an psychoanalytischen Inhalten interessiert. So verlangten 1918 in Budapest Studierende der Medizin nach psychoanalytischen Vorlesungen und tatsächlich wurde Sandor Ferenczi, allerdings nur für kurze Zeit, Professor für Psychoanalyse [16]. Sigmund Freud hatte dieses Unternehmen mit dem Aufsatz „Soll die Psychoanalyse an den Universitäten gelehrt werden?“ unterstützt und kam zum Schluss, „daß jede Universität nur Vorteile davon haben kann, wenn sie bereit 52 ist, die Psychoanalyse in ihren Lehrplan aufzunehmen” [12]. Freud sah zwar den Bedarf an einer zusätzlichen Schulung künftiger Ärzte, er wollte diese allerdings den Studierenden in einer ökonomisch so angespannten Zeit nicht zumuten. „Macht man sich die gewiß vollberechtigte Forderung zu eigen, daß der Arzt auch mit der seelischen Seite des Krankseins vertraut sein müsse, und dehnt darum die ärztliche Erziehung auf ein Stück Vorbereitung für die Analyse aus, so bedeutet das eine weitere Vergrößerung des Lehrstoffes und die entsprechende Verlängerung der Studienjahre” [14]. Freuds Urteil über Ausbildung und Umgang mit Kranken insbesondere mit Patienten mit neurotischen Störungen war hart: „Der kranke Mensch ist ein kompliziertes Wesen, er kann uns daran mahnen, daß auch die so schwer faßbaren seelischen Phänomene nicht aus dem Bild des Lebens gelöscht werden dürfen. Der Neurotiker gar ist eine unerwünschte Komplikation, eine Verlegenheit für die Heilkunde nicht minder als für die Rechtspflege und den Armendienst. Aber er existiert und geht die Medizin besonders nahe an. Und für seine Würdigung wie für seine Behandlung leistet die medizinische Schulung nichts, aber auch gar nichts” [13]. Wohl auch um diesen Missstand zu beheben, gründeten 1925 Studierende der Medizin in Wien den Akademischen Verein für Medizinische Psychologie, der später höchste Anerkennung genießen sollte, wie beispielsweise der schweizer Psychiater Max Müller formulierte: „Der dortige Akademische Verein für Medizinische Psychologie fragte mich im September 1934 an, ob ich nicht im Laufe des kommenden Winters aus dem Gebiet der Kriminalpsychologie einen Vortrag halten könnte. Diese Anfrage war sehr ehrenvoll, denn es handelte sich um eine Gesellschaft, deren hohes Niveau allgemein bekannt war“ [23]. Dezidiertes Ziel des Vereins war es, alle psychologischen und psychotherapeutischen Richtungen in Vorträgen und Kursen, die durchwegs von akademischen Lehrern auf universitärem Boden abgehalten wurden, zu Wort Zur Geschichte der Institutionalisierung der Medizinischen Psychologie in Österreich kommen zu lassen. Im zwölfjährigen Bestehen des Vereins wurden über 200 wissenschaftliche Vorträge und Kurse abgehalten. Neurosenlehre der Psychoanalyse sowie der Individualpsychologie, Entwicklungspsychologie, Psychosomatik, damals noch die psychophysischen Zusammenhänge sowie Fragen und Schulen der Psychotherapie waren neben psychiatrischen Themen wichtige Inhalte. Der Verein stellte sich zur Aufgabe eine Lehrkanzel für Medizinische Psychologie an der Wiener Universität zu schaffen. Die Mittlerrolle, die der Verein für Medizinische Psychologie zwischen Akademischer Psychologie, Psychoanalyse und Psychotherapie und Medizinischen Fachrichtungen eingenommen hatte, war mit dem Anschluss Österreichs im März 1938 und mit der Vertreibung der meisten seiner Mitarbeiter jedoch abrupt aufgehoben. Eine Annäherung erfolgte erst wieder in den späten sechziger Jahren (siehe [18], [19]). Nachkriegszeit Beträchtliche Schwierigkeiten bereitet die Nachkriegszeit, will man sie im Hinblick auf die Aktivitäten der Medizinischen Psychologie beurteilen. Obwohl die Vorstände der Neurologisch-Psychiatrischen Universitätsklinik Wien Otto Kauders (1945–1949) und Hans Hoff (1950–1969) schon in der Zwischenkriegszeit im Akademischen Verein für Medizinische Psychologie eine aktive Rolle gespielt hatten, war man von einer Wiederaufnahme der Lehrinhalte noch weit entfernt. Beide waren im Exil und konnten daher erst nach 1945 wieder Fuß fassen, im Gegensatz zu den meisten anderen vertriebenen Mitgliedern der Universität Wien. Von Seiten der Republik wurden nach 1945 nur sehr zaghafte Versuche unternommen ehemalige Professoren zurückzuholen, immerhin aber hatte Hubert Rohracher vor seiner Ernennung zum Vorstand des Psychologischen Instituts in Wien bei Karl Bühler angefragt, um ihm die Rückkehr auf seine Wiener Professur anzubieten und erst nach dessen Absage diese angenommen (siehe [3]). Auch in didaktischer Hinsicht hatte man die Leistungen der frühen Medizinpsychologen in Österreich vergessen. So fand Paul Schilders exzellentes Lehrbuch Medizinische Psychologie für Ärzte und Psychologen, erstmalig erschienen in Wien 1924, keine Beachtung im deutschen Sprachraum, wurde aber 1953 in englischer Übersetzung in den USA neu aufgelegt. Auch das Buch von Margarethe von Andics über Menschen nach Suizidversuch [2] wurde zwar in London 1947 auf englisch publiziert, hierzulande jedoch vergessen. Ebenso wurde das Buch „Lectures in Medical Psychology“ [4], welches sich mit dem Umgang mit Patienten beschäftigte, von Grete L. Bibring, die von Wien aus 1938 ins Exil musste, mit keiner Silbe rezipiert. An der Medizinischen Fakultät der Universität Wien der Nachkriegszeit wurden psychologische und psychotherapeutische Lehrinhalte, soweit überhaupt vorhanden, nur an der Neurologischpsychiatrischen Universitätsklinik angeboten. Erwin Ringel beispielsweise leitete ab 1954 eine erste psychosomatische Station, 1961 wurde unter der Leitung von Hans Strotzka ein Psychotherapeutisches Lehrinstitut eingerichtet [21] und 1964 bezeichnete Erwin Ringel gemeinsam mit Hans Hoff Psychosomatik bzw. Medizinische Psychologie als „eine Lücke im Lehrplan der medizinischen Fakultäten” [20]; Hans Strotzka forderte diese zu schließen [28]. Jegliche „medizinpsychologische” Aktivität war an diese Klinik gebunden. Verwunderlich mutet an, dass Hans Hoff, der das Psychotherapeutische Lehrinstitut als seine „Lieblingsidee" bezeichnete, mit keinem Wort die Aktivitäten der Studierenden vor dem Krieg erwähnte, war er doch selbst Redner und wissenschaftlicher Beirat im Akademischen Verein für Medizinische Psychologie, beziehungsweise musste er das Lehrinstitut der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung gekannt haben, mit dem eine enge Kooperation bestand. Die Studentenbewegung der 68er Jahre, 53 mit ihrer scharfen Psychiatriekritik und ihrer Forderung die Psychoanalyse und andere psychotherapeutische Schulen in den Unterricht aufzunehmen, führte zu einer Änderung. Vorreiter in Österreich war Erich Pakesch, der 1968 das Institut für Medizinische Psychologie und Psychotherapie an der Medizinischen Fakultät in Graz gründete. Er begründete 1969 auch das heute noch stattfindende Integrative Seminar für Psychotherapie in Bad Gleichenberg [22]. Sein Nachfolger ist Walter Pieringer. Der Aufgabenbereich der neu geschaffenen Klinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie umfasst neben der universitären Lehre und wissenschaftlichen Forschung Aufgaben im Bereich der Patientenversorgung, Team-Supervision und psychologische Beratung des medizinischen Krankenhauspersonals [7]. Zu den Forschungsschwerpunkten zählen unter anderen Psychophy­siologie, Psychotherapieforschung, Netzwerk Psychosomatik Österreich, Wirkung des professionellen ärztlichen Gesprächs auf PatientInnen-Parameter, Subjektivitätsforschung „Spiritualität im Krankenhaus“. Auch die akademische Psychologie spielte bei der Etablierung der Medizinischen Psychologie an der medizinischen Fakultät der Universität Wien eine bedeutende Rolle. Als eine der Variablen, warum es 1971 relativ rasch zur Gründung der Klinik für Tiefenpsychologie in Wien kam, erwähnte Hans Strotzka: „Außerdem war Rohracher unter schwersten Druck der Studenten gekommen, etwas für die Psychoanalyse zu tun. Er war bereit aber nicht an der Psychologie, sondern an der Medizin. Er kannte mich gut vom HirnverletztenLazarett während des Krieges und hatte vor mir (mit Recht wie sich zeigte) keine Angst” [17], (siehe auch [25]). Anlässlich der Universitätsreform 1975 wurde Medizinische Psychologie als Vorprüfungsfach für den zweiten Studienabschnitt eingeführt, als Institut der Universität Wien begann man im Jahre 1981. Ursprünglich war Raoul A. Schmiedeck, Professor an der Yale Uni­versity als Vorstand des Instituts für H. Hirnsperger, R. Mundschütz, G. Sonneck Medizinische Psychologie vorgesehen. Durch seinen plötzlichen Tod wurde Erwin Ringel erster Vorstand des Instituts. Nach Erwin Ringels Ernennung zum Ordinarius für Medizinische Psychologie im Jahre 1981 dauerte es noch über ein Jahr bis die Medizinische Psychologie mit einem eigenen Institut ausgestattet wurde. Die erste konstituierende Sitzung im Rahmen einer Institutskonferenz fand am 14. Jänner 1983 statt. Der Berufung Erwin Ringels war eine lebhafte Diskussion vorausgegangen, ob ein Psychologe oder ein Arzt die Leitung des Instituts übernehmen sollte. Immerhin aber wurden zwei Psychologen, beide mit tiefenpsychologischer Ausbildung, am Institut beschäftigt. Im Medizinstudium wurde ein Praktikum „Seminar in Medizinischer Psychologie” verpflichtend eingeführt mit dem Ziel den Studierenden „das Zusammenwirken von biologischen, psychologischen und soziokulturellen Faktoren bei Gesundheit und Krankheit im Sinne einer möglichst ganzheitlichen Sicht des kranken Menschen“ – bio-psychosoziokulturelle Medizin – zu vermitteln. Ein erster Leitfaden für Medizinische Psychologie wurde 1989 aufgelegt und entwickelte sich zum Lehrbuch mit insgesamt sieben Auf­lagen [27]. Erstmals wurden auch Kooperationen mit verschiedenen anderen Kliniken eingegangen und Themen wie Schmerz, Psychosomatik, Psychoonkologie gemeinsam erforscht und klinisch umgesetzt. Zu den genannten Schwerpunkten kamen Arzt-Patient-Beziehung, das ärztliche Gespräch, Anamnesegruppen, Unterrichtsforschung, Abschiedsbriefforschung, Suizidologie, Geschichte der Medizinischen Psychologie, die Darstellung von Kranken im Film, Burnout sowie Präterminalität, Sterben und Tod hinzu. Erwin Ringel wurde 1991 emeritiert und sein Nachfolger wurde – vorerst als supplierender Leiter – im Jahr 1996 Gernot Sonneck. Dem Auf- und Ausbau der Lehre in Medizinischer Psychologie folgten gravierende Änderungen. Die medizinische Fakultät der Universität wurde 2004 zur eigenständigen Medizinischen Universität. Ein neuer Studienplan wurde erstellt. Es erfolgte eine deutliche Aufwertung der psychosozialen Fächer, die gegenwärtig jedoch Gefahr laufen reduziert zu werden. In Innsbruck war ein Ordinariat für Medizinische Psychologie und Psychotherapie ab 1984 zunächst der Psychiatrie zugeordnet. Wolfgang Wesiack übernahm 1987 als erster Vorstand das neu gegründete Institut für Medizinische Psychologie und Psychotherapie. Ein vom Institut initiiertes Ausbildungscurriculum für Ärzte in Psychosomatischer Medizin hatte Vorbildfunktion für die später geschaffenen PSY-Diplome der Ärztekammer. Nachfolger von Wolfgang Wesiack ist Gerhard Schüßler. Der Aufgabenbereich der Innsbrucker Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie beinhaltet neben der universitären Lehre und wissenschaftlichen Forschung – ähnlich wie in Graz – Psychotherapeutische Ambulanz, einen Konsiliar- und Liaisondienst, eine Frauenambulanz, eine Psychosomatische Schmerzambulanz sowie eine Abteilung für Sexualmedizin. Psychotherapieforschung, Grundlagenforschung, insbesondere Psychoneuroimmunologie, Psychosomatische Grundlagen und Versorgungsforschung, insbesondere im Konsiliar- und Liaisonbereich werden als Forschungsbereiche angeführt. Ab Mitte der 80er Jahre waren damit in Österreich an allen drei medizinischen Fakultäten psychoanalytische und psychotherapeutische Lehrinhalte für die Studierenden verbindlich. Im Jahr 1990 wurde unter maßgeblicher Mitarbeit der Klinik in Graz (Josef Egger) die erste in Österreich erscheinende wissenschaftliche Zeitschrift für Medizinische Psychologie und Psychotherapie „Psychologie in der Medizin“ gegründet, die heute unter dem Namen „Psychologische Medizin“ [26] erscheint. Die Zeitschrift ist offizielles Mitteilungsorgan der Österreichischen Gesellschaft für Medizinische Psychologie, Psychotherapie und Psychosomatik (ÖGMP). Diese wissenschaftliche Gesellschaft wurde 1990 von der Univ.-Klinik für Medizi- 54 nische Psychologie und Psychotherapie Graz in Kooperation mit der Univ.-Klinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie Innsbruck, dem Institut für Medizinische Psychologie Wien und der Univ.-Klinik für Tiefenpsychologie und Psychotherapie Wien (jetzt Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie) gegründet. Die genannten Kliniken sind es auch, die gemeinsame Fachtagungen organisieren. 1998 wurde von dem Internisten Karl Harnoncourt der Interuniversitäre Fachbeirat (IUFB) für Psychosomatik gegründet, mit dem Ziel Qualitätsstandards zur psychosomatischen Versorgung in Österreich zu erarbeiten. Gründungsmitglieder waren zunächst die drei medizinpsychologischen Ordinarii, später erweitert um die Ordinaria für Tiefenpsychologie und Psychotherapie (Wien), den Leiter der psychiatrischen Klinik von Graz sowie den Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer. Vier Arbeitsgruppen (Netzwerk Psychosomatik – Graz, Indikationen – Innsbruck, Bedarf – Tiefenpsycholgie und Psychotherapie Wien sowie Evaluation – Wien) erstellten im Auftrag des Gesundheitsministeriums einen umfangreichen Projektbericht, der als Grundlage für das auch im Entwicklungsplan der MUW [8] angeführte Interuniversitäre Institut für Psychosomatik dienen sollte. Rückblick – Ausblick Die Psychologie kann der Medizin konstruktiv näher kommen, sobald eine gewisse Eigenständigkeit von Medizinischer Psychologie, Psychotherapie und Psychoanalyse gewahrt wird. Eine Angliederung an medizinische Disziplinen, wie an die Psychiatrie, hat sich als nicht förderlich herausgestellt. Offensichtlich aber besteht für medizinpsychologische Fachrichtungen eine latente Gefahr vereinnahmt zu werden. So wurden 2003 an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien zehn Forschungsschwerpunkte definiert, von denen einer „Neurowissenschaften“ war. Darunter sollten nun die Fächer Zur Geschichte der Institutionalisierung der Medizinischen Psychologie in Österreich der Psychiatrie, der Medizinischen Psychologie und der Tiefenpsychologie – Psychotherapie subsumiert werden. Die Ordinarii von Psychiatrie, Neuropsychiatrie des Kindes und Jugendalters, der Medizinischen Psychologie sowie der Tiefenpsychologie und Psychotherapie sahen sich genötigt als Arbeitsgruppe mit wissenschaftslogischen Argumenten für eine Eigenständigkeit der „psychiatrischen und psychosozialen Wissenschaften” im Rahmen der Medizin einzutreten, damit neben den so genannten Neurowissenschaften unter den wissenschaftlichen Schwerpunkten der Medizinischen Universität die psychiatrischen und psychosozialen Wissenschaften eine gleichwertige Position einnehmen können. Im Jahre 2010, dem Jahr der Emeritierung des Institutsvorstands, ist eine Nachbesetzung des Ordinariats für Medizinische Psychologie vorerst bis 2012 nicht vorgesehen. Eine Zusammenlegung mit der Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie ist angedacht, vorläufig bleibt jedoch die Medizinische Psychologie als Subeinheit gemeinsam mit der Allgemein- und Familienmedizin, der Sozialmedizin der Ethik in der Medizinischen Forschung, der Epidemiologie und der Umwelthygiene im Zentrum für Public Health. Ob das alles der bio-psycho-sozio-kulturellen Balance der Medizin auf längere Sicht gut tun wird? Literatur [1] Adler A.: Eine Lehrkanzel für soziale Medizin. In: Bruder-Bezzel A.: Alfred Adler. Gesellschaft und Kultur. Vandenhook & Ruprecht, Göttingen 2009. [2] Andics M.: Suicide and the meaning of life. W. Hodge, London 1947. [3] Benetka G.: Entnazifizierung und verhinderte Rückkehr. Zur personellen Situation der akademischen Psychologie in Österreich nach 1945. ÖZG 9, 188–217 (1998). [4] Bibring G. L.: Lectures in medical psychology. An introduction to the care of patients. International Universities Press, New York 1968. [5] Bleuler E.: Die Notwendigkeit eines medizinisch-psychologischen Unterrichts. Zeitschr Pathopsychol Erg. Bd., 3–8 (1914). [6] Bleuler E.: Die Notwendigkeit eines medizinisch-psychologischen Unterrichts. Sammlung klinischer Vorträge. Neue Folge 701. Barth, Leipzig 1914. [7] Egger, J., Pieringer, W.: Aufgaben und Struktur der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie Graz. In: Egger, J.: Psychologie in der Medizin. Medizinische Psychologie, Psychotherapie, Psychosomatik. WUV-Universitätsverlag, 16–52, Wien 1993 [8] Entwicklungsplan der Medizinischen Universität Wien. In: Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Wien. Ausgegeben am 30. 4. 2009, 13. Stück; Nr. 20, Studienjahr 2008/2009 [9] Forel A.: Die Stellung der Neurologie, der Psychiatrie und der Psychotherapie an der Hochschule. Journal für Psychologie und Neurologie 15, 280–287(1910). [10] Forel A.: Rückblick auf mein Leben. Europa-Verlag, Zürich 1935. [11] Forel A.: Briefe. Huber, Bern 1968. [12] Freud S.: Soll die Psychoanalyse an den Universitäten gelehrt werden? Das Argument 3, 80–82 (1969). [13] Freud S.: Die Frage der Laienanalyse. GW XIV, 209–296. Fischer, Frankfurt am Main 1981. [14] Freud S.: Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung. GW VIII, 376–387. Fischer, Frankfurt am Main 1981. [15] Freud S.: Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung. GW X, 43–113. Fischer, Frankfurt am Main 1981. [16] Harmat P.: Freud, Ferenczi und die ungarische Psychoanalyse. Mit einer Einleitung von Bela Grunberger. Edition Diskord, Tübingen 1988. [17] Hauer N.: Hans Strotzka. Eine Biographie. Holzhausen, Wien 2000. [18] Hirnsperger H., Sonneck G.: Psychologie und Medizin. Eine historische Skizze. In: Mehta G.: Die Praxis der Psychologie. Ein Karriereplaner. Springer-Verlag, Wien 2004. [19] Hirnsperger H., Mundschütz R., Sonneck G.: Der Akademische Verein für Medizinische Psychologie an der Universität Wien 1925–1938. Psychologische Medizin 20, 17–32 (2009). [20] Hoff H., Ringel E.: Aktuelle Probleme der psychosomatischen Medizin. Kritische Beiträge zur Somatisierung der Neurose und ihrer Therapie. Jolis Verlag, München 1964. [21] Hoff H.: Bedeutung und Notwendigkeit eines Psychotherapeutischen Lehrinstitutes. Wiener Medizinische 55 Wochenschrift 111, 315–316 (1961). [22] Karloff D., Papatschy H., Pieringer W., Verlic B.: Aufbruch ins Innere. 40 Jahre Integratives Seminar für Psychotherapie in Bad Gleichender. Pro Business, Berlin 2009 [23] Müller M.: Erinnerungen. Erlebte Psychiatrie-Geschichte 1920–1960. Springer, Berlin 1988. [24] Internationaler Verein für medizinische Psychologie und Psychotherapie. Journal für Psychologie und Neurologie 15, 143–144 (1909). [25] Plangl M.: Die Entstehungsgeschichte des Instituts für Tiefenpsychologie und Psychotherapie an der Wiener Medizinischen Fakultät. Diplomarbeit, Universität Wien 2004. [26] Psychologische Medizin: Österreichische Fachzeitschrift für Medizinische Psychologie, Psychotherapie und Psychosomatik. Facultas, Wien (ISSN 1014–8167). [27] Sonneck G., Frischenschlager O., et al.: Medizinische Psychologie. Ein Leitfaden für Studium und Praxis mit Prüfungsfragen. Facultas, Wien 1995. [28] Strotzka H.: Über die Notwendigkeit der Einführung einer medizinischen Psychologie und Soziologie in die medizinische Ausbildung. Wiener Medizinische Wochenschrift 115, 403–406 (1965). Links Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie Medizinische Universität Graz Universitätsklinik für Medizinische Psychologie der Medizinischen Universität Innsbruck Institut für Medizinische Psychologie Medizinische Universität Wien Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie Medizinische Universität Wien Hans Hirnsperger, Medizinische Universität Wien, Zentrum für Public Health, Institut für Medizinische Psychologie, [email protected] http://www.springer.com/journal/40211