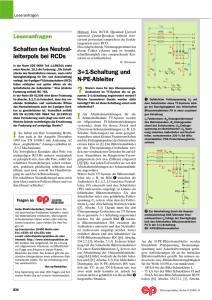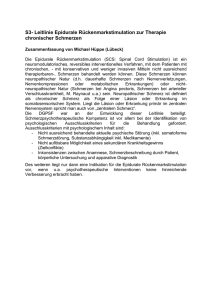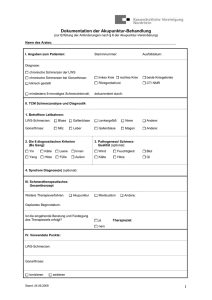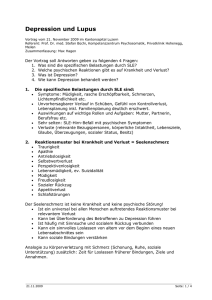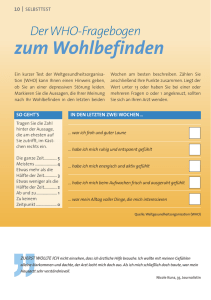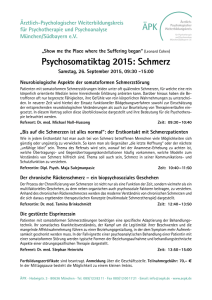Gesundheits- und Krankheitsmodelle
Werbung

15 Gesundheitsund Krankheitsmodelle H. Faller, H. Lang 2.1 Verhaltensmodelle – 16 H. Faller 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Lerntheoretische und kognitions­theoretische Grundlagen – 16 Verhaltensanalytisches G ­ enesemodell – 20 Verhaltensmedizinische Ansätze – 21 Verhaltensgenetik – 22 2.2 Psychobiologische Modelle – 24 H. Faller 2.2.1 Emotion, Stress und Krankheit – 25 2.2.2 Schmerz – 28 2.3 Psychodynamische Modelle – 32 H. Faller, H. Lang 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 Psychoanalytische E­ ntwicklungspsychologie – 32 Traditionelle Stadien der p ­ sychosexuellen Entwicklung – 34 Drei-Instanzen-Modell, ­Triebmodell – 36 Trieb-, Ich-, Selbst- und Objekt-psychologische Modelle – 37 Abwehrmechanismen – 37 Primärer und sekundärer K ­ rankheitsgewinn – 40 Struktur und Konflikt – 40 2.4 Sozialpsychologische Modelle – 41 H. Faller 2.4.1 Psychosoziale Einflüsse auf Gesundheit und Krankheit – 41 2.4.2 Psychische Risiko- und Schutzfaktoren – 42 2.4.3 Soziale Unterstützung – 44 2.5 Soziologische Modelle – 46 H. Faller 2.5.1 Einflüsse der gesellschaftlichen Opportunitätsstruktur – 46 2.5.2 Einflüsse ökonomischer und ökologischer Umweltfaktoren – 47 H. Faller, H. Lang, Medizinische Psychologie und Soziologie, DOI 10.1007/978-3-662-46615-5_2, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016 2 16 2 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle Im folgenden Kapitel werden unterschiedliche ­theoretische Modelle von Gesundheit und Krankheit vorgestellt: Verhaltensmodelle, psychobiologische Modelle, psychodynamische Modelle, sozialpsychologische Modelle und soziologische Modelle. Diese Einteilung reflektiert die bis in die jüngste Vergangenheit und zum Teil auch heute noch vorherrschende Zersplitterung der Wissenschaft. Sie ist aber nur noch aus didaktischen Gründen zu rechtfertigen. ­Gesundheit und Krankheit sind so komplexe Phänomene, dass es nicht angemessen ist, sie nur unter dem Blickwinkel eines einzelnen Modells zu be­ trachten. Die Ergebnisse der verschiedenen Perspektiven werden heutzutage in zunehmendem Maße miteinander verknüpft. In Studien, die sich auf dem aktu­ellen Stand der Wissenschaft befinden, werden biologische und psychologische Einflüsse gleich­ zeitig analysiert. Dies geschieht z. B. in verhaltens­ genetischen Untersuchungen, in denen sowohl die Gene als auch elterliches Verhalten erfasst werden, um das Zusammenwirken von Anlage und Umwelt bei der Persönlichkeitsentwicklung aufzuklären. 2.1 Verhaltensmodelle H. Faller Lernziele Der Leser soll 55 das respondente, operante und kognitive ­Lernmodell beschreiben können, 55 das SORKC-Modell der Verhaltensanalyse ­beschreiben können, 55 Gen-Umwelt-Interaktion und Gen-UmweltKorrelation unterscheiden können. Das menschliche Verhalten spielt eine wichtige ­Rolle bei der Entstehung und Bewältigung von Krankheiten. Diejenigen Verhaltensweisen, die sich auf die menschliche Gesundheit auswirken, werden Gesundheitsverhalten genannt. Ein Beispiel für ein günstiges Gesundheitsverhalten ist körperliche Aktivität. Sie schützt vor der Entstehung von Herz­ erkrankungen und Krebs. Beispiele für ungünstiges, riskantes Gesundheitsverhalten sind Zigaretten­ rauchen, ungesunde Ernährung und Bewegungs­ mangel. Diese Verhaltensweisen sind Risikofakto­ ren für die Entstehung von Herzkrankheiten und Krebs. Das Verhalten eines Menschen, der schon an einer Krankheit leidet, wird als Krankheitsver­ halten bezeichnet. Ein Beispiel für ein günstiges Krankheitsverhalten ist die Mitarbeit bei der medi­ zinischen Therapie, z. B. regelmäßige Medikamen­ teneinnahme (Compliance, 7 Abschn. 5.5.2). Aus den Verhaltensmodellen, die im Folgenden vor­ gestellt werden, lassen sich Strategien ableiten, wie man das Gesundheits- und Krankheitsverhalten in eine günstige Richtung lenken kann. 2.1.1 Lerntheoretische und kognitions­ theoretische Grundlagen Verhaltensmodelle basieren auf der Lerntheorie. Zunächst dominierte hier der Behaviorismus, der nur beobachtbares Verhalten als Gegenstand der Psychologie akzeptierte und die Betrachtung von inneren Prozessen (Introspektion) als unwissen­ schaftlich ablehnte. Die menschliche Psyche wurde als »Black Box« betrachtet, in die man nicht hinein­ sehen kann. Verhalten wurde allein durch Umwelt­ bedingungen zu erklären versucht. Während diese radikale Perspektive damals einen Fortschritt ge­ genüber einer rein spekulativen Psychologie dar­ stellte und viele (tier-)experimentelle Untersu­ chungen anregte, schoss sie doch über das Ziel ­hinaus und schränkte die Erkenntnismöglichkeiten der Psychologie unnötig ein. In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts hat deshalb die »kognitive ­Wende« stattgefunden. Kognitionen, d. h. Gedan­ ken, Bewertungen, Erwartungen, Ziele etc., werden heute als wichtige verhaltenssteuernde Faktoren angesehen. Die Lerntheorie hat gerade den weiteren Schritt vollzogen, auch unbewusste Lernprozesse anzuerkennen, so dass möglicherweise in nicht all­ zu ferner Zukunft lerntheoretische und psychody­ namische Modelle miteinander kombiniert werden können. In diesem Abschnitt werden die Lerntheorien kurz im Überblick dargestellt. Ergänzungen folgen in 7 Abschn. 4.2. 17 2.1 · Verhaltensmodelle >> Die Lerntheorien werden unterschieden in 55respondentes Modell (klassische Kondi­ tionierung), 55operantes Modell (operante Kondi­ tionierung), 55kognitives Modell (Lernen durch Eigen­ steuerung, Lernen durch Einsicht). Respondentes Modell Das respondente Modell ­ etrifft Verhalten, das durch einen Reiz ausgelöst b wird: Das Verhalten stellt die Antwort (response) auf den Reiz dar, daher der Name respondent. Synonym ist der Begriff klassische Konditionierung. Be­ gründer dieses Modells ist der russische Physiologe Iwan Pawlow. Im Rahmen seiner Experimente zum Speichelfluss bei Hunden stellte er eher beiläufig fest, dass bei den Versuchstieren schon dann Spei­ chelfluss auftrat, wenn sie den Raum betraten, in dem sie üblicherweise gefüttert wurden, oder den Tierpfleger sahen, der ihnen das Futter brachte, oder ihn auch nur kommen hörten. Der Klang sei­ ner Schritte war zu einem Signal dafür geworden, dass es bald Futter gab. Pawlow führte eine Serie von Experimenten durch, in denen als Signalreiz beispielsweise ein Glockenton verwandt wurde: Re­ gelmäßig kurz vor der Fütterung wurde eine Glocke geläutet. Nach einigen Versuchsdurchgängen löste alleine der Glockenton Speichelfluss aus. Grundlage der klassischen Konditionierung ist ein angeborener Reflex. Dieser besteht aus einem unkonditionierten Reiz (unconditioned stimulus, UCS) und einer unkonditionierten Reaktion (UCR): Futter (UCS) löst Speichel (UCR) aus. Nimmt man nun einen neutralen Reiz wie einen Glockenton (der zunächst nur eine Orientierungsreaktion, z. B. ein neugieriges Ohrenaufstellen, provoziert) und setzt ihn mehrfach kurz vor der Futtergabe ein (­Koppelung mit dem UCS), so wird der neutrale Reiz zum konditionierten Reiz (CS). Er wirkt wie ein Signal für den darauf folgenden UCS und ist schließlich auch alleine in der Lage, Speichelfluss auszulösen, selbst wenn danach gar kein Futter ge­ geben wird. Eine konditionierte Reaktion (CR) ist entstanden. >> Bei der klassischen Konditionierung werden 2 Reize miteinander verknüpft, ein unkondi­ tionierter Reiz (UCS, z. B. Futter) und ein kondi­ 2 tionierter Reiz (CS, z. B. Glocke). Nach mehr­ facher Präsentation des CS kurz vor dem UCS ist auch der CS in der Lage, eine Reaktion (kon­ ditionierte Reaktion, z. B. Speichel) auszulösen. Evolutionärer Sinn Bei der klassischen Konditio­ nierung wird eine Assoziation zwischen UCS und CS gelernt. Das Individuum entwickelt die Erwar­ tung, dass nach dem CS der UCS eintreten wird. Klassische Konditionierung ermöglicht dem Orga­ nismus eine sinnvolle Repräsentation seiner Um­ welt. Er bildet stabile Erwartungen aus, z. B. da­ rüber, an welcher Stelle (CS) Nahrung (UCS) zu finden ist oder aber ein Feind lauert (UCS), dem er besser nicht begegnet. Wenn auf Dauer der UCS nicht mehr auf den CS folgt, also diese Erwartung nicht mehr gerechtfertigt ist, wird die kondi­ tionierte Reaktion wieder gelöscht (Extinktion). Dabei verschwindet die Verbindung von UCS und CS aber nicht völlig, sondern wird lediglich ­gehemmt. Löschung bedeutet also das Lernen einer Hemmung. Gelöschte Reaktionen können nämlich später wieder erneut auftreten (spontane Erholung). Entstehung einer Phobie Berühmt geworden ist ein (aus heutiger Sicht ethisch fragwürdiges) ­Experiment des amerikanischen Begründers des Behaviorismus John B. Watson aus dem Jahr 1920: Einem kleinen Jungen (»der kleine Albert«) wurde eine Ratte gezeigt. Immer wenn er seine Hand nach ihr ausstreckte, schlugen die Experimentatoren ­hinter seinem Rücken auf eine Eisenstange und er­ zeugten dadurch lauten Lärm. Albert zuckte zurück und weinte. Nach 5 Durchgängen genügte schon der Anblick der Ratte, Angst auszulösen, ohne dass erneut Lärm gemacht werden musste. Lärm ist für Kinder ein unkonditionierter Angstreiz. Durch die Koppelung mit der Ratte wurde eine konditionierte Angstreaktion auf die Ratte erzeugt: Eine Ratten­ phobie war entstanden. Um die Reaktion wieder zu löschen, hätte der kleine Albert mit der Ratte konfrontiert werden müssen, ohne Lärm erschallen zu lassen, so dass er die Erfahrung hätte machen können, dass beim Anblick der Ratte nichts Schlim­ mes passiert. Versuche anderer Forscher, in den folgenden Jahren diese Studie zu wiederholen, schlugen aller­ 18 2 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle dings fehl. Heute wird die klassische Konditio­ nierung eines zuvor neutralen Reizes deshalb von manchen Forschern nicht mehr als notwendige Ent­ stehungsbedingung einer Phobie betrachtet. Die meisten Menschen, die eine Phobie entwickeln, ­haben keine traumatischen Erfahrungen mit dem Objekt ihrer Furcht gemacht. Was als Furchtobjekt ausgewählt wird, hängt vielmehr von einer biolo­ gischen Bereitschaft des Reizes ab (preparedness). Dadurch erklärt sich, dass es zwar viele Menschen mit Schlangenphobie, aber nur wenige mit Steck­ dosenphobie gibt: Vor Schlangen Angst zu entwi­ ckeln, erhöhte während der Evolution die Über­ lebenschancen. Steckdosen, von denen in unserer Umgebung für Kinder viel größere Gefahr ausgeht, gibt es noch nicht lange genug, als dass sie evolu­ tionäre Folgen hinterlassen konnten. Watson hat in seinem Experiment mit dem kleinen Albert un­ absichtlich einen biologisch vorbereiteten Reiz als CS gewählt (ein kleines behaartes Tier). Möglicher­ weise sind die Replikationsversuche deshalb fehl­ geschlagen, weil die Forscher andere, biologisch sinnlose Reize als CS auswählten. Immunkonditionierung Zytostatika beeinträch­ tigen die Immunabwehr (deshalb werden sie auch bei Transplantationen eingesetzt, um Abstoßungs­ reaktionen zu verhindern). Ganz analog zur kon­ ditionierten Übelkeit (7 Klinikbox) hat man bei Chemotherapiepatienten auch eine konditionierte Abschwächung der Immunabwehr festgestellt. ­Immunkonditionierung wurde experimentell in Tierversuchen ausführlich untersucht: Ratten, die zunächst ein Zytostatikum gemeinsam mit einer Zuckerlösung zugeführt bekamen, zeigten nach mehrfacher Koppelung schließlich auch allein auf die Gabe der Zuckerlösung eine Verminderung von Immunzellen. In einem Experiment mit Men­ schen hat man die klassische Konditionierung ­genutzt, um die Immunabwehr zu stärken. Die Versuchsper­sonen erhielten Adrenalin, das einen kurzfristigen Anstieg der Immunabwehr bewirkt, gemeinsam mit einem Brausebonbon. Nach mehr­ maliger gekoppelter Gabe war auch das Brause­ bonbon für sich genommen in der Lage, den Effekt auszulösen. Allerdings war der Effekt nicht sehr groß und nur ­kurzfristig vorhanden, so dass unklar bleibt, ob er klinisch von Bedeutung ist. Denkbar, wenn auch bisher nur im Tierexperiment unter­ sucht, ist auch Konditionierung einzusetzen, um die Abstoßungsreaktion gegenüber Transplantaten abzuschwächen oder Autoimmunerkrankungen wie die rheuma­toide Arthritis günstig zu beein­ flussen. Klinik: Konditionierung bei Chemotherapie Die Chemotherapie mit Zytostatika ist ein bewährtes Verfahren zur Behandlung von Krebskrankheiten. ­Zytostatika töten schnellwachsende Krebszellen ab. Sie werden nicht nur bei fortgeschrittenen Tumoren eingesetzt, die schon Metastasen gebildet haben, sondern auch als zusätzliche (adjuvante) Maßnahme, z. B. nach einer Operation bei Brustkrebs, um die ­Gefahr eines Rezidivs zu verringern. Meist erfolgt die Chemotherapie in mehreren Zyklen, zwischen denen die Patienten nach Hause entlassen werden. Viele ­gebräuchliche Zytostatika haben als Nebenwirkung starke Übelkeit, die direkt im Gehirn ausgelöst wird. Chemotherapeutisch behandelte Patienten ent­ wickeln diese Übelkeit im Laufe der Zeit manchmal schon beim Anblick der Klinik oder dem Geruch der Station, wenn sie zu einem erneuten Zyklus auf­ genommen werden. Selbst die Farbe der Zytostatika­ lösung oder die Erwartung (Antizipation), am ­nächsten Tag wieder in die Klinik gehen zu müssen, können Übelkeit auslösen. Diese antizipatorische Übelkeit lässt sich mit der klassischen Konditionierung erklären: All diejenigen Bedingungen, die während der Chemotherapie zugegen waren, können zum konditionierten Stimulus werden. Mittels Entspannungsverfahren (7 Abschn. 8.2.5) lässt sich die konditionierte Übelkeit abmildern. Operantes Modell Das Modell der operanten ­Konditionierung wurde von dem amerikanischen Psychologen Burrhus F. Skinner begründet. Er un­ tersuchte die Konsequenzen, die auf ein Verhalten folgen, also von diesem bewirkt werden (daher der Name: operantes Verhalten), und stellte fest, dass die Wahrscheinlichkeit eines Verhaltens steigt (Ver­ stärkung), wenn auf das Verhalten eine angenehme Konsequenz folgt. Tauben, Skinners Versuchstiere, pickten auf eine Scheibe, oder Ratten drückten ­einen Hebel, wenn sie danach eine Futterpille er­ hielten. Sie lernten aber auch, einem unangeneh­ men Elektroschock zu entgehen, indem sie einen 19 2.1 · Verhaltensmodelle Hebel drückten oder den Käfig wechselten. Die Wahrscheinlichkeit eines Verhaltens steigt also nicht nur, wenn es durch eine angenehme Konse­ quenz belohnt wird (positive Verstärkung), son­ dern auch dann, wenn dadurch etwas Unange­ nehmes beseitigt wird (negative Verstärkung). Negative Verstärkung muss von Bestrafung unter­ schieden werden. Bestrafung verringert die Wahr­ scheinlichkeit eines Verhaltens, negative Verstär­ kung erhöht sie. Im Modell der operanten Konditionierung steigt die Wahrscheinlichkeit eines Verhaltens, wenn diesem eine angenehme Konsequenz folgt (positive Verstärkung) oder wenn durch das Ver­ halten eine unangenehme Konsequenz vermieden wird (negative Verstärkung). Vermeidungsverhalten Negative Verstärkung spielt bei der Aufrechterhaltung einer Phobie eine wich­ tige Rolle. Eine Person, die an einer Agora­phobie (Angst vor öffentlichen Plätzen) leidet, befürchtet z. B., dass sie auf der Straße ohnmächtig werden könnte. Sie verlässt deshalb ihr Haus nicht mehr ohne Begleitung. Dieses Vermeidungsverhalten führt dazu, dass sie die Angst nicht mehr spürt (eine unangenehme Konsequenz bleibt aus), und wird dadurch aufrechterhalten (negative Ver­ stärkung). Der Preis, den sie dafür zahlt, ist aber eine starke Einengung ihres Bewegungsspielraums. Um die Angst zu löschen, wäre es erforderlich, dass ­sie sich der angstauslösenden Situation aus­ setzt (Reizkonfrontation, Exposition), so dass sie die Er­fahrung machen kann, dass das befürchtete Ereignis, ohnmächtig zu werden, gar nicht eintritt (7 Abschn. 8.2.2). Auch beim Schmerzverhalten spielt negative Verstärkung eine Rolle: Schmerz­ kranke nehmen Medikamente oder schonen sich, weil dann der Schmerz nachlässt. >> Vermeidungsverhalten wird durch negative Verstärkung aufrechterhalten. Kognitives Modell Das kognitive Modell schreibt Kognitionen (Gedanken, d. h. Bewertungen, Inter­ pretationen, Erwartungen, Ziele etc.) eine große Bedeutung für die Erklärung des Verhaltens zu. ­Kognitionen spielen bei der Depression eine wich­ tige Rolle. 2 Typische Symptome einer Depression 55Niedergeschlagene Stimmung 55Verlust von Antrieb und Energie 55Verlust von Lebensfreude und Interessen 55Körperliche Beschwerden: Konzentrationsstörung, motorische Hemmung, Müdigkeit, Schlafstörung, Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme, Schmerzen unterschiedlicher ­Lokalisation 55Kognitive Symptome: negatives Bild von sich selbst, der Welt und der Zukunft (kognitive Triade), Pessimismus, Sinn­ losigkeitsgefühle, Schuldgefühle, Selbstmordgedanken (Suizidalität) Welche davon finden Sie im Fallbeispiel in der Kli­ nikbox? Klinik: Depression Ein 20-jähriger Student kommt in die Sprechstunde. Er sitzt vornüber gebeugt auf dem Stuhl, den Blick zum Boden gerichtet, und spricht mit leiser, mono­ toner Stimme: »Ich bin völlig niedergeschlagen und ohne Energie. Nichts macht mir mehr Freude. Sogar mich mit meinen Freunden zu treffen, habe ich keine Lust mehr. Morgens ist es am Schlimmsten: Der Tag kommt mir dann wie ein riesiger Berg vor, den ich nicht bewältigen kann. Schon der Gedanke, aufzu­ stehen und mich anzuziehen, ist mir zu viel. Am ­liebsten würde ich im Bett bleiben. Ich fühle mich als völliger Versager. Manchmal hatte ich auch schon den Gedanken, gar nicht mehr auf der Welt sein zu wollen. Alles ist grau in grau, und nichts wird sich jemals daran ändern.« Kognitive Verhaltenstherapie Das kognitive Modell nimmt an, dass irrationale, automatisch ablaufende Gedanken die depressive Stimmung aufrechterhal­ ten. Daraus folgt, dass man in der Psychotherapie diese Gedanken verändern muss. 20 2 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle Komponenten der kognitiven Verhaltenstherapie einer Depression (7 Abschn. 8.2.2) 55Infragestellung verzerrter, irrationaler ­Kognitionen (z. B. »Ich werde es nie ­schaffen, eine Freundin zu finden.«) im ­Dialog zwischen Patient und Therapeut (­sokratischer Dialog). 55Schrittweiser Aufbau angenehmer Akti­ vitäten, um den Verstärkerverlust zu ­kompensieren (z. B. Anregung, wieder einmal auszugehen). 55Training sozialer Kompetenzen im Rollenspiel (z. B. Wie spreche ich jemanden an, der mir gefällt?). 2.1.2 Verhaltensanalytisches ­Genesemodell am besten, man zieht sich zurück. Hilfe kann man sowieso keine erwarten.«). Wenn eine derartige Prädisposition besteht, ist das Risiko erhöht, unter belastenden Lebensbedingungen mit einer Depres­ sion zu reagieren. Diese Hintergrundbedingungen werden in der vertikalen Verhaltensanalyse er­ fasst, in Ergänzung zur horizontalen Verhaltens­ analyse, die die aktuell wirksamen aufrechterhal­ tenden Bedingungen beschreibt. SORKC-Modell Für die horizontale Verhaltens­ analyse benutzt man das SORKC-Modell (Verhal­ tensgleichung). Das Wort SORKC setzt sich aus den Anfangsbuchstaben von Stimulus (S), Organismus (O), Reaktion (R), Kontingenz (K) und Konsequenz (C) zusammen. Auf diesen 5 Ebenen werden das problematische Verhalten und die Bedingungen, die es steuern, beschrieben. Als Beispiel soll ein Patient mit chronischen Rückenschmerzen dienen: SORKC-Modell der Verhaltensanalyse Entstehung und Aufrechterhaltung In einer Ver­ haltensanalyse werden diejenigen Bedingungen be­ schrieben, die für die Entstehung und Aufrecht­ erhaltung eines Verhaltens verantwortlich sind. Psychische Probleme wie z. B. eine Depression wer­ den dabei als depressives Verhalten aufgefasst. Rückzug von anderen Menschen ist ein Beispiel für ein bei depressiven Menschen häufig auftretendes Verhalten. Diejenigen Faktoren, die bei der Ent­ stehung des depressiven Verhaltens eine Rolle ­spielten, müssen nun nicht unbedingt dieselben sein wie ­diejenigen, die aktuell dafür sorgen, dass das Verhalten aufrechterhalten wird. Für die Ent­ stehung kann beispielsweise ein Verlusterlebnis wie die Trennung vom Beziehungspartner verantwort­ lich sein. Für die gegenwärtige Aufrechterhaltung ­spielen aber möglicherweise rückzugsförderliche ­Kognitionen (»Es wird mir sowieso keine Freude machen, neue Kontakte aufzunehmen.«) eine Rolle. Zusätzlich können noch Bedingungen unter­ schieden werden, die dazu beitragen, dass ein Indi­ viduum besonders anfällig dafür ist, eine Depres­ sion zu entwickeln, wie genetische Faktoren oder die individuelle Lerngeschichte, die sich in be­ stimmten Einstellungen und Wertvorstellungen niederschlägt (»Wenn es einem schlecht geht, ist es 55Stimulus (S): Die Schmerzen treten immer dann auf, wenn der Patient eine Aus­ einandersetzung mit einem Arbeitskollegen hat (auslösender Reiz). Besonders stark ­werden die Schmerzen erlebt, wenn seine Ehefrau anwesend ist (diskriminativer Reiz, SD). 55Organismus (O): Die Rückenschmerzen ­treten vor allem dann auf, wenn der Patient schon vorher innerlich angespannt ist, was sich auch in einer Muskelverspannung äußert. Die Schmerzen werden durch ­katastrophisierende Gedanken gefördert (»Meine Beschwerden werden immer schlimmer! Gegen meinen Kollegen komme ich niemals an! Schlussendlich verliere ich noch meinen Arbeitsplatz!«). Nicht nur ­körperliche, sondern auch kognitive Einflüsse werden zu den Organismusvariablen gerechnet. 55Reaktion (R): Unter Reaktion wird die Schmerzsymptomatik selbst beschrieben, und zwar auf sensorischer, vegetativer, emotionaler, kognitiver und motorischer Ebene (7 Abschn. 2.2.2). 21 2.1 · Verhaltensmodelle 55Kontingenz (K): Unter Kontingenz versteht man das Koppelungsverhältnis von Reak­ tion und Konsequenz. Die Ehefrau tröstet den Patienten jedes Mal, wenn er seine Schmerzen äußert (kontinuierliche Verstär­ kung). Der Hausarzt schreibt ihn jedoch nicht immer krank (intermittierende Ver­ stärkung). 55Konsequenz (C): Wenn der Patient seine Schmerzen seiner Frau gegenüber zum Ausdruck bringt, tröstet sie ihn (positive Konsequenz). Sein Arzt schreibt ihn krank, so dass er nicht zur Arbeit gehen muss und dadurch auch nicht mit dem schwierigen Kollegen konfrontiert wird (Wegfall einer negativen Konsequenz). Kurzfristig hat der Schmerz für den Patienten also angenehme Konsequenzen. Langfristig aber führt die körperliche Schonung zu einem Verlust an Fitness, die ihn schmerzanfälliger macht. Das SORKC-Modell ist ein einfaches Schema, das der ersten Orientierung dienen kann. In der moder­ nen Verhaltenstherapie bezieht man auch komple­ xere Wechselwirkungen und Rückkopplungen ein, die über das lineare SORKC-Modell hinausgehen. Entstehung einer Panikstörung Eine Panikstörung ist durch plötzliche, auf den ersten Blick ohne ­äußeren Anlass auftretende Angstanfälle (Panik­ attacke) gekennzeichnet. Die Anfälle gehen mit sehr intensiv erlebten körperlichen Beschwerden einher: Herzklopfen oder Herzrasen, Schwindel oder Benommenheit, Atemnot, aber auch Schweiß­ ausbrüche, Brustschmerzen, Übelkeit, Zittern, Hit­ ze- und Kältegefühl, Taubheitsgefühle u. a. Die ­Betroffenen befürchten, ohnmächtig oder hilflos zu werden oder gar zu sterben. Auch zwischen den Anfällen sind sie ständig in Sorge vor neuen An­ fällen (»Angst vor der Angst«) und deren Folgen. Sie befürchten z. B. infolge der Angst einen Herz­ infarkt zu erleiden. Wenn die Anfälle schon einmal in der Öffentlichkeit aufgetreten sind, versuchen sie, diese Orte zu vermeiden. Dann liegt zusätzlich zur Panikstörung eine Agoraphobie (Angst vor öffent­ lichen Plätzen) vor. 2 ..Abb. 2.1 Teufelskreis der Angst Panikpatienten nehmen ihre Körperempfindun­ gen besonders stark war, »bemerken« z. B. ­einen starken Pulsanstieg, auch wenn der Puls objektiv nur wenig schneller ist, und interpretieren die Emp­ findung in übertriebener Weise als bedrohlich. Es kommt dann zu einem Teufelskreis, in dem sich kognitive Faktoren (Interpretation von Körper­ empfindungen als bedrohlich) und physiologische Faktoren (Herzklopfen als körperliche Begleit­ erscheinung der Angst) gegenseitig aufschaukeln (. Abb. 2.1). Die physiologische Erregung nennt man Aktivierung (7 Abschn. 4.1.7). 2.1.3 Verhaltensmedizinische Ansätze Verhaltensmedizin ist die Anwendung der Verhal­ tenstherapie in der Medizin. Verhaltenstherapie ist diejenige Psychotherapieform, die auf den Lern­ theorien beruht (7 Abschn. 8.2.2). Sie analysiert die funktionellen Zusammenhänge eines Verhaltens mit den unmittelbar vorausgehenden und nachfol­ genden Bedingungen, also den auslösenden Reizen und den Konsequenzen (SORKC-Modell). Die ko­ gnitive Verhaltenstherapie der Depression wurde oben beschrieben. 22 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle 2.1.4 2 Komponenten der kognitiven ­Verhaltenstherapie bei Panikstörung 55Informationsvermittlung: Gemeinsam mit dem Patienten wird herausgearbeitet, welche Rolle seine Wahrnehmungen und Kognitionen beim Angstanfall spielen. Das Teufelskreismodell von . Abb. 2.1 wird auf diese Weise individuell auf den Patien­ ten zugeschnitten. 55Kognitive Therapie: Der Patient lernt im ­Dialog mit dem Therapeuten, seine Fehl­ interpretationen körperlicher Empfindungen als Anzeichen einer bedrohlichen Krankheit infrage zu stellen und aufzu­ geben. 55Konfrontation mit angstauslösenden ­Reizen: Durch »Verhaltensexperimente«, wie z. B. schnelles Treppensteigen oder absichtliches Hyperventilieren, setzen sich die Patienten den körperlichen Symptomen (Herzklopfen, Atemnot) aus und machen damit die Erfahrung, dass nichts Schlimmes dabei passiert. Stressmanagement Kognitive Faktoren spielen auch bei der Stressbewältigung eine wichtige Rolle. In Programmen zum Stressmanagement lernen die Patienten, dysfunktionale automatische Gedanken, die die Belastung noch vergrößern (»Niemals werde ich das schaffen!«), infrage zu stellen und durch för­ derliche Selbstinstruktionen zu ersetzen (kognitive Umstrukturierung). Anstatt zu denken »Die Er­ eignisse überschwemmen mich!«, sagen sie zu sich selbst: »Immer mit der Ruhe! Eins nach dem ande­ ren!« Wenn man die Situation als Herausforderung betrachtet, die man Schritt für Schritt bewältigen kann, sind Überforderungsgefühle weniger wahr­ scheinlich. Die Patienten werden zudem angeleitet, Strategien der systematischen Problemlösung ein­ zusetzen, Handlungsalternativen abzuwägen, die beste Lösung auszuwählen und ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Weitere verhaltensmedizinische Einsatzgebie­ te sind Schmerzbewältigung (z. B. Biofeedback, 7 Abschn. 2.2.2) und Patientenschulungen (7 Abschn. 8.1.3). Verhaltensgenetik Die Verhaltensgenetik untersucht genetische Ein­ flüsse auf das Verhalten. Dabei benutzt sie Korrela­ tionen zwischen Personen unterschiedlichen Ver­ wandtschaftsgrads und damit unterschiedlicher ­genetischer Ähnlichkeit (z. B. sind eineiige Zwillinge 100 % genetisch ähnlich, zweieiige Zwillinge/Ge­ schwister 50 %, Adoptivgeschwister 0 %). Eine Zwil­ lingsstudie erlaubt es, aus der größeren psychischen Ähnlichkeit eineiiger im Vergleich zu zwei­eiigen Zwillingen die Erblichkeit zu schätzen. Besonders interessant sind auch Korrelationen zwischen ge­ trennt aufgewachsenen eineiigen Zwillingen, deren Ähnlichkeit nicht auf gemeinsame Umwelterfah­ rungen zurückgehen kann. Getrennt aufgewachsene Zwillinge korrelieren in Persönlichkeitsmerkmalen genauso hoch miteinander wie gemeinsam aufge­ wachsene, was für eine geringe Bedeutung der ge­ meinsamen Umwelt spricht. In einer Adoptionsstudie vergleicht man die Ähnlichkeit von leiblichen und Adoptivgeschwis­ tern, die in derselben Umwelt aufgewachsen, gene­ tisch einander aber nicht ähnlich sind. Adoptivge­ schwister korrelieren in Persönlichkeitsmerkmalen nicht miteinander, wohl aber mit ihren biologischen Eltern, was ebenfalls für die geringe Bedeutung der gemeinsamen Umwelt spricht. Die besten Schätzungen der einzelnen Anteile von Anlage und Umwelt erbringen Kombinations­ studien, in denen Menschen unterschiedlicher ge­ netischer Ähnlichkeit und unterschiedlicher Um­ welt gemeinsam analysiert werden. Einflussfaktoren in der Verhaltensgenetik 55Genetische Faktoren 55Gemeinsame (geteilte) Umwelteinflüsse 55Individuelle (nichtgeteilte) Umwelteinflüsse Während die gemeinsame Umwelt zu einer größe­ ren Ähnlichkeit zwischen den Mitgliedern einer Familie beiträgt, bewirken individuelle, nichtgeteil­ te Umwelteinflüsse, dass die Mitglieder einer Fa­ milie einander unähnlich werden. Nichtgeteilte Umwelteinflüsse kommen auch dadurch zustande, dass ein und dasselbe Ereignis (z. B. die Scheidung der Eltern) von den Mitgliedern einer Familie un­ 23 2.1 · Verhaltensmodelle terschiedlich verarbeitet wird. Unter nichtgeteilter Umwelt werden nicht nur psychosoziale Einflüsse gefasst, sondern auch Einflüsse der physikalischen Umwelt (z. B. während der Schwangerschaft) und des Messfehlers (Abweichungen durch ungenaue Messungen des psychischen Merkmals). Die Verhaltensgenetik hat für alle bisher unter­ suchten psychischen Merkmale mehr oder minder starke genetische Einflüsse gefunden. >> Genetischer Einfluss bei psychischen ­Störungen: 55starker Einfluss bei Autismus, Schizophre­ nie, bipolarer affektiver Störung (manischdepressiver Erkrankung) und Aufmerk­ samkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, 55mittelgroßer Einfluss bei Depression, Angststörungen und Substanzmissbrauch/ -abhängigkeit. Gene wirken aber nicht nur bei psychischen Störun­ gen, sondern auch bei normalen Persönlichkeits­ merkmalen (7 Abschn. 4.6). Vom Gen zum Verhalten ist es ein weiter Weg. Gene determinieren nicht einzelne Verhaltenswei­ sen. Sie beeinflussen jedoch die Entwicklung neuro­ naler Schaltkreise, welche wiederum in Wechsel­ wirkung mit der Umwelt das Verhalten beeinflus­ sen. Genwirkungen lassen sich deshalb in der Funk­ tion neuronaler Schaltkreise viel leichter nachweisen als im Verhalten selbst. Beispiel: Ängstliche oder ärgerliche Gesichter lösen eine Amygdala-Akti­ vierung aus. Diese Aktivierung fällt bei Trägern des kurzen Allels (s-Allel) des SerotonintransporterGens, welches einen Risikofaktor für Angst und Depression darstellt, höher aus. Wie kommt dies zustande? Das s-Allel des SerotonintransporterGens scheint sich, bedingt durch einen weniger ak­ tiven Serotonintransporter, ungünstig auf die Ent­ wicklung eines Schaltkreises zwischen Amygdala und anteriorem zingulärem Kortex auszuwirken, der für die Regulation von Angst von Bedeutung ist. Dieser Schaltkreis ist bei Trägern des kurzen Allels anatomisch weniger gut ausgebildet und funktio­ nal weniger aktiv, wie Bildgebungsstudien zeigen. Die verminderte Aktivität steht wiederum mit Ängstlichkeit als Persönlichkeitsmerkmal in Zu­ sammenhang. Träger des s-Allels weisen auch eine geringere Bindungskapazität eines Serotoninrezep­ 2 tors auf, gemessen mit radioaktiven Liganden im PET (7 Abschn. 3.6.3). Auch dadurch ist die Sero­ toninwirkung vermindert. >> Von Gen-Umwelt-Interaktion spricht man, wenn die Wirkung eines Gens davon ab­ hängt, ob eine spezifische Umweltbedingung vorliegt oder nicht. Oder umgekehrt, wenn eine bestimmte (z. B. schädliche) Umweltbe­ dingung nur dann wirksam wird, wenn auch eine genetische Disposition (Vulnerabilität) besteht. Beispiele: Adoptionsstudien zeigten, dass die Häu­ figkeit antisozialen Verhaltens bei nach der Geburt von ihren Müttern getrennten und in Adoptivfa­ milien aufgenommenen Kindern nur dann erhöht war, wenn sowohl ein biologisches Risiko (antiso­ ziales Verhalten der leiblichen Mutter) als auch ein Umweltrisiko (Probleme in der Adoptivfamilie) bestanden, nicht aber, wenn nur einer der beiden Risikofaktoren vorlag. Eine molekulargenetische Untersuchung k­ onnte demonstrieren, dass das Risiko antisozialen Ver­ haltens im Erwachsenenalter bei Menschen, die in ihrer Kindheit misshandelt worden waren, dann stark erhöht war, wenn sie eine wenig effi­ziente Form des Monoaminoxidase-A-Gens trugen. Die Aufgabe des vom MAOA-Gens kodierten Enzyms besteht darin, Neurotransmitter wie Noradrenalin, Serotonin und Dopamin zu metaboli­sieren und ­deren Funktion zu regulieren. Ein voll funktions­ fähiges Gen stellte einen Schutzfaktor gegenüber der Entwicklung antisozialen Verhaltens dar. In einer ähnlichen Studie zeigte sich, dass der Einfluss belastender Lebensereignisse auf die Entste­ hung einer Depression vom SerotonintransporterGen abhing (7 Abschn. 4.1.6). Menschen, die 1 oder 2 kurze Allele dieses Gens (mit geringerer Tran­ skriptionseffizienz) trugen, hatten nach be­lastenden Lebensereignissen mehr depressive Symp­ tome, ­waren stärker suizidgefährdet und entwickelten häu­ figer eine ausgeprägte Depression als Menschen mit 2 langen Allelen. Letztere waren vor den negativen Auswirkungen der Lebensereignisse geschützt. Die­ ser Zusammenhang konnte in meh­reren anderen, wenn auch nicht in allen Studien bestätigt werden. Träger der beiden kurzen Allele reagieren aber nicht nur verstärkt auf negative Einflüsse der Umgebung 24 2 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle (belastende Lebensereignisse, ungünstige Familien­ umwelt), sondern auch auf positive: Wenn sie in ­einer freundlichen, versorgenden Familie aufwach­ sen, haben sie weniger depressive Symptome als ­Träger des langen Allels, und sie profitieren auch im Erwachsenenalter von emotionaler Unterstützung. Das kurze Allel scheint also Menschen generell emp­ findlicher für den Einfluss der sozialen Umgebung zu machen, im Guten wie im Schlechten. Eine vergleichbare Interaktion fand sich in einer Studie, in der eine Risikoerhöhung für das Auf­ treten einer Depression nach einem belastenden Lebensereignis nur bei den Trägern eines bestimm­ ten Allels des Dopamin-Rezeptors D2 auftrat, nicht aber bei denjenigen Personen, die dieses Allel nicht trugen. >> Gene und Umwelterfahrungen wirken bei der Entstehung psychischer Störungen zusammen. Gen-Umwelt-Korrelation Gen-Umwelt-Korrelation bedeutet gemeinsames Auftreten bestimmter Gene und bestimmter Umweltfaktoren. Entstehung einer Gen-Umwelt-Korrelation 55Aktiv, d. h. selbst hergestellt oder ausgewählt. Menschen suchen sich ihre Umwelt aus, gestalten und verändern sie. Sie tun dies auch auf der Basis genetisch ver­ ankerter Persönlichkeitsmerkmale und ­Vorlieben. Beispiel: Ein Kind sucht sich die Spielgefährten, die zu seinem Temperament passen. Dies führt zu einer Stabilisierung der P ­ ersönlichkeitsentwicklung im Laufe des Lebens. 55Evokativ oder reaktiv, d. h. vom Kind ausgelöst. Die Umwelt reagiert auf genetisch beeinflusste Persönlichkeitsmerkmale. Beispiel: Das Verhalten des Kindes löst ein komplementäres elterliches Verhalten aus: Liebenswürdige Kinder erfahren mehr ­Wärme und Zuwendung, schwierige Kinder mehr negative Reaktionen. 55Passiv, d. h. von außen bewirkt. Eine passive Korrelation kommt ohne Zutun des ­ enträgers und ohne Reaktion der Umwelt G zustande, sondern einfach deshalb, weil ­Eltern und ihre Kinder zum Teil dieselben Gene haben. Beispiel: Intelligente Eltern schaffen für ihre Kinder eine anregende Lernumwelt und haben zugleich eher (­genetisch vermittelt) intelligente Kinder. Deshalb korreliert die Zahl der Bücher in ­einem Haushalt auch dann mit der Intelligenz der Kinder, wenn diese Bücher überhaupt nicht gelesen werden. Aus einer Korrelation zwischen Umweltfaktoren und Verhaltensweisen darf deshalb nicht vorschnell auf einen kausalen Einfluss der Umwelt geschlossen werden, wie es in der Entwicklungspsychologie und Sozialisationsforschung früher häufig getan wurde. Vielmehr kann diese Korrelation genetisch vermit­ telt sein. iiVertiefen Lefrancois G (2014) Psychologie des Lernens. 5. Aufl. Springer, Berlin (klassisches Lehrbuch) Margraf J, Schneider S (Hrsg) (2008) Lehrbuch der Verhaltenstherapie. 3. Aufl. Springer, Berlin (hervorragende, praxisorientierte Darstellung) Plomin R, DeFries JC, Knopik VS, Neiderhiser JM (2013) Behavioral Genetics. 6th ed. Basing­ stoke, Worth Publihers, New York (didaktisch gut aufgebautes Lehrbuch) 2.2 Psychobiologische Modelle H. Faller Lernziele Der Leser soll 55 das allgemeine Adaptationssyndrom beschreiben können, 55 die zwei Pfade der Stressreaktion beschreiben können, 55 akuten und chronischen Schmerz unterscheiden können, 55 Risikofaktoren der Schmerzchronifizierung ­nennen können. 25 2.2 · Psychobiologische Modelle 2.2.1 Emotion, Stress und Krankheit >> Stress ist die Reaktion eines Individuums auf eine belastende Situation. Der Belastungs­ faktor, der diese Stressreaktion auslöst, wird Stressor genannt. Stress tritt auf, wenn die Anforderungen der Umwelt die Bewälti­ gungsmöglichkeiten des Individuums über­ steigen. Unter Stress geht das harmonische Gleichgewicht zwischen Individuum und Umwelt (Homöostase) verloren. Der Begriff Homöostase geht auf Walter Cannon zurück, der Begriff Stress auf Hans Selye. Er beschrieb Stress als unspezifische Antwort des Organismus auf eine Störung der Homöostase (all­ gemeines Adaptationssyndrom), die in 3 Phasen verläuft: >> Das allgemeine Adaptationssyndrom ­besteht aus 3 Phasen: 55Alarmphase: Stimulierung des sympathi­ schen Nervensystems. Mobilisierung von adrenokortikotropem Hormon (ACTH) in der Hypophyse 55Widerstandsphase: Kortisolausschüttung als Folge der ACTH-Ausschüttung 55Erschöpfungsphase: Dekompensation der Stressreaktion bei chronischem Stress Spezifische Reaktionen Allerdings müssen nach heutigem Kenntnisstand unterschiedliche Stresso­ ren keineswegs immer zu den gleichen Reaktionen führen. Im Stressmodell von Henry werden spezi­ fische Reaktionen je nach Stresssituation beschrie­ ben: Furcht (Flucht) geht mit Adrenalinanstieg, Ärger (Kampf) mit Noradrenalin- und Testosteron­ anstieg, Depression (Kontrollverlust, Unterord­ nung) mit Kortisolanstieg und Testosteronabfall einher (stimulusspezifische Reaktion). Umgekehrt besitzt ungefähr ein Drittel der Menschen die Nei­ gung, auf unterschiedliche Stressoren immer auf die gleiche Art und Weise zu reagieren (individual­ spezifische Reaktion). Beispiel: Der eine bekommt bei Aufregung immer kalte Hände und Herzklop­ fen, der andere muss auf die Toilette. 2 Allostase Im Unterschied zu homöostatischen Sys­ temen des inneren Milieus (z. B. ph-Wert des Bluts), die einen festen Sollwert haben und in engen ­Grenzen reguliert werden, erlauben allostatische Systeme eine Sollwertverschiebung, d. h. eine ­Re­gulation innerhalb eines breiteren Korridors, und ­dadurch eine bessere Umweltanpassung un­ ter Stress (Homöostase-Allostase-Modell). Reak­ tionen, die ursprünglich zur Bewältigung von Stress dienten, können jedoch überschießen oder chro­ nisch werden. Dann ist es nicht der Stress selbst, sondern der gegenregulatorische Mechanismus, der eine Schä­digung bewirkt (allostatische Be­ lastung). Akuter Stress ist nicht generell schädlich. Er versetzt den Organismus in die Lage, einen Stres­ sor zu bewäl­tigen. Schädlich ist erst eine Stress­ reaktion, die zu lange oder zu häufig auftritt (wie bei chronischen Stressoren) oder für die keine physio­ logische Notwendigkeit besteht (wie bei psycho­ sozialen Stressoren, die nicht durch Kampf oder Flucht bewältigt werden können). Es kann dann zu einer Fehlregulation allostatischer Systeme ­kommen (z. B. chro­nische Überproduktion von Stressbotenstoffen wie Kortisol und Noradrenalin und Herunterregula­tion ihrer Rezeptoren), die zu Krankheiten führen können (z. B. Bluthochdruck als Risikofaktor für koronare Herzkrankheit und Schlaganfall). Subjektive Bewertung und Disposition Ob eine S­ ituation zum Stressor wird, hängt maßgeblich von der subjektiven Bewertung und den Bewältigungs­ möglichkeiten des Individuums ab. Ein und die­ selbe Situation kann von dem einen Menschen als Herausforderung, die er sich zu bewältigen zutraut, von einem anderen hingegen als Bedrohung, der er hilflos ausgeliefert ist, interpretiert werden. Nur im 2. Fall entsteht Stress. Ob Stress schließlich zu Krankheit führt, hängt darüber hinaus von der Dis­ position des Individuums ab (Stress-Vulnerabili­ täts-Modell; syn. Stress-Diathese-Modell. Beispiel: Zusammenwirken von belastenden Lebensereignis­ sen und der genetischen Anlage bei der Entstehung einer Depression, 7 Abschn. 2.1.4). Physiologische Pfade Die Stressreaktion stellt eine ehemals evolutionär sinnvolle Reaktion auf Be­ drohung dar, indem sie die physiologischen Voraus­ 26 2 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle setzungen für Kampf oder Flucht schafft. Dies ge­ schieht über 2 Wege: 44das Hypothalamus-Sympathikus-Nebennieren­ mark-System, 44die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren­ rinden-Achse. Hypothalamus-Sympathikus-NebennierenmarkSystem Der Sympathikus ist eines der beiden Haupt­ bestandteile des vegetativen Nervensystems. Er steu­ ert diejenigen Prozesse, die eine Aktivierung (7 Abschn. 4.1.7) des Organismus bewirken. (Der andere Hauptbestandteil ist der Parasympathikus, der Erho­ lungsprozesse steuert.) Aktivierung be­deutet psycho­ physische Erregung und Bereitstellung von Energie. Die Wirkungen des Sympathikus auf den Organismus werden durch Adrenalin und Noradrenalin (Kate­ cholamine) vermittelt, die im Nebennierenmark ge­ bildet werden: Herzfrequenz und Blutdruck steigen an, die Muskeldurchblutung wird gefördert, als Ener­ giequelle wird Glukose bereitgestellt. Diese Reaktion geschieht sehr schnell (innerhalb von Sekunden), die weiter unten dargestellte zweite Achse braucht länger (mehrere Minuten) bis zur Aktivierung. Klinik: Sympathikusaktivierung und Herz-Kreislauf-Risiko Körperlich gesunde Menschen, die an einer Depres­ sion leiden, haben im Vergleich zu Nichtdepressiven ein 2-mal so hohes Risiko für die Entwicklung einer koronaren Herzkrankheit. Bei Menschen, die schon einen Herzinfarkt erlitten haben, besteht bei Vor­ liegen einer Depression ebenso ein ca. doppelt so hohes Risiko, an einem erneuten Infarkt zu versterben. Wenngleich es noch nicht völlig geklärt ist, ob Depression einen kausalen Risikofaktor darstellt oder lediglich einen Risikoindikator, der zwar das ­Eintreffen eines Krankheitsereignisses voraussagen lässt, es aber nicht ursächlich beeinflusst, so sind doch mehrere biologische Mechanismen plausibel, die den Einfluss einer Depression auf die koronare Herzkrankheit vermitteln könnten: 44 Sympathikusaktivierung: Bei einer Depression ist das sympathoadrenerge System überaktiv, mit Zunahme von Herzfrequenz, Blutdruck und Kontraktilität (erhöhte kardiovaskuläre Reak­ tivität), was wiederum Endothelschädigungen und Atherosklerose (Arteriosklerose) begünstigt. 44 Aktivierung der Hypothalamus-HypophysenNebennierenrinden-Achse: Depression und Stress gehen mit einer erhöhten Sekretion von Kortisol einher. Kortisol ist wiederum ein Risikofaktor für Hypertonus, Hyperlipidämie und ­Atherosklerose. 44 Verminderte Herzfrequenzvariabilität: Diese ist Ausdruck des erhöhten sympathischen und des reduzierten parasympathischen Tonus und stellt einen Risikofaktor für Herzrhythmusstörungen und den plötzlichen Herztod dar. 44 Stressbedingte Ischämie: Stress kann durch die Steigerung von Herzfrequenz und Kontraktilität unmittelbar einen Sauerstoffmangel (Ischämie) im Herzmuskel bewirken. Dieser Mechanismus ist vermutlich für die erhöhte Herzinfarktrate während aufregenden Fußballspielen verantwortlich. Während der Fußballweltmeisterschaft 2006 ­traten mehr als doppelt so viele Infarkte auf wie in den Vergleichszeiträumen der Vorjahre, und zwar genau zu den Zeiten, wenn die deutsche Mannschaft wichtige Spiele absolvierte. 44 Blutgerinnung und Plättchenaggregation: Stress und Depression gehen mit einer Aktivierung der Blutgerinnung und der Thrombozyten, die Serotoninrezeptoren tragen, einher. Dies ­fördert die Bildung von Thromben in verengten Herzkranzgefäßen, mit der Folge eines Herzinfarkts. 44 Immunsystem und Entzündung: Bei einer ­Depression werden entzündungsfördernde (proinflammatorische) Zytokine (Interleukine) ge­ bildet, die sowohl bei der Entstehung einer Depression als auch bei der koronaren Herzkrankheit eine Rolle spielen können. Auch das C-reaktive Protein, das eine Entzündung anzeigt, ist bei einer Depression erhöht. Allerdings scheint der Zusammenhang zwischen Depression und Entzündungsindikatoren großenteils genetisch vermittelt zu sein. 44 Endotheliale Dysfunktion: Die Gefäßdilatation infolge Sauerstoffmangels ist bei Depression gestört. Dies stellt wiederum einen Risikofaktor für die Atherosklerose dar. 44 Gesundheitsverhalten und Compliance: Zusätzlich zu den biologischen Mechanismen kann eine Depression auf der Ebene des Verhaltens zur Entwicklung bzw. Verschlimmerung einer koronaren Herzkrankheit beitragen. Depressive Menschen 27 2.2 · Psychobiologische Modelle weisen häufiger die klassischen Risikofaktoren ­einer koronaren Herzkrankheit, wie Bewegungsmangel und Übergewicht, auf. Sie setzen Empfehlungen zum Gesundheitsverhalten, z. B. körperlich aktiver zu werden, seltener in die Tat um und halten sich weniger an die verordnete Medikation (geringere Compliance). Hypothalamus-Hypophysen-NebennierenrindenAchse Der Hypothalamus, der Eingangssignale von der Amygdala (Angstzentrum) erhält, bewirkt durch Abgabe von Corticotropin-Releasing-Hor­ mon (CRH) die Sekretion von adrenokortikotro­ pem Hormon (ACTH) aus der Hypophyse ins Blut, das wiederum die Nebennierenrinde zur Bildung von Kortisol anregt. Kortisol dient ebenfalls der Be­ reitstellung von Glukose, es hemmt die Fettsynthese sowie, bei chronischer Sekretion, die Immunab­ wehr. Kortikoide werden bei Organtransplanta­ tionen gegeben, um eine Immunsuppression zu bewirken und dadurch eine Abstoßung des trans­ plantierten Organs zu verhindern. Kortisol spielt auch bei der Steuerung von Emotionen eine Rolle. Hohe Dosen bewirken eine Depression. Chronischer Stress und Kortisol Zur Wirkung von chronischem Stress auf die Kortisolausschüttung gibt es widersprüchliche Forschungsergebnisse. Diese Widersprüche lassen sich jedoch zu einem guten Teil auflösen, wenn man Eigenschaften des Stressors (kontrollierbar vs. unkontrollierbar; kör­ perliche vs. psychische Gefahr) berücksichtigt. ­Generell geht chronischer Stress mit geringen Kor­ tisolkonzentrationen am Morgen, aber höheren Konzentrationen am Nachmittag und Abend ein­ her, so dass der Tagesrhythmus abgeflacht ist. Ins­ gesamt ist die Kortisolausschüttung erhöht. Auch der Zeitverlauf spielt eine Rolle: Unmittelbar nach dem Eintritt des Stressors findet man erhöhte Wer­ te; je mehr Zeit vergeht, umso stärker fallen diese wieder ab, und zwar bis unter die Normalwerte. Psychoneuroimmunologie Dieses Forschungsge­ biet untersucht Zusammenhänge zwischen Stress bzw. Emotionen, dem Gehirn und dem Immunsys­ tem. Das Immunsystem setzt sich aus der zellulä­ ren unspezifischen Immunabwehr (z. B. natürliche Killerzellen) und der zellulären spezifischen ­ 2 Immun­abwehr (T-Lymphozyten: T-Helfer-Zellen, T-Suppressor-Zellen, zytotoxische T-Zellen) sowie der unspezifischen (z. B. Komplementsystem) und spezifischen (Antikörper) humoralen Immunab­ wehr zusammen. Die anatomischen und zellbio­ logischen Voraussetzungen der Zusammenhänge zwischen Psyche bzw. Gehirn und Immunsystem sind dadurch gegeben, dass lymphatische Organe innerviert sind und Lymphozyten Rezeptoren für Neurotransmitter tragen. Umgekehrt produzieren Immunzellen Botenstoffe, die Zytokine (Interleu­ kine, Interferone und Tumornekrosefaktoren), die nicht nur die Kommunikation innerhalb des ­Immunsystems bewerkstelligen, sondern auch psy­ chische Effekte haben. Eine Aktivierung des Immunsystems macht sich in Veränderungen des Befindens deutlich, die sich als Krankheitsverhalten wie z. B. bei einem grippalen Infekt äußern: reduzierte Aktivität, sozia­ ler Rückzug, vermehrte Schmerzempfindlichkeit, Appetitlosigkeit und Depressivität. Stress und Immunantwort >> Akuter Stress verbessert die Immunantwort, während chronischer Stress sie hemmt. Der Anstieg der unspezifischen Immunantwort bei akutem Stress ist evolutionär sinnvoll, weil dadurch die Heilung einer Wunde, z. B. bei einem Angriff, gefördert würde. Bei akuten, zeitlich begrenzten ­Laborstressoren, wie z. B. vor Zuhörern eine Rede halten, steigt die Zahl der natürlichen Killerzellen an. Prüfungsstress geht mit einer Verschiebung von der zellulären hin zur humoralen Immunantwort und einer verlängerten Wundheilung einher. Ver­ lusterlebnisse wie der Verlust des Partners führen zu einer verminderten Zahl von natürlichen Killer­ zellen. >> Chronische Stressoren, die als unkontrollier­ bar erlebt werden, wie die Betreuung eines an Morbus Alzheimer erkrankten Angehöri­ gen, sind mit einer globalen Immunsuppres­ sion verbunden. Die schädliche Wirkung von chronischen Stresso­ ren auf das Immunsystem wird wahrscheinlich über eine zu lange anhaltende Sekretion von Kortisol vermittelt, die zu einer Herunterregulation von 28 2 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle z­ ellulären Kortisolrezeptoren führt. Dadurch wird die Fähigkeit der Zelle eingeschränkt, auf entzün­ dungsfördernde Zytokine (z. B. Interleukin 6) zu reagieren. In Tiermodellen konnte gezeigt werden, dass chronischer Stress negative Auswirkungen auf Immunparameter hat und die Tumorentstehung und -progression fördert. Alte Menschen und ­Kranke sind anfälliger für die Wirkungen von Stress auf das Immunsystem. Umgekehrt können Opti­ mismus, eine gute Bewältigungsfähigkeit und emo­ tionale Unterstützung durch andere Menschen die schädliche Wirkung abschwächen. Die stressmin­ dernde Wirkung von sozialer Unterstützung wird durch Oxytozin vermittelt (7 Abschn. 4.4.5). Klinik: Beeinträchtigung der Gedächtnisbildung Lang dauernde Kortisolüberproduktion führt zu einer Atrophie des Hippocampus, einer für die Gedächtnisbildung wichtigen Hirnstruktur im limbischen System. Dies ließ sich im Tierexperiment zeigen. Der Befund fand sich auch bei Depressiven und bei Vietnamveteranen, die an einer posttraumatischen Belastungs­ störung (post-traumatic stress disorder, PTSD) litten. Bei der PTSD gelingt die Stressbewältigung nicht. Es drängen sich noch lange nach einem traumatischen Erlebnis intensive Bilder der traumatischen Situation auf (flashbacks), obwohl (oder wahrscheinlich: gerade weil) die Patienten versuchen, alle Gedanken oder ­Situationen zu vermeiden, die sie an die erlebte Situation erinnern. Die Betroffenen fühlen sich einerseits emotional abgestumpft, andererseits leiden sie an physiologischen Stresssymptomen. Nach neueren Untersuchungen ist es allerdings ­unklar, ob das verminderte Hippocampusvolumen tatsächlich eine Folge der posttraumatischen Be­ lastungsstörung ist. Vergleicht man traumatisierte ­Vietnamveteranen mit ihren eineiigen Zwillingen, die zu Hause geblieben waren und nicht traumatisiert wurden, so zeigen diese ebenfalls einen kleineren Hippocampus. Dies spricht dafür, dass die Verkleinerung schon vorher bestand und lediglich das Risiko erhöht, eine PTSD zu entwickeln. 2.2.2 Schmerz Neurobiologie Die neuronale Grundlage des Schmerzerlebens stellt das Schmerznetzwerk dar. Dabei kann man ein laterales Schmerzsystem und ein mediales Schmerzsystem unterscheiden. Das laterale Schmerzsystem besteht aus lateralen Kern­ gruppen des Thalamus sowie dem primären und sekundären sensorischen Kortex. Es ist für die sen­ sorisch-diskriminative Komponente zuständig. Das mediale Schmerzsystem, das aus medialen thala­ mischen Strukturen, dem zingulären Kortex, dem präfrontalen Kortex, dem Nucleus accumbens und der Amygdala besteht, repräsentiert die affektivmotivationale Komponente. Ein äußerer Schmerz­ reiz oder ein im Gehirn generierter Schmerz gehen mit einer Aktivierung derselben Hirnregionen ein­ her. Das Gefühl »Schmerz« kann also auch rein ­zerebral entstehen. Akuter und chronischer Schmerz Die physiolo­ gische Grundlage des Schmerzes ist das nozizep­ tive System. Mit Nozizeption wird die Aktivität dieses Systems beschrieben. Schmerz ist die einzige ­Sinnesempfindung, die fast immer mit einem nega­ tiven Affekt einhergeht: Schmerz wird vom Betrof­ fenen als quälend oder angsterregend erlebt. >> Akuter Schmerz weist meist auf eine Gewebe­ schädigung durch einen noxischen Reiz hin (Schutzfunktion des Schmerzes). Bei chronischem Schmerz gilt das nicht mehr. Hier lässt sich oft keine Gewebeschädigung feststellen. Chronische Schmerzen ohne organische Krank­heit können zu einem eigenständigen Störungsbild werden (somatoforme Schmerzstörung) und stellen ein großes Problem in der medizinischen Versorgung dar. Schmerzmessung In der experimentellen Schmerz­ forschung werden Schmerzschwellen bestimmt. >> Die Wahrnehmungsschwelle ist diejenige Reizintensität, bei der der Proband angibt, dass ein Reiz (z. B. kaltes Wasser) schmerzhaft sei. Die Toleranzschwelle ist diejenige Reiz­ intensität, bei der der Schmerz unerträglich wird (und der Proband seine Hand aus dem kalten Wasser zieht). Die Einschätzung des Schmerzes durch den Betrof­ fenen nennt man subjektive Algesimetrie (subjek­ tive Schmerzmessung). Hierfür gibt es Fragebögen. 29 2.2 · Psychobiologische Modelle Für die Beurteilung der Schmerzstärke wurde ­häufig eine visuelle Analogskala verwandt. Dies ist eine 10 cm lange Linie, deren Endpunkte mit Worten beschrieben sind: Am linken Ende steht »kein Schmerz«, am rechten Ende »stärkster vor­ stellbarer Schmerz«. Der Betroffene soll nun sein aktuelles Schmerzempfinden auf diesem Konti­ nuum einordnen und ein Kreuz an der entspre­ chenden Stelle machen. Die Schmerzstärke kann dann einfach quantifiziert werden, indem man die Strecke vom linken Ende bis zum Kreuz abmisst. Neuerdings werden jedoch eher numerische Skalen verwandt (Likert-Skala; 7 Abschn. 3.2.2). Eine gute Möglichkeit, Auskunft über auslösende und auf­ recht er­haltende Faktoren des Schmerzes zu ge­ winnen, ist ein Schmerztagebuch, das vom Patien­ ten geführt wird. Der am weitesten verbreite Frage­ bogen zur Erfassung der Schmerzempfindung ist der McGill-Schmerzfragebogen, der sowohl die sensorisch-diskriminative als auch die affektiv-­ motivationale und die kognitiv-evaluative Dimen­ sion erfragt. Komponenten des Schmerzes 55Sensorische Komponente: Wahrnehmung des Schmerzes, seiner Qualität (z. B. »stechend«, »brennend«), Lokalisation (z. B. »oberflächlich«, »tief«) und Stärke 55Affektive Komponente: emotionale ­Färbung (»quälend«, »fürchterlich«, »unerträglich«) 55Kognitive Komponente: gedankliche Interpretation (»Das Herz kann es nicht sein, weil…«) 55Vegetative Komponente: körperliche ­Begleiterscheinungen (z. B. Übelkeit; Herzfrequenzanstieg) 55Motorische Komponente: Gesichtsausdruck, Schonverhalten Gate-Control-Modell Schmerz wird nicht einfach von der Peripherie ins Gehirn geleitet, sondern zu­ gleich von absteigenden Fasern moduliert. Grund­ annahme der Gate-Control-Theorie ist, dass schon auf der Ebene des Rückenmarks efferente Regula­ tionsmechanismen (eine Art »Türsteher«) existie­ 2 ren, die darüber entscheiden, ob Schmerzsignale ins Gehirn weitergeleitet werden oder nicht. Ein ab­ steigendes Schmerzhemmsystem kann das »Tor« im Rückenmark öffnen oder schließen. Diese Grund­ annahme hat sich empirisch bestätigt, auch wenn Details des Modells heute nicht mehr gültig sind. Eine aktive Schmerzhemmung wird auch durch ­ ndogene Opiate (Endorphine) bewirkt, die an e Opiatrezeptoren binden, wo sie die Freisetzung von schmerzfördernden Neurotransmittern unter­ drücken. Angst und Depression verstärken die Schmerzwahrnehmung, Ablenkung und eine opti­ mistische Einstellung vermindern sie. Empathie Bei einem Menschen, der beobachtet, wie eine nahestehende Person Schmerzen erleidet, und sich in deren Erleben einfühlt (Empathie), sind dieselben Netzwerke aktiviert, so als würde er den Schmerz auch selbst spüren. Interessant ist nun, dass nicht das ganze Netzwerk aktiv ist, sondern nur ein Teil davon, und zwar der mediale Anteil, der den emotionalen Aspekt des Schmerzerlebens vermit­ telt. Um sich in einen anderen Menschen hineinver­ setzen zu können, ist offenbar der affektive Gehalt des Schmerzes wichtiger als der sensorische. Dabei fand sich sogar ein direkter Zusammen­ hang zwischen der Stärke der Aktivierung der ent­ sprechenden Hirnregionen und den interindividu­ ellen Unterschieden in der Empathie. Menschen, die ein größeres Einfühlungsvermögen aufwiesen, zeigten auch eine stärkere Aktivität. Empathie hat sich also vermutlich aus einem System entwickelt, das unsere inneren körperlichen Zustände und Ge­ fühle repräsentiert. Je besser der Zugang zu eigenen Gefühlen, desto besser auch das Einfühlungsver­ mögen in andere (Mentalisierung; 7 Abschn. 2.3). Ähnlich ist es auch bei der Wahrnehmung von Gefühlen bei anderen Menschen. Wenn wir den emotionalen Gesichtsausdruck eines anderen Men­ schen (z. B. Freude oder Trauer) sehen, werden die dem jeweiligen Gefühl zugrunde liegenden Hirn­ regionen (anteriore Insel, anteriorer zingulärer ­Kortex) auch bei uns selbst aktiviert, mit den ent­ sprechenden vegetativen und körperlichen Begleit­ erscheinungen (7 Abschn. 4.4). Diese »emotionale Ansteckung« geschieht ganz automatisch, ohne dass eine bewusste Absicht oder Anstrengung dafür er­ forderlich wäre. 30 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle Schmerzgedächtnis Schmerzerfahrungen können 2 zu »Erinnerungen« auf kortikalen und subkorti­ kalen Ebenen führen. Starke Schmerzen, die nicht ausreichend behandelt werden, können Spuren im Zentralnervensystem hinterlassen. Neuronale plas­ tische Veränderungen auf kortikaler und subkorti­ kaler Ebene (v. a. im Rückenmark) bewirken eine erhöhten Schmerzsensibilität: Nozizeptive Nerven­ zellen werden empfindlicher für Schmerzreize. Dann lösen auch harmlose, normalerweise nicht schmerzhafte Reize Schmerzen aus. Auf diese Weise entstehen chronische Schmerzen, die im Unter­ schied zu akuten Schmerzen kein Signal für eine Gewebeschädigung sind. Der zugrunde liegende Mechanismus wird Langzeitpotenzierung ge­ nannt (7 Abschn. 4.2.1). Die synaptische Übertra­ gung wird dabei verstärkt (potenziert). Die synapti­ schen Veränderungen gleichen denjenigen, die man bei der Gedächtnisbildung im Hippocampus findet (deshalb »Schmerzgedächtnis«). Normalerweise beugt die körpereigene Schmerzabwehr (endogene Opioide) der Entstehung des Schmerzgedächtnisses vor. Bei Operationen kann man durch präven­tive Schmerzausschaltung (Analgesie) z. B. mit Leitungs­ blockaden eine Langzeitpotenzierung verhindern. Ein schon entstandenes Schmerzgedächtnis lässt sich pharmakologisch nicht löschen. Was teilweise hilft, sind Gegenstimulationsverfahren (transkutane elektrische Nervenstimulation, TENS; Elektroaku­ punktur) und psychologische Verfahren (s. u.). Die zentrale Sensibilisierung der Schmerz­ wahrnehmung bei Schmerzkranken lässt sich phy­ siologisch durch evozierte Potentiale und bildge­ bende Verfahren nachweisen (7 Abschn. 3.6). Auch der Einfluss von operanten Lernvorgängen lässt sich objektivieren: Wenn der Partner anwesend ist, der den Kranken üblicherweise tröstet, sinkt die Schmerzschwelle, der Gesichtsausdruck wird ge­ quälter, die evozierten Potentiale zeigen eine inten­ sivere Reaktion an, die aktivierten Hirnareale sind in bildgebenden Verfahren ausgedehnter (und zwar schon vor der bewussten Schmerzwahrnehmung). Bei der operanten Verhaltenstherapie lernen die Partner deshalb, auf Schmerzen nicht mehr mit Zu­ wendung zu reagieren, um das Schmerzverhalten nicht zu verstärken. Auch der Plazeboeffekt, d. h. die Schmerzlin­ derung allein infolge der Erwartung, dass ein Mittel hilft, auch wenn es pharmakologisch unwirksam ist, lässt sich objektivieren. Diese Erwartung aktiviert das körpereigene Opioidsystem. Umgekehrt lässt sich der Plazeboeffekt aufheben, wenn man das Opioidsystem mit dem Opiatantagonisten Naloxon blockiert. Bei plazebobedingter Schmerzlinderung finden sich in bildgebenden Verfahren auch ent­ sprechende Hirnaktivitätsänderungen, die auf eine veränderte Schmerzinterpretation hindeuten. Al­ lerdings ist nur ein Teil der Schmerzpatienten für Plazeboeffekte empfänglich (zum Plazeboeffekt 7 Abschn. 6.2.6). Phantomschmerzen Phantomschmerzen, d. h. die »Wahrnehmung« von Schmerzen in Gliedmaßen, die infolge einer Amputation gar nicht mehr exis­ tieren, sind auf die Reorganisation von Hirnarealen zurückzuführen. Die kortikalen Projektionsgebiete des amputierten Glieds, die keinen Input mehr er­ halten, werden von anderen Projektionen sozu­ sagen mitbenutzt. Da der kortikale Ort aber festlegt, wo die Reize räumlich wahrgenommen werden, empfindet der Betroffene die Schmerzen als aus dem amputierten Glied kommend, auch wenn dies gar nicht mehr vorhanden ist. Phantomschmerzen lassen sich durch konsequente Analgesie vor der Amputation verhindern oder abschwächen. Eine Prothese, die den Stumpf elektrisch stimuliert, macht die kortikale Reorganisation wieder rück­ gängig und vermindert die Phantomschmerzen. Eine weitere Behandlungsmöglichkeit, die ebenfalls die neuronale Plastizität benutzt, ist die Spiegel­ therapie (7 Abschn. 4.2.1). Chronische Schmerzen Als chronische Schmerzen werden Schmerzen mit einer Dauer von mehr als 6 Monaten bezeichnet. Hier findet sich, wie er­ wähnt, häufig keine organische Ursache, die die Schmerzen erklären könnte. Die häufigsten chroni­ schen Schmerzen sind chronische Rückenschmer­ zen sowie Kopfschmerzen (Migräne und Span­ nungskopfschmerz). Das verhaltensmedizinische Schmerzmodell unterscheidet prädisponierende, auslösende und aufrecht erhaltende Faktoren des Schmerzes. Prädisponierend sind eine genetische Disposition, frühe mit Schmerz verbundene Er­ lebnisse (z. B. schmerzhafte medizinische Unter­ suchungen), eine Überlastung von Körperregionen 31 2.2 · Psychobiologische Modelle (z. B. der Muskulatur des Nackens, der Schulter und des Rückens bei Computerarbeit) und Modell­ lernen (z. B. bei Kindern, deren Eltern ebenfalls an Schmerzen leiden). Die auslösenden Faktoren um­ fassen akute und chronische Stresssituationen mit Erhöhung der Muskelspannung, was zu einem ­Circulus vitiosus von Stress und Muskelspannung führen kann. Außerdem spielen Fehlinterpretatio­ nen von Körperwahrnehmungen als Schmerz eine Rolle sowie eine Kausalattribution der Schmerzen als Zeichen einer körperlichen Krankheit, ähnlich wie bei der Somatisierungsstörung. Zu den aufrecht erhaltenen Faktoren gehören operante Konditionie­ rung (z. B. Zuwendung durch den Ehepartner bei Schmerzäußerungen) und dysfunktionale Kogni­ tionen (z. B. Katastrophisieren) sowie maladap­ tives Schmerzverhalten (z. B. Angst-VermeidungsStrategie oder Durchhaltestrategie), die weiter un­ ten am Beispiel der chronischen Rückenschmerzen beschrieben werden. Chronische Rückenschmerzen Chronische Rücken­ schmerzen sind eine häufige Ursache von Arbeits­ unfähigkeit, stationärer Krankenhausbehandlung, medizinischer Rehabilitation und Frühberentung. Meist findet man keine organischen Veränderungen an der Wirbelsäule, die die Schmerzen erklären ­würden. Menschen, die chronische Rückenschmer­ zen entwickeln, reagieren in Stresssituationen bevor­ zugt mit einer Verkrampfung der Rückenmusku­ latur (individualspezifische Reaktion). Infolge der eintretenden Schmerzen verkrampft sich die Mus­ kulatur zusätzlich, so dass ein Teufelskreis entsteht. Die Betroffenen schonen sich aus Angst, durch kör­ perliche Aktivität ihrem Rücken zu schaden, immer mehr und vermeiden körperliche Anstrengungen (Angst-Vermeidungs-Strategie), was zwar kurz­ fristig zur Entlastung führt (negative Verstärkung des Vermeidungsverhaltens), langfristig aber zu ­einer Zunahme der Schmerzen. Wenn sie sich ein­ mal körperlich anstrengen und dabei Schmerzen verspüren, entwickeln sie oft starke Befürchtungen, dass sich ihr Gesundheitszustand immer mehr ver­ schlechtern wird (katastrophisierende Gedanken). Kommt infolge des sozialen Rückzugs und der Auf­ gabe von Aktivitäten noch eine Depression hinzu, ist das Chronifizierungsrisiko der Rückenschmerzen noch größer. Den Gegenpol stellen Schmerzpatien­ 2 ten dar, die auf Schmerzen mit Durchhalteappellen reagieren und sich immer weiter körperlich anstren­ gen, auch auf die Gefahr hin, sich zu überfordern. Diese Durchhaltestrategie erhöht ebenfalls das Chronifizierungsrisiko. Die wichtigste Therapie besteht in körperlicher Aktivität trotz Schmerzen. Dies gilt auch bei akuten Rückenschmerzen, bei denen Bettruhe auf das ab­ solut Notwendige begrenzt werden sollte. In der Rehabilitation kommen ein gezieltes Funktionstrai­ ning, Üben arbeitsplatzbezogener Tätigkeiten und verhaltensmedizinische Verfahren wie Stressbewäl­ tigungstraining und Patientenschulungen (Rücken­ schule) zum Einsatz. >> Die wichtigste Behandlungsmaßnahme bei chronischen Rückenschmerzen besteht in körperlicher Aktivität. Eine ausschließlich medikamentöse Behandlung stößt bei chronischen Schmerzen an ihre Grenze, zumal Schmerzmittel auf Dauer selbst schmerzaus­ lösend wirken können. Deshalb ist ein multimoda­ les Vorgehen angezeigt, in welchem auch psycholo­ gische Behandlungsverfahren ihren Platz haben. Verhaltensmedizin Verhaltensmedizinische Thera­ piebausteine sind Stressbewältigungstrainings, Ent­ spannungsmethoden (7 Abschn. 8.2.5), Biofeedback sowie Schmerzbewältigungsstrategien. Dabei ler­ nen die Patienten z. B. ihre Aufmerksamkeit von den Schmerzen abzulenken oder sich in Gedanken an einen besonders schönen Ort zu versetzen, wo sie sich früher einmal sehr wohl fühlten (geleitete Imagination). Biofeedback dient dazu, üblicherweise auto­ matisch ablaufende körperliche Regulationsvorgän­ ge – Muskelspannung, Herzfrequenz, Blutdruck, Körpertemperatur oder Gehirnströme – vermehrt unter bewusste und aktive Kontrolle zu bekommen. Um diese Kontrolle zu ermöglichen, werden die ­jeweiligen Vorgänge gemessen und in optische oder akustische Signale umgewandelt, so dass die Patien­ ten unmittelbar sehen oder hören können, wenn sich beispielsweise der Muskeltonus verändert. Mit der Aufforderung, das optische Signal auf einem Bildschirm nicht über eine angezeigte Schwelle ge­ langen zu lassen, können sie lernen, den Muskel­ tonus (oder andere o. g. Vorgänge) aktiv zu beein­ 32 2 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle flussen und zu steuern. Das Erlernen der nötigen »inneren Einstellungsprozesse« erfolgt dabei über operante Konditionierung, auch wenn noch nicht völlig geklärt ist, wodurch Biofeedback wirkt. Die Veränderung der körperlichen Vorgänge ist meist die Folge von Entspannungszuständen. Biofeed­ back ist somit eine Form des Lernens, die Körper­ wahrnehmung, Entspannung und Selbstkontrolle schult. Auch die schmerzevozierten Potenziale (und damit die Schmerzwahrnehmung) lassen sich durch Biofeedback beeinflussen. Bei Migräne ler­ nen die Patienten, die Blutgefäße des Gehirns, die im Migräneanfall erweitert sind, wieder zu ver­ engen, entweder direkt über einen Sensor, der über der Schläfenarterie angebracht ist, oder indirekt, indem sie lernen, eine Erwärmung der Hand zu ­bewirken, die eine Verengung der Kopfgefäße nach sich zieht. Hierzu wird ihnen über einen Tempera­ turfühler die Hauttemperatur der Hand zurück­ gemeldet. Die anfangs hohen Erwartungen mit Hilfe von Biofeedback ein so großes Maß an Kontrolle über die körperlichen Vorgänge zu ermöglichen, dass z. B. Medikamente gegen Schmerzen oder Blut­ hochdruck überflüssig würden, sind jedoch ent­ täuscht worden. So ist es zwar möglich, die genann­ ten Körperfunktionen willentlich zu beeinflussen, jedoch nicht in dem Ausmaß, wie ursprünglich er­ hofft. Dennoch ist Biofeedback eine fruchtbare zu­ sätzliche Intervention bei vielen Beschwerden wie z. B. Migräne, Spannungskopfschmerz, Schlafstö­ rungen, Bluthochdruck und Lähmungen (z. B. nach Schlaganfall). iiVertiefen Birbaumer N, Schmidt RF (2010) Biologische Psychologie, 7. Aufl. Springer, Berlin Heidelberg New York (umfassendes, grundlegendes Werk) Schandry R (2011) Biologische Psychologie, 3. Aufl. Beltz, Weinheim (gut verständliche Einführung) Segerstrom SC, Miller GE (2004) Psychological stress and the human immune system: A metaanalytic study of 30 years of inquiry. Psycho­ logical Bulletin 130:601–630 (umfassende Übersicht über die Forschung) 2.3 Psychodynamische Modelle H. Faller, H. Lang Lernziele Der Leser soll 55 Kernkonzepte psychodynamischer Modelle (­unbewusste Konflikte, implizite Beziehungs­ muster) benennen können, 55 unterschiedliche Abwehrmechanismen ­definieren können, 55 das Konzept des sekundären Krankheitsgewinns kennen. >> Psychodynamische, d. h. an der Psychoana­ lyse orientierte Modelle, nehmen an, dass ­unbewusste Konflikte und Beziehungsmuster, die ihre Wurzeln bereits in der Kindheit haben können, psychischen Störungen zugrunde ­liegen. 2.3.1 Psychoanalytische ­Entwicklungspsychologie Das Bild des Säuglings im Wandel In der psycho­ analytischen Entwicklungspsychologie spielt die frühe Kindheit eine große Rolle. Das Erleben des Säuglings und kleinen Kindes wurde anhand der Köperorgane, auf die sich, so die Theorie Freuds, die sexuelle Lust des Kindes richte, in Phasen einge­ teilt (Stadienmodell: orale, anale, phallische Phase; 7 Abschn. 2.3.2). Im Zentrum der frühkindlichen Entwicklung stand die Bewältigung des Ödipus­ komplexes. Diese theoretischen Annahmen waren jedoch retrospektiv aus pathologischen Phänome­ nen bei erwachsenen Patienten entwickelt und so­ zusagen auf die normale Kindheitsentwicklung zu­ rückdatiert worden. Als man in jüngerer Zeit dazu überging, Säuglinge direkt zu beobachten, wandelte sich das Bild des Kindes. Es wurde klar, dass Säug­ linge bei ihren Bedürfnisspannungen bereits diffe­ renzierte Emotionen empfinden und aktiv mit ihren primären Bezugspersonen interagieren, bei denen sie auf ein intuitives Elternverhalten treffen. Sie sind zu komplexen Wahrnehmungs- und kognitiven Leistungen in der Lage und erforschen früh ihre Umwelt, um eigene Wirkungen auf diese zu erkun­ 33 2.3 · Psychodynamische Modelle den. Beispiel: Verbindet man den Fuß eines Säug­ lings durch einen Faden mit einem Mobile, so er­ kennt er bald, dass er dieses selbst in Bewegung setzen kann, und wiederholt diesen Effekt immer wieder: Neugier und Funktionslust statt sexueller Lust. Situationen hoher Spannung, gesteuert von »Trieben«, »Versagungen« und »Verführungen« sind nicht das Normale, sondern entstehen dann, wenn Eltern aufgrund eigener unbewältigter Kon­ flikte oder psychischer Belastungen nicht in der Lage sind, den Bedürfnissen ihrer Kinder gerecht zu werden. In moderner psychoanalytischer Sicht­ weise spielt die kindliche Sexualität keine so große Rolle mehr. Andere Bedürfnisse, wie diejenigen nach Bindung und Kommunikation, aber auch ­Exploration sind wichtiger. Beispiel: Der Säugling nimmt in der »oralen Phase« nicht deswegen Dinge in den Mund, weil er sich dadurch sexuelle Lust ver­ schaffen will, sondern um ihre Beschaffenheit her­ auszufinden. Implizite Beziehungsmuster Im Zentrum der psy­ choanalytischen Theorie stehen unbewusste intra­ psychische Konflikte, die das Erleben und Ver­ halten bestimmen. Innere Konflikte entstammen jedoch den interpersonellen Erfahrungen, die ein Mensch im Verlaufe seiner Entwicklung gemacht hat. Diese Erfahrungen schlagen sich in Verhaltensund Erlebensmustern nieder, die nicht bewusst, sondern implizit und im prozeduralen Gedächtnis repräsentiert sind (implizites Beziehungswissen). Dieses implizite Wissen enthält z. B. Annahmen da­ rüber, wie man seine Gefühle ausdrücken darf und seine Ziele verfolgen kann, oder Erwartungen, wie andere reagieren werden, wenn man sich ihnen ge­ genüber auf eine bestimmte Art oder Weise verhält. Beispiel einer auf Video aufgezeichneten Interak­ tionssequenz: Ein 18 Monate alter Junge sitzt zu­ sammen mit seiner depressiven Mutter auf dem Sofa. Er trinkt sein Fläschchen, die Mutter raucht eine Zigarette und starrt ins Leere. Nachdem er aus­ getrunken hat, hüpft er auf dem Sofa auf und ab, ohne dass seine Mutter reagiert. In dem Augen­ blick aber, in dem er zu ihr hinüber krabbelt, schimpft sie: »Ich hatte dir doch gesagt, du sollst nicht auf dem Sofa hüpfen!« In dieser Sequenz wird deutlich, dass ihr Schimpfen nicht durch das vor­ herige Hüpfen, sondern durch seine Annäherung 2 ausgelöst wurde. Wenn sich derartige Erlebnisse wiederholen, erwirbt das Kind ein implizites Be­ ziehungswissen derart, dass Ausdruck von Nähe wahrscheinlich mit Zurückweisung beantwortet wird. Es wird deshalb Nähewünsche unterdrü­ cken, um Zurückweisungen zu verhindern. In einer späteren Szene sieht man, wie der Kleine auf ­ seine Mutter zuläuft und die Hand nach ihr aus­ streckt; doch kurz bevor er sie berührt, zieht er die Hand wieder zurück. Er würde gerne mit der Mutter ­Kontakt a­ ufnehmen, lässt es aber dann doch lieber bleiben. Er entwickelt einen Konflikt zwi­ schen ­ Nähewünschen und ihrer Abwehr. Die ­Abwehr von Nähebedürfnissen dient der Bewäl­ tigung realer Erfahrungen. Auf deren Basis ent­ stehen unbe­wusste Beziehungsschemata, wie sie auch von der Bindungs­theorie beschrieben werden (7 Abschn. 4.7.3). Affektregulation Wie gelingt es Säuglingen, ihre Gefühle zu regulieren? Um dies zu lernen, benö­ tigen sie die einfühlsame Reaktion eines Gegen­ übers, der primären Bezugsperson, üblicherweise der Mutter. Deren Aufgabe ist es, die vom Kind zum Ausdruck gebrachten Gefühle zu reflektieren (­Affektspiegelung), und zwar in einer markierten, übertriebenen Weise, so dass das Kind merkt, dass es sich nicht um den eigenen Affekt der Mutter, son­ dern um seinen von der Mutter wahrgenommenen und zurückgespiegelten Affekt handelt (»Als-obAffekt«). Das Kind sieht sozusagen im Gesicht der Mutter seinen eigenen Zustand. Beispiel: Wenn es sich weh getan hat, wird die Mutter den Schmerz in ihrem eigenen Gesicht etwas dramatisiert darstellen und danach beruhigend und tröstend zum Kind sprechen, wodurch sich dessen Schmerz abmildert. Dies geschieht zunächst ganz automatisch. Später kann das Kind diese Strategie auch bewusst einset­ zen, nachdem es die Fähigkeit zum symbolischen Denken entwickelt hat: Es bildet dann eine Reprä­ sentation, d. h. eine Vorstellung des Gefühls, welche es ihm ermöglicht, gezielt Bewältigungsstrategien anzuwenden oder sich von dem Gefühl zu distan­ zieren. Eine ähnliche Rolle kann das Spielen ein­ nehmen, in welchem das Kind beispielsweise so tut, als ob sein Teddybär sich weh getan hat, ihn tröstet und das schmerzliche Gefühl auf diese Weise ver­ arbeitet. 34 2 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle Mentalisierung Wenn die Mutter die kindlichen Gefühle auf einfühlsame Weise widerspiegelt und feinfühlig, prompt und angemessen auf die kind­ lichen Bedürfnisse reagiert, entwickelt das Kind die Vorstellung, dass es selbst, aber auch andere Men­ schen Wesen mit geistigen Zuständen, Wünschen, Bedürfnissen und Absichten sind. Diesen Prozess nennt man Mentalisierung, sein Ergebnis eine t­ heory of mind (7 Abschn. 4.7.3). In Abhängigkeit vom Aus­ maß der mütterlichen Feinfühligkeit kann dieser Mentalisierungsprozess mehr oder weniger gut ge­ lingen. Wenn eine Mutter die Kontaktwünsche ihres Kindes zurückweist, wenn sie es zu sehr kontrolliert oder auch überstimuliert, wenn sie ­infolge eigener konflikthafter Einstellungen dem Kind nicht gerecht wird, am extremsten aber bei sexuellem oder aggres­ sivem Missbrauch, kann das Kind diese Fähigkeit, sich in andere hineinzuver­setzen, nicht ausreichend erwerben. Dies scheint z. B. bei der Borderline-Per­ sönlichkeitsstörung der Fall zu sein. 2.3.2 Traditionelle Stadien der ­psychosexuellen Entwicklung nahme. In der Bezeichnung dieser Phase kommt zum Ausdruck, dass der Mund und die Haut wich­ tige Medien der frühen Umweltkommunikation des Säuglings sind. Gestillt und gefüttert werden, getra­ gen und gehalten werden führen zu einem Urgefühl von Geborgensein und Versorgung, das als Urver­ trauen bezeichnet wird. Bildet sich dieses Gefühl der Sicherheit nicht angemessen aus, können z. B. Dispositionen für eine spätere Depression oder auch eine Störung des zwischenmenschlichen Kon­ takts resultieren. Anal-muskuläre Phase Diese Phase hat ihren Na­ men daher, dass nun Reinlichkeitserziehung und motorische Expansion bedeutsam werden. Zum einen gewinnt das Kind Kontrolle über die Aus­ scheidungsfunktionen, zum zweiten kann es sich von seinen Eltern weg bewegen und dadurch Auto­ nomie erlangen. Zugleich aber können Scham und Zweifel auftreten, weil die ersten Versuche der Ver­ selbständigung wortwörtlich »in die Hose gehen« können. Übermäßige Einschränkungen der autono­ men Regungen des Kindes durch die Eltern können mit Trotz und Rebellion beantwortet werden. Das traditionelle Stadienmodell der psychosexuel­ len Entwicklung geht auf Sigmund Freud, den Be­ gründer der Psychoanalyse zurück. Erik H. Erikson erweiterte das Modell über die Kindheit hinaus in das Erwachsenenalter. Die Information über die kindliche Entwicklung gewann Freud, wie erwähnt, aus den Erinnerungen seiner Patienten. Im Stadienmodell der psychosexuellen Ent­ wicklung werden typische Phasen beschrieben, die, wenn sie gestört werden, zu einer späteren neuro­ tischen Erkrankung disponieren können. Diese Phasen sind nach den Organsystemen bezeichnet, die in der jeweiligen Zeit eine wichtige Rolle spielen. In den Bezeichnungen der Phasen kommt zum Aus­ druck, dass die psychische und sexuelle Entwick­ lung in engem Zusammenhang mit der körper­ lichen Entwicklung stehen. Einen Überblick über die Stadien der psychosexuellen Entwicklung gibt . Tab. 2.1. Im Folgenden werden die Phasen bis zur Adoleszenz näher erläutert. Phallisch-ödipale Phase In der ödipalen Phase t­ reten die eigentlichen Sexualorgane in den Vorder­ grund. Freud hat zwar auch die bisherigen Phasen als psychosexuelle Stadien verstanden, dabei aber den Begriff der Sexualität weit über die übliche Defini­tion hinaus auf jegliche lustvolle Empfindung aus­gedehnt. In der ödipalen Phase verspürt der klei­ ne Junge eine heftige Zuneigung zu seiner Mutter, das kleine Mädchen zu seinem Vater (»Wenn ich groß bin, heirate ich dich!«). Das jeweils gleichge­ schlechtliche Elternteil wird dadurch zum Rivalen, den man verdrängen möchte. Dies führt zu einem inneren Konflikt, weil der kleine Junge den Vater (analog das kleine Mädchen seine Mutter) nicht nur loswerden will, sondern ihn (bzw. sie) zugleich auch gerne hat. Konkurrenzerleben und Phantasien der Rivalität verursachen Schuldgefühle. Sexualstörun­ gen, wie z. B. Verlust des Interesses an der Sexualität oder erektile Dysfunktion, können hier eine Wurzel haben. Oral-sensorische Phase Das Neugeborene ist ange­ Latenzphase Nach der ödipalen Phase ist nach Freud die frühkindliche Sexualentwicklung ab­ wiesen auf Wärme, Hautkontakt und Nahrungsauf­ 35 2.3 · Psychodynamische Modelle 2 ..Tab. 2.1 Stadien der psychosexuellen Entwicklung (nach Freud, Erikson) Lebensalter in Jahren Psychosexuelle Phasen Umkreis der Bezie­ hungspersonen Psychosexuelle Modalitäten Psychosoziale ­Krisen Bis 1½ Oral-sensorische Phase Mutter (Vater) Empfangen und (sich-) ein­ verleiben, atmosphärisches Fühlen, Hören, Sehen, Riechen Urvertrauen vs. Urmisstrauen 1½ bis 3 Anal-muskuläre Phase Eltern Festhalten und hergeben, Trotz – Fügsamkeit Autonomie vs. Scham und Zweifel 3 bis 5 (6) Phallisch-ödipale Phase Familie Vergleichen und konkurrieren, Geschlechtsrollenfindung Initiative vs. Schuldgefühl 6 bis 10 Latenzphase Wohngegend, Schule Etwas »Richtiges« machen, etwas mit anderen zusammen machen Leistung vs. Minder­ wertigkeitsgefühl 10 bis 18 (20) Pubertät und Adoleszenz »Eigene« Gruppen, »die Anderen«, ­Führer – Vorbilder Wer bin ich? (Wer bin ich nicht?); das Ich in der Gemeinschaft ­Identitätsdiffusion 20 bis 40 Frühes Erwach­ senenalter – Genitalität Freunde, sexuelle Partner, Rivalen, ­Mitarbeiter Sich im Anderen verlieren und finden Intimität vs. ­Isolierung 40 bis 60 Mittleres Erwach­ senen­alter Gemeinsame Arbeit, Zusammenleben in der Ehe Schaffen, versorgen Generativität vs. Stagnation Über 60 Spätes Erwach­ senenalter »Die Menschheit«, »Menschen meiner Art« Sein, was man geworden ist; wissen, dass man einmal nicht mehr sein wird Integrität vs. ­Verzweiflung geschlossen, und das Sexuelle tritt in die Latenz ­zurück. Nun werden Gleichaltrige (die peer group) wichtiger. In der Schule geht es um Leistung und Kompetenz. Auf der anderen Seite können Min­ derwertigkeitsgefühle auftreten, wenn sich ein Kind den Leistungsanforderungen nicht gewachsen fühlt. Pubertät und Adoleszenz In der Pubertät werden durch die körperliche Entwicklung (hormonelle Veränderungen, Auftreten der sekundären Ge­ schlechtsmerkmale) zum einen die ödipalen Stre­ bungen der Kindheit wiederbelebt, zum anderen geht es um eine Ablösung aus dem familiären Kon­ text und die Hinwendung zu anderen Menschen. Die eigene Identität im Vergleich zu anderen bildet sich aus. Dass diese Anforderungen nicht von allen Heranwachsenden gleich gut bewältigt werden, zeigen Störungen wie die Pubertätsmagersucht ­ (Anorexia nervosa), bei der die Annahme der weib­ Identität vs. lichen Identität einschließlich der Körpermerkmale ein wichtiges Thema sein kann (7 Abschn. 4.8.1). Kritik Kritisch zur psychosexuellen Stadienlehre ist anzumerken, dass sie das Konflikthafte und po­ tenziell Pathologische in den Vordergrund stellt, weil sie ja auf der Basis von Patientenberichten ge­ wonnen wurde. Außerdem weiß man heute auf­ grund von Längsschnittuntersuchungen, dass die Erinnerungen Erwachsener an ihre Kindheit nur sehr schwach mit damals tatsächlich vorgefallenen Ereignissen zusammenhängen. Die beschriebenen Phasen sollte man auch nicht streng voneinander abgrenzen, sondern eher als Entwicklungsthemen betrachten, die mehr oder weniger stark während der gesamten Biographie eine Rolle spielen können. Psychotraumatologie Sexueller und aggressiver Missbrauch von Kindern ist viel häufiger, als man früher annahm. Missbrauch stellt ein Trauma dar, 36 2 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle das Langzeitfolgen wie eine psychische Störung, z. B. eine Depression, hervorrufen kann. Dabei spielen auch Interaktionen mit genetischen Dis­ positionen eine Rolle. Mit der psychologischen Be­ handlung von Traumaopfern befasst sich die Psy­ chotraumatologie. Ein Trauma ist definiert als ein Lebensereignis, auf welches fast alle Menschen mit starker psychischer Belastung reagieren würden. Dazu gehören neben kindlichem Missbrauch auch andere aggressive oder sexuelle Gewalterfahrun­ gen wie Vergewaltigung, Entführung, Geiselnahme, Kriegserlebnisse, Folter, aber auch Naturkatastro­ phen oder schwere Unfälle. Die psychische Be­ lastung bildet sich zwar mit der Zeit meist wieder zurück; aber bei einem Teil der Betroffenen (10 % der Männer, 20 % der Frauen) entwickelt sich eine posttraumatische Belastungsstörung. Risikofak­ toren sind neben der Art und Schwere des Traumas vorbestehende oder wiederholte Traumatisierun­ gen und die Vermeidung, sich mit dem Trauma aus­ einanderzusetzen. Denn dann kann das Trauma nicht im Gedächtnis abgespeichert werden und drängt sich dem Erleben immer wieder unverarbei­ tet auf, als würde es jeweils erneut durchlebt werden (Intrusionen, flashbacks). In der Therapie lernen die Betroffenen zuerst Strategien anzuwenden, um sich gegen das Eindringen der Traumabilder zu schützen (Stabilisierung). Danach konfrontieren sie sich vor­ sichtig und schrittweise mit der traumatischen Er­ fahrung (Exposition), um sie auf diese Weise in das autobiographische Gedächtnis zu integrieren. 2.3.3 Drei-Instanzen-Modell, ­Triebmodell Das psychoanalytische Strukturmodell der Persön­ lichkeit unterscheidet drei Instanzen: Es, Ich und Über-Ich. Es Das Es ist die Quelle der Wünsche, Antriebe und Begierden. Diese unbewussten Impulse, die unwill­ kürlich aus der Tiefe (deshalb Tiefenpsychologie) auftauchen, wurden als Triebe bezeichnet. Die Psy­ choanalyse hat sich vor allem mit dem Sexualtrieb und dem Aggressionstrieb beschäftigt. Diese Triebe drängen auf Befriedigung, stoßen aber auch auf ­Widerstand und Verbote. Über-Ich Das Über-Ich vertritt die verinnerlichten Normen der sozialen Umwelt und deren moralische Forderungen. Es ist eine warnende Instanz, die wir als die »Stimme des Gewissens« kennen. Während ursprünglich die elterlichen Verbote und Gebote die triebhaften Bedürfnisse einschränkten, wird diese Aufgabe im Laufe der Entwicklung zunehmend von der inneren moralischen Instanz des Über-Ichs übernommen. Das Über-Ich umfasst auch eine ­ideale Vorstellung von sich selbst, der man nach­ strebt (Ich-Ideal). Ich Das Ich vermittelt zwischen Es und Über-Ich. Es berücksichtigt die Forderungen der Realität und versucht einen Kompromiss zu erzielen zwischen den Triebbedürfnissen des Es auf der einen Seite und den moralischen Ver- und Geboten des ÜberIchs auf der anderen Seite. Es kann entweder einen Triebimpuls akzeptieren und seine Befriedigung ermöglichen und dies lustvoll genießen, aber auch auf die Erfüllung eines Triebwunsches bewusst ver­ zichten oder ihn schließlich unbewusst abwehren (7 Abschn. 2.3.5). Das Ich vertritt das Realitätsprin­ zip, während das Es vom Lustprinzip regiert wird. Da das Ich in einem Spannungsverhältnis zwischen unterschiedlich wirkenden Kräften aus dem Es und dem Über-Ich steht und es zu entsprechenden Kon­ flikten zwischen Über-Ich und Es kommen kann, spricht man von Psychodynamik. Topographisches Modell Neben dem Instanzen­ modell gibt es noch das topographische Modell. Es unterscheidet 3 Bereiche, die sich mit den 3 Instan­ zen Ich, Es und Über-Ich überschneiden: 44das Bewusste, 44das Vorbewusste, 44das Unbewusste. Diejenigen psychischen Inhalte, zu denen wir im aktuellen Erleben Zugang haben, werden als das ­ ewusste bezeichnet. Das Vorbewusste ist uns B zwar aktuell nicht bewusst, kann aber ohne größe­ ren Aufwand bewusst gemacht werden: Es ist be­ wusstseinsfähig. Das Unbewusste, das nach Freud den größten Teil des Seeelenlebens ausmacht, wird hingegen nur sehr selten bewusst. Es setzt dem Be­ wusstwerden oft sogar einen Widerstand entgegen. Die Bewusstmachung erfordert deshalb bestimmte 37 2.3 · Psychodynamische Modelle therapeutische Techniken wie die freie Assoziation (7 Abschn. 8.2.1). Während das Es vollständig dem Unbewussten zugeordnet wird, haben Ich und Über-Ich sowohl bewusste als auch vor- und unbewusste Anteile. Die Abwehr als eine Funktion des Ichs erfolgt beispiels­ weise gleichwohl unbewusst (7 Abschn. 2.3.5). Das Geniale an Freuds Theorie ist die große Be­ deutung, die dem Unbewussten für das Erleben und Verhalten des Menschen zugeschrieben wird. Diese Entdeckung wurde durch die neuen Ergebnisse der Hirnforschung voll bestätigt. Neurowissenschaftler bezeichnen heute wie schon damals Freud das be­ wusste Erleben im Alltag als die »Spitze des Eis­ bergs«, unter der die allermeisten kognitiven und Wahrnehmungsprozesse unbewusst ablaufen. Aller­ dings ist das Unbewusste, wie es von den Neurowis­ senschaften beschrieben wird, nicht aus neuro­ tischen Motiven verdrängt worden, sondern stellt ein sehr adaptives Verhaltenssteuerungssystem dar (7 Abschn. 4.3.1). Psychodynamische Persönlichkeitsmodelle werden in 7 Abschn. 4.6.2 dargestellt. 2.3.4 Trieb-, Ich-, Selbst- und Objektpsychologische Modelle Die Psychoanalyse ist keine einheitliche Theorie. Vielmehr finden sich unter dem Oberbegriff »psy­ choanalytisch« viele unterschiedliche, teilweise ­heterogene Modelle. Vier Modelle der Psychoanalyse 55Trieb-psychologisches Modell: Dieses ­frühe Modell stellt den Konflikt zwischen einem Triebwunsch und der Abwehr in den Vordergrund. Psychische Störungen entstehen demnach durch ein Übermaß an Triebunterdrückung. 55Ich-psychologisches Modell: Hier steht die Rolle des Ich im Vordergrund, das die ­Funktionen der Emotionsregulation und ­Realitätsanpassung ausübt. Psychische ­Störungen entstehen, wenn das Ich zu schwach ist, diese Aufgaben zu leisten. 2 55Selbst-psychologisches Modell: Im Zentrum dieses Modells stehen Selbstbild und Selbstwertgefühl. Psychische Störungen entstehen, wenn ein Mensch keine kohärente Identität und kein ausreichendes Selbstwertgefühl ausbilden kann (narzisstische Störung). 55Objekt-psychologisches Modell: Als Ob­ jekte werden in der psychoanalytischen ­Terminologie die anderen Menschen bezeichnet. Hier geht es um zwischenmenschliche Beziehungsmuster, die das Erleben und Verhalten steuern. Psychische Störungen entstehen, wenn diese Muster dysfunktional sind. 2.3.5 Abwehrmechanismen >> Eine Möglichkeit des Ichs, mit unbewussten Triebregungen, inneren Konflikten oder un­ erträglichen Gefühlen umzugehen, ist die Abwehr. Abwehrvorgänge halten diese unan­ genehmen Zustände vom bewussten ­Erleben fern, und der Mensch weiß in der ­Regel gar nicht, dass er sich solcher Mechanismen ­bedient, weil auch die Abwehr selbst unbe­ wusst erfolgt. Abwehrvorgänge können bei der Entstehung psy­ chischer Symptome eine Rolle spielen. Sie sind je­ doch nicht per se pathologisch, sondern kommen auch im normalen Alltagsleben (sog. Freudsche Fehlleistungen wie Versprecher) oder bei der psychi­ schen Bewältigung schwerer körperlicher Erkran­ kungen vor. Man unterscheidet eine ganze Reihe von Abwehrmechanismen je nach der Art und Weise, wie unerwünschte Motive oder Gefühle verarbeitet werden (. Tab. 2.2). Verdrängung Verdrängung ist der Prototyp eines Abwehrmechanismus. Verdrängen heißt Vergessen aufgrund unbewusster Motive. Beispiel: »Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz. Und bleibt unerbitt­ lich. Endlich gibt das Gedächtnis nach« (Nietzsche). 38 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle ..Tab. 2.2 Abwehrmechanismen 2 Mechanismus Verdrängung Ausschaltung bestimmter verpönter Motive und Konflikte aus dem bewussten Erleben Verschiebung Verlagerung einer Emotion (z. B. Angst, Wut) von einem bedrohlichen auf ein ungefährliches Objekt (»Prügelknabe«, ein Objekt als Ersatz für ein anderes Objekt) Verleugnung Abwehr der Realität von traumatisierenden Wahrnehmungen – der Gegenstand einer bedrohlichen Wahrnehmung wird als nicht existent angesehen (»Kopf-in-den-Sand-Stecken«) Projektion Verlagerung eigener abgewehrter Wünsche, Impulse, Ängste, Schwächen und Schuld­gefühle in den anderen (»Sündenbock« = Adressat einer Projektion, dient zur Entlastung von Selbstvorwürfen) Spaltung Widersprüchliche Aspekte bzw. Gefühlszustände – z. B. Wahrnehmen von Gut und Böse bei sich oder beim anderen – werden so auseinander gehalten, als beträfen sie verschiedene Personen Identifikation Unbewusste Übernahme von Einstellungen, Verhaltensweisen und Wertmaßstäben einer anderen Person oder Gruppe Reaktionsbildung Aktivierung des entgegengesetzten Impulses (statt Hass übertriebene Freundlichkeit; ­Überkompensation) Rationalisierung Falsche Begründung eines bestimmten Sachverhalts (»Pseudoerklärung«) Isolierung Künstliches Abtrennen der Gefühle vom gedanklichen Inhalt Ungeschehen­ machen Vorausgegangenes nichtakzeptables Handeln soll durch nachfolgendes Handeln aufge­hoben werden Sublimierung Ablenkung sexueller Triebenergie auf ein nichtsexuelles, kulturell oder sozial wertvolles Ziel Konversion Umwandlung von psychischen Konflikten in körperliche Symptome Verschiebung Eine Emotion, die zu äußern einem Angst macht, wie z. B. Wut auf den Chef, der einen gerade kritisiert hat, gegen den man sich aber nicht zur Wehr setzen kann, wird auf ein weniger gefähr­ liches Objekt, wie z. B. einen Arbeitskollegen, der sich das eher gefallen lässt, verschoben. Verleugnung Verleugnung bedeutet das Nicht- Wahrhaben-Wollen einer bedrohlichen Informa­ tion. Sie findet sich häufig nach der Mitteilung einer schwerwiegenden Diagnose. Beispiel: Ein Patient, der gerade von seinem Stationsarzt erfahren hat, dass er an einer unheilbaren Krebskrankheit leidet, beschwert sich kurze Zeit später gegenüber der Sta­ tionsschwester: »In diesem Krankenhaus bekommt man ja eh nicht gesagt, was man hat.« Verleugnung richtet sich also eher nach außen, gegen die bedroh­ liche Realität, Verdrängung mehr nach innen, gegen unbewusste Triebwünsche. Verleugnung ist kein Alles-oder-Nichts-Phä­ nomen. Auch wenn ein Kranker in einem Augen­ blick sich so verhält, als wisse er überhaupt nicht, dass er an Krebs erkrankt ist, kann er in einer ande­ ren Situation, in der er sich emotional unterstützt fühlt, durchaus die Information aus dem Unbe­ wussten »hervorholen«. Verleugnung kann als eine Art Notfall- oder Schutzmechanismus ver­ standen werden, der verhindert, dass der Betroffe­ ne von Angst oder Verzweiflung überschwemmt wird. In einer Situa­tion, in der er sich sicher fühlt, kann er die Verleugnung dann schrittweise wieder zurücknehmen und sich mit der bedrohlichen ­Realität auseinander­setzen. Kurzfristig kann Ver­ leugnung deshalb ganz hilfreich sein. Langfristig kann sie aber dazu führen, dass die Patienten not­ wendige diagnostische und therapeutische Maß­ nahmen unterlassen und sich dadurch selbst ge­ fährden. 39 2.3 · Psychodynamische Modelle >> Verleugnungsprozessen kann man als Ärztin oder Arzt am besten vorbeugen, indem man Informationen schrittweise vermittelt und sich am Informationsbedürfnis des Patienten und seinen Verarbeitungsmöglichkeiten orientiert, um ihn nicht emotional zu überfordern. Projektion Eigene Wünsche, Impulse oder Affekte, die ich mir selbst nicht eingestehen kann, werden anderen zugeschrieben. Man sieht »den Splitter im Auge des anderen, aber nicht den Balken im eigenen Auge«. Der andere fungiert als »Sündenbock« für die eigenen uneingestandenen Schwächen. Beispiel: Eine Patientin, die voll uneingestandener Wut auf ihre Arbeitskollegen ist, beklagt sich, von ihnen ge­ mobbt zu werden. Sie nimmt ihre eigene Aggres­ sivität nicht wahr, ist aber sehr empfindlich für ver­ meintliche Aggressivität der anderen. Spaltung Bei der Spaltung werden widersprüchli­ che Impulse, die eigentlich miteinander unverein­ bar sein müssten, abwechselnd ausgelebt. Die Um­ welt (oder auch die eigene Person) wird entweder schwarz oder weiß wahrgenommen, nicht aber im realistischeren Grauton. Beispiele: Eine Patientin mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, die ihren Partner bis gestern noch für ihre letzte Hoffnung und den einzigen Retter aus ihrem Elend wahrge­ nommen hat, ist aufgrund einer geringfügigen ­Enttäuschung nun der festen Meinung, dass er von Grund auf böse und schuld an ihrem Unglück sei. Ein Patient mit einer narzisstischen Persönlich­ keitsstruktur schwankt vom einen Augenblick zum anderen zwischen Größenideen (»Ich bin der ­Größte!«) und Minderwertigkeitsgefühlen (»Ich bin ein Nichts!«). Spaltungsvorgänge findet man auch bei Patienten, die das Behandlungsteam in die Guten und die Bösen aufteilen, beispielsweise den Stationsarzt idealisieren und die Stationsschwester verteufeln. Identifikation Um Gefühle von Minderwertigkeit abzuwehren, kann man versuchen, sich mit einer berühmten Person zu identifizieren und so sein zu wollen wie diese. Beispiel: Jugendliche, die sich in einer Identitätskrise befinden und sich anziehen wie ihr bewunderter Star. Als Identifikation mit dem Aggressor bezeichnet man eine Abwehrform, bei 2 der man sich aus der Rolle des Opfers in die Rolle des Täters begibt. Dann ist man nicht länger hilflos ausgeliefert, sondern selbst derjenige, der andere angreift. Reaktionsbildung Bei der Reaktionsbildung wird eine Gegenreaktion aktiviert. Anstelle von Aggres­ sivität, die nicht erlaubt ist, zeigt der Betroffene übertriebene Friedfertigkeit. Die dadurch abge­ wehrte Aggressivität wird jedoch für die Umgebung gleichwohl untergründig spürbar, die Freundlich­ keit wirkt gezwungen und unecht. Rationalisierung Diese Abwehrform ist in den ­ lltagssprachgebrauch übergegangen. Man versteht A darunter eine Pseudoerklärung, die anstelle der wahren Motive vorgeschoben wird. Beispiel: Ein Patient mit Lungenkrebs, der an einem Rezidiv ­leidet, macht andere, weniger bedrohliche Gründe für seinen Husten verantwortlich, z. B. einen grip­ palen Infekt. Isolierung Hier werden die mit einem Gedan­ keninhalt normalerweise einhergehenden Gefühle nicht wahrgenommen. Man spricht deshalb auch von Isolierung vom Affekt. Beispiel: Ein lebens­ bedrohlich Erkrankter redet ohne jede gefühls­ mäßige Beteiligung über seine Krankheit, so als ginge es um eine andere Person, nicht aber um ihn selbst. Ungeschehenmachen Es werden Handlungen un­ ternommen, die eine frühere, aber inakzeptable Handlung unwirksam und rückgängig machen ­sollen. Beispiele: Ein Patient mit einer Zwangs­ neurose entwickelt einen Waschzwang, um sich von unbewussten Schuldgefühlen rein zu waschen. Ein Patient nach Herzinfarkt unternimmt Kraft­ proben, um sich zu beweisen, dass er noch »ganz der Alte« ist. Sublimierung Hierunter verstand Freud, dass s­ exuelle Triebenergie in einen anderen »Aggregats­ zustand« überführt und beispielsweise in wissen­ schaftliche oder künstlerische Leistungen um­gesetzt wird. Solche Leistungen kann man selbstverständ­ lich auch aus anderen Gründen als Abwehrprozes­ sen erbringen. 40 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle Konversion Unter Konversion verstand Freud die 2 Umwandlung von psychischen Vorgängen in kör­ perliche Innervationen. Unter einer Konversions­ neurose wurde demnach eine Störung verstanden, bei der körperliche Beschwerden auftreten, die als symbolischer Ausdruck eines unbewussten Kon­ flikts erklärbar sind. Zwei Beispiele: Ein Dirigent hat den unbewussten Impuls, seinen Rivalen anzu­ greifen. Da dieser Impuls inakzeptabel ist, ent­ wickelt er stattdessen eine Lähmung des rechten Arms. Ein Angestellter, der auf eine höhere Position befördert wurde, der er sich unbewusst nicht ge­ wachsen fühlt, entwickelt Schwindelgefühle und Standunsicherheit. Konversionssymptome treten meist in den Be­ reichen der Motorik, Sensibilität und Sinneswahr­ nehmung auf: funktionelle Lähmungen, psycho­ gene Anfälle, die klar von epileptischen Anfällen unterschieden werden können, Sensibilitätsstörun­ gen oder psychogene Sehstörungen. Dabei findet man keinen organischen Befund, der die subjek­ tiven Ausfälle erklären könnte. Heutzutage wird der Begriff Konversionsstörung vor allem auf Symp­ tome im Bereich der Neurologie angewendet, ohne dass man die ursprüngliche Theorie einer Um­ wandlung unbewusster Phantasien in symbolische körperliche Beschwerden durchgehend aufrecht­ erhält. Im ICD-10 werden Konversionsstörungen auch als dissoziative Störungen bezeichnet. Im Begriff Dissoziation kommt zum Ausdruck, dass die Betroffenen kein Wissen davon haben, dass sie ihre Beschwerden durch unbewusste Prozesse selbst er­ zeugen. Eine dissoziative Störung muss von einer Simulation, d. h. dem bewussten Vortäuschen der Beschwerden, abgegrenzt werden. 2.3.6 Primärer und sekundärer ­Krankheitsgewinn Psychische Symptome verursachen Leid. Auf der anderen Seite gehen sie auch mit einer Entlastung für den Kranken einher: Die Konfliktspannung wird durch die Abwehrprozesse abgemildert, und der Betroffene spürt den Konflikt nicht mehr so sehr wie zuvor. Diese innerpsychische Entlastung durch die Krankheit bezeichnet man als primären Krankheitsgewinn. Beispiel: Der oben erwähnte Dirigent mit der Konversionsstörung kann nun in seiner unbewuss­ ten Phantasie nicht mehr in die Situation geraten, seinen Rivalen anzugreifen, da er ja gelähmt ist. Das nimmt Druck von ihm. >> Als sekundären Krankheitsgewinn bezeich­ net man die äußeren Vorteile, die ein Kranker aus seiner Krankheit zieht. Der sekundäre Krankheitsgewinn kann unbeabsichtigt, aber auch bewusst sein. Beispiel: Unser Dirigent muss aufgrund seiner Läh­ mung nicht zur Arbeit gehen und sich damit auch der unangenehmen Konkurrenzsituation am Arbeits­ platz nicht aussetzen. Häufige Formen des s­ ekundären Krankheitsgewinns sind Zuwendung durch den Ehe­ partner (7 Abschn. 2.2.2 »chronische Rückenschmerzen«) sowie Entlastung von Verpflichtungen zu Hau­ se oder bei der Arbeit (Krankschreibung, Frühberen­ tung). Bei manchen Kranken kann der Wunsch, für einen Unfall entschädigt zu werden oder wegen einer chronischen Krankheit eine Rente zu bekommen (Rentenbegehren), so übermächtig werden, dass alle Behandlungsversuche fehlschlagen. 2.3.7 Struktur und Konflikt In der multiaxialen operationalisierten psycho­ dynamischen Diagnostik (OPD), die im Rahmen der psychoanalytisch orientierten Psychotherapie­ verfahren (7 Abschn. 8.2.1) eingesetzt wird, unter­ scheidet man zwischen den Achsen Struktur und Konflikt. Weitere 3 Achsen betreffen Krankheits­ erleben und Behandlungsvoraussetzungen, Bezie­ hungsmuster und die ICD-Diagnose. Struktur Unter der Achse Struktur wird beurteilt, wie gut das Ich seine Funktionen erfüllt. Zu den IchFunktionen gehören eine differenzierte, ganzheit­ liche und realistische Wahrnehmung von sich selbst und anderen Menschen, die Regulierung von Im­ pulsen und Affekten, die Kommunikation mit an­ deren Menschen und das Eingehen stabiler Bezie­ hungen. Wenn diese Funktionen nicht gut erfüllt werden, liegt eine gering integrierte Ich-Struktur vor. Dies ist z. B. bei der Borderline-Persönlichkeits­ störung der Fall. 41 2.4 · Sozialpsychologische Modelle Konflikt Unter der Achse Konflikt wird beurteilt, wie gut es einem Menschen gelingt, einander wider­ strebende Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Ein Konfliktthema lautet beispielsweise »Individua­ tion versus Abhängigkeit«. Hier geht es um Bedürf­ nisse nach Nähe und Zusammensein einerseits, Alleinsein und Distanz andererseits. Manche Men­ schen können diese beiden Bedürfnisse nicht mit­ einander in Einklang bringen und entscheiden sich einseitig für einen der beiden Pole. Die einen stre­ ben enge, harmonische Beziehungen um jeden Preis an; die anderen können sich aus Angst, vereinnahmt zu werden, überhaupt nicht auf eine Beziehung ein­ lassen und kämpfen andauernd um ihre Eigenstän­ digkeit. In der OPD wird eine ganze Reihe weiterer Konfliktthemen beschrieben, z. B. Unterwerfung versus Kontrolle oder Versorgung versus Autarkie. iiVertiefen Dornes M (2001) Der kompetente Säugling. ­Fischer, Frankfurt (gut lesbare Einführung in die Säuglingsforschung) Dornes M (2008) Die Seele des Kindes. Fischer, Frankfurt (sehr verständlich geschriebene Einführung in die psychoanalytische Entwicklungspsychologie) Mertens W (2008) Psychoanalyse. Beck, ­München (gut verständliche Einführung einschließlich neuerer Entwicklungen) 2.4 Sozialpsychologische Modelle H. Faller Lernziele Der Leser soll 55 Intra- und Interrollenkonflikte unterscheiden können, 55 psychische Schutzfaktoren nennen können, 55 die Komponenten der sozialen Unterstützung beschreiben können, 55 die beiden Modelle der Wirkung sozialer ­­Unterstützung (Stress-Puffer-Modell, Haupt­ effektmodell) erläutern können. 2.4.1 2 Psychosoziale Einflüsse auf Gesundheit und Krankheit Soziale Rollen, Normen und Einstellungen können – vermittelt über das Gesundheitsverhalten – die Ge­ sundheit beeinflussen. >> Unter einer sozialen Rolle versteht man die Gesamtheit der Verhaltenserwartungen, die an den Inhaber einer bestimmten Posi­ tion im Netzwerk der sozialen Beziehungen gerichtet werden. Soziale Rollen führen zu einer gewissen Berechen­ barkeit des Verhaltens von Menschen in sozialen Situationen. So kann sich ein Patient normalerweise darauf verlassen, dass er vom Arzt eine Diagnose mitgeteilt bekommt und eine angemessene Be­ handlung erhält. Jeder Mensch ist Inhaber mehrerer Rollen, mit denen er unterschiedlich stark identifi­ ziert ist (Rollenidentifikation) oder zu denen er auch Distanz hält (Rollendistanz). Rollen legen das Verhalten nicht hundertpro­ zentig fest, sondern lassen einen Spielraum für fle­ xibles Verhalten in unterschiedlichen Situationen. Dies kann bis zu einem Konflikt zwischen unter­ schiedlichen Rollenerwartungen gehen. Bestehen unterschiedliche Erwartungen innerhalb einer Rol­ le, spricht man von einem Intrarollenkonflikt. Bei­ spiel: Ein Arzt möchte einerseits seinem Patienten die optimale und notfalls auch kostspielige Therapie zukommen lassen, andererseits sieht er sich durch die Krankenkassen unter Kostendruck gesetzt und möchte deshalb möglichst preiswerte Medikamente verordnen. Wenn konflikthafte Erwartungen zwischen ver­ schiedenen Rollen bestehen, die ein und dieselbe Person innehat, spricht man von einem Interrollen­ konflikt. Beispiel: Eine Krankenhausärztin, die zu­ gleich Mutter eines kleinen Kindes ist, sieht auf der einen Seite die Erwartung an sich gerichtet, auf der Station Überstunden zu machen, um neu aufge­ nommene Patienten zu versorgen, und muss ande­ rerseits ihre Tochter vom Kindergarten abholen. Der Konflikt resultiert hier also aus schwer zu ver­ einbarenden Anforderungen aus der Rolle als Ärz­ tin und der Rolle als Mutter. Arbeitslosigkeit bedeutet den Verlust einer zentralen sozialen Rolle. Sie bringt nicht nur finan­ 42 2 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle zielle Einbußen mit sich, sondern auch den Verlust der wichtigsten Quelle sozialer Anerkennung, den Verlust einer sinnvollen Tätigkeit und eines strukturierten Tagesablaufs. Arbeitslose leiden an vermindertem Selbstwertgefühl, Resignation und Rückzugstendenzen. Sie tragen ein erhöhtes Krank­ heits- und Sterberisiko. Schlafstörungen, depressive und Angststörungen sind häufig. Die Inanspruch­ nahme des medizinischen Versorgungssystems ist erhöht. Am stärksten belastet sind Langzeitarbeits­ lose. Ob Arbeitslosigkeit krank macht (Kausalitäts­ hypothese) oder Krankheit zu Arbeitslosigkeit führt (Selektionshypothese), lässt sich wissenschaftlich bis heute nicht abschließend beantworten. Für die Kausalitätshypothese spricht, dass eine Wiederauf­ nahme der Arbeit auch mit einer Verbesserung des seelischen Befindens einhergeht. Für die Selektions­ hypothese spricht, dass ein Drittel aller Kündigun­ gen krankheitsbedingt erfolgt. Wahrscheinlich spie­ len beide Mechanismen eine Rolle. Soziale Normen Soziale Normen sind Regeln, die sich auf das Verhalten aller Menschen in der Gesell­ schaft beziehen. Verhalten, das von der Norm ­abweicht, wird negativ sanktioniert, um der Norm Geltung zu verschaffen. Normen unterscheiden sich im Grad ihrer Formalisierung und im Ausmaß der Sanktionen. Normen können auch das Gesundheits­ verhalten betreffen. Beispiel: Mit der Safer-Sex-Kam­ pagne im Rahmen der HIV-Prävention wird ver­ sucht, eine Verhaltensnorm zu verändern. Es wird angestrebt, dass die Benutzung eines Kondoms zur Norm beim Geschlechtsverkehr wird. Durch die Än­ derung der Einstellungen in der Öffentlichkeit sollen solche Verhaltensänderungen gefördert werden. Hintergrundinformation Überlegenheit sanktionierender Institutionen In Public-goods-Experimenten erhalten die Mitspieler ein bestimmtes Vermögen und entscheiden dann, wie viel sie davon in einen »öffentlichen Topf« geben, von dem alle umso mehr profitieren, je mehr darin investiert wird. Manche Mitspieler investieren viel, in der Erwartung, dass andere ihrem Beispiel folgen und dadurch der Nutzen für alle am größten wird. Manche hingegen investieren gar nichts und partizi­ pieren lediglich vom öffentlichen Gut (free rider, »Schwarzfahrer«). Wie kann man verhindern, dass wenige Free-Rider alle anderen entmutigen zu kooperieren, so dass das Ausmaß der Investition in das öffentliche Gut auf Null sinkt? Ein Experiment: Die Mitspieler konnten wählen, ob sie einer Institution beitreten wollen, in der es keine Sanktionen gab, oder aber einer anderen, in der unkooperatives Verhalten sanktioniert werden konnte. Jeder erhielt dann 20 Geldein­ heiten und konnte davon so viel er wollte in das öffentliche Gut einbringen. Jedes Gruppenmitglied profitierte gleichermaßen vom öffentlichen Gut, unabhängig vom eigenen Beitrag. Diese Spielanordnung stellt natürlich eine Versuchung dar, selbst nichts abzugeben, aber von den Beiträgen der anderen zu profitieren. Dies führte dazu, dass die Koopera­tion in der sanktionsfreien Gruppe bald gegen Null ging. In der an­ deren Gruppe bestand für jeden die Möglichkeit, »Schwarz­ fahrer« zu bestrafen. Jede Bestrafung kostete das bestrafte Gruppenmitglied 3 Geldeinheiten, war allerdings auch für denjenigen, der die Sanktion ausübte, mit einem Verlust von 1 Geldeinheit verbunden. Bestrafung führte also auch für den, der bestrafte, zunächst zu einem Nachteil. Auch wenn nur ­wenige Teilnehmer unter Inkaufnahme dieses Nachteils für die Einhaltung der Kooperationsnorm sorgten, führte dies binnen kurzem in der sanktionierenden Gruppe zu einem Anstieg der Kooperation, so dass bald über 90 % der Mitspieler hohe Beiträge oder gar ihr ganzes Vermögen investierten (und damit letztlich auch den höchsten Nutzen für sich selbst zogen). Zu Beginn des Spiels hatten sich zwei Drittel der Teilnehmer für die sanktionsfreie Gruppe entschieden, nur ein Drittel für die sanktionierende. Die Teilnehmer hatten jedoch nach jeder Spielrunde die Möglichkeit, in die andere Gruppe zu wechseln. Von Runde zu Runde wechselten immer mehr Teilnehmer in die sanktionierende Gruppe. Diese »Abstimmung mit den Füßen« demonstrierte klar die Überlegenheit einer sanktionierenden Institution, weil eine wechselseitige Kooperation, die auch für jeden Einzelnen den Nutzen maximierte, nur dort realisiert wurde (Gürerk et al. 2006). Einstellungen Unter einer Einstellung versteht man die Bewertung eines konkreten Objekts, z. B. eines bestimmten Gesundheits- oder Sexualverhaltens. Die Psychologie versucht seit langem herauszufin­ den, auf welche Weise Einstellungen und Verhalten am besten verändert werden können. Ein wesent­ liches Ergebnis ist, dass die Änderung von Einstel­ lungen oft nicht ausreicht, auch das Verhalten zu verändern. Zwischen Einstellungen und Verhalten besteht nur ein schwacher Zusammenhang. Die ­effektivste Methode einer Einstellungsänderung ist ironischerweise, zunächst das Verhalten zu ändern. Die Einstellungsänderung folgt dann der Verhal­ tensänderung nach (7 Abschn. 10.4.2). 2.4.2 Psychische Risikound Schutzfaktoren In sozialpsychologischen Modellen werden psy­ chische Risiko- und Schutzfaktoren im Hinblick auf 43 2.4 · Sozialpsychologische Modelle die Krankheitsentstehung untersucht. Als Risikofak­ toren gelten beispielsweise belastende Lebensereig­ nisse, insbesondere Verlusterlebnisse, mangelnde soziale Integration, erlernte Hilflosigkeit und De­ pression (7 Abschn. 4.4.5). Daneben hat die Gesund­ heitspsychologie unter unterschiedlichen Bezeich­ nungen eine Reihe einander ähnlicher Konzepte als sog. Schutzfaktoren beschrieben, die der Entste­ hung von Krankheiten entgegenwirken sollen. Schutzfaktoren 55Internale Kontrollüberzeugung: Überzeugung, durch das eigene Verhalten den ­Gesundheitszustand positiv beeinflussen zu können. 55Selbstwirksamkeit: Überzeugung, ein bestimmtes gesundheitsförderliches Verhalten auch unter widrigen Umständen ausführen zu können (Kompetenzerwartung). 55Dispositioneller Optimismus: Zuversicht, Probleme bewältigen zu können, im Sinne eines Persönlichkeitsmerkmals. 55Hardiness (Robustheit): Gefühl, seine ­Umwelt kontrollieren zu können; Veränderungen als Chance sehen. 55Kohärenzsinn (sense of coherence): Gefühl, dass die Ereignisse des Lebens erklärbar sind (Verstehbarkeit), bewältigt werden können (Bewältigbarkeit) und sich die Bewältigung auch lohnt (Sinnhaftigkeit) (­Salutogenese; 7 Hintergrundinformation »Salutogenese«). Kritik Bei diesen sog. Schutzfaktoren stellt sich zu­ nächst die Frage, ob es sich jeweils um eigenständi­ ge Konstrukte handelt oder diese Eigenschaften nicht vielmehr einen breiten Überlappungsbereich aufweisen. Zum zweiten stellt sich die Frage, ob es sich um von der Gesundheit unabhängige Faktoren handelt, die die Gesundheit beeinflussen, oder eher um Bestandteile der (psychischen) Gesundheit. Dies ist insbesondere dann nicht zu klären, wenn im Rahmen einer Querschnittsstudie zu ein und dem­ selben Messzeitpunkt ein Zusammenhang zwischen einem sog. Schutzfaktor und der psychischen Ge­ sundheit festgestellt wird. Dann lässt sich nicht klä­ 2 ren, was Ursache und was Folge ist, ob Optimismus zu Wohlbefinden führt oder Wohlbefinden zu ­Optimismus oder beides Teilkomponenten psychi­ scher Gesundheit sind. Günstiger als beim Konzept der Salutogenese (7 Hintergrundinformation »Salutogenese«) sieht die Forschungslage bei internaler Kontrollüberzeu­ gung, dispositionellem Optimismus und Selbst­ wirksamkeit aus. Hier existieren Längsschnittunter­ suchungen, die zeigen, dass eine hohe Ausprägung auf den genannten Variablen förderlich für eine aktive Krankheitsbewältigung und das Gesund­ heitsverhalten ist. Teilweise ließen sich sogar posi­ tive Effekte in Bezug auf den körperlichen Krank­ heitsverlauf, z. B. die Rekonvaleszenz nach Opera­ tionen, nachweisen. Hintergrundinformation Salutogenese Das Modell der Salutogenese geht auf den amerikanischisraelischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky zurück. Er sieht Krankheit und Gesundheit als 2 Pole einer Dimension und versucht, Faktoren zu identifizieren, die ein Individuum in Richtung auf den Pol Gesundheit bewegen, d. h. der Gesundheitsförderung (statt der Vermeidung von Krankheit) dienen. Als gesundheitsförderlichen Faktor hat Antonovsky das sog. Kohärenzgefühl (sense of coherence), d. h. ein Gefühl von Stimmigkeit, beschrieben. Es setzt sich aus 3 Komponenten zusammen: 55 dem Gefühl, dass die Anforderungen des Lebens nicht willkürlich und zufällig, sondern vorhersehbar und erklärbar sind (Verstehbarkeit), 55 dem Gefühl, dass ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen, diesen Anforderungen gerecht zu werden und die Schwierigkeiten zu lösen (Bewältigbarkeit), 55 dem Gefühl, dass es sich auch lohnt, sich zu engagieren und Energie zu investieren (Sinnhaftigkeit). In den vorliegenden Studien fanden sich positive Korrelationen mit psychischer Gesundheit sowie negative Zusammenhänge mit Ängstlichkeit und Depressivität oder Stress. Aber diese Zusammenhänge gehen lediglich auf Querschnitts­ studien zurück, so dass die Frage von Ursache oder Folge ­offen bleiben muss. Mit körperlichen Erkrankungen oder auch dem Gesundheitsverhalten konnten bisher nur wenige und zudem inkonsistente Zusammenhänge gefunden werden. Deshalb muss das Modell gegenwärtig als noch nicht ausreichend bestätigt angesehen werden, so dass vor un­ realistischen Erwartungen gewarnt wird. Es wird gleichwohl oft in einem ideologischen, gesundheitspolitischen Kontext verwendet, um Maßnahmen zur Gesundheitsförderung zu begründen. 2 44 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle 2.4.3 Soziale Unterstützung >> Soziale Unterstützung (syn. sozialer Rück­ halt) ist die hilfreiche Interaktion mit einem anderen Menschen bei der Bewältigung ­eines Problems. Komponenten der sozialen Unterstützung 55Emotionale Unterstützung: verständnisvolle Zuwendung, Trost, Ermutigung 55Instrumentelle Unterstützung: praktische Hilfe, finanzielle Unterstützung, Hilfe bei täglichen Arbeiten 55Informationelle Unterstützung: Informa­ tionsvermittlung, Rat, Anleitung 55Bewertungsunterstützung: Übereinstimmung in Wertvorstellungen und Meinungen Oft wird nur die vom Betroffenen wahrgenomme­ ne Unterstützung erforscht, also sein persönliches Erleben, wie gut er sich von anderen Menschen ­unterstützt fühlt, nicht die tatsächlich erhaltene ­Unterstützung. Wahrgenommene Unterstützung ist aber auch von der Bewertung durch die jeweilige Person abhängig. Bei depressiven Menschen ist bei­ spielsweise das Gefühl, gemocht zu werden, gerin­ ger ausgeprägt als bei Gesunden. Wahrgenommene Unterstützung ist eine relativ stabile Erwartung, ein Persönlichkeitsmerkmal. Wahrgenommene und erhaltene Unterstützung überlappen sich kaum. Soziale Integration Von der funktionellen sozia­ len Unterstützung lässt sich die soziale Integration abgrenzen, d. h. die Integration in ein Netzwerk von sozialen Beziehungen (strukturelle Unterstüt­ zung). Sie hat eine Verhaltenskomponente – das aktive Engagement in einem breiten Spektrum ­ sozia­ler Aktivitäten und Beziehungen – und eine ­kognitive Komponente – ein Gefühl der Zugehörig­ keit und Identifikation mit sozialen Rollen. Gegen­ pol ist die soziale Isolation. Geschlechtsunterschiede Schon kleine Mädchen haben mehr Freundinnen als Jungen Freunde. ­Frauen haben zeitlebens engere und größere soziale Netzwerke. Sie bieten anderen mehr Unterstützung an und erhalten auch selbst mehr Hilfe. Sowohl Frauen als auch Männer profitieren mehr von weib­ licher Unterstützung als von männlicher. In einer Laborstudie profitierten Männer unter Stress von verbaler Zuwendung durch ihre Frauen, nicht aber umgekehrt. Frauen profitierten hingegen von nonverbaler Zuwendung (Berührung) durch ihre Männer. Die Wirkung sozialer Unterstützung wird durch Oxytozin vermittelt. Hierfür sprechen experimen­ telle Befunde, die zeigen, dass die Gabe von Oxyto­ zin die Wirkung sozialer Unterstützung verstärkt. Umgekehrt profitieren manche Männer, die eine be­ stimmte Variante des Oxytozinrezeptorgens tragen, weniger von sozialer Unterstützung. Mög­licherweise trägt die bessere Verfügbarkeit von Oxytozin zur besseren sozialen Einbindung von Frauen bei. Oxy­ tozin hat die ursprüngliche Funktion, die MutterKind-Beziehung zu fördern (7 Abschn. 4.4.5). In der Evolution hat sich dies als förderlich dafür erwiesen, dass Mütter ihren Nachwuchs besser vor Gefahren schützen können. Kinder lernen im Laufe ihrer Ent­ wicklung, dass die Mutter ihnen Sicherheit ver­ mittelt. Dieses Sicherheitslernen bildet die Grund­ lage für die stressmildernde Wirkung von sozialer Unterstützung durch andere Bezugspersonen im weiteren Lauf des Lebens. Gesundheitsförderliche Effekte Soziale Unterstüt­ zung und soziale Integration wirken gesundheits­ förderlich und schützen vor Krankheit. Auch bei schon bestehender Krankheit fördern sie einen günstigen Verlauf. So hatten beispielsweise Herz­ infarktpatienten nach einer Bypass-Operation einen schnelleren Genesungsverlauf, wenn sie ­ sozia­le Unterstützung erfuhren (Besuche vom Ehe­ partner). Soziale Unterstützung fördert die Immu­ nabwehr und die Wundheilung. Das Mortalitäts­ risiko bei einer koronaren Herzkrankheit ist ge­ ringer bei gut unterstützten Patienten. Verheiratete Krebspatienten erhalten häufiger die notwendige Therapie und haben eine geringere Sterblichkeit als unverheiratete Krebspatienten. Allerdings schei­ nen die positiven Effekte sozialer Integration bei Männern etwas stärker ausgeprägt zu sein als bei Frauen. Für die gesundheitsprotektiven Effekte sozialer Unterstützung werden 2 Wirkmechanismen unter­ 45 2.4 · Sozialpsychologische Modelle schieden: das Stress-Puffer-Modell und das Haupt­ effektmodell. >> Das Stress-Puffer-Modell besagt, dass die Wirkungen von Stress durch soziale Unter­ stützung abgemildert (abgepuffert) werden. Stress ist nicht mehr so schlimm, wenn man über­ zeugt ist, dass es jemanden gibt, der einem bei der Bewältigung hilft. Die belastende Situation er­ scheint dann weniger schwierig zu bewältigen, emotionale und physiologische Reaktionen sind abgeschwächt. Beispiel: In einer Längsschnittunter­ suchung mit gesunden schwedischen Männern im Alter von 50 Jahren oder älter besaßen diejenigen Studienteilnehmer, die im Jahr zuvor viele belasten­ de Lebensereignisse erlitten hatten, in der Folgezeit ein höheres Risiko zu versterben. Dieses Risiko war jedoch bei denjenigen Männern abgeschwächt, die ein hohes Maß an emotionaler Unterstützung zur Verfügung hatten. Hier handelt es sich um einen typischen Interaktionseffekt (7 Abschn. 3.4.1): Der Zusammenhang zwischen Stress und Krankheit wird durch das Vorhandensein eines 3. Faktors, nämlich die soziale Unterstützung, abgeschwächt. Der Stress-Puffer-Effekt wird möglicherweise über verminderte negative Emotionen vermittelt. Negative Emotionen wie Angst und Depression wer­ den durch emotionale Zuwendung abgeschwächt. Dadurch vermindern sich entzündungsfördernde Botenstoffe (proinflammatorische Zytokine), wäh­ rend stressmildernde Peptidhormone wie Oxytozin und Endorphine ansteigen. >> Das Haupteffektmodell besagt, dass soziale Unterstützung generell günstig ist, unab­ hängig davon, ob sich jemand in Stress befin­ det oder nicht. Das Haupteffektmodell scheint insbesondere für die soziale Integration zu gelten. Eine große Zahl von Studien hat in konsistenter Weise den Zusammen­ hang zwischen guter sozialer Integration und Ge­ sundheit bestätigt. Gesunde Erwachsene, die sozial besser integriert sind, d. h. verheiratet sind, in Fa­ milien leben oder viele Freunde haben, haben eine geringere Sterblichkeit. Dies gilt auch in Bezug auf die Sterblichkeit in Folge spezifischer Erkrankun­ gen, wie Herzerkrankungen und Krebs, ebenso wie für die Anfälligkeit für virale Infekte oder auch den 2 kognitiven Abbau im Alter. Wie groß das Netzwerk ist, spielt dabei eine geringere Rolle. Vielmehr ist es wichtig, wie sehr man sich verbunden fühlt, also qualitative Kriterien. Diese Wirkung wird wahr­ scheinlich über das Gesundheitsverhalten ver­mittelt. Menschen, die in einem sozialen Netzwerk ver­ bunden sind, stehen unter stärkerer sozialer Kon­ trolle im Hinblick auf normgerechtes Gesundheits­ verhalten. Die Bezugsgruppe, in die man einge­ bunden ist, gibt einem eine Norm vor, wie man sich verhalten soll, um »dazu zu gehören« bzw. aner­ kannt zu werden (soziale Regulation). Die wichtigs­ te Bezugsgruppe ist zumeist die Familie. Die Ehe­ frau sorgt beispielsweise dafür, dass ihr Mann nicht so viel raucht und trinkt, sich gesund ernährt und Sport treibt. Am wichtigsten scheint dabei zu sein, dass sie ihn ermutigt und ihm versichert, dass sie es ihm zutraut, ein bestimmtes Gesundheitsver­ halten (z. B. regelmäßig zu trainieren) auszuüben. Dadurch wird seine Selbstwirksamkeit gestärkt, und es fällt ihm leichter, mit dem Training anzu­ fangen. Wenn er einmal damit begonnen hat, würde ohne den kontinuierlichen Ansporn womöglich das Risiko steigen, dass er seine sportliche Aktivität ­wieder aufgibt und in eine passive Lebensweise zu­ rückfällt. So aber entwickelt er ein Gefühl der Ver­ antwortung für sich selbst und seine Familie. Umgekehrt sind Verlusterlebnisse, Einsamkeit oder konflikthafte soziale Beziehungen mit einem erhöhten Krankheitsrisiko verbunden. Geringe so­ ziale Unterstützung und Integration begünstigen die Entwicklung einer Depression. Diese ist selbst wiederum ein Risikofaktor für die koronare Herz­ krankheit. iiVertiefen Knoll N, Scholz U, Rieckmann N (2013) Einführung Gesundheitspsychologie. 3. Aufl. Reinhardt, München (guter Einstieg in die Thematik) 2 46 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle 2.5 Soziologische Modelle H. Faller Lernziele Der Leser soll 55 die 3 Indikatoren der sozialen Schicht nennen können, 55 den sozialen Gradienten der Gesundheit beschreiben können, 55 Modelle zur Erklärung des sozialen Gradienten der Gesundheit erläutern können. 2.5.1 Einflüsse der gesellschaftlichen Opportunitätsstruktur Soziologische Modelle befassen sich mit dem Ein­ fluss von Merkmalen der Sozialstruktur auf Gesund­ heit und Krankheit. Innerhalb einer Gesellschaft sind die Chancen, z. B. für Bildung als Vorausset­ zung des Gesundheitsverhaltens, ungleich verteilt. Der Zugang zu den gesellschaftlichen Ressourcen, wie Bildung, Arbeit und soziale Integration, wird als soziale Opportunitätsstruktur bezeichnet. Der wichtigste zusammenfassende Indikator der Oppor­ tunitätsstruktur ist die soziale Schichtung. >> Die soziale Schicht (syn. sozioökonomischer Status) wird anhand von 3 Merkmalen ­bestimmt (sog. meritokratische Triade): 55Bildung 55Beruf 55Einkommen Im Begriff »meritokratisch« wird zum Ausdruck gebracht, dass der soziale Status durch Leistung »verdient« wurde. Gesundheitliche Ungleichheit Der sozioökonomi­ sche Status steht mit der Sterblichkeit (Mortalität) und der Krankheitshäufigkeit (Morbidität) in Zu­ sammenhang. Beispiele: Erwachsene ohne Abitur haben eine kürzere Lebenserwartung als Erwachse­ ne mit Abitur. Die Differenz beträgt bei Männern 3 Jahre und bei Frauen 4 Jahre. Zwar steigt die Le­ benserwartung auch in den unteren Schichten, aber nicht so schnell wie in den oberen Schichten, so dass der Unterschied größer wird. Säuglings- und Kindersterblichkeit sind in der Unterschicht höher, stationäre Behandlungen wegen Infektionskrank­ heiten dauern bei Unterschichtkindern länger, ihr Zahnstatus ist schlechter. Menschen mit Hauptoder Realschulabschluss erleiden häufiger einen Herzinfarkt als Abiturienten. Für viele andere Krankheiten ließ sich eine solche soziale Ungleich­ heit ebenfalls belegen. Auch psychische Störungen, wie Angststörungen, Depression, Substanzmiss­ brauch und Persönlichkeitsstörungen, sind bei Per­ sonen mit niedrigerem sozialen Status häufiger. Die wenigen Ausnahmen von diesem Muster sind Brustkrebs, Asthma, Allergien und Neurodermitis. Für die Entstehung dieser Krankheiten spielen die weiter unten beschriebenen Einflussfaktoren wie Gesundheitsverhalten und Stress offensichtlich eine geringere Rolle. Meist findet sich ein sozialer Gradient mit linear abgestuften Risiken je nach den Schichtstufen. Die­ ser soziale Gradient zeigt sich während der ganzen Lebensspanne, nimmt im Alter jedoch ab. Schon die Schichtzugehörigkeit als Kind sagt gesundheitliche Unterschiede im Erwachsenenalter voraus. Die mit niedriger Schicht verbundenen gesundheitlichen ­Risikofaktoren werden also schon sehr früh ange­ legt. Selbst ein überwiegend genetisch beeinflusstes Merkmal wie die Körpergröße zeigt einen Schicht­ gradienten. Männer der Unterschicht sind 5 cm ­kleiner als Männer der Oberschicht. Bei Frauen be­ trägt der Unterschied 3,5 cm. Erklärungsmodelle In der Soziologie werden haupt­ sächlich 2 Erklärungsmodelle diskutiert: sozia­le Verursachung (schlagwortartig formuliert: »Armut macht krank.«) und sozialer Abstieg (schlagwort­ artig: »Krankheit macht arm.«). Für das Modell des sozialen Abstiegs, auch Drift-Hypothese genannt, finden sich Hinweise bei psychischen Störungen, wie der Schizophrenie (7 Abschn. 4.10.4) oder bei Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit den ­Arbeitsplatz verloren haben. Häufiger wird jedoch das Modell der sozialen Verursachung für relevant erachtet. Als Einflussfaktoren gelten sowohl mate­ rielle Lebensbedingungen als auch psychosoziale und Verhaltensfaktoren, die in den unteren sozialen Schichten ungünstiger ausgeprägt sind. Die medizi­ nische Versorgung spielt demgegenüber eine geringe Rolle. 47 2.5 · Soziologische Modelle Krankheitsförderliche Faktoren bei niedrigerem sozialem Status 55Unhygienische oder beengte Wohnverhält­ nisse, Lärm, Luftverschmutzung: Diese mit ungünstigen Lebensverhältnissen verbundene Benachteiligung wird strukturelle oder materielle Deprivation genannt. 55Physische und psychische Arbeitsbelas­ tungen: schwere körperliche Arbeit, Lärm, Eintönigkeit, geringe Möglichkeit des Mitentscheidens, weniger Anerkennung (7 Abschn. 4.8.3 »Anforderungs-Kontrollmodell«, »Gratifikationsmodell«). 55Ungünstiges Gesundheitsverhalten: ­Zigarettenrauchen, ungesunde Ernährung, geringere körperliche Aktivität, deshalb größere Verbreitung der Risikofaktoren für Krankheiten. 55Geringere Nutzung von Gesundheitsange­ boten: seltenere Teilnahme an Präventionsmaßnahmen, geringere Inanspruchnahme medizinischer Leistungen. 55Psychosoziale Risikofaktoren: mehr Stress (höhere Sekretion von Adrenalin, Noradrenalin, Kortisol), geringere Stressbewältigungsressourcen, weniger unterstützende soziale Netzwerke, mehr negative Emotionen (Angst, Depression). Starkes Übergewicht (Adipositas) und Bewe­ gungsmangel kommen bei Menschen mit ge­ ringerer ­Bildung häufiger vor. Auch das Zigaretten­ rauchen ist in den unteren Schichten deutlich ­stärker verbreitet. Rauchen wiederum ist der wich­ tigste ein­ zelne Risikofaktor für die Entstehung einer Vielzahl von Krankheiten, insbesondere von Herz-Kreislauf-Krankheiten (Herzinfarkt, Schlag­ anfall) und Krebserkrankungen (Lungenkrebs, viele andere Tumor­arten). In der Pathogenese der koronaren Herzkrankheit spielen entzündliche ­Prozesse eine Rolle. In der unteren Schicht finden sich höhere Werte für Entzündungsindikatoren (­Interleukin 6, C-reak­tives Protein). Dies könnte zur Risikoerhöhung beitragen. Schon im Kindes­ alter zeigt sich eine entzündungsförderliche Gen­ expression.­ 2 Auch Persönlichkeitseigenschaften können eine Rolle als Verursacher spielen. Gewissenhaftigkeit ist neben Intelligenz der beste Prädiktor des Bildungs­ niveaus, aber auch des Gesundheitsverhaltens. Niedriger sozioökonomischer Status und ungünsti­ ges Gesundheitsverhalten könnten die gemeinsame Folge einer niedrigen Ausprägung dieses Persön­ lichkeitsmerkmals sein. Gesundheitspolitische Maßnahmen versuchen, gesundheitliche Chancengleichheit herbeizufüh­ ren. Sie sind jedoch bisher nicht sehr erfolgreich gewesen (7 Abschn. 11.1.4). 2.5.2 Einflüsse ökonomischer und ökologischer Umweltfaktoren Soziologische Modelle betrachten nicht nur die so­ ziale Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft, sondern vergleichen auch unterschiedliche Gesell­ schaften miteinander, um Hinweise auf ökonomi­ sche und ökologische Umwelteinflüsse zu erhalten. Gesellschaften unterscheiden sich im Hinblick auf das Ausmaß der Industrialisierung (Industrie- vs. Entwicklungsländer), Urbanisierung (Anteil der Bevölkerung, der in Städten vs. auf dem Land lebt) und der Teilnahme an den Welthandelsbeziehun­ gen (Globalisierung). Industrialisierung Sowohl innerhalb der Industrie­ länder als auch weltweit lässt sich in den letzten Jahr­ zehnten eine Zunahme des Wohlstands konstatie­ ren. So hat sich im 20. Jahrhundert der durchschnitt­ liche Lebensstandard in Westeuropa zumindest verzehnfacht. In der Bundesrepublik Deutschland als Beispiel für ein Industrieland kann dies daran ­illustriert werden, wie lange ein Arbeiter im produ­ zierenden Gewerbe durchschnittlich arbeiten muss, um ein bestimmtes Produkt erwerben zu können. Um eine Waschmaschine zu kaufen, musste ein ­Arbeiter im Jahr 2012 3 Tage arbeiten, im Jahr 1960 waren dazu noch 27 Tage erforderlich, für ein Fern­ sehgerät im Jahr 2012 4 Tage, 1960 noch 42 Tage. Auch die Kosten für Nahrungsmittel sanken relativ: Für 1 Liter Milch waren im Jahr 2012 3 Minuten ­Arbeitszeit aufzuwenden (1960 10 Minuten), für 1 Kilogramm Brot 2012 10 Minuten (1960 19 Minu­ ten). Sehr stark sanken insbesondere die Kosten für 48 2 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle Mobilität (z. B. Flugreisen) oder Kommunikation (z. B. Telefongespräche). Die Zunahme des Wohl­ stands hat eine größere individuelle Freiheit mit sich gebracht. Dies zeigt sich in folgenden Punkten. Folgen des Wohlstands für die Lebens­ gestaltung 55Eigener Haushalt: Menschen leben seltener in einer Großfamilie zusammen. Sie entziehen sich dadurch der sozialen Kontrolle und der Notwendigkeit, auf andere Rücksicht zu nehmen. Dies geht nur, weil das günstigere Wirtschaften, das eine Großfamilie erlaubt, heutzutage nicht mehr ins Gewicht fällt. 55Arbeitszeitverkürzung: Die effektive Jahresarbeitszeit hat sich in den letzten 100 Jahren halbiert. Dadurch bleibt mehr Zeit für die individuelle Lebensgestaltung. 55Wahl des Wohnorts: Individuelle Mobilität und Freiheit bei der Wahl des Wohnorts ­haben zugenommen (zu nachteiligen Folgen der Mobilität auf die Familiengründung 7 Abschn. 4.9.4). 55Emanzipation der Frau: Die Freiheiten von Frauen hinsichtlich Berufstätigkeit, Wahl des Partners, Reversibilität der Partnerwahl (Scheidung) als Folge der finanziellen Unabhängigkeit haben zugenommen. Zeitbudget Generell kann eine Zunahme der Frei­ zeit konstatiert werden, die sich von 1900 bis heute verdoppelt hat, und dies auch noch vor dem Hinter­ grund einer Zunahme der Lebenszeit um mehr als die Hälfte. Während der Anteil der Arbeitszeit von 34 % auf 9 % zurückging und der Anteil für die Be­ friedigung der Grundbedürfnisse (Essen, Schlafen) mit 41 % bzw. 40 % konstant blieb, stieg der Anteil der Freizeit von 25 % auf 51 % an. Armut Zwischen 1990 und 2010 hat sich die Zahl der Armen weltweit halbiert. Seitdem lebt rund 1 Mrd. Menschen weniger unter Armut und Hun­ ger. Ursache dafür ist das zunehmende wirtschaft­ liche Wachstum in den Entwicklungsländern. Vor der industriellen Revolution kämpften die Men­ schen weltweit mit Armut und Hunger. Doch auch heute gibt es noch viele Länder, in denen große ­Armut herrscht. Einer der Gründe, weshalb die ar­ men Länder kein ausreichendes Wirtschaftswachs­ tum erzielen, sind Infektionskrankheiten, wie Mala­ ria und Aids. Diese könnten mit mehr Hilfe durch die entwickelten Länder erfolgreicher bekämpft wer­ den. Weitere Gründe von Armut sind geographische Nachteile (z. B. fehlende Häfen), fehlende Infra­ struktur (z. B. Trinkwasser, Elektrizität, S­ traßen), politische Fehlentwicklungen (z. B. Korruption), Handelsschranken, Überschuldung, zu wenig Fi­ nanzmittel (z. B. für den Kauf von Dünger), eine zu hohe Geburtenziffer (sog. demographische Falle), fehlende Schulbildungsangebote, fehlende Gesund­ heitsversorgung, Diskriminierung der Frauen oder ethnischer Minderheiten, Kriege und Bürgerkriege. Der wichtigste Grund ist das Versagen der Regierun­ gen, das sich in Korruption und fehlender Rechts­ staatlichkeit äußert. Nur 5 % der knapp 50 Länder Schwarzafrikas sind liberale Demokratien. Die klas­ sische Entwicklungshilfe ist insbesondere deshalb gescheitert, weil den Empfängerländern die Institu­ tionen fehlen, die dafür sorgen, dass die Gelder zweckentsprechend verwendet werden. Urbanisierung Während in den Industrieländern die Kernstädte schon wieder schrumpfen, nimmt in den Entwicklungsländern die Migration vom Land in die großen Städte immer mehr zu. Mega­ städte entstehen, der Anteil der Weltbevölkerung, der in Städten lebt, wächst. Menschen flüchten vom Land wegen zu geringer Erträge der Landwirt­ schaft, U ­ mweltzerstörung oder vor Bürgerkriegen. Sie erhoffen sich vom Leben in der Stadt bessere ­Arbeitsmöglichkeiten, Zugang zu Bildung, Woh­ nung und Gesundheitsversorgung und bessere ­Infrastruktur. Diese Hoffnungen erfüllen sich nicht für alle. In Schwarzafrika, Mittel- und Südasien ­leben 50 % der Stadtbewohner in Slums, in Süd­ amerika 30 %. Pilotprojekte streben an, die Woh­ nungssituation zu verbessern. Slumbewohner erhal­ ten Grundeigentum als Anreiz dafür, angemessene Wohnungen zu bauen. Zugleich soll eine funktionie­ rende Infrastruktur geschaffen werden. Insgesamt geht Urbanisierung mit wirtschaftlicher Entwick­ lung, Zunahme des durchschnittlichen Pro-KopfEinkommens und Abnahme der Geburtenrate ein­ her (7 Abschn. 4.9.4). 49 2.5 · Soziologische Modelle Globalisierung Als Ursache des zunehmenden Wohlstands wird die Steigerung der Produktivität in Folge von internationaler Arbeitsteilung angesehen. Länder können sich auf diejenigen Produkte spezi­ alisieren, die sie besonders gut und kostengünstig herstellen können. Beide Partner eines Handels­ austausches profitieren davon. Für Industrieländer bedeutet dies die Chance, sach- und humankapital­ intensive Produkte zu exportieren und lohnintensiv hergestellte Produkte billiger zu erwerben, die in ehemaligen Entwicklungsländern kostengünstiger hergestellt werden können. Damit einher geht je­ doch auch das Risiko, dass ineffiziente Arbeitsplät­ ze, bei denen die Lohnkosten die Produktivität übersteigen, verloren gehen. Für die Entwicklungs­ länder bedeutet Globalisierung vor allem Abbau der Handelsbeschränkungen, Öffnung der Märkte der Industrienationen für die Produkte der Ent­ wicklungsländer und Investitionen internationaler Unternehmen, die vor Ort Arbeitsplätze schaffen. Für alle Nationen bedeutet Globalisierung poten­ ziell die Förderung von Demokratie und der univer­ sellen Geltung der Menschenrechte. Es lässt sich empirisch zeigen, dass der Wohl­ stand eines Landes, gemessen am Bruttoinlands­ produkt pro Person, umso größer ist, je größer die wirtschaftliche Freiheit in diesem Land ist, gemes­ sen an Indikatoren wie dem geringen Einfluss des Staates auf die Wirtschaft, freien Außenhandels­ beziehungen, einer stabilen Währung, Rechtssicher­ heit, Schutz des Eigentums und einer niedrigen Regulierungsdichte, z. B. am Arbeitsmarkt. Entwicklung hat auch psychologische Auswir­ kungen. Je höher der Entwicklungsstand einer Ge­ sellschaft, gemessen an Lebensstandard, Bildungs­ niveau und Lebenserwartung, desto zufriedener und glücklicher sind die Menschen und desto ge­ ringer ist die Selbstmordrate. Damit muss die weit verbreitete These, dass die Modernisierung der Ge­ sellschaft Unglück und Unzufriedenheit mit sich bringt, in Frage gestellt werden. 2 Einflussfaktoren gesellschaftlicher ­Strukturen auf Gesundheit 55Das Ausmaß der Einkommensungleichheit (Gini-Koeffizient) innerhalb einer Gesellschaft (je geringer, desto günstiger). Neuere Studien auf breiterer Datenbasis konnten diesen Zusammenhang allerdings nicht bestätigen. Wenn überhaupt vorhanden, ist der Effekt sehr klein. 55Das Ausmaß der gegenseitigen Verbun­ denheit der Mitglieder einer Gesellschaft (soziale Kohäsion). 55Das Ausmaß des Vertrauens, das man seiner gesellschaftlichen Umwelt entgegenbringt (soziales Kapital). Lebenserwartung Infolge der Verbesserung der Le­ bens- und Ernährungsbedingungen (ausreichende Ernährung, sauberes Trinkwasser, hygienische Wohnungen) ist es in den letzten hundert Jahren zu einer kontinuierlichen Zunahme der Lebenser­ wartung gekommen (7 Abschn. 4.9). Noch immer besteht jedoch eine starke Diskrepanz zwischen der Lebenserwartung in Industrieländern und in Ent­ wicklungsländern. Auch die Körpergröße, ein stark genetisch bedingtes Merkmal, nahm in den vergan­ genen Jahrzehnten kontinuierlich zu, wahrschein­ lich als Folge verbesserter Ernährungsbedingungen. Selbst in einem so kurzen Zeitraum wie 10 Jahren konnte ein derartiger Effekt nachgewiesen werden: Rekruten aus der ehemaligen DDR erreichten ­binnen 10 Jahren nach der Wende die Größe ihrer westdeutschen Altersgenossen, denen sie zuvor kör­ pergrößenmäßig um 2 cm unterlegen waren. Wohlstandskrankheiten Mit der Industrialisierung und den damit einhergehenden verbesserten Le­ bensbedingungen nahmen insbesondere Infek­ tionskrankheiten stark ab. Die Industrialisierung hat jedoch ihren Preis: die sog. Wohlstandskrankheiten, die durch das Gesundheitsverhalten mitbedingt sind. Hier sind vor allem Herz-Kreislauf-Erkran­ kungen anzuführen. Risikofaktoren der koronaren Herzkrankheit und des Schlaganfalls sind Zigaret­ tenrauchen, arterielle Hypertonie (Bluthoch­druck), Hypercholesterinämie (erhöhte Blutfettwerte) und 50 2 Kapitel 2 · Gesundheits- und Krankheitsmodelle Hyperglykämie (Diabetes mellitus). Diese Risiko­ faktoren sind ganz überwiegend vom Verhalten ab­ hängig (Zigarettenrauchen, zu wenig körperliche Aktivität, Über- und Fehlernährung). Dass Überge­ wicht eine Folge des Lebensstils ist, lässt sich anhand einer Studie mit Immigranten zeigen. Einwanderer in die USA im 1. Jahr nach der Einwanderung waren zu 8 % übergewichtig, im Unterschied zu 22 % der Amerikaner. Aber nach 15 Jahren waren die Ein­ wanderer inzwischen fast genauso häufig überge­ wichtig (19 %) wie die Einheimischen. Soziale Instabilität Eine soziologische Theorie be­ sagt, dass soziale Instabilität (Anomie) die Suizid­ rate fördert (Emile Durkheim). Ein Beispiel ist der Verlauf der Suizidrate des russischen Bevölke­ rungsanteils in Estland während des Unabhängig­ keitsprozesses. Während die russischen Einwohner Estlands zu Zeiten der Sowjetunion, als sie noch privilegiert waren, eine niedrigere Suizidrate auf­ wiesen als die Esten, stieg die Suizidrate während des Verlusts ihrer privilegierten Position auf Werte über diejenigen der Esten (und auch der Russen in Russland). Soziale Veränderungen sind jedoch nicht per se negativ. So konnte in den neuen Bundesländern, wo sich nach der Wende erhebliche soziale Veränderun­ gen – zwar meist positiver, aber z. T. auch negativer Art, wie Anstieg der Arbeitslosigkeit – voll­zogen, eine Abnahme der Suizidrate festgestellt werden. ­Suizide erfolgen oft im Rahmen einer psychischen Störung, insbesondere einer Depression. Durch die bessere Erkennung und Behandlung e­ iner Depres­ sion kann dementsprechend die Suizidrate gesenkt werden. Dies ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass in der ehemaligen DDR nach der Wende die Suizidrate abnahm und auf das niedrigere Niveau der alten Bundesrepublik fiel. In der DDR durfte zu­ vor über Depression und Suizid nicht gesprochen werden, weil es nicht mit der sozialistischen Ideo­ logie vereinbar war. Nachdem dieses Tabu aufge­ brochen worden war, konnten entsprechende dia­ gnostische und therapeutische Maßnahmen einge­ leitet werden, mit dem Ergebnis einer besseren Be­ handlung der Depression und einer niedrigeren Suizidrate. Gegenwärtig ist die Prävalenz psychischer Stö­ rungen in Ost- und Westdeutschland gleich hoch. Dies spricht gegen starke regionale oder gesell­ schaftliche Einflüsse auf die Entstehung psychischer Störungen. Die Schizophrenie tritt beispielsweise weltweit in allen untersuchten Ländern mit einer ungefähr gleich hohen Lebenszeitprävalenz von 1 % auf, was gegen einen starken ökonomischen oder ökologischen Einfluss spricht. iiVertiefen Mielck A (2005) Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Huber, Bern (zusammenfassende Darstellung der empirischen Befunde zur Schicht­ abhängigkeit von Gesundheitsindikatoren) Schwartz FW, Walter U, Siegrist J, Kolip P, Leidl R, Dierks ML, Busse R, Schneider N (Hrsg) (2012) Public Health. Gesundheit und Gesundheits­ wesen. 3. Aufl. Urban u. Fischer, München (umfassende, handbuchartige Übersicht) Siegrist J (2005) Medizinische Soziologie, 6. Aufl. Urban & Fischer, München (viele Beispiele zu ­sozialer Ungleichheit und Krankheit) http://www.springer.com/978-3-662-46614-8