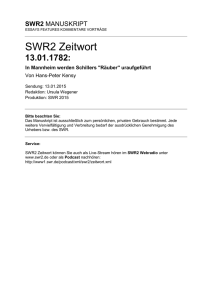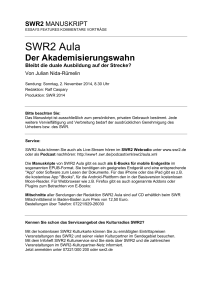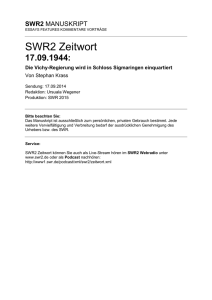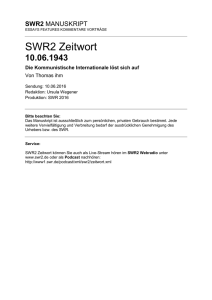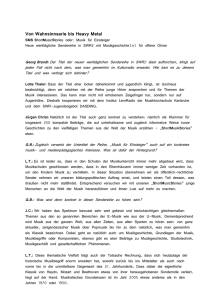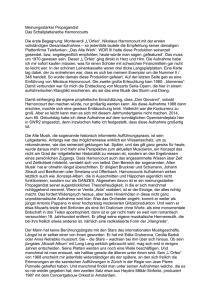Was politische Parteien sein könnten
Werbung

SÜDWESTRUNDFUNK SWR2 AULA – Manuskriptdienst Was politische Parteien sein könnten Ein Plädoyer, das die Piraten fest im Blick hat Autor und Sprecher: Dr. Felix Heidenreich * Redaktion: Ralf Caspary Sendung: Sonntag, 17. Februar 2013, 8.30 Uhr, SWR 2 ___________________________________________________________________ Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Mitschnitte auf CD von allen Sendungen der Redaktion SWR2 Wissen/Aula (Montag bis Sonntag 8.30 bis 9.00 Uhr) sind beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden für 12,50 € erhältlich. Bestellmöglichkeiten: 07221/929-26030 Kennen Sie schon das neue Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de SWR2 Wissen/Aula können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter www.swr2.de oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml Manuskripte für E-Book-Reader E-Books, digitale Bücher, sind derzeit voll im Trend. Ab sofort gibt es auch die Manuskripte von SWR2 Wissen/Aula als E-Books für mobile Endgeräte im sogenannten EPUB-Format. Sie benötigen ein geeignetes Endgerät und eine entsprechende "App" oder Software zum Lesen der Dokumente. Für das iPhone oder das iPad gibt es z.B. die kostenlose App "iBooks", für die Android-Plattform den in der Basisversion kostenlosen Moon-Reader. Für Webbrowser wie z.B. Firefox gibt es auch Addons oder Plugins zum Betrachten von EBooks. http://www1.swr.de/epub/swr2/wissen.xml ___________________________________________________________________ 2 Ansage: Mit dem Thema: „Was politische Parteien sein könnten.“ Es ist so leicht, auf die Parteien zu schimpfen, zu sagen, sie würden gar nicht mehr das Volk repräsentieren, sondern eigentlich nur noch ihre eigenen Machtinteressen; in diesem Zusammenhang ist dann oft vom "Raumschiff Bundestag" die Rede, das losgelöst von aller Realität durch die unendlichen Weiten des politischen Systems rast. Und die Gegner des Parteienstaates reden dann vollmundig vom Ende der Parteien – siehe die Piraten. Aber diese Rede geht an der Funktion der Parteien vorbei, das sagt Dr. Felix Heidenreich, Politikwissenschaftler an der Universität Stuttgart. In der SWR2 Aula zeigt er, warum Parteien nach wie vor unverzichtbar sind und warum die Piraten keine Alternative sind. Felix Heidenreich: Wenn es derzeit einen überlappenden politischen Konsens über die sozialen und kulturellen Milieus hinweg gibt, dann lautet dieser: Schluss mit der Parteienherrschaft. Die bereits vor Jahrzehnten formulierte Diagnose vom „Parteienstaat“ (Wilhelm Hennis) hat sich in allen Teilen der Gesellschaft herumgesprochen und scheint der zentrale Ankerpunkt der Politik-, Politiker- und Parteienverdrossenheit zu sein. Nach dieser Lesart haben sich die Parteien den Staat zur Beute gemacht. Sie benutzen ihn als Verteilungssystem für Posten und Finanzmittel, höhlen jedoch seine Institutionen jedoch systematisch aus, indem sie zentrale Entscheidungen in Parteigremien verschieben. Das Wahlrecht macht es dem Bürger unmöglich, dieses Kartell aufzubrechen, weil er immer nur zwischen Skylla und Charybdis wählen kann. Jede, den klassischen Parteien anvertraute Wählerstimme nutzt demnach nur einer politischen Klasse, die ihre Netzwerke in die Aufsichtsräte von Medienanstalten, in die Lobbyorganisationen von Arbeitgebern und Gewerkschaften, in die Kirchen und Verbände spinnt. Wer in die Parlamente entsandt wird, entschieden bisher in den meisten Fällen eben nicht die Bürger, sondern die Parteien selbst über ihre Landeslisten. Dieses zweifelhafte Gebaren der Parteien schlägt denn auch auf sie zurück. Ihr Zustand ist seit Jahren in den Worten des Parteien-Forschers Hubert Kleinert „besorgniserregend“. Die Parteien, einst als vermittelnde Elemente zwischen Bürgern und Staat mit hoher Legitimation ausgestattet, haben sich aus dieser Sicht in ihrer bisherigen Form schlicht überlebt. Der Erfolg der Partei „Die Piraten“ erklärt sich zu guten Teilen aus einer erfolgreichen Inszenierung als Anti-Parteien-Partei. Die Paradoxien dieser Inszenierung beginnen bereits beim Namen, denn „Piraten“ bewegen sich per Definition außerhalb des Rechtssystems, sind „outlaws“. Die Versuche, sich als eine Partei zu etablieren, die gegen die Etablierung von Parteien opponiert, wirken denn auch auf manche interessant, auf andere eher amüsant. Die nautische Metaphorik von den wackeren Freibeutern, die sich aufmachen, das Staatsschiff zu entern, kollidiert zudem auf seltsame Weise mit dem gleichzeitig verbreiteten Selbstbild von den rational-kühlen Programmierern, die den verstockten Staatstrukturen endlich ein neues Betriebssystem oder zumindest ein „update“ verpassen. Die klassische Vorstellung SWR2 Aula vom 15.02.2013 Was politische Parteien sein könnten – Ein Plädoyer, das die Piraten fest im Blick hat Von Dr. Felix Heidenreich 3 der politischen Partei aber wäre aus dieser Perspektive ein „Bug“, ein Programmierfehler, den es zu beheben gilt. Die Kritik an den etablierten Parteien ist selbstverständlich nicht einfach falsch. Die Art und Weise, in der über künftige Bundespräsidenten entschieden wird, war in manchen Fällen schlicht entwürdigend – für das Amt und damit auch für das Land. Die unverhohlene politische Einflussnahme auf die Redaktionen des öffentlichrechtlichen Mediensystems verschlägt dem Beobachter bisweilen die Sprache. Sie gipfelt in Personalwechseln, bei denen Nachrichtenredakteure ihr in öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten erworbenes kulturelles Kapital direkt in politische Vorteile umzumünzen versuchen. Die Piraten haben also durchaus Recht: Über das Verhältnis zwischen Bürgern, Parteien und Staat muss neu nachgedacht werden. Aber – und hier beginnt mein Einwand gegen eine allzu pauschale, ja bisweilen wohlfeile Kritik an politischen Parteien – es gibt mittlerweile eine Verachtung für Parteien, die nicht nur unangemessen, sondern regelrecht gefährlich ist. Sie hat viele Fürsprecher und man trifft sie überall. Wenn der Philosoph und Publizist Richard David Precht im Interview beteuert, er habe nie einer Partei angehört, so klingt das schon beinahe wie ein Verdienst: Nein, mit diesen Leuten habe ich noch nie etwas zu tun gehabt, scheint er uns sagen zu wollen. Auch wenn der nicht minder populäre Journalist Gabor Steingart der Wahlenthaltung das Wort redet, indem er beteuert, auch in einem Supermarkt habe man ja das Recht, nichts zu kaufen, offenbaren sich grundlegende Missverständnisse über die Funktionsweise der Demokratie. Eine Demokratie ist kein Supermarkt und ein Bürger sollte sich selbst nicht allein deshalb für bürgernah und basisdemokratisch halten, weil er sich nie in einer Partei engagiert hat. Die Skepsis der Bürger gegenüber politischen Parteien schlägt sich zum einen in sinkenden Wahlbeteiligungen nieder. Von manchen Politikwissenschaftlern wird Wahlenthaltung als stille Zustimmung oder rational begründete Entscheidung gewertet. Langfristig bedenklicher als die Wahlenthaltung scheinen mir der Rückgang der Mitgliederzahlen und das rückläufige Engagement in den meisten politischen Parteien. Die Rede von den oligarchischen Hinterzimmer-Parteien droht so zu einer Art sich selbst erfüllender Prophezeiung zu werden. Je weniger Bürger sich in Parteien engagieren, umso einfacher lassen sich dort oligarchische Strukturen aufbauen. Aber wie sind wir so weit gekommen? Haben sich die weit verbreiteten Vorstellungen von Demokratie gewandelt und die etablierten Parteien passen sich lediglich zu träge an? Haben die Parteien selbst ihr Image zu Grunde gerichtet durch all die Skandale, all die Mauscheleien und strategischen Spielchen? Wie müssten Parteien aussehen, um für Wähler und potenzielle Mitglieder wieder attraktiv zu werden? Um diese Fragen zu beantworten, empfiehlt sich eine Perspektive, die nicht einfach ökonomisch oder funktionalistisch nach dem Kalkül im Verhalten der Parteien oder einzelner Akteure fragt. Diese Theorien, man nennt sie Theorien der rationalen Wahl, die Parteien als Anbieter auf einem Markt verstehen, auf dem man um Wählerstimmen konkurriert und Mitgliedern Karrierechancen gegen Lebenszeit bietet, können womöglich Wahlergebnisse erklären. Um jedoch normative Ansprüche plausibel zu machen, bedarf einer gänzlich anderen Art der Betrachtung. SWR2 Aula vom 15.02.2013 Was politische Parteien sein könnten – Ein Plädoyer, das die Piraten fest im Blick hat Von Dr. Felix Heidenreich 4 Der in Frankfurt lehrende Philosoph Axel Honneth hat in seinem viel diskutierten Buch „Das Recht der Freiheit“ eine solche Perspektive vorgeschlagen. Unter einer „normativen Rekonstruktion“ versteht er eine Betrachtungsweise, die nach jenem Versprechen fragt, das historisch mit bestimmten Institutionen verbundenen war. In der Tradition Hegels geht Honneth davon aus, dass sich in den sittlichen Praktiken und Rechtsformen eine Art DNA ablesen lässt, die im alltäglichen Leben als selbstverständlicher Hintergrund vorausgesetzt ist. In den Institutionen finden wir demnach im besten Falle die Weisheit von Jahrhunderten – ein Idealbild, das der Wirklichkeit nicht einfach entgegen gestellt wird, sondern sich aus der Geschichte der jeweiligen Institution und Praktiken selbst herausarbeiten lässt. Ich will Honneths Verfahren kurz veranschaulichen: Das vielleicht markanteste Beispiel für eine normative Rekonstruktion ist Honneths Beschreibung der Familie. Das Versprechen der Familie, formuliert im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, formulierte die Utopie einer frei gegründeten, also nicht arrangierten, dann aber quasi-natürlichen Solidargemeinschaft, die verschiedene Generationen verbindet und die Teilhabe an den Lebensaltern der Anderen ermöglicht. Die moderne Familie wird demnach als ein Ort sozialer Freiheit gedacht, an dem anders als in der antiken römischen Familie keine Besitzverhältnisse, sondern Anerkennungsverhältnisse vorherrschen sollen. Alle Reformvorschläge bezüglich des Familienlebens müssen sich an dieser rekonstruierten normativen Idealvorstellung messen. Und auch und gerade die wachsende Verrechtlichung der Familie – man denke an das erst in den letzten Jahrzehnten konsequent umgesetzte Gewaltverbot – dient dann dazu, das implizite Ideal schrittweise zu entfalten. Und die Parteien? Welches Versprechen wurde in ihrer Herausbildung formuliert? Welchem Begriff versuchen die entsprechenden Gesetze eine Gestalt zu geben? Welche normative Idee von politischer Partei kann als Maßstab für die Wirklichkeit herhalten? Honneth selbst äußert sich hierzu kaum. Vielmehr lautet seine These: „Ein Ausweg aus der Krise des demokratischen Rechtsstaats böte nur die Bündelung der öffentlichen Macht von Verbänden, sozialen Bewegungen und zivilen Assoziationen, um koordiniert den parlamentarischen Gesetzgeber unter Druck zu setzen.“ Gerade dieses „nur“ scheint mir problematisch, weil damit das Bild eines Parlaments gezeichnet wird, das nicht durch innerparteilich Bottom-up-Prozesse, sondern nur durch eine letztlich außerparlamentarische Opposition zur Responsivität gezwungen werden kann. Gefragt ist also, methodisch mit, aber vom Ergebnis her gegen Honneth eine normative Rekonstruktion der Idee der politischen Partei. Der entscheidende qualitative Unterschied, der zwischen Parteien und anderen politischen Interessengruppen besteht, also Bürgerinitiativen, Vereinen, LobbyGruppen wie dem ADAC beispielsweise, ist der Anspruch auf innerparteiliche Demokratie. Parteien sind Organisationen, die sich an jenen Ansprüchen an geregelte, demokratische und transparente Verfahren messen lassen müssen, wie wir sie sonst nur für Parlamente kennen. Gerade jene Mechanismen der Wahl und Delegation, die vielen Parteienkritikern so verhasst sind, haben ihren spezifischen Sinn: Sie verlagern die Ansprüche an eine demokratische Willensbildung aus dem staatlichen Bereich im engeren Sinne auf die Schnittstelle zur Zivilgesellschaft. SWR2 Aula vom 15.02.2013 Was politische Parteien sein könnten – Ein Plädoyer, das die Piraten fest im Blick hat Von Dr. Felix Heidenreich 5 Die Parteien haben folglich, darauf hat beispielsweise Ernst Wolfgang Böckenförde sehr plausibel insistiert, eine besondere „Zwischenstellung zwischen Staat und Gesellschaft“. Sie dürfen nicht selbst staatlich werden, niemand von uns will Staatsparteien haben, weil dies die Offenheit der Willensbildung beenden würde. Sie sind aber auch nicht nur einfach gesellschaftlich, sondern agieren auf den Staat hin und daher unter besonderen, im Parteiengesetz definierten Spielregeln. Eine wichtige Konsequenz dieses Anspruchs ist die Wiederkehr des Prinzips der Repräsentation in den Parteien. Auch hier gibt es Delegierte, Vorsitzende, Sprecher, kurz: Repräsentanten. Nicht jeder darf alles sagen – und mancher muss sogar mit Parteiausschluss rechnen, wenn er glaubt, alles sagen zu dürfen. Man denke an die Debatte um Thilo Sarrazin in der SPD. Der Mechanismus der Repräsentation baut folglich Filter und Schleusen in den innerparteilichen Diskurs ein. Damit bezahlt die Partei als Organisation die erworbene Verlässlichkeit mit Exklusion. Enttäuschte werden sagen: „Ich fühle mich hier nicht repräsentiert!“ „Nicht Du als Individuum sollst hier jedoch repräsentiert werden, sondern eine Idee des Gemeinwohl!“, so könnte man erwidern. Zumindest ein gewisser Anteil der Parteienverdrossenheit könnte damit zusammen hängen, dass die Wähler keine individuell zugeschnittenen Sonderanfertigungen erhalten, sondern am Ende immer das kleinste Übel, also eine halbwegs akzeptable Mischung aus Politikvorschlägen, wählen müssen. In einer Zeit sich immer weiter ausdifferenzierender Sozialmilieus findet man dann aber „nichts Passendes“. Der Kern des Problems hängt wohl weniger mit wachsendem Individualismus zusammen als mit einer systematischen Schwierigkeit des Begriffs der Repräsentation. Denn Repräsentation kann zwei gänzlich verschiedene Bedeutungen haben. Eine vor allem in den USA vorherrschende Bedeutung versteht „Repräsentation“ als eine Art der Delegation: Der Repräsentant vertritt die Interessen seiner Wähler – und zwar so genau wie nur irgend möglich. Als Repräsentant ist er lediglich ein aus technischen Gründen in die Hauptstadt entsandter Bote. Dass Politiker die Bürger „repräsentieren“ sollen, bedeutet dann, dass sie deren Präferenzen möglichst genau abbilden und auf entsprechende Änderungen möglichst schnell reagieren sollen. Die Repräsentierten und die Repräsentanten stehen nach diesem Ideal in einem Verhältnis der maßstabsgetreuen Abbildung, also der lediglich technisch vermittelten Identität. Eine zweite Bedeutung hingegen betont den Charakter der Verbesserung des Repräsentierten durch das Repräsentierende. Wenn wir beispielsweise sagen: Der Bundestag soll die Bevölkerung Deutschlands, die deutschen Bürgerinnen und Bürger repräsentieren, so meinen wir damit ja gerade nicht ein Verhältnis maßstabsgetreuer Abbildung, sondern einen Prozess der Verbesserung, der Kondensierung des Wesentlichen, der Sublimierung. Die klügsten Köpfe sollen im Parlament sitzen und nicht etwa ein repräsentativer Anteil von Straftätern. Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Hanna F. Pitkin hat in einer klassischen Studie zum Repräsentationsbegriff diese Doppelbedeutung anhand der Metaphern von Koch und Arzt diskutiert. In der hier gewählten Zuspitzung wird die Gegenüberstellung von Koch und Arzt bei Pitkin zwar nicht formuliert, doch der Text scheint mir diese Grenzbegriffe ganz klar nahezulegen. In der identitären Bedeutung muss der Koch als Repräsentant unsere Wünsche möglichst genau erfüllen. In der SWR2 Aula vom 15.02.2013 Was politische Parteien sein könnten – Ein Plädoyer, das die Piraten fest im Blick hat Von Dr. Felix Heidenreich 6 differenzorientierten Bedeutung macht gerade die zusätzliche Kompetenz des Arztes diesen zu einem legitimen Anwalt unserer Interessen. Beide Begriffe von Repräsentation zeigen bereits ein Scheitern an. Der willenlose Koch, der selbst die unbekömmlichsten Speisen auf Wunsch zubereitet, wäre ein ebenso schlechter Politiker wie ein Arzt, der die anzustrebende Vorstellung von Gesundheit oder von einer gelingenden Therapie mit seinen Patienten nicht zu diskutieren braucht. Dennoch schwingen in unserem Sprachgebrauch beide Ansprüche an Repräsentation stets mit: maßstabsgetreue Abbildung einerseits und stellvertretende Anwaltschaft, verbesserte Vertretung von Interessen andererseits. Die Politiker sollen als Köche genau das tun, was wir wollen; sie sollen aber gleichzeitig wie Ärzte auch jene bittere Medizin verschreiben, die der Mehrheit nicht schmeckt, obwohl sie ihr langfristig bekommt. Daher kann man „den Politikern“ wahlweise vorwerfen, sie seien so furchtbar abgehoben oder aber sie seien so furchtbar durchschnittlich. Viel Frustration über „die Politiker“ lässt sich aus dem unlösbaren „double-bind“ zweier gegenläufiger Ansprüche verstehen, die in einem einzigen Begriff zusammengebunden sind. Besonders deutlich wird dies in der Art und Weise, wie großes Lob in beißende Kritik umschlug, als die Skandale um Bundespräsident Christian Wulff eskalierten. Er wurde zunächst dafür gelobt, zusammen mit seiner jungen Frau ein volksnahes Amtsverständnis zu praktizieren. Er bemühte sich nach Kräften, „einer von uns“ zu sein, wie man so schön sagt. Groß war dann aber die Enttäuschung, als sich herausstellte, dass er wirklich einer von uns ist. Dass der Bundespräsident die Bürger repräsentieren soll, bedeutet nämlich zugleich, dass er gerade kein durchschnittlicher Schnäppchen-Jäger sein darf. Die in der Piraten-Partei weit verbreitete Skepsis gegen herausragende Parteimitglieder – manche sprechen auch von einem regelrechten Hass – lässt sich vor diesem Hintergrund als eine Verkürzung des Repräsentationsbegriffs verstehen. Wenn sich beispielsweise Parteimitglieder bei Podiumsdiskussionen weigern, ihren Namen zu nennen und stattdessen erklären: „Ich bin Pirat. Punkt.“, so scheint dahinter ein identitäres Demokratieverständnis zu stehen. Das Einzelne muss hier vollständig im Ganzen aufgehen; daher muss sich der Einzelne dem Ganzen auch gar nicht unterordnen, darf also beispielsweise zugleich Mitglied einer anderen Partei sein. In der Piraten-Partei, so scheint es, kann jeder sagen, was er will, aber keiner kann sagen, was die Partei als Ganzes will. Aber was hat diese spannungsgeladene Bedeutung des Repräsentationsbegriffs mit der Sonderrolle von politischen Parteien zu tun? Ganz einfach: Parteien können verstanden werden als jene Institutionen, in denen die doppelte, sich selbst widersprechende Bedeutung von Repräsentation in eine produktive Spannung umgewandelt werden kann. Der oder die Ortsvorsitzende ist sehr nahe, andererseits schon ein bisschen entfernt, ist Koch und Arzt, Duz-Freund, aber auch Parteitagsdelegierter. In der Partei fühlt sich das Mitglied einerseits wie in einer politischen Familie zuhause, andererseits hadert es stets mit der Parteiführung. Solange in Parteien die Spannung in eine produktive Auseinandersetzung gelenkt werden kann, sind Parteien offene Diskursräume der Meinungsbildung, der inhaltlich, oft medienfernen politischen Auseinandersetzung. SWR2 Aula vom 15.02.2013 Was politische Parteien sein könnten – Ein Plädoyer, das die Piraten fest im Blick hat Von Dr. Felix Heidenreich 7 Dies setzt allerdings die Möglichkeit des Rollenwechsels zwischen den Akteuren voraus. Dazu braucht es Mechanismen, die die Bildung von Oligarchien und informellen Netzwerken zumindest erschweren. Axel Honneth hat in seiner „normativen Rekonstruktion“ der Familie die Verrechtlichung als legitime und wichtige Rückfalloption im Falle der Krise beschrieben. Wenn Familien scheitern, sind der rechtlich garantierte Schutz von Kindern, die rechtliche Sicherheit im Prozess der Scheidung, von großer Bedeutung. Das Recht allein kann keine funktionierenden Familien hervorbringen; aber es kann durch klare Regelungen daran erinnern, was eine Familie sein sollte und was nicht. Auch im Falle der Parteien könnte das Medium des Rechts als Motor einer Umsetzung der ursprünglichen Ideale sinnvoll sein. Das Parteiengesetz, dessen 40jähriges Bestehen 2008 gefeiert wurde, ist hierfür enorm bedeutsam. Wie wichtig beispielsweise eine transparente und faire Regelung der Parteienfinanzierung ist, zeigt vor allem der Vergleich zu den USA. Denn hier sind viele Abgeordnete primär damit beschäftigt, Wahlkampfmittel einzuwerben. Der Kampf um eine Ordnung der Parteienfinanzierung in den USA scheint momentan aussichtslos. Aber vielleicht lässt sich auch in Deutschland nachjustieren. Die teilweise enge Verknüpfung mit Wirtschaftsverbänden, die schiefen Wege versteckter Parteienfinanzierung über Tochterfirmen oder Vereine, die Intransparenz von Kungelrunden – all diese negativen Auswüchse entziehen sich nicht einer potenziellen rechtlichen Regelung. Mit Axel Honneth könnten wir hoffen, dass es gelingt, bereits implizit Vorstellungen einer demokratischen Parteienlandschaft auch rechtlich noch stärker explizit zu machen. Diese Vorstellung mag naiv erscheinen. Aus Sicht der vehementen Parteienkritiker scheint sie auf die Hoffnung hinauszulaufen, dass Partei-Eliten ihre eigene Position freiwillig schwächen. Betrachtet man Parteien rein ökonomisch als Verbände nutzenmaximierender Akteure, die versuchen, kollektive oder individuelle Interessen durchzusetzen, so ist mit Besserung in der Tat nicht zu rechnen. Aber die Wähler haben immer noch die Möglichkeit, die Parteien in Konkurrenz zueinander zu setzen und könnten genau diese Reformen fordern. Die Parteien beginnen bereits jetzt, mit neuen Ideen dieser Art um Wählerstimmen zu werben. Gleichermaßen könnten sie gegenüber den Wählern um die striktesten Antikorruptionsregeln konkurrieren. Die Tendenz zur Mitgliederbeteiligung bei der Suche nach Spitzenkandidaten oder bei Einzelentscheidungen deutet darauf hin, dass sich die Parteien bereits bewegen. Das ist wichtig, denn die direktdemokratischen Elemente, die allerorten gefordert werden, können die parteipolitischen Mechanismen nicht ersetzen. Sie können der öffentlichen Debatte mehr Gewicht verleihen und das repräsentative System zu mehr Responsivität zwingen, das Spektrum der Beteiligungsoptionen also abrunden. Ihre Ausweitung ist zu begrüßen. Aber sie können eben niemals das repräsentative System einfach ersetzen: Mit Volksabstimmungen lassen sich weder Stellenbesetzungspläne noch Budgetplanungen angemessen entscheiden. Die eigentliche Gefahr des Anti-Parteien-Diskurses liegt in seiner Verachtung für die langatmige, kleinteilige und bisweilen nervtötende politische Arbeit. Diese Arbeit findet, wenn sie in Parteien stattfinden, in Institutionen statt, die anderen demokratischen Standards entsprechen müssen als Verbände, Bürgerinitiativen oder SWR2 Aula vom 15.02.2013 Was politische Parteien sein könnten – Ein Plädoyer, das die Piraten fest im Blick hat Von Dr. Felix Heidenreich 8 bloße Kampagnengruppen: Ein Ortsverein, der über die Geschäftsordnung debattiert, mag in der Tat abschreckend sein – aber er ist demokratisch als runder Tisch, eine Kommission oder irgendein Rat. Die Folgen des Antiparteiendiskurses sind jedoch weitreichend. Es geht das Gerücht, Parteien bildeten eine Art Negativ-Auslese. Wer in der Wirtschaft wegen Kompetenzmangels keine Karriere machen könne, wähle die Ochsentour durch die Parteien. Wenn wir jedoch einer Stimmung das Wort reden, der zufolge nur Sozialversager Karrierestreber und Langweiler in Parteien zu finden sind, so verschärft sich das Problem in einer sich selbst verstärkenden Dynamik. Besorgniserregend ist nicht nur die größtenteils abnehmende Zahl von Parteimitgliedern, die natürlich auch auf den demografischen Wandel zurückzuführen ist, sondern auch und vor allem das in manchen Fällen massive Nachwuchsproblem der Parteien. Noch nie war es unter jungen Leuten so uncool, sich in einer Partei zu engagieren. Selbst unter Studierenden der Politikwissenschaft finden sich immer weniger, die auch nur Mitglied einer Partei sind. Ob es ein stark ausgeprägter Individualismus, gewöhnliche Bequemlichkeit oder aber die Überlastung in einer hochkompetitiven und flexiblen Arbeitswelt ist, die das Engagement unwahrscheinlicher machen, ist unklar. Der Anti-Parteien-Diskurs spielt zweifellos auch eine Rolle. Dass sich das Engagement der jungen Leute neue, unkonventionellere Wege sucht, kann aus meiner Sicht nicht beruhigen. Ohne in Parteien engagierte Bürger wird auf absehbare Zeit kein demokratischer Staat zu machen sein. Daher schulden all jene, die sich nicht in engagieren, den Engagierten zunächst einmal Respekt – und keinen Hohn. In der Tat: Auch die Parteien müssen sich verändern. Aber das können sie nur mit engagierten Mitgliedern, die sich zumuten, dort mit Menschen zusammenzuarbeiten, die eventuell nicht ihrem kulturellen Hintergrund entsprechen oder ihrem sozialen Milieu entstammen. Der Bestseller „Empört Euch!“ des französischen Widerstandskämpfers Stéphane Hessel sollte uns zu denken geben. Die Résistance als Referenzgröße zu bemühen, mag aus deutscher Sicht ein bisschen zu dick aufgetragen wirken. Aber wir sollten nicht vergessen, dass die Résistance als Armee organisiert war, über Kommandostrukturen und Befehlsketten verfügte. Die richtungslose Frustration über dieses und jenes muss den Weg durch die Institutionen nehmen. Die angemessene Folgerung kann dann nicht lauten: Engagiert Euch!, - egal wo, sondern: Organisiert Euch – und zwar auch in Parteien! Wer andere Parteien haben will, der sollte die bestehenden verändern oder neue gründen und sich nicht damit brüsten, dass er sich die Mühen der politischen Arbeit erspart. ***** * Felix Heidenreich studierte Philosophie und Politikwissenschaften in Heidelberg, Paris und Berlin. Er ist wissenschaftlicher Koordinator am Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung (IZKT) der Universität Stuttgart und Lehrbeauftragter im Fachbereich Politikwissenschaften. Zu seinen Arbeitsgebieten gehören die Politische Theorie, die Kulturphilosophie und die Wirtschaftsethik. Zuletzt erschien SWR2 Aula vom 15.02.2013 Was politische Parteien sein könnten – Ein Plädoyer, das die Piraten fest im Blick hat Von Dr. Felix Heidenreich 9 seine Einführung “Theorien der Gerechtigkeit”, die anhand der Auseinandersetzung zwischen Antigone und Kreon einen anschaulichen Überblick über die Ideengeschichte des Gerechtigkeitsbegriffs und die aktuelle Debatte liefert. Bücher: – Wirtschaftsethik zur Einführung, Junius-Verlag. 2012. – Theorien der Gerechtigkeit, Opladen (UTB.) 2011. SWR2 Aula vom 15.02.2013 Was politische Parteien sein könnten – Ein Plädoyer, das die Piraten fest im Blick hat Von Dr. Felix Heidenreich