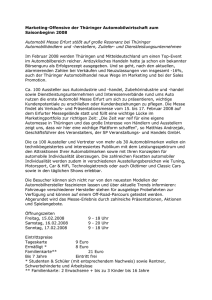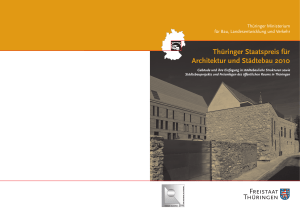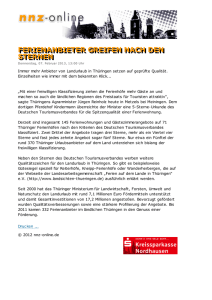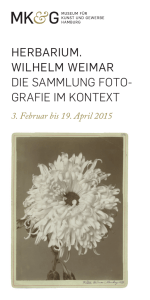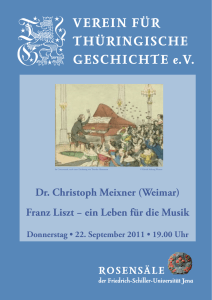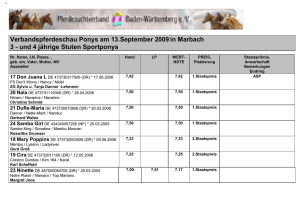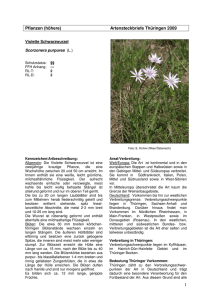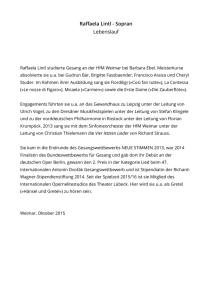Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr
Werbung

Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr „Öffentliche Bauten und ihre Einfügung in städtebauliche Strukturen unter Einbeziehung der Freianlagen und des öffentlichen Raumes“ THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 »Öffentliche Bauten und ihre Einfügung in städtebauliche Strukturen unter Einbeziehung der Freianlagen und des öffentlichen Raumes« Dokumentation Auslober Freistaat Thüringen Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr Zusammenarbeit Architektenkammer Thüringen Bauhaus-Universität Weimar Fachhochschule Erfurt 1 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Neubau Bibliotheks- und Hörsaalgebäude der Bauhaus-Universität Weimar 2 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Vorwort Thüringer Minister für Bau und Verkehr Andreas Trautvetter Die Kultur des Bauens ist mehr als bloße Funktion: Sie ist Markenzeichen und Spiegelbild unserer Gesellschaft. »Baukultur betrifft die gesamte gestaltete Umwelt. Somit ist sie ein Spiegel der Gesellschaft, wie sie sich verhält und was sie sich wünscht«, sagt der bekannte Ingenieur und Architekt Werner Sobek. Baukultur verbindet den Willen der Gesellschaft zur Wahrung des kulturellen Erbes mit der Bereitschaft zur Modernisierung und Veränderung. Deutschland verfügt über eine hoch entwickelte Infrastruktur, weltweit anerkannte Standards sowie ein großes historisches Erbe. Gerade bei Veränderung der Rahmenbedingungen in Gesellschaft und Wirtschaft ist ein innovatives und wettbewerbsfähiges Planungs- und Bauwesen wichtig. Baukultur kann dabei als Synonym für qualitätvolle Architektur angesehen werden. Sie wird durch jeden gut gestalteten Neu- oder Umbau weiterentwickelt und prägt damit wesentlich das Erscheinungsbild unserer Städte. Architekten, Stadtplaner und Ingenieure haben hierbei eine besondere Verantwortung. Unseren Kommunen soll ein unverwechselbares Bild mit qualitätvoll gestalteten Lebensräumen gegeben werden. Dies ist jedoch nicht allein eine Aufgabe der Planer, sondern kann nur im Zusammenwirken mit den Bauherren und Behörden erfolgen. Die Landesregierung des Freistaats Thüringen sieht in der Förderung der Baukultur ein wichtiges Ziel ihrer Politik und unterstützt diese seit langem. Hervorheben möchte ich in diesem Zusammenhang die Thüringer Stiftung für Baukultur, die mit unserer Unterstützung 2003 gegründet wurde. Auch von dem geplanten Europäischen Forum für Stadt- und Infrastrukturentwicklung, das im Schloss Ettersburg bei Weimar seinen Sitz erhalten soll, werden wichtige Impulse ausgehen. Mit dem seit 1996 mittlerweile zum sechsten Mal vergebenen THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU wollen wir in Zusammenarbeit mit der Architektenkammer Thüringen herausragende Leistungen auf dem Gebiet von Architektur und Städtebau auszeichnen und öffentlich bekannt machen. Es ist inzwischen eine gute Tradition, alle zwei Jahre vorbildliche Architektur auszuzeichnen. Durch die Auszeichnung hervorragender Beispiele wollen wir das Bemühen und die Bereitschaft für neue Qualitäten 3 im Bereich des Bauens fördern. Gerade in der jetzt wirtschaftlich angespannten Zeit besteht die Gefahr, dass die für die gebaute Umwelt Verantwortlichen baukulturelle Aspekte vernachlässigen. Schlechte Architektur ist jedoch nicht revidierbar, sie beeinträchtigt das Erscheinungsbild unserer Umwelt für Jahrzehnte. Wir brauchen kluge städtebauliche Konzepte und hervorragend gestaltete Gebäude. Der Staatspreis will innovative städtebauliche und architektonische Konzeptionen auffinden und in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. Dabei ist das Hauptaugenmerk auf qualitäts- und kostengünstige Lösungen gerichtet, die in einen fruchtbaren Dialog mit der Umgebung treten. Wie bereits im Jahr 2004 wurde in der diesjährigen Ausschreibung die Bewertung der Freianlagengestaltung ausdrücklich einbezogen. Gefragt ist eine integrative Gesamtgestaltung des umgebenden öffentlichen Raumes. Die Jury hat nach eingehender Diskussion und mehreren Wertungsdurchgängen entschieden, den mit 15.000 € dotierten Preis zu teilen und an zwei Projekte gleichberechtigt zu verleihen. Staatspreise gehen an die Projekte »Erweiterungsbau der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek Weimar« sowie »Neubau Bibliotheks- und Hörsaalgebäude der Bauhaus-Universität Weimar«. Außerdem werden vier Anerkennungen vergeben. Die ausgezeichneten Projekte bilden einen großen Spannungsbogen öffentlicher Bauaufgaben ab. Das Spektrum reicht von geschickten baulichen Einfügungen in das innerstädtische Umfeld über die denkmalgerechte Sanierung leer stehender historischer Bausubstanz bis zur qualitativ anspruchsvollen Ergänzung einer Polizei-Liegenschaft. Ich gratuliere allen Preisträgern zu ihren wegweisenden Arbeiten und wünsche ihnen auch weiterhin viele innovative Ideen! Die vorgestellten Bauten sollen möglichst viele Bürger zur Diskussion über Architektur und Städtebau anregen. Bedanken möchte ich mich bei den Organisatoren und Mitwirkenden des THÜRINGER STAATSPREISES FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 sowie besonders bei allen Bauherren und Architekten. Sie haben die Baukultur in Thüringen ein gutes Stück voran gebracht. THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Erweiterungsbau der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek Weimar 4 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Grußworte G Prof. Dr. Gerd Zimmermann Rektor der Bauhaus-Universität Weimar Vorsitzender des Preisgerichts Preise sind wie Spotlights. Sie heben ihren Gegenstand mehr oder weniger schlaglichtartig in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Der Thüringer Staatspreis Architektur ist von dieser Art. Er würdigt herausragende Leistungen der Architektur, damit die Architekten, Planer und Bauherren, aber er setzt darüber hinaus ganz generell ein Zeichen für den Rang, den der Freistaat der Architektur und im weiteren Sinne einer hohen Baukultur zumisst. Dies kann man nur nachhaltig begrüßen, denn für die Architektur, die doch eine hochgradig »öffentliche Kunst« ist, muss anhaltend und nachhaltig geworben werden - durch eine kluge Architekturkritik, vor allem aber auch durch die Inszenierung des modellhaften Beispiels. Der Gros der zum Wettbewerb eingereichten Arbeiten zeigt, dass sich in Thüringen eine bestimmte Schule moderner Architektur herauskristallisiert hat. Ihr Charakteristikum ist wohl eine streng moderne Sprache, basierend auf dem kreativen Gebrauch des Materials und des Raumes, dann aber vor allem eingesetzt in einer Art dialektischer Spannung mit den jeweils vorgefundenen Kontexten der historisch gewachsenen Stadträume. Eine Art kontextuelle Moderne, der jedoch dieses Offenhalten der Differenz zwischen dem vorgefundenen »Alten« und der modernen Intervention wichtig ist. Und wenn wir von einer »Schule« sprechen, dann muss auch gesagt werden, dass die großen Inspiratoren hier die Hochschulen sind, die Bauhaus-Universität sowie die FH Erfurt. Die moderne »Schule«, von der wir hier reden, lebt von der Allianz sehr guter, oft junger Architekturbüros mit der Universität, deren »Spin-Offs« sie ja sehr oft auch sind. Wir sehen in dieser neuen Thüringer Architekturschule ein exzellentes Beispiel dafür, wie Theorie und Praxis interagieren können, wie aber gerade Universitäten und Fachhochschulen als Entwicklungskerne und Inkubatoren einer Region fungieren, so wie das »Silicon Valley« hier eben ein »Architecture Valley«. Die Jury hat Anerkennungen vergeben, und sie hat den Staatspreis zugleich an zwei herausragende Projekte vergeben, das neue Studienzentrum der Anna-Amalia-Bibliothek Weimar (Architekten Karl-Heinz Schmitz und Hildegard Barz-Malfatti) und die neue Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar (Architekt Andreas Meck). Beide Projekte, so unterschiedlich sie auch sind, zeigen sich als exzellente Architekturen. Und es verdient auch festgehalten zu werden, dass wir hier zwei Bibliotheksbauten auszeichnen, Speicher des Wissens und damit Schlüsselbauten der modernen Wissens- und Informationsgesellschaft. Spot also auf die Orte des Wissens! 5 Dipl. Ing. Hartmut Strube, Architekt BDA Präsident der Architektenkammer Thüringen Die in Thüringen tätigen Büros waren erneut aufgefordert, die Ergebnisse ihrer Arbeit einer Jury zur Verleihung des Thüringer Staatspreises für Architektur und Städtebau 2006 zu präsentieren. Trotz der Beschränkung auf öffentliche Bauten und ihre Einfügung in städtebauliche Strukturen wurden 20 Arbeiten eingereicht. Das ist eine Verdopplung der Teilnehmerzahlen gegenüber 2004. Es wird also noch gebaut und es entsteht Vorzeigbares, erfreulicherweise auch wieder mit der Beteiligung von Landschaftsarchitekten. Die Mehrzahl der eingereichten Arbeiten waren Ergänzungs-, An- und Umbauten. Bauen im Bestand, Baulückenschließungen und die Bebauung von Brachen sind im Zusammenhang mit dem erforderlichen Stadtumbau verstärkt anspruchsvolles Betätigungsfeld der Architekten. Die eingereichten Arbeiten bestätigten diesen Trend. Zur Bewertung standen interessante unterschiedliche Bauaufgaben, die den beauftragten Architekten neben der erforderlichen Fachkunde viele Ideen und Kreativität abverlangten. Die der Jury vorgestellte Ergebnisse zeugten davon und waren in erfreulich hoher Qualität. Die zur Entscheidung gestellten Gebäude waren nahezu alle bereits zum diesjährigen »tag der architektouren« in Thüringen der Öffentlichkeit zugänglich. Sie waren Bestandteil der unter dem Thema »Stadt als Bühne - die Renaissance des öffentlichen Raumes« an 74 Standorten gezeigten Leistungsschau der in Thüringen tätigen Architekten und zeugten auch dort von der weiter gewachsenen Leistungsfähigkeit des Berufsstandes. Aufgrund der Leistungsdichte der eingereichten Arbeiten entschloss sich die Jury, den Thüringer Staatspreis für Architektur zwei Gebäudekomplexen zuzuordnen. Es war das Studienzentrum der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek vom Architekturbüro Prof. Karl-Heinz Schmitz / Prof. Hilde BarzMalfatti, Weimar und das Bibliotheks- und Hörsaalgebäude der Bauhaus-Universität vom Architekturbüro meck architekten München. Beide Arbeiten bewegen sich im Bestand. Sie zeigen Neubauten in zeitgemäßer Gestaltung in unmittelbarer Nachbarschaft denkmalgeschützter Bausubstanz und erzeugen damit eine unverwechselbare Architektur in wichtigen Innenstadtbereichen der Stadt Weimar. Sie sind also beispielhaft in Ihrer Qualität und in der Umsetzung von individuellen Bauaufgaben des erforderlichen Stadtumbaus unter komplizierten äußeren Bedingungen. Diese Art Bauaufgaben werden verstärkt die zukünftigen Planungsaufträge für Architekten sein. Die Preisträger haben dafür einen hohen Maßstab geschaffen. Dafür ist Ihnen zu danken und dafür erhalten sie verdient die hohe Auszeichnung. Dank auch den Organisatoren und Helfern der diesjährigen Preisverleihung und natürlich allen Teilnehmern. Den Preisträgern herzlichen Glückwunsch und für die weitere Arbeit viel Freude und Erfolg. THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 1. Preis 7.500 € Erweiterungsbau der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek Weimar Burgplatz 4, Weimar Bauherr Klassik Stiftung Weimar Entwurfsverfasser Prof. Hilde Barz-Malfatti und Prof. Karl-Heinz Schmitz, Weimar Baudurchführung: Rittmannsperger+Partner, Erfurt Freianlagenplaner DANE Landschaftsarchitekten, Weimar Kosten 25,1 Mio. Euro Erläuterungen der Entwurfsverfasser Eine wesentliche Herausforderung bestand darin, die umfangreiche Erweiterung, deren Volumen ein Vielfaches des historischen Bibliotheksgebäudes ausmacht, innerhalb des geschützten Weimarer Schlösserbezirks städtebaulich zurückhaltend einzufügen. Hierfür wurden mehrere Bestandsbauten umgenutzt und weitere oberirdische und unterirdische Bauwerke hinzugefügt. Der neue Entwurf bezieht sich auf die Grundtypologie der alten Hofanlage und interpretiert sie neu. Die alte Anlage wurde ergänzt durch den Eingangsneubau, welcher einen Vorgängerbau aus dem 19. Jh. ersetzt und durch ein Magazin, welches als gebaute Parkkante in Erscheinung tritt. Unter dem Platz der Demokratie verborgen liegt das 2-geschossige Tiefmagazin, das eine Million Bücher aufnehmen kann und unterirdisch an das Stammhaus und an das neue Studienzentrum angeschlossen ist. Ein in den alten Innenhof eingesetzter Bücherkubus mit 16 verglasten Oberlichtern bildet das Kernstück der neuen Anlage und verleiht dem heterogenen Gefüge eine ruhige Mitte. Mit seinem Kontrast zwischen »rauer« Außenseite aus Sichtbeton und »feiner Holzschale« im Innern mit umlaufenden Büchergalerien, ist dieser geometrische Innenraum eine Reminiszenz an den Rokokosaal der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek. Um diesen Bücherkubus liegen auf verschiedenen Ebenen die öffentlichen Bereiche des neuen Studienzentrums. Diese wiederum sind umgeben von den Verwaltungsräumen und Spezialbereichen der Bibliothek. Eine unterirdische Raumsequenz mit öffentlichen Magazin- und Lesebereichen stellt die Verbindung vom Kubus zum historischen Bibliotheksgebäude her. Durch den Wechsel von niedrigen und hohen Räumen und von natürlichem und künstlichem Licht entstehen je nach Tages- und Jahreszeit unterschiedliche atmosphärische Stimmungen im Bücherkubus und den verschiedenen Lesebereichen. 6 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Würdigung der Jury Der 2005 eröffnete Neubau des Studienzentrums der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar ist ein herausragendes Beispiel für die Implantation neuer Architektur in ein bedeutendes, historisch gewachsenes Bauensemble. Die Aufgabe bestand darin, die berühmte alte Bibliothek durch ein modernes Studienzentrum im gegenüberliegenden Stadtquartier zu erweitern. Dabei war ein neues Tiefenmagazin unter dem Stadtplatz zu bauen und der hohe denkmalpflegerische Anspruch des so genannten Schlösserbezirks im Umfeld des Residenzschlosses einzulösen. Die hohe Qualität der Lösung liegt in einer Art wohltemperierter Moderne. Die Geltung des historischen Bauensembles wird durch die neue Architektur nicht nur nicht in Frage gestellt, sondern das Neue steigert das Alte, weil es nur zeichenhaft und kontrapunktisch auftritt: in der Figur des »Bücherkubus« mit Eingangsbauwerk sowie in der schön konturierenden Kurve des Tiefenmagazins zum Park hin. So gelingt es den Architekten, mittels eines komplexen Raumdenkens ein bestechendes Gehäuse im labyrinthischen Gefüge der Stadt zu errichten. Entstanden ist eine funktionierende Bibliothek im Zusammenhang von alter Bibliothek, Tiefenmagazin und Studienzentrum und gewonnen ist ein alt-neuer faszinierender Stadtraum. Hervorzuheben ist auch die besondere Qualität markanter Räume, wie z.B. des Bücherkubus, der einen gewissermaßen magischen Wirkungsraum des Buches erzeugt, man könnte auch sagen, eine »Kathedrale des Buches«, die moderne Analogie des alten Rokoko-Saals. Die Jury anerkennt mit dem Staatspreis die hohe architektonische Qualität, die wesentlich auf der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen Bauherren, Architekten und Ingenieuren beruht. Es soll aber auch betont werden, dass mit der neuen Bibliothek ein Bau der Wissensgesellschaft entstanden ist und damit eine für Thüringen wichtige Investition in die Zukunft. 7 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 8 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 9 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 1. Preis 7.500 € Neubau Bibliotheks- und Hörsaalgebäude der Bauhaus-Universität Weimar Steubenstraße, 6, Weimar Bauherr Freistaat Thüringen, vertr. durch das Staatsbauamt Erfurt Entwurfsverfasser Andreas Meck (meck architekten) und Stephan Köppel (Architekt) (Phase 1 mit 4), München Freianlagenplaner mahl gebhard landschaftsarchitekten, München Kosten 12,0 Mio. Euro Würdigung der Jury Im Zentrum Weimars, unweit des Frauenplans, befindet sich das neue Bibliotheks- und Hörsaalgebäude der Bauhaus-Universität Weimar. Städtebaulich gesehen reagiert der Neubau auf vorhandene Gebäudestrukturen im Inneren eines historischen Baublockes. An einer Stelle, einer Baulücke an der Steubenstraße, wird der Neubau durch eine Giebelfassade im öffentlichen Straßenraum deutlich sichtbar. Parallel zu den neuen Baukörpern sind im Inneren des Blockes öffentliche Wege und Platzräume entstanden, die eine unerwartete räumliche Qualität aufweisen. Diese öffentlichen Wege und Plätze stellen auch neue Fußgängerverbindungen im Zentrum Weimars her, die eine Bereicherung des erlebbaren Stadtraumes darstellen. Das nach Norden abfallende Gelände wurde geschickt in das Konzept mit einbezogen. Dem Geländeverlauf folgend wurde das Volumen des Hörsaals im Geländesprung gut integriert. Die Verbindung im Inneren des Neubaus über Lufträume und Treppen verleiht dem Gebäude eine räumliche Großzügigkeit, die gerade wegen der beengten städtebaulichen Situation angenehm wirkt. Der Bibliotheksbaukörper wurde wie ein großes Bücherregal linear und übersichtlich entwickelt. Durch eine einläufige Treppe ist die räumliche Wirkung des Hauptbaukörpers gesteigert und für den Nutzer ergibt sich damit auch eine selbstverständliche Orientierung. Die Materialwahl und deren Oberflächen sind sorgsam abgestimmt und den unterschiedlichen Nutzungsbereichen zugeordnet worden. Im Innenraum der Bibliothek wird durch eine »hölzerne Hülle« aus Eichenholz eine besondere Prägnanz erzielt. Der sachliche Umgang und die klare Detailausbildung der roh belassenen Oberflächen schaffen eine eigenständige angenehme Atmosphäre. Das neue Bibliotheks- und Hörsaalgebäude ist, trotz schwieriger Entstehungsgeschichte und komplizierter städtebaulicher Rahmenbedingungen, ein weiteres herausragendes Beispiel qualitätvoller Architektur in Thüringen. 10 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Erläuterungen des Entwurfsverfassers »Pass-Stück« in der gewachsenen Stadt Das neue Bibliotheks- und Hörsaalgebäude fügt sich als »Pass-Stück« in die umgebende Bebauung zum Frauenplan ein und ordnet die Räume innerhalb des Blockes neu: Der größere Bauteil des Bibliotheksgebäudes öffnet sich mit seiner großzügig verglasten Fassade zu einem Platz im Innern des Quartiers, dem Hochschulforum, während der Verwaltungsbereich und die Büros sich dem ruhigen Innenhof zum Frauenplan zuwenden. Über Fußwegeverbindungen sowohl in Nord-Süd als auch Ost-West-Richtung und eine Folge öffentlicher Platz- und Hofräume wird der Ort des neuen Universitätsgebäudes mit dem Stadtraum verknüpft. Der Topographie des von Süd nach Nord fallenden Geländes folgend ist das Volumen des Hörsaales in den Geländesprung integriert, so dass zwei Zugangsbereiche auf Ebene der Bibliothek und des Hörsaals mit öffentlichem Foyer entstehen. Mit einer deutlichen Geste artikuliert sich der Neubau des Bibliothekgebäudes im Stadtraum zur Steubenstraße und stellt sich weithin sichtbar als neues Gebäude im historischen Stadtinnern dar. Dieser prägnante Baukörper, der den Bereich der Hochschulbibliothek beinhaltet, lehnt sich in seiner Gestaltung an das Bild eines Bücherregals an: Die Bibliothek erscheint wie ein großer Rahmen, einem Regal vergleichbar, in den über die Geschosse die Regalreihen eingestellt sind wie die Bücher in die Regalböden. Die Gestaltung der Fassaden ist eine Reminiszenz an die alten mit Putz überzogenen Fachwerkbauten, die das Stadtbild Weimars prägen. Die Gebäudehülle ist monolithisch in Beton gegossen, ihre Oberfläche durch Schleifen und Spachteln nachbearbeitet. Durch einen lasierenden Anstrich werden Materialsichtigkeit und lebendige Struktur des Betons erhalten. Zusammen mit der Farbschicht wirken diese Flächen wie eine gespannte Haut und erinnern an das Erscheinungsbild der historischen Fassaden. Die Gestaltung der Innenräume ist auf wenige Materialien reduziert. Neben rohem Estrich, gestrichenen Beton werden farbige Beschichtungen in Anlehnung an die Bauhausarchitektur zum Thema. Die Bibliothek dagegen ist im Innern ganz mit Eichenholz ausgeschlagen in Analogie zur Anna-Amalia-Bibliothek, die ebenfalls als »hölzerner Korpus« in einen massiven Bau eingestellt ist. Zahlreiche Blickbezüge steigern das Erlebnis räumlicher Komplexität bei selbstverständlicher Orientierung: Transparenz und Offenheit werden so zu zentralen Themen der Bibliothek. 11 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 12 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 13 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Anerkennung 3.500 € Umbau und Erweiterung des ehemaligen Hotels »Roter Hirsch« zum Bürger- und Behördenhaus, Saalfeld Markt 6, Saalfeld Bauherr Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH Entwurfsverfasser Junk & Reich Architekten BDA, Weimar Freianlagenplaner Junk & Reich Architekten BDA, Weimar Kosten 6,1 Mio. Euro Erläuterungen des Entwurfsverfassers Das Technische Rathaus Saalfeld ist ein Komplex von Gebäuden unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Struktur im Zentrum der Stadt Saalfeld. Exponiert steht als ältestes Gebäude der »Rote Hirsch« an der Nordseite des Marktes. Durch die Stadt Saalfeld wurde es mit dem Ziel erworben, die verstreuten technischen Abteilungen der Stadtverwaltung an einem zentralen Standort zu konzentrieren. Unter Beachtung aller denkmalpflegerischen Aspekte sollte ein moderner Verwaltungsbau entstehen, der alle Anforderungen der heutigen Zeit an ein öffentliches Gebäude erfüllt. Einen umfangreichen Teil nahmen die restauratorischen Untersuchungen und die Abstimmungen mit den Ämtern für Denkmalpflege ein. Schwerpunkte der Erhaltung und Aufarbeitung der historischen Substanz waren das Vorderhaus, die historischen Holztreppenhäuser, der Saal und die Höfe 1 und 2. Die Hintergebäude bedurften zur Herrichtung für die Büronutzung neuer Raumaufteilungen. Die Belange des Brand-, Schall-, Arbeits- und Datenschutzes waren zu berücksichtigen. Um den gordischen Knoten der ursprünglichen verwinkelten und unübersichtlichen Erschließung zu zerschlagen, wurde an der Ostseite ein neuer Erschließungsriegel mit Treppen und Aufzug errichtet. Die Sanierung des ehemaligen Hotels »Roter Hirsch« zum modernen Bürger- und Behördenzentrum präsentiert sich als gelungener Beitrag zur Förderung der Baukultur. Trotz niedrigen Kostenbudgets ist es gelungen, ein Stück Baugeschichte der Stadt Saalfeld zu bewahren und in Verbindung mit modernen Gebäudeteilen zum funktionsfähigen Bürger- und Behördenhaus zu erweitern. Der Bauherr, vertreten durch die WOBAG Saalfeld, war sich seiner Verpflichtung als öffentliche Institution und der damit verbundenen Vorbildwirkung hinsichtlich des Umgangs mit einem Denkmal bewusst und nahm daraus entstehende Mehrkosten in Kauf. 14 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Würdigung der Jury Im Zentrum der historischen Altstadt Saalfelds direkt an der Westseite des Marktplatzes wurde ein aus mehreren Gebäuden unterschiedlichen Alters bestehender Gebäudekomplex saniert und zu einem modernen Bürger- und Behördenhaus umgebaut. Bauherr und Architekt ist es sehr gut gelungen, die denkmalgeschützte historische Situation mit neuen Nutzungen zu besetzen. Anerkennung verdient zum einen der behutsame und rücksichtsvolle Umgang mit den erhaltenswerten Gebäuden und Gebäudeteilen (Hauptgebäude zum Markt, historische Holztreppen-häuser, Saal im 2. Obergeschoß, Innenhöfe) zum anderen aber auch die konsequent zeitgemäße Ausformung der baulichen Ergänzungen. So wird die ursprünglich verwinkelte und unübersichtliche Erschließung des zwischen 1919 und 1925 zum Hotel umgebauten Gebäudeensembles durch einen vorgelagerten Treppenhausriegel mit Aufzug und großzügiger Stahl-Glas-Fassade neu geordnet. Damit werden alle wichtigen Funktionsbereiche des Gebäudes effektiv miteinander verbunden. Die gläserne Erschließungszone und der mit nur wenigen Öffnungen versehene Anschlussbereich der Bestandsgebäude (ehemalige Brandwand) ergeben eine interessante und spannungsreiche Südansicht. Hervorzuheben ist zudem, dass alle aus den neuen funktionalen Anforderungen resultierenden Einbauten weitestgehend ablesbar gestaltet wurden. Insgesamt ist die Sanierung und der Umbau des Bürgerund Behördenhauses »Roter Hirsch« ein gelungenes Beispiel für die zunehmend an Bedeutung gewinnende Umnutzung von historischer Bausubstanz sowie ein wichtiger Beitrag zum Thema Bauen im historischen Kontext. Anerkennung gilt insbesondere auch dem Bauherrn, der die Chancen und Potenziale des Vorhandenen erkannt und vorbildlich genutzt hat. Die Wiedernutzung des seit 1990 überwiegend leer stehenden Baudenkmals in Verbindung mit neuen Gebäudeteilen und Funktionen, die bisher dezentral in Saalfeld verteilt waren, stärkt nachhaltig die Struktur der historischen Kernstadt und ist auch ein positiver Beitrag zum Stadtumbau. 15 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Anerkennung 3.500 € Neubau Materialforschungs- und Prüfanstalt Weimar Coudraystraße 9, Weimar Bauherr Freistaat Thüringen, vertr. durch das Staatsbauamt Erfurt Entwurfsverfasser gildehaus.reich Architekten BDA, Weimar Freianlagenplaner DANE Landschaftsarchitekten, Weimar Kosten 14,4 Mio. Euro Würdigung der Jury Das moderne Forschungs- und Laborgebäude basiert auf dem mit einem Ersten Preis ausgezeichneten Entwurf des im Jahr 1996 durchgeführten beschränkten Architektenwettbewerbes. Mit dem Neubau wurde ein städtebaulicher »Unort« neu geordnet, wobei Teile des bestehenden Hörsaalgebäudes Coudraystraße 9a einzubeziehen waren. Neben der Materialforschungs- und Prüfanstalt nutzt auch die Bauhaus-Universität einen Teil der aufwendig ausgestatteten Forschungsflächen. Mit dem Neubau gelingt eine konsequente Weiterentwicklung/Reparatur des Gebietes, insbesondere durch Aufnahme der Raumkanten in der Coudraystraße und in der Richard-Strauß-Straße. Durch die Außerwinkligkeit des eingebundenen Hörsaales entstehen räumlich interessante Foyer- und Flurbereiche, die dem inneren Erschließungssystem ein hohes Maß an Identität verleihen. Gut gelöst ist die klare funktionale Trennung zwischen Büronutzung entlang der Coudraystraße sowie Labor- und Versuchsräumen an der Richard-Strauß-Straße. Auch konstruktiv hat das Gebäude eine klare Grundstruktur. Alle wesentlichen Tragelemente wurden als Sichtbeton-Fertigteile ausgeführt, die unterzugsfreien Decken ermöglichten eine freie Raumgestaltung und ungestörte technische Installationen. Die Detaillierung ist sauber gestaltet. Die im Hofbereich eingeordnete große Versuchshalle bildet eine in Höhe und Charakteristik eigenständige Entwurfseinheit. Die wegen des begrenzten Grundstücks bescheiden dimensionierten Freiflächen sind wohltuend proportioniert und zurückhaltend ausgebildet. Ihre funktionale Gliederung ermöglicht die vielfältigen notwendigen Nutzungen. Dem öffentlichen Bauherrn ist zu danken, dass er entsprechend seiner baukulturellen Verpflichtung diese städtebauliche Wunde Weimars schloss, auch wenn der Standort mit der Integration des Hörsaalgebäudes, abzubrechenden Bunkeranlagen und zu überbauenden Mediengängen schwierig war. Insgesamt erfährt der bauwissenschaftliche Schwerpunkt in der Coudraystraße mit dem Neubau der MFPA eine bedeutende Aufwertung. 16 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Erläuterungen des Entwurfsverfassers »Wo soll man denn dort überhaupt bauen?« Diese Frage stand am Anfang des - für unser Büro bislang größten Bauvorhabens »Neubau der Materialforschungs- und Prüfanstalt Weimar«; ein Bestandsgebäude, leicht schräg zur umgebenden Bebauung gestrandet, im Inneren teilweise frisch saniert und deshalb erhaltenswert. Davor ein Grünstreifen, kaum breiter als ein Vorgarten. Hinter dem Haus unterirdische Kohlebunker, abgängig, aber eben doch nicht so einfach abzureißen. Daneben ein Siebengeschosser mit Bestandsverpflichtung. Und auf dem Gelände insgesamt sehr wenig Bewegungsfreiheit. Das waren die »harten« Standortbedingungen der Aufgabe. Dazu kamen zwei anspruchsvolle Nutzer (MFPA + BauhausUniversität), ein ebenso anspruchsvolles Raumprogramm und vielfältige Anforderungen an die Freiflächen - vom Freilager für Baustoffe bis zum Außenfoyer für Studierende. Unser Projekt zielt darauf, zwischen all diesen Anforderungen zu vermitteln, ohne dabei selbst »unter die Räder zu geraten«. Maßgeschneidert und dennoch alltagstauglich sind Gebäude und Freianlagen so zueinander und zu ihrer Umgebung platziert, dass Stadtraum und Parzelle eine behutsame Neuordnung erfahren und gleichzeitig sinnvolle Funktionszusammenhänge und interessante Zwischenräume entstehen. Unser besonderes Augenmerk galt dabei der Gestaltung der »öffentlichen Räume« innerhalb des Areals, also der Vorplätze, Eingänge, Foyers und Flure, all der Orte, an und in denen Menschen sich bewegen und einander begegnen. Sie alle sind »Zwischenräume«, werden gebildet von den Oberflächen der Altbauten und der - auf diese reagierenden und mit diesen kommunizierenden - Neubebauung. Sobald diese öffentlichen Räume verlassen werden, liegt das Augenmerk der Raumgestaltung auf der optimalen Nutzbarkeit der Büros, Labors und vielfältigen Spezialräume. Hier wird vor allem ein konzentriertes Arbeiten der Nutzer ermöglicht. 17 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Anerkennung 3.500 € Neubau Mensa- und Unterrichtsgebäude des Aus- und Fortbildungszentrums der Thüringer Polizei, Meiningen Friedenssiedlung 6, Meiningen Bauherr Freistaat Thüringen, vertr. durch das Staatsbauamt Erfurt, Nebenstelle Suhl Entwurfsverfasser Kirchmeier & Brück Architekten BDA, Weimar Freianlagenplaner Planungsgruppe Stadt + Landschaft, Erfurt Kosten 4,8 Mio. Euro Würdigung der Jury Das Gebäude überzeugt durch hohe Funktionalität in der Anordnung der Räume, besonders aber durch seine klare Architektursprache. Die Südfassade wird durch die großzügige Fensterfront der Mensa und die ruhige Wandscheibe der Cafeteria geprägt, an der das Motiv des nach außen aufsteigenden Pultdaches gut ablesbar ist. Die aus den Pultdächern folgenden raumhohen Glasfassaden von Mensa und Cafeteria ermöglichen optimalen Lichteinfall und gute Durchdringung von Innen- und Außenraum, der jedoch - vom Stehen lassen einiger vorhandener Großgehölze abgesehen - keine Gestaltungsabsicht der Verfasser erkennen lässt. Das Motiv von Pultdach und raumhoher Fensterfront taucht an der Westfassade wieder auf und findet in der großen Mauerscheibe des Haupteinganges mit ihren drei unterschiedlichen Höhen eine sehr gelungene Ergänzung. Das Gebäude ist bis ins Detail gut durchgearbeitet, wie man z. B. am »Mensa«-Schriftzug am Vordach des Haupteinganges erkennen kann. Insgesamt handelt es sich um einen sehr ansprechenden Neubau mit hoher Gestaltqualität und Unverwechselbarkeit. 18 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Erläuterungen des Entwurfsverfassers Die Umwidmung der ehemaligen Militäranlagen zu einer modernen Ausbildungseinrichtung der Thüringer Polizei soll - mit einer Reihe von Eingriffen - auch atmosphärisch erlebbar werden. Das Grundstück liegt auf einen Plateau am Stadtrand Meiningens und ist durch eine Abfolge von Kasernengebäuden aus den dreißiger Jahren geprägt. Das zeichenhafte Haus des neuen Kantinen- und Unterrichtsgebäudes nuanciert selbstbewusst, strahlend weiß, die Abfolge der ehemaligen Kasernenbauten. Das Mensagebäude ist zwischen zwei Kasernenbauten an der internen Erschließung des Gesamtareals situiert. Das dreigeschossige Haus hat eine Grundfläche von 33,3 m x 35,5 m und ist in seiner Grundkonstruktion ein konventioneller Mauerwerksbau. Im Erdgeschoss sind die Küche mit Kühllager und der Mehrzwecksaal angeordnet. Der Saal, ist durch die Gebäudeausformung der zwei Pultdächer und der großflächigen Verglasung in zwei Bereiche gegliedert und bietet Möglichkeiten für verschiedene Nutzungen. Den Saalbereichen sind jeweils die unterschiedlichen Ausgabebereiche der Küche zugeordnet. Im Obergeschoss sind Räume für Verwaltung und Lehre angeordnet. Die Technikzentrale, Hausanschlussräume, Nebenräume der Küche und Lager befinden sich im Untergeschoss. Die Volumenentwicklung spiegelt das Innenleben. In den internen Funktionsbereichen werden die drei Themen formuliert: Der Küchenbetrieb, funktional und hygienisch, vollständig in Glas aufgelöst, umfließt einen bernsteingleißenden Kern, der die Kühlräume birgt. Der Saal greift mit zwei gerichteten Raumweitungen über seinen Grundriss und vereinnahmt Umgebung sowie Ausblicke. Das Obergeschoss streckt sich in die Fläche und in die Höhe zum Raumangebot: Ausstellen, Lehren, Erfahren. 19 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Anerkennung 3.500 € Neu- und Umbau der alten Hautklinik zum Hauptgeschäftssitz der Industrie- und Handelskammer Erfurt Arnstädter Straße 34, Erfurt Bauherr Industrie- und Handelskammer Erfurt Entwurfsverfasser hks Architekten + Gesamtplaner GmbH, Erfurt Freianlagenplaner plandrei Dittrich-Luz Landschaftsarchitekten, Erfurt Kosten 7,7 Mio. Euro Würdigung der Jury Bauen im Bestand, Sanierung, Umbau und Anbauten sind verstärkt anspruchsvolle Aufgaben für Architekten. Sie verlangen zum einen Erfahrung bei der erforderlichen Analyse der vorhandenen Bausubstanz, der Einschätzung ihrer Verwendbarkeit für neue Nutzungen und zum anderen Phantasie und Selbstbewusstsein bei der zeitgemäßen Gestaltung erforderlicher Ergänzungen. Die IHK erwarb ein Grundstück mit einer leerstehenden ehemaligen Hautklinik als Ausgangsbasis für einen erforderlichen Bürokomplex. Verwaltungsfunktionen mit den heutigen hohen Anforderungen an Informationstechnik, Beleuchtung, Raumklima und Akustik waren in den vorhandenen denkmalgeschützten Bestand zu integrieren, eine anspruchsvolle Aufgabe für die beauftragten Architekten. Sie legten geschickt die erforderlichen Elektround EDV-Leitungen hinter abgehängte Deckensegel oder schwarze Holzpaneele. Vorhandene erhaltenswerte Bauteile des Altbaus wie Fassadenputz mit Werksteinleibungen, Eichetüren und Deckenstuck wurden aufgearbeitet und damit erhalten. Das Gebäudeensemble wurde mit einem Neubau ergänzt. Dieser Erweiterungsbau harmoniert in Maßstab, Öffnungsstruktur und Farbgebung mit dem Altbau, ist aber in Materialwahl und Gestaltung erkennbar zeitgemäße Architektur in hoher Qualität. Trotz Verwendung langlebiger und ästhetisch hochwertiger Materialien wie Naturstein, Faserzementplatten und Sichtbeton wurden nach Aussage des Bauherren Budget- und Terminvereinbarungen eingehalten. Die begrenzten Freiflächen wurden sinnvoll strukturiert und harmonisch gestaltet. Alle erforderlichen Funktionsbereiche wie Eingangszonen, Terrassenerweiterung am Neubau und Parken sind in hoher Qualität realisiert. Mit dem Umbau und der Sanierung des Bürokomplexes für die IHK in Erfurt ist den Architekten ein hervorragendes Ensemble gelungen. Es erfüllt in großem Umfang die Kriterien des Staatspreises des Freistaates Thüringen nach einer beispielhaften innovativen Lösung für ein öffentliches Gebäude und des umgebenden Freiraumes und erhält deshalb eine Anerkennung. 20 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Erläuterungen des Entwurfsverfassers Zielstellung des Entwurfsverfassers ist die Entwicklung eines verträglichen und angemessenen Neunutzungs- und Raumkonzeptes für das Gebäudeensemble eines Fachkrankenhauses der 50er Jahre durch Rückbau sowie durch ergänzende Neubauten. Ziel des Verfassers ist es weiterhin durch die ergänzenden Neubauten sichtbare Zeichen dieses Nutzungswandels zu setzen und einen städtebaulichen und auch baulichen Beitrag zur Arrondierung des Gesamtensembles im Bereich des Thüringer Landtages zu leisten. In der Betrachtung der denkmalwerten Bausubstanz steht die das Baudenkmal respektierende Instandsetzung und Sanierung bei weitgehendem Erhalt wieder verwertbarer Bausubstanz und zeittypischer Bauelemente und Einbauten sowie die behutsame Integration neuester haustechnischer Anlagen im Vordergrund. Die hinzugefügten Neubauten, in denen alle großflächigen Raumzuschnitte umgesetzt wurden, die im Altbau ohne wesentliche grundrissverändernde Eingriffe nicht integrierbar waren, verfolgen das Ziel, mit zeitgemäßer Formensprache und Gestaltungselementen sowie angemessener Materialwahl das Gebäudeensemble zu ergänzen und gestalterisch aufzuwerten. Die Formensprache, die Fassadengestaltung und die Detailausbildung zwischen Alt- und Neubau unterscheiden sich einerseits bewusst deutlich und erkennbar. Durch die gewählten Materialien, insbesondere deren Farbigkeit und Tektur wird jedoch eine harmonische Verbindung zwischen den verschiedenen Gebäudebereichen erreicht. Die Funktionsaufteilung im Altbau folgt den gegebenen Grundrissstrukturen und wird durch die Neubaubereiche sinnvoll ergänzt. Insbesondere der öffentlich zugängige, großzügige und getrennt nutzbare Eingangsbereich im Erdgeschoss verfügt über verschiedene Zugangsmöglichkeiten vom Innenhof sowie vom öffentlichen Straßenraum, wobei der von 4 Säulen gestützte Haupteingang am Altbau seine dominierende Wirkung behält. Die Entscheidungen zur Materialwahl Außen und Innen verfolgen das Ziel der Nachhaltigkeit und Langlebigkeit und nicht in erster Linie der Preisgünstigkeit. Ebenso stellt das energieeffiziente haustechnische Konzept mit Betonkernaktivierung einen zeitgemäßen Beitrag zur Energieeinsparung bzw. Vermeidung insbesondere von Kühlenergie dar. Durch zeitgemäße, dem Denkmalschutz unterworfene Wärmeschutzmaßnahmen wird auch eine wesentliche Verbesserung des winterlichen Wärmeschutzes insbesondere im Altbau erreicht. Integraler Bestandteil der Hochbauplanung ist das Planungskonzept für die hochwertig ausgestalteten Freiflächen. Belagkonzepte, Farbigkeiten und Beleuchtungsund Bepflanzungsszenarien stellen einen wesentlichen Beitrag zur harmonischen Wirkung des gesamten Gebäudeensembles dar. 21 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Zweiter Wertungsrundgang Neubau Hörsaalgebäude mit Cafeteria (Röntgenbau) der Technischen Universität Ilmenau Weimarer Straße 25, Ilmenau Bauherr Freistaat Thüringen, vertr. durch das Staatsbauamt Erfurt Entwurfsverfasser Nikolic + Partner Architekten, Berlin Freianlagenplaner Nikolic + Partner Architekten, Berlin Kosten 3,1 Mio. Euro Erläuterungen des Entwurfsverfassers Der Experimentierhörsaal befindet sich am Hochschulstandort im Zentrum der Stadt Ilmenau und bildet mit historischen Gebäuden, Curie- und Faradaybau, ein urbanes Ensemble. Der Hörsaal mit 264 Sitzplätzen wird genutzt von den Studierenden der naturwissenschaftlichen und mathematischen Fächer, vorrangig Physik und Chemie. Die Cafeteria versorgt das Hochschulareal in der Stadtmitte. Angelehnt an die architektonische Formsprache des durch mich vor einigen Jahren umstrukturierten und umgebauten historischen Gebäudes des Curiebaus entstand ein autonomer freistehender Baukörper, streng, durch die Funktionen bestimmt, ein kristalliner Quader mit unterschiedlichen durch die jeweiligen dahinter liegenden Funktionsbereiche bestimmten Fassaden: • gläsern entlang des Umganges zur Erschließung, als Foyer zum Schutz vor Witterungen, Wärme, Kälte und Schall an der Süd- und Ostseite des Gebäudes, • geschlossen im Obergeschoss als Abschluss von Sammlung, offen im Erdgeschoss nach Norden als Abschluss der Vorbereitungsräume, • die Hörsaalfunktionen abbildend, aus Glas und Holz, sich zur versenkten Cafeteria öffnend, und somit korrespondierend mit dem vorhandenen Curiebau an der Westseite. Ein Hörsaal mit Tageslicht, simpel strukturiert, klassisch organisiert, aus Beton-Stahl-Glas-Holz erbaut. Erschlossen wird der Hörsaal durch zwei gebäudehohe Holzportale zum Curie- und Faradaybau orientiert. Die Eingangsportale sind ausgestattet mit großen temperaturgesteuerten Lüftungsklappen zur Gewährleistung natürlicher Raumluftkonditionierung der Umgangsflächen und des Foyers. Die Cafeteria mit Innenhof ist versenkt mit Sitzstufen innen und außen. Größe und Kosten minimierend, die Anforderungen der Nutzer akzeptierend, weiterentwickelnd entwarf ich meine architektonische Antwort auf die vorhandene Urbanität, auf funktionale Anforderungen, auf Nutzerwünsche und Vorstellungen, auf die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel und auf die zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen bei Nutzer-Planer-Verwalter. 22 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Umbau Dienstleistungszentrale der Stadtwerke und Stadtwirtschaft Weimar Industriestraße 14, Weimar Bauherr Stadtwerke und Stadtversorgungs- GmbH, Weimar Entwurfsverfasser Kirchmeier & Brück Architekten BDA, Weimar Kosten 3,5 Mio. Euro Erläuterungen des Entwurfsverfassers Die Stadtwerke und Stadtversorgungs- GmbH Weimar haben 2003 das Grundstück in der Industriestraße 14 mit dem Ziel erworben, hier sämtliche Betriebsteile an einem Standort zusammenzuführen. Dabei sollten sowohl strukturelle als auch funktionale und räumliche Synergien nutzbar gemacht werden. Das Grundstück wurde zunächst seinen logischen Grundmustern folgend, neu interpretiert. Die Straßenseite wurde zur öffentlichen Fläche für Besucher. Damit erhält der Komplex seine eindeutige Adresse an der Industriestraße. Die Hofseite wird Betriebshof, Parkplatz für Mitarbeiter und Arbeitshof für den Verkehrsbetrieb. Neue offenere Bürostrukturen wurden im 8-geschossigen Plattenbau untergebracht, der einen großzügigen neuen Erschließungs- und Versammlungsbereich erhält. Das Kundenzentrum hielt Einzug in der ehemaligen Sporthalle. Ein neues Verbindungsgebäude verknüpft den Verwaltungs- und den Kundenbereich mit einem S-förmigen Glaskörper. Dieser fügt sich in die Halle, verbindet mit der Lobby und Cafeteria, stellt sich mit neuer Erschließung an den Plattenbau und legt sich auf diesen mit Konferenz und Ausstellungsräumen. Sowohl die städtebauliche Dichte als auch die Standorte der Gebäude »auf der grünen Wiese« lassen das Nordviertel zur Hinterseite des Bahnhofs werden. Die Qualitäten des Ortes eröffnen sich erst auf den zweiten Blick. Die Hanglage zum Süden ermöglicht einen weiten Blick über das Zentrum, er wird selbst zur Stadtkrone. Die erschlossenen Grundstücke bieten Platz für wachsende Dienstleistungs- und Produktionsansiedlungen. Immer, wenn sich in einem Gebiet eine große Menge an Energie befindet und in einem benachbarten Gebiet nur sehr wenig, tendiert die Energie dazu, von einem Bereich zum anderen zu wandern, bis Gleichgewicht hergestellt ist. Diesen ganzen Prozess kann man als eine Tendenz zur Demokratie bezeichnen. Der Entwurf bedient sich dieses Argumentes zur Definition des Verbindungspavillons. Der Ort an sich ist exzentrisch. Den hohen Verwaltungsbau vor sich, die lange weite Halle neben sich, wirkt der Glaspavillon als Entree und Bindeglied. Die Lobby mit der Cafeteria erfüllt den Wunsch nach Treffpunkt und Kommunikation intern und extern. Der neue Verwaltungskomplex stellt sich als weißer strahlender Baukörper in einer heterogenen Industrie- und Produktionsumgebung dar. 23 Zweiter Wertungsrundgang THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Zweiter Wertungsrundgang Neubau Gefahrenabwehrzentrum an der Bundesautobahn 71/73 in Suhl / Zella-Mehlis Rennsteigstraße 10, Zella-Mehlis Bauherr Freistaat Thüringen, vertr. durch das Staatsbauamt Erfurt, Nebenstelle Suhl Entwurfsverfasser Kirchmeier & Brück Architekten BDA, Weimar Freianlagenplaner Kirchmeier & Brück Architekten BDA, Weimar Kosten 12,8 Mio. Euro Erläuterungen des Entwurfsverfassers Der Freistaat Thüringen stand mit der Entscheidung zum Bau der Bundesautobahn A71/A73 durch den Thüringer Wald vor dem Problem der Organisation einer effizienten Gefahrenabwehr speziell entlang des ca. 14 km langen Tunnel- und Brückensystems von Geraberg bis Suhl. Trotz modernster technischer Ausstattung und Überwachung der Tunnelanlagen bestand die Aufgabe, eine Lösung zu finden, die insbesondere bei Großschadenslagen Voraussetzungen bietet, die komplexen Aufgaben aller Sicherheits- und Rettungsdienste zu koordinieren und zu bewältigen. Mit der Errichtung des Gefahrenabwehrzentrums nutzte der Freistaat Thüringen die Chance über die reine Funktion hinaus ein wahrnehmungswirksames Zeichen zu setzen; Imagebildung als standortübergreifende Maßnahme. In dem Gebäudekomplex sind nunmehr die Verkehrspolizeiinspektion, die Feuerwehr der Stadt Suhl mit der Tunnelfeuerwehr, der Rettungsdienstzweckverband Südthüringen mit der Zentralen Leitstelle und Teile des Katastrophenschutzes des Landkreises SchmalkaldenMeiningen untergebracht. Das Grundstück befindet sich in einem Industriegebiet in Zella-Mehlis. Der Standort des GAZ wird eingespannt zwischen der neuen Autobahn und dem dahinter liegenden Naturschutzgebiet des Thüringer Waldes. Der Entwurf bezieht sich auf dieses diametrale Nebeneinander und reiht sich zwischen die beiden Extreme. Die Gebäudeform markiert den Grenzverlauf entlang des Naturschutzgebietes, eröffnet den verschiedenen Nutzungen separate Außenräume und folgt mit seiner Länge von über 135 m dem Verlauf der Autobahn. Das Haus markiert den Ort und fügt sich dem Verlauf begleitend ein. Die verschnittenen Dachformen unterstreichen die skulpturale Ausformulierung des Körpers. Diese fünfte Ansicht mit den Verschränkungen des Körpers soll einerseits die fünf verschiedenen Nutzungen unter einem Dach zusammenfassen und in ihrer Komplexität nachzeichnen, jedoch andererseits auch ablesbar lassen. Die einheitlich kräftige Materialisierung der anthrazitfarbenen Fassade stärkt diese Intention. 24 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Sanierung und Umbau Mozarthaus des Musikgymnasiums Weimar-Belvedere Schlosspark Belvedere, Weimar Bauherr Freistaat Thüringen, vertr. durch das Staatsbauamt Erfurt Entwurfsverfasser Aschenbach Architekten BDA, Weimar Kosten 2,0 Mio. Euro Erläuterungen des Entwurfsverfassers Als Einzeldenkmal ist das Mozarthaus Teil der Schloss- und Parkanlage auf dem Belvedere in Weimar und eines von vier Kavaliershäusern, die sich um den Ehrenhof und die barocke Hauptachse gruppieren. Das ursprüngliche Wohngebäude der Dienerschaft mit Stall und Remise (Bogenbau), um 1730 errichtet, gliedert sich in drei Baukörperteile: Turmhaus, Langhaus und Bogenbau. Aufgabe war es, das barocke Kavaliershaus zu sanieren und Unterrichtsräume, einen Chorsaal und einen Sportsaal unterzubringen. Die historischen Innenraumstrukturen bildeten in der Regel kleine Räume, die besonders in den Obergeschossen als Instrumentalübungsräume saniert, instand gesetzt und raumakustisch befähigt wurden. Größere Umbauten erfolgten erdgeschossig für einen Chor- und Kammermusiksaal sowie den Sportsaal im Bogenbau, dessen Bodenniveau um ca. 1,20 m abgesenkt wurde. Der Bogenbau wurde vollständig entkernt, die nicht bauzeitlichen Quer- und Längswände abgebrochen. An den Stirnseiten des Sportsaals bilden schalldämpfende Prallwandpaneele eine Aufkantung des Fußbodens, im Material wie das Sportbodenparkett. Im Sportsaal wurde eine Akustikdecke eingebracht, die wie die Fensterbereiche ballwurfsicher ausgebildet wurde. Ein zweiter baulicher Rettungsweg wurde durch eine neue Stahlaußentreppe am Westgiebel realisiert, die mit einem Wandschirm aus verzinkten Stahlrosten (Rankgerüst) abschließt. Die Holzständerstrukturen von Turm- und Langhaus wurden erhalten oder als Fachwerkwände neu aufgeführt. Eine Fortführung der vor Ort vorgefundenen Lehmbautradition ermöglicht die Einhaltung des Mindestwärmeschutzes an den durchschnittlich 12 cm dicken Fachwerkaußenwänden und die Reduzierung des Primärenergieverbrauchs um über ein Drittel. Raumgestaltung, Wand- und Deckenfarben, die neuen Holzfußböden folgen in ihrer Modernität Vorbildern der Entstehungszeit. Neue Raumbereiche markieren sich durch signifikante Helligkeit und räumliche Größe. 25 Zweiter Wertungsrundgang THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Erster Wertungsrundgang Neubau Verwaltungsgebäude Griesson-de Beukelaer Kahla Im Camisch 1, Kahla Bauherr Griesson-de Beukelaer GmbH & Co. KG, Polch Entwurfsverfasser 1a architekt und stadtplaner d. kowalczik, Koblenz Freianlagenplaner 1a architekt und stadtplaner d. kowalczik, Koblenz Neubau Infocenter Griesson-de Beukelaer Kahla Im Camisch 1, Kahla Bauherr Griesson-de Beukelaer GmbH & Co. KG, Polch Entwurfsverfasser 1a architekt und stadtplaner d. kowalczik, Koblenz Landschaftsarchitekt 1a architekt und stadtplaner d. kowalczik, Koblenz Evangelische Grundschule Gotha An der Wolfgangwiese, Gotha Bauherr Föderation Ev. Kirchen in Mitteldeutschland, Eisenach Entwurfsverfasser nitschke + donath architekten GmbH, Weimar Freianlagenplaner nitschke + donath architekten GmbH, Weimar Umbau zum Grundschulhort Neustadt an der Orla Kirchplatz 3, Neustadt an der Orla Bauherr Stadt Neustadt an der Orla Entwurfsverfasser Planungsbüro Sprigade, Pößneck Freianlagenplaner Planungsbüro Sprigade, Pößneck Ersatzneubau »Haus hinter dem Stadttor« Neustadt an der Orla Pößnecker Straße 1, Neustadt an der Orla Bauherr Stadt Neustadt an der Orla Entwurfsverfasser Dipl.-Ing. Wolfram Sittel, Schöndorf Freianlagenplaner Dipl.-Ing. Wolfram Sittel, Schöndorf 26 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Erster Wertungsrundgang Neubau Kindertagesstätte Hirschberg Friedrich-Fröbel-Strasse, Hirschberg Bauherr AWO-Sozialmanagement gGmbH, Pößneck Entwurfsverfasser Greim Architekten BDA, Bayreuth Freianlagenplaner Greim Architekten BDA, Bayreuth Neubau Abbe-Zentrum des Wissenschaftscampus Jena-Beutenberg Hans-Knöll-Straße 1, Jena Bauherr Ernst-Abbe-Stiftung, Jena Entwurfsverfasser gmp-Architekten von Gerkan, Marg+Partner, Hamburg Freianlagenplaner gmp mit Büro Hagel, Berlin Umbau Sportgymnasium »Pierre-de-Coubertin« Erfurt Mozartallee 4, Erfurt Bauherr Freistaat Thüringen, vertr. durch das Staatsbauamt Gera Entwurfsverfasser Gruber & Bollwahn Architekten, Erfurt Freianlagenplaner Gruber & Bollwahn Architekten, Erfurt Neubau Justizzentrum Jena Rathenaustraße 13, Jena Bauherr Hannoversche Leasing GmbH & Co. KG, Pullach Entwurfsverfasser Gruber & Bollwahn Architekten, Erfurt Freianlagenplaner Landschaftsarchitekt Werner Kurze, Erfurt Umbau Kompetenzzentrum der Fachhochschule Nordhausen Weinberghof, Nordhausen Bauherr Freistaat Thüringen, vertr. durch das Staatsbauamt Erfurt Entwurfsverfasser Ewald + Lopp + Schmidt Architekten, Weimar Freianlagenplaner Ewald + Lopp + Schmidt Architekten, Weimar 27 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Staatspreise Übersicht 1996 Neubau Musikgymnasium Schloss Belvedere, Weimar Bauherr Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Entwurf Architekturbüro van den Valentyn, M. Oreyzi, Köln 1998 Neubau Multifunktionshalle Meiningen Bauherr Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Stadt Meiningen Entwurfsverfasser Architekt Peter Kulka, Köln 2000 Neubau Bundesarbeitsgericht Erfurt Bauherr Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Staatsbauamt Erfurt Entwurfsverfasser Architektin Gesine Weinmiller, Berlin 2002 Neu- und Umbau Justizzentrum Meiningen Bauherr Livida Molaris GmbH & Co. KG, Erfurt Entwurfsverfasser KBK Architekten Belz, Kucher, Lutz, Stuttgart 28 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Staatspreise Übersicht 2004 Umbau und Sanierung Marie-Curie-Gymnasium, Bad Berka Bauherr Landkreis Weimarer Land, Apolda Entwurfsverfasser Junk & Reich Architekten, Weimar 2004 Neubau Oper Erfurt Bauherr Stadt Erfurt Entwurfsverfasser PFP Architekten Hamburg / WES & Partner Hamburg 2006 Erweiterungsbau der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek Weimar Bauherr Klassik Stiftung Weimar Entwurfsverfasser Prof. Hilde Barz-Malfatti und Prof. Karl-Heinz Schmitz, Weimar 2006 Neubau Bibliotheks- und Hörsaalgebäude der Bauhaus-Universität Weimar Bauherr Freistaat Thüringen, vertr. d. d. Staatsbauamt Erfurt Entwurfsverfasser meck architekten mit Stephan Köppel, München 29 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Staatspreis in Stichworten Termine 15.02.2006 15.05.2006 21.06.2006 15.11.2006 Auslobung Ende der Bewerbungsfrist Jurysitzung Preisverleihung im Thüringer Landtag Auslobung Dr.-Ing. Angelika Krause Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr, Erfurt Vorprüfung Architekt BDA Dipl.-Ing. Hartmut Strube Präsident der Architektenkammer Thüringen, Erfurt Architekt Dipl.-Ing. Mathias Heller Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr, Erfurt Dipl.-Ing. für Bauwesen (FH) Cornelia Vogel Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr, Erfurt Preisgericht Architekt Prof. Dr.-Ing. Gerd Zimmermann (Vorsitzender) Rektor der Bauhaus-Universität Weimar Dr.-Ing. Klaus Göbel Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr, Hochbauabteilung, Erfurt Architekt Dipl.-Ing. Konrad Ballheim Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr, Städtebauabteilung Erfurt Architekt BDA Dipl.-Ing. Hartmut Strube Präsident der Architektenkammer Thüringen, Erfurt Architekt Prof. Dipl.-Ing. Michael Mann Fachhochschule Erfurt Architekt Dipl.-Ing. Olaf Baum Weimar Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. Wolfram Stock Jena Bewertungskriterien • Architektur- und Ingenierbauqualität • städtebauliche Einordnung und Freiflächengestaltung • Ausführungsqualität • stadt- und bauökologische Qualität • energie-, kosten- und flächensparendes Bauen und Betreiben / Wirtschaftlichkeit • Behindertengerechtigkeit • Funktionalität / Bauherrenzufriedenheit Es waren beispielhafte und innovative Lösungen für öffentliche Gebäude und Gewerbebauten einzureichen, die den Zielen eines modernen Städtebildes entsprechen. 30 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Impressum Herausgeber Freistaat Thüringen Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr Werner-Seelenbinder-Straße 8 99096 Erfurt Tel. 0361-37 91 740 Fax 0361-37 91 749 www.thueringen.de/tmbv © Copyright Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwertung der Texte, Bilder und des Logos auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung des Rechtsinhabers urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen. Urheber Logo Bildhauer Lutz Hellmuth, Erfurt Fotonachweis Carlo Bansini, Erfurt: Seite 27 2. von unten Falko Behr, Erfurt: Seite 14 - 15, 29 oben Digitalstudio-Die Falken Ltd., Egstedt: Seite 3 gildehaus.reich Architekten, Weimar: Seite 16 - 17 Karl-Heinz Greim, Bayreuth: Seite 27 oben Steffen Michael Groß, Weimar: Seite 25 Roland Halbe, Stuttgart: Seite 28 unten Michael Heinrich, München: Seite 2, 29 unten Mathias Heller, Erfurt: Seite 11 oben und Mitte, 18 oben und unten, 19 Mitte und unten, 22 - 23, 26, 27 2. von oben, 28 2. von unten, 29 2. von oben Jörg Hempel, Aachen: Seite 20 - 21 Kirchmeier & Brück, Weimar: Seite 24 oben Rainer Mader, Köln: Seite 28 oben Detlef Marschall, Weimar: Seite 27 unten Michael Miltzow, Weimar: Titel, Seite 10, 11 unten, 12, 13 Jürgen Norwig, Erfurt: Seite 18 Mitte, 19, 27 Mitte Punktum, Leipzig: Seite 28 2. von oben Simone Rosenberg, München: Seite 24 außer oben Ulrich Schwarz, Berlin: Seite 4 - 9, 29 2. von unten Die Projekte sind innerhalb ihrer Kategorie in der Reihenfolge des Eingangs dargestellt. Die Abbildungsrechte der Fotografien und Pläne liegen, soweit nicht anders ausgewiesen, bei den Entwurfsverfassern. Für die Vollständigkeit der Angaben und Wahrung der Urheber-, Foto- sowie Autorenrechte seitens der beteiligten Planer übernimmt der Herausgeber keine Gewähr. Die Nutzungsrechte sind dem Herausgeber durch die Einreicher kostenfrei übertragen worden. Gestaltung und konzeptionelle Bearbeitung Mathias Heller Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr, Erfurt Satz und Druck Handmann Werbung Erfurt Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier Redaktionsschluss September 2006 31 THÜRINGER STAATSPREIS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU 2006 Verteilerhinweis Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Freistaats Thüringen herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Die genannten Beschränkungen gelten unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Druckschrift dem Empfänger zugegangen ist. Den Parteien ist es jedoch gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. 32