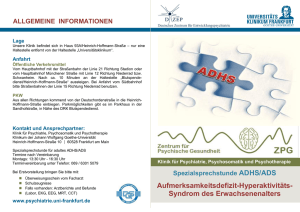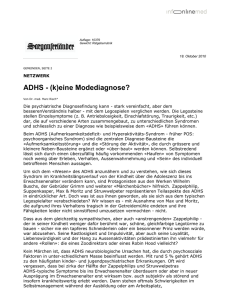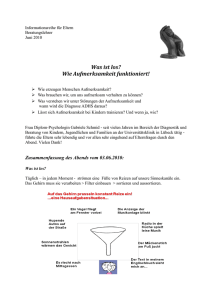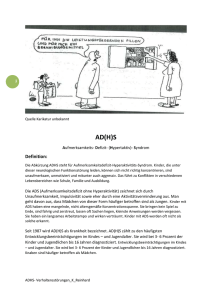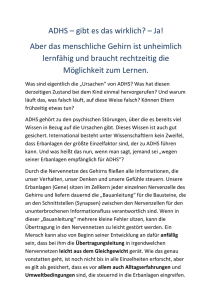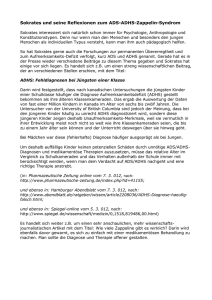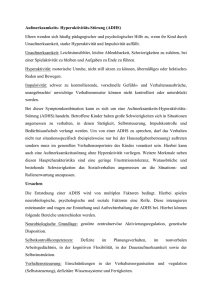ADHS in der Schule - Salzmann
Werbung
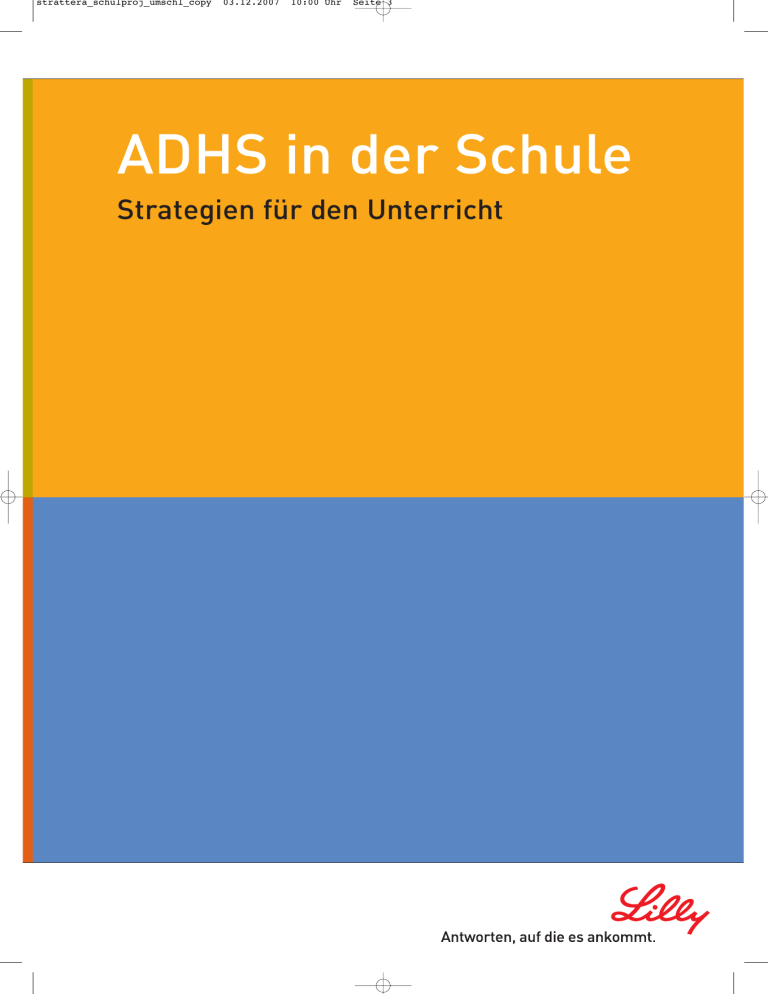
strattera_schulproj_umschl_copy 03.12.2007 10:00 Uhr Seite 3 ADHS in der Schule Strategien für den Unterricht strattera_schulproj_umschl_copy 03.12.2007 10:00 Uhr Seite 4 strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 1 strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 2 Autoren Barbara Bargelé Bundesverband Arbeitskreis Überaktives Kind e. V. (AÜK e. V.) Dr. Jürgen Bausch Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Allgemeinmedizin Ehrenvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen Monika Bohn Gymnasiallehrerin, systemisch-lösungsorientierte Beraterin und Supervisorin, Heilpraktikerin Psychotherapie Cordula Neuhaus Diplom-Psychologin, Diplom-Heilpädagogin, Psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, Verhaltenstherapeutin Dr. Jan-Hendrik Puls Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Hochschulambulanz für Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein Campus Lübeck Prof. Dr. Franz Resch Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Heidelberg Gabriele Schmid Diplom-Psychologin Hochschulambulanz für Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, Campus Lübeck Prof. Dr. Michael Schulte-Markwort Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Ärztlicher Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychosomatik des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf (UKE) ❮2❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 3 Inhaltsverzeichnis Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Wissen, was ADHS bedeutet Vorbemerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Was ist ADHS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Symptome, Ursachen, Diagnose und Therapie von ADHS Was bedeutet ADHS für den Lehrer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Fallbeispiel: Burn-out-Syndrom und vorzeitige Berentung Was bedeutet ADHS für betroffene Kinder? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Fallbeispiele: Felix und Saskia Strategie-Bausteine für Lehrer Vorbemerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Fragebogen zur Verhaltensbeobachtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Grundlage für weitere pädagogische Maßnahmen Gesprächsleitfaden Elterngespräch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Empfehlungen für ein Gespräch mit den Eltern von Felix Gesprächsleitfaden Schülergespräch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Empfehlungen für ein Gespräch mit Felix Modularer Leitfaden für den Unterricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Anwendung von ausgewählten Techniken im Unterricht Hilfreiche Informationen Informationen zu gesetzlichen Ansprüchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zusätzliche Unterstützung für ADHS-Kinder und deren Eltern Informationsquellen zu ADHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Hilfreiche Empfehlungen für Eltern Glossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Was versteht man unter …? Eckpunktepapier des BMGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Eckpunkte der Ergebnisse der vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung durchgeführten interdisziplinären Konsensuskonferenz zur Verbesserung der Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) Kopiervorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ADHS in der Schule, 2. überarbeitete Auflage, 2006; PPPP Service ❮3❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 4 Vorwort Liebe Lehrerin, lieber Lehrer, wie Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, geben Angehörige Ihrer Berufsgruppe im Vergleich zu anderen Akademikern vergleichsweise häufig ihren Beruf auf. Der Anteil krankheitsbedingter Frühpensionen bei Lehrern liegt seit zehn Jahren zwischen 50 und 60 Prozent. Ursache hierfür ist nicht selten eine vollkommene psychische wie auch körperliche Erschöpfung („Burn-out“) infolge der schwierigen alltäglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Eine wunschgemäße Unterrichtsgestaltung und ein störungsfreier Unterrichtsablauf scheinen aus außerordentlich vielen Gründen erschwert zu sein – Lehrer zu sein ist offensichtlich kein leichter Job in der heutigen Zeit. Dass es sich bei ADHS um eine ernst zu nehmende Erkrankung handelt (und nicht um ein Erziehungsproblem o. Ä.), steht außer Zweifel. Dies ist nicht nur Stand der Wissenschaft, sondern auch die Politik hat sich bereits intensiv mit ADHS beschäftigt. So hat das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS) im Jahre 2002 ein Eckpunktepapier zur Verbesserung der Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit ADHS verabschiedet, das klare Forderungen hinsichtlich der dringend nötigen Aufklärung über das Krankheitsbild ADHS und der Anerkennung der multimodalen Therapie, inklusive der medikamentösen Therapie, enthält (s. „Hilfreiche Informationen“). Besonders belastend für den Lehrer ist vor allem der Umgang mit problematischen Kindern in der Klasse. Unruhige und ungezogene Kinder hat es zwar schon immer gegeben, aber es hat den Anschein, dass es nicht nur immer schwieriger wird, mit ihnen umzugehen, sondern es auch immer mehr Kinder gibt, die eine besondere Aufmerksamkeit des Lehrers erfordern – eine fast unlösbare Aufgabe in Anbetracht großer Klassen und straffer Lehrpläne. In diesem Eckpunktepapier wird vor allem deutlich, wie wichtig die Zusammenarbeit aller beteiligten Gruppen bei der Behandlung von ADHS ist, dass Eltern, Ärzte und Lehrer „an einem Strang ziehen“. Sie als Lehrer können hier einen wichtigen Beitrag leisten, indem Sie frühzeitig auf Auffälligkeiten hinweisen, den Arzt mithilfe Ihrer Beobachtungen bei der Diagnosestellung unterstützen und die in Frage kommenden Therapiemaßnahmen mittragen. Die Mitarbeit der Eltern vorausgesetzt, können Sie also entscheidend dazu beitragen, dass Kindern mit ADHS frühzeitig und adäquat geholfen wird, diese somit – nicht nur in schulischer bzw. beruflicher Hinsicht – eine Zukunftsperspektive haben. Zu den problematischen Kindern gehören auch diejenigen, die an der Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS) leiden. Bestimmt haben Sie von ADHS schon gehört, gelesen oder auch selbst bereits Erfahrungen mit ADHS-Kindern in der Klasse gemacht – bei rund 500.000 betroffenen Kindern in Deutschland müsste sich rein statistisch gesehen in jeder Schulklasse durchschnittlich ein Kind mit ADHS befinden. Die Kernsymptome dieser Erkrankung (Unaufmerksamkeit, Impulsivität, Hyperaktivität) ermöglichen es den Betroffenen mitunter nicht, dem Unterricht zu folgen, und erschweren es Ihnen als Lehrer, einen geordneten Unterricht durchzuführen. ❮4❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 5 Vor diesem Hintergrund, vor allem aber auch angesichts der Probleme, die Sie als Lehrer im Umgang mit ADHS-Kindern tagtäglich zu bewältigen haben, haben wir uns als Autoren dieses Manuals zusammengefunden, um Ihnen im Rahmen eines neuen Konzepts Hilfestellung bei dieser speziellen pädagogischen Herausforderung zu bieten. „Wir“ sind Pädagogen, Psychologen, Psychotherapeuten und Ärzte, die sich bereits intensiv mit dem Thema ADHS in der Schule auseinander gesetzt haben. Mit dem vorliegenden Manual möchten wir Ihnen die erforderliche Kompetenz im Umgang mit ADHS-Kindern vermitteln, dadurch Ihren Stress abbauen, was sich positiv auf die gesamte Unterrichtsgestaltung und Ihre Berufsgesundheit auswirken kann. Wir hoffen, dass Ihnen das Manual gefällt und es Ihnen vor allem in Ihrer täglichen Arbeit von Nutzen sein wird. Über Rückmeldungen würden wir uns sehr freuen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! Barbara Bargelé, Dr. Jürgen Bausch, Monika Bohn, Cordula Neuhaus, Dr. Jan-Hendrik Puls, Prof. Dr. Franz Resch, Gabriele Schmid, Prof. Dr. Michael SchulteMarkwort Das Manual besteht aus zwei Teilen: • Im ersten Teil möchten wir Ihnen erklären, was in Kindern im wahrsten Sinne des Wortes „vorgeht“, die aufgrund von ADHS über Tisch und Bänke springen, wie abwesend erscheinen oder sich partout nicht für längere Zeit auf eine Sache konzentrieren können. Anhand aktueller medizinischer Daten zu Ursachen, Diagnostik sowie Therapie von ADHS und Fallbeispielen möchten wir Ihnen das notwendige Hintergrundwissen zu ADHS an die Hand geben und Ihnen verdeutlichen, welche Auswirkungen ADHS für alle Beteiligten haben kann. • Im zweiten Teil geht es um die konstruktive Bewältigung von typischen Belastungssituationen. Sie finden dort Empfehlungen zu Vorgehensweisen, wie zum Beispiel einen modularen Unterrichtsleitfaden, der Ihnen ganz konkret aufzeigt, wie Sie den Unterricht mit einem ADHS-Kind gestalten können. ❮5❯ strattera_schulproj_inh ❮6❯ 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 6 strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 7 Vorbemerkung Lösungen für Probleme lassen sich leichter finden, wenn die aktuelle Situation von den Beteiligten in der gleichen Weise wahrgenommen wird, wenn die Erklärungsansätze für die aufgetretenen Probleme ähnlich sind, wenn Einigkeit darin besteht, welche Ziele als Erstes verfolgt werden sollen, und wenn auf allen Seiten akzeptiert wird, dass es auf diesem Weg zu weiteren Absprachen kommen kann, um die gesetzten Ziele zu erreichen. In Bezug auf ADHS ist es für Lehrer und Eltern ein erster wichtiger Schritt, über ein gemeinsames und gut begründetes Wissen zu verfügen, worin sich ADHS äußert und was das für das Kind und alle weiteren Beteiligten in ihrer besonderen Situation bedeutet. Aus diesem Grund finden Sie in diesem ersten Kapitel sowohl Informationen zum Krankheitsbild ADHS („Was ist ADHS?“) als auch Fallbeispiele, die deutlich zeigen, was ADHS konkret für den Lehrer und die betroffenen Kinder bedeuten kann. Sie geben Ihnen die Möglichkeit zu überprüfen, was Ihnen daran bekannt vorkommt oder neu erscheint. Die eine oder andere Beschreibung deckt sich sicherlich mit Ihren Erfahrungen und wird diese – abhängig von Ihrem Vorwissen – gegebenenfalls in ein anderes Licht rücken. Als Lehrer verbringen Sie viele Stunden des Tages mit Ihren Schülerinnen und Schülern. Sie verfügen über die entsprechende pädagogische Kompetenz, Kinder gemäß ihren Fähigkeiten zu fördern, sie zu bilden und zu erziehen. Zudem erleben Sie die Kinder in der Schule in einem völlig anderen sozialen Kontext als die Eltern. Ein geschärfter Blick für das Krankheitsbild ADHS wird es Ihnen ermöglichen, die ersten Weichen für eine Differenzialdiagnostik von auffälligen Kindern zu stellen und – für Sie als Lehrer entscheidend – den Unterricht mit einem ADHS-Kind in der Klasse so zu gestalten, dass er entspannter ist. ❮7❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 8 Was ist ADHS? Symptome, Ursachen, Diagnose und Therapie von ADHS Nomenklatur Mit der Abkürzung ADHS bezeichnet man die Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung. Häufig trifft man auf weitere Bezeichnungen und Abkürzungen, die für bestimmte Ausprägungen oder Subtypen der gleichen Erkrankung verwendet werden. Wir benutzen in unserem Manual einheitlich die Abkürzung ADHS – nur an den Stellen, an denen eine genauere Spezifizierung des Krankheitsbilds für das Verständnis wichtig ist, weichen wir davon ab. 3 = 4 : 2 2 1 = x4 4 = 3 : 2 2 1 = 3 4x 6 = 2 : 12 2 1 = 2 6x Störungsbild Aufmerksamkeitsstörungen können mit und ohne Hyperaktivität (ADHS/ ADS) auftreten. Um von ADHS sprechen zu können, müssen die Symptome bereits vor dem Alter von sieben Jahren aufgetreten sein und länger als ein halbes Jahr vorliegen. Insgesamt entsprechen die Auffälligkeiten und das Verhalten der Kinder nicht ihrem Alter. Betroffen sind etwa 3 bis 7 Prozent der Kinder im schulpflichtigen Alter. Häufige ADHS-Kernsymptome Unaufmerksamkeit • schlechte Konzentration • leichte Ablenkbarkeit • Vergesslichkeit Impulsivität • ständiges Unterbrechen und Stören anderer • Herausplatzen mit Antworten • nicht warten können Hyperaktivität • • • • extremer Bewegungsdrang motorische Unruhe ständiges Laufen und Klettern Ruhelosigkeit/Getriebenheit Es fällt den Kindern schwer, ihre Aufmerksamkeit gezielt und über eine längere Zeitspanne hinweg Aufgaben zu widmen, besonders wenn diese subjektiv als schwierig oder langweilig erachtet werden. Auch können sie sich nicht schnell von einer Situation auf eine andere umorientieren, wenn ihre Aufmerksamkeit bereits durch eine bestimmte Sache oder Person gebunden ist. Dazu kommt, dass der Wahrnehmungsstil dieser Kinder oberflächlich und flüchtig und dadurch mit einer entsprechend hohen Fehlerwahrscheinlichkeit behaftet ist. Sie nehmen oft ihre Umwelt nicht wertungsfrei wahr, sondern eher einseitig, direkt bewertend und polarisierend. Begleitet wird dies häufig von raschen Stimmungsumschwüngen mit extremen Gefühlsausprägungen: Die Kinder sind in einem Moment überschwänglich begeistert, im nächsten beleidigt und im übernächsten „stinksauer“. Sie steigern sich in diese Gefühle hinein, ohne dies zu wollen. ❮8❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 9 Besonders problematisch für die soziale Interaktion ist, dass kein „automatischer Perspektivwechsel“ heranreift: ADHS-Kinder können sich nicht wie ihre Altersgenossen in andere hineinversetzen oder automatisch vorwegnehmen, was der andere sieht oder wie er handeln wird. Auch ist die Latenz, bis sie Regeln oder sie nicht interessierende Lerninhalte verinnerlicht haben, bedeutend höher als bei Nichtbetroffenen. Bei ADHS-Kindern kann man sozusagen von einer „seelischen Entwicklungsverzögerung“ sprechen. Die Probleme sind nicht nur auf bestimmte Situationen wie Schule oder Hausaufgaben beschränkt, sondern treten fast durchgehend In Deutschland sind auf. Nur bei optimalen Bedingungen und in Einzelfällen können Kinder mit ADHS etwa gleich lange bei der Sache bleiben ca. 500.000 Kinder im schulpflichtigen Alter wie ihre Altersgenossen. Die Kernsymptome an ADHS erkrankt. Das Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität können bedeutet, dass sich im durch weitere Schwierigkeiten wie z.B. eine schlechte soziale Durchschnitt in jeder Integration, Aggressivität, mangelhafte Schulleistungen und Schulklasse ein betrofgefahrenträchtiges Verhalten ergänzt werden. Dabei handelt fenes Kind befindet. es sich um sekundäre Probleme, die aufgrund von ADHS erst entstehen. Jungen sind häufiger betroffen als Mädchen, manchmal wird das Vorliegen der Störung bei Mädchen aber auch einfach übersehen. Besonders weil sie häufiger an der eher unauffälligen Variante dieser Erkrankung leiden – ADS –, die ohne Hyperaktivität einhergeht. Die Kinder gelten als verträumt oder abwesend und vergesslich, an eine behandlungsbedürftige Störung denkt oft zunächst niemand. Ursachen und deren Auswirkungen ADHS ist eine neurobiologische Erkrankung: Im Vergleich zu Nichtbetroffenen zeigen sich bei Erkrankten neben strukturellen Unterschieden Auffälligkeiten in bestimmten Botenstoffsystemen im Gehirn, die für die Informationsübertragung von Zelle zu Zelle zuständig sind. Insbesondere Dopamin und Noradrenalin spielen hier eine wichtige Rolle. Offensichtlich nutzen Betroffene in der Folge ihre neuronalen Netzwerke anders. Es fällt ihnen schwer, in einer vernetzten und geordneten Arbeitsweise komplexe Aufgaben zu bewältigen, wichtige und unwichtige Wahrnehmungen voneinander zu unterscheiden und diese Informationen in der Handlungsplanung zu berücksichtigen. Ihr Kurzzeitspeicher entwickelt nicht die normale Kapazität, der Spontanabruf von Gedächtnisinhalten und die Integration neuer Informationen sind ebenfalls problematisch. Dadurch können ADHS-Kinder nicht effektiv aus Erfahrungen lernen, und es entsteht kein Gefühl für Zeit, so dass das Einteilen von Zeit oft misslingt. Das Ungleichgewicht im Stoffwechsel des Stirnhirns, in dem die so genannten exekutiven Funktionen reguliert werden, macht es den Kindern schwer, Prioritäten zu setzen. Die Fähigkeiten, reife und ausgewogene Entscheidungen zu treffen sowie planvoll und zielgerichtet zu handeln, sind nicht ausreichend entwickelt. ❮9❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 10 Vorderes Aufmerksamkeitssystem Präfrontaler Kortex (Großhirnrinde im vorderen Stirnlappen) Dopamin: spielt eine wesentliche Rolle bei Antrieb und Motivation Hinteres Aufmerksamkeitssystem Hinterer parietaler Kortex (Großhirnrinde im Scheitellappen) Aufmerksamkeit Impulsivität Motorik Noradrenalin: spielt eine wesentliche Rolle bei der Aufmerksamkeit Modifiziert nach Pliska et al. (1996): Catecholamines in attention-deficit hyperactivity disorder. J Am Acad Cild Adolesc Psychiatry, 35 (3): 264–272, sowie Himelstein et al. (2001): The neurobiology of attention-deficit hyperactivity disorder. Front Biosci 5: D461–78 Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat deutliche Fortschritte gemacht, aber noch keine vollständige Aufklärung der Ursachen von ADHS erzielen können. Man geht heute davon aus, dass viele verschiedene Faktoren an der Entstehung und Ausprägung von ADHS beteiligt sind (z. B. biologische und/oder psychosoziale Einflüsse). Als ADHS ist eine neurogesichert kann gelten, dass die Dysregulation des Hirnbiologische Funktionsstoffwechsels in hohem Maße von genetischen Faktoren störung mit einer hoabhängt. Darum sind nicht nur häufig mehrere Kinder hen genetischen Komeiner Familie betroffen, sondern möglicherweise auch ponente. ADHS wird ihre Eltern und später ihre eigenen Kinder. keinesfalls durch das Verhalten oder die Entsprechend den neurobiologischen Befunden zeigen Erziehung der Eltern die wissenschaftlichen Studien klar, dass die elterliche verursacht. Erziehung keinesfalls die Ursache von ADHS ist. Verlauf In der Rückschau berichten Eltern häufig, dass schon die allerersten Lebensjahre anders verlaufen seien als bei anderen Kindern. Im Kindergarten werden viele Familien erstmals auf das schwierige Verhalten ihrer Kinder angesprochen. Mit dem Schulbeginn können die Kernsymptome immer eindeutiger beschrieben werden. Wenn in der PuADHS wächst sich nicht bertät bei vielen Patienten die motorische Unruhe spürbar aus. Bei rund zwei Dritnachlässt, hoffen viele, die Probleme seien nun zu Ende. teln bleiben die SympDoch Unaufmerksamkeit und Impulsivität bestehen fort, tome bis ins Erwachseund insbesondere ihr vorschnelles und unüberlegtes Hannenalter – wenn auch deln bringt die Jugendlichen bei fehlender Unterstützung in veränderter Form – immer wieder in Schwierigkeiten. Der Konsum von legalen erhalten. Meist domiund illegalen Drogen ist höher als bei Altersgenossen, und niert die Aufmerksamoft kommt es zu kleineren oder größeren Straftaten. Die keitsstörung. Betroffenen sind häufiger in Verkehrsunfälle verwickelt ❮10❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 11 und haben Probleme in der Schule sowie später am Ausbildungs- und Arbeitsplatz. Rund zwei Drittel der Kinder werden auch als Erwachsene noch unter den Symptomen von ADHS leiden. Selbstbild Im Gegensatz zu ihrer Umwelt nehmen besonders Kindergarten- und Grundschulkinder die Kernprobleme der Aufmerksamkeitsstörung kaum selbst wahr. Sie tun einfach das, was ihnen im jeweiligen Augenblick richtig und wichtig erscheint. Jugendliche sind zunehmend mehr in der Lage, ihre Konzentrationsprobleme zu beschreiben und zu bemerken, dass sie oft vorschnell handeln. Was sie aber in der Regel sehr deutlich realisieren, ist, dass sie es mit den Menschen in ihrer Umgebung schwer haben. Sie spüren, dass es zunehmend problematischer wird, Freunde zu finden, und dass sie ausgegrenzt werden. Häufig gibt es Streit zu Hause, und in der Schule fällt das Lernen schwer. Die Hausaufgaben sind eine Qual, die Lehrer sind unzufrieden, weil Unterrichtsmaterial häufig vergessen wird und der Ablauf in der Klasse gestört wird. Kinder Wird ADHS nicht frühmit ADHS bringen zeitig diagnostiziert diese Dinge nicht und adäquat behanunbedingt mit eigedelt, können diverse nem Fehlverhalten sekundäre Begleitin Verbindung, aber erkrankungen und sie fühlen sich von Probleme auftreten. ihren Mitmenschen oft ungerecht behandelt. Wut und Aggression, aber auch sozialer Rückzug, Ängste und Depressionen können die Folge sein. Familie Für die Familie stellt sich bald die Frage, ob die eigene Erziehung schuld an dem auffälligen Verhalten des Kindes ist – häufig wird diese Frage auch von anderer Seite an die sich zunehmend überfordert fühlenden Eltern herangetragen. Partnerschaftskonflikte um Erziehungsfragen entstehen, und die Erwachsenen leiden insgesamt unter der ständig herrschenden Anspannung. Die schulischen Probleme führen zu Ängsten, mit der Schule in offenem Kontakt zu bleiben. Nicht betroffene Geschwister fühlen sich ins Abseits gestellt und werben selbst auf ihre Art und Weise um die Aufmerksamkeit von Mutter und Vater. Zusätzlich erschwert werden kann die Situation durch die ebenfalls vorliegende ADHSErkrankung eines oder beider Elternteile. Die Betreuung der von ADHS betroffenen Kinder ist schwierig, ihr lautes und ungestümes Verhalten führt dazu, dass sie nicht immer gern gesehene Gäste bei den Eltern anderer Kinder sind. Großeltern, Freunde und Babysitter fühlen sich der Aufgabe häufig nicht gewachsen. Schule Obwohl die besonderen Probleme der Kinder auch im Kindergartenalter oft schon erkennbar sind, stellt die Schule die entscheidende Hürde für die meisten Kinder mit ADHS dar. Das ungewohnte Stillsitzen und die notwendige Selbstkontrolle überfordern sie, es fällt schwer abzuwarten. Und 45 Minuten sind eine sehr lange Zeit, wenn die Konzentration nach zehn Minuten bereits am Ende ist. Kinder mit ADHS sind als Gruppe nicht mehr und nicht weniger intelligent als ihre Altersgenossen. Natürlich gibt es auch unter ihnen Kinder mit hoher oder niedriger Intelligenz, doch weder sind sie übermäßig häufig hochbegabt, noch in ihrer Mehrzahl Kandidaten für die Förderschule. In jedem Fall aber fällt es ihnen schwer, ihr intellektuelles Potenzial voll auszuschöpfen. Damit enttäuschen sie nicht nur sich selbst und ihre Eltern, sondern auch ihre Lehrer, die nicht selten annehmen, das Kind könne, wolle aber nicht mitarbeiten. Auch wer als Lehrer um die besondere Problematik der Kinder weiß, empfindet sie häufig als sehr anstrengend. Oft scheint die Mühe, die sich viele Lehrkräfte machen, nicht so recht zu fruchten. Der Kontakt zu den Eltern wird zunehmend angespannt. Die Konsequenz daraus ist, dass die Quote der ADHSKinder, die eine Kinder mit ADHS sind Klasse wiederholen im Durchschnitt NICHT oder gar die Schule mehr und NICHT weniohne Abschluss verger intelligent als ihre lassen müssen, Altersgenossen. Sie deutlich erhöht ist. können aber aufgrund von ADHS ihr intellektuelles Potenzial oft nicht voll ausschöpfen. ❮11❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 12 Ansprechpartner Die Diagnose sollte von Fachleuten gestellt werden – dies sind Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, aber auch erfahrene und entsprechend qualifizierte Fachärzte für Kinderund Jugendmedizin sowie Klinische Psychologen. Vorausgegangen sein sollte die körperliche und neurologische Untersuchung durch einen Kinder- und Jugendarzt. Sinnvoll ist oft auch die Vorstellung bei HNO- und Augenärzten, um entsprechende Beeinträchtigungen nicht zu übersehen. Weitere mögliche Ansprechpartner sind sozialpädiatrische Zentren sowie der Schulpsychologische Dienst. Untersuchung Um andere Erkrankungen auszuschließen, gehört zur Basisdiagnostik eine eingehende körperlich-neurologische Untersuchung, gegebenenfalls ergänzt durch Laboranalysen und ein EEG. Entscheidend ist die ausführliche Erhebung der Vorgeschichte des Kindes und seiner Familie, die durch Fragebögen und Angaben von Dritten ergänzt wird. Die Durchsicht der Zeugnisse, aber auch aktuelle Situationsbeschreibungen der Lehrer und von ihnen ausgefüllte Fragebögen sind unverzichtbarer Bestandteil der Diagnostik. Standardmäßig werden darüber hinaus Intelligenz- und Aufmerksamkeitstest durchgeführt und Teilfunktionen Entscheidend ist: Keine überprüft (GedächtTherapie ohne vorhernis, Wahrnehmung). gehende Diagnose! Psychologische TestADHS kann nicht durch verfahren können eine „Blickdiagnose“ die Diagnostik eroder ein kurzes Gegänzen. Kein Teil spräch festgestellt dieser Untersuchung werden und erfordert kann allein die Diagviel fachliche Erfahrung. nose ADHS sichern. Differenzialdiagnose Die Symptome von ADHS können oberflächlich betrachtet mit denen anderer Probleme, Störungen oder Krankheiten verwechselt werden. Für den Bereich der Kinderheilkunde sind dies zum Beispiel Schilddrüsenstörungen oder Anfallsleiden. Kinder- und jugendpsychiatrisch sollte die Problematik von Sozialverhaltensstörungen, Ängsten, Depressionen oder autistischen Störungen abgegrenzt werden. Vor allem bei Jugendlichen muss auch an eine beginnende Psychose ❮12❯ oder eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung gedacht werden. Auch Kinder mit einer Lernbehinderung oder, seltener, einer Hochbegabung können sich ähnlich auffällig verhalten. Gleiches gilt bei einer schulischen Überforderung – etwa an der weiterführenden Schule – oder bei anderen Auslösern in der aktuellen Lebenssituation des Kindes. Begleiterkrankungen Kinder mit ADHS haben häufig noch andere kinder- und jugendpsychiatrische Erkrankungen. Neben einem trotzig-oppositionellen Verhalten oder einer Sozialverhaltensstörung können dies auch Depressionen, Ängste oder Zwänge sein. Auch Tics und das Tourette-Syndrom, also Erkrankungen mit unwillkürlichen Muskelzuckungen, vor allem im In mehr als der Hälfte Gesichts- und aller Fälle haben KinSchulterbereich, der mit ADHS eine Beoder auch plötzligleiterkrankung, eine chen und ungesogenannte Komorbide wollten stimmlichen Störung. Diese kann die Äußerungen, treten Entwicklung des Kindes bei Kindern mit zusätzlich erschweren. ADHS gehäuft auf. Oftmals finden sich außerdem umschriebene Entwicklungsstörungen und Teilleistungsschwächen wie Legasthenie und Dyskalkulie. Schließlich kann ADHS auch von einer Lernbehinderung begleitet werden. Therapie Die Therapie von ADHS sollte in der Regel immer multimodal angelegt sein. Dabei ergänzen sich optimalerweise verschiedene Behandlungsmethoden, so dass mit ihrem Zusammenwirken der bestmögliche Erfolg erzielt wird. Gleiches gilt für Die Bausteine eines muldie Integration timodalen Therapieverschiedener konzepts sind Beratung Ansprechpartner und Aufklärung, Verin die Behandlung. haltenstherapie sowie medikamentöse Behandlung, die einzelfallabhängig kombiniert werden. strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 13 Multimodale Therapie Beratung und Aufklärung Grundlage jeder Therapie muss wie bei allen chronischen Erkrankungen die gründliche Aufklärung und Information der Familie, also altersentsprechend auch des Kindes oder Jugendlichen, über das Störungsbild und seine Ursachen sein. Eine kontinuierliche Betreuung und Beratung zu den immer wieder auftretenden Fragen ist unerlässlich. Auch die Schule sollte gut informiert sein. Nur dann kann der Erfahrungsschatz der Lehrer, aber auch ihre präzise Beobachtung der erreichten Fortschritte, für die Behandlung genutzt werden. Verhaltenstherapie Verhaltenstherapeutische, störungsorientierte Verfahren (z. B. Elterntrainings, siehe nachfolgend) helfen, störende Verhaltensweisen zu erkennen und abzulegen sowie neue, gewünschte zu erlernen. Ich ge h Du geh s er geh t Sie Geh t es Geh t wir geh eN ihr geh t sie geh eN Medikamente Nicht alle ADHS-Kinder benötigen Medikamente. Wenn diese aber angezeigt sind, können sie die Symptome dieser Störung deutlich mindern. Oft sind sie erst die Grundvoraussetzung dafür, dass weitere Maßnahmen Erfolg bringend durchgeführt werden können. Neben diesen wichtigsten Bausteinen des multimodalen Therapiekonzepts können zusätzlich Trainings zur Konzentrations- und Wahrnehmungsförderung und sozialen Kompetenz hilfreich sein. ❮13❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 14 Verhaltenstherapie Von den verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren konnte insbesondere für die Verhaltenstherapie nachgewiesen werden, dass mit ihr eine Reduktion der ADHS-typischen Symptome gelingt. In der Verhaltenstherapie, die als Einzel-, aber auch als Gruppentherapie angewendet werden kann, geht es um die gezielte Veränderung des täglichen Verhaltens. So kann mit dem Kind herausgefunden werden, welche Verhaltensformen besonders gut und welche weniger gut zur Bewältigung einer bestimmten Situation geeignet sind. Die Therapie zielt darauf ab, das erwünschte Verhalten zu verstärken, also zu belohnen, so dass es häufiger angewendet wird. Dazu ist die enge Kooperation mit den Eltern, aber auch mit der Schule notwendig. Die Verhaltensänderungen können sich dabei auf die Mitarbeit im Unterricht oder die Erledigung von Pflichten wie Hausaufgaben, aber auch auf den Umgang mit Stress und Streit oder negativen Gefühlen wie Angst, Wut oder Selbstunsicherheit beziehen. Elterntraining Störungsspezifisch orientierte Elterntrainings sind eine Quelle der Entlastung und Information zugleich. Wie bei anderen Elterntrainings und Erziehungsberatungen auch, liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung eines wohlwollenden, aber konsequenten Erziehungsansatzes sowie von Sachwissen über die kindliche Entwicklung. Zudem wird Eltern erläutert, wie sie auf die Besonderheiten ihrer Kinder mit ADHS eingehen können. Durch die Begegnung mit anderen betroffenen Vätern und Müttern haben viele Eltern erstmals das Gefühl, mit ihren speziellen Problemen nicht allein zu stehen. In der Gruppe wird auch deutlich, dass es keine Patentlösungen gibt – wohl aber Erfahrungen, von denen andere profitieren können. Schließlich wird deutlich gemacht, dass die Eltern mit der Veränderung eigenen Verhaltens auch das Verhalten des Kindes beeinflussen können und so wesentlich zu seiner positiven Entwicklung beitragen können. Medikamente Die medikamentöse Behandlung ist eine der Säulen der Behandlung. Während es in der Öffentlichkeit immer wieder Vorbehalte gibt, zeigen die Forschungsergebnisse aus mehreren Jahrzehnten, dass diese Therapie in der Regel wirksam und gut verträglich ist. Die Behandlung sollte sich immer auf eine solide Diagnose stützen. Eine Medikation vor dem sechsten Lebensjahr wird in der Regel nicht empfohlen. Danach sollte die Wirksamkeit ebenso wie mögliche Nebenwirkungen – die sich meist in Grenzen halten – von Eltern und Lehrkräften gemeinsam beurteilt werden. Die zur Behandlung einer ADHS eingesetzten Medikamente unterscheiden sich zum einen in ihrem Wirkmechanismus (Psychostimulanzien und selektive Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer) und in ihrer Wirkdauer (von 2 bis 4 Stunden bis hin zu einer kontinuierlichen Wirkung). Dabei unterliegen die Psychostimulanzien dem Betäubungsmittelgesetzt, weshalb sie auf einem speziellen Rezept (dem sogenannten BtM-Rezept) verordnet werden müssen, während selektive Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer auf einem normalen Rezept verordnet werden können. Neuere Medikamente erlauben eine Behandlung über den ganzen Tag hinweg mit einer einmaligen morgendlichen Gabe. ❮14❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 15 Ergänzende Therapieoptionen Viele Familien haben Erfahrungen mit weiteren therapeutischen Möglichkeiten gemacht, die allerdings bisher in ihrer Wirksamkeit nicht wissenschaftlich nachgewiesen wurden. So werden nicht nur die Verhaltenstherapie, sondern auch viele weitere psychotherapeutische Verfahren bei der Behandlung der ADHS eingesetzt, unter anderen die Familientherapie. Soziale Kompetenztrainings werden bei Kindern an Grundschulen und weiterführenden Schulen vor allem in Gruppen angewendet. Die Ergotherapie wird vor allem mit Kindern im Vor- und Grundschulalter häufig durchgeführt. Psychomotorik kann bei Kindern dieser Altersgruppe die Bewegungsfreude aufgreifen und therapeutisch nutzen. Biofeedbackverfahren haben erste ermutigende Ergebnisse gebracht. Darüber hinaus gibt es Angebote für Trainings zur Konzentrationsförderung sowie lerntherapeutische Methoden. 3 = 4 : 12 2 1 = 4 3x 4 = 3 : 12 2 1 = 3 4x 6 = 2 : 12 1 = 2 6x Zusammenfassung Der Wissensstand zu ADHS ist umfangreich. Manche Details können Einsteigern als verwirrend erscheinen. Die wichtigsten Fakten sind jedoch sehr eindeutig belegt. ADHS ist eine neurobiologische Erkrankung mit erheblichen psychosozialen Auswirkungen. Die Diagnose erfordert einen hohen Aufwand und viel Erfahrung. Die Therapie sollte multimodal angelegt sein und dabei vor allem auf die Elemente Elterntraining, Verhaltenstherapie und Medikation zurückgreifen. Durch fachgerechte Behandlung kann der Verlauf positiv beeinflusst werden. ❮15❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 16 Was bedeutet ADHS für den Lehrer? Fallbeispiel: Burn-out-Syndrom und vorzeitige Berentung Das vorliegende Fallbeispiel beschreibt eine Entwicklung, die Sie so oder so ähnlich vielleicht schon einmal selbst in Ihrem Kollegenkreis miterlebt haben. Denn leider ist ein solcher Verlauf nicht untypisch für den Lehrerberuf. Das Beispiel zeigt deutlich, wie die Anforderungen des Lehrerberufes, vor allem kontinuierlich problematische Unterrichtssituationen und Auseinandersetzungen mit Eltern auf lange Sicht ernsthaft krank machen können. Und nicht selten sind die vermeintlichen „Störenfriede“ und „Klassenkasper“ ADHS-Kinder, die den Unterrichtsrahmen schnell sprengen können. ❮16❯ Arno B. aus C., 56 Jahre, ist Witwer, der in einer neuen Beziehung lebt. Er ist Grundschullehrer und gilt in seiner Schule als schwierig und minder belastbar. Nach einem vergeblichen und lauten Disput mit einer allein erziehenden Mutter bekommt er einen Hörsturz. Er hatte versucht, der Frau begreiflich zu machen, dass ihr 9-jähriger Sohn als „Klassenkasper“ nahezu jede Unterrichtsstunde sprengt und außerdem erhebliche Leistungsdefizite aufweist. Die gewünschte Unterstützung der Mutter zur Erziehung des unruhigen Jungen bleibt jedoch nicht nur aus, sondern wird von ihr umgemünzt als eine notwendige Reaktion des Buben auf seine Voreingenommenheit und Erziehungsschwäche. Nach einigen Tagen kehrt das Gehör wieder zurück, jedoch nur allmählich, und hinterlässt ein an Intensität wechselndes störendes und einseitiges Ohrgeräusch. Schlaf und Konzentration leiden; Korrekturen, Unterrichtsvorbereitungen und das Disziplinieren der Klassen im Unterricht fallen ihm immer schwerer. Am Morgen klagt er über Unwohlsein und Lustlosigkeit. Innerlich plagt ihn auch die zunehmende Angst, allmählich zum Versager zu werden und den Anforderungen nicht mehr gewachsen zu sein – Arno B. hat schließlich nicht nur diesen einen „Klassenkasper“ … Die Schulleitung lässt ihn nach einer Attacke des Elternbeirates im Regen stehen. Es folgt ein erneuter Hörsturz. Trotz längerer Arbeitsunfähigkeit tritt keine Erholung ein. Es folgt eine antidepressive medikamentöse Therapie, die erfolglos bleibt. Nach einem vergeblichen Versuch der Wiederaufnahme des Unterrichts am Ende eines eineinhalbjährigen, auch psychotherapeutisch begleiteten Leidenswegs ist die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand aus Krankheitsgründen unvermeidlich. strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 17 Was bedeutet ADHS für betroffene Kinder? Fallbeispiele: Felix und Saskia Die Fallbeispiele der Grundschulkinder Felix und Saskia sind so ausgewählt, dass sie einerseits typische Merkmale von ADHS aufzeigen. Andererseits beschreiben sie unterschiedliche Perspektiven (Kind, Eltern, Lehrer) und machen schließlich gleichzeitig auf schulrelevante Formulierungen aufmerksam, wie sie sich auch in verbalisierten Zeugnissen finden. Wir laden Sie an dieser Stelle explizit ein, sich auf die verschiedenen Perspektiven einzulassen und auf Ihre unterschiedlichen Wahrnehmungen zu achten. Perspektivwechsel können nützlich sein, um die Situation der betroffenen Kinder und ihrer Familien noch besser zu verstehen. Dieser Ansatz wird bereits durch ein altes indianisches Sprichwort zum Ausdruck gebracht: „Um jemanden wirklich verstehen zu können, musst du mindestens tausend Meilen in seinen Schuhen gegangen sein.“ Fallbeispiel 1: Felix (2. Schuljahr) Der 8-jährige Felix besucht die zweite Grundschulklasse und fragt sich, warum das ganze Leben so „blöd“ ist und ob es nicht viel besser wäre, niemals geboren worden zu sein. In der Familie sei alles nur „blöd“. Der jüngere Bruder werde mehr geliebt und dürfe alles, er dürfe nichts. Die Mama habe ihn eh nicht lieb, und der Papa habe nie Zeit für ihn. Am liebsten ginge er auch nicht in die Schule, weil dort alle nur gegen ihn seien. Er werde ungerechterweise von den Lehrerinnen immer beschuldigt, an allem schuld zu sein. Und ständig werde er von anderen Kindern so provoziert, dass er nur noch wie wild um sich schlage. Er wisse gar nicht, was mit ihm los sei. Die Lehrerinnen sehen Felix als Klassenkasper, der sich ständig in den Vordergrund spielen muss. Besonders montags sei er kaum zu bremsen und störe massiv den Unterricht durch Zwischenrufe und Umherlaufen. Aufgrund seiner niedrigen Frustrationsgrenze sei der Junge ständig in Streitereien und Schlägereien verwickelt. Seine Leistungen seien schwankend und tagesformabhängig. Sein Schriftbild müsste Felix dringend verbessern und er müsse mehr Ordnung halten. Erstaunlicherweise sei der Junge in der Zweiersituation wie verwandelt und sehr zugänglich. Die Lehrerinnen sind der Auffassung, dass die Eltern ihren Sohn nicht richtig erzögen. Felix müsse einfach lernen, motivierter und ehrgeiziger zu sein. Vor allem die Mutter ist verzweifelt. Sie hat das Gefühl, dass ihr der ältere Sohn entgleitet, und aufgrund der zahlreichen Klagen aus der Schule befürchtet sie ein massives Schulversagen. Von der Schule habe Felix eine sehr schlechte Meinung, alle Lehrerinnen seien „blöd“, „doof“ und ungerecht. Keine verstehe ihn. Oft müsse er Strafarbeiten erledigen, die seinen Hass auf die Schule noch verstärkten. Zudem attackiere Felix ständig seinen kleineren Bruder. Seine Unruhe und Zerstreutheit habe er kaum unter Kontrolle, und er fühle sich bereits durch die kleinste Kritik grundsätzlich in Frage gestellt. Seine Essmanieren ließen sehr zu wünschen übrig, und es falle immer etwas auf den Boden. ❮17❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 18 Von ihrem Mann fühlt sich Felix’ Mutter nicht sehr verstanden und unterstützt. Er vertritt die Auffassung, dass Felix ein wilder Junge sei, der sich „die Hörner noch abstoße“. Vorgehensweise und weitere Entwicklung Als sich sich die Situation immer mehr zuspitzt, suchen die Eltern einen Facharzt auf. Die psychologische Testung zeigt, dass Felix über eine gute Intelligenz verfügt, sich aber nur kurze Zeit konzentrieren kann. Jedes Geräusch und jede Bewegung lenken ihn ab. Nach der anschließenden medizinischen Untersuchung stellt der Arzt die Diagnose ADHS mit ausgeprägter Hyperaktivität und Impulsivität. Er empfiehlt, das Kind zunächst psychotherapeutisch und gegebenenfalls medikamentös zu behandeln. Er rät den Eltern, parallel dazu an einem Elterntraining teilzunehmen. Sie stimmen diesem Vorgehen zu. Felix lernt im verhaltenstherapeutischen Einzeltraining, mit seiner Impulsivität umzugehen und Provokationen zu ignorieren, so dass sich die Lage in der Schule und zu Hause etwas entspannt. Sein Selbstwertgefühl steigt, indem sein Fokus auf das gelenkt wird, was ihm gelingt und was er gut kann. Auch die Eltern profitieren von ihrem Training. Sie lernen, auf die Unruhe ihres Kindes gelassener zu reagieren und klarere Strukturen und Regeln in den Familienalltag zu bringen. Zudem informieren Felix’ Eltern seine Lehrer und vereinbaren, dass der Junge Auszeiten erhält. Außerdem binden die Lehrer seinen Bewegungsdrang in hilfreiche Aktionen wie Tafelputzen positiv ein. Der feste Sitzplatz an einem Tisch mit ruhigeren Kindern erleichtert Felix die konstruktive Mitarbeit im Unterricht. Aufgrund seiner guten schulischen Leistungen erhält Felix Mitte der 4. Klasse die Empfehlung zum Wechsel auf das Gymnasium. ❮18❯ Fallbeispiel 2: Saskia (4. Schuljahr) Saskia ist zehn Jahre alt und besucht die vierte Grundschulklasse. Sie weiß, dass die Zeugnisnoten des 1. Halbjahres darüber entscheiden, welche weiterführende Schule sie besuchen darf. Obwohl sie fleißig lerne, wisse sie in den meisten Klassenarbeiten nur noch wenig. Irgendwie fühle sich das an, als wäre alles wie weggeblasen. Saskia habe das Gefühl, „doof“ zu sein und nicht so gut mitzukommen wie die anderen. Dabei strenge sie sich doch so an. Während des Unterrichts sitze sie ganz still da und merke dann plötzlich, dass sie in einer ganz anderen Welt gewesen sei. Die Wolken am Himmel oder der singende Vogel auf dem Baum vor dem Fenster ihrer Klasse wüssten ja auch so interessante Geschichten zu erzählen. Abends falle ihr das Einschlafen immer schwerer. Vor lauter Bauchschmerzen und Kopfschmerzen wisse sie manchmal nicht mehr ein noch aus. Auch Mama sei nie zufrieden mit ihr. Die „blöden“ Aufträge, wie Getränke holen oder Wäsche sortieren, könne sich doch keiner merken. Es ist alles viel zu viel für sie. Die Lehrerinnen können sich über Saskias Sozialverhalten nicht beklagen. Das Mädchen sitze ruhig an seinem Tisch und störe keinen. Auch sei es in der Lage, seinen Platz in Ordnung zu halten. Sogar der Ranzen wirke aufgeräumt. Wenn Saskia wolle, zeige sie ein sehr ordentliches Schriftbild. Umso unverständlicher sei es ihnen, dass das Mädchen in seinen Leistungen so sehr nachgelassen habe. Geträumt habe Saskia schon immer, aber sie sei bis zum dritten Schuljahr doch noch ganz gut mitgekommen. Nun ja, wahrscheinlich brauche sie noch mehr Zeit, sich zu entwickeln. Sie sei eben extrem langsam und lasse sich schnell ablenken. Die Eltern verstehen die Welt nicht mehr. Ihre beiden ältesten Kinder besuchen erfolgreich das Gymnasium, und auch für Saskia sah es bis zum dritten Schuljahr so aus, als könne sie den älteren Geschwistern folgen. Gut, so selbstständig wie die Großen sei sie nie gewesen. Oft sei es strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 19 notwendig, wegen der Hausaufgaben bei den Klassenkameradinnen anzurufen, da Saskia vergessen habe, sie aufzuschreiben. Zudem müsse man bei der Erledigung der Aufgaben immer neben ihr sitzen, weil sie einfach keinen Anfang findet. Mit etwas Unterstützung funktioniere es dann aber eigentlich doch recht gut. Am Fleiß könne es nicht liegen, denn Saskia verbringe mittlerweile den ganzen Nachmittag mit Schulaufgaben. Umso bedauerlicher sei es, dass das Kind das, was es zu Hause gekonnt habe, in den Arbeiten nicht zeigen könne. Eine positive Ausnahme habe es allerdings gegeben, als Saskia wegen einer Erkrankung die Deutscharbeit allein mit der Lehrerin habe nachschreiben müssen. Dank verständnisvoller Lehrerinnen, die Saskia nun verstärkt Strukturierungshilfe geben, ihre Konzentration immer wieder zum Unterricht zurücklenken und es ihr ermöglichen, die Klassenarbeiten in der Zweiersituation zu schreiben, kann das Mädchen aufatmen und erste kleine Erfolgserlebnisse verbuchen. Nach der vierten Klasse wechselt sie auf eine Realschule, wo sie unter Berücksichtigung des Nachteilsausgleiches erfolgreich am Unterricht teilnehmen kann (Informationen zum Nachteilsausgleich siehe „Informationen zu gesetzlichen Ansprüchen“). Der Mutter tut es Leid, dass sie so oft barsch auf die Misserfolge des Kindes reagiert und ihr die klugen Geschwister immer wieder vor Augen führt. Schon seit einiger Zeit will sich Saskia nicht einmal mehr mit Schulfreunden verabreden. Vorgehensweise und weitere Entwicklung Das Gespräch mit den Lehrerinnen am Elternsprechtag zeigt Saskias Eltern, dass ihre Tochter Hilfe braucht. Das einst so fröhliche Kind hat sich immer mehr in sich zurückgezogen und im Religionsunterricht sogar gesagt, dass es gut verstehen könne, wenn sich Menschen auf den Tod freuen. Der Kinderarzt überweist Saskia zu einer Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, die sich sehr viel Zeit für Gespräche und sorgfältige Diagnostik nimmt. Nach eingehenden organischen, neurologischen und psychologischen Untersuchungen kommt die Ärztin zu dem Ergebnis, dass bei Saskia eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung, jedoch ohne Hyperaktivität (ADS) vorliege. Sie klärt die Eltern über mögliche Therapien auf, die Saskia unterstützen könnten. Nach sorgfältigen Überlegungen stimmen sie zu, dass Saskia mit einem aufmerksamkeitsfördernden Medikament behandelt wird und zusätzlich eine Verhaltenstherapie erhält. ❮19❯ strattera_schulproj_inh ❮20❯ 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 20 strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 21 Vorbemerkung Sie halten dieses Manual in den Händen, weil Sie auf der Suche nach pädagogisch sinnvollen Möglichkeiten sind, ein Kind mit ADHS zu unterrichten und den Umgang mit diesem Kind in Ihren Schulstunden positiv zu gestalten. Jedes Kind mit dem Störungsbild ADHS ist anders und in unterschiedlichen schulischen Bereichen beeinträchtigt – es benötigt also individuelle pädagogische Strategien, die Ihnen und dem Kind das schulische Miteinander erleichtern können. Dieses Manual bezieht sich auf einen konkreten Schüler, von dem Sie wissen oder vermuten, dass er ADHS hat. Vielleicht haben Sie schon Kontakt zu den Eltern oder einem Arzt/Psychologen und erste Möglichkeiten zum Umgang mit diesem Kind erarbeitet, oder aber Sie stehen erst am „Anfang“ eines solchen Weges … In jedem Fall besteht der erste logische Schritt – noch vor der Erarbeitung geeigneter pädagogischer Maßnahmen für ein Kind – in einer möglichst genauen Beschreibung des Verhaltens des Kindes: Was fällt im Unterricht im Einzelnen auf? Mit welchen Verhaltensweisen behindert das Kind sich selbst oder auch andere Kinder der Klasse? Andererseits: Welche Stärken bzw. positiven Aspekte bringt das Kind in den Unterricht ein? Der „Fragebogen zur Verhaltensbeobachtung“ soll Ihnen hier eine Hilfestellung geben. Das weitere Vorgehen hängt natürlich von der jeweiligen Situation ab. Aus diesem Grund haben wir für Sie in diesem Kapitel einzelne Bausteine zusammengestellt, die wir für die Erarbeitung einer individuellen pädagogischen Strategie als wichtig erachten, die Sie aber unabhängig voneinander nutzen können. Sie finden dort – neben dem Fragebogen, der quasi die Grundlage bildet – Empfehlungen für die Gespräche mit den Eltern und dem Kind („Gesprächsleitfaden Eltern- bzw. Schülergespräch“) sowie Vorschläge zu konkreten Strategien für den Unterricht („Modularer Leitfaden für den Unterricht“). ❮21❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 22 Fragebogen zur Verhaltensbeobachtung Grundlage für weitere pädagogische Maßnahmen Die Beantwortung der folgenden Fragen kann Ihnen helfen, einen konkreten Schüler, von dem Sie wissen oder vermuten, dass er ADHS hat, besser einzuschätzen. Der Fragebogen führt Sie durch verschiedene Verhaltens-, Persönlichkeits- und Leistungsmerkmale des Kindes und Ihres pädagogischen Handelns. Dimensional angelegte Beurteilungsskalen sollen die Ausprägung des in Frage stehenden Verhaltens des Kindes bildhaft verdeutlichen – für Sie selbst oder z. B. als Grundlage für ein Elterngespräch. den Kontakt zu Lehrerkollegen, um das Kind möglichst exakt beschreiben zu können. Greifen Sie z. B. diejenigen Verhaltensweisen heraus, die Sie als am meisten störend empfinden, und führen Sie in der kommenden Woche eine Strichliste über die Auftretenshäufigkeit in jeder einzelnen Schulstunde – ohne Ihr übliches Lehrverhalten zu verändern („beobachten und festhalten“). Dies kann Ihnen das Ausfüllen des Bogens erleichtern und eine gute Grundlage für Ihr weiteres pädagogisches Vorgehen sein. Füllen Sie den Bogen so genau wie möglich aus! Nutzen Sie bei Unsicherheiten einige Tage der Verhaltensbeobachtung im Unterricht oder (Eine Kopiervorlage dieses Bogens finden Sie am Ende des Manuals.) A. RAHMENBEDINGUNGEN Name des Kindes: Alter des Kindes: Jahre Klasse: Unterrichtsfächer: Wochenstunden: Klassengröße: Ich unterrichte das Kind seit: Meine Beziehung zum Kind bewerte ich wie folgt: Sitznachbar des Kindes (falls zutreffend): Sitzt eher ❏ vorn ❏ mittig ❏ hinten Gute/Eher gute Kontakte hat das Kind derzeit zu folgenden Mitschülern: Schlechte/Eher schlechte Kontakte hat das Kind derzeit zu folgenden Mitschülern: ❮22❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 23 Der letzte Elternkontakt (telefonisch, persönlich) fand vor Wochen/Tagen statt. Anlass: Besteht eine formale ADHS-Diagnose? ❏ ja ❏ nein Falls ja, ist mir diese bekannt seit Gibt es bereits laufende Behandlungen, von denen ich weiß? ❏ Medikamente ❏ Elternberatung ❏ Ergotherapie ❏ Nachhilfe ❏ Verhaltenstherapie ❏ andere: Behandelnder Arzt/Therapeut (falls bekannt): Telefonnummer (falls bekannt): Bestand bereits Kontakt zum Arzt/Therapeuten? Wenn ja, wann zuletzt? Wie sehen die Schulleistungen des Kindes derzeit aus? Deutsch ❏ gut ❏ befriedigend ❏ ausreichend ❏ schlechter Mathematik ❏ gut ❏ befriedigend ❏ ausreichend ❏ schlechter Sachkunde ❏ gut ❏ befriedigend ❏ ausreichend ❏ schlechter In welchen Fächern/Bei welchen Kollegen bestehen die größten Verhaltens- bzw. Konzentrationsschwierigkeiten? In welchen Fächern klappt es besser/am besten? ❮23❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 24 Gibt es einen „typischen Verlauf“ der Auffälligkeiten ❏ über die Woche (z. B. schlechter am Wochenanfang)? ❏ am Schulvormittag (z. B. auffälliger in den ersten Stunden)? B. VERHALTENSBEOBACHTUNGEN Block 1 Worin bestehen leistungsbehindernde Verhaltensweisen im Unterricht? nie/nein durchschnittlich immer/ja durchschnittlich immer/ja fängt nicht mit der Arbeit an kann sich nur kurzfristig auf eine Aufgabe konzentrieren träumt oft vor sich hin vergisst häufig Arbeitsanweisungen beteiligt sich kaum am Unterricht hat Schwierigkeiten mit schnellem schriftlichem Arbeiten krakeliges Schriftbild drückt beim Schreiben/Malen sehr fest auf kann die Arbeitsmaterialien nicht organisieren Materialien sind oft unvollständig hat Schwierigkeiten, sauber zu arbeiten scheint oft nicht zu wissen, was zu tun ist Hausaufgaben oft nicht oder unvollständig gemacht schafft oft nur einen Teil des Pensums scheint Stoff zu beherrschen, versagt dann oft in Klassenarbeiten schnelles Arbeiten geht genauem Arbeiten vor ist bei Gruppenarbeiten oft in der Außenseiterrolle sonstige: Block 2 Was sind positive Verhaltensweisen und Eigenschaften des Kindes? nie/nein ist anderen gegenüber hilfsbereit hat freundliches Wesen/interessiert an seiner Umwelt /neugierig ist spontan ❮24❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 25 nie/nein durchschnittlich immer/ja durchschnittlich immer/ja hat viele, oft kreative Ideen kann sich für vieles begeistern besitzt ausgeprägtes Mitgefühl bringt andere zum Lachen hat ausgeprägten Gerechtigkeitssinn ist anderen gegenüber nicht nachtragend setzt sich für andere ein kann den Unterricht oft bereichern begeistert sich für Sport sonstige: Block 3 Worin bestehen den Unterricht störende Verhaltensweisen? nie/nein ruft und redet häufig dazwischen kommentiert Beiträge anderer unangemessen verlässt seinen Sitzplatz verbreitet Unruhe am Sitzplatz/Tisch fällt vom Stuhl lenkt Sitznachbarn ab möchte häufig der Erste sein versucht, bei Gruppenaktivitäten zu dominieren gerät im Unterricht in Auseinandersetzungen mit anderen lenkt andere Kinder mit unterrichtsfremden Aktivitäten ab sonstige: Block 4 Worin bestehen mich persönlich störende Verhaltensweisen (über das bereits Gesagte hinaus)? nie/nein durchschnittlich immer/ja widersetzt sich oft meinen Anweisungen beeinflusst andere Kinder/das Klassenklima negativ ist mir gegenüber oft frech und anmaßend bindet meine Aufmerksamkeit zu oft und zu lange kostet mich viel Zeit im Unterricht erfordert viele Kontakte zu Eltern/anderen Lehrern sonstige: ❮25❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 26 C. MEIN EIGENES PÄDAGOGISCHES HANDELN Was ich bereits versucht habe, um das problematische Verhalten des Kindes zu beeinflussen (Elternkontakt, Einzelplatz, Sanktionen etc.): (Listen Sie möglichst konkret ein Problemverhalten und die durchgeführte Maßnahme auf und bewerten Sie den Erfolg ihrer Reaktion mit Noten von 1 bis 6) Problemverhalten Pädagogische Maßnahme z. B. Hausaufgaben vergessen z. B. nacharbeiten lassen ❮26❯ Erfolg strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 27 Gesprächsleitfaden Elterngespräch Empfehlungen für ein Gespräch mit den Eltern von Felix „Viele LehrerInnen sind auch Eltern. Alle Eltern waren auch SchülerInnen. Viele SchülerInnen werden Eltern. Manche SchülerInnen werden Lehrer. Sollte es da kein Verstehen, keine Gemeinsamkeiten geben?“ Reinhold Miller Erziehungsgemeinschaft von Eltern und Lehrern Eltern und Lehrer tragen eine gemeinsame Verantwortung für die Bildung und Erziehung der Kinder. Sie haben es mit denselben Kindern zu tun, die einen als professionelle und die anderen als natürliche Erzieher. Da ist es absolut logisch, dass Erziehung am besten funktioniert, wenn die Bemühungen von Eltern und Erziehern gut aufeinander abgestimmt sind. Im Schulalltag hingegen ergeben sich immer wieder Situationen, in denen sich Schüler, Eltern und Lehrer uneins sind, denn Konfliktfelder gibt es genug. Hier ist Kommunikation dringend notwendig. Jeder sollte die Möglichkeit haben, bei auftretenden Problemen Gespräche zu führen, und mit seinen Problemen ernst genommen werden. Ziel des Elterngesprächs Das Elterngespräch sollte ergebnisorientiert sein. Es sollte das Ziel verfolgen, ein Bündnis zwischen Lehrern und Eltern zu schließen, um dem Kind gemeinsam helfen zu können. Kontaktaufnahme mit den Eltern Wenn Sie den Verdacht haben, dass das Kind ADHS hat: • Laden Sie die Eltern frühzeitig zu einem Gespräch ein. • Teilen Sie den Eltern Ihre Sorge um das Kind mit. • Schildern Sie das Verhalten des Kindes im Unterricht, etwa: Im Gegensatz zu den anderen Kindern der Klasse ist es (z. B. unruhig, ruft dazwischen, zieht sich zurück, zeigt Vermeidungsverhalten, ist oft traurig, kaspert). • Verweisen Sie auch auf die Stärken, die Sie bei dem Kind wahrnehmen. • Ermuntern Sie die Eltern, eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen und/oder zu einem Facharzt Kontakt aufzunehmen. Voraussetzungen für ein erfolgreiches Elterngespräch Vor dem Gespräch sollten die folgenden Punkte abgeklärt werden: Je früher ein Gespräch mit den Eltern stattfindet, umso früher kann auch dem betroffenen Kind geholfen werden, und die Situation in der Klasse kann sich entspannen. • Gibt es unterschiedliche Sichtweisen über das Störungsbild ADHS? Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Eltern und Lehrer zu einer gemeinsamen Sichtweise des Störungsbildes ADHS finden, ggf. unter Einbeziehung von Fachleuten (behandelndem Arzt/Psychologen, Vertreter eines Selbsthilfeverbandes). Nur auf dieser Grundlage kann auch ein einheitlicher Lösungsweg (Hilfeplan) für das Kind entwickelt werden. Beispiel: Aus Sicht der Lehrkraft sind die Verhaltensschwierigkeiten des Kindes die Folge von übermäßigem TV-Konsum oder vernachlässigender Erziehung. Tatsächlich wurde jedoch bereits fachärztlich das Krankheitsbild ADHS festgestellt. Die pädagogischen und therapeutischen Maßnahmen für dieses Kind würden somit sehr unterschiedlich ausfallen. ❮27❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 28 Eine gemeinsame Grundlage könnte z. B. die Lektüre des „Leitfadens ADS/ADHS“ des Hamburger Arbeitskreises sein (siehe „Informationsquellen zu ADHS“). • Wie stark sind die aufgestauten Gefühle – bei mir und bei den Eltern? Häufig wird erst das Gespräch mit den Eltern gesucht, wenn eine Situation bereits eskaliert ist. Dies ist keine gute Voraussetzung für ein konstruktives Gespräch. Eltern von ADHS-Kindern reagieren meist ausgesprochen sensibel, da sie oft schon jahrelang Schuldzuweisungen, Ablehnung und Ausgrenzung erfahren haben. Viele Eltern müssen erst verstehen, welche Schwierigkeiten das Verhalten ihres Kindes im Unterricht mit sich bringt. Gesprächsstrategie Ein Elterngespräch kann im Sinne der Zielrichtung vorbereitet werden. Dabei ist die Berücksichtigung der Gesprächsstrategien entscheidend: • Suchen Sie das frühe Gespräch. • Führen Sie kein Gespräch im Affekt, auch nicht zwischen „Tür und Angel“. • Benennen Sie konkret die positiven Seiten des Kindes und signalisieren Sie so den Eltern, dass auch diese im Unterricht registriert werden. So entschärfen Sie die oft negativ behaftete Gesprächssituation. (Im Fragebogen zur Verhaltensbeobachtung finden Sie dazu Anregungen!) • Benennen Sie konkrete Verhaltensweisen des Kindes, zum Beispiel: „Er verlässt in der Deutschstunde mehrmals den Platz, während er das im Sozialkunde-Unterricht nur selten tut.“ (Bei der genauen Beschreibung des Problemverhaltens kann Ihnen auch der Fragebogen helfen!) • Entwickeln Sie ein gemeinsames Störungsmodell (siehe Voraussetzungen). Ich-Botschaften helfen, • Tauschen Sie sich über Erziehungsgrundsätze aus. dass ein Gespräch mit • Bewerten Sie nicht, sondern schildern Sie Ihre Wahrnehden Eltern eines betrofmung in Ich-Botschaften wie zum Beispiel: „Ich erlebe fenen Kindes positiv Ihren Sohn als sehr unkonzentriert“ oder „Ich habe verläuft. den Eindruck, dass Ihr Kind unter der Situation leidet“. • Vermeiden Sie Killerphrasen wie zum Beispiel: „Als verantwortungsvolle Eltern müssen Sie doch einsehen …“, „ Ihr Sohn ist immer in Streitereien verwickelt“, „Er hat nie seine Hausaufgaben gemacht“, „Es wäre nett, wenn auch Ihr Sohn mal sein Turnzeug dabei hätte“, „Es muss sich umgehend was ändern“. • Erheben Sie keine Anschuldigungen und Vorwürfe. • Bitten Sie die Eltern um Rat. • Stellen Sie keine Forderung auf, sondern finden Sie gemeinsame Ziele. • Halten Sie den Kontakt zu den Eltern. Wichtig ist dabei Regelmäßigkeit und dass Absprachen bei kleinen und groEntwickeln Sie gemeinßen Problemen verbindlich eingehalten werden. sam mit den Eltern • Vermitteln Sie die Botschaft „Wir sitzen in einem Boot“. einen Plan, wie dem Ziel ist es, gemeinsam einen Hilfeplan für das Kind zu Kind geholfen werden erstellen. kann. ❮28❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 29 Fazit: • Stimmen Sie mit den Eltern Ihre Bemühungen ab. • Nehmen Sie dabei keine Monopolstellung ein. • Setzen Sie die Eltern nicht unter Druck. • Tauschen Sie Wissen aus. • Übernehmen Sie gemeinsam Erziehungsverantwortung für ein und dasselbe Kind. • Zeigen Sie Gesprächsbereitschaft und Akzeptanz. Das Konfliktgespräch Nicht immer gelingt es frühzeitig, mit den Eltern in Kontakt zu treten. Sei es, weil die Eltern sich weigern, wenig Zeit haben oder man selbst die Situation nicht richtig eingeschätzt hat. Hier ist es besonders wichtig, sachlich und zum Wohle des Kindes zu handeln, denn es geht um das Kind und nicht um die Erwachsenen. Häufig ist es sehr hilfreich, auch andere beteiligte Personen zum Gespräch einzuladen, z. B. den behandelnden Arzt, Psychologen, Therapeuten oder Kollegen (natürlich in Absprache mit den Eltern). Bleiben Sie auch in • Wenn es einen Konflikt gibt, versuchen Sie sachlich einem Konfliktgespräch aufzuklären. immer sachlich. • Benennen Sie den Gesprächsanlass und beschreiben Sie dabei sachlich, was genau vorgefallen ist. Darüber hinaus skizzieren Sie den Ablauf des Gespräches. • Fragen Sie die Eltern nach deren subjektiver Sicht des Geschehens. Die Eltern berichten zum Beispiel: „Bei Felix wurde bereits vor der Einschulung ADHS diagnostiziert. Felix entwickelt auch zu Hause zunehmend Widerstand gegen schulische Anforderungen und verhält sich in der Familie oft aggressiv.“ Die Eltern zeigen sich ratlos und verärgert, da die ersten beiden Schuljahre recht gut verlaufen sind. • Schildern Sie dann Ihre subjektive Sicht. • Stellen Sie dar, wie sich die Verhaltensweisen des betroffenen Schülers auf die Klasse bzw. den Unterricht auswirken. Zum Beispiel: „Felix ist seit einiger Zeit sehr unruhig und abgelenkt. Er stört durch dieses Verhalten massiv seine Mitschüler, die ihn aufgrund seiner Kaspereien inzwischen ausgrenzen. Ermahnungen und gutes Zureden zeigen wenig Erfolg. Zunehmend reagiert er aggressiv, verweigert sich oder gibt sich betont gleichgültig.“ • Bitten Sie die Eltern um Unterstützung, zum Beispiel Denken Sie daran, die um Informationen über ADHS, Tipps im Umgang mit Eltern kennen ihr Kind Aggressionen, welche Hilfen braucht das Kind etc. am besten. Fragen Sie • Stellen Sie den Eltern daraufhin vor, welche Maßnahmen nach, welche Strategien Sie sich überlegt haben, um ihrem Kind zu helfen. sie im Umgang mit (Geeignete Strategien werden Ihnen in „Modularer dem Kind haben. Leitfaden für den Unterricht“ vorgestellt.) • Beziehen Sie gegebenenfalls andere Helfer mit ein. • Halten Sie Abmachungen verbindlich ein. • Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, halten Sie den weiteren Dienstweg ein und ziehen Sie zum Beispiel einen weiteren Beratungslehrer hinzu. ❮29❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 30 Verlieren Sie nicht den Humor, denn diese kleinen „Teufelchen“ haben auch ihre guten Seiten. Zitat einer Mutter: „Ich glaube, mein Sohn ist als Denkanstoß auf die Welt gekommen. Nehmen wir diese Herausforderung doch einfach an! E S E L ch t s e i L Du t s e i L er t s e i L Sie t s e i L Es N E S E L Wir T S E L IHR N E S E L SIE ❮30❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 31 Gesprächsleitfaden Schülergespräch Empfehlungen für ein Gespräch mit Felix Sie haben in Ihrer Klasse ein Kind, auf das die weiter vorne ausgeführten diagnostischen Beschreibungen zutreffen. Oder Sie sind von Eltern darüber informiert worden, dass bei Felix (das ist unser Beispielkind) ADHS vorliegt. Dieser Gesprächsleitfaden soll Ihnen helfen, ein Gespräch mit Felix unter verschiedenen Bedingungen zu führen: • Einmal kann es darum gehen, Ihren Verdacht weiter zu erhärten, um danach mit den Eltern zu besprechen, dass Sie eine vertiefte kinder- und jugendpsychiatrische bzw. -psychologische Diagnostik empfehlen würden. • Andererseits könnten Ihnen die Eltern bereits mitgeteilt haben, dass bei ihrem Felix ADHS vorliegt, und Sie wollen auf der Grundlage des vorliegenden Manuals dem Kind das Lernen und sich den Unterricht erleichtern. Allgemeiner Grundsatz Das Gespräch mit Felix soll und kann keine Diagnostik ersetzen. Es kann Ihnen aber helfen – auch in anderen Fällen als beim Verdacht auf ADHS – Ihre Beziehung zum Kind zu verbessern, zu vertiefen oder überhaupt eine tragfähige Beziehung zum Kind anzubahnen. Zum besseren Verständnis haben wir den Gesprächsleitfaden schrittweise aufgebaut. Schritt 1 – Das Setting Unter Setting versteht man die Festlegung der Strukturen und Rahmenbedingungen, unter denen ein Gespräch stattfinden soll (z. B. Häufigkeit und Dauer). Auch für das Gespräch mit Felix ist es wichtig, zunächst das Setting festzulegen. Nur wenn der Rahmen für Sie ebenfalls stimmt, kann das Gespräch erfolgreich verlaufen. Im Allgemeinen sollte das Gespräch nur angeregt werden, wenn vorher die Eltern darüber informiert wurden und sie einverstanden sind (siehe „Gesprächsleitfaden Elterngespräch“). Zur Durchführung des Gesprächs sind ein paar Regeln hilfreich: • Führen Sie kein Pausengespräch. • Planen Sie mindestens 30 Minuten Zeit ein. • Lassen Sie das Gespräch in einer „Extrazeit“ stattfinden, am besten vor oder nach der Schule. Sollte dies aus organisatorischen Gründen (z. B. Schulbus) nicht möglich sein, so sprechen Sie mit einem Kollegen ab, dass Felix im Rahmen einer Ihrer Freistunden ausnahmsweise vom Unterricht befreit wird. Es macht wenig Sinn, • Sorgen Sie dafür, dass Sie ungestört miteinander sprechen mit einem Kind ein können. • Achten Sie nach Möglichkeit auf einen für beide Gesprächs- konstruktives Gespräch zu suchen, wenn man partner angenehmen Raum. es nicht mag. Deshalb: Suchen Sie aktiv nach Schritt 2 – Ihre Haltung liebenswerten EigenGehen Sie immer davon aus, dass sich Ihre Haltung einem schaften des Kindes – Kind gegenüber ausdrückt und vermittelt, auch wenn Sie erst dann sollten Sie bewusst versuchen, diese – z. B. ablehnende Haltung – zu das Gespräch planen! verbergen. ❮31❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 32 • Versuchen Sie, sich für das Gespräch mit Felix in eine möglichst unvoreingenommene Haltung zu bringen. Überprüfen Sie Ihre Vorannahmen über ihn (z. B.: Er ist faul; er ist darauf aus, mich zu provozieren) und sorgen Sie dafür, dass diese Vorannahmen unwirksam werden. Hilfreich ist hierbei die Technik des Reframings (Umdeutung). So könnte man „Geschwätzigkeit“ umdeuten in „interessiert an sozialem Austausch“, „faul“ könnte bedeuten „Fähigkeit, Arbeit aus dem Weg zu gehen“ oder „sucht emotionale Motivation durch den Lehrer/die Lehrerin“. Bringen Sie sich in eine Haltung, die von einem positiv-neugierigen Interesse für Felix gekennzeichnet ist. Je mehr Sie sich authentisch (!) für Felix interessieren können, desto mehr werden Sie erfahren – und desto mehr werden Sie an Felix entdecken können, was Sie für ihn einnimmt. • Überprüfen Sie, wie sympathisch Felix Ihnen ist. • Grundsätzlich sollte Ihre Haltung dadurch gekennzeichnet sein, dass Sie Informationen sammeln wollen über Felix. Je mehr er dabei Ihr Verbündeter ist („Wir erkunden gemeinsam den unbekannten Kontinent Felix“), desto mehr werden Sie erfahren und umso weniger wird er sich bedrängt fühlen. • Gehen Sie davon aus, dass es sich bei dem Verhalten von Felix primär um ein nicht beabsichtigtes Fehlverhalten handelt. Primär ist kein Kind – auch Felix nicht – bösartig. Immer wird es Lebensgeschichten Kontrolle ist gut, geben, die uns ein solches Verhalten erklären können. Vertrauen ist besser! Je besser es Ihnen gelingt, sich in eine Haltung voller Respekt Felix gegenüber zu bringen, desto effektiver wird jedes Gespräch und jeder Kontakt sein – und desto respektvoller wird Felix Sie behandeln. Schritt 3 – Gespächsbegründung Wenn Sie Felix zum Gespräch bitten oder seine Eltern ihm dies ankündigen, nachdem Sie sich mit ihnen abgestimmt haben, gehen Sie davon aus, dass allein diese Ankündigung beim Kind Befürchtungen und Ängste auslöst. Deshalb: • Räumen Sie potenzielle Befürchtungen aus, auch wenn diese von Felix nicht explizit benannt worden sind. • Sprechen Sie aktiv an, dass das Gespräch nicht zensurenabhängig ist, oder auch, dass es sich nicht um eine Strafe, ein Nachsitzen handelt. Machen Sie stattdessen deutlich, dass Sie gemeinsam mit Schaffen Sie Felix überlegen möchten, was ihn in der Schule unterstützen Transparenz! könnte. Sowohl in der Ankündigung für das Gespräch als auch in der unmittelbaren Gesprächseröffnung sollten Sie kurz und genau darstellen, worum es geht. Was Sie wie lange und mit welchem Motiv und welchen Konsequenzen mit Felix besprechen wollen. Drücken Sie dabei immer Ihre Sorge aus, lassen Sie nie Ihrer Skepsis oder Ihren – verständlichen – Vorwürfen freien Lauf. („Ich möchte gerne mit dir sprechen, weil ich mir Sorgen mache darüber, wie du im Unterricht mitkommst. Obwohl du ein kluger Junge bist, habe ich den Eindruck, du stehst dir manchmal selbst im Weg und möchtest das selbst nicht. Lass uns gemeinsam am XY in der Zeit von XY bis XY heraus- ❮32❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 33 finden, was los sein könnte. Du darfst ganz gelassen bleiben – es geht mir darum, ob ich herausfinden kann, wie ich dir helfen und dich besser verstehen kann.“) 23+4 12-3= 3x3=9 12+12=2 6x2=12 8-4=4 3+2=5 Bei der konkreten Gesprächseröffnung kann es darüber hinaus hilfreich sein, darauf hinzuweisen, dass alles (wirklich alles!) gesagt werden darf und dass sich das Gespräch insofern deutlich vom Unterricht unterscheidet. Machen Sie sich vorher klar, worüber Sie Stillschweigen bewahren können und worüber Sie sich mit anderen möglicherweise austauschen möchten. Besprechen Sie mit Felix die Frage der Vertraulichkeit vor Gesprächsbeginn. Schritt 4 – Das Ziel Zentrales Ziel des Gespräches mit Felix ist, seine Sicht der Dinge zu verstehen. Die Kindersicht ist das, was Sie interessiert. Interessieren Sie sich für die Zufriedenheit von Felix, dafür, wie er sich selbst erlebt. Formulieren Sie konstruktive W-Fragen: • Wer sind deine Freunde? • Wie gefällt es dir in deiner Klasse? • Was für Hobbys hast du? • Was machst du gerne in deiner Freizeit? • Wie gerne machst Du Schularbeiten? • Wie verbringst du deine Pausen? • Wann macht dir Unterricht am meisten Freude? • Wer zu Hause ist besonders wichtig für dich? Stellen Sie diese Fragen so, dass Felix sich nicht wie am Richtertisch fühlt. Wenn Sie den Eindruck haben, er reagiert auf manche Fragen abweisend oder wundert sich über Ihre „Neugier“ („Das geht Sie doch gar nichts an!“), erklären Sie noch einmal, worum es Ihnen geht, und überprüfen Sie Ihre Haltung. Im Zweifelsfall fragen Sie nicht weiter und verabreden sich lieber ein zweites Mal. Interessieren Sie sich dafür, was aus der Sicht von Felix schwierig ist und was nicht. Falls Felix „alles normal“ findet, insistieren Sie nicht, und vor allem: keine Moralisierungen („Du musst doch selbst merken …“)! Und nicht zuletzt: Interessieren Sie sich für die Position von Felix im Klassenverband. Wer oder was hilft ihm, wer oder was hilft ihm nicht und schließlich: Wer stört ihn und wodurch? Schritt 5 – Das Spiegeln Ein weiteres Ziel des Gespräches ist eine möglichst umfassende Informationssammlung. Es darf keine Vorwürfe und auch keine Moralisierungen geben. Wichtiger ist die Frage: Wie reagiert Felix, wie kann er das Gesprächs- und Beziehungsangebot annehmen? Kann er – gemeinsam mit Ihnen – Hilfsangebote entwickeln bzw. annehmen? Verstärken Sie allenfalls Gedanken oder Gefühle, die von Felix selbst kommen: „Das macht dich bestimmt traurig“, oder: „Da hast du es wirklich ❮33❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 34 schwer“, oder: „Da bist du bestimmt manchmal sehr wütend …“ Verhalten Sie sich wie ein Spiegel für Felix, und zwar einer, in dem er sich auch wirklich sehen kann! Die vermeintlichen Spiegel kennt er zur Genüge („Du musst dich eben mehr anstrengen; so unordentlich will dich keiner …“). Schritt 5 – Die Verabredung Wenn Sie genügend Informationen gesammelt haben, können Sie Felix damit vertraut machen, dass Sie entweder seinen Eltern empfehlen werden, ihn einmal genauer untersuchen zu lassen (Version 1 des Gesprächs), oder dass Sie sich gerne mit ihm für bestimmte Unterrichtstechniken verabreden möchten, um gemeinsam herauszufinden, ob der Unterricht für Felix nicht besser gestaltet werden kann. Besprechen Sie nun genau mit Felix, welche Inhalte des Gesprächs an wen und zu welchem Zweck weitergegeben werden sollen. Auf keinen Fall darf Felix das Gefühl bekommen, sein Vertrauen Ihnen gegenüber könnte missbraucht werden. Schritt 6 – Die Dokumentation Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Gespräch mit Felix so zu dokumentieren, dass Sie auch später und anderen gegenüber darauf zurückgreifen können. • Eine Möglichkeit sind standardisierte Verfahren, wie zum Beispiel die TRF (teacher report form), ein Verfahren, mit dem man allgemeine Verhaltensauffälligkeiten von Kindern erfassen kann. • Eine zweite Möglichkeit sind die Connors-Skalen, mit denen man gezielt – auch im Verlauf – Auffälligkeiten im Zusammenhang mit ADHS erfassen kann. • Eine dritte Möglichkeit ist ein eigenes freies Protokoll, in dem Sie festhalten, wie das Gespräch verlaufen ist, was Ihnen aufgefallen ist und mit welchen Absprachen es geendet hat. Dabei ist es für den weiteren Fortgang besonders wichtig, einzuschätzen und zu dokumentieren, wie gut sich Felix auf Sie und das Gesprächsangebot einlassen konnte, wie er die Beziehung zu Ihnen gestaltet hat und wie hoch Ihnen seine Reflexionsfähigkeit erscheint. Diese letzten Punkte sind wichtig, weil nur auf einer freundlich-kooperativen Grundlage das „10-Stunden-Projekt“ (siehe Kapitel „Modularer Leitfaden für den Unterricht“) gelingen kann. Sollten Sie den Eindruck haben, mit dem Gespräch gescheitert zu sein, überlegen Sie, ob Sie nicht erst noch einmal das Elterngespräch suchen, um eine bessere Basis auf der Erwachsenenebene zu finden. Man kann nicht alle Suchen Sie lieber erneut das Gespräch mit Felix, als dass Sie Familien und alle den Unterrichtsversuch auf einer Basis starten, die nicht ausKinder erreichen! reichend tragfähig ist! ❮34❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 35 Modularer Leitfaden für den Unterricht Anwendung von ausgewählten Techniken im Unterricht Inzwischen haben Sie alle Vorbedingungen geschaffen, um jetzt Ihren Unterricht mit Felix anzugehen und ihn zu verbessern. Denn wenn Felix das Aufpassen leichter fällt, kann der Unterricht ruhiger und konzentrierter und somit für alle ergiebiger verlaufen. schNel l schNel ler am SCHNEL lSTE Das „10-Stunden-Projekt“ Wir schlagen vor, dass Sie nun ein kleines „Projekt“ starten, das zunächst auf die Dauer von 10 Unterrichtsstunden beschränkt ist. Ziel ist es, ausgewählte Techniken – die wir Ihnen unten näher vorstellen – zunächst über einen begrenzten Zeitraum anzuwenden. Damit steigt bei dem Kind und auch bei Ihnen die Motivation, neue Verhaltensweisen auszuprobieren und sich über die Erfolge (oder Misserfolge) in kurzen Abständen auszutauschen. Beginnen Sie mit den Techniken, die Ihnen leicht umzusetzen erscheinen, und wählen Sie nicht mehr als drei auf einmal. Voraussetzung Voraussetzung für den Start dieses 10-Stunden-Projekts ist das Gespräch mit Felix und seinen Eltern und dass ein Konsens zwischen allen Beteiligten hergestellt wurde. Weit Weiter am weites teN Vereinbarung von Zielen Falls im Gespräch mit Felix noch nicht geschehen, sollten Sie nun einen gemeinsamen Zielplan mit ihm erstellen. Achten Sie darauf, dass die Ziele möglichst konkret, überschaubar und umsetzbar, d. h. realistisch, sind (z. B. als Ziel für Felix möglichst nicht vereinbaren: „Ich will ruhiger werden“, sondern: „Ich möchte es schaffen, 10 Minuten am Stück sitzen zu bleiben“ oder: „Ich möchte mein Hausaufgabenheft während der nächsten Woche mitbringen“). Entscheidend ist, dass es wirklich gemeinsame Ziele sind. Sollte Felix keine eigenen benennen können, schlagen Sie welche vor. Nehmen Sie aber nur solche auf, die das Kind authentisch bejaht. Sie können die Ziele für jede Stunde neu oder gleich für alle 10 Stunden festlegen. Nach Möglichkeit sollte Felix die Ziele selbst aufschreiben (siehe Kopiervorlage „Zielplan“). Informieren der Klasse Bevor Sie mit den konkreten Unterrichtseinheiten beginnen, kann es sinnvoll sein, die Klasse zu informieren. Sprechen Sie diesen Schritt aber unbedingt im Vorfeld mit Felix und den Eltern ab. Erklären Sie, dass Transparenz das Vorgehen erleichtern kann, akzeptieren Sie aber auch, wenn diesem Vorgehen nicht zugestimmt wird. Wenn Sie die Klasse in Kenntnis setzen, beobachten Sie, wie die Information aufgenommen wird, wer eventuell eifersüchtig reagiert oder wer auch gerne einbezogen wäre, wer das Projekt stören könnte usw. Informieren Sie so sachlich wie möglich (Beispiel: „Ihr wisst ja alle, dass Felix manchmal Probleme mit dem Aufpassen hat und dann sehr unruhig wird. Manche von euch fühlen sich dadurch gestört. Um Felix zu helfen, besser zurechtzukommen, habe ich mit ihm für die nächsten 10 Unterrichtsstunden ein kleines Hilfeprojekt abgesprochen. Wundert euch also bitte nicht, wenn ich z. B. Felix bestimmte Zeichen gebe oder mich anders verhalte als sonst. Ich bitte euch herzlich, Felix und mich in unserem Projekt zu unterstützen.“). ❮35❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 36 Stundenprotokoll Zwecks einer kontinuierlichen Dokumentation und zu Ihrer eigenen Kontrolle bietet es sich an, nach jeder Stunde ein kurzes Protokoll auszufüllen, in dem Sie angeben, welche Technik(en) Sie mit welchem Erfolg angewandt haben, sei es in Bezug auf das Verhalten von Felix oder Ihr eigenes Verhalten bzw. den Einsatz der beschriebenen Techniken (siehe Kopiervorlage „Stundenprotokoll“). Zufriedenheitsthermometer Am Ende jeder Stunde (oder auch am Ende einer internen Unterrichtseinheit) kann es hilfreich sein, von Felix ein Zufriedenheitsthermometer aktivieren zu lassen. Das Thermometer hat 100 Grad, 100 bedeutet eine maximale Zufriedenheit und 0 völlige Unzufriedenheit mit seinem eigenen Verhalten. Halten Sie sich mit Einschätzungen gegenüber Felix zurück – es sei denn, Sie sind selbst sehr zufrieden. Schätzt Felix sich selbst schlecht ein und deckt sich diese Einschätzung mit Ihrer, so ermuntern Sie ihn dahingehend, dass er morgen wieder eine neue Chance bekommt (siehe Kopiervorlage „Zufriedenheitsthermometer“). Einschätzung der Zielerreichung In mit Felix abgesprochenen Zeitabständen sollten Sie gemeinsam den Grad der Zielerreichung einschätzen. Dies kann von den Werten Ihres Stundenprotokolls bzw. Felix’ Zufriedenheitsthermometer (s. o.) abweichen, weil die subjektive Zufriedenheit nicht unbedingt mit erreichten Zielen identisch ist (siehe Kopiervorlage „Gradmesser Zielerreichung“). Implementierung in den Alltag Waren die Interventionen erfolgreich, sollten Sie nun überlegen, welche Strategien sich von jetzt an dauerhaft in den Unterrichtsalltag implementieren lassen. Wichtig dabei ist, nicht nachzulassen, weil Sie nicht davon ausgehen können, dass veränderte Verhaltensweisen von Felix dauerhaft erhalten bleiben. So können sich von Zeit zu Zeit „Auffrischeinheiten“ lohnen, die Sie nach Absprache mit Felix einsetzen. Unterstützen Sie ihn weiter! Unter Soziometrie versteht man eine Methode der Sozialpsychologie, mit der man soziale Beziehungen in einer Gruppe von Menschen in Bezug auf vorher definierte Kriterien sichtbar macht. Vorab: Durchführung einer Soziometrie Wenn es Ihnen hilfreich erscheint, können Sie zusätzlich vor Beginn des Projekts eine Soziometrie durchführen, die es Ihnen erleichtert, sich das soziale Beziehungsgefüge der Klasse zu vergegenwärtigen und es unter Umständen für das Projekt einzusetzen. Überlegen Sie sich spezifische Fragen, nach denen Sie das soziale Geflecht der Klasse besser verstehen möchten. Zum Beispiel: Wer sitzt gerne neben wem? Wer möchte auf keinen Fall neben wem sitzen? Wer verbringt die Pausen am liebsten mit wem? Wer meidet den Pausenkontakt mit wem? Wer ist mit wem über die Schule hinaus befreundet? Wer hasst wen? Wer hilft wem? Wer ärgert wen? ❮36❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 37 (Hier können Sie auch den ausgefüllten Fragebogen zur Verhaltensbeobachtung zu Rate ziehen.) Sie können sich natürlich auch eigene Fragen überlegen. Am einfachsten ist es, wenn Sie die Fragen (nicht zu viele!) selbst beantworten können. Sie können Sie aber auch der Klasse kurz schriftlich geben. Vorsicht: Achten Sie darauf, dass jeder seinen Bogen für sich allein ausfüllt und die anderen die Antworten nicht zu sehen bekommen, weil dies eventuell sehr kränkend und verletzend sein kann! Dasselbe gilt für Ihre eigene Einschätzung: Behalten Sie sie für sich und nutzen Sie die Ergebnisse der Soziometrie nur für sich. Geben Sie für die Auswertung jedem Kind eine Nummer oder ein Kürzel. Tragen Sie diese Kürzel als Kreise in gleichmäßiger Verteilung auf ein Blatt Papier auf. Verbinden Sie dann die Kreise mit Pfeilen analog zu den Antworten, wobei Sie die jeweilige Wahl farblich markieren (positive Wahl ist z. B. grün und Abwahl rot). Sortieren Sie dann die Kreise neu so, dass das Gefüge übersichtlich wird. Sie werden sehen, dass es wenige sehr beliebte und wenige unbeliebte Kinder gibt. Besonders wichtig – weil potenziell konfliktreich – sind gegenläufige Wahlen (ein Kind wählt ein anderes positiv, dasselbe wählt im Gegenzug jedoch ab). Beispiel einer Klassensoziometrie „Sitzordnung“ Fragestellung: Neben wem sitzt du am liebsten (grün)? Neben wem möchtest du auf keinen Fall sitzen (rot)? Anna Sarah Jakob Lisa Hannah Lucas Maria Felix Max Florian Jan Achten Sie darauf, dass keine Schüler durch den Sitzplan missbraucht werden! Nur weil ein bestimmtes Mädchen z. B. ruhig und verträglich ist, darf über dessen Wahl nicht hinweggegangen werden! Sie können die Ergebnisse der Soziometrie nun nutzen, um z. B. den Sitzplan der Klasse so zu gestalten, dass möglichst wenig Reibung durch nebeneinander sitzende Kinder mit negativen Wahlen entsteht. Gleichzeitig können Sie die Position von Felix besser einschätzen und gerade ihm jemanden an die Seite geben, der – soziometrisch betrachtet – hilfreich sein könnte. ❮37❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 38 In unserem Beispiel wird klar ersichtlich, dass neben Felix die wenigsten sitzen möchten (3 Abwahlen), wohingegen Lisa sich großer Beliebtheit erfreut (3 positive Wahlen). Haben sich zwei Kinder gegenseitig als liebste Tischnachbarn gewählt (z. B. Lucas und Jan oder Anna und Lisa), bietet es sich an, die beiden nebeneinander zu setzen – vorausgesetzt, sie haben sich im Unterricht nicht „zu viel zu erzählen“. Als Tischnachbar für Felix kämen z. B. Maria, Sarah oder Max in Frage – diese haben Felix nicht „abgewählt“ und haben keine „besten“ Freunde, durch die sie gewählt wurden. Techniken Es gibt bestimmte, aus der Verhaltenspädagogik abgeleitete Techniken, die nun im Unterrichtsprojekt eingesetzt werden sollen. Sie sollten alle vor ihrem Einsatz daraufhin überprüfen, ob sie Ihnen in Ihrem speziellen Fall sinnvoll und einsetzbar erscheinen. Diese sollten mit Felix abgesprochen sein, denn sie helfen nur, wenn alle Beteiligten über deren Sinn und Zweck umfassend informiert sind. Technik 1 – Blickkontakt Verabreden Sie mit Felix, dass Sie häufig Blickkontakt zu ihm aufnehmen und halten werden. Ermuntern Sie ihn, diesen Blickkontakt zu erwidern. Technik 2 – Zeichensprache Zusätzlich kann eine verabredete Zeichensprache hilfreich sein. Denken Sie sich gemeinsam mit Felix eines oder mehrere „Geheimzeichen“ aus, die Sie fortan einsetzen. Achten Sie darauf, dass diese Zeichen nach Möglichkeit ermunternd und eher sekundär Ein erhobener Zeigefin- ermahnend sind! ger ist ein Drohsignal und keine Ermunterung. Ein Victory-Zeichen dagegen erinnert an die gemeinsam formulierte Ziellinie, die erreicht werden will! ❮38❯ Technik 3 – Körperkontakt Nutzen Sie die beruhigende Wirkung eines freundlich-ermunternden Körperkontakts. Gehen Sie während des Unterrichts an Felix vorbei und legen Sie ihm die Hand auf die Schulter. Nach Möglichkeit immer dann, wenn ein Abfall seiner Konzentration kurz bevorsteht, aber auch dann, wenn er gerade wieder „aus dem Ruder“ läuft. Achten Sie auch hier darauf, dass der Kontakt vorher abgesprochen ist und ein „informed consent“ (Einverständnis) besteht. Bei gegengeschlechtlichen Kontakten ist es besonKörperkontakt sollte ders wichtig, die Zunur bis zu einem bestimmung dazu vorstimmten Alter eingeher einzuholen und setzt werden. Spätesden Körperkontakt tens mit dem Eintritt in die Pubertät kann diese nur sehr sparsam und unzweideutig Technik kontraprodukeinzusetzen. tiv werden! Technik 4 – Karten Setzen Sie farbige Karten (siehe Literaturverzeichnis) ein, um mit Felix während des Unterrichts nonverbal zu kommunizieren und ihm eine Rückmeldung über sein Verhalten zu geben bzw. um ihn anzuspornen. Zeigen Sie ihm immer Stopp-Regeln verbrauwieder die grüne Karte chen sich schnell in für ein „Go“, ein ihrer Wirksamkeit! „Weiter so“. Nutzen Deshalb: sparsamer Sie die gelbe Karte, Einsatz! wenn Sie den Eindruck haben, dass ein „Stopp“ notwendig ist. Technik 5 – Time-out Bei manchen Kindern kann es hilfreich sein, ihnen von Zeit zu Zeit eine Auszeit zu gewähren. Dies sollte am besten im Unterricht erfolgen, damit Felix nicht ausgeschlossen wird („Du brauchst jetzt 5 MiErwarten Sie nicht, dass nuten nicht aufzupassen – entspann Felix nach einem kleidich mit …“ Hier können Lauf ruhiger ist. nen z. B. kleine AufKinder mit ADHS wergaben eingesetzt den nicht automatisch werden, die ein moruhiger, wenn man sie torisches „Austoben“ gewähren lässt! strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 39 ermöglichen.) Es gibt aber auch Kinder, denen besser damit geholfen ist, wenn sie 5 Minuten um den Pausenhof laufen dürfen. Technik 6 – Positive Verstärkung Führen Sie mit Felix ein Punktesystem ein, mit dem er sich an das gemeinsame Ziel heranarbeiten kann. Unterteilen Sie, soweit möglich, den Unterricht in kleinere Einheiten, für die es jeweils zwei oder drei Punkte gibt. So kann Felix z. B. neun Punkte pro Stunde sammeln, die dann schon erreichte Subziele dokumentieren. Dieses Punktesystem kann auch mit den Eltern abgesprochen werden, die dann für alle 40 bis 50 Punkte (Achtung: auf Erreichbarkeit achten!) eine besondere Aktivität mit Felix unternehmen (nach Möglichkeit keine Geschenke im üblichen Sinn, sondern eher gemeinsam verbrachte Zeit/ gemeinsame Aktivitäten – und nur, wenn die Eltern bereit dazu sind und es sich leisten können). Technik 9 – Rückfragen Behalten Sie Felix im Auge und überprüfen Sie sooft es geht, ob er dabeibleiben konnte. Unterstellen Sie dabei immer ein Nichtkönnen – nie ein Nichtwollen. Fragen Sie z. B. in Verbindung mit einem kurzen, freundlichen Körperkontakt: „Wie gut konntest du zuhören?“ oder „Was konntest du verstehen?“ Überprüfen Sie, ob Ihre Aufgabenstellungen auch wirklich bei Felix angekommen sind. Technik 10 – Hausaufgabenheft Führen Sie für Felix ein Hausaufgabenheft ein, das nach Absprache mit den Eltern von diesen gegengezeichnet wird. Setzen Sie dieses Instrument immer als Unterstützung für Felix ein – nie so, dass er das Gefühl bekommt, es handele sich um ein Kontroll- und Reglementierungsinstrument. Technik 7 – Feedback Führen Sie mit Felix ein Rückmeldesystem ein, das ihm möglichst zeitnah und knapp einen Eindruck über das Geleistete verschafft. Achten Sie primär auf das, was er geschafft hat, das Nichterreichte wird nach Möglichkeit nicht erwähnt. Nur in Ausnahmefällen und wenn Sie sicher sein können, dass Felix die Kritik vertragen kann, erwähnen Sie auch das, was nicht so gut geklappt hat. Sie können dieses System auch verschriftlichen und nach jeder Stunde bzw. nach der jeweils verabredeten Einheit Felix (auch für zu Hause) mitgeben oder Sie führen jeweils eine kurze Gesprächsrunde am Beginn der Pause ein. („Mir hat heute gefallen …“ Zuerst berichtet Felix und dann Sie). Technik 8 – Anspornen Wenn es der Unterricht zulässt, sollten Sie Felix immer dann anspornen, wenn Sie merken, dass seine Aufmerksamkeit nachlässt. „Versuch, noch länger durchzuhalten“ oder „Komm, noch fünf Minuten – das kannst du schaffen“. Achten Sie darauf, Felix nicht zu überfordern. Anspornen macht nur Sinn, wenn die geforderte Leistung auch zu schaffen ist. Wenn Felix nicht folgen kann: „Macht nichts – bestimmt klappt es beim nächsten Mal.“ ❮39❯ strattera_schulproj_inh ❮40❯ 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 40 strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 41 Informationen zu gesetzlichen Ansprüchen Zusätzliche Unterstützung für ADHS-Kinder und deren Eltern Die meisten ADHS-Kinder benötigen in der Schule besondere Unterstützung und Förderung, damit sie ihre Möglichkeiten ausschöpfen und somit den schulischen Erfordernissen gerecht werden können. Sie als Lehrer können den Familien – neben einer adäquaten Unterrichtsgestaltung – zusätzlich helfen, indem Sie die Eltern betroffener Kinder auf in gesetzlichen Regelungen vorgesehene Fördermöglichkeiten aufmerksam machen und sie dahingehend beraten. Folgende gesetzliche Regelungen können von ADHS-Kindern bzw. deren Eltern in Anspruch genommen werden: A. Regelungen der Kultusministerien zum so genannten Nachteilsausgleich Hintergrund Die Regelung des Umgangs mit kranken Kindern in den Schulen obliegt den Kultusministerien der Länder. Ein Vergleich der Regelungen der Kultusministerien zeigt, dass keiner der Erlasse ADHS namentlich ausweist. Somit fällt ADHS unter die Erlasse zu „Krankheiten“ allgemein und unter den Punkt „Sonderpädagogische Förderung“. Voraussetzung dafür ist, dass eine ärztliche Diagnose mit entsprechender Empfehlung für die Schule vorliegt. Nachteilsausgleich Der so genannte Nachteilsausgleich wird in den meisten Bundesländern in den Schulgesetzen für kranke Schülerinnen und Schüler geregelt. Er sieht besondere Maßnahmen seitens der Schule vor (z. B. Zeitverlängerung bei Klassenarbeiten). Ob ein solcher Nachteilsausgleich gewährt wird, entscheidet die Schule selbst; Antragsteller sind bei minderjährigen Kindern die Eltern. Stellvertretend für die verschiedenen Regelungen in den einzelnen Bundesländern folgt nun ein Ausschnitt aus einem Erlass zum „Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen bei Prüfungen und Leistungsnachweisen“ des Hessischen Kultusministeriums vom 19. Dezember 1995: „Aufgrund des § 50 Hessisches Schulgesetz haben die allgemeinen Schulen und die Sonderschulen den gemeinsamen Auftrag, bei der Rehabilitation und Eingliederung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen bzw. mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die Gesellschaft mitzuwirken. Dieser Auftrag und Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes erfordern die besondere Fürsorge der Schule im täglichen Schulleben in und außerhalb von Unterricht. Bei Prüfungen ist Schülern und Schülerinnen nach dem Grundsatz des § 6 Abs. 2 Hessische Laufbahnverordnung (HLVO) ein ihrer körperlichen Behinderung angemessener Nachteilsausgleich zu gewähren, die fachlichen Anforderungen dürfen jedoch nicht geringer bemessen werden. § 9 Abs. 2 der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung regelt die Gestaltung des gemeinsamen Unterrichts für Schüler und Schülerinnen mit abweichender Zielsetzung. Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen, die zielgerichtet unterrichtet werden können, haben Anspruch auf Nachteilsausgleich bei Leistungsanforderungen im Rahmen der allgemeinen Fürsorgepflicht der Schule und der entsprechenden Regelungen im Schwerbehindertengesetz (Nachteilsausgleich § 48 Schwerbehindertengesetz [SchwbG]). Schülern und Schülerinnen mit Behinderungen, die gemeinsam mit Nichtbehinderten unterrichtet werden, darf bei der Leistungsvermittlung kein Nachteil aufgrund ihrer Behinderung entstehen. Bei mündlichen, schriftlichen, praktischen und sonstigen Leistungsanforderungen ist auf die Behinderung des Schülers bzw. der Schülerin angemessen Rücksicht zu nehmen und ggf. ein Nachteilsausgleich zu schaffen bzw. eine differenzierte Leistungsanforderung zu stellen, z. B.: • verlängerte Arbeitszeiten bei Klassenarbeiten; • Bereitstellen bzw. Zulassen spezieller Arbeitsmittel (Einmaleinstabelle, Schreibmaschine, Computer, Kassettenrecorder, größere bzw. spezifisch gestaltete Arbeitsblätter, größere Linien, spezielle Stifte u. Ä.); • mündliche statt schriftlicher Prüfung (z. B. einen Aufsatz auf Band sprechen); ❮41❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 42 • unterrichtsorganisatorische Veränderungen (z. B. individuell gestaltete Pausenregelungen, individuelle Arbeitsplatzorganisation, Verzicht auf Mitschrift von Tafeltexten); • differenzierte Hausaufgabenstellung; • individuelle Sportübungen. Ein Nachteilsausgleich ist auch bei einer nur vorübergehenden Funktionsbeeinträchtigung (z. B. bei Armbruch) zu gewähren. Antragsberechtigt sind für minderjährige Schülerinnen und Schüler die Eltern, im Übrigen die volljährige Schülerin bzw. der Schüler selbst. Der Antrag ist an die Leiterin bzw. den Leiter der besuchten Einrichtung zu richten. Über eine Behinderung oder eine vorübergehende Beeinträchtigung ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen. Über Art und Umfang eines zu gewährenden Nachteilsausgleiches entscheidet die Leiterin bzw. der Leiter der besuchten Schule in Absprache mit den unterrichtenden Lehrkräften. Ihre bzw. seine Entscheidung ist zu den Akten zu nehmen. In Zweifelsfällen ist die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde einzuholen. Ein Vermerk über den gewährten Nachteilsausgleich darf nicht in Arbeiten und Zeugnissen erscheinen (siehe § 52 SchwbG).“ B. Regelungen im Kinder- und Jugendhilfegesetz Das bundesweit geltende Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) wird als Instrument zur Vorbeugung, zur Hilfestellung und zum Viele Eltern haben BeSchutz von Kindern rührungsängste mit und Jugendlichen dem Jugendamt. Sie verstanden. Im Vorwollen auf keinen Fall dergrund stehen die als „Sozialfall“ gelten. Förderung der EntWichtig ist, die Eltern wicklung junger auf den unterstützenMenschen und die den Charakter der Integration in die GeJugendhilfe aufmerksellschaft durch allsam zu machen. ❮42❯ gemeine Förderungsangebote und Leistungen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Das KJHG ist identisch mit dem achten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VIII). In besonderen Einzelfällen bietet das KJHG Familien z. B. die Möglichkeit, staatliche Mittel zur Förderung ihrer Kinder in Anspruch zu nehmen. Denn nicht immer werden die Kosten für notwendige spezielle Fördermaßnahmen (v. a. Unterstützungsangebote freier Anbieter) von den Krankenkassen gedeckt. Ob und welche Zuwendungen Familien allerdings erhalten, hängt von den einzelnen Jugendämtern ab. Oft werden Anträge auf Kostenübernahme privater Anbieter angesichts leerer Kassen abgelehnt. Anspruchsgrundlagen Eltern von ADHS-Kindern können sich insbesondere auf den vierten Abschnitt des KJHG berufen, der die „Hilfe zur Erziehung“ und die „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ regelt: Hilfe zur Erziehung gem. § 27 KJHG (1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. (2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfe ist in der Regel im Inland zu erbringen; sie darf nur dann im Ausland erbracht werden, wenn dies nach Maßgabe der Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich ist. strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 43 (2 a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses erforderlich, so entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass eine andere unterhaltspflichtige Person bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die Gewährung von Hilfe zur Erziehung setzt in diesem Fall voraus, dass diese Person bereit und geeignet ist, den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe der §§ 36 und 37 zu decken. (3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen im Sinne von § 13 Abs. 2 einschließen. (4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthaltes in einer Einrichtung oder einer Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung auch die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a SGB VIII (1) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und 2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses Buches sind Kinder oder Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. § 27 Abs. 4 gilt entsprechend. (1 a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme 1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder 3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt, einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information herausgegebenen deutschen Fassung zu erstellen. Dabei ist auch darzulegen, ob die Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer Krankheit beruht. Die Hilfe soll nicht von der Person oder dem Dienst oder der Einrichtung, der die Person angehört, die die Stellungnahme abgibt, erbracht werden. Ablauf Grundsätzlich sollten zunächst die schulinternen Möglichkeiten ausgeschöpft werden (Durchführung von speziellen Maßnahmen wie Gesprächen, schulischen Fördermaßnahmen, Erarbeitung eines qualifizierten Förderangebots etc.). Wenn diese Maßnahmen nicht zu einer Besserung der Lernsituation bzw. des Verhaltens führen und es zu Integrationsproblemen kommt, kann die Inanspruchnahme von außerschulischen Hilfemöglichkeiten – wie z. B. ein Antrag auf Leistungen nach dem KJHG – sinnvoll sein. Der Ablauf für die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem KHJG ist wie folgt: • Die Eltern des betroffenen Kindes stellen einen Antrag auf Leistungen nach dem KJHG bei dem zuständigen Jugendamt. • In Abstimmung mit den Eltern, dem Kind sowie in Kooperation mit den beteiligten Institutionen prüft der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) die Voraussetzungen zur Gewährung von ambulanten Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG) sowie von Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (§ 35a KJHG). • Es werden Stellungnahmen des beteiligten ❮43❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 44 Facharztes, der Schule etc. eingeholt und Gespräche mit den Eltern und dem Kind über seine soziale Integration durchgeführt. Die Untersuchung muss in der Regel der Amtsarzt des Gesundheitsamtes vornehmen. • Sind die Voraussetzungen für ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 KJHG oder Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG gegeben, wird in der Regel im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte gemeinsam mit den Eltern und dem Kind ein Hilfeplan gemäß § 36 KJHG erstellt; dieser macht Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen. Bei der Fortschreibung des Hilfeplans, dessen Realisierung regelmäßig zu prüfen ist, sind die Schule, der beteiligte Arzt, die Eltern und das Kind erneut hinzuzuziehen. ❮44❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 45 Informationsquellen zu ADHS Hilfreiche Empfehlungen für Eltern Die Arbeit mit Schulen zeigt uns immer wieder, dass in Lehrerkreisen oftmals Unsicherheit darin besteht, die Eltern betroffener Kinder gut zu beraten. Dabei mangelt es nicht an Informationsquellen, die man zu Rate ziehen kann. Neben Büchern und Broschüren bietet insbesondere das Internet eine nahezu unüberschaubare Datenfülle zum Thema ADHS, die für jeden frei verfügbar ist. Gibt man in eine der gängigen Suchmaschinen den Begriff ADHS ein, erhält man über 200.000 Einträge. Bei einer solchen Fülle von Informationen fällt es natürlich nicht immer leicht, seriös von unseriös zu unterscheiden. Elternselbsthilfegruppen Sie werden es bestimmt auch schon erlebt haben, dass Eltern von Kindern mit ADHS Hilfe suchend auf Sie zugekommen sind und um Ihren Rat gebeten haben, an wen sie sich wenden können und wo sie Unterstützung erhalten. Über hervorragendes Informationsmaterial und kompetente Ansprechpartner verfügen in der Regel die Elternselbsthilfegruppen. Hier erfahren Eltern Unterstützung und Begleitung in allen Fragen, die ADHS betreffen. Auch Schulen erhalten Hilfestellung durch Fortbildungsangebote und unterrichtsrelevante Broschüren. Aufgrund ihres meist ausgezeichneten Informationsnetzes können Elternselbsthilfegruppen darüber hinaus eine erste Orientierung geben, an welche qualifizierten Fachärzte oder sonstigen kompetenten Anlaufstellen sich Eltern betroffener Kinder wenden können. Die Adressen der Verbände der bundesweit agierenden ADHS-Selbsthilfegruppen finden Sie am Ende des Kapitels aufgeführt. Deren Regionalgruppen können Sie ausfindig machen entweder über deren Webseite oder über • die Gelben Seiten, • die Krankenkassen, • den Schulpsychologischen Dienst des zuständigen Schulamtes, • Beratungsschulen (Förderschulen). ❮45❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 46 Literatur Zum Thema ADHS gibt es mindestens so viele Bücher und Ratgeber, wie es Meinungen zu diesem Thema gibt. Wir beschränken uns daher darauf, Sie auf ein Standardwerk und eine Broschüre des Hamburger Arbeitskreises zu verweisen. Hilfreiche Fachliteratur zu Unterrichtsmethodik finden Sie bei den Schulbuchverlagen, die sich auf handlungsorientierten Unterricht spezialisiert haben. Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung München (Hrsg.): Aufmerksamkeitsgestörte, hyperaktive Kinder und Jugendliche im Unterricht. Auer Verlag. ISBN 3-403-03248-5 Hamburger Arbeitskreis ADS/ADHS: Informationsbroschüre „Leitfaden ADS/ADHS“ inklusive einer Übersicht praktischer Tipps „ADS/ADHS im Alltag“ Der Leitfaden kann kostenlos angefordert werden, entweder per Brief/Postkarte oder per E-Mail. Hamburger Arbeitskreis ADS/ADHS Postfach 65 22 40, 22373 Hamburg [email protected] Signalkarten Es geht auch ohne Worte. Signalkarten für den Unterricht. Hund, Wolfgang, Verlag an der Ruhr Orientierung ohne Worte. Kirschner, Jens und Treu, Sabine, Verlag an der Ruhr Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: www.info-adhs.de ❮46❯ Adressen Selbsthilfegruppen BV AH Bundesverband Aufmerksamkeitsstörungen/ Hyperaktivität e. V. Postfach 60, 91291 Forchheim Telefon 09191 704260, Fax 09191 34874 www.bv-ah.de [email protected] BV AÜK Bundesverband Arbeitskreis überaktives Kind e. V. Postfach 41 07 24, 12117 Berlin Telefon 030 85605902, Fax 030 85605970 www.bv-auek.de [email protected] ADS e. V. Elterninitiative zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit AufmerksamkeitsDefizitSyndrom (ADS) mit/ ohne Hyperaktivität Postfach 11 65, Im Tiefentobel 28, 73055 Ebersbach Telefon 07161 920225, Fax 07161 920226 www.ads-ev.de [email protected] (An dieser Stelle sind nur die größten Verbände aufgeführt. Auf den Internetseiten dieser Verbände finden Sie aber eine Vielzahl von Links und Hinweisen zu weiteren Verbänden und regionalen Gruppen.) strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 47 ❮47❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 48 Glossar Was versteht man unter…? ADHS Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit ➔ Hyperaktivität. Kernsymptome sind eine verminderte Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit, gesteigerter Bewegungsdrang sowie ➔ Impulsivität. ADS Aufmerksamkeitsdefizitstörung ohne ➔ Hyperaktivität. Die Kernsymptome sind verminderte Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit, ➔ Impulsivität sowie ein normaler oder reduzierter Bewegungsdrang. Der Begriff ADHS wird gewöhnlich für beide Varianten (ADS und ADHS) verwandt. Dopamin ➔ Neurotransmitter (Botenstoff), der eine wichtige Rolle bei der Reizweiterleitung im Gehirn spielt. EEG Elektroenzephalogramm: das Aufzeichnen und Auswerten des Hirnstrombildes. Hyperaktivität Gesteigerter Bewegungsdrang und körperliche Unruhe. Impulsivität, impulsives Verhalten Spontanes, plötzliches Ausführen von Handlungen, ohne zu überlegen und/oder die Folgen zu bedenken. Führt bei ADHS-Kindern häufig zu Unfällen und Verletzungen. Komorbiditäten Begleiterkrankungen, die neben ADHS auftreten und gesondert diagnostiziert und behandelt werden müssen. ❮48❯ Lese-Rechtsschreib- und Rechen-Schwäche Teilleistungsstörungen, bei denen durch spezifische und umschriebene Funktionsstörungen in bestimmten Hirnbereichen die Lese- und/oder Rechtschreibleistungen des betroffenen Kindes beeinträchtigt sind bzw. eine spezifische Rechenschwäche vorliegt. Beide Störungen gehen in der Regel mit normaler Intelligenz einher. Multimodale Therapie Behandlung, die sich aus einer jeweils individuellen Kombination unterschiedlicher Therapieformen zusammensetzt. Der multimodale Therapieansatz bei ADHS umfasst das Elterntraining, psychotherapeutische Maßnahmen, (z. B. Verhaltenstherapie) und die medikamentöse Therapie. Nachteilsausgleich Vorschriften über Hilfen für behinderte Menschen zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile oder Mehraufwendungen. Neurotransmitter Im Nervensystem wirkende körpereigene Substanzen (Botenstoffe), die für die Reizübertragung zwischen Nervenzellen zuständig sind. Die wichtigsten im Zusammenhang mit ADHS sind ➔ Dopamin und ➔ Noradrenalin. Noradrenalin ➔ Neurotransmitter (Botenstoff), der eine wichtige Rolle bei der Reizweiterleitung im Gehirn spielt. Psychostimulanzien Substanzen (Psychopharmaka), die über eine direkte Beeinflussung des Zentralnervensystems Erleben und Verhalten des Patienten verändern können. Bei Gesunden können sie den Antrieb steigern und psychisch anregend wirken. Bei ADHS hingegen wirken sie nicht anregend, sondern eher ausgleichend. Die Verordnung dieser Medikamente unterliegt in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz. strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 49 Selktive NoradrenalinWiederaufnahmehemmer Substanzen (Psychopharmaka), die zu einer Regulation des ➔ Noradrenalin-Systems im Gehirn beitragen können. Erste medikamentöse Behandlungsoption für ADHS, die kein Psychostimulanz ist. Soziometrie Eine Methode der Sozialpsychologie, mit der man soziale Beziehungen in einer Gruppe von Menschen in Bezug auf vorher definierte Kriterien sichtbar macht. Stimulanzien ➔ Psychostimulanzien Teilleistungsstörungen Leistungsstörungen, die bestimmte Funktionen des Gehirns betreffen (Lesen, Schreiben, Rechnen). Zusammen mit ADHS können ➔ LeseRechtschreib- und Rechen-Schwäche vorkommen. Tic-Störungen Unwillkürliche Muskelzuckungen, besonders im Gesicht, die bei ADHS häufig begleitend auftreten. Tourette-Syndrom (TS) Eine neuropsychiatrische Erkrankung, die durch komplexe (vokal/motorische) Tics charakterisiert ist. Tics sind spontane, plötzliche und häufig heftige Bewegungen oder Lautäußerungen. Benannt nach dem französischen Arzt Gilles de la Tourette, der die Symptomatik erstmals um 1885 beschrieb. Verhaltenstherapie Psychotherapeutische Behandlung, bei der unerwünschte Verhaltensweisen abgebaut und gezielt durch neu erlernte ersetzt werden. Baustein der ➔ multimodalen Therapie von ADHS. ❮49❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 50 Eckpunktepapier des BMGS Eckpunkte der Ergebnisse der vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung durchgeführten interdisziplinären Konsensuskonferenz zur Verbesserung der Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) (Oktober 2002) Pressemitteilung des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung vom 27. Dezember 2002: Zur Verbesserung der Versorgung von Kindern, Jugendlichen sowie von Erwachsenen mit der Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) wurde auf Einladung des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung eine Konferenz durchgeführt, auf der ein weit reichender Konsens über verbindliche Standards in der Diagnose und Behandlung des ADHS erzielt wurde. An der Konferenz waren Vertreter der Kinder- und Jugendmedizin, der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Psychologie, weiterer Berufsgruppen sowie der Elternverbände beteiligt. Hierzu erklärt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, Marion Caspers-Merk: • eine Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Berufsgruppen über den Aufbau von regionalen und überregionalen Netzwerken unter Beteiligung der Elternverbände verbessert werden soll sowie • die Fachkompetenz der jeweiligen ärztlichen und nichtärztlichen Berufsgruppen über den Aufbau eines fachübergreifenden modularen Fortbildungsangebotes zur ADHS sichergestellt wird. „Ich begrüße es sehr, dass die unterschiedlichen Berufs- und Fachgruppen, die mit der Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung konfrontiert sind, sich über wesentliche Kriterien zur Diagnose und Therapie einigen konnten. Es geht dabei in erster Linie um die Sicherstellung einer qualitätsgesicherten und bedarfsgerechten Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie der Gruppe von Erwachsenen mit ADHS. Dabei ist mir sehr wichtig, dass über den erzielten Konsens nun: Der Inhalt der Übereinkunft ist in einem Eckpunktepapier zusammengefasst. • den betroffenen Familien und der Öffentlichkeit ein gemeinsames Verständnis über das Krankheitsbild und die Behandlung vermittelt wird, • die Verschreibung von Methylphenidat auf der Grundlage wissenschaftlicher Standards im Rahmen einer abgestimmten Diagnosestellung und multimodalen Therapie erfolgt, ❮50❯ Mit der Einigung verbinde ich die Hoffnung, dass wir die gesundheitliche Versorgung in der Diagnose und multimodalen Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung wesentlich verbessern können. Ich erhoffe mir auch, dass die öffentliche Diskussion nicht weiterhin mit widersprüchlichen und unverantwortlichen Botschaften zur medikamentösen Behandlung behaftet ist.“ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 51 Eckpunkte der Ergebnisse der vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung durchgeführten interdisziplinären Konsensuskonferenz zur Verbesserung der Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). (Bonn, 28. und 29. Oktober 2002) 1. Aktuelle Prävalenzschätzungen zur ADHS gehen von 2 bis 6 % betroffenen Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren aus. ADHS ist damit eines der häufigsten chronisch verlaufenden Krankheitsbilder bei Kindern und Jugendlichen. Die bedarfsgerechte Versorgung dieser Patienten – die durch unterschiedliche Berufsgruppen getragen wird – ist derzeit nicht flächendeckend gewährleistet. Es besteht noch oft eine ungenügende Verzahnung kooperativer Diagnostik. Es fehlt häufig an verlaufsbegleitenden Überprüfungen der Diagnostik nach dem Einsetzen therapeutischer Maßnahmen. 2. Bei einem nicht unerheblichen Teil der Betroffenen dauern die Symptome bis ins Erwachsenenalter an. ADHS stellt somit auch bei Erwachsenen eine behandlungsbedürftige psychische Störung dar. Es fehlen hier verbindliche diagnostische Kriterien und angemessene Versorgungsstrukturen. Die Behandlung mit Methylphenidat erfolgt derzeit im Erwachsenenalter „off label“, da dieses Medikament für die Behandlung von Erwachsenen bei dieser Indikation nicht zugelassen ist. 3. In der Öffentlichkeit besteht noch weitgehende Unkenntnis und Fehlinformation über das Krankheitsbild. Schulen, Tageseinrichtungen und andere Erziehungsinstitutionen sowie an der öffentlichen Gesundheitsfürsorge beteiligte Verwaltungen (Jugendamt, Gesundheitsamt, Sozialamt, Strafvollzug und Polizei) sollten verstärkt über ADHS informiert werden. Die Konsensuskonferenz erhebt die Forderung nach einem Awareness-Programm als gemeinsame Aktion. 4. Für eine korrekte Diagnosestellung der ADHS ist eine umfassende Diagnostik und Differenzialdiagnostik anhand anerkannter Klassifikationsschemata (ICD 10 oder DSM IV) erforderlich. Grundlage der Diagnosestellung sind Exploration und klinische Untersuchung mit Verhaltensbeobachtung. Die störungsspezifische Anamnese soll Familie und weiteres Umfeld (z. B. Schule) einbeziehen und zusätzlich erschwerende sowie entlastende Umgebungsfaktoren berücksichti- gen. Fremdbeurteilungen durch Lehrer und Erzieher sollen einbezogen werden. Die Benutzung von Fragebögen als diagnostische Hilfen ist sinnvoll. Intelligenzdiagnostik und Untersuchung von Teilleistungsschwächen sollen das diagnostische Mosaik ergänzen. Die differenzialdiagnostische Abklärung zu anderen Erkrankungen mit ähnlichen (Teil-) Symptomen und die Erfassung von Begleiterkrankungen bilden einen notwendigen Baustein zur Diagnosesicherung. Eine solche mehrdimensionale Diagnostik bildet die Grundlage der multimodalen Behandlung. Die Diagnostik der ADHS ebenso wie die Therapie, auch die psychotherapeutische Behandlung, orientieren sich an den evidenzbasierten Leitlinien der beteiligten Fachverbände. Derzeit scheitert die multimodale Diagnostik noch in einigen Regionen Deutschlands an der Versorgungsrealität. Um die Versorgungsstruktur zu verbessern, ist Unterstützung der Politik erforderlich. 5. Eine qualitätsgesicherte Versorgung von ADHS ist unter Einbeziehung aller beteiligten Berufsgruppen notwendig. Die Therapie der ADHS ist als multimodales Behandlungsangebot definiert. Nur ein Teil der Kinder bedarf der medikamentösen Therapie. Nach ausführlicher Diagnostik und erst wenn psychoedukative und psychosoziale Maßnahmen nach angemessener Zeit keine ausreichende Wirkung entfaltet haben, besteht die Indikation zu einer medikamentösen Therapie. Stimulanzien wie Methylphenidat stellen empirisch gesicherte Medikamente zur Behandlung der ADHS dar, wobei der langfristige Einfluss dieser Medikation auf die Entwicklung des Kindes verstärkt erforscht werden muss. Auch andere Medikamente haben ihre Wirksamkeit bewiesen. Im Vorschulalter soll erst nach Ausschöpfung aller Maßnahmen eine medikamentöse Behandlung im Einzelfall in Erwägung gezogen werden. Für die Behandlung sind spezielle Kenntnisse der biologischen, psychischen und sozialen Entwicklung des Kindes Voraussetzung. 6. Die spezielle Indikationsstellung zur medikamentösen Behandlung mit Stimulanzien ist im Einzelfall ebenso wie die Entscheidung über ❮51❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 52 Zeitpunkt, Dauer und Dosis sorgfältig und entsprechend dem aktuellen wissenschaftlichen Standard zu treffen. Auf altersspezifische Besonderheiten im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter ist zu achten. Jede medikamentöse Behandlung mit Stimulanzien ist in ein umfassendes Therapiekonzept im Sinne einer multimodalen Behandlung einzubinden. Jede medikamentöse Behandlung bedarf als Mindeststandard einer intensiven ärztlichen Begleitung und ausführlichen Beratung. Die alleinige Verabreichung von Stimulanzien ist keine ausreichende Behandlungsmethode. Der Ausbau von Versorgungsstrukturen für begleitende psychosoziale und andere therapeutische Maßnahmen soll von der Politik intensiv unterstützt werden. 7. Die bedarfsgerechte Versorgung erfordert eine enge Zusammenarbeit der Ärzte untereinander (Kinder- und Jugendärzte, Kinder- und Jugendpsychiater, Psychiater, Allgemeinmediziner) und mit Psychologen, Psychotherapeuten, Pädagogen, Heilmittelerbringern (z. B. Ergotherapeuten) und Selbsthilfeverbänden. Die enge Zusammenarbeit mit weiteren an der gesundheitlichen Versorgung beteiligten Berufsgruppen ist notwendig. Erziehungsberatungsstellen sollen unter einer pädagogischen Zielsetzung im Rahmen kooperativer Netzwerke tätig werden. Auch Kindergärten, Tagesstätten und Schulen sowie weitere psychosoziale Bereiche sollen unter Einschluss der Jugendhilfe in das Behandlungsnetzwerk als Kompetenzpartner einbezogen werden, um einer schädlichen Desintegration der Kinder vorzubeugen. 8. Je nach Fachgruppe und therapeutischer Ausbildung besteht eine unterschiedliche Qualifikation zur Behandlung von ADHS. Die Verbesserung der Qualifikation muss daher differenziell erfolgen. Angestrebt wird ein modulares Fortbildungskonzept mit unterschiedlicher Gewichtung der Inhalte. Grundlage dieses Konzeptes soll empirisches Tatsachenwissen über Entstehung, Verlauf und Therapie von ADHS sein. ❮52❯ Die Grundlage für interdisziplinäre Zusammenarbeit bildet ein allen Berufsgruppen zugängliches Basiswissen, dessen Vermittlung eine gezielte Fortbildung der unterschiedlichen Beteiligten erfordert. Eine fachübergreifende gemeinsame Fortbildung im Sinne einer wechselseitigen Erkenntniserweiterung ist anzustreben und ermöglicht eine qualifizierte Kooperation. 9. Interdisziplinäre Zusammenarbeit beruht auf der Fachkompetenz und dem wechselseitigen Respekt der beteiligten Berufsgruppen. Die Verantwortung für die Koordination der interdisziplinären Behandlung liegt in der Hand des zuständigen Arztes. Ziel ist ein abgestimmtes multimodales störungsspezifisches Vorgehen zur Behandlung der Kernsymptomatik und der Begleitstörungen auf Evidenzbasis. 10. Aus berufspolitischer Sicht der beteiligten Verbände besteht Klärungsbedarf im Hinblick auf Leistungsanreize und eine leistungsgerechte Honorierung bzw. Finanzierung der Versorgungstätigkeit. Unter Einbezug von Leistungsträgern und Leistungserbringern müssen solidarische Finanzierungsmodelle im Rahmen der Leistungen der SGB V, VIII und IX gewährleistet sein. Die Politik soll ihren Einfluss im Rahmen der Zuständigkeiten geltend machen. 11. Regionale und überregionale Netzwerke sollen gebildet und die vorhandenen Netzwerke ausgebaut werden. Von der Politik wird eine Hilfestellung bei der Bestandsaufnahme bestehender regionaler Netzwerke gewünscht. Diese regionalen Netzwerke sollen die Umsetzung der Leitlinien in die Praxis unterstützen. Die Politik soll die Bildung qualifizierter interdisziplinär orientierter Arbeitsgruppen zum Thema ADHS unter Einbezug von Betroffenenvertretern begleiten und unterstützen. 12. Zum Thema ADHS besteht weiterhin erheblicher Forschungsbedarf. Dies betrifft sowohl den langfristigen Einfluss medikamentöser Therapien, besonders des Methylphenidats auf die Entwicklung des Kindes, als auch empirische Untersuchungen zur Wirkungsweise weiterer strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 53 Behandlungsmaßnahmen bei ADHS. Auch die Intensivierung der Forschung zur Evaluation der Struktur-, Verlaufs- und Ergebnisqualität in Bezug auf diese unterschiedlichen Therapieverfahren und die bedarfsgerechte Versorgung ist notwendig und erwünscht. Parlamentarische Staatssekretärin und Drogenbeauftragte der Bundesregierung Frau Caspers-Merk Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie Prof. Dr. Resch Für die Gesellschaften der Kinderheilkunde und Jugendmedizin Dr. Skrodzki ❮53❯ strattera_schulproj_inh ❮54❯ 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 54 strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 55 Kopiervorlagen • Fragebogen zur Verhaltensbeobachtung • Zielplan „10-Stunden-Projekt“ • Stundenprotokoll „10-Stunden-Projekt“ • Zufriedenheitsthermometer „10-Stunden-Projekt“ • Gradmesser Zielerreichung „10-Stunden-Projekt“ ❮55❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 56 Fragebogen zur Verhaltensbeobachtung A. RAHMENBEDINGUNGEN Name des Kindes: Alter des Kindes: Jahre Klasse: Unterrichtsfächer: Wochenstunden: Klassengröße: Ich unterrichte das Kind seit: Meine Beziehung zum Kind bewerte ich wie folgt: Sitznachbar des Kindes (falls zutreffend): Sitzt eher ❏ vorn ❏ mittig ❏ hinten Gute/Eher gute Kontakte hat das Kind derzeit zu folgenden Mitschülern: Schlechte/Eher schlechte Kontakte hat das Kind derzeit zu folgenden Mitschülern: Der letzte Elternkontakt (telefonisch, persönlich) fand vor Wochen/Tagen statt. Anlass: Besteht eine formale ADHS-Diagnose? Falls ja, ist mir diese bekannt seit ❮I❯ ❏ ja ❏ nein strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 57 Fragebogen zur Verhaltensbeobachtung Gibt es bereits laufende Behandlungen, von denen ich weiß? ❏ Medikamente ❏ Elternberatung ❏ Ergotherapie ❏ Nachhilfe ❏ Verhaltenstherapie ❏ andere: Behandelnder Arzt/Therapeut (falls bekannt): Telefonnummer (falls bekannt): Bestand bereits Kontakt zum Arzt/Therapeuten? Wenn ja, wann zuletzt? Wie sehen die Schulleistungen des Kindes derzeit aus? Deutsch ❏ gut ❏ befriedigend ❏ ausreichend ❏ schlechter Mathematik ❏ gut ❏ befriedigend ❏ ausreichend ❏ schlechter Sachkunde ❏ gut ❏ befriedigend ❏ ausreichend ❏ schlechter In welchen Fächern/Bei welchen Kollegen bestehen die größten Verhaltens- bzw. Konzentrationsschwierigkeiten? In welchen Fächern klappt es besser/am besten? Gibt es einen „typischen Verlauf“ der Auffälligkeiten ❏ über die Woche (z. B. schlechter am Wochenanfang)? ❏ am Schulvormittag (z. B. auffälliger in den ersten Stunden)? ❮II❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 58 Fragebogen zur Verhaltensbeobachtung B. VERHALTENSBEOBACHTUNGEN Block 1 Worin bestehen leistungsbehindernde Verhaltensweisen im Unterricht? nie/nein durchschnittlich immer/ja durchschnittlich immer/ja fängt nicht mit der Arbeit an kann sich nur kurzfristig auf eine Aufgabe konzentrieren träumt oft vor sich hin vergisst häufig Arbeitsanweisungen beteiligt sich kaum am Unterricht hat Schwierigkeiten mit schnellem schriftlichem Arbeiten krakeliges Schriftbild drückt beim Schreiben/Malen sehr fest auf kann die Arbeitsmaterialien nicht organisieren Materialien sind oft unvollständig hat Schwierigkeiten, sauber zu arbeiten scheint oft nicht zu wissen, was zu tun ist Hausaufgaben oft nicht oder unvollständig gemacht schafft oft nur einen Teil des Pensums scheint Stoff zu beherrschen, versagt dann oft in Klassenarbeiten schnelles Arbeiten geht genauem Arbeiten vor ist bei Gruppenarbeiten oft in der Außenseiterrolle sonstige: Block 2 Was sind positive Verhaltensweisen und Eigenschaften des Kindes? nie/nein ist anderen gegenüber hilfsbereit hat freundliches Wesen/interessiert an seiner Umwelt /neugierig ist spontan ❮III❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 59 Fragebogen zur Verhaltensbeobachtung nie/nein durchschnittlich immer/ja durchschnittlich immer/ja hat viele, oft kreative Ideen kann sich für vieles begeistern besitzt ausgeprägtes Mitgefühl bringt andere zum Lachen hat ausgeprägten Gerechtigkeitssinn ist anderen gegenüber nicht nachtragend setzt sich für andere ein kann den Unterricht oft bereichern begeistert sich für Sport sonstige: Block 3 Worin bestehen den Unterricht störende Verhaltensweisen? nie/nein ruft und redet häufig dazwischen kommentiert Beiträge anderer unangemessen verlässt seinen Sitzplatz verbreitet Unruhe am Sitzplatz/Tisch fällt vom Stuhl lenkt Sitznachbarn ab möchte häufig der Erste sein versucht, bei Gruppenaktivitäten zu dominieren gerät im Unterricht in Auseinandersetzungen mit anderen lenkt andere Kinder mit unterrichtsfremden Aktivitäten ab sonstige: Block 4 Worin bestehen mich persönlich störende Verhaltensweisen (über das bereits gesagte hinaus)? nie/nein durchschnittlich immer/ja widersetzt sich oft meinen Anweisungen beeinflusst andere Kinder/das Klassenklima negativ ist mir gegenüber oft frech und anmaßend bindet meine Aufmerksamkeit zu oft und zu lange kostet mich viel Zeit im Unterricht erfordert viele Kontakte zu Eltern/anderen Lehrern sonstige: ❮IV❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 60 Fragebogen zur Verhaltensbeobachtung C. MEIN EIGENES PÄDAGOGISCHES HANDELN Was ich bereits versucht habe, um das problematische Verhalten des Kindes zu beeinflussen (Elternkontakt, Einzelplatz, Sanktionen etc.): (Listen Sie möglichst konkret ein Problemverhalten und die durchgeführte Maßnahme auf und bewerten Sie den Erfolg ihrer Reaktion mit Noten von 1 bis 6) Problemverhalten Pädagogische Maßnahme z. B. Hausaufgaben vergessen z. B. nacharbeiten lassen ❮V❯ Erfolg strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 61 Zielplan „10-Stunden-Projekt“ Unsere gemeinsamen Ziele für morgen/die nächsten 3 Stunden/die nächsten 10 Stunden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Unsere gemeinsamen Ziele für die Zeit bis zu den Ferien/zum Halbjahreszeugnis/zum Zeugnis: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ❮VI❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 62 Stundenprotokoll „10-Stunden-Projekt“ Stunde Nr. Eingesetzte Techniken: 1. Erfolg: 1 2 3 4 5 6 (analog Schulnoten) 1 2 3 4 5 6 (analog Schulnoten) 1 2 3 4 5 6 (analog Schulnoten) 1 2 3 4 5 6 (analog Schulnoten) 1 2 3 4 5 6 (analog Schulnoten) 1 2 3 4 5 6 (analog Schulnoten) 2. Erfolg: 3. Erfolg: 4. Erfolg: 5. Erfolg: 6. Erfolg: Bemerkungen ❮VII❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 63 Zufriedenheitsthermometer „10-Stunden-Projekt“ Ich fand mein Verhalten heute super ganz o.k. schlecht ❮VIII❯ strattera_schulproj_inh 13.07.2006 13:56 Uhr Seite 64 Gradmesser „10-Stunden-Projekt“ Haben wir die vereinbarten Ziele erreicht? Ziel 1 Ziel 2 ja ja ja fast fast fast ein wenig ein wenig ein wenig nein nein nein Ziel 4 ❮IX❯ Ziel 3 Ziel 5 Ziel 6 ja ja ja fast fast fast ein wenig ein wenig ein wenig nein nein nein strattera_schulproj_umschl_copy 03.12.2007 10:00 Uhr Seite 5 03.12.2007 Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2–4 61352 Bad Homburg www.lilly-pharma.de www.info-adhs.de 10:00 Uhr Seite 2 Schutzgebühr EUR 4,90 ISBN 3-935966-19-9 PM 470477 strattera_schulproj_umschl_copy Leitfaden ads | adhs I N F O R M AT I O N S B R O S C H Ü R E DES HAMBURGER ARBEITSKREISES Stand: Dezember 2004, 2. überarbeitete Auflage Leitfaden ads | adhs Informationsbroschüre des Hamburger Arbeitskreises Inhaltsverzeichnis Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Der Hamburger Arbeitskreis ADS | ADHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Max, ein ganz normales ADHS-Kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Definition von ADS | ADHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Was ist eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ADS und ADHS – zwei Formen einer Störung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. Aufmerksamkeitsdefizit ohne Hyperaktivität (ADS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Aufmerksamkeitsdefizit mit Hyperaktivität (ADHS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Mögliche Folgen der Leitsymptome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Was passiert im Gehirn eines ADS | ADHS-Kindes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Wie äußert sich ADS | ADHS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Welche Begleiterkrankungen können auftreten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wie viele ADS | ADHS-Betroffene gibt es? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Was weiß man über die Ursachen von ADS | ADHS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Was weiß man heute über die Entstehung der ADS | ADHS-typischen Symptome? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1. Biologische Faktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2. Psychosoziale Faktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Wer hilft bei der Diagnose von ADS | ADHS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Was können Eltern, Lehrer und Erzieher zur Diagnosestellung beitragen? . . . . . . . . . 24 Wo liegt die Schaltzentrale der Diagnose und Therapie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Welcher Facharzt sollte hinzugezogen werden?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Basisdiagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Psychodiagnostik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Untersuchungen, die in jedem Fall durchgeführt werden müssen . . . . . . . . . . . . . 25 Untersuchungen, die nur in bestimmten Fällen durchgeführt werden müssen . . . 26 Untersuchungen vor Beginn einer medikamentösen Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Wie lange dauert die Diagnostik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Leitfaden des Hamburger Arbeitskreises zur Diagnostik der ADS | ADHS . . . . . . . 27 Das multimodale Therapiekonzept. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1. Obligate Therapiemaßnahmen Information, Aufklärung und Anleitung von Eltern, Kind und Umfeld . . . . . . . . . . 31 2. Fakultative Therapiemaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 a) Pharmakotherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2 b) Psychotherapien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2 c) „Übende Verfahren“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2 d) Sozialpsychiatrische Therapie | Sonderpädagogische Maßnahmen . . . . . . . . . 35 Was ist von alternativen Therapieansätzen zu halten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Leitfaden des Hamburger Arbeitskreises zur ärztlich-psychotherapeutischen Therapie von ADS | ADHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kostenübernahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Fallbeispiele zu Diagnose und Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 1. Beispiel Lars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2. Beispiel Felix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Kontaktadressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ADS | ADHS im Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Glossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Vorwort GEMEINSAM HANDELN Liebe Eltern, Lehrer und Ärzte, kaum ein anderes psychisches Krankheitsbild und seine Behandlung haben in der jüngsten Zeit so viele Diskussionen hervorgerufen wie die Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit und ohne Hyperaktivität (ADS | ADHS). An ADS | ADHS scheiden sich in der Öffentlichkeit die Geister: Die einen sehen darin nichts weiter als eine „Modediagnose“ und führen das Verhalten der Kinder pauschal auf Erziehungsfehler der Eltern zurück, andere hingegen sprechen von einem behandlungsbedürftigen Krankheitsbild. Die Leidtragenden dieser oft mit wenig Sachkenntnis, aber dafür sehr emotional geführten Auseinandersetzungen sind die betroffenen Kinder und ihre Familien. Viele Eltern sind verunsichert: Sie wissen nicht mehr, welchen Informationen sie noch Glauben schenken sollen, wem sie vertrauen und an wen sie sich wenden können. Denn trotz der zunehmenden Aufklärungsarbeit zum Thema ADS | ADHS, z. B. durch Tagungen und Symposien der Elternselbsthilfegruppen und der verschiedenen ärztlichen Berufsverbände, gibt es auch unter vielen Ärzten noch immer großen Fortbildungsbedarf. Die Diagnose und Behandlung von ADS | ADHS sind zudem sehr zeitaufwändig und erfordern eine enge Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schule und den einzelnen Facharztgruppen – eine Kooperation, die bislang nur sehr selten gelingt. Die Folgen sind oft jahrelange Arztodysseen und Schulwechsel, aber auch Fehldiagnosen und Therapie-Irrwege. SEITE 4 Aus dieser Situation heraus hat sich im Frühjahr 2001 der Hamburger Arbeitskreis ADS | ADHS (HAK) gegründet. Er ist ein bislang einmaliger fachübergreifender Zusammenschluss von Vertretern des regionalen Berufsverbandes der Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, des regionalen Berufsverbandes der Kinderund Jugendärzte, von Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie zweier Elternselbsthilfegruppen. Ziel des Arbeitskreises ist es, die Diskussion um das Thema ADS | ADHS wieder zu versachlichen und die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Facharztgruppen zu verstärken. Zudem soll der Kenntnisstand über ADS|ADHS sowohl bei den Ärzten als auch bei den Eltern, Lehrern und Erziehern verbessert werden, damit betroffene Kinder frühzeitig erkannt und behandelt werden können. In dem vorliegenden Leitfaden ADS | ADHS hat der Hamburger Arbeitskreis seine gemeinsam erarbeiteten Empfehlungen zu Diagnose und Therapie für eine breite Öffentlichkeit zusammengefasst. Der Leitfaden richtet sich vor allem an die betroffenen Eltern, aber auch an interessierte Ärzte und Lehrer. Er soll Orientierungshilfe und Wegweiser durch den Diagnose- und Therapiedschungel sein. Wir freuen uns, damit Eltern, Lehrern und Ärzten zum ersten Mal einen interdisziplinär erarbeiteten Leitfaden zum Thema ADS|ADHS an die Hand geben zu können und hoffen damit eine größere Sicherheit im Umgang mit dem Krankheitsbild zu vermitteln. In dem Leitfaden finden sich neben allgemeinen Informationen zum Krankheitsbild ausführliche Empfehlungen des Hamburger Arbeitskreises zur Diagnose und Therapie von ADS | ADHS. Der Arbeitskreis setzt sich darin klar für eine qualifizierte Diagnostik sowie das multimodale Therapiekonzept ein. Kennzeichen des multimodalen Therapiekonzeptes ist die jeweils individuelle Kombination aus verschiedenen Therapieformen, d. h. psychotherapeutische Maßnahmen, Elternberatung und gegebenenfalls medikamentöse Behandlung. Dabei erfordert das multimodale Therapiekonzept die enge Kooperation zwischen allen beteiligten Parteien (Kind, Eltern, Lehrern, Therapeuten und Fachärzten). Der Hamburger Arbeitskreis unterstreicht durch den interdisziplinären Leitfaden die Bedeutung der Zusammenarbeit aller Fachgruppen, die sich mit dem Krankheitsbild befassen. Es ist zu wünschen, dass diese Zusammenarbeit in der Diagnostik und Therapie auch in der Praxis ausgebaut wird – zum Wohle der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Der Hamburger Arbeitskreis ADS | ADHS SEITE 5 Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Der Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie Hamburger und -psychotherapie Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Arbeitskreis ADS | ADHS Jugendpsychosomatik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf Dr. Tobias Wiencke Niedergelassener Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Vorsitzender des Berufsverbandes der Ärzte für Kinderund Jugendpsychiatrie und –psychotherapie (BKJPP), Landesverband Hamburg Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten Anne Schroeder Dipl.-Psychologin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin am Werner Otto Institut / Sozialpädiatrisches Zentrum der ev. Stiftung Alsterdorf SEITE 6 Fachärzte für Vertreter Kinder- und Jugendmedizin Elternverbände Dr. med. Christian Fricke Werner Henschel Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Andreas Weigel Ärztlicher Leiter des Werner Otto Instituts Leiter der Elternselbsthilfegruppe Sozialpädiatrisches Zentrum der ev. Michel, Mitglied im Bundesverband Stiftung Alsterdorf Aufmerksamkeitsstörung / Hyperaktivität e.V. (BV AH), Regionalverband Hamburg Dr. med. Kirsten Stollhoff Niedergelassene Fachärztin für Rita Schmidt Kinder- und Jugendmedizin mit Vorsitzende der Hamburger Eltern- Schwerpunkt Neuropädiatrie initiative zur Förderung der Kinder und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen Dr. med. Michael Zinke Niedergelassener Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Vorsitzender und Pressesprecher (MCD / HKS /ADS / POS) e.V., Mitglied in der IG ADHD (bundesweiter Zusammenschluss der Elternselbsthilfegruppen) des Berufsverbandes der Kinderund Jugendärzte, Landesverband Hamburg SEITE 7 Einleitung AUS DER SICHT DER ELTERN Max, ein ganz normales ADHS-Kind Unser Max ist heute 13 Jahre alt. Seit seinem 2. Lebensjahr ist er verhaltensauffällig. Er war ständig in Bewegung, turnte über die Möbel und sprang von Schränken. Er hatte keine Angst davor, sich wehzutun, und seine Schmerzgrenze lag sehr hoch. Daher war er sehr unfallgefährdet und wir waren zeitweilig häufig in den Unfallaufnahmen der Krankenhäuser. Ein ganz normaler Alltag mit unserem Max beginnt morgens um 6 Uhr mit dem Wecken. Da er abends vor 22 Uhr nie zur Ruhe kommt, kann er morgens nicht gut wach werden. Oft wird schon das Wecken zum Kampf und dauert seine Zeit. Anschließend geht es ins Bad: Jeder Handgriff der Morgentoilette muss einzeln angesagt und eingefordert werden. Das Fratzenziehen vor dem Spiegel beim Zähneputzen ist interessanter als das Zähneputzen selbst! Nun kommt das Anziehen. Steht nicht einer von uns dabei, so kann es vorkommen, dass Max im Winter mit kurzen Hosen und T-Shirt am Frühstückstisch erscheint. Es ist jetzt schon wieder so viel Zeit vergangen, dass das Frühstück im Eiltempo und nur mit ständigem Antreiben unsererseits erfolgen kann. Bereits im Kindergarten, besonders aber in der Schule fällt Max dadurch auf, dass er sich unkonzentriert und fahrig, übermütig und körperlich sehr energisch verhält sowie ein sensibles Gerechtigkeitsempfinden zeigt. Die LehrerInnen klagen darüber, dass unser Sohn sehr leicht ablenkbar ist, den Unterricht stört, sich verweigert und Arbeitsunterlagen zerstört. Bei Themen jedoch, die ihn sehr interessieren, arbeitet er konzentriert und begeistert mit. Auch für die LehrerInnen ist es ein immer währendes Ermahnen und Sichbemühen, um Max durch den Schultag zu helfen. SEITE 8 Die Intensität dieser Verhaltensweisen Das Drama setzt sich zu Hause fort: Wo nimmt mit zunehmendem Alter nicht ab, sind die Arbeitsunterlagen und was habt ihr sondern zu und mündet in einen regen auf? Es werden also Mitschüler telefonisch Wechsel von Institutionen, weil er überall befragt und so können wir uns ein Bild aneckt und weil ihm und uns als Eltern machen. Das Erledigen der Hausaufgaben schließlich seine Untragbarkeit signalisiert ist für Max sehr anstrengend. Meist wird. Am Ende des 2. Schuljahres muss er benötigen wir zwei Stunden – harte Arbeit zur Sonderschule für verhaltensgestörte für Mutter und Kind mit Tränen, Gähnen, Kinder wechseln. Geschrei und Umherwerfen von Bleistift und Radiergummi, Beschwichtigungen Nach langem Suchen finden wir einen fach- und unendlicher Geduld der Mutter. kundigen Arzt, der bei Max die Diagnose ADHS gestellt hat. 7 Monate lang kämpfen Nach der Diagnosestellung wird Max fach- wir, dass Max von der Sonderschule kundig behandelt. Ihm wird dadurch der zurück auf eine Grundschule wechseln erneute Verweis auf die Sonderschule kann. erspart. Auch wir werden fachkundig unterstützt, unser Leben mit ihm konflikt- und Mit den üblichen Erziehungsmethoden erleidet man bei Max Schiffbruch. Er ist nämlich keineswegs im üblichen Sinne „ungehorsam“. Aufgrund seiner ADHS kann er sein Verhalten nur schwer, manchmal auch gar nicht steuern. Er kann nicht über längere Zeit aufmerksam sein und er leidet selbst unter seiner ausgeprägten motorischen Unruhe, die ihm in der Schule immer wieder ärgerliche Zurechtweisungen ein- stressfreier zu gestalten. Diese Behandlung bewirkt jedoch nicht, dass aus Max von heute auf morgen ein völlig neues Kind wird, aber er kann seine Möglichkeiten jetzt viel besser nutzen und hat in der Schule Erfolgserlebnisse. Es ist ein anstrengendes Leben mit unserem Max, aber wir lieben ihn – eigenwillig, schusselig, kreativ, explosiv, unordentlich, vergesslich und pfiffig, wie er ist! bringt. Doch obwohl er oft den Unterricht stört, ist er in der Klasse sehr beliebt. Er ist Max ist nicht ungehorsam oder unwillig, hilfsbereit, großzügig und reagiert sensibel nicht schlecht erzogen und schon gar kein und mitfühlend, wenn ein anderes Kind „hoffnungsloser Fall“. Max leidet an der Pech Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts- gehabt hat oder wegen einer schlechten Note traurig ist. Störung, kurz ADHS genannt. Seine Noten liegen trotz ADHS im mittleren Bereich. Die Lehrer behaupten, Max könne mehr erreichen, wenn er nur wolle. Wir Eltern aber wissen, dass Max tut, was er kann. Max kann seine Aufmerksamkeit nicht willentlich steuern. SEITE 9 Definition von Was ist eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung? Von einer Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS) spricht man, wenn ein Kind länger als sechs Monate sowohl im Kindergarten, in der Schule (Gruppensituationen) als auch zu Hause ADS | ADHS durch ausgeprägt unaufmerksames und impulsives Verhalten aufgefallen ist. Kommen motorische Unruhe und übermäßiger Bewegungsdrang (Hyperaktivität) hinzu, dann spricht man von einer ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-HyperaktivitätsStörung). Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität sind die Leitsymptome der Erkrankung. Typisch ist, dass die Verhaltensweisen weder dem Alter noch dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechen und sich nicht von allein wieder bessern. Das auffallende Verhalten tritt also nicht phasenweise auf, sondern ist zeitlich stabil. Erhebliche Teilleistungsstörungen wie eine Lese-Rechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche können außerdem zu Problemen im sozialen Umfeld und zu zusätzlichem Leistungsabfall in der Schule führen. SEITE 10 ADS | ADHS: Zwei Formen einer Störung ADS 1. Aufmerksamkeitsdefizit ohne Hyperaktivität (ADS) Die ADS zeichnet sich durch Unaufmerksamkeit, Impulsivität sowie eher durch eine Aktivitätsverminderung (Hypoaktivität) aus. Man geht davon aus, dass Mädchen von dieser Form häufiger betroffen sind als Jungen. Kinder mit ADS haben eine mangelnde, nicht altersgemäße Konzentrationsspanne. Sie bringen kein Spiel zu Ende, sind fahrig und zerstreut, lassen oft Sachen liegen, kleinste Anweisungen werden vergessen. Sie haben ein langsames Arbeitstempo und wirken verträumt. Kinder mit ADS werden oft nicht als solche erkannt. Obwohl das überschießende Verhalten vollkommen fehlt, werden auch Kinder mit ADS oft isoliert, denn auch sie neigen zu Wutanfällen und heftigen Stimmungsschwankungen, sind in der Schule aufgrund der Konzentrationsstörung leistungsschwach und gelten deshalb als dumm und /oder faul. SEITE 11 ADHS 2. Aufmerksamkeitsdefizit mit Hyperaktivität (ADHS) Viele Eltern beschreiben eine ausgeprägte und sehr lang anhaltende Trotzphase mit häufigen und imposanten Wutanfällen. Das Spielverhalten ist plan- und rastlos, die Ausdauer im Einzel- und Gruppenspiel gering und der Umgang mit Spielzeug sinnwidrig und destruktiv. Kinder mit ADHS sind im Vergleich zu anderen Kindern häufiger von motorischen Teilleistungsstörungen betroffen. Das Sozialverhalten der Kinder mit ADHS kann sich im Laufe der Zeit ebenfalls gestört entwickeln. Bei einem Teil der Kinder ist das Verhalten nicht vorhersehbar und kann sich in aggressivem Verhalten äußern. Dies kann schließlich dazu führen, dass das Kind zunehmend isoliert wird, keine beständigen Freundschaften hat und nicht zu Kindergeburtstagen eingeladen wird. In der Schule kommt es infolge der gesteigerten Anforderungen bald zu erheblichen Schwierigkeiten. Das Kind stört anhaltend den Unterricht, zeigt wenig Ausdauer und ist sehr schnell abgelenkt. Es gibt Eltern, die sich nahezu täglich mit den Lehrern auseinander setzen müssen, weil ihr Kind dazwischenredet, Geräusche produziert, zappelt, den Banknachbarn nicht in Ruhe lässt, Klassenkameraden verletzt ... Die Beschwerden nehmen kein Ende. Auf Ermahnungen reagiert das Kind häufig mit Wutanfällen. Oder es spielt den Klassenclown, um Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erhalten. Auch das zieht eine Kette von Ermahnungen und Bestrafungen nach sich. Die Grundstimmung des Kindes ist unglücklich, sein Selbstbewusstsein schwindet. SEITE 12 Mögliche Folgen der Leitsymptome Bei schwer betroffenen ADS | ADHS-Kindern kommt es oft schon früh zu ausgeprägtem Trotzverhalten, das gemeinsam mit den vielen Misserfolgen und der Isolation unter Gleichaltrigen im Kindergarten oder in der Schule Probleme bereitet. Kinder und Jugendliche mit ADS | ADHS haben ein mehrfach gesteigertes Risiko für Unfälle. Immer wieder berichten Eltern von Kindern mit ADS | ADHS über Beinaheunfälle. Unbehandelte ADS | ADHS-Kinder beginnen oft schon in sehr jungem Alter, Zigaretten zu rauchen oder Alkohol zu trinken. Die Gefahr, süchtig zu werden, ist bei ihnen höher als bei Kindern und Jugendlichen ohne ADS | ADHS. SEITE 13 Was passiert im Gehirn eines ADS | ADHS-Kindes? Sowohl bei einer ADS mit Hyperaktivität als auch bei einer ADS ohne Hyperaktivität stehen die Störung der Aufmerksamkeitsausrichtung und mangelnde Impulshemmung („erst handeln, dann denken“) sowie eine „Reizüberflutung“ im Vordergrund. Man kann sich das Gehirn eines Kindes mit ADS | ADHS als „Dschungelhirn“ vorstellen, während Kinder ohne diese Störung eine Art „Informationsautobahn“ im Kopf haben. Bei Kindern mit ADS | ADHS müssen sich Informationen durch viele geschlängelte Pfade kämpfen und gehen dabei teilweise verloren, bevor der Rest über viele Umwege schließlich im „Verarbeitungszentrum” ankommt. Deswegen vergessen Kinder mit ADS | ADHS aufgenommene Informationen schnell und lernen schlecht aus Erfahrungen. SEITE 14 Wie äußert sich ADS | ADHS? Durch die „Reizüberflutung“ sind die Kinder – im wahrsten Sinne des Wortes – ständig „überreizt“ und immer an der Grenze ihrer Kraft. Aus diesem Dauerstress resultiert eine sehr geringe Frustrationstoleranz mit starken Stimmungsschwankungen und heftigen Gefühlsabstürzen. Viele Kinder mit ADS | ADHS scheinen nicht zu hören, wenn sie angesprochen werden, und Dinge nicht zu finden, auch wenn sie direkt vor ihnen liegen. Kinder mit ADS | ADHS haben in der Regel Schwierigkeiten in der kontrollierten Abfolge von – im Grunde ganz alltäglichen – Handlungsabläufen, d. h. es fällt ihnen schwer, Handlungen in der durch Eltern oder Lehrer vorgegebenen Reihenfolge auszuführen. Das Schreiben fällt den Kindern oft sehr schwer. Die Schrift ist schlecht bis unleserlich, das Heft unsauber geführt. Eine Lese-Rechtschreibschwäche oder Rechenschwäche kommt häufig hinzu und kompliziert die Situation weiter. Die Hausaufgaben werden zu einem täglichen Kampf zwischen Eltern und Kind. Die Störung der Aufmerksamkeit und der Informationsverarbeitung führt zu einer Beeinträchtigung von Gedächtnis und Lernen, zu mangelhafter Strukturierung der Aufgaben und schließlich zu Schulversagen. Lern- und Leistungsprobleme sind immer wieder Anlass für Schulwechsel und Klassenwiederholungen. Unbehandelte Jugendliche mit ADS | ADHS tendieren aufgrund einer möglichen (durch eine ADS | ADHS begünstigten) Störung des Sozialverhaltens zu sozialen Randgruppen. Eltern machen sich in dieser Zeit oft große Sorgen, ihr Kind könne in eine kriminelle Laufbahn oder Suchtkarriere abgleiten. Diese Gefahr ist tatsächlich gegeben, wenn die rechtzeitige Behandlung und stützende Faktoren fehlen. SEITE 15 Begleiterkrankungen Welche Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) können auftreten? Wie erwähnt, entwickeln Kinder mit ADS | ADHS infolge der häufigen Misserfolge im sozialen und schulischen Bereich und durch die Konflikte mit Gleichaltrigen wie auch zu Hause oft weitere, so genannte sekundäre Störungen. So besitzen sie eine erhöhte Anfälligkeit für bestimmte zusätzliche psychische Erkrankungen, die grundsätzlich jedoch auch als eigenständiges Krankheitsbild auftreten können. Auch die Entwicklung von Teilfunktionsstörungen wie einer Lese-Rechtschreibschwäche oder Rechenschwäche tritt häufig auf. Psychische Erkrankungen • Aggressive Störungen treten bei Kindern mit ADS | ADHS häufig auf, weil diese ihr Verhalten nur schwer oder gar nicht steuern können. Ihre Gefühle fahren regelrecht Achterbahn. Die Kinder sind jedoch nicht mit Absicht aggressiv. Es ist ihnen in dem Moment der Wut nicht möglich, auf die „innere Bremse“ zu treten. • Bei entsprechender Ausprägung dieser Symptomatik spricht man von einer Störung des Sozialverhaltens, die gehäuft kombiniert mit ADS | ADHS vorkommt. SEITE 16 • Depressionen gehören zu den häufigsten sekundären Störungen bei ADS | ADHS. Sie beruhen auf dem sich ständig verschlechternden Selbstwertgefühl, das mit dem wiederholten Scheitern trotz aller Mühe einhergeht. • Von einer Angststörung spricht man, wenn das Ausmaß und die Dauer der Ängste nicht mehr im Verhältnis zur angeschuldigten Ursache stehen. • Häufig sind auch Tic-Störungen. Etwa 50 % der Kinder mit einfachen Tic-Störungen leiden gleichzeitig an einer ADS | ADHS. Unter einem Tic versteht man das unwillkürliche Zucken von Muskeln, meistens im Gesicht. Der häufigste Tic ist der Blinzel -Tic (Tics sind nicht zu verwechseln mit Ticks, worunter man gemeinhin besondere Verhaltensweisen oder Vorlieben versteht). Grundsätzlich müssen psychische Störungen, die zusätzlich zur ADS | ADHS vorliegen, gesondert kinder- und jugendpsychiatrisch und -psychotherapeutisch diagnostiziert und behandelt werden. SEITE 17 BEGLEITERKRANKUNGEN Teilfunktionsstörungen • Eine Lese-Rechtschreibschwäche und eine Rechenschwäche kommen bei ADS | ADHS überdurchschnittlich häufig hinzu, ebenso zentralmotorische Koordinationsstörungen. Darunter versteht man die gestörte Umsetzung von Befehlen aus dem Gehirn durch die Muskeln. Die Kinder haben z. B. eine schlechte Körperkoordination, können nicht gut Bälle fangen u. a. m. (Syndrom des ungeschickten Kindes). SEITE 18 Wieviele ADS | ADHS-Betroffene gibt es? In der Literatur schwanken die Angaben zur Häufigkeit (Prävalenz) von ADS | ADHS bei Kindern von 5 bis 18 Jahren zwischen 2 % bis 18 %. Eine Ursache für diese Schwankungen sind die unterschiedlichen Diagnosekriterien der internationalen Leitlinien ICD-10 und DSM-IV (siehe Glossar). Ein weiterer Grund ist die unterschiedliche Betrachtungsweise. Manche Autoren beschränken sich bei ihren Angaben auf Kinder, deren ADS | ADHS einer medikamentösen Behandlung bedarf, während andere auch die Kinder aufnehmen, bei denen eine Strukturierung des Umfeldes, ein Elterntraining und ein Verhaltenstraining zur Besserung der Störung ausreichen. Wieder andere Untersuchungen beschränken sich auf das Elternurteil. Aufgrund repräsentativer nationaler Studien geht der Hamburger Arbeitskreis ADS | ADHS von einer Häufigkeit von 2,5 % bis 6 % in Deutschland für die Altersgruppe von 5 bis 18 Jahren aus. SEITE 19 Entstehung & Ursachen Was weiß man über die Ursachen von ADS | ADHS? Die entscheidenden Erkenntnisse zu den Ursachen einer ADS | ADHS wurden erst im Verlauf der letzten 15 Jahre gewonnen. Der Verdacht auf eine genetische Disposition (Vererbung der Krankheit) konnte inzwischen durch groß angelegte Zwillings- und Adoptionsstudien weitgehend gesichert werden. Man geht heute davon aus, dass ADS | ADHS-Kinder mit einer unterschiedlichen Anfälligkeit (Vulnerabilität) zur Welt kommen. Diese Anfälligkeit trägt entscheidend dazu bei, ob sich beim Kind eine ADS | ADHS ausbildet. Doch nicht nur die Vererbung allein spielt eine Rolle – auch Umgebungsfaktoren sind mit von Bedeutung. Denn je nachdem, ob das Kind in einer strukturierten und liebevollen Umgebung aufwächst oder nicht, können die Symptome mehr oder weniger stark ausfallen. Ist allerdings diese Anfälligkeit (Vulnerabilität) sehr stark ausgeprägt, so entwickelt sich in jedem Fall eine ADS | ADHS. SEITE 20 Was weiß man heute über die Entstehung der ADS | ADHS-typischen Symptome? Bis heute diskutiert man zwei Komponenten in der Entstehung der ADS | ADHS: biologische und psychosoziale Faktoren. Nach wie vor gibt es eine Unsicherheit über Ausmaß und Bedeutung der psychosozialen Faktoren in der Entstehung eines ADS | ADHS. 1. Biologische Faktoren Der Aufmerksamkeitsstörung und Impulsivität liegt bisherigen Studien zufolge sehr wahrscheinlich eine „Kommunikationsstörung“ zwischen Stirnhirn und Basalganglien zugrunde. Die Basalganglien sind jene Bereiche des Zwischenhirns, in denen die unbewussten Bewegungen gesteuert werden. Die Nervenbahnen zwischen diesen beiden Hirnbereichen nutzen den Botenstoff Dopamin zur Weiterleitung von Informationen oder „Befehlen“. Botenstoffe, auch Neurotransmitter genannt, sind erforderlich, weil die einzelnen Nervenzellen nicht direkt miteinander verbunden sind. Zwischen ihnen liegt ein kleiner Spalt, der so genannte synaptische Spalt, der von den Botenstoffen überbrückt wird. Wie kleine Schiffe transportieren die Botenstoffe Informationen von einer Zelle zur nächsten. Bei Menschen mit ADS | ADHS ist die Aktivität der Nervenzellen im Bereich BasalganglienStirnhirn deutlich herabgesetzt. Insbesondere im Stirnhirn, das für die Handlungsplanung zuständig ist, findet sich deutlich weniger Aktivität als bei Menschen ohne ADS | ADHS. Die Unteraktivität beruht wahrscheinlich auf einem Ungleichgewicht bestimmter Botenstoffe. Zu den wichtigsten Botenstoffen gehören im Zusammenhang mit dem ADS | ADHS das Dopamin und das daraus gebildete Noradrenalin. So kann die Übermittlungsfunktion des Gehirns auch beeinträchtigt sein, wenn das Noradrenalin zu schnell wieder in die Zelle aufgenommen wird. Daneben sind noch andere Hirnbotenstoffe in einem sich gegenseitig beeinflussenden Gleichgewicht beteiligt. SEITE 21 ENTSTEHUNG & URSACHEN Bei Menschen mit ADS | ADHS liegen zu viele Transportereiweiße im synaptischen Spalt vor, die wie kleine Staubsauger funktionieren. Kaum ist das Dopamin bzw. Noradrenalin aus der Zelle freigesetzt, wird es von den vielen Transportereiweißen schon wieder zurückgeholt. Die Botenstoffe haben also „keine Zeit“, ausreichend Informationen zur nächsten Zelle fortzuleiten. Durch moderne Darstellungsverfahren konnte die erhöhte Dichte an Transportereiweißen bei Menschen mit ADS | ADHS kürzlich belegt werden. Eine wichtige Funktion des Dopamins und Noradrenalins ist es, einströmende Reize weiterzuleiten. Durch die zu schnelle Wiederaufnahme des Dopamins bzw. Noradrenalins in die Nervenzellen leiden Kinder mit ADS | ADHS an einer „Reizüberflutung“. Bildlich gesprochen, filtert bei Kindern ohne ADS | ADHS ein feines, intaktes Haarsieb die einströmenden Umgebungsreize, während bei Kindern mit ADS | ADHS ein sehr grobes Sieb vorliegt, das außerdem an mehreren Stellen eingerissen ist. Dadurch sind die Kinder sehr leicht ablenkbar. Andererseits ergeben sich durch die beschriebenen Neurotransmitterstörungen Ansätze für eine medikamentöse Behandlung (siehe weiter unten). 2. Psychosoziale Faktoren Die wichtigsten psychosozialen Faktoren, die mit der Entstehung von ADS | ADHS in Verbindung gebracht werden, sind ungünstige Familienverhältnisse bzw. Umgebungsbedingungen (so genannte deprivierende Verhältnisse). Darunter versteht man unklare, unzuverlässige und/oder schnell wechselnde Beziehungsbedingungen, ungeordnete Tagesabläufe sowie Vernachlässigung bis hin zur Misshandlung. Alle Umgebungsbedingungen, die unüberschaubar, unstrukturiert, chaotisch und /oder unzuverlässig sind, können bei entsprechend anfälligen (vulnerablen) Kindern auslösend bzw. verstärkend bezüglich ADS | ADHS wirken. Dies kann ebenso für belastende Lebensereignisse gelten, denen die Kinder ausgesetzt sind wie z. B. Scheidung, psychische Erkrankung eines Elternteils oder andere, plötzlich auftretende Belastungen. SEITE 22 Diagnostik Wer hilft bei der Diagnose von ADS | ADHS? Der Hamburger Arbeitskreis ADS | ADHS betont, dass bei der Diagnostik des Störungsbildes verschiedene Fachgruppen übergreifend zusammenarbeiten müssen. Die Diagnose ADS/ADHS setzt sich wie ein Mosaik aus vielen verschiedenen Steinen zusammen, die genau zueinander passen müssen. Um dieses Mosaik perfekt zu machen, ist es erforderlich, dass Eltern, Lehrer, Erzieher, Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin mit besonderer Ausbildung, Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zum Wohle ihrer Patienten ein Bündnis schließen. Dies ist der Grundgedanke des Hamburger Arbeitskreises ADS | ADHS. Die Diagnostik setzt sich aus der Beobachtung durch Eltern, Erzieher und Lehrer sowie der ärztlichen Basisdiagnostik und der Differentialdiagnostik Arbeitskreis warnt zusammen. nachdrücklich vor Der Hamburger jeder Art von „Blickdiagnose“ bei dem Verdacht auf ein ADS | ADHS. SEITE 23 Was können Eltern, Lehrer und Erzieher zur Diagnosestellung beitragen? Wenn Eltern und Erzieher Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern registrieren und sie dann gezielt auf weitere für ADS | ADHStypische Besonderheiten beobachten, wird viel Zeit bis zur Diagnose eingespart. Eltern, Lehrer und Erzieher können erheblich zu der Verdachtsdiagnose ADS | ADHS beitragen, wenn sie mit den charakteristischen Auffälligkeiten des Störungsbildes vertraut sind. Wo liegt die Schaltzentrale der Diagnose und Therapie? Die Schaltzentrale liegt bei dem Arzt, der das Kind langfristig betreut. Das kann der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder der speziell weitergebildete Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin sein. Welcher Facharzt sollte hinzugezogen werden ? Der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie ist in der Regel aufgrund seiner Ausbildung ohne weitere Qualifikation zu der Behandlung von Kindern mit ADS | ADHS unter Einbeziehung der Familie und anderen mitbeteiligten und betroffenen Institutionen in der Lage. Sozialpädiatrische Zentren bieten durch enge kinderärztlich-psychotherapeutische Teamarbeit eine entsprechende Kompetenz. Bei Ärzten für Kinder- und Jugendmedizin ist dies gegeben, wenn sie sich zusätzlich qualifiziert haben. Liegt allerdings eine zusätzliche psychische Störung vor oder besteht der Verdacht darauf, dann ist in jedem Fall ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie hinzuzuziehen. SEITE 24 Die ärztliche Basisdiagnostik Zur Basisdiagnostik gehören die grundlegenden medizinischen Untersuchungen und psychologische Testungen. An erster Stelle steht eine gründliche Erhebung der Vorgeschichte nicht nur des Kindes (störungsspezifische Anamnese), sondern der ganzen Familie (Familienanamnese). Durch den Einsatz von Fragebogen für Eltern, Lehrer und Erzieher wird gezielt nach ADS | ADHS-typischen Auffälligkeiten im Verhalten des Kindes in unterschiedlichen Situationen gesucht. Wichtig ist es, den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes sowie die Umgebungsfaktoren (Familie, Freunde, Schule etc.) zu berücksichtigen. Das Kind wird zu Beginn gründlich untersucht, um körperliche Krankheiten ausschließen zu können und mögliche Entwicklungsrückstände sowie den Pflege- und Allgemeinzustand des Kindes zu erfassen. Die gründliche neurologisch-motoskopische Untersuchung schließt neurologische Erkrankungen aus und ermittelt, ob in den Bewegungsmustern der Kinder Auffälligkeiten bestehen. Zum Ausschluss eines Anfallsleidens oder anderer organischer Hirnerkrankungen wird ein EEG abgeleitet. Durch Laboranalysen können weitere körperliche Erkrankungen ausgeschlossen werden. Psychodiagnostik 1. Psychologische Untersuchungen, die in jedem Falle durchgeführt werden sollten (obligat) Zunächst wird die Intelligenz des Kindes mit einem standardisierten Test ermittelt. Außerdem werden mit verschiedenen Tests die Konzentrationsfähigkeit, die Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeitsspanne und die Merkfähigkeit untersucht. Besondere Aufmerksamkeit gilt den so genannten Teilfunktionen, über deren Testung sich z. B. Hinweise für eine mögliche Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwäche ergeben. SEITE 25 DIAGNOSTIK 2. Psychologische Untersuchungen, die nur in bestimmten Fällen durchgeführt werden sollten (fakultativ) Um die Diagnostik zu vervollständigen, können in bestimmten Fällen, z. B. durch Fragebogen, komorbide Störungen (vgl. „Welche Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) können auftreten?“, S.16) erfasst werden. Durch spezifische Untersuchungsmethoden (z. B. projektive Testung) kann die emotionale Situation des Kindes ermittelt werden. Eine videogestützte Diagnostik kann zur bisher durchgeführten Diagnostik einen weiteren Beitrag leisten. In wenigen Fällen sind weiterführende diagnostische Maßnahmen notwendig. Untersuchungen vor Beginn einer medikamentösen Therapie Untersuchungen, die in jedem Falle durchgeführt werden sollten (obligat) Wenn eine medikamentöse Behandlung durchgeführt werden muss, sollten zu Beginn sowohl das Kind / der Jugendliche als auch seine Eltern hinsichtlich seiner / ihrer Bereitschaft und Fähigkeit zur Mitarbeit (Compliance) befragt werden. Bestehen keine Zweifel an einer ausreichenden Compliance, so sind ein EKG, die in dem Leitfaden aufgeführten Laboruntersuchungen sowie Körpergröße und -gewicht zu ermitteln. Bei Jugendlichen ist ein Drogenmissbrauch auszuschließen (obligat). Wie lange dauert die Diagnostik? Der Hamburger Arbeitskreis geht im Allgemeinen von zirka 5 Stunden aus. Liegen jedoch weitere Störungen vor, kann die Diagnostik bis zu 10 Stunden in Anspruch nehmen. Bei der Überlagerung verschiedener Störungen gestaltet sich das diagnostische Mosaik sehr viel schwieriger als bei einer ausschließlichen ADS | ADHS und erfordert den Einsatz aller Fachleute. SEITE 26 Leitfaden des Hamburger Arbeitskreises zur Diagnostik der ADS | ADHS 1. Ärztliche Basisdiagnostik • Allgemeine und störungsspezifische Anamnese und Familienanamnese unter besonderer Berücksichtigung von Psychodynamik • Fragebogen Eltern /Kind / Kindergarten / Schule • Einbeziehung von Entwicklungsaspekten und Milieubedingungen • Psychiatrischer Befund • Körperliche und neurologisch-motoskopische Untersuchung • EEG • Labor: Blutbild, Differentialblutbild, Leberwerte, Schilddrüsenwerte, Creatinin 2. Psychodiagnostik • obligat a) Standardisierte IQ-Testung (z. B. K-ABC, HAWIK-III) b) Überprüfung der Teilfunktionen (z. B. Gedächtnis, Wahrnehmung) c) Testung und Überprüfung der Aufmerksamkeit • fakultativ a) Erfassung komorbider Störungen (z. B. durch Fragebogen) b) Erfassung von emotionalen Bedingungen (z. B. projektive Testung) c) Videogestützte Diagnostik 3. Fakultative weiterführende Diagnostik • Phoniatrische Differentialdiagnostik • Pädaudiologische Differentialdiagnostik • Pädophtalmologische Differentialdiagnostik • Genetische Differentialdiagnostik • Bildgebende/elektophysiologische Verfahren 4. Untersuchungen zu Beginn einer medikamentösen Therapie • obligat a. Überprüfung der Bereitschaft und Fähigkeit der Familie zur Mitarbeit (Compliance) b. EKG c. Labor (s.o.) d. Körpergröße und Gewicht e. Bei Jugendlichen ist ein Drogenmissbrauch auszuschließen Der Zeitaufwand für Basisdiagnostik und Psychodiagnostik beträgt in der Regel 5 Stunden. Diagnose von ADS | ADHS S Das multimodale Therapiekonzept Auf die Diagnose folgt die Frage, welche Therapie nun die geeignetste ist. Darüber bestehen auch unter Ärzten teilweise Meinungsverschiedenheiten. Häufig werden zur Behandlung von ADS | ADHS Psychostimulanzien wie Methylphenidat eingesetzt. Ob eine medikamentöse Therapie sinnvoll ist oder nicht, hängt jedoch stark vom Einzelfall ab. Grundlegend sind in jedem Fall die umfassende Information und Aufklärung der Eltern. Oft reichen bereits Verhaltensänderungen im Umgang mit dem Kind – wie z. B. Einführung von übersichtlichen Strukturen im Alltag – aus, um Erfolge zu erzielen. Der Hamburger Arbeitskreis ADS | ADHS setzt sich deshalb für das multimodale Therapiekonzept ein. Kennzeichen des multimodalen Therapiekonzeptes ist die jeweils individuelle Kombination aus verschiedenen Therapieformen: Eltern-Kind-Beratung, psychotherapeuthische Maßnahmen (Verhaltenstherapie) und gegebenenfalls medikamentöse Maßnahmen. Der Hamburger Arbeitskreis ADS | ADHS unterscheidet dabei – analog zur Diagnosestellung – wieder zwischen obligaten Therapiemaßnahmen (in jedem Fall notwendig, immer durchzuführen) und fakultativen Therapiemaßnahmen (nur in bestimmten Fällen erforderlich). So gehört die medikamentöse Therapie nach Ansicht des Hamburger Arbeitskreises ADS | ADHS in die Kategorie der fakultativen Behandlungsformen. Drittes wesentliches Merkmal des multimodalen Therapieansatzes ist die enge Zusammenarbeit der verschiedenen in das Behandlungskonzept involvierten Fachbereiche und -gruppen (Fachärzte, Psychologen, Eltern, Lehrer und Erzieher). SEITE 30 1. Obligate Therapiemaßnahmen Information, Aufklärung und Anleitung von Eltern, Kind und Umfeld Unerlässlich (obligat) sind eine ausführliche Aufklärung und Beratung der Eltern und des betroffenen Kindes. Wenn die Eltern über die Besonderheiten ihres Kindes informiert sind, können sie durch eine Strukturierung des Umfeldes und die Bereitstellung einfacher Hilfen sehr zur Besserung der Situation beitragen. Auch die Aufklärung der Lehrer ist von großer Bedeutung. In der Eltern-Kind-Behandlung sowie einem speziellen Elterntraining lernen die Eltern den Umgang mit ihrem eigenwilligen Kind, erhalten Ratschläge und können Reaktionen auf bestimmte Verhaltensweisen einüben. Sie lernen, wie sie den Tag und die Hausaufgaben mit ihrem Kind erfolgreicher bewältigen und wie Konflikte minimiert werden können. Eine störungsspezifische Therapie setzt sich aus unterschiedlichen verhaltenstherapeutischen und tiefenpsychologisch orientierten Elementen zusammen. Da sich die spezifische Behandlung nach dem individuellen Befund richtet, wird der behandelnde Arzt /Psychotherapeut für jedes Kind einen gesonderten Therapieplan erarbeiten. Jede störungsspezifische Therapie des Kindes und seiner Familie sollte das soziale Umfeld so weit wie möglich und nötig einbeziehen. Bei der Information und Aufklärung spielen auch die Selbsthilfegruppen eine zentrale Rolle. Hier können sich Eltern informieren, praktische Ratschläge und Tipps holen sowie einfach einmal die Sorgen von der Seele reden. Die Gruppen halten meist regelmäßige Treffen ab, denen man sich zwanglos anschließen kann. Eine Auflistung der Selbsthilfegruppen finden Sie am Ende dieses Leitfadens. 2. Fakultative Therapiemaßnahmen Zusätzlich zu den Elterntrainings und verhaltenstherapeutischen Maßnahmen können eine medikamentöse Therapie (Pharmakotherapie) sowie weitere psychotherapeutische Maßnahmen erforderlich werden (die Reihenfolge in der nachfolgenden Übersicht zur Therapie der ADS | ADHS gibt keine Gewichtung wieder!). SEITE 31 2 a) Pharmakotherapie Wenn sich die ADS | ADHS-Symptome durch Veränderungen im Umfeld oder durch andere begleitende Maßnahmen wie z. B. Elterntrainings und Verhaltenstherapie nicht hinreichend vermindern lassen, kann eine medikamentöse Therapie angezeigt sein. Nicht alle Kinder mit einer ADS | ADHS brauchen eine medikamentöse Behandlung. Viele kommen zurecht, wenn bestimmte Veränderungen im sozialen Umfeld vorgenommen oder bestimmte Behandlungsformen eingeleitet werden. Auch hier muss in jedem Einzelfall entschieden werden, welche Behandlungsform die geeignete ist. Sind die Symptome jedoch sehr stark ausgeprägt, so dass es zu einem Scheitern in der Schule oder zu erheblichen Problemen in der Familie kommt, kann es sein, dass die medikamentöse Behandlung eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, um die anderen Behandlungsformen erfolgreich einsetzen zu können. Am häufigsten werden zur Behandlung des ADS | ADHS die so genannten Psychostimulanzien (das bekannteste ist das Methylphenidat) eingesetzt. Die genaue Wirkungsweise dieser Psychostimulanzien ist bis heute nicht bekannt. Man geht jedoch davon aus, dass es im präsynaptischen Spalt zu einer Blockade der Transportereiweiße für den Botenstoff Dopamin kommt und damit der zu schnelle Rücktransport in die Nervenzellen verhindert wird. Gerade in der letzten Zeit wurde in den Medien der Einsatz von Psychostimulanzien in Frage gestellt. Den Eltern warf man dabei oft unverantwortlichen Umgang mit der Gesundheit ihrer Kinder vor, da Methylphenidat zur Gruppe der Psychostimulanzien, also der Amphetamine, gehört. Psychostimulanzien wie Methylphenidat unterliegen tatsächlich dem Betäubungsmittelgesetz, haben jedoch bei Kindern mit ADS | ADHS keine berauschende Wirkung und machen auch nicht süchtig. Bei Menschen ohne ADHS wirkt es anregend, aufputschend und schlafmindernd. Wenn hingegen ein Kind mit ADS | ADHS Methylphenidat einnimmt, kann es sich besser konzentrieren und sein Verhalten besser steuern. Wenn man kleinere Kinder fragt, ob sich seit der Therapie etwas geändert habe, dann sagen sie meist: „Mama schimpft nicht mehr so viel mit mir.“ Sie registrieren also nicht die Wirkung des Medikaments, sondern die Wirkung ihres veränderten Verhaltens auf das soziale Umfeld. Durch Studien ist belegt, dass die Gabe von Methylphenidat bei ADS | ADHS in der Kindheit und / oder in der Jugend dieser Kinder dazu führt, dass sie seltener zu Drogen greifen als unbehandelte Kinder. SEITE 32 DAS MULTIMODALE THERAPIEKONZEPT Die Wirkung von Methylphenidat tritt etwa 30 bis 45 Minuten nach Einnahme der Tabletten ein; sie hält dann etwa 2 bis 4 Stunden an. Danach schwächt sie sich ab. Bei manchen Kindern kann es deshalb notwendig sein, noch in der Schule eine zweite Tablette einzunehmen. Bei einigen Kindern genügen sehr niedrige Dosierungen, andere benötigen mehrere Tabletten. In jedem Falle muss die jeweils individuelle Dosierung in enger Absprache und Kooperation mit dem behandelnden Arzt erfolgen. Eine enge Absprache mit der Schule und den Lehrern ist zudem wünschenswert. Allerdings ist der Einsatz von Methylphenidat auch mit Nebenwirkungen verbunden, die mehr oder weniger stark ausgeprägt sein können. Dazu zählen Einschlafstörungen und Appetitlosigkeit. Manchmal treten auch Weinerlichkeit und Zuckungen im Gesicht (Tics) auf. In der Regel sind diese Nebenwirkungen aber nicht sehr stark und lassen sich durch eine Verminderung der Dosierung abschwächen. Statt Methylphenidat wird auch oft Amphetaminsaft gegeben. Auch das Amphetamin gehört zu den Stimulanzien. Warum es bei manchen Kindern mit ADS | ADHS besser wirkt als Methylphenidat, ist ungeklärt. Mehrere Studien haben aber gezeigt, dass Kinder, bei denen sich unter dem einen Stimulans die Symptomatik nicht bessert, nach Umstellung auf das andere positiv reagieren können. Fenetyllin gehört ebenfalls zu den Stimulanzien, wird aber nur verordnet, wenn mit Methylphenidat oder Amphetamin keine Besserung zu erzielen ist. Es wirkt stärker und braucht deswegen meist nur einmal täglich eingenommen zu werden. Wegen der stärkeren Wirkung wird es aber nur bei kräftigeren Kindern und nicht vor der Pubertät eingesetzt. Seit Ende 2002 ist in den USA ein innovatives Medikament der Fa. Lilly zur Behandlung der ADHS zugelassen, das in erster Linie in den Noradrenalin-Haushalt im Gehirn eingreift und kein Stimulanz ist. In Deutschland ist es seit März 2005 erhältlich. Dieses Medikament hemmt hochselektiv die Noradrenalinwiederaufnahme und unterliegt nicht dem Betäubungsmittelgesetz. In einigen Studien, die notwendige Grundlage der Zulassung durch die amerikanischen Behörden waren, zeigte sich eine Wirksamkeit, die mit der Wirkung von Methylphenidat als vergleichbar bezeichnet werden könnte. Eine Stärke der Substanz dürfte die kontinuierliche, über den gesamten Tag andauernde Wirkung sein. Auch bezüglich der Verträglichkeit und der Häufigkeit von Nebenwirkungen scheint der Wirkstoff mit Methylphenidat vergleichbar zu sein, bei einem möglicherweise günstigeren Verträglichkeitsprofil in dem Bereich Schlaf. SEITE 33 DAS MULTIMODALE THERAPIEKONZEPT 2 b) Psychotherapien Als weitere fakultative Maßnahmen können verschiedene Arten der Psychotherapie sinnvoll sein, die sich entweder allein auf das Kind (kindzentrierte Verfahren) oder auch auf das Umfeld (Familie, Kindergarten, Schule) beziehen. Dazu zählen: • Einzelpsychotherapie • Gruppentherapie • Familientherapie Im Zentrum einzelpsychotherapeutischer Maßnahmen steht die Verhaltenstherapie mit begleitender Elternberatung. Es kann aber auch sein, dass eine tiefenpsychologisch orientierte oder psychoanalytische Einzelpsychotherapie indiziert ist. Gruppentherapeutische Verfahren kommen besonders dann infrage, wenn soziale Defizite des betroffenen Kindes im Vordergrund stehen. Das familientherapeutische Verfahren beeinflusst den Umgang der Familienmitglieder mit dem betroffenen Kind. In spezifischen Eltern-Kind-Programmen geht es einerseits um die Verbesserung der Verhaltenskontrolle des Kindes, andererseits lernen die Eltern Techniken und Verhaltensweisen, wie sie ihr Kind darin stärken und Strategien, wie sie ihren Umgang mit dem Kind positiv beeinflussen können. SEITE 34 2 d) Sozialpsychiatrische Therapie / 2 c) „Übende Verfahren“ Sonderpädagogische Maßnahmen • Soziales Kompetenztraining • Aufmerksamkeitstraining Die kindergarten- und schulzentrierten Bei den kindzentrierten Interventionen steht das soziale Kompetenztraining im Mittelpunkt, das sich verschiedener Techniken bedient. Hierbei lernen die Kinder, wie sie soziale Situationen richtig einschätzen und sich entsprechend ange- Interventionen haben eine Verminderung der Verhaltensauffälligkeiten in den jeweiligen Einrichtungen zum Ziel und sind erforderlich, wenn bei dem Kind ausgeprägte hyperkinetische und /oder oppositionelle Auffälligkeiten vorliegen. Für LehrerInnen / ErzieherInnen werden messen verhalten können. Möglichkeiten erarbeitet, die eine Integraüben tion des Kindes in die Schule verbessern die Kinder, z. B. mit computergestützten helfen. Ein Austausch zwischen Eltern Aufgaben ihre Ausdauer zu steigern oder und Schule bzw. Kindergarten ist von auch anhand sich ständig steigernder grundlegender Bedeutung, um Erfolg Schwierigkeitsgrade den Aufgaben über oder Misserfolg der Therapie beurteilen einen längeren Zeitraum mit Aufmerksam- zu können. Beim Aufmerksamkeitstraining keit zu folgen. SEITE 35 DAS MULTIMODALE THERAPIEKONZEPT Was ist von alternativen Therapieansätzen zu halten? Häufig werden auch so genannte alternative Therapien angeboten. Der Arbeitskreis rät vom Einsatz dieser vermeintlichen Alternativen bei ADS | ADHS ab, weil ihre Wirkung nicht erwiesen ist. Zu den unwirksamen Maßnahmen gehören die Prismenbrille, die Kinesiologie, die kraniosakrale Therapie, die Atlastherapie, die Reflextherapie, die Klangtherapie, die Hörtherapie und die Festhaltetherapie. Auch die Homöopathie, Bachblüten, Algen, die kombinierte Calcium- und Vitamin-DGabe sowie die phosphatfreie, die salicylatfreie und die zuckerreduzierte Diät nehmen keinen Einfluss auf die Symptomatik einer ADS | ADHS. SEITE 36 Leitfaden des Hamburger Arbeitskreises zur ärztlich-psychotherapeutischen Therapie von ADS | ADHS 1. Obligat • Information, Aufklärung und Anleitung von Kind, Eltern und Umfeld • Eltern-Kind-Behandlung (störungsspezifische Behandlung von Familie und Kind unter Einbeziehung des sozialen Kontextes mit speziellem Elterntraining) • Einleitung und Koordination begleitender Maßnahmen 2. Fakultativ • Psychopharmakotherapie (bei erheblicher psychosozialer Gefährdung kann diese Behandlung auch schon zu Beginn der Therapie eingesetzt werden) • Soziales Kompetenztraining • Aufmerksamkeitstraining • Einzelpsychotherapie • Gruppentherapie • Familientherapie 3. Behandlung komorbider Störungen • Störung des Sozialverhaltens • Umschriebene Entwicklungsstörungen • Depression • Angst Wissenschaftlich nicht fundierte und z. T. schädliche Verfahren für Diagnostik und Behandlung • Alleinige Videodiagnostik • Festhaltetherapie nach Prekop • Ernährungszusätze und Diäten, z. B. – Calciumtherapie – Fettsäurentherapie – Algentherapie – Bachblütentherapie • Knochen- und Gelenkbehandlungen, z. B. – Cranio-Sacraltherapie – Osteotherapie – Atlastherapie • • Klang- und Hörtherapien Pseudoneurophysiologische Therapien, z. B. – Reflextherapie – Prismenbrillen – Kinesiologie • Homöopathie Therapie von ADS | ADHS S Kosten Kostenübernahme Bei ADS | ADHS handelt es sich um eine seelische Krankheit auf der Basis einer neurobiologischen Störung. Die Kosten der ärztlichen Diagnostik und Behandlung werden von den Krankenkassen übernommen. Kosten für eine Behandlung durch einen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten werden dann übernommen, wenn dieser von den kassenärztlichen Vereinigungen zur testpsychologischen Diagnostik und Behandlung zugelassen ist. Es empfiehlt sich immer, alle Teile der Diagnostik und Behandlung nur von den genannten Berufsgruppen durchführen zu lassen. Wissenschaftlich nicht fundierte Therapieformen (s. o.) werden von den Kassen nicht bezahlt und sollten vermieden werden. SEITE 40 Fallbeispiele zu Diagnose & Therapie LARS Zwei Fallbeispiele zur Diagnose und Therapie von ADS | ADHS Im Folgenden stellt der Hamburger Arbeitskreis ADS/ADHS zwei Fallbeispiele zur Diagnose und Therapie von ADS | ADHS vor. Das erste stammt von Dr. Kirsten Stollhoff vom Kinderneurologischen Institut Prof. Dr. med. Lagenstein, das zweite wurde von Dr. Christian Fricke, dem ärztlichen Leiter des Werner Otto Instituts, zur Verfügung gestellt. Die Namen und persönlichen Angaben der Kinder wurden geändert. Die Fälle entsprechen jedoch der Realität und sollen Ihnen einen Einblick in unterschiedliche Diagnose- und Therapieformen geben. 1. Beispiel: Lars Lars wurde mir im Alter von 6 Jahren zum ersten Mal vorgestellt. Die Mutter hatte von einer Freundin über die Aufmerksamkeitsdefizitstörung gehört und fragte sich, ob die Verhaltensauffälligkeiten ihres Sohnes nicht auf ein ADHS zurückzuführen seien. Lars ist das erste Kind gesunder Eltern. Seine Schwester Rike wurde zwei Jahre nach ihm geboren. Die Mutter, die als kaufmännische Angestellte arbeitete, ist seit der Geburt ihres Sohnes nicht mehr berufstätig. Sie ist zufrieden mit ihrer jetzigen Aufgabe, ihre Kinder zu erziehen und den Haushalt zu führen. Der Vater, im Management tätig, ist zwar unter der Woche sehr beschäftigt, entlastet seine Frau aber an den Wochenenden nach Kräften. SEITE 41 LARS Im Vergleich zu der zweiten Schwangerschaft war die erste für die Mutter wesentlich anstrengender: Bereits früh habe Lars sich wie ein Wilder aufgeführt, berichtet die Mutter. Ab der 25. Schwangerschaftswoche musste sie wegen vorzeitiger Wehen medikamentös behandelt werden und viel liegen. Von Beginn an war das Leben mit Lars anders als es sich die Eltern vorgestellt hatten. Alle Stillversuche schlugen fehl, Lars habe nur gebissen. Baden war eine Katastrophe, er habe nur geschrieen. Wickeln gelang oft nur mit zwei Erwachsenen und wurden nach zwei Stürzen vom Wickeltisch nur noch auf dem Boden durchgeführt. Die motorische Entwicklung war beschleunigt, mit 7 Monaten krabbelte er und mit 10 Monaten lief er – und von da an nur noch weg. Die Sprachentwicklung verlief jedoch völlig normal. In der Spielgruppe bestand sein Kontakt zu anderen Kindern in „Schubsen“, konstruktive Spiele wurden schnell abgebrochen. Spielsachen wurden in der Regel als Wurfgeschosse benutzt. Im Vergleich zu den anderen Kindern war er der motorisch Aktivste. Gemeinsames Spielen mit anderen Kindern endete meist damit, dass die Mutter gebeten wurde, Lars zu „entfernen“. Die Verwandtschaft und auch die Freunde begannen sich zu distanzieren. Der hört ja nie – kommt doch vorbei, aber besser ohne Lars. Und immer deutlicher wurde den Eltern Erziehungsunfähigkeit unterstellt. Die darauf besuchte Erziehungsberatung empfahl ihnen, „strenger“ mit ihm zu sein. SEITE 42 Auf die Schwester reagierte er mit heftiger Eifersucht und Zerstörungswut. Die beiden konnten nie alleingelassen werden, da er sie immer wieder ohne ersichtlichen Grund trat oder ihr ein Spielzeug ins Gesicht schleuderte. Auf der anderen Seite zeigte er aber eine sensible Beobachtungsgabe für Dinge, Menschen und Situationen. Weinte Rike, dann tröstete er sie, wurde ihr von anderen Kindern etwas weggenommen, dann erkämpfte er es für sie zurück. Der Versuch, Entlastung durch eine Tagesmutter zu erhalten, scheiterte, da Lars, inzwischen 3 Jahre, eine Tagesmutter nach der andern „verschliss“. Deren Kommentare lauteten beispielsweise: Den tu ich mir doch nicht an, der hat ja eine kriminelle Energie. Eine zu diesem Zeitpunkt konsultierte Kinderpsychologin konnte jedoch keine Auffälligkeit entdecken: Lars habe 1 Stunde mit ihr ausdauernd Kugelbahn gespielt und dabei charmant und intelligent geplaudert. Sie haben wirklich einen prima Jungen, erklärte sie der Mutter. Mit 41/2 Jahren erhielt Lars einen Platz in einem Integrationskindergarten. Hier wurde seiner Mutter erstmals bestätigt, dass ihr Kind anders als die anderen sei, er habe „Wahrnehmungsstörungen“. Er wurde schnell zum Außenseiter, kein Kind wollte mit ihm spielen, zu Kindergeburtstagen wurde er nicht eingeladen. SEITE 43 LARS Eine Ergotherapie wurde begonnen, diese änderte jedoch weder seine Verhaltensauffälligkeit mit unberechenbaren, zum Teil aggressiven Handlungen, die ihn und andere in Gefahr brachten, noch besserten sich seine reduzierte Ablenkbarkeit oder seine motorische Unruhe. Unverändert habe er Phasen von einigen Tagen, berichtete die Mutter, an denen alle aufatmen, an denen er rücksichtsvoll, witzig und intelligent sei und sich eine halbe Stunde alleine beschäftigen könne. Darauf folgten dann aber wieder Phasen, in denen Lars mit zunehmender Kraft ausflippte. Untersuchungsbefund Schon während meines Gesprächs mit der Mutter schaffte es Lars, das Untersuchungszimmer zur Unkenntlichkeit umzugestalten. Als ich dann alleine mit ihm sprach, konnte er sich jedoch über einen Zeitraum von 45 Minuten mit einem Spiel beschäftigen, redete aber ununterbrochen. Er erzählte, dass er sich ärgere über seine Wutausbrüche, vor allem darüber, dass er am Tag zuvor seine Lokomotive zerstört habe, ohne zu wissen, warum. Seine Schwester fand er überflüssig und nervig, er war traurig darüber, keine Freunde zu haben. Die neuropsychologische Testung, die Beobachtung im spontanen und abgeleiteten Spiel zusammen mit den Informationen der Eltern und der Kindergärtner ergaben die Verdachtsdiagnose des ADHS mit sozialen Störungen. Mit Hilfe eines Elterntrainings gelang es den Eltern zu Hause Strukturen und Grenzen zu setzen, wenngleich es sehr anstrengend war und immer wieder gefährliche Situationen für die jüngere Schwester entstanden. Die Androhung des Kindergartens, ihn auszuschließen, führte dann zu der Entscheidung, eine medikamentöse Therapie zu beginnen. SEITE 44 Verlauf Unter einer Dosierung von Methylphenidat 3 x 1/2 Tablette ver- änderte sich sein Verhalten schlagartig. Die Eltern waren zuerst erschrocken über „seine Ruhe und Friedlichkeit“, konnten aber seit Jahren erstmalig wieder die Geschwister unbeobachtet allein lassen, das familiäre Leben entspannte sich sichtlich. Auch im Kindergarten wurde eine positive Veränderung beobachtet. Lars zeigte mehr Ausdauer im Gruppenspiel, sein unberechenbarer Zerstörungsdrang ließ nach und seine Wutanfälle traten nur noch selten auf. Lars wurde wenige Monate nach Therapiebeginn erstmals zu einem Kindergeburtstag eingeladen und hat jetzt mehr Freunde. Ein Problem stellen noch die morgendlichen und abendlichen Phasen dar, wenn die Wirkung des Medikamentes noch nicht oder nicht mehr besteht. Dann werden die Eltern wieder an frühere Zeiten erinnert mit Türenschlagen und Geschrei. Als Nebenwirkung wurde lediglich weniger Appetit tagsüber beobachtet. Da er abends seine Hauptmahlzeit einnimmt, hält sich der Gewichtsverlust jedoch in Grenzen. Die Ergotherapie – jetzt mit zwei anderen Kindern – wird noch weitergeführt, da er dort ein soziales Kompetenztraining erhält. Lars wird jetzt, inzwischen 7 Jahre alt, eingeschult werden – abzuwarten bleibt, ob für die Schulanforderungen seine Aufmerksamkeit ausreicht. Dr. Kirsten Stollhoff Kinderneurologisches Institut Prof. Lagenstein SEITE 45 FELIX 2. Beispiel: Felix Bei der Erstvorstellung ist Felix 9 Jahre alt, er wird vorgestellt wegen Zappeligkeit, motorischer Unruhe und Koordinationsschwäche. Felix ist das dritte Kind der Familie. Nach unkomplizierter Schwangerschaft muss die Geburt mit Kaiserschnitt beendet werden. In der Neugeborenenzeit zeigt Felix keine Auffälligkeiten. Er schläft als Säugling gut, ist aber immer sehr lebhaft. Im Vorschulalter zeigen sich motorische Koordinationsprobleme (so kann er z. B. erst mit 6 Jahren Rad fahren), therapeutische Maßnahmen werden nicht für erforderlich gehalten. Ansonsten fallen bei den Vorsorgeuntersuchungen keine Besonderheiten auf. In der Vorschulzeit gilt Felix ebenso wie seine ältere Schwester als sehr temperamentvolles Kind, was aber in der Familie und in der sehr turbulenten Kindergartengruppe nicht als störend empfunden wird. Zunehmende Unruhe zeigt Felix mit Beginn des Schulbesuchs. Er kippelt auf dem Stuhl, läuft in der Klasse herum und stört andere Kinder. Felix kann sich über eine kurze Zeitspanne auf den Unterricht konzentrieren und zeigt dann durchaus eine gute Auffassungsgabe. Schreiben ist schwierig, erlernte Buchstaben werden wieder vergessen. Das Schriftbild ist so schlecht, dass die eigene Schrift oft kaum gelesen werden kann. Die Hausaufgaben, an denen Felix lange sitzt, werden zunehmend zur Qual. SEITE 46 Zu Hause wird die bekannte Lebhaftigkeit zunehmend als störende Unruhe erlebt, auch bei den Mahlzeiten fällt Felix das Stillsitzen extrem schwer. Er ist leicht ablenkbar, verbale Aufforderungen erreichen ihn oft nicht. Die gesamte Familie leidet zunehmend unter täglichen Auseinandersetzungen um Alltagsprobleme. Auch Felix wirkt unglücklich, zeigt oft Stimmungsschwankungen. Er hat nur wenige Freunde. Der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin überweist Felix in ein Sozialpädiatrisches Zentrum. Bei den Untersuchungen zeigen sich bei durchschnittlicher Intelligenz eine Rechtschreibschwäche (ansonsten keine Teilleistungsproblematik) und eine leichte motorische Dyskoordination. Daneben finden sich deutliche Zeichen einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung. SEITE 47 FELIX Wegen der Rechtschreibschwäche wird eine Lerntherapie für 11/2 Jahre eingeleitet. Felix lernt in diesem Rahmen recht gut Lesen und Schreiben, die Hausaufgabensituation entspannt sich. Die motorische Unruhe und die schwankende Aufmerksamkeit bestehen weiterhin und werden in Schulzeugnissen immer wieder bemerkt, Felix wird aber in die nächsthöhere Klasse versetzt. Die Eltern, die sich selbst mit der Thematik intensiv befasst hatten, werden ausführlich psychologisch beraten. Eine Behandlung mit Stimulanzien wird zwar angesprochen, von den Eltern und beteiligten Fachleuten aber als nicht erforderlich angesehen. Unter enger Führung der konsequenten Eltern kommt Felix im familiären Rahmen und in der Freizeit insgesamt zurecht. Er nimmt erfolgreich am Schwimmsport im Verein teil, nachdem er zuvor beim Fußball gescheitert war. Dr. Christian Fricke Werner Otto Institut SEITE 48 Kontaktadressen Elternselbsthilfegruppen des ADHS – Deutschland e.V. Selbsthilfe für Menschen mit ADHS Vertreten durch: Werner Henschel Bodestr. 28, 21031 Hamburg Telefon: 040 – 7 39 55 54, FAX: 040 – 7 65 09 28 Susanne Augstein, Telefon: 04158 – 89 03 35 Adressen Michel Stadtteilgruppen Gruppe HH-Barmbek Treffen: jeden dritten Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im KISS – Barmbek Fuhlsbütteler Straße 401/ Ecke Harzloh Kontakt: Andreas Weigel, Telefon: 040 – 6 52 76 89 Gruppe HH-Bergedorf Treffen: jeden ersten Dienstag im Monat um 20.00 Uhr im „Der Begleiter e.V.“, Soziales Zentrum, Ludwig-Rosenberg-Ring 47, 21031 Hamburg Kontakt: Helga Meyer, Telefon: 040 – 7 38 05 82 Gruppe HH – Harburg Treffen: jeden ersten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr im Kinder- und Jugendhilfezentrum in Harburg Eißendorfer Pferdeweg 40a Kontakt: Christiane Eich, Telefon: 04108 – 41 60 92 Gruppe Eidelstedt Treffen: jeden letzten Dienstag im Monat um 20.00 Uhr im Dörpsweg 1, 22527 Hamburg Kontakt: Gerhild Gehrmann, Telefon: 04121 – 80 72 72 SEITE 49 KONTAKTADRESSEN Elterninitiative Teilleistungsstörungen e.V. (ADS, POS, HKS) Mitglied der IG ADHD Leitung: Rita Schmidt und Petra Haupt Auf der Heide 26 a, 22393 Hamburg Telefon: 0 40 - 6 01 99 22, 0 40 - 61 16 38 95, Telefax: 040 - 6 01 99 22 E-Mail: elternini.adhs @ t-online.de Elterninitiative Stadtteilgruppen Sasel /Poppenbüttel /Rahlstedt Treffen: jeden ersten Dienstag im Monat Kontakt: Rita Schmidt, Telefon: 0 40 - 6 01 99 22 Bergedorf „Rappelzappel“ Treffen: jeden zweiten Donnerstag im Monat Kontakt: Rita Hinz, Telefon: 0 40 -7 24 42 54 Harburg Treffen: jeden dritten Mittwoch im Monat Kontakt: Ute Kuck, Telefon: 0 40 -77 11 08 98 Elbvororte einschließlich Altona Treffen: jeden vierten Mittwoch im Monat Sabine Thilo, Telefon: 0 40 - 89 23 13 SEITE 50 ADS e.V. Elterninitiative zur Förderung von Kindern mit Aufmerksamkeitsstörung mit / ohne Hyperaktivität Kontakt: Claudia Kloster Telefon: 0 41 91 - 773 91, E-Mail: info @ ads-norderstedt.de SEITE SEITE51 6 INFOS / TIPPS Internet Weiteres Informationsmaterial, praktische Tipps für Eltern und Lehrer im Umgang mit ADS | ADHS-Kindern sowie Buchempfehlungen erhalten Sie bei den angegebenen Selbsthilfegruppen sowie ständig aktualisiert unter folgenden Internetseiten: Bundesverband AH www.osn.de/user/hunter/badd.htm ADS e.V. www.ads-ev.de ADS Gesprächskreis Norderstedt www.ads-norderstedt.de AÜK e.V. www.auek.de Hier finden Sie teilweise auch Chatforen, in denen Sie sich direkt mit anderen betroffenen Eltern austauschen können. SEITE 52 Glossar ADHS Compliance Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität. Bereitschaft des Patienten, bei diagnostischen Leitsymptome sind eine verminderte Konzentra- und therapeutischen Maßnahmen mitzuwirken. tions- und Aufmerksamkeitsfähigkeit, gesteigerter Beispiel: Zuverlässigkeit bezüglich des Befolgens Bewegungsdrang sowie Impulsivität. ärztlicher Anweisungen. ADS Deprivierende Verhältnisse Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ohne Hyper- Familiäre Bedingungen, die verwahrlosend auf aktivität). Die Leitsymptome sind verminderte das Kind wirken. Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit, Impulsivität sowie ein normaler oder reduzierter Bewegungsdrang. Dopamin Botenstoff des Gehirns. Dopamin spielt eine wichtige Rolle bei der Reizweiterleitung in den Anamnese ➔ Synapsen. Erhebung der Patientenvorgeschichte durch den Arzt. Gespräch des Arztes mit dem Patienten; bei Kindern auch mit den Eltern. DSM IV Diagnostisches Statistisches Manual. Richtlinie zur Einteilung psychischer Störungen nach Basalganglien Empfehlungen der amerikanischen Gesellschaft Ansammlung von Nervenzellkörpern (Kernge- für Psychiatrie (APA). Für ADS | ADHS werden biete), die tief im Zwischenhirn liegen. Sie sind drei Unterklassifizierungen genannt: die Zentren für die unbewusste Bewegungs- • die überwiegend unaufmerksame Form, koordination, Körperhaltung, Gestik und Mimik. • die überwiegend hyperaktiv-impulsive Form, • die gemischte Form, bei der alle drei Bildgebende /elektrophysiologische Verhaltensauffälligkeiten (unaufmerksamer, Verfahren impulsiver und hyperaktiver Typ) vorliegen. Verfahren und Techniken zur Untersuchung von Gehirnfunktionen, z. B. Computertomographie oder Magnetresonanztomographie sowie z. B. Elektroenzephalographie ( ➔ EEG). EEG Elektroenzephalogramm: das Aufzeichnen und Auswerten des Hirnstrombildes. SEITE 53 EKG ICD-10 Elektrokardiogramm: diagnostisches Verfahren Das ICD-10 ist das internationale Klassifikations- zum Aufzeichnen der Herzmuskelströme. system für psychische Erkrankungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Elterntraining Es unterscheidet zwei Kategorien: Übungen für Eltern, mit denen sie lernen • die einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeits- können, auf bestimmte Verhaltensweisen ihres Kindes angemessen zu reagieren. störung, • die hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (Hyperaktivität in Kombination mit Fakultativ Der eigenen Entscheidung bzw. der Entscheidung des Arztes überlassen. Nur in bestimmten Fällen notwendig. Familienzentrierte Therapie Form der Psychotherapie, bei der die Familie als Ganzes in die Behandlung mit einbezogen wird. Dies bringt oft größere Behandlungserfolge als sozialem Fehlverhalten). Das ICD-10 ist in Deutschland das maßgebende System zur Klassifizierung der ADS | ADHSSymptomatik. Impulsives Verhalten, Impulsivität Spontanes plötzliches Ausführen von Handlungen, ohne zu überlegen und /oder die Folgen zu bedenken. die Alleintherapie des Patienten. Intervention Genetische Differentialdiagnostik Vorgehen zum Nachweis und zur Feststellung von genetisch bedingten Krankheiten bzw. zum Geplante und gezielt eingesetzte Maßnahmen, um Störungen vorzubeugen, zu beheben oder deren negative Folgen einzudämmen. Nachweis einer vererbten Anfälligkeit für eine Krankheit. Kindzentrierte Verfahren Behandlungen, die sich vornehmlich mit dem Hyperaktivität Kind beschäftigen. (von griechisch hyper = über, hoch) Übersteigerter Bewegungsdrang, Unrast, Komorbiditäten Unruhe. Begleiterkrankungen, die neben der ADS | ADHS auftreten und gesondert diagnostiziert und be- Hyperkinetisches Syndrom handelt werden müssen. Anderer Begriff für das Krankheitsbild ADS | ADHS. Leitsymptome Zentrale Symptome ( ➔ Symptome). Hypoaktivität (von griechisch hypo = unter, unterhalb) Verminderter Bewegungsdrang. SEITE 54 Lese-Rechtschreibschwäche/Rechenschwäche Teilleistungsstörungen, bei denen durch spezifische und umschriebene Störungen in bestimmten Hirnbereichen die Lese- und/oder Rechtschreibleistungen des betroffenen Kindes beeinträchtigt sind bzw. eine spezifische Rechenschwäche vorliegt. Beide Störungen gehen in der Regel mit normaler Intelligenz einher. Motorik Gesamtheit der vom Zentralnervensystem gesteuerten aktiven Bewegungen. Die Motorik beinhaltet die Einzelbewegung, das Zusammenspiel aller Bewegungsabläufe sowie die Feinabstimmung der Bewegungen. Störungen der Motorik können sowohl durch eine Erkrankung der Muskulatur, der Bänder und Gelenke ausgelöst werden als auch auf einer Störung des Nervensystems beruhen. Motorische Teilleistungsstörungen Spezifische Beeinträchtigungen in der Koordination der Bewegungsabläufe. Dies äußert sich z. B. bei Kindern darin, dass sie schlecht Bälle fangen oder den Hampelmannsprung nicht ausführen können. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Syndrom des „ungeschickten Kindes“. Multimodaler Therapieansatz Behandlung, die sich aus einer jeweils individuellen Kombination unterschiedlicher Therapien bzw. Therapieanteilen zusammensetzt. Der multimodale Therapieansatz bei ADS/ADHS umfasst die Eltern-Kind-Beratung, psychotherapeutische Maßnahmen (z. B. ➔ Verhaltenstherapie) und gegebenenfalls eine medikamentöse Therapie. Neurologische Untersuchung Analyse und Registrierung von Ausfällen der Funktionen und Leistungen des Nervensystems. Neurologisch-motoskopische Untersuchung Neurologische Untersuchung eines Kindes mit zusätzlicher spezifischer Untersuchung der Bewegungsabläufe. Noradrenalin Botenstoff des Gehirns. Noradrenalin spielt eine wichtige Rolle bei der Reizweiterleitung in den ➔ Synapsen. SEITE 55 Obligat In jedem Fall notwendig. Pädaudiologie Fachrichtung der Medizin, die sich mit der Diagnostik und Behandlung kindlicher Hörstörungen befasst. Pädophthalmologie Fachrichtung der Medizin, die sich mit der Diagnostik und Behandlung kindlicher Sehstörungen befasst. Pharmakotherapie Therapie mit Medikamenten. Phoniatrie Fachrichtung der Medizin, die sich mit der Diagnostik und Behandlung der Stimm- und Sprechstörungen befasst. Projektive Testung Testpsychologische Untersuchung, die sich die Eigenschaft von Menschen zu Nutze macht, z. B. in einem gemalten Bild unbewusste Prozesse auszudrücken oder aber in mehrdeutigen Abbildungen die Dinge zu sehen, die für den jeweiligen Menschen von besonderer Bedeutung sind. Psychodiagnostik Mit Hilfe von Verhaltensbeobachtung, Testverfahren oder Befragung werden Eigenschaften systematisch erfasst, die eine Vorhersage oder Erklärung von Verhalten zulassen. Psychosoziale Faktoren Faktoren der Umwelt (Familie, Schule, Beruf, Umfeld). SEITE 56 Psychostimulanzien Syndrom des ungeschickten Kindes Auch: Psychopharmaka. Substanzen, die über Siehe ➔ motorische Teilleistungsstörungen. eine direkte Beeinflussung des Zentralnervensystems Erleben und Verhalten des Patienten verändern. Medikamente, die vor allem den Antrieb steigern und psychisch anregend wirken. Teilfunktionen, Teilleistungen Gedächtnis, Wahrnehmung, Feinmotorik, Koordination. Die Verordnung dieser Medikamente unterliegt in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz. Teilleistungsstörungen Stirnhirn Großhirnlappen mit Zentren für willkürliche Bewegungen sowie Kontrolle und Koordination vegetativer, affektiver und geistiger Funktionen. Symptome Zeichen, die auf ein bestimmtes Krankheitsbild hindeuten. Störungen, die das Gedächtnis, die Wahrnehmung, die Feinmotorik oder die Koordination betreffen. In Zusammenhang mit ADS | ADHS sind das vor allem die Lese-Rechtschreibschwäche und die Rechenschwäche. Tic-Störungen Unwillkürliche Zuckung eines oder mehrerer – meistens – Gesichtsmuskel, die sich unter Anspannung verstärkt. Synaptischer Spalt, Synapse Als Synapse bezeichnet man die Kontaktstelle zwischen zwei Nervenzellen. Sie ist die Umschaltstelle zur Übertragung von Erregungen Übende Verfahren Hierbei trainieren die Kinder, wie sie andere Verhaltensweisen erlernen können. von einer Nervenzelle auf die andere bzw. auf das jeweilige Organ (z. B. auf den Muskel). Die Erregungsübertragung erfolgt auf chemischem Weg über die Neurotransmitter. Die Synapse besteht aus 2 Teilen, die durch den synaptischen Spalt getrennt sind. SEITE 57 Verhaltenstherapie Psychotherapeutisches Verfahren zur Behandlung von seelischen Störungen, bei dem störende Verhaltensweisen abgebaut und dafür neue erlernt werden. Der Betroffene soll seine Störung gewissermaßen verlernen und stattdessen bestimmte Bewältigungsstrategien erlernen, um sein Leben zu meistern. Eine Form der Verhaltenstherapie ist die operante Konditionierung. Hier werden erwünschte Verhaltensweisen systematisch belohnt. Diese Methode kommt auch bei der Behandlung der ADS | ADHS zum Einsatz. Videogestützte Diagnostik Diagnostik unter Zuhilfenahme von Videoaufnahmen der betroffenen Kinder und ihrer Familien. Vulnerabilität Verletzlichkeit, Empfänglichkeit. Bezeichnung für eine individuelle Empfänglichkeit, auf Belastungen überdurchschnittlich stark zu reagieren. Diese Verletzlichkeit kann durch genetische, organische, biochemische, psychische und soziale Faktoren bedingt sein. Zentralmotorische Koordinationsstörungen Siehe ➔ motorische Teilleistungsstörungen. SEITE 58 Impressum Text: Hamburger Arbeitskreis ADS | ADHS Postfach 65 22 40, 22373 Hamburg Konzeption: Gianni & Meissner PR GmbH, Frankfurt Gestaltung: Polarlicht Mediengestaltung GmbH, Wiesbaden SEITE 60 Lilly Deutschland GmbH, Bad Homburg PM 470490 mit freundlicher Unterstützung von Christian-Gotthilf-Salzmann-Schule Schule zur Erziehungshilfe Motto Salzmann-Schule Der Förderschwerpunkt „emotionale und soziale Entwicklung“ umfasst Gefühls- und Verhaltensstörungen Begriffsfassung (nach amerikanischen CCBD) entnommen Opp, Arbeitsbuch schulische Erziehungshilfe 2003, S. 54 Beeinträchtigungen, die als emotionale Reaktionen und Verhalten wahrgenommen werden und sich von altersangemessenen, kulturellen oder ethischen Normen so weit unterscheiden, dass sie auf die Erziehungserfolge (schulische Leistungen, soziale, berufsqualifizierende und persönliche Fähigkeiten) der SchülerInnen einen negativen Einfluss haben Salzmann-Schule Gefühls- und Verhaltensstörungen mehr als eine zeitlich begrenzte, erwartbare Reaktion auf Stresseinflüsse im Lebensumfeld tritt über einen längeren Zeitraum in mindestens zwei verschiedenen Verhaltensbereichen auf, wobei mindestens einer schulbezogen ist und durch direkte Intervention im Rahmen allgemeiner Erziehungsmaßnahmen nicht aufhebbar (da diese bereits erfolglos waren) Gefühls- und Verhaltensstörungen können im Zusammenhang mit weiteren Behinderungen (schizophrenen, psychosomatischen o. Angst-Störungen o.a.) auftreten, wenn diese den Erziehungserfolg dauerhaft negativ beeinflussen) Salzmann-Schule Ziele selbstbewusste und selbstständige Persönlichkeiten Stärkung sozialer Kompetenzen Rückführung in die Grund- oder Sekundarschulen Erfolgreiche Berufsorientierung Hauptschulabschluss Erweiterter Hauptschulabschluss Salzmann-Schule personelle Bedingungen 87 Schüler und 12 Schülerinnen 20 LehrerInnen, davon 15 mit Ausbildung Förderschule Zusatzqualifikation: 1 Sprachheilpädagogin 1 Lerntherapeut für Dyskalkulie 1 Sportförderlehrerin Salzmann-Schule personelle Bedingungen 9 pädagogische MitarbeiterInnen davon 1 mit Montessori Diplom 3 LehramtsanwärterInnen 1 Schulsozialarbeiterin Qualifikation Diplompädagogin 1 Sekretärin 2 Hausmeister Salzmann-Schule räumliche Bedingungen Schulleitung als ein Kommunikationszentrum je Lerngruppe 1 Klassenraum und 1 Förderraum moderne Fachkabinette Lernwerkstatt und Hausaufgabenzimmer, Bibliothek Entspannungsraum Raum für therapeutische Angebote Freizeitbereich für Fahrschüler Salzmann-Schule Kernelemente unserer (förder-)pädagogischen Arbeit Salzmann-Schule Kernelemente unserer (förder-)pädagogischen Arbeit Schule als fürsorgliche Gemeinschaft 2-Pädagogen-System projekt- und praxisbezogene Unterrichtsformen jahrgangsübergreifende Lerngruppen (Klassenstufen 7 – 9) als Teams time-out-Angebote professionsübergreifende Arbeit mit individuellen Förderplänen temporäre Sonderstundenpläne für einzelne SchülerInnen Salzmann-Schule Kernelemente unserer (förder-)pädagogischen Arbeit regelmäßiges Methodentraining frühzeitige Berufsorientierung schuleinheitliches Regel- und Tokensystem tiergestützte Pädagogik Vernetzung mit therapeutischen Angeboten Elternarbeit langjährige Etablierung bedarfsorientierter Schulsozialarbeit Grafik GS und Salzmann-Schule SEK Kernelemente unserer pädagogischen Arbeit Grafik SK GS Salzmann-Schule Kernelemente unserer pädagogischen Arbeit Grafik Wochenplan GRAFIK WOCHENSTUNDEN Salzmann-Schule Techniken des Eingreifens im Unterricht Bewusstes Ignorieren Eingriff durch Signale Eingreifen/Beruhigen durch körperliche Nähe und Berührung Engagement in einer „Interessengemeinschaft“ Affektive Zuwendung Spannungsentschärfung durch Humor Hilfestellung zur Überwindung von Hindernissen Salzmann-Schule Techniken des Eingreifens im Unterricht Bewusster Blickkontakt Positive Verstärkung /Tokensystem zeitnahes Feedback Anspornen Nachfragen bei schwierigen Aufgaben Rückmeldung im Pendel-/Hausaufgabenheft Vermeidung von Überforderung durch Differenzierung Salzmann-Schule Techniken des Eingreifens im Unterricht Deutung als Eingriff Umgruppierung Umstrukturierung Direkter Appell Einschränkung der räumlichen Bewegungsfreiheit und der Verfügbarkeit von Gegenständen Antiseptischer Hinauswurf (o. situative Entfernung) Physisches Eingreifen Salzmann-Schule Techniken des Eingreifens im Unterricht Erlaubnis autoritatives Verbot Versprechen Belohnung Bestrafung, Ankündigung Konsequenzen Spiegelung Verstärkung holen (lassen) Salzmann-Schule UnterstützerInnen - Netzwerk Erlaubnis autoritatives Verbot Versprechen Belohnung Bestrafung Drohungen Verstärkung holen (lassen) Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.